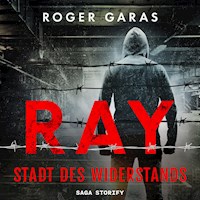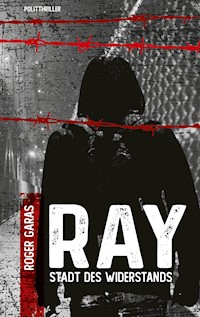
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Deutschland in naher Zukunft: Die regierende Partei ´Heimatfront Deutschland´ deportiert alle Migranten und politische Gegner in eine Hand voll hermetisch abgeriegelter sogenannter Flüchtlingsstädte. Elsa Jacobi, die charismatische Führerin der ´HfD´, herrscht mit eiserner Hand über die Republik und kontrolliert Medien und Staatsorgane mit Gewalt und Terror. Wie Marionetten manipuliert sie die Menschen um sich herum für ihre Zwecke. So auch den jungen Politstar Hassan, der getrieben vom Hass auf seine türkischen Wurzeln nach Anerkennung und Macht strebt. Auf der Suche nach seinem spurlos verschwundenen Freund, dem Hacker und Regimegegner Ari, gerät Durchschnittsbürger Finn ins Visier der ´HfD´ und muss in einer Flüchtlingsstadt untertauchen. Während er dort ums Überleben kämpft, holt ihn die gemeinsame Vergangenheit mit Elsa Jacobi ein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 635
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
TEIL I
EINS
RÜCKBLICK – ARI & FINN
ZWEI
DREI
VIER
RÜCKBLICK - HASSAN
FÜNF
TEIL II
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEH N
RÜCKBLICK - ELSA
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
TEIL III
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
EPILOG
PROLOG
Neues Kanzleramt Berlin, 5. Januar
Seine Hand hinterließ einen feuchten Abdruck auf der Glasfläche des Scanners. Schweiß tropfte von Schneyers dünnen Augenbrauen auf die Innenseite der Brillengläser, während er seine zitternden Finger ansah, und sein Magen zog sich noch ein Stück weiter zusammen. Aber die Lampe über ihm leuchtete grün auf und der Sicherheitsmann mit der Beretta im Holster nickte ihm mit ernster Miene zu. Das rote Barett wippte herunter und wieder hoch.
Schnell wischte sich Schneyer die Brille an seinem karierten Hemd ab und strich sich eine lange, dunkle Strähne hinters Ohr zu den anderen Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren. Mit einem Quantum an Erleichterung ging er durch den Metalldetektor.
Das kreischende ›Beeeeep‹ ließ ihn augenblicklich wieder zusammenfahren.
Der zweite Sicherheitsmann hob ihm die flache Hand vors Gesicht. »Halt! Nochmal zurück!«
Schneyer ging rückwärts durch das graue Tor im Keller des Neuen Kanzleramtes. Er kam sich vor, als würde er dabei von zwei hungrigen Hyänen beäugt. Mit zitternder Hand kramte er den Autoschlüssel aus seiner Jackentasche und legte ihn in die dafür vorgesehen Plastikschale. »Tut … tut mir leid.«
»Jaja, Sie brillantes Computer-Genie! Sie wissen ja nicht mal, wie das Ding hier funktioniert!«, meckerte einer der Wachmänner. Mit seinen schiefen Zähnen und roten Haaren sah er aus wie ein schottischer Teenager.
Sein kurz geschorener Kollege stimmte in das Gelächter mit ein. Die beiden hatten sichtlich Spaß daran, den großen und dünnen Nerd Doktor Eduard Schneyer aufzuziehen. Den Soldaten war jegliche Abwechslung willkommen. Kein Wunder, waren sie doch für die Sicherheitskontrolle des Abschirmdienstes hier im Keller des Neuen Kanzleramts zuständig, eine Tätigkeit, die wenig Abwechslung und viel Langeweile mit sich brachte. Die Sicherheitskontrolle im Keller kam erst nach der Kontrolle, die beim Eintritt ins Innere des Neuen Kanzleramts vorgenommen wurde, und diese wiederum kam erst nach der ersten Kontrolle beim Betreten des weiträumig abgesperrten Geländes um das ohnehin schon riesige Gebäude. Die neue Regierung hatte diesen Prachtbau direkt nach Kanzlerin Elsa Jacobis Amtsantritt erbauen lassen und er stand sinnbildlich für ihren Machtanspruch und den Kontrollwahn, mit dem sie die Bundesrepublik seither regierte. Sehr wahrscheinlich gab es weltweit kein Gebäude, das besser bewacht wurde.
Hier passierte schlichtweg nie etwas. Die Beschäftigung der jungen Gefreiten bestand viel mehr darin, sich denselben Witz zum fünfzigsten Mal zu erzählen oder über das Hinterteil jeder einzelnen Angestellten ausgiebig zu fachsimpeln.
»Sofort Haltung annehmen!«, raunzte der Hauptmann der Sicherheitsmänner im Näherkommen.
Die beiden Uniformierten erstarrten sofort. Weder sie noch Schneyer hatten ihn zuvor bemerkt. Der Hauptmann trat so dicht vor den schottischen Teenager, dass ihn seine Nasenspitze fast berührte. Bohrend starrte er seinen Untergeben einige Sekunden an.
Schließlich drehte er sich zu Schneyer um. Er war um einiges größer als seine beiden Soldaten. Sein Barett steckte in der Schlaufe über der breiten Schulter. »Doktor Schneyer, kein Grund, sich zu entschuldigen!« Er schleimte. »Das macht doch nichts. Mit Verlaub: Sie sehen nicht gut aus. Sind Sie vielleicht krank?« Mit gespielter Besorgnis legte er den Kopf auf die Seite. »Da kann man seinen Schlüssel in der Tasche schon mal vergessen.«
Schneyer sah wirklich nicht gut aus. Es klebten noch mehr dünne Strähnen in seinem Gesicht und er war schweißgebadet, aber das hatte andere Gründe.
»Ein wenig«, log er. »Aber es geht schon. Danke der Nachfrage.« Er verschränkte die Arme, als ob er fröstelte. So waren seine zitternden Hände nicht zu sehen.
»Sie sollten sich krankmelden, Doktor. Andererseits, wer fängt dann das ganze Hacker- und Gutmenschen-Pack ein, nicht wahr? Ha!?« Der Mann klopfte ihm brutal auf die schmale Schulter.
Schneyer nickte, so freundlich es ging, und drehte sich um. Mit großer Anstrengung zügelte er den Drang, zu rennen. Im Weggehen hörte er, wie der Hauptmann einen der Wachmänner zusammenfaltete.
»Wer hat Ihnen denn ins Gehirn geschissen, Junge?! Das ist Doktor Eduard Schneyer! Der hat noch jeden gekriegt. Wenn er will, weiß morgen ganz Deutschland, zu welchem Porno Sie sich gestern einen von der Palme gewedelt haben, Soldat!«
Schneyer wusste um seinen Ruf. Im Auftrag der Kanzlerin hatte er unzählige Computer gehackt, Regimegegner aufgestöbert, flüchtige Widerständler gejagt, alle im Darknet oder auf ähnlichen Plattformen. Immer waren es Menschen gewesen, die Elsa Jacobis Partei Heimatfront Deutschland, kurz HfD, öffentlich oder im Verborgenen angegriffen hatten. Die Tiefen des Internets waren der einzige Ort, den die HfD nicht endgültig unter Kontrolle bekam, was diese Abgründe zur letzten Bastion des Widerstands machte.
Und genau deshalb brauchte die Kanzlerin Menschen wie Schneyer und seine Kollegen im sogenannten Abschirmdienst, der nichts anderes war als eine moderne Gestapo.
»Guten Morgen, Doktor.« Ein deutlich älterer Kollege begrüßte Schneyer ehrfurchtsvoll, als er ihm auf dem Flur zwischen den Glaskästen entgegenkam.
»Hm«, brummte er nur und verbarg damit ein mögliches Zittern in seiner Stimme.
Sein Blick schweifte durch den dunklen, mit hohen Glaswänden durchzogenen Raum. Alle nannten die Abteilung scherzhaft IT-Keller, weil fast jeder hier ein Genie oder zumindest ein absoluter Fachmann auf dem Gebiet der Informationstechnik war. Viele von ihnen nickten Schneyer anerkennend zu, als sein Blick sie traf. Er war mit Abstand der Beste von allen. Das war ihm selbst genauso bewusst wie allen Kollegen im IT-Keller und sogar vielen über dessen Grenzen hinaus. Auch wenn außerhalb des Abschirmdienstes fast niemand so wirklich wusste, was dort eigentlich vor sich ging, genoss Schneyer ein hohes Ansehen im ganzen Kanzleramt.
Eine der wenigen Frauen im IT-Keller kreuzte seinen Weg, als er um die Ecke einer der eingeglasten Arbeitsinseln bog. »Oh, hallo, Doktor Schneyer!«
Damals an der Uni hatte kaum jemand seinen Namen gekannt, Frauen schon gar nicht und erst recht keine hübschen. Das hatte sich hier schnell geändert und hatte Schneyer, noch viel mehr als sein üppiges Gehalt, dabei geholfen zu verdrängen, welchem finalen Zweck seine Arbeit eigentlich diente. Schneyer fand Identitäten von Hackern heraus, lokalisierte sie und gab dann die gesammelten Informationen weiter. Was danach geschah, hatte ihn nie interessiert, und die Frage nach dem Schicksal dieser Menschen hatte er stets einfach ausgeblendet. Er hatte die Augen davor verschlossen, wie er es als Kind bei Horrorfilmen getan hatte, wenn das Monster ins Bild gekommen war.
Nur ein einziger Moment hatte dann ausgereicht, um Schneyers heile Welt in die Hölle auf Erden zu verwandeln. Eine Grippewelle hatte dafür gesorgt, dass Schneyer selbst und nicht der dafür vorgesehene Kollege bei einer Verhaftung die Luftunterstützung durch das Steuern einer Drohne leisten musste. Kommandokräfte der Regierung hatten das Haus eines Hackers gestürmt, dessen Standort Schneyer zuvor ermittelt hatte. Seinen Fluchtversuch hatte der Hacker umgehend mit dem Leben bezahlt, als das Kommandoteam ihn erschossen hatte.
Schneyer hatte alles live miterlebt. Als hätte ihm jemand die Augenlider an die Stirn getackert, hatte er das Monster ansehen müssen - und seine Welt war aus den Fugen geraten. All diese Menschen, die er aufgestöbert hatte, wo waren die? Waren die vor Gericht gestellt worden? Hatten sie einen fairen Prozess bekommen? Nein! Du hast sie alle getötet, Schneyer. Alle!
Seitdem spielten sein hohes Ansehen und sein üppiges Gehalt für ihn keine Rolle mehr. Schneyer hatte nur noch eines im Sinn: seine Verbrechen irgendwie wiedergutzumachen, von hier zu verschwinden und sich dem Widerstand anzuschließen, den er bisher so vehement bekämpft hatte.
Heute, an seinem letzten Tag im IT-Keller, gab sich Schneyer so normal, wie er nur konnte. Er setzte sich in einem der Glaskästen an seinen Platz, der von dem schwachen Licht im Keller beleuchtet wurde. Die schwarzen Wände und Möbel im Keller taten ihr Übriges, um für eine düstere Atmosphäre zu sorgen.
»Guten Morgen zusammen«, begrüßte er die anderen.
Wie immer kam von ihnen nicht mehr zurück als das leise Klappern der Tasten. Die sieben Kollegen, mit denen er sich den Glaskasten teilte, hatten die Ehrfurcht vor ihm schon lange abgelegt und waren in die Arbeit vertieft. Erleichtert darüber, keine Aufmerksamkeit erregt zu haben, tat Schneyer es ihnen gleich.
»Brauer hat nach dir gefragt, Eddy«, tönte es nach einer Weile hinter der Trennwand neben ihm hervor. »Es kann nichts Gutes bedeuten, wenn sich der Chef nach einem erkundigt.«
»Hat er das?« Schneyer würde das ignorieren. »Ich gehe nachher zu ihm.« Würde er nicht. Nichts war ihm egaler als seine Karriere im Abschirmdienst. Seit Tagen hackte er sich nun schon durch den HfD-Server und sammelte Aufzeichnungen und Dokumente, mit denen er die Regierung ans Messer liefern konnte. Täglich fand er mehr. Das Monster war noch viel grässlicher, als er es sich in seinen schlimmsten Albträumen hätte ausmalen können.
Schwierig und vor allem gefährlich würde es werden, die Daten dem Widerstand zugänglich zu machen. Er konnte schließlich nicht einfach mit einem USB-Stick durch die Sicherheitskontrollen spazieren oder sie einfach per Mail versenden, zumindest nicht, ohne sich selbst und den Empfänger damit zu verraten. Schneyer würde eine winzige Lücke in das Sicherheitssystem programmieren, das er selbst mitentwickelt hatte, um dann später von einem versteckten Ort aus zugreifen und sofort fliehen zu können. Für den Fall, dass der Zugriff entdeckt und geortet wurde.
Das Problem war nur, von außen an diese Lücke zu kommen – lebend. Man würde ihn bis ans Ende der Welt verfolgen.
Eines Nachts, als er wieder einmal auf dem Dach seines Hauses gesessen und mit dem Gedanken an Selbstmord gespielt hatte, war ihm aber die Idee gekommen: Du wirst nicht lebend davonkommen.
Nicht lebend? Das war es. So konnte er es schaffen: Nicht als lebender, sondern als toter Mann.
»Herr Schneyer, wie ist das werte Befinden heute?« Brauer.
Er erschrak. Sein Vorgesetzter Brauer hatte leise die Tür des Glaskastens geöffnet und sich hinter ihn geschlichen. »Dieser Störenfried – wie nennt er sich noch gleich?«
»Äh …« Schneyer riss sich zusammen, aber seine Stimme zitterte. »Meinen Sie diesen Taqif Shanonen?«
»Genau der, wie auch immer man das richtig ausspricht. Der führt Sie schon seit einigen Tagen an der Nase herum, nicht wahr?«
Schneyer nickte verstohlen. Diesen Hacker verfolgte er seit fast einer Woche.
Brauers graue Augen wurden schmaler. »Was stimmt nicht mit Ihnen? Das passt so gar nicht!«
Schneyer drückte eine Tastenkombination. »Ich habe seinen Standort auf etwa zwanzig Kilometer genau eingrenzen können. Den Rest bekomme ich auch noch hin. Den Zwischenbericht habe ich gerade an Sie gesendet, Herr Brauer«, sagte er mit einem unterwürfigen Ton. »Im Südwesten, nicht weit von der Flüchtlingsstadt dort.«
In Wahrheit hatte er die genaue Adresse bereits seit drei Tagen. Er würde irgendwie Kontakt zu diesem Hacker aufnehmen, sobald er hier draußen war. Taqif Shanonen schien ziemlich clever zu sein. Zumindest hatten sich vor Schneyer alle von Brauers Männern die Zähne an ihm ausgebissen. Um keinen Verdacht aufkommen zu lassen, musste er seinem Chef aber irgendetwas liefern.
Brauer sah ihn mit einem arroganten Grinsen an. »Na geht doch! Ich überprüfe das. Aber danach müssen wir uns mal unterhalten, verstanden?!« Er fuhr sich über die blonden, nach hinten gegelten Haare. Ein kläglicher Versuch, lässig zu wirken, da half auch der legere Designeranzug nichts. »Ich warte in meinem Büro auf Sie.« Daraufhin ging er zur Glastür.
Schneyer nutzte die Gelegenheit. Sein Vorgesetzter würde mindestens dreißig Sekunden bis zu seinem Computer brauchen, von wo er auf alle anderen Bildschirme zugreifen konnte, um zu sehen, was dort gerade passierte. Wie geplant öffnete Schneyer in Windeseile die Lücke und verwischte die Spuren. Er brauchte dafür keine dreißig Sekunden, nicht mal zehn, ließ sich dann nach hinten in den Bürostuhl fallen und drehte sich in Richtung Glastür.
Er erstarrte. Brauer stand noch in der Tür. Er hielt sein Smartphone in der Hand und tippte darauf herum. Ohne aufzusehen, sagte er zu Schneyer: »Sie machen mir langsam Sorgen, Mann.«
Brauer war der Einzige, der ihn nie mit seinem Doktortitel ansprach. Schneyer hatte das Gefühl, Brauer fühle sich von ihm in seiner Position als Vorgesetzter bedroht, weil Schneyer unbestritten eine Koryphäe auf seinem Gebiet war.
»Sie wissen, ich kann Sie nicht einfach gehen lassen, oder?«
Er hat was bemerkt. Das war's. Jetzt bin ich dran!
»Sie brauchen professionelle Hilfe. Nicht jeder kommt mit diesem Druck klar. Sie sind vielleicht clever, Schneyer, aber nicht hart genug für diesen Job.«
Schneyer verstand sofort. Brauer hatte tatsächlich etwas bemerkt, aber nicht etwa die Sicherheitslücke oder das Herumstöbern. Trotz aller Anstrengung hatte er vor seinem Vorgesetzten nicht verbergen können, dass ihn der Tod des jungen Hackers, den er über die Drohne beobachtet hatte, schwer belastete, und Brauer, dieses Schwein, roch eine menschliche Schwäche noch eine Meile gegen den Wind, vor allem, wenn ihm das einen Vorteil verschaffen konnte. Das war für ihn die Chance, sich einen aufstrebenden jungen Kollegen vom Hals zu halten.
»Ich denke, Sie haben recht, Herr Brauer.« Er gab sich so unterwürfig wie möglich.
»Natürlich habe ich recht!«
»Ich hatte ohnehin in Betracht gezogen, mich krankzumelden. Hätten Sie die Freundlichkeit, mich beim Abteilungspsychologen anzumelden?«
»Denken Sie, ich habe nichts Besseres zu tun!?«, wurde er angefahren. »Das machen Sie schön selbst.«
»Natürlich, Herr Brauer. Es tut mir leid, ich dachte nur …«
»Denken scheint im Moment ja nicht Ihre Stärke zu sein. Gehen Sie nach Hause! So können wir Sie hier nicht gebrauchen.«
Schneyer senkte den Kopf und sackte in sich zusammen. Er bemerkte, wie die Kollegen vorsichtig hinter ihren Trennwänden hervorlugten, und spürte regelrecht ihre mitleidigen Blicke auf der Haut. Innerlich verbuchte er einen Etappensieg. Es hätte nicht besser laufen können.
Auf seinem Weg zwischen den Glaskästen hindurch folgten ihm - dem großen Doktor Eduard Schneyer - viele Augenpaare. Er verzog sein Gesicht, um möglichst deprimiert und angeschlagen auszusehen. Wenn er ehrlich zu sich war, fiel ihm das auch nicht schwer. Das einzige Mal im Leben, dass Menschen zu ihm aufgesehen hatten, seinen Ruf, den er sich hier aufgebaut hatte, und so etwas wie Freunde: Das alles würde er für immer hinter sich lassen, sobald er hier draußen war.
Der Abschiedsbrief an seine Mutter in Hamburg, zu der Schneyer den Kontakt schon vor langer Zeit abgebrochen hatte, lag offen auf dem Küchentisch in seiner Wohnung. Man würde ihn sofort finden. Darin war zu lesen, dass er dem ganzen Druck nicht mehr habe standhalten können und alledem entfliehen wolle. Passend dazu waren im Mülleimer ein paar leere Packungen Antidepressiva zu finden.
Er fuhr nochmal nach Hause, um dort das neue Smartphone zu holen, das er nicht im Auto hatte lassen wollen. Er wusste, dass die Fahrzeuge der Angestellten von Zeit zu Zeit durchsucht wurden. Außerdem sollte es so aussehen, als sei seine Entscheidung spontan gefallen, und die Uhrzeit musste in etwa passen.
Abends machte er sich dann auf den Weg nach Hamburg, wo die perfekten Bedingungen für die Ausführung seines Plans vorhanden waren. Kurz vor seinem Ziel fuhr er absichtlich zu schnell und wurde geblitzt. Man würde seinen Wagen bald finden. Schneyer fuhr an die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen und stellte ihn dort in der Nähe unverschlossen ab. Dann ging er zu Fuß etwa einen Kilometer bis zu der Stelle, an der er schon eine Woche zuvor mit dem Handy und einem Stativ das Video gemacht hatte: Etwas, das aussah wie ein Mensch, stürzte die gut fünfzig Meter von der Brücke hinab und schlug heftig auf die Wasseroberfläche auf. Die Qualität des Videos war nicht besonders gut und es war nicht zu erkennen, dass es sich bei diesem Etwas um zusammengenähte, mit Reis gefüllte Säcke handelte, die bei dem Aufschlag aufs Wasser sofort geplatzt waren. Das Video hatte er im Nachhinein entsprechend bearbeitet. Was man allerdings sehen konnte, war Schneyers markante rote Jacke, die er oft getragen hatte.
Die Wolkendecke war heute genauso dicht wie vor einer Woche, als er das Video gedreht hatte. Die Lichter vom Hafen, die das Video überhaupt erst möglich gemacht hatten, strahlten auch jetzt wieder grell. Schneyer schaute sich die Sequenz noch einmal an und war mit seinem Werk zufrieden.
Dann machte er sich auf den Weg. Er zog die Mütze tief ins Gesicht und den Schal weit über den Hals. Nur der falsche Schnurrbart und die neue Brille ohne Gläser waren noch zu sehen. Die langen Haare hatte er sich abgeschnitten, er trug Handschuhe und Kontaktlinsen. Erst nachdem er etwa eine Stunde zu Fuß gegangen war, nahm er die U-Bahn zum Hauptbahnhof. Dort angekommen kaufte er sich am Automaten ein ICE-Ticket und lud das Video anonym ins Internet hoch. In Windeseile würde es sich über die Medien verbreiten. Er schätzte, dass er in höchstens einer Woche für tot erklärt werden würde. Ein Doktor Eduard Schneyer existierte dann nicht mehr.
Das Handy schmiss er in einen Mülleimer, die SIM-Karte und den Akku in einen anderen. Für das, was er vorhatte, brauchte er nur den gefälschten rumänischen Ausweis. Er verließ Hamburg mit dem Zug in Richtung Süden.
TEIL I
EINS
Vor Aris Wohnung, 10. April
Die Pizza surrte über Finn hinweg. Er sog den Duft von Käse und Salami genüsslich ein. Dass diese Geruchswahrnehmung nur Einbildung sein konnte, störte ihn dabei nicht und das Wasser lief ihm im Mund zusammen. Die letzten fünfzehn Meter legte er im Laufschritt zurück. Bestellt hatte er schon vor einer Stunde von zu Hause aus. Bequem, wie er war, hatte er das von Alexa erledigen lassen. Wie fast alle Deutschen besaß auch Finn das Gerät, das sein Leben so schön unkompliziert machte und dafür nicht mehr als den Verzicht auf ein Stück Datensicherheit verlangte.
Lieferadresse war die Ecke Blumenstraße-Rosenstraße, ein gutes Stück von Aris Wohnung entfernt, damit dieser nicht merkte, dass sein Abendessen per Drohne geliefert wurde. In diesem Fall würde er die Pizza aus Prinzip nicht essen und sie stattdessen samt der von Finn wie ein Frisbee aus dem Fenster werfen, am besten so, dass möglichst viele Nachbarn es mitbekamen, was ihm eine hinreichend große Bühne für sein Statement zum Thema Drohnen und Datenschutz bieten würde.
»Keine Angst, Süße! Das mit uns beiden findet der Freak nie raus«, sagte Finn zu der Drohne und legte seinen Daumen auf den Scanner, den sie ihm am vereinbarten Ort wie zum Handschlag entgegenstreckte. Einäugig starrte sie ihn an. Das Objektiv glich Finns Gesicht zusätzlich mit einer Datenbank ab. Schmale Züge, Dreitagebart, braune Haare: Es passte.
»Zahlung bestätigt. Danke, Finn. Nimm deine Ware bitte aus der Box«, forderte ihn die Drohne mit einer angenehmen weiblichen Stimme auf.
Die Klappe an der schwarzen Box, die die Drohne transportierte, sprang auf. Jetzt kam ihm der echte Geruch von Salami, Käse, Oregano und Tomaten entgegen und um ein Haar hätte Finn angefangen, zu sabbern. Er schluckte, nahm die zwei Kartons heraus und klappte die Box wieder zu.
»Grazie mille!« Zum Abschied warf Finn der Drohne einen Kuss zu. Zwei Minuten später klingelte er an der Tür des Mehrfamilienhauses, in dem sich Aris Wohnung befand.
»Wer stört?«, blaffte es aus der Sprechanlage und der Lichtkringel um die Kamera leuchtete auf.
»Ich bin’s.« Finn hielt den geöffneten Karton in die Kamera. »Und ich hab die Ware dabei.«
»Zeig mir dein hässliches Affengesicht!«
Langsam klappte Finn den Karton wieder zu und schaute ernst in die Kamera, hob dann zwei Finger, zu einem V gespreizt, vor die Linse. Er wartete kurz, streckte seine Zunge durch das V und ließ sie ein paarmal auf und ab springen. Dann grinste er breit. »Mach auf, du Idiot!«
Zur Antwort summte nur der Öffner und die Tür sprang auf.
Auf dem Weg in den vierten Stock dachte Finn darüber nach, wie unreif und kindisch er und Ari doch meistens miteinander sprachen. Es störte ihn nicht, nur war er inzwischen schon Anfang dreißig und er hatte erst als Kind, dann als Teenager, dann an der Uni und spätestens, als er angefangen hatte zu arbeiten, immer damit gerechnet, eines Tages der erwachsene, seriöse Herr Finn Falken zu werden. Aber irgendwie trat das einfach nicht ein. Zeitweise hatte ihn das mit Selbstzweifel erfüllt, weil er davon ausgegangen war, dass die Leute um ihn herum anders gestrickt waren.
Irgendwann hatte er dann aber doch begonnen, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass andere im Inneren vielleicht auch nicht so vollkommen normal waren, wie es nach außen hin schien. Auslöser war ein Meeting bei der Arbeit gewesen, das ihn über alle Maßen langweilte. Um nicht einzuschlafen, fing er an zu zählen, wie oft der Hauptredner, ein Kunde des Architekturbüros, in dem er arbeitete, die Floskel ›Sagen wir mal‹ in den Mund nahm. Es waren ganze 117 Mal in einer Stunde. Finn hatte unter dem Tisch eine Strichliste geführt.
Nach dem Meeting bestellte sein Chef ihn in sein Büro und stellte ihn zur Rede. »Herr Falken, was haben Sie da für eine Liste gemacht?« Er schaute Finn mit ernster Miene an, durchbohrte ihn geradezu mit seinem Blick.
Finn war sich sicher, dass ihn die Hemdknöpfe seines Chefs jeden Augenblick erschießen würden. So sehr spannte sich sein fetter Wanst darunter.
»Ich, äh …« Fieberhaft versuchte er, irgendeine Antwort zu finden, mit der er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen konnte. Der Moment wurde zu einer Ewigkeit, seine Knie weich wie Butter, und mehr Schweiß als an seinen Händen war nur zwischen seinen Pobacken. Er spannte sie aus Furcht so stark an, dass dort Diamanten hätten entstehen können.
»Halt! Lassen Sie mich raten: 118, stimmt’s?« Sein Boss grinste. »Entspannen Sie sich. Wir haben den Zuschlag bereits vor dem Meeting bekommen, wusste der aber nicht.«
Finn war verdutzt, schaltete aber schnell. Die Anspannung in seinen Pobacken fing an, sich zu lösen, wenn auch nur sehr langsam.
»Machen Sie sich locker, Falken! Ich kenn den schon eine halbe Ewigkeit. Der Mann hört sich verdammt gerne reden und der Kunde ist nun mal König. Also habe ich ihn labern lassen. Was soll’s?! Jedenfalls war das Ding von vornherein geritzt. Ihr Entwurf war ziemlich gut. Er wollte ihn sofort haben.« Der Wanst passte sich an die Form des Schreibtisches an, als Finns Chef sich auf ihn lehnte. »Wie lange sind Sie jetzt eigentlich schon bei uns? Ein Jahr? Oder zwei? Drauf geschissen! Jedenfalls lange genug für eine Gehaltserhöhung, oder? Und jetzt will ich eine Zahl hören!«
»Äh, äh … ich weiß nicht.« Finn war komplett überfordert. »Na ja, ich würde sagen, vielleicht zweihundert Euro!?«
»Doch nicht die Gehaltserhöhung!« Der massige Körper plumpste wieder in den Ledersessel. »Ich will wissen, wie oft Sie ›Sagen wir mal‹ gezählt haben.«
»Oh, ach so das.« Finns Pobacken sackten vollends herunter. »Äh, ich glaube, das waren 117. Ja, doch, 117 habe ich mir aufgeschrieben. Die Liste habe ich aber nicht mehr, tut mir leid.«
Der Boss riss die Augen auf. »Gott, so knapp daneben! Gibt’s das?! Das zeigt, wir sind ein gutes Team, oder? Das mit der Gehaltserhöhung muss ich mit der Frau Frank aus der Personalabteilung machen. Die Blonde, Sie wissen schon, die mit den großen ›Augen‹.« Er zog das Wort in die Länge und deutete mit den Fingern Anführungszeichen an.
Zugegeben, Frau Franks ›Augen‹ waren Finn auch schon aufgefallen.
»Ich leg ein gutes Wort für Sie ein, Falken. Gute Arbeit! Und jetzt zurück an den Schreibtisch! Sonst denken Ihre Kollegen noch, Sie versuchen, sich hochzuschlafen, oder?! Ciao.«
Desillusioniert und gefühlt zehn Jahre älter verließ Finn das Büro ohne die Hoffnung auf eine Gehaltserhöhung. Selbst wenn das Versprechen ernst gemeint gewesen war, würde der unvergleichliche Charme seines Chefs sein Übriges bei Frau Frank anrichten und die Möglichkeit auf mehr Geld im Keim ersticken. Da war sich Finn sicher. Nicht mal eine Woche später traf dann ein Brief bei ihm ein, der anstatt einer Rechnung eine Mitteilung über eine Gehaltserhöhung enthielt, die sich sehen lassen konnte.
Seit diesem Erlebnis versuchte Finn, die Menschen um sich herum anders zu sehen, ihnen die Chance zu geben, Spinner zu sein. Zwar konnte er nicht gerade bei vielen Kollegen Anzeichen für ›Scheiße im Hirn‹ entdecken, aber er gab gewissermaßen sein Monopol darauf auf.
Aris Wohnungstür stand schon offen. Finn trat ein und zog sie hinter sich zu. Am Ende des für die kleine Wohnung sehr langen Flurs lag die winzige Küche. Erst danach gelangte man in das verwinkelte Wohnzimmer mit dem kleinen Balkon. Eigentlich bestand die Wohnung fast nur aus Flur und zwei winzigen Zimmern nebst Bad und Küche.
Finn legte die Pizzen in den Backofen, schaltete ihn ein und stellte die Temperatur auf 75 Grad. Ari hatte eigentlich immer irgendetwas zu berichten, wenn sich die beiden längere Zeit oder auch nur ein paar Tage nicht gesehen hatten. Je nach Brisanz oder Aris Begeisterung für das Thema konnte es da schon eine ganze Weile dauern, bis er damit fertig war. Die Tatsache, dass Ari nicht an der Wohnungstür auf Finn gewartete hatte, während aus dem Wohnzimmer gerade der Beginn der Tagesschau zu hören war, bestärkte Finn darin, Vorsicht walten zu lassen und die Pizzen lieber im Ofen warm zu halten. Fünfzehn Minuten plus anschließende kritische Aufarbeitung des Berichteten durch Ari konnten sie entscheidend abkühlen.
»Die News fangen schon an!«, hörte er Ari durch die Wohnung schreien.
Sie zu verpassen, war zu einem absoluten No-Go für ihn geworden, seitdem sich seine Scharmützel mit der örtlichen Polizei zu einem Guerillakrieg gegen das verhasste HfD-Regime entwickelt hatten.
Ari war schon als Kind ständig mit der Polizei aneinandergeraten. Etwa weil er und Finn im Laden Süßigkeiten geklaut oder weil sie zusammen Laternen ausgetreten hatten. Später waren es dann häufiger kleine Marihuana-Delikte gewesen, aber vor allem sein loses Mundwerk hatte ihn bei der örtlichen Polizei besonders bekannt und beliebt gemacht. Ari hatte Grenzen noch nie wirklich leiden können, vielleicht auch, weil er schon als Kind zahlreiche davon hatte überwinden müssen, als er mit seiner Familie von Albanien nach Deutschland geflohen war.
»Jaja, keine Panik!«, gab Finn zurück. »Ist doch sowieso immer das Gleiche.« Das murmelte er nur noch.
Aris revolutionärem Tatendrang stand Finns Resignation hinsichtlich allem, was Politik anging, gegenüber. Er wusste von Aris Aktivitäten im Internet, seinen Aktionen gegen die HfD. Einmal hatten Ari und seine Hackerkumpel für eine Stunde Hitlers Konterfei auf der Website der HfD platziert, ohne erwischt zu werden. Ein solches Risiko überhaupt einzugehen, nur um gegen das Regime zu protestieren, erschien Finn allerdings völlig unverhältnismäßig. Auch wenn er seinen Kumpel insgeheim für seinen Mut bewunderte, konnte er keinen Sinn in dem aussichtlosen Kampf gegen diese Übermacht erkennen.
Daran änderte auch nichts, dass Ari ihn ständig und wenig zimperlich daran erinnerte, dass er seiner Pflicht als Bürger Deutschlands nicht nachkäme, »unser tolles Land gegen den Großangriff von ganz rechts zu bekämpfen. Mit allen Mitteln: legal, illegal, scheißegal. Von mir aus auch horizontal, vertikal oder anal. Ha! Anal ist wahrscheinlich sogar am effektivsten!«
Deswegen wollte Finn auch nicht, dass Ari mitbekam, dass sein Abendessen heute per Drohne gekommen war. In Aris Wohnung gab es auch keine mit dem Internet gekoppelte Alexa wie bei Finn. Datenschutz war Ari heilig. Die Zimmer waren zwar bis unter die Decke vollgepackt mit High-Tech, aber er hatte sich alles selbst zusammengebaut und programmiert.
»Komm schnell!«, brüllte es aus dem Wohnzimmer. »Die Hitlers sind wieder im Fernsehen!«
Als Finn aus der Küche ins Wohnzimmer einbog, sah er grade noch die Gesichter von Bundeskanzlerin Elsa Jacobi und Staatsminister Hassan Altuntas auf dem Fernseher. Der kurze Überblick zu Beginn der Tagesschau zeigte dann in kurzer Folge Bilder aus Kriegsgebieten und Flüchtlingscamps und von einer Pressekonferenz mit DfB-Präsident Uli Hoeneß.
Finn ließ sich auf das verratzte aber überaus gemütliche Sofa plumpsen. Ari stand da und starrte mit der Fernbedienung in der Hand auf den riesigen Bildschirm an der Wand.
»Psssst!«, zischte er, als Finn ihm die Hand entgegenstreckte. Er drehte die Lautstärke noch etwas auf, um auf gar keinen Fall auch nur den leisesten Ton zu verpassen.
»Guten Abend, meine Damen und Herren«, begann die Sprecherin der Tagesschau. »Am heutigen Nachmittag hat die Bundesregierung in einer Pressekonferenz die Ergebnisse der Verhandlungen der Regierungskoalition präsentiert. Zuerst gab Staatsminister und CFU-Vize Hassan Altuntas gravierende Änderungen in der Bildungspolitik bekannt.«
Immer wenn Finn Polit-Shootingstar Hassan Altuntas im Fernsehen sah, fragte er sich, wie genial dieser Mensch wohl sein musste. Der Sohn türkischer Einwanderer hatte sich in eine Regierung gearbeitet, die so eindeutig rassistisch und nationalistisch war, dass kein halbwegs intelligenter Mensch es übersehen konnte.
Klar, Altuntas verkörperte trotz seines Migrationshintergrundes etwas Urbayrisches und hatte sogar einen deutlich erkennbaren bayrischen Akzent, aber seine Wurzeln waren unverkennbar: pechschwarzes Haar, dunkle Augen, dunkler Teint. Da half auch das bayrische Trachtensakko nichts, das er bei fast jedem öffentlichen Auftritt trug. Trotzdem war er Minister in einem Kabinett geworden, das überwiegend Ziele verfolgte, die darauf ausgerichtet waren, den Anteil an nicht ›urdeutschen‹ Bundesbürgern zu verringern. Das passte für Finn einfach nicht zusammen.
Selbst Ari, der sonst zu allem eine Theorie hatte, musste da passen. »Hey, eine HfD-CFU-Regierung, und die ernennen einen Kanaken zum Minister? Jetzt kannst du dich nicht mal mehr drauf verlassen, dass Nazis Rassisten sind, oder wie?! Oder ein Quotentürke wegen ›Political Correctness‹? Ich verstehe das einfach nicht!«
Vielleicht war es wirklich eine Art Quote. Die Anzahl der türkischstämmigen Deutschen war nach wie vor riesig und ohne genügend Wählerstimmen konnte auch eine nationalistische Regierung nicht über eine Legislaturperiode hinaus regieren. Das hoffte Finn zumindest.
Hin und wieder gab er sich auch einer Hoffnung hin, die ihm besser gefiel. Allem Anschein nach war die Kanzlerin die größte Unterstützerin Altuntas'. Zumindest betonte sie bei jeder Gelegenheit, dass sie ihn gegen viele Stimmen aus der eigenen Partei als Minister durchgesetzt hatte. Deshalb flammte in Finn manchmal ein Fünkchen Hoffnung auf, dass die Kanzlerin Elsa Jacobi selbst vielleicht keine Rassistin war. Der Gedanke gefiel ihm sehr. Schmerzlich musste er sich dann immer wieder eingestehen, dass er es besser wusste – aus erster Hand.
Die Tagesschau-Sprecherin fuhr fort. »Anschließend verkündete Kanzlerin und HfD-Vorsitzende Jacobi die gemeinsamen Pläne für eine Reform und Lockerung der Datenschutzgesetze. Ziel dieser Maßnahme sei es, den Schutz der Bevölkerung vor Terrorismus und weiteren Angriffen aus dem Ausland noch effizienter gestalten zu können. Die Ankündigung der Pläne, deren Inhalte schon im Voraus durchgesickert waren, wurde prompt und überraschend scharf kritisiert.«
Es folgte ein Ausschnitt der Pressekonferenz. Die Kamera schwenkte auf einen Reporter aus der hintersten Reihe des Auditoriums.
»Frau Jacobi, die Pläne stehen in starkem Widerspruch zum Grundgesetz und speziell zur Freiheit des Einzelnen. Der Mensch wird gläsern und dem Staat – in diesem Fall Ihnen, Frau Bundeskanzlerin – wird eine Blankovollmacht zum Abhören und mit den neuen Technologien sogar zum Beobachten jedes einzelnen Menschen gegeben. Glauben Sie nicht, dass dies zu viel Macht in der Hand einiger weniger Menschen ist?«
Finn staunte nicht schlecht über so viel Wagemut. Es musste sich dabei um einen unabhängigen Reporter handeln. Die großen Magazine und Zeitungen hüteten sich seit Jahren davor, kritische Berichte zu schreiben, geschweige denn Teile der Regierung direkt und öffentlich zu kritisieren. Das hatte in den letzten Jahren zu oft zu Ärger geführt.
Man munkelte, dass allzu kritische Journalisten bedroht wurden, nachweisen konnte man das jedoch nie. Klar war aber, dass ihnen keinerlei Interviews mehr gegeben wurden und sie keinen Zugang zu Pressekonferenzen wie dieser erhielten. Dass die Tagesschau diesen Ausschnitt überhaupt zeigte, grenzte schon an ein Wunder.
Finn konnte sehen, wie sämtliche bei der Konferenz Anwesenden augenblicklich erstarrten. Plötzlich gab es kein Gemurmel im Hintergrund mehr. Einige Reporter senkten die Köpfe. Alle Parteimitglieder, die zu sehen waren, schauten einander fragend an.
Alle erstarrten - bis auf Bundeskanzlerin Elsa Jacobi. Im Gegensatz zu jedem anderen strahlte sie nach wie vor Gelassenheit aus. Ihre Gesichtszüge blieben freundlich und die aufrechte Haltung wirkte nicht steif, sondern natürlich. Mit ihren stahlblauen Augen fixierte sie den Fragensteller, ohne dabei angriffslustig zu wirken.
Sie hatte einfach ein unfassbar einnehmendes Wesen. Schon vor langer Zeit hatte Finn lernen müssen, sie als den perfekten Wolf im Schafspelz zu betrachten – oder vielleicht eher als den Teufel in der Gestalt eines Engels. Er wusste nur zu gut, was sie wirklich war.
Überhaupt war ihr Äußeres makellos. Wie immer trat sie stilsicher auf. Ihr blondes Haar war zu einem Zopf gebunden. Ihr schwarzes Kleid saß perfekt am wohlgeformten Körper. Sie erinnerte etwas an die junge Heidi Klum, noch ohne den irren Blick in den Augen. Gut, der körperliche Verfall hatte mit Anfang dreißig noch nicht wirklich eingesetzt. Bei dem Beruf musste man aber eigentlich erwarten, dass die gesundheitliche Verfassung unter den täglichen Belastungen litt. Nicht so bei Elsa Jacobi. Man hatte das Gefühl, dass ihr Selbstvertrauen stets über Stress und Alter siegte, und es war ein Kantersieg. Dieses Selbstvertrauen kam auch sicher nicht von ungefähr. Sie war zweifelsohne die schönste Frau der Weltpolitik – und außerdem die mächtigste.
»Herr Schmid, wenn ich mich nicht irre?«
Sie irrte sich nicht. Elsa Jacobi war perfekt vorbereitet, zumindest über einen Knopf im Ohr, der ihr sagte, mit wem sie es zu tun hatte. In der kurzen Atempause, die auf die Frage folgte, bekam sie in einem Satz erklärt, wer dieser Kerl war und was sie über ihn wissen musste. Indem sie ihn direkt und beim Namen ansprach, suggerierte sie der Öffentlichkeit, dass sie sich nicht über den Journalisten stellen wollte, zum anderen aber zeigte sie dem Mann, dass sie sich sicher war, die Situation komplett im Griff zu haben.
Finn kannte sie. Er hatte den Eindruck, sie wolle dem Journalisten klarmachen, dass sie seine Eier ganz fest in der Hand hielt. Mit ein wenig Druck konnte sie sein Schicksal äußerst unangenehm gestalten.
»Ihre Frage ist absolut berechtigt und ich will auf Ihre Ängste eingehen.« Sie ordnete den Stapel Papier auf dem Pult. »Natürlich geben die Menschen in Zukunft etwas mehr von sich preis, aber doch nicht etwa der Öffentlichkeit oder einfach irgendjemandem. Sie legen ihre Geheimnisse und ihre Sicherheit vielmehr in die schützenden Hände ihrer gewählten Vertreter. Und damit komme ich schon zum viel wichtigeren Punkt: der Sicherheit unseres Volkes. Wir erleben seit Jahren ein zunehmendes Maß an Terrorismus. Ich brauche nicht näher auf die Anschläge der letzte Jahre, wie beispielswiese auf dem Oktoberfest, einzugehen, diese sind uns noch allzu präsent und in schmerzhafter Erinnerung.« Dabei ließ sie kurz den Blick sinken und holte Luft. »Wenn wir uns nicht stärker rüsten gegen die Feinde im In- und im Ausland, dann werden bald wir, unsere Freunde, unsere Kinder, viel häufiger Opfer sein.« Wieder eine kurze Pause. »Wir haben die Wahl: Mehr Geheimnisse oder mehr Sicherheit. Sie, Herr Schmid, haben die Wahl: Mehr Privatsphäre oder mehr tote Kinder auf Deutschlands Schulhöfen. Wählen Sie!«
Unter den Parteianhängern und Regierungsmitgliedern brach euphorischer Applaus aus und damit endete der aufgezeichnete Ausschnitt aus der Pressekonferenz.
»Die dazu notwendige Grundgesetzänderung könne nur in Form eines Volksentscheides legitimiert werden«, komplettierte die Tagesschau-Sprecherin. »Der Entscheid könne beispielsweise im Juni oder Juli stattfinden, so die Kanzlerin in einem späteren Statement.«
Bei dem Satz schlug Ari die Hände über seinen schwarzen Locken zusammen. »Juni oder Juli?« Er stellte sich vor den Fernseher und blickte Finn mit großen Augen an. »Du weißt, was da ist und was da auf den Straßen los sein wird, oder?!«
Finn zuckte mit den Schultern.
»Die machen das während der Fußball-WM«, stöhnte Ari. »Da wird es sicher ein paar Bombendrohungen geben oder sonst was.« Er legte den Kopf in den Nacken. »Ob echt oder nicht, Elsa kriegt ihre Bombe. Alle Deutschen kriegen Panik und was passiert?! Volksentscheid pro Überwachung … und der Staat kann mir beim Wichsen zuschauen … mit einer Drohne durchs Fenster … Scheiße, Mann, dumm ist Elsa nicht.«
Er ließ nacheinander beide Hände vom Kopf fallen, seine Schultern sackten plötzlich herab und dann plumpste er neben Finn aufs Sofa. Er schloss die Augen und verzog sein Gesicht, als hätte er gerade einen Jägermeister geschluckt.
»Mal ehrlich, Finn, was ist das für eine Welt, in der mir Vater Staat beim Wichsen zuschauen kann?«
Finn warf Ari einen Seitenblick zu, der zugleich voller Bewunderung und voller Mitleid war. Bewunderung, weil er anscheinend in Sekunden durchschaut hatte, was Elsa Jacobi im Schilde führte. Mitleid, weil Ari das so sehr mitnahm, dass er beinahe in Tränen ausbrach.
Tatsächlich war es auch wirklich eine bittere Pille, die sie da beide gerade schlucken mussten. Und nicht nur sie beide, sondern eigentlich alle Bürger Deutschlands. Nur hatte Finn schon vor längerer Zeit aufgegeben, sich über so etwas wie Politik aufzuregen. Sein Einfluss darauf war ohnehin minimal, wenn überhaupt vorhanden. Ein wenig hoffte er auch einfach auf das Gute und darauf, dass alles irgendwann besser würde. Mit einem verstärkten Sicherheitsgefühl ausgestattet, würden die Menschen bestimmt wieder vernünftiger und vielleicht schon bei der nächsten Wahl wieder eine Regierung aus der politischen Mitte wählen. Vielleicht sogar von etwas weiter links, sozusagen als Ausgleich. Vielleicht war das aber auch einfach nur naiv.
Im Moment dachte er allerdings in etwas kleinerem Maßstab. Wie konnte er Ari aus diesem Zustand der Depression erretten? Er konnte seinen Freund einfach nicht so leiden sehen. Zwei bis drei Minuten saßen sie schweigend da, während Finn krampfhaft überlegte. Dann kam ihm ein Gedanke. Er musste grinsen, unterdrückte es aber sofort wieder, setzte eine gleichgültige, betont lässige Miene auf.
»Sieh’s doch mal so, alter Freund. Eigentlich ist es fast wie früher, wie in den guten alten Zeiten.« Er ließ seine Worte erstmal sacken und beobachtete Ari.
Man konnte sehen, wie es in ihm ratterte. Seine Augen bewegten sich unter den Lidern, die buschigen Brauen zogen sich weiter zusammen und die kurzen Stoppel um seine Mundwinkel zuckten ein paarmal, als wolle er etwas sagen, behielte es dann aber doch für sich. Ari konnte sich keinen Reim darauf machen.
»Was meinst du?«, fragte er schließlich.
»Na hör mal, Alter. Ich bin mir sicher, daran erinnerst du dich ganz genau!«
Ari öffnete die Augen. »Was, Alter?«
Finn betrachtete seine Fingernägel. »Da kommst du schon alleine drauf.«
Ari beugte sich vor und schaute Finn verärgert von der Seite an. »Sag – es – mir – einfach!«
»Na gut! Also!« Darauf hatte Finn sich wie ein kleiner Junge gefreut. »Früher war Elsa auch schon bei dir beim Wichsen dabei. Nur hat sie damals, sagen wir, auch noch selbst Hand angelegt. Der Unterschied ist ja wohl marginal und so kleinlich und wählerisch darf man in solchen Zeiten nicht mehr sein. Oder was meinst du, Ardijan Ferhati?«
Finn ließ seine Worte ihre Wirkung entfalten und seinem Grinsen langsam, aber sicher freien Lauf. Es reichte schließlich von einem Ohr bis zum anderen.
Aris offener Mund wurde etwas schmaler und die Mundwinkel wanderten nach und nach von ganz unten nach oben. Er schaute Finn mit zusammengekniffenen Augen an und schüttelte langsam den Kopf. Schließlich konnte auch er sich das Lachen nicht mehr verkneifen.
»Du, Finn Falken«, er tippte ihm mit dem Zeigefinger auf die Brust, »hast ein ernsthaftes Problem und solltest weniger an Geschlechtsverkehr mit Elsa denken, Mann. Okay, gut, ich kann’s ja verstehen.« Er schüttelte noch grinsend den den Kopf. »Elsa hat es echt ein bisschen weiter gebracht als wir zwei Pflaumen, oder?!«
RÜCKBLICK – ARI & FINN
Uhlandschule, 2002
Finn saß zusammen mit all den anderen Jungen mit seiner Schultüte auf dem Schoß da. Auf der anderen Seite des Klassenzimmers saßen die Mädchen. Alle waren wahnsinnig aufgeregt.
Frau Neises rief nacheinander die Namen auf und jeder sagte, falls er überhaupt ein Wort herausbrachte, ein paar kurze Sätze über sich. Finn schaute alle mit großen Augen an, vor allem die, die sich gar nicht erst trauten, etwas zu sagen.
»Daniel? Heb bitte deine Hand.« Frau Neises´ Blick wanderte durch den Raum. »Ach da. Schön, dich kennenzulernen. Du darfst was sagen, wenn du magst.«
»D-D-D-Daniel …« Mehr brachte der kleine, dünne Kerl auch nach einer gefühlten Ewigkeit nicht heraus.
»Schon gut«, sagte Frau Neises fürsorglich. »Wir lernen uns alle grade erst kennen. Da ist es normal, dass man nicht so viel redet. So, weiter.« Sie sah auf ihre Liste. »Finn?«
Er hatte da keine Probleme. »Hallo, ich bin Finn.«
»Willst du noch was sagen?«
»Ich kann schon ziemlich gut rechnen.« Konnte er wirklich.
»Okay, Finn, das ist super. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Wir begrüßen erstmal alle und dann können wir rechnen, okay?«
»Okay.« Finn war ein wenig enttäuscht, aber der Name, den er dann hörte, klang in seinen Ohren vollkommen fremd und die Neugierde verdrängte das bisschen Enttäuschung.
»Der Nächste auf meiner Liste ist Ardijan.« Sie hob den Kopf.
Finn schaute durch die Klasse. Keiner hob den Arm.
»Habe ich das überhaupt richtig ausgesprochen?« Sie las nochmal laut nach. »Ardijan Ferhati? Nicht da?«
In dem Moment ging die Tür auf. Eine Frau mit dunklen Locken und einem netten Gesicht schob einen sehr kleinen Jungen mit genauso dunklen Locken und einer großen Brille auf der Nase herein.
Die Frau setzte an: »Frau Lehrerin, entschuldigen bitte. Ich nicht finden …«
»Alles in Ordnung.« Frau Neises lächelte und gab der Frau die Hand. »Jetzt sind Sie ja da.« Dann beugte sie sich zu dem Jungen hinunter. »Du musst Ardijan sein.«
Der Junge ließ seinen Blick über die Klasse schweifen und wirkte erst einmal wenig interessiert an der Lehrerin.
»Ardijan, setz dich doch zu den anderen Jungs.«
Er drehte seinen Kopf zu Frau Neises und sah ihr über die Brille in die Augen. »Du bist die Lehrerin?«
»Ja.«
»Cool, ich mag dich. Ich bin Ari.« Er streckte ihr die Hand entgegen und im gleichen Moment hatte er Frau Neises auch schon um den Finger gewickelt. »Meine Mama kann nicht so gut Deutsch, aber ich schon. Wir kommen aus Albanien.«
Finn staunte. Er kannte aus dem Kindergarten Griechen, Italiener, Türken, aber von einem Land namens Albanien hatte er noch nie gehört. Er wurde noch neugieriger. Bis eben hatte der dürre Daniel neben ihm gesessen. Den schob er kurzerhand zur Seite, sodass Platz für Ari war. Den nahm dieser auch ein und Finn fragte Ari Löcher in den Bauch, stundenlang, tagelang. Von da an waren beide unzertrennlich.
Nach der Grundschule kam Ari auf die Realschule und Finn auf das Gymnasium. Das änderte nicht das Geringste an ihrer Freundschaft. Sobald Zeit da war, hingen sie miteinander ab. Später kamen zu den Treffen tagsüber auch noch die nächtlichen Aktivitäten: Alkohol, Mädchen, manchmal Gras.
Erst viel später wurde ihre Freundschaft auf die Probe gestellt, und zwar – wie sollte es anders sein – durch eine Frau.
In der zwölften Klasse kam am ersten Schultag nach den Sommerferien Herr Benner, der Lateinlehrer, in Finns Klasse. Er war ungewöhnlich nervös und blieb in der Tür stehen.
»So, Leute, jetzt reißt euch bitte mal am Riemen. Ihr habt einen neuen Mitschüler, vielmehr eine Mitschülerin. Bitte.«
Er bedeutete jemandem, der vor der Tür stand, hereinzukommen. Finn glaubte sogar zu sehen, dass sich der Lehrer leicht vor diesem jemand verbeugte.
»Darf ich vorstellen? Elsa Jacobi.«
Eine großgewachsene blonde Frau mit stahlblauen Augen trat ein. Sie war eine Frau. Wenn auch alle anderen in der Klasse, Finn eingeschlossen, noch Teenager waren, Elsa Jacobi war eine Frau!
Sie strahlte in die Klasse. »Hallo, ich bin Elsa. Ich freue mich schon darauf, euch alle kennenzulernen.«
Und alle Jungs in der Klasse freuten sich darauf, Elsa kennenzulernen. Ganz besonders Finn, so viel stand fest. Nie im Leben hatte er eine schönere Frau gesehen. Er stierte sie an, war gefesselt von ihrer Aura, die sofort den ganzen Raum erfüllt hatte. Und dann plötzlich traf ihn ihr Blick und er war unfassbar peinlich berührt. Finn erstarrte zur Salzsäule, doch Elsa lächelte ihn an. Sein Herzschlag setzte für eine Sekunde aus.
Sein Klassenkamerad Pierre, der neben ihm saß, drückte mit der Hand Finns herunterhängende Kinnlade nach oben.
»Ruhig, Brauner!«, sagte er. »Frag sie doch nach einem Date. Klappt bestimmt.«
Pierre war stockschwul und offensichtlich der Einzige in der Klasse, der nicht sofort in Elsa verschossen war, einmal abgesehen von den Schülerinnen. Die hassten sie – ein Naturgesetz.
»Für die, die es nicht wissen«, fuhr Herr Benner fort. »Elsa Jacobi ist die Tochter von Roland Jacobi.«
Der Lehrer schaute fragend in die Runde. Es klingelte nicht bei Finn. Genauso wenig wie bei den meisten anderen.
»Kommt schon, Leute!?« Einer der Klassenstreber meldete sich mit gespielter Entrüstung zu Wort. »Doktor Roland Jacobi, Inhaber von ›Jacobi Industries‹. Hallo?!« Mit den Fäusten in der Hüfte verdrehte er die Augen. »Der Name steht ganz oben auf der Spendertafel unten in der Aula. Elsas Vater haben wir unsere neuen Notebooks zu verdanken. Gott, Leute, werdet erwachsen!«
Der Namen ›Jacobi Industries‹ sagte Finn etwas. Er glaubte, ihn im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften gehört zu haben.
»So besonders ist mein Vater auch nicht. Ein ganz normaler alter Mann eben.« Elsa hob beschwichtigend die Hände. »Und ich bin auch ganz normal. Bitte vergesst einfach meinen alten Herrn, okay?!«
Auf diese Weise konnte sie das Eis zwar noch nicht brechen, aber ihm zumindest einen ersten kleinen Riss verpassen. Elsa gab sich in der folgenden Zeit nahbar, und so nahmen sie auch die Schülerinnen schnell in ihre Gemeinschaft auf, sosehr sie Elsa zunächst gehasst haben mochten.
Finn konnte gar nicht anders. Er musste irgendwie an Elsa herankommen. Er traute sich aber nicht, sie einfach so anzusprechen. Elsa schüchterte ihn ein. Allerdings konnte er gut mit Pierre. Finn hatte einmal als Freundschaftsdienst für Pierre einen älteren Schüler nach seiner Handynummer gefragt. Als der daraufhin Pierre verprügeln wollte, hatte wiederum Finn eingegriffen, was in einer üblen Schlägerei mit blutigen Nasen geendet hatte. Seitdem hatte er bei Pierre einen Stein im Brett. Er durfte auch immer bei ihm abschreiben, was in Anbetracht der Tatsache, dass Finn Pierre in der siebten Klasse bei einem Streich in eine Mülltonne gesteckt hatte, ziemlich cool war.
Dann, als ein paar Wochen vergangen waren, ergab sich eine Chance. Zum Glück für Finn erfüllte sich ein Klischee: Schwule Männer können gut mit hübschen Frauen und andersherum. Pierre und Elsa waren schon nach kurzer Zeit sehr gut befreundet. Das sah auch Finn und witterte seine Chance.
»Pierre, hast du einen neuen Duft? Du riechst so gut heute«, säuselte er eines Morgens vor Unterrichtsbeginn.
»Alter Charmeur!« Pierre warf seine blonden, halblangen Haare nach hinten, bevor er Finn mit steinerner Miene ansah. »Aber schlechter Versuch. Was willst du?«
»Na ja, ich hab gedacht … weil ich dir ja auch schon mal die Nummer besorgt hab … Zugegeben, der Nutzen war gering.« Schon wegen Elsa nach einem Gefallen zu fragen, machte Finn nervös. »Aber könntest du vielleicht …«
»Das hat aber lange gedauert, Finn. Hätte nicht gedacht, dass du da was anbrennen lässt.«
Pierre kramte in seinem Rucksack und holte einen Block Papier heraus. Er zeichnete ein großes von einem Pfeil durchbohrtes Herz darauf und schrieb eine Nummer in das Herz.
»Halt dich ran! Sie ist heiß begehrt. Und bevor es noch peinlicher wird: Ich glaube, deine Chancen stehen gar nicht mal schlecht. Aber ab jetzt kann ich nicht mehr viel für dich tun, Honey.«
»Alter, Danke! Ich geb dir einen Appletini aus. Versprochen!«
»Ist schon gut, Romeo. Verbock es nicht!«
Natürlich brauchte es nochmal eine Woche und einen Arschtritt von Pierre, bis Finn sich traute, Elsa eine Nachricht zu schreiben. Eigentlich war es kindisch und er hätte sie direkt ansprechen sollen, das war ihm auch klar, aber das ging einfach nicht. Er bekam schon feuchte Hände, wenn er nur an Elsa dachte – und nachts nicht nur feuchte Hände. Also suchte er einen Vorwand, um das Eis irgendwie zu brechen. Glücklicherweise kam ihm Bruder Zufall zu Hilfe, als er in der Schule einen Vortrag über die explodierenden Immobilienpreise in der Region halten sollte. Immobilien? Elsa Jacobi? Da war doch was! Er schrieb Elsa eine Nachricht mit dem Smartphone.
Hallo Elsa,
ich hab mich gefragt, ob du mir bei meinem Vortrag helfen kannst. Dein Vater macht was mit Immobilien, oder? Wäre super, wenn du mir ein paar Tipps geben könntest. Vielleicht bei einem Kaffee? Ich lade dich natürlich ein.
Grüße
Finn
Nachdem die Nachricht endlich versendet war – er hatte sie zehn oder elf Mal gelöscht und neu geschrieben – legte er sich in sein Bett und starrte an die Decke. Es hatte eine gute Stunde gedauert, dieses Meisterwerk der Liebeslyrik zu verfassen, und jetzt war Finn ziemlich erschöpft und schloss die Augen.
Dann vibrierte sein Smartphone und sein Puls kam schlagartig ins Rasen. Enttäuschung pur. Es war eine Videodatei von Ari. Eine Frau in High Heels trat einem gefesselten nackten Mann mehrmals hintereinander in die Weichteile. Der Mann zuckte jedes Mal schmerzerfüllt zusammen. Dazu gab es eine kurze Nachricht von Ari.
Hände auf die Decke und schlafen, du alter Rubbler! xD Jetzt solltest du ohnehin keinen mehr hochkriegen! Falls doch, lösch sofort meine Nummer!!!
An Schlaf war jetzt aber nicht mehr zu denken. Die Erschöpfung war der Aufregung gewichen und am liebsten hätte Finn die Nachricht an Elsa zurückgeholt und wieder gelöscht. In seinem Kopf jagten sich unzählige Varianten, wie es wohl weitergehen würde. Sie reichten von bekommenen Körben und lachenden Mädchen, die mit Fingern auf ihn zeigten, über Nachrichten mit positiven Antworten und Dates mit Händchenhalten bis hin zu ineinander verschlungenen Körpern. In dieser Nacht passierte jedoch erstmal gar nichts und irgendwann übermannte ihn die Müdigkeit.
Mit dem Handy in der Hand wachte Finn auf. Er war sofort hellwach, obwohl es nicht viele Stunden Schlaf gewesen sein konnten. Per Fingerabdruck entsperrte er sein Smartphone. Nichts! Nicht mal das obligatorische Möpse-Bild von Ari, das schon fast jeden Tag kam. Er checkte die Datenverbindung. Alles okay, scheiße! Sofort machte sich Enttäuschung in ihm breit. Anscheinend ging da nichts. Aber das war doch klar, Mann. Er packte seinen Rucksack und stopfte sich lustlos eine Scheibe ungetoastetes Toastbrot in den Mund, bevor er das Haus verließ.
Die Bahn war rammelvoll und hatte Verspätung. Natürlich, das passte zu seinem beschissenen Tag. Er musste den Weg vom Bahnhof zur Schule sprinten, weil es in Strömen regnete und er ohnehin viel zu spät dran war. Der Haupteingang der Schule war bereits verschlossen. Finn musste am Nebeneingang klingeln, um hineinzukommen, was seit Neustem die Handhabe der Schule war, um die Zu-spät-Kommer besser kontrollieren und listen zu können. An der Klingel holte er sich den üblichen Anschiss ab und drückte dann die summende Tür auf.
»Gib’s mir richtig, Welt!«, jammerte er.
Jemand hinter ihm rief: »Halt mir die Tür auf!«
»Ja, aber beeil dich gefälligst!«
Ohne sich umzudrehen, stellte Finn den Fuß in die sich schließende Tür.
Die Stimme war jetzt näher, direkt hinter Finn. »Ein echter Gentleman sieht aber anders aus. Du solltest an deinen Umgangsformen arbeiten, Mister, sonst hilft dir keiner bei deinem Vortrag.«
Voller Entsetzen versuchte Finn sich aus der Erstarrung zu lösen, die ihn plötzlich gelähmt hatte. Er schluckte. Dass sein Versuch, seine Gesichtszüge wieder zu entspannen, auch nicht im Ansatz funktionierte, wurde ihm schnell klar. Aber er konnte nicht ewig mit dem Rücken zu ihr stehen bleiben. Er drehte sich zu Elsa um.
»Ich … ich …«, stotterte er. »Tut mir leid.«
»Schon gut!«
Sie ging an Finn vorbei und er sah ihr auf den Hintern. Als sie sich umdrehte, konnte er gerade noch rechtzeitig den Blick in Richtung Augen hochreißen. Sie hatte ihn nicht dabei erwischt, wie er ihr auf den Po starrte, das war gut, aber er stand noch immer wie angewurzelt da. Sag was, Mann!
»Ich hätte nicht gedacht, dass eine Elsa Jacobi mal zu spät kommt.«
»Tu ich auch nicht. Ich war beim Arzt. Zumindest steht das auf der Entschuldigung hier.« Sie zwinkerte ihm zu. »Jetzt komm! Bist spät dran.«
Das Zwinkern reichte schon wieder aus, Finns Herz höherschlagen zu lassen. Die Anspannung war noch da, aber sehr langsam spürte er ein gutes Gefühl in sich aufsteigen. Es konnte kein Zufall sein, dass sie beide sich hier trafen. Ein Wink des Schicksals? Deine Chance, Junge! Er nahm all seinen Mut zusammen.
»Je später der Abend, desto schöner die Gäste. Das trifft zumindest auf eine Person von uns zu. Und außerdem, wenn du zuerst ins Klassenzimmer gehst, beachtet mich sowieso keiner mehr. Dann kann ich mich einfach auf meinen Platz schleichen und niemand merkt was.«
Sie lächelte, schaute kurz vor sich auf den Boden.
Ich hab sie in Verlegenheit gebracht! Kann das sein? Seine schlechte Laune war in Windeseile verflogen und stattdessen machte sich Hoffnung breit. Finns angeborenes Selbstvertrauen kam langsam zurück.
Elsa setzte zu einer Antwort an, hielt dann aber inne, grinste und drehte sich um. Damit konnte Finn erst einmal nichts anfangen, doch er spürte, dass das Eis zu brechen begann. Für den Moment war er im Glück. Auf dem Weg Richtung Klassenzimmer blieb er immer ein paar Meter auf Abstand und bestaunte Elsas Rückseite.
»Wo bleibst du denn?«
»Ich genieße die Aussicht!« Sein eigenes Selbstvertrauen Elsa gegenüber überraschte ihn, und ihr schien es tatsächlich zu gefallen. Das glaubte er zumindest aus dem »Tzzz« herauszuhören, mit dem sie ihm darauf antwortete.
Als sie in die Klasse kamen, lief es für Finn wie am Schnürchen. Elsa ging auf Herrn Benner zu, begrüßte ihn per Handschlag und erklärte ihre Verspätung. In ihrer gewohnt charmanten Art sah sie dem Lehrer dabei in die Augen, während der damit zu kämpfen hatte, nicht sofort ihre Rundungen von oben bis unten zu begaffen. Das gelang ihm sogar, aber was hinter ihr geschah, war für Herrn Benner in dem Moment unsichtbar. Finn hätte in einem Clownskostüm hereinkommen können und der Lehrer hätte es nicht bemerkt. Also schlenderte er betont lässig quer durchs Zimmer an seinen Platz.
Er sah über die Schulter von Herrn Benner, der von ihm abgewandt stand, in Elsas Gesicht. Er winkte ihr zu, um ihr zu zeigen, dass er wie prophezeit unbemerkt hereingekommen war. Ein kurzes Lächeln huschte über ihr Gesicht, gleichzeitig aber redete sie unbeirrt weiter.
Finn ließ sich in seinen Stuhl sacken und ein Triumphgefühl überkam ihn. Natürlich landete er ein weiteres Mal auf der Liste der Zu-spät-Kommer, aber heute konnte ihm nichts, aber auch gar nichts mehr die Stimmung verhageln. Pierre war das Ganze nicht verborgen geblieben und unter dem Tisch stießen sie die Fäuste gegeneinander.
Er flüsterte: »Ich weiß zwar nicht, was genau passiert ist, aber so wie du aussiehst, lief’s gut.«
Elsa setzte sich auch auf ihren Platz auf der anderen Seite des Zimmers. Sie schaute zu den beiden herüber.
»Und so wie die dich gerade anschmachtet«, fuhr Pierre fort. »Sehe ich da etwas auf dich zukommen. Ich spüre heterosexuelle Spannung, Baby.«
Finn beließ es bei einem zufriedenen Schweigen.
»Pass auf, Finni. Ich gehe am Freitag mit ein paar Jungs und Mädels ins ›Dilayla‹. Gute Musik, gute Drinks, viele verrückte Leute - könnte auch was für mich dabei sein – und vor allem viele dunkle Ecken, in die man sich zu zweit zurückziehen kann. Und rate mal, wer auch mitkommen will?!«
Finn musste nicht raten. Er wusste es und eine Antwort war genauso wenig nötig.
»Richtig! Prinzessin Jacobi herself! Wir glühen bei mir vor. Meine Alten sind auf Achse. Da musst du einfach mitkommen, Finn!«
Finn nickte begeistert.
Nach ein paar Sekunden fügte Pierre hinzu. »Und Finn, ich glaube, eine Sache ist bei Hetero- und Homomännern gleich. In solchen Momenten nie mit geladener Kanone losziehen!«
Ein paar Tage später war es so weit. Finn hatte aus dem Keller seiner Eltern Apfellikör, Wodka und Triple Sec geklaut. Damit konnte er etwas zum Vorglühen beitragen und gleichzeitig seine Schuld gegenüber Pierre, nämlich den versprochenen Appletini, begleichen. Er war später dran als vereinbart. Der Plan war, nach Elsa anzukommen. Ihm kam es irgendwie cooler vor, als Letzter zu erscheinen. So saß er in der Bahn, etwas aufgeregt, aber trotzdem entspannt, auch weil er Pierres Rat befolgt hatte, hauptsächlich jedoch, weil er sehr zuversichtlich war, was Elsa anging.
Als er bei Pierre ankam, waren wie erwartet alle schon da - außer natürlich Elsa, aber Finn blieb cool. Er durchforstete auch nicht gleich jeden Winkel des Wohnzimmers nach Elsa, obwohl ihm danach war. Eigentlich hätte er es sich ohnehin denken können, dass sie und nicht er den großen Auftritt bekommen würde, und so kam es dann auch.
Elsa kam mit dem Taxi. Pierre öffnete ihr die Tür und hielt dabei schon seinen vierten Appletini in der Hand. Sie begrüßten sich überschwänglich, was hauptsächlich an Pierres Pegel lag.
Finn saß mit einem Klassenkameraden an der Theke der offenen Küche und nippte an einem Bier. Er schaute zur Haustür und Elsa lächelte ihn einmal mehr an. So, wie sie es auch schon die letzten paar Tage immer wieder getan hatte. Für Finn sah es im Moment verdammt gut aus.
Elsas großer Auftritt bestand darin, dass allen der Atem stockte, als sie ihre Jacke auszog. Eigentlich hatte sie nur ein schlichtes schwarzes Kleid an, aber an ihr sah es wie Haute Couture aus.
Als Erster fand selbstverständlich Pierre seine Sprache wieder. »Hey Sexy, willst du auch ´n Appletini? Is´ von Finn.« Er hickste. »Der kann was!«
»Appletini?« Elsa wirkte amüsiert. »Ich dachte, wir sind zum Vorglühen hier?!« Sie holte aus ihrer Tasche eine Flasche Rum und eine Flasche Wodka und stellte beide auf den Tisch in der Mitte des Zimmers. Da staunten alle nicht schlecht und auch Finn hatte damit wirklich nicht gerechnet. Aber es passte dann doch zu Elsa, dass es mehr brauchte als einen leichten Cocktail, um sie zu beeindrucken.
Sie spielten ein Trinkspiel, bei dem Pierre und ein paar andere schon früh ausstiegen, aus Angst, das eigentliche Ziel des Abends, den Club, nicht mehr zu erreichen. Von zwei der Mädchen, die sich getraut hatten mitzuspielen, hing eine bald über der Schüssel und die andere kurz danach hackedicht in den Armen eines von Finns Klassenkameraden.
Am Ende hatten Elsa und Finn jeweils etwa eine halbe Flasche Schnaps intus. Finn war betrunken. Er war aber auf einem Level, auf dem er alles halbwegs unter Kontrolle hatte. Das Erstaunliche war, dass man Elsa so gut wie nichts anmerkte. Sie sprach klar und ihre Bewegungen waren elegant wie eh und je. Die Frau ist echt verdammt sexy.
Als alle anderen vom Tisch aufgestanden waren, die es noch konnten, setzte er sich näher zu ihr. Es schien ihr zu gefallen. Sie fixierte in mit ihrem Blick.
»Fräulein Jacobi?«, sagte Finn, darum bemüht, nicht zu lallen. »Gehört sich so ein Trinkverhalten für eine Millionenerbin von Ihrem Stand?«
Mit einem Mal hörte sie auf zu lächeln und funkelte ihn an.
»Ich bin kein Fräulein, kapiert?!«, fuhr sie ihn an. »Und ich nehme mir, was immer ich will!« Sie krallte ihre Hand in seinen Nacken, zog ihn zu sich heran und steckte ihm die Zunge in den Hals. In dem Moment konnte Finn sein Glück kaum fassen und er genoss das Zungenspiel. Sein Herz raste und sein Blut schoss aus dem Kopf in den Körper. Ihm wurde heiß und er umfasste reflexartig Elsas Schenkel.
»Na, na, na«, hörte er Pierre sagen. »Wir wollen schon noch ins ›Dilayla‹, aber ihr könnt auch gerne die Nacht auf dem Sofa verbringen. Falls nicht, sollten wir jetzt langsam los.«
Genauso plötzlich schob Elsa Finn wieder zur Seite. »Ich bin in Tanzlaune! Gehen wir!«
Natürlich mussten sie vor dem ›Dilayla‹ nicht anstehen, obwohl sie mit ihrer Schülerclique die mit Abstand Jüngsten hier waren. Unter normalen Umständen wäre es sicher nicht leicht gewesen, überhaupt in den Club hineinzukommen, aber der Name Jacobi öffnete die Türen. Irgendwie waren sie auf die Gästeliste gekommen und jetzt schritten sie unter den verächtlichen Blicken der älteren Kundschaft an der Schlange vorbei.
Neben den verächtlichen gab es noch die schon fast selbstverständlich gewordenen lüsternen Blicke der Männer, die an Elsas Kurven klebten. Aber es gab auch mehrere Paare weiblicher Augen, die Finn folgten. Ihm war schon in der Bahn aufgefallen, dass ihn ein paar seiner Freunde bewundernd – oder neidisch – ansahen. Woran das lag, wusste er sofort. Jetzt waren es aber auch Frauen, die ihm hinterhersahen. Gut, er war hochgewachsen, gut gebaut und hatte ein hübsches Gesicht mit strahlenden Augen. Beim Stylen seiner Haare hatte er sich für diesen Abend natürlich besonders viel Mühe geben. Seinen Bart hatte er zwei Tage vorher gestutzt, sodass er, wie er fand, die perfekte Länge von ein paar Millimetern hatte. Sein Outfit mit Jeans, Lederjacke und Chucks fand er in seinem angetrunkenen Zustand auch besonders toll, aber das war alles mehr oder weniger dasselbe wie immer. Anders war nur seine Ausstrahlung. Er wurde überwältigt von seinem eigenen Selbstvertrauen. So einen Fang wie er machten nur die ganz Besonderen.
So viel Arroganz wollte er eigentlich nicht zulassen. Das half aber nichts. Er konnte nicht anders und stolzierte wie ein Hahn an der Schlange vorbei. Dass ihn jetzt auch noch Frauen anschmachteten, die ein paar Jahre älter waren als er selbst, tat sein Übriges zu seiner stolzgeschwellten Brust.