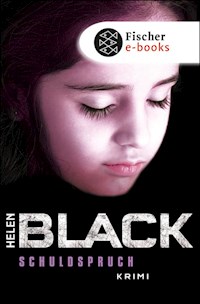4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ihr neuer Fall stürzt die Londoner Anwältin Lilly Valentine in schwere Konflikte. Die 14jährige Asylbewerberin Anna ist von drei englischen Internatsschülern missbraucht worden. Aber als sie Lilly um Hilfe bittet, rät die Anwältin ab: wer wird ihrer Aussage schon Glauben schenken? Dann wird Anna wegen Mordes verhaftet. Lilly erhält rassistische Drohungen, ihr Sohn gerät in Gefahr. Darf Lilly überhaupt noch für Anna kämpfen? Brisant und aktuell: Blacks zweiter Krimi mit Lilly Valentine, der Anwältin der Außenseiter und Schwachen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Helen Black
Rechenschaft
Krimi
Aus dem Englischen von Christine Strüh
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Mutter
Weltweit gibt es 9,2 Millionen Flüchtlinge.
Großbritannien bietet drei Prozent
von ihnen eine neue Heimat.
Von denen, die hier Unterschlupf suchen,
sind ein Fünftel Kinder ohne Begleitung.
Prolog
Allmählich geraten die Dinge außer Kontrolle. Das ist ein Lieblingsspruch von Luke Walkers Mutter.
Ihm tut der Kopf weh von den Stimmen seiner Freunde, die, von unrhythmischem Händeklatschen begleitet, einen Song von Lily Allen grölen. Damit wollen sie das Mädchen anfeuern. Tom juchzt wie ein kleines Kind an Weihnachten, und er sabbert so, dass ihm die Spucke übers Kinn läuft. Charlie versetzt Luke einen Rippenstoß und brüllt ihm etwas ins Ohr, aber die Worte gehen in einem Lachanfall unter.
Das Mädchen ist der Mittelpunkt ihres schwankenden Kreises, ihr Lachen inzwischen beinahe hysterisch. Sie sagt etwas, was keiner von ihnen versteht, dreht sich schwungvoll im Kreis, so schnell, dass ihr Rock in die Höhe fliegt und die Jungen ihren Slip sehen können.
Tom streckt die Hand nach ihr aus. »Yeah, Baby«, blökt er, gerät vor lauter Begeisterung aus dem Gleichgewicht, kippt um und reißt Luke mit sich.
Eine Weile tastet er auf dem Boden herum und flucht.
Luke ist kotzübel. Er will nach Hause. Aber heute schläft er im Internat, also geht das nicht. Und wenn der Hausvorsteher ihn in diesem Zustand erwischt, kriegt er einen Monat Hausarrest.
Außerdem schwankt der Boden unter ihm, alles dreht sich, und es ist mehr als unklar, ob er überhaupt aufstehen kann.
»Gefällt euch?«, fragt das Mädchen.
Die anderen beiden applaudieren, aber Luke kann nicht mal nicken. Nein, ihm gefällt das nicht. Überhaupt nicht.
Dabei hat der Abend ganz normal angefangen. Als die Schularbeiten erledigt waren und Mr Philips sich noch um einen der neuen Jungs mit Heimweh kümmerte, haben Luke und seine Freunde sich weggeschlichen, um ein bisschen im Dorf abzuhängen. Wie anders ihr Leben sein wird, wenn sie erst mal einen Führerschein haben!
Charlie ist der Älteste und kriegt zu seinem siebzehnten Geburtstag Fahrstunden, aber bis dahin sind es noch über zwei Monate.
Als Nächster müsste eigentlich Luke an der Reihe sein, aber jedes Mal, wenn er den Führerschein erwähnt, wirft seine Mutter ihm nur diesen Blick zu und erzählt ihm, wie viele junge Menschen pro Jahr bei Autounfällen ums Leben kommen.
Tom ist der Jüngste von ihnen, macht die Fahrprüfung aber wahrscheinlich trotzdem als Erster. Sein Dad lässt ihn nämlich jetzt schon mit einem alten Jeep über das Grundstück juckeln.
Sie sind also zum Spirituosengeschäft gezogen. Unterwegs überlegte Luke, warum sie sich überhaupt die Mühe machten, denn Mrs Singh weiß, dass sie vom Internat kommen und minderjährig sind. Prompt beschimpfte Tom sie als »verdammtes Pakiweib« und schmiss ein Regal mit Chips um. Luke hasst es, wenn Tom so was macht.
Als Mrs Singh drohte, die Polizei zu holen, schafften Luke und Charlie es schließlich, Tom aus dem Laden zu schleifen. Und da entdeckten sie das Mädchen, das gegenüber am Fenster des Postamts lehnte. Eindeutig eine aus dem Wohnheim, das konnte man an ihren Klamotten erkennen und an ihren Haaren. Und sie stand auch so da, zusammengekauert, als wollte sie im Boden versinken.
»Hey du!«, rief Tom.
Sie sah erschrocken aus, weil jemand sie ansprach, und wollte sich gleich aus dem Staub machen, aber Tom rannte über die Straße und packte sie am Arm.
»Möchtest du ein bisschen Geld verdienen?«, fragte er sie.
Aber sie sah ihn nur verständnislos an.
»Geld«, wiederholte er und rieb Daumen und Zeigefinger aneinander, als wäre das Mädchen taub oder geistig zurückgeblieben. Dann gaben sie ihr fünf Pfund, sagten ihr, sie sollte ihnen ein paar Flaschen Cider kaufen, und machten sich auf den Weg in den Park.
Der Park ist für die Kids aus der Nachbarschaft angelegt, aber die sind alle zu Hause und spielen auf ihren Nintendos. Stattdessen gehen die Internatsschüler in den Park – jedenfalls wenn sie es schaffen, sich von den abendlichen Aktivitäten wegzuschleichen. Hier kommt nie einer vorbei, es ist kalt, und man kann sich in aller Ruhe volllaufen lassen.
Luke weiß nicht, warum das Mädchen mitgegangen ist. Vielleicht gefällt ihr Charlie. Er ist groß und dunkelhaarig, und alle Mädchen finden ihn toll. Oder Tom hat sie überredet. Er hat rote Haare und eine Lücke zwischen den Schneidezähnen, aber wenn er es drauf anlegt, kriegt er von den anderen immer, was er will. So was nennt Lukes Mum immer »Führungsqualitäten«.
Wie auch immer, jedenfalls haben sie sich auf die Schaukeln gesetzt und sich abwechselnd den Fusel reingekippt. Das Mädchen sagte kaum ein Wort, nur, dass sie Anna hieß. Luke fand sie auf eine seltsame Art hübsch.
Als sie zu tanzen anfing, merkte man, dass sie betrunken war und nicht mehr richtig wusste, was sie tat. Luke macht sich Vorwürfe, dass er ihr nicht gesagt hat, sie soll sich hinsetzen.
Denn jetzt gerät alles außer Kontrolle. Tom hat Anna auf den Boden gezerrt. Sie lacht zwar immer noch, versucht ihn aber wegzuschubsen.
»Nein, nein, nein«, sagt sie.
Sie wehrt sich, aber sie ist nicht besonders stark. Tom dagegen ist Kapitän der Rugby-Startelf. Jetzt erst fällt Luke so richtig auf, wie mager das Mädchen ist, und Tom muss sich kein bisschen anstrengen, ihre dünnen Arme über ihrem Kopf festzuhalten. Ihr Pulli ist hochgerutscht, und Luke sieht ihre Rippenknochen durch die Haut.
»Komm schon, Tom, lass sie in Ruhe«, sagt er.
»Verpiss dich bloß«, zischt Tom. Er keucht heftig. Seine Stirn glänzt, sie ist nass vor Schweiß, und man sieht die unverkennbare Beule, wo sein Penis gegen die Hose drückt.
Luke fühlt, wie ihm die Galle hochkommt. Es brennt, und er muss den Brechreiz niederkämpfen.
Das Mädchen wehrt sich und versucht sich zu befreien.
»Hilf mir mal, Charlie«, sagt Tom.
Aber der tritt nur unsicher von einem Fuß auf den anderen.
»Halt ihr die Arme fest«, grunzt Tom.
Als Charlie sich immer noch nicht rührt, knurrt Tom: »Halt ihr die verdammten Arme fest, du Schwuchtel.«
Charlie blickt verstohlen in Lukes Richtung. Natürlich hat er Angst vor dem, was gleich passiert, aber er hat noch mehr Angst davor, sich Tom zu widersetzen. Luke wünscht sich mit aller Kraft, dass er sich umdreht und weggeht, dass die ganze Sache bloß ein Witz war. Aber Charlie kniet sich hin, direkt hinter Annas Kopf, und presst ihre Handgelenke auf den Boden.
Jetzt merkt Luke, dass das Mädchen schreit. Markerschütternd.
Tom hält ihr mit der einen Hand den Mund zu und macht sich mit der anderen an seinem Reißverschluss zu schaffen. Währenddessen versucht Luke aufzustehen, er will dem Mädchen helfen, aber er kippt um, landet wieder auf dem Boden und zappelt wie ein Fisch im Netz.
Tom lacht. »Keine Sorge, du kommst auch gleich an die Reihe, Lukey.« Dann stößt er mit der Hüfte nach vorn, und Anna reißt die Augen auf. Luke weiß, dass er etwas tun muss. Irgendwas. Aber warum rührt er sich dann nicht? Warum liegt er immer noch auf dem harten herbstlich kalten Boden? Angeekelt schließt er die Augen und wünscht sich, es wäre morgen früh.
Kapitel 1
Der Himmel draußen vor dem Büro war klar und freundlich. Eifrig versuchte die blasse Oktobersonne sich bemerkbar zu machen, und Lilly sehnte sich nach ihrem Mittagsspaziergang. Im Verlauf eines vierwöchigen sehr schwierigen und nervenaufreibenden Scheidungsfalls hatte sie angefangen, täglich eine Runde im Harpenden Park zu drehen, denn sie merkte, dass ihr die frische Luft guttat und verhinderte, dass sie sich zum Lunch mehr als ein Sandwich einverleibte.
Seufzend wandte sie den Blick wieder vom Fenster ab und ihrem Klienten zu. Mr Maxwell war so fasziniert von seiner eigenen Geschichte, dass er das mangelnde Interesse seiner Anwältin gar nicht bemerkte.
»Ich sehe absolut keinen Anlass, ihr auch nur einen einzigen Penny zusätzlich zukommen zu lassen«, sagte er gerade. »Und ich sehe auch keinesfalls ein, warum sie den ganzen Tag sorglos zu Hause sitzen soll, während ich von früh bis spät schufte wie ein Pferd.«
Lilly fragte sich, warum ein Mann, der so heftig lispelte, so viele Wörter benutzte, in denen ein Zischlaut vorkam. Die Spuckeflecken auf seiner Krawatte übersah sie geflissentlich.
»Sie muss sich immerhin um drei Kinder kümmern«, wandte Lilly ein, »und das sind auch Ihre.«
»Für die Kinder haben wir ein Au-pair-Mädchen.« Er fixierte Lilly mit seinen vorstehenden Augen, die aus seinem ansonsten flachen Gesicht quollen wie zwei Glasmurmeln. »Sie haben auch ein Kind, Miss Valentine, und trotzdem sieht es so aus, als schaffen Sie Ihre Arbeit ganz gut.«
Lilly dachte an ihre tägliche, geradezu lachhaft komplizierte Betreuungsplanung, die ihren Exmann, zahlreiche Freunde und eigentlich jeden mit einschloss, der bereit war, eine Mitfahrgelegenheit zur Schule anzubieten.
»Was meinen Sie denn, was Ihre Frau tun könnte, um Geld zu verdienen?«, fragte Lilly.
Mr Maxwell zuckte die Achseln. »Früher war sie Model.«
Lilly versuchte ihren Schock zu verbergen. Welche schöne Frau würde sich denn freiwillig mit diesem unattraktiven Mann einlassen? Mr Maxwell blinzelte wie ein Laubfrosch. Natürlich war die Antwort offensichtlich: Die Sorte Frau, die gern den lieben langen Tag auf ihrem knochigen Hintern saß und sich damit vergnügte, das Geld ihres Ehemanns zu zählen.
»So ärgerlich es sein mag, Mr Maxwell, das Gericht hat angeordnet, dass Sie Ihrer Frau und Ihren Kindern Unterhalt zu zahlen haben«, erklärte Lilly.
»Meiner Exfrau.«
»Ja, und dieser Anordnung müssen Sie wohl oder übel nachkommen«, nickte Lilly.
Endlich schlurfte Mr Maxwell, die Froschaugen vor Entrüstung weit aufgerissen, aus Lillys Büro.
Lilly sah ihm nach, wie er das Gebäude verließ und die Straße entlanghumpelte. Er lispelte, zwinkerte und hinkte – vielleicht war sie zu hart mit dem armen Mann. Aber dann tänzelte eine Blondine mit wabernden Silikonbrüsten, die sich mächtig bemühten, ihre Bluse zu sprengen, auf ihn zu. Jauchzend fiel sie ihm in die Arme und bedeckte seinen kahlen Kopf mit Küssen.
Offensichtlich wartete also schon die nächste Mrs Maxwell in den Kulissen. Manche Männer waren einfach nicht lernfähig.
Als Lilly auf ihre Armbanduhr schaute, stöhnte sie unwillkürlich, weil ihr klar wurde, dass jede Minute der nächste Klient anrücken konnte. Zwar versuchte sie immer, einen Puffer zwischen ihren Terminen zu lassen, aber Scheidungsfälle überzogen immer ihre Zeit. Andererseits bezahlten sie pro Stunde, also waren sie selbst schuld, wenn sie länger als vereinbart plapperten – was unweigerlich passierte. Wenn es darum ging, den ehelichen Zugewinn zu teilen, stritten sich diese Leute selbst noch über den Inhalt des Staubsaugerbeutels.
Lilly vermisste ihre Fürsorgefälle. Pampige Teenager, die sich zwischen dem Ladendiebstahl bei Tesco und dem Treffen mit den Kumpels im Einkaufszentrum zehn Minuten abknapsten. Manchmal tauchten sie auch gar nicht erst auf und hinterließen nur verwickelte Nachrichten über einstweilige Verfügungen, Sozialarbeiter und Schwangerschaftstests.
Himmel, sie vermisste diese Arbeit so.
Lilly zog ein Kitkat aus ihrer Tasche. Schokolade und keine Bewegung. Doppeltes Übel. Sie dachte daran, dass das Einzige, was sie bei Verstand hielt, der wöchentliche Ausflug ins Hound’s Place war. Da konnte sie wenigstens etwas Gutes tun. Etwas wirklich Gutes.
»Vielleicht fahr ich nach dem nächsten Termin kurz mal hin«, sinnierte sie laut.
»Schlagen Sie sich das lieber gleich aus dem Kopf.«
Lilly drehte sich zur Tür um, wo ihre ewig grimmige Sekretärin Sheila erschienen war.
»Sie wissen doch gar nicht, was ich meine«, erwiderte Lilly.
Empört verschränkte Sheila die Arme vor der Brust. »Sie wollen ins Dog’s Home abzischen.«
»Das Heim heißt Hound’s Place«, erklärte Lilly. »Das wissen Sie doch genau.«
Sheila sammelte ein paar Papiere vom Boden auf und schob sie in ihre Akte zurück. »Sind Sie zu Hause auch so unordentlich wie hier?«
»Sind Sie bloß gekommen, um mich zu ärgern, oder ist Ihnen das Nägelfeilen langweilig geworden?«
Sheila versuchte, die Akte in die Schublade zurückzulegen, aber die klemmte. Sie zog und zerrte, und das Stöhnen des Metalls passte gut zu ihrem eigenen.
»Wollen Sie denn was von mir, Sheila?«, fragte sie schließlich.
»Die Chefs möchten nach der Arbeit noch was mit Ihnen trinken gehen«, antwortete Sheila, ohne sich umzudrehen.
Lilly stützte den Kopf in die Hände. »Na toll.«
»Hören Sie bloß auf zu jammern«, wies Sheila sie zurecht. »Die wollen sich bei Ihnen bestimmt für Ihre harte Arbeit und Ihr Engagement bedanken.«
»In meiner neuen Rolle als Beraterin der Reichen, Hässlichen und Geschiedenen mache ich Geld wie Heu. Engagement gehört nicht zum Angebot.«
»Ich weiß nicht, warum Sie so mies drauf sind. Sie verdienen gut, oder etwa nicht?«
Das stimmte. Seit die Firma Lillys Fallbelastung umgeschichtet hatte, war ihr Gehalt um fünfzig Prozent gestiegen.
»Die Wurzel allen Übels«, sagte sie.
Vom Druck des Metalls verformte sich Sheilas Wange. »Als Sie noch kein Geld hatten, haben Sie so was aber nicht gesagt. Da haben Sie sich bloß endlos über den Zustand Ihres Hauses beklagt, über Ihr kaputtes Auto und dass Sie sich Sams Schuluniform nicht leisten können.«
»Aber jetzt langweile ich mich.«
»Werden Sie endlich erwachsen«, grunzte Sheila. »Immer noch besser als die hoffnungslosen Fälle, die früher hier aufliefen und die Tacker haben mitgehen lassen.«
»Schutzlose Kinder«, schnaubte Lilly.
»Die meisten waren doch Junkies«, beharrte Sheila. »Wie diese Verrückte, die das Putzmittel getrunken hat.«
»Kelsey war nicht auf Drogen«, verteidigte sie Lilly. »Nur ihre Mutter war süchtig.«
»Wie auch immer«, gab Sheila kopfschüttelnd zurück, als wären solche Details unwichtig. »Der springende Punkt ist doch, dass das Büro wegen solcher Sachen um ein Haar pleitegegangen wäre.«
»Wir haben aber nicht umsonst gearbeitet«, gab Lilly zu bedenken.
»Almosen von der Prozesskostenbeihilfe waren das, wie Sie sehr wohl wissen«, entgegnete Sheila. »Und was diese Schnorrer im Dog’s Home angeht, kann ich wirklich nicht verstehen, warum Sie sich um die kümmern.«
»Weil es meinen Intellekt stimuliert«, antwortete Lilly. »Aber das verstehen Sie nicht.«
»Ich verstehe, dass man Opfer bringen muss, wenn man Kinder hat.« Endlich zog Sheila ihren Arm wieder aus dem Schrank hervor. »Das steckte ganz hinten.« Sie warf ein Buch auf Lillys Schreibtisch. Die Kunst des positiven Denkens.
»Damit können Sie auch Ihren Intellekt stimulieren.«
Lilly ließ den Kopf auf den Schreibtisch sinken. »Muss ich wirklich mit denen was trinken gehen?«
Sheilas Lachen konnte man nur als grausam bezeichnen. »Rupinder sagt, es herrscht Fraktionszwang.«
Der Tag war entsetzlich gewesen. Ein Albtraum. Mr Peters hatte Luke angeschrien, weil er nicht aufpasste. Er würde seine Begabung verschwenden, und das sei kriminell. Am liebsten hätte Luke ihm gesagt, wie nahe das der Wahrheit kam.
In Informatik hatte er im Netz gesurft, um herauszufinden, wie lange man für Vergewaltigung sitzen musste – wie alt er sein würde, wenn er aus dem Gefängnis wieder herauskam. Als er sah, dass Strafen bis Lebenslänglich verhängt wurden, stockte ihm der Atem. Er hatte einmal einen Politiker im Fernsehen gesehen, der meinte, die Regierung sei zu nachgiebig. »Lebenslänglich sollte wirklich lebenslänglich bedeuten«, hatte der Mann gepredigt. Luke biss sich auf die Unterlippe, bis sie blutete, weil er solche Angst hatte, vor versammelter Klasse in Tränen auszubrechen.
Schlimmer noch – Tom hatte sich benommen, als wäre nichts passiert. Im Aufenthaltsraum hatte er sogar damit angegeben, er hätte ein »echtes kleines Flittchen« kennengelernt.
Die anderen Jungs lachten und meinten, er würde bestimmt mal wieder Scheiß labern.
Tom beugte sich über den Billardtisch und versenkte die schwarze Kugel.
»Fragt Lukey, der kann euch erzählen, wie die drauf war«, sagte er. »Hat drum gebettelt, stimmt’s?«
Luke lächelte schwach. In Gedanken hörte er das Mädchen immer noch schreien und sah ihre schmalen Handgelenke, die sich in Charlies Klammergriff blau-schwarz verfärbt hatten.
Jetzt klingelt es, und Luke kann endlich abhauen. Gott sei Dank übernachtet er heute nicht im Internat. Er möchte nach Hause, sich auf seine Arsenal-Decke werfen und alle viere von sich strecken. Vielleicht sollte er seiner Mum erzählen, was passiert ist. Vielleicht kann sie helfen. Und selbst wenn nicht, hört dann vielleicht der schlechte Film auf, der ständig wie auf Endlosschleife in seinem Kopf läuft.
Er sieht ihr Auto am Kricketfeld parken und rennt hin. Drinnen riecht es nach sauberer Wäsche.
Seine Mum lächelt. »Hattest du einen schönen Tag, mein Schatz?«
Er kriegt kein Wort heraus und kneift die Augen fest zusammen.
»Ist alles in Ordnung, Liebes?«, fragt seine Mum.
Mit schlappem Handgelenk rührt er seine Pasta um.
»Luke?«
Ihre Stimme klingt so sanft. Er fühlt sich entsetzlich mies.
Behutsam hebt sie sein Kinn und schaut ihm in die Augen. »Du würdest es mir doch sagen, wenn etwas nicht stimmt, ja?«
In ihrem vertrauten Gesicht sieht er ein Leben aus Naseputzen und Geburtstagsfeiern. Aber hier geht es nicht um eine zerbrochene Fensterscheibe oder eine schlechte Klassenarbeit. Wie soll er ihr sagen, was er mit angesehen, was er getan hat? Sie kann es nicht ungeschehen machen. Das kann niemand.
»Ich bin bloß müde«, stößt er mühsam hervor.
»Du siehst ein bisschen krank aus«, sagt sie und legt ihre kühle Handfläche auf seine Stirn. »Nicht heiß, aber es kommt mir vor, als würdest du irgendwas ausbrüten.«
Sofort schiebt er den Teller weg. »Ja. Ich fühl mich nicht gut.«
Erleichtert sieht seine Mutter ihn an. Damit kennt sie sich aus.
»Dann leg dich am besten hin, Liebes«, sagt sie. »Kommst du zurecht, solange ich deine Schwester abhole?«
Das Bild von Jessie, die ein Jahr jünger ist als Luke, erscheint vor seinem inneren Auge. Was, wenn irgendwelche Jungs sie in den Park schleppen würden … sie festhalten und …
Er springt auf, rennt aus dem Zimmer, die Hand auf den Mund gepresst, und Galle quillt zwischen seinen Fingern hervor.
Sein Zimmer dreht sich, und Luke konzentriert sich auf einen kleinen braunen Wasserfleck an der Decke.
»Bin in zwanzig Minuten wieder da«, ruft seine Mum von unten. »Wie wäre es, wenn ich bei Waitrose ein bisschen Lucozade für dich hole?«
Aber Luke antwortet nicht.
Als er die Haustür ins Schloss fallen hört, lässt er den Tränen freien Lauf, rollt sich zusammen und weint, bis ihm der Rotz aus der Nase auf die Lippen trieft. Und dann wird ihm plötzlich klar, was er tun muss.
Er wischt sich mit dem Handrücken über die Augen und packt seine Tasche.
Lilly hatte es versucht, ganz ehrlich. Sie hatte den Mantel übergezogen und wirklich vorgehabt, sich auf den Weg in die Bar zu machen, wo ihre Chefin und die anderen Partner der Firma auf sie warteten. Aber als es dann so weit war, machte sie plötzlich eine scharfe Rechtskurve und hüpfte hastig in ihren neuen Mini Cooper.
Als sie die A5 hinunterbrauste, holte sie das Handy heraus.
»Rupes, ich bin’s. Tut mir leid, dass ich es nicht in den Pub geschafft habe, aber ich muss Sam abholen. Er hat mir gedroht, dass er auszieht, wenn er nach der Schule noch mal in den Hort muss.«
Es stimmte, dass Sam nicht gern mit den Internatsschülern spät in der Schule blieb. Angeblich miefte es im Aufenthaltsraum, und man kriegte zum Tee im Speiseraum immer dasselbe. »Keine Ahnung, wie die das machen, Mum, aber egal, an welchem Tag man hingeht, es gibt immer Mince Pies«, erklärte er. »Die geben ihnen natürlich unterschiedliche Namen, aber darauf fällt längst keiner mehr rein.«
Rupinder sagte nichts. Aber Lilly konnte sich genau vorstellen, wie sie die Lippen schürzte und versuchte, die Sache auf die leichte Schulter zu nehmen. »Du kannst mich morgen zur Schnecke machen und sparst das Geld für ein Pint.«
»Setz deinen Arsch in Bewegung und mach, dass du hierherkommst.«
Lancasters hatte schon wieder den Besitzer gewechselt. Jetzt war es ein Franchiseunternehmen eines bekannten Kochs aus dem Londoner West End, neu gestylt als Gastro-Pub. Dafür bekam man salbeigrüne Wände von Farrow & Ball und Steaks für fünfzehn Pfund das Stück. Wie üblich war das Lokal fast leer.
Rupinder und die anderen hatten sich am hinteren Ende der Bar versammelt. Lilly hörte das Ploppen eines Sektkorkens, und ihr wurde flau im Magen. Hatte sie vielleicht etwas Wichtiges nicht mitgekriegt? Hatte heute womöglich jemand Geburtstag?
»Was feiern wir denn überhaupt?«, rief sie bemüht heiter.
Rupinder reckte ihr Glas in die Höhe. »Deine Zulassung zu höheren Gerichten. Du hast die Prüfung bestanden.«
Vor ein paar Monaten war Rupinder von ihren Kollegen unter Druck gesetzt worden, Lilly rauszuschmeißen, weil sie erstens kein Blatt vor den Mund nahm und zweitens die Neigung hatte, Fälle anzunehmen, die zu wenig Geld für die Altersversorgung der Anwälte einbrachten. Rupinder hatte Widerstand geleistet, sich aber bereit erklärt, ihre Kosten zu senken. Eine Maßnahme zu diesem Zweck war, dass kein Geld mehr für Barristers verschwendet werden und dass Lilly soweit wie möglich ihre eigene Advokatur übernehmen sollte.
»Wow«, sagte Lilly. In der Flut ihrer Scheidungsfälle hatte sie tatsächlich die Prüfungen vergessen, die sie im Sommer abgelegt hatte.
»Das kann man wohl sagen«, bestätigte Rupinder, wenn auch in kaltem Ton. Offensichtlich hatte sie Lilly ihren Fluchtversuch noch nicht verziehen. »Herzlichen Glückwunsch.«
Sheila leerte ihr Glas und füllte es aus der Doppelmagnum nach, ohne das Glas schräg zu halten, so dass der teure Schaum überquoll und am Stiel hinunterfloss.
»Ich vermute, dass du dich jetzt noch weniger im Büro aufhalten wirst«, sagte sie. »Und ich bin die Dumme, die den ganzen zusätzlichen Papierkram aufgehalst kriegt.«
»So hat doch alles seine guten Seiten«, meinte Lilly.
»Vielleicht könnten wir mal unsere Differenzen beiseite lassen und uns wie ein Team benehmen«, sagte Rupinder streng. »Ausnahmsweise.«
Lilly machte sich auf eine Moralpredigt gefasst, aber ihr Handy rettete sie. »Ich hab euch doch gesagt, dass Sam einen Hals schieben würde, wenn ich nicht auftauche.«
Da Rupinder ein erfreulich betretenes Gesicht machte, erwähnte Lilly nicht, dass Sam erst in einer Stunde mit dem Fußballtraining fertig war.
Sie entfernte sich ein Stück von den anderen.
»Miss Valentine?«
»Ja, am Apparat.«
»Ich arbeite im Hound’s Place und wollte Sie fragen, ob Sie wohl Zeit hätten, mit einem unserer Bewohner zu sprechen.«
Lilly schielte zu Rupinder hinüber und schnitt ihre beste zerknirschte Eltern-Grimasse. »Ja, ich bin gleich da.«
Das englische Volk hat genug! Blood River, 15:05
Dieses Land war ein Land, auf das wir stolz sein konnten.
Auf der ganzen Welt genoss unsere Nation Ansehen und Respekt.
Die Menschen wussten, wer sie sind.
Können wir das ehrlicherweise immer noch für uns in Anspruch nehmen?
Das englische Volk hat genug! Skin Lick, 15:12
Nein, leider nicht.
Das Land geht vor die Hunde, weil wir uns dauernd für irgendwelche Ausländer krummlegen.
Das englische Volk hat genug! Snow White, 15:15
Was mich wirklich nervt, ist, wenn man die Straße entlangspaziert, und jeder Zweite, der einem begegnet, ist ein Einwanderer. Letzte Woche bin ich in London in den Zug gestiegen und habe ungefähr zwanzig verschiedene Sprachen gehört. Da hab ich mich gefragt, wo ich eigentlich bin …
Das englische Volk hat genug! Skin Lick, 15:22
Ich weiß, was du meinst, Snow White. In meiner Stadt gibt es drei Moscheen. Drei!!!
Wir leben doch echt in Englastan.
Das englische Volk hat genug! Snow White, 15:26
Ich hab gelesen, dass die Kinder in manchen Schulen gezwungen werden, Eid und Diwali zu feiern, aber einander keine Weihnachtskarten schicken dürfen. Ich möchte nicht, dass meine Kinder so aufwachsen.
Das englische Volk hat genug! Skin Lick,15:38
Das ist ein Skandal.
Die weißen Eingeborenen dieses Landes werden bald eine Minderheit sein, und dann verlieren wir unser Erbe und unsere Kultur.
Wir können uns darauf gefasst machen, dass wir uns bald von Ostern, Silvester und Bonfire Night verabschieden müssen.
Das englische Volk hat genug! Blood River, 15:46
Ich persönlich bin nicht bereit, all das zu opfern, was mir lieb und wert ist.
Die Masseneinwanderung war eine Katastrophe, und es muss endlich Schluss damit sein.
Unser Land ist mit Fremden längst übersättigt.
Schreibt an eure Abgeordneten, dass ihr es nicht mehr toleriert, in eurer eigenen Heimat Bürger zweiter Klasse zu sein.
Boykottiert die Läden von Einwanderern.
Lasst stolz die Fahne mit dem Georgskreuz wehen.
Snow White klappte ihren Laptop zu. Sie hasste es, aus einer Live-Diskussion auszusteigen, aber sie musste die Hemden ihres Mannes aus der Reinigung holen. Sie sah auf die Uhr. Wenn sie nicht trödelte, schaffte sie es sogar noch schnell zum Fleischer und war trotzdem rechtzeitig zum Live-Podcast wieder zu Hause.
In Manor Wood hatte man ein Wohnheim eingerichtet, ungefähr eine halbe Meile von Sams Schule entfernt. Das Gebäude, Hound’s Place, war früher einmal eine Polizeistation gewesen, aber von einem Immobilienmakler aufgekauft worden, der das Potential des Gebäudes als Ausländerwohnheim erkannte: In jedes Zimmer konnte er mühelos fünf verzweifelte Flüchtlinge quetschen.
In einem kleinen Dorf wie Manor Wood war der Zustrom von fast dreißig Ausländern nicht mit ungetrübter Begeisterung aufgenommen worden. Die berühmte Gastfreundlichkeit der englischen Landbevölkerung schien sich nicht auf den Zigeunerhaufen junger Männer und Frauen zu erstrecken, die alles hinter sich gelassen und aufs Spiel gesetzt hatten, um ihre vom Krieg zerrütteten Heimatländer zu verlassen.
Lilly hatte Rupinder gebeten, sie zwei vierzehnjährige Jungs vertreten zu lassen, die vor den Taliban geflohen waren. Ohne Verwandtschaft in Großbritannien ging ein Fürsorgeauftrag ohne große Umstände durch, so dass Lilly so gut wie keine Zeit investieren musste. Doch aus zwei Jugendlichen wurden vier, dann kam ein Teenager aus Bosnien und einer aus Uganda. Obwohl Lilly die steigende Anzahl ihrer Schützlinge wohlweislich für sich behielt, vertrat sie inzwischen mindestens die Hälfte der in Hound’s Place untergeschlüpften Kids. Aber ihre Energie reichte ja locker für sie alle, sagte sie sich, als sie jetzt einen Blick auf die Uhr warf.
Sobald sie über die Schwelle trat, kam ein junger Mann im Karohemd auf sie zu.
»Hallo, Artan«, begrüßte Lilly ihn.
Mit seinen vollen Lippen und den tiefschwarzen Wimpern hätte er eigentlich ein gutaussehender Kerl sein müssen, aber irgendetwas an ihm verunsicherte Lilly immer. Seine ganze Familie war im Kosovo ums Leben gekommen, und er machte trotzdem nie einen wütenden, traurigen oder auch nur verwirrten Eindruck. Er wirkte seltsam kalt.
»Wie geht es dir?«, fragte sie.
Artan schüttelte den Kopf, um zu zeigen, dass etwas nicht in Ordnung war. »Ich muss mit Ihnen sprechen.«
»Ich habe genau zwanzig Minuten«, sagte Lilly.
Sie gingen in die Küche, und die wenigen Bewohner, die hier herumgesessen und geplaudert hatten, standen auf und verließen wortlos den Raum. Irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht.
»Bist du mal wieder verhaftet worden, Artan?«, fragte Lilly. Vor einem Monat hatte man ihn beim Klauen erwischt, aber dank Lilly hatte man ihn mit einer Verwarnung davonkommen lassen.
»Nein, nein, nichts in der Art.« Seine Augen waren ausdruckslos, ohne den geringsten Hinweis darauf, was sich unter ihrer Oberfläche abspielte.
»Bist du in Schwierigkeiten?«, fragte sie.
»Einer Freundin von mir ist was passiert«, erklärte er.
»Was Schlimmes?«
»Etwas sehr, sehr Schlimmes.«
In Lillys Kopf klingelten die Alarmglocken. »Ist sie verletzt?«
»Ja, sie ist verletzt«, antwortete Artan.
Jetzt war es kein Klingeln mehr, sondern ein Dröhnen. Die Dreiminutenwarnung.
»Und?«, fragte sie.
»Ein paar Jungs aus dem Dorf haben sie überfallen.«
»Du meinst, die haben sie vergewaltigt?«
Artan nickte.
»War sie bei der Polizei?«, fragte Lilly.
»Das ist nicht so einfach«, erwiderte Artan. »Sie vertraut der Polizei nicht.«
Lilly nickte. Trotz Spezialeinheiten und Taskforces wurden die meisten Vergewaltigungen nach wie vor nicht gemeldet, und bei Flüchtlingen war es sogar noch unwahrscheinlicher, dass sie auch nur versuchten, sich bei der Polizei zu melden.
»Sie meint, dass die Polizei ihr nicht glauben wird«, erklärte Artan.
»Warum nicht?«
»Sie hat mit den Dorfjungs Alkohol getrunken und ist mit ihnen in den Park gegangen«, antwortete er. »Die werden sagen, sie wollte Sex.«
»Warum ist sie denn mit ihnen gegangen?«, fragte Lilly.
»Weil sie nicht klar denken kann«, sagte er.
Eine Weile schwiegen sie beide. Lilly wusste, dass alle die Jugendlichen im Heim schreckliche Dinge durchgemacht hatten. Dass keiner von ihnen unversehrt war.
»Können Sie mir versprechen, dass diese Jungs verurteilt werden?«, fragte Artan schließlich.
»So etwas kann niemand versprechen.«
Er beugte sich zu ihr und senkte die Stimme. »Gibt es wenigstens eine gute Chance?«
Lilly wog ihre Worte sorgfältig ab. »Vergewaltigung ist eines der am schwersten beweisbaren Vergehen, und in einem Fall wie diesem, wo das Wort des Mädchens gegen drei vorgeblich blitzsaubere Schuljungen steht, wäre es noch schwieriger.«
Artan schloss die Augen, sein Atem ging langsam und schwer.
Lilly schauderte. »Aber damit will ich nicht sagen, dass sie es nicht melden soll.«
»Warum?« Seine Stimme war kaum hörbar. »Damit sie immer wieder gedemütigt werden kann?«
Als er die Augen wieder öffnete, sahen sie noch hoffnungsloser aus als vorhin.
»Tut mir leid«, sagte Lilly und meinte für einen Augenblick Wut in seinem Gesicht zu erkennen.
»Wir sind keine Tiere«, sagte er. »Diese Jungs müssen bestraft werden.«
Vierundzwanzig Pfund.
Das war doch der reinste Diebstahl, wie man hier das Geld aus der Tasche gezogen bekam.
Aber es war das beste Bio-Rindfleisch von Kühen, die frei auf einem Bauernhof in Sussex herumlaufen durften. Mr Simms hatte sogar Fotos von den »Mädels« über der Theke hängen, rehäugig und mit Glocken um den Hals. Einige Kunden fanden das etwas übertrieben, aber Snow White hatte daran nichts auszusetzen. Ihr Grandpa hatte Hühner gehabt und ihnen vor ihren Augen zum Sonntagslunch die Gurgel durchgeschnitten. Das verdammte Gekreische hatte sie immer noch in den Ohren.
Heutzutage hatten die Leute einfach keinen Respekt mehr vor der Herkunft ihres Essens. Sie wollten immer nur alles sauber und in Plastikfolie verpackt.
Doch Snow White hatte ihren Kindern beigebracht, dass das Leben nicht so war. Als ein Fuchs einmal ihre sämtlichen Kaninchen geholt hatte, hatte sie ihnen befohlen, mit der Heulerei aufzuhören, war mit ihnen bis Mitternacht aufgeblieben und hatte den Räuber, der prompt wieder auftauchte, mit ihrer Schrotflinte erledigt. »Manchmal muss man sich eben die Hände schmutzig machen.«
Sie legte das Fleisch in den Kühlschrank und loggte sich auf ihrem Laptop ein.
Willkommen Snow White – in fünf Minuten beginnt der heutige Live Podcast!
Wunderbar. Sie hatte also noch nichts verpasst.
Vor sich hin summend machte sie sich eine Kanne Darjeeling.
Lillys Herz war noch schwer von dem, was sie gehört hatte. Als sie zur Schule ihres Sohns abbog, hätte sie um ein Haar einen Mercedes gerammt, und die Fahrerin hupte laut. Lilly hätte ihr gern den ausgestreckten Mittelfinger entgegengehalten, aber so eine Geste galt unter den Mittelklasse-Eltern, bei denen Lilly sowieso nicht sehr viele Freunde hatte, als ungehobelt, vulgär und absolut unverzeihlich.
Gerade wollte sie sich wieder einmal dafür beschimpfen, dass sie sich beim Thema Schule von ihrem Exmann hatte beschwatzen und umstimmen lassen, als ihr Handy klingelte.
Die Stimme war einschmeichelnd wie irischer Honig. »Hallo, Hübsche. Hast du Zeit für ein Schwätzchen?«
Es war Jack McNally, ein Polizist, den Lilly schon seit Jahren kannte und mit dem sie fast von Anfang an geflirtet hatte. Aber bis zu den ersten Annäherungsversuchen hatte es ganz schön lange gedauert.
»Was hast du an?«
Lilly lachte. »Ich würde gern behaupten, dass ich mich hier in Bustier und Netzstrümpfen rumtreibe.«
Eine vorübereilende Mutter rümpfte die Nase.
»Aber?«, sagte Jack. »Ich ahne da ein Aber.«
»Um ehrlich zu sein, hole ich gerade Sam vom Fußballtraining ab, und nicht mal ich wäre unverschämt genug, hier in Unterwäsche aufzulaufen.«
»Du möchtest ja auch die ganzen Supermuttis nicht neidisch machen«, meinte er.
»Jetzt wird mir doch mal wieder klar, warum ich dich mag.«
Lilly schlenderte zum Fußballplatz, wo Sam im Tor stand und sich gerade bereitmachte, einen Elfmeter zu halten. Obwohl es nur Training war, wagte Lilly kaum hinzuschauen. »Und wie geht es dir so?«
»Wie immer, wie immer«, antwortete er.
»Ohhh«, stöhnte Lilly, als Sam den Ball mit aller Kraft aus dem Tor schlug. Sogar von der Seitenlinie konnte man hören, wie das Leder auf seine Haut knallte. Für einen Neunjährigen war es natürlich total uncool, Schmerz zu zeigen, aber eine mittelalte Mutter konnte es sich nicht verkneifen.
»Alles klar bei dir?«, fragte Jack etwas besorgt. »Du klingst irgendwie unkonzentriert.«
»Kurz bevor du angerufen hast, hatte ich eine komische Begegnung.«
»Komisch haha oder komisch sonderbar?«
»Komisch beunruhigend«, antwortete sie. »Ein Mädchen aus dem Wohnheim ist vergewaltigt worden.«
»Eine von den Asylbewerberinnen?«
»Ja. Ihr Freund wollte von mir wissen, was passieren würde, wenn sie die Polizei einschalten.«
»Und?«, bohrte Jack nach.
»Ich hab ihm die Wahrheit gesagt.«
Der Schiedsrichter blies in seine Trillerpfeife, und zehn Jungs rannten auf Sam zu, der ganz eindeutig der Retter in der Not gewesen war.
»Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Dass er womöglich irgendeine Dummheit macht«, sagte Lilly.
Als Profi, der er war, klang Jacks Stimme ernst und sachlich. »Was denn zum Beispiel?«
Lilly winkte ihrem Sohn zu, der feierlich seinen Gegenspielern die Hand gab und dann, wild mit den Armen wedelnd, auf Lilly zugerannt kam.
»Ich weiß nicht, vielleicht gar nichts. Vergiss es einfach.«
»Das klingt aber nicht, als sollte man es vergessen, Lilly.«
Jetzt war Sam fast bei ihr. »Du weißt doch, dass ich gelegentlich überreagiere. Wahrscheinlich war er einfach nur aufgebracht. Verständlicherweise.«
»Lilly, das ist keine Überreaktion«, beharrte Jack. »Du hast einen hervorragenden Instinkt, und wenn du meinst, dass da irgendwas im Busch ist, musst du mit jemandem reden.«
»Das werde ich auch. Na ja, erst muss ich mir alles noch mal durch den Kopf gehen lassen.« Sam warf sich in ihre Arme und holte sie fast von den Füßen. »Hör mal, ich muss Schluss machen. Unser Fußballstar braucht seinen Tee.«
Ein herzliches Willkommen an alle Mitglieder. Die heutige Diskussion leitet unser regelmäßiger Teilnehmer Nigel Purves.
Snow White trank einen Schluck Garibaldi-Wein und machte es sich gemütlich. Nigel war immer interessant.
»… ich möchte heute über Vielfalt sprechen, und ich möchte, dass alle sich einmal fragen, ob das eine gute Sache ist oder eher nicht.«
Snow White tunkte ihren Keks ein und lächelte den Bildschirm an. Nigel war ein redegewandter Mann, der mit einer Klarheit und Überzeugung seine Meinung darstellte, die den meisten Politikern bedauerlicherweise fehlte. Und er wusste, wie man Anzug und Krawatte trug.
»… Oberflächlich betrachtet erscheint uns Unterschiedlichkeit vielleicht als etwas Positives – wer möchte denn schon, dass alles gleich ist? Abwechslung ist das Salz in der Suppe, richtig?
Aber treten wir einmal einen Schritt zurück und fragen wir uns, was eine Familie so besonders macht.«
Snow White griff nach einem Ingwerkeks. Nigel war in Höchstform.
»Ist es nicht der Umstand, dass alle aus demselben Holz geschnitzt sind? Dass sie Dinge gemeinsam haben? Dass sie eine homogene Gruppe sind?«
Nigel fuhr sich mit der Hand durch die Haare, die graumeliert, aber noch voll waren.
»Was auch immer man uns einreden möchte – es ist einfach unsere Natur, dass wir die Gesellschaft von unseresgleichen suchen. Vielleicht halten manche das für rassistisch. Aber ich nenne es gesunden Menschenverstand …«
»Mum, ich bin am Verhungern.«
Mist. Snow White stellte den Podcast ab.
»Was gibt’s zu essen?«
Die Mädchen waren früh zu Hause. Dann musste Nigel eben warten.
»Es gibt Scones«, sagte sie. »Oder Crumpets. Sucht euch was aus.«
»Ich habe einen Bekannten, der jemanden kennt. Der besorgt dir, was du brauchst.«
Artan nickt und gibt dem Albaner das Geld.
Er stellt keine Fragen. Er weiß auch, dass er keine Antwort kriegen würde. Seit er mit der Anwältin geredet hat, kann er an nichts anderes mehr denken.
Diese Jungs müssen bezahlen.
Kapitel 2
»Kommst du auch mit, Mum?«
Lilly schaute von der Spülschüssel auf und lächelte ihrem Sohn zu. »Ja klar, Sam.«
Er stopfte den letzten Löffel Porridge in den Mund und strahlte sie an. »Aber manchmal wirst du bei der Arbeit aufgehalten.«
»Im Büro hab ich schon alles geregelt und mit einem dicken roten Stift im Terminkalender vermerkt, dass ich nicht da bin.«
»Aber bei den großen Kinderfällen passiert doch manchmal was Unvorhergesehenes«, gab er zu bedenken.
»Du weißt doch, dass ich die nicht mehr mache«, erwiderte sie. »Und wie könnte ich das Halbfinale verpassen?«
Beruhigt packte Sam seine Sporttasche und drei Bananen zusammen. »Damit ich Energie habe«, erklärte er.
Da sie kein Geschirrtuch finden konnte, wischte sich Lilly die Hände am Pulli ab. Seifenschaum sammelte sich über ihrem Brustkorb, und als sie die Bläschen mit dem Ellbogen abzuwischen versuchte, verschmierte sie alles nur noch mehr. »Verdammt.«
»Warum kaufst du denn keine neue Spülmaschine, Mum?«, fragte Sam.
»Das werde ich schon noch«, sagte sie, griff nach ihrem Autoschlüssel und wollte die Haustür öffnen. Aber so sehr sie auch zerrte, die Tür rührte sich nicht vom Fleck. Durch die Novemberfeuchtigkeit war das Holz aufgequollen, und die Tür klebte am Rahmen fest, als wäre sie einbetoniert. Erst als Lilly sich mit dem Fuß an der Wand abstützte und noch einmal mit aller Kraft zog, öffnete sich ein etwa dreißig Zentimeter breiter Spalt, und Lilly scheuchte ihren Sohn hinaus.
»Es muss eine Menge repariert werden in unserem Haus, stimmt’s?«, erkundigte sich Sam.
Lilly quetschte sich durch die Lücke und ging wieder in Stellung, diesmal mit dem Stiefelabsatz an der Außenwand des Cottages. Dann warf sie sich nach hinten, die Tür knallte zu, und vom Dach der Veranda regnete der Putz.
»Na ja, vielleicht so ein, zwei Kleinigkeiten«, antwortete sie und schüttelte das Mauerwerk aus den Haaren.
»Wenn ich erst mal bei Liverpool spiele, bin ich reich«, sagte Sam. »Aber vermutlich brauchen wir das Geld jetzt gleich.«
Sie warfen ihre Taschen auf den Rücksitz und stiegen in den Mini. »Keine Sorgen, Großer, die Scheidungsfälle zahlen gut.«
»Aber du magst sie nicht, stimmt das, Mum?«
Das neue Auto schnurrte los. »Ach, das ist schon okay.«
»Und was ist mit den Kindern, denen du früher immer geholfen hast?«, fragte er.
Lilly seufzte. »Die vertritt jetzt eben jemand anderes.«
»Und das macht dir echt nichts aus?«
Lilly lächelte und fuhr los.
Als sie Sam vor der Schule absetzte, vergewisserte er sich noch einmal, dass sie zum Spiel da sein würde.
»Ja, natürlich«, lachte sie. »Und ich hab hier was für dich.« Sie überreichte ihm eine Plastiktüte und beobachtete mit großem Vergnügen, wie sich die Freude auf dem Gesicht ihres Sohns ausbreitete, als er die nagelneuen Nike-Torwarthandschuhe auspackte.
Die Bank ist hart und kalt, aber Artan ist darauf vorbereitet, den ganzen Tag zu warten. Anna lehnt sich an ihn, die Wange an seiner Brust, den knochigen Arm um seine Taille.
Sie halten Ausschau nach den verräterischen grünen Blazern, an denen man die Jungs aus Manor Park von den Jungs aus der Nachbarschaft hier unterscheiden kann.
»Sag Bescheid, wenn du sie siehst«, sagt er.
Sie nickt, und ihre Wange streicht über den Reißverschluss seiner Jacke. Zwei Jungen in Kapuzenjacken turnen auf der Straße herum und tun so, als würden sie Karate-Kicks landen. Ein paar Freunde feuern sie an und werfen ihnen Süßigkeiten und Chips zu. Als sie die beiden Fremden auf der Bank entdecken, werden sie unruhig.
»Was gibt’s denn da zu glotzen?«
Artan antwortet nicht, aber sein Gesichtsausdruck vertreibt die anderen Jungen.
Er spürt, wie sich Annas Körper neben ihm verkrampft.
»Was?«
»Da«, sagt sie, und sieht zu vier Jungens in Grün hinüber.
Er folgt ihrem Blick. »Bist du sicher?«, fragt er.
Anna nickt. »Der mit den dunklen Haaren und der Rothaarige.«
»Ich dachte, du hast gesagt, es waren drei.«
»Stimmt«, antwortet sie. »Aber der Dritte ist nicht dabei.«
Sie schauen zu, wie die Manor-Park-Jungs sich etwas zu trinken kaufen und folgen ihnen dann in sicherem Abstand.
Den ganzen Weg albern die vier miteinander herum. Der Rothaarige hat eindeutig das Sagen. Seine Stimme ist am lautesten, und er boxt seinen Freund ein bisschen zu heftig in den Oberarm. Als der aufjault, lacht er ihm ins Gesicht und nennt ihn »schwul«.
»Er erinnert mich an Gabi«, sagt Anna.
»Du sollst doch diesen Namen nicht sagen.«
Anna schmiegt sich an ihn. »Entschuldige.«
Aber er schiebt sie weg und legt die Hand an den Revolver. Er fühlt sich vertraut an, wie ein alter Freund.
Jack rannte, der Rhythmus seiner Füße eine Trommel in seinem Kopf. Eins, zwei, drei, vier. Unbarmherzig. Aber seltsam beruhigend.
Vor sechs Monaten hatte er angefangen zu joggen, weil der Arzt ihm gesagt hatte, dass sein Blutdruck an der Grenze dessen lag, was man als gefährlich erachtete. Außerdem hatte der Arzt ihm noch gesagt, er sollte das Trinken einschränken, aber man konnte ja nicht alles auf einmal machen.
Er patschte durch Pfützen und Öllachen, ohne auf den Schlamm zu achten, der ihm an die Waden spritzte, ganz auf seinen Atem konzentriert. Eins, zwei, drei, vier. Eigentlich hatte er erwartet, dass das Laufen seine Anziehungskraft verlieren würde, sobald der Sommer vorbei war, aber merkwürdigerweise fand er die grauen Straßen sogar noch verlockender.
Inzwischen hatte er schon über sechs Kilo abgenommen, was eine Leistung war, wenn man daran dachte, wie gut Lilly kochte. Er lächelte beim Gedanken daran, wie sie genüsslich den Kuchenteig vom Rührlöffel ableckte.
Nachher wollte er sie anrufen und fragen, ob sie und Sam vielleicht Lust hatten, heute Abend einen Film auszuleihen. Gestern war sie so unaufmerksam gewesen, wahrscheinlich aus Sorge wegen dem Jungen aus dem Wohnheim. Sie engagierte sich immer hundertprozentig für die Kids, für die sie arbeitete. Nahm sich alles zu Herzen. Es würde ihr guttun, sich weniger von dieser Art Arbeit aufzubürden.
Plötzlich fiel ihm ein, dass Sam heute Nachmittag ein Fußballmatch in der Schule hatte. Vielleicht sollte er Lilly doch nicht anrufen. Sondern sie lieber überraschen …
Jack beobachtete Lilly, die gegen die Kälte mit den Füßen stampfte. Die meisten anderen Mütter trugen grüne Gummistiefel und Daunenjacken. Kaschmirschals. Aber Lilly war offensichtlich direkt von der Arbeit hergekommen und trug ihr Kostüm und Stiefel mit Ledersohlen. Sie sah halb erfroren aus, wie sie da von einem Fuß auf den anderen trat. Das Spielfeld lag nach allen Seiten offen, und der Wind fegte ungehindert darüber hinweg.
»Für das Geld, das ihr hier bezahlt, sollte man euch eigentlich besseres Wetter garantieren.«
Lilly lächelte Jack an. »Woher wusstest du, dass ich hier sein würde?«
»Na, ich hab natürlich dein Telefon angezapft.«
Sie lachte, und ihr Atem bauschte sich in dicken Wolken um ihr Gesicht.
»Ich hoffe, es stört dich nicht«, sagte er. »Dass ich hier bin, meine ich, nicht das Abhören.«
Sie hakte sich bei ihm ein. »Aber nein. Und Sam wird begeistert sein, dich zu sehen.«
»Wo ist der kleine Mann denn?«
»In fünf Minuten geht es los. Wenn wir dann noch nicht erfroren sind.«
Er zog seine Lederjacke aus und legte sie ihr um die Schultern. »Du brauchst einen richtigen Mantel bei dem Wetter, Lilly.«
»Ja, Dad.«
Jetzt fror Jack, aber es hätte ihm kaum gleichgültiger sein können. Er stand neben seiner Freundin, einer supertollen Frau, und sah ihrem Sohn beim Fußballspielen zu. Das fühlte sich an wie … Er wagte es kaum zu denken, aber es fühlte sich an wie Familie.
Immer mehr Eltern trudelten ein, und auch Jungs aus den höheren Klassen kamen, um die Kleinen anzufeuern. Ein paar alberten herum, lachten und blökten, und der Größte der Truppe fand sich offenbar trotz seiner krausen karottenroten Haare unwiderstehlich. Er streckte den Brustkorb vor wie ein Rotkehlchen, und aus jeder Pore strömte Arroganz. Jack hoffte, dass Sam nie so werden würde, sagte aber nichts. Lilly quälte sich sowieso schon wegen dieser Privatschule, aber ihr Exmann bestand darauf, dass Sam hier gut aufgehoben war. Und Jack war zu klug, um sich einzumischen.
Die Hecke ist schütter, der Herbst hat sie in ein dürres Skelett verwandelt. Mühelos bahnen sie sich einen Weg hindurch, treten auf die Wiese hinaus und wandern übers Gras.
Artan blickt zum Hauptgebäude hinüber. Eine Villa aus glattem braunem Stein, mit Efeu bewachsen, die hölzernen Fensterrahmen frisch weiß gestrichen. Ist das wirklich nur eine Schule?
Links stehen drei Buchen, die dabei sind, die letzten Blätter abzuwerfen, der Boden unter ihnen ein Teppich aus Bronze und Gold.
Ein uniformierter Mann saugt das Laub mit einer Maschine weg, die er in der Hand hält.
»Was ist das?«, flüstert Anna.
»Ein Staubsauger«, antwortet Artan kopfschüttelnd. »Ein Staubsauger für Blätter.«
Manchmal staunt er immer noch über dieses Land. Zu Hause hatte seine Mutter nicht mal einen normalen Staubsauger für die Wohnung. Sie hat mit einem alten Besen ausgefegt, genau wie es ihre Mutter vor ihr getan hat.
»Diese Menschen«, sagt er. »Diese Menschen haben keine Ahnung, wie gut es ihnen geht.«
»Schnell, ehe uns jemand sieht«, sagt sie leise.
Sie marschieren auf ein Nebengebäude zu, aber es ist zu spät.
»He!«, ruft der Mann. »He, ihr beiden!« Schon legt er den Laubsauger weg und stapft auf sie zu. »Was habt ihr denn hier zu suchen?«
Artan breitet die Arme aus. »Sorry. Englisch nicht gut.«
»Verstehe«, sagt der Mann. »Ihr seid von der Agentur. Na ja, und spät dran.«
Artan und Anna erstarren. Was ist eine Agentur?
»Ihr seid zum Arbeiten hier?«, fährt der Mann unbeirrt fort und tut so, als würde er fegen.
Wieder muss Artan an seine Mutter denken und lacht.
»Richtig«, sagt der Mann und deutet auf einen Schuppen. »Holt euch einen Rechen und kommt dann wieder her.«
»Rechen«, wiederholt Artan.
»Genau. Bewegt euch.« Der Mann schubst Artan ins Kreuz. »Verdammte Ausländer.«
Artan lächelt weiter, aber seine rechte Hand hat sich wieder ganz fest um den Revolver gelegt.
Die Menge applaudierte. Kein frenetischer Beifall, sondern nur ein wohlwollendes Klatschen, aber Sam lächelte trotzdem.
Lilly winkte ihrem Sohn zu, und als er Jack neben ihr erkannte, strahlte er übers ganze Gesicht.
Lag es an ihrer Beziehung zu Jack, dass die Streitereien mit David, wer wem was angetan hatte, endlich aufgehört hatten? Oder war es der Anblick von Davids neuer Freundin mit ihren müden, rot geränderten Augen, völlig erschöpft, weil ihre kleine Tochter zahnte, der den alten Groll vertrieben hatte?
Die Dinge fühlten sich einfach richtig an. Irgendwie neu.
Lilly lachte über ihren geistigen Höhenflug.
Das gegnerische Team von der Dorfschule gewann die Seitenwahl, und das Spiel begann.
»Auf geht’s, Manor Park«, rief Lilly.
»Yeah«, rief einer der Internatsschüler. »Zeigen wir den Prolls, was wir können!«
Lilly tat so, als hätte sie nichts gehört, sah aber ein paar Elternteile aus Manor Park zustimmend lächeln. Warum mussten diese Leute sich nur immer so aufblasen? Warum mussten sie auf andere herabschauen, nur weil die vielleicht etwas weniger Geld hatten?
»So schlecht war der Ball doch gar nicht«, sagte Jack.
»Was?«
»Der Pass war schlecht getimed, da hast du recht, aber die Jungs sind doch auch erst neun.«
Ein unverhohlener Versuch, sie abzulenken. Lilly lachte und schmiegte die Wange an Jacks Schulter.
Von der anderen Seite schlenderte ein Elternpaar auf das Spielfeld zu. Sie waren zu spät dran und bekämen von ihrem Sohn nach dem Spiel bestimmt ordentlich eins aufs Dach. Als sie näher kamen, sah Lilly, dass beide Overalls trugen, also waren es gar keine Eltern, sondern Gartenpersonal. Die Schule hatte eine ganze Armee von Angestellten, die sich um das Mähen des Grases und ähnliche Wartungsarbeiten kümmerten.
»Sehr gut gehalten!«, rief Jack, und Lilly wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Spiel zu.
»Was ist passiert?«
»Nummer acht ist über den Flügel super aufs Tor zugelaufen und hat den Ball direkt ins linke Eck geschlenzt, aber Sam ist grade noch mit den Fingerspitzen drangekommen.«
»Seit wann bist du denn Fußballfachmann?«, grinste Lilly.
»Du dachtest wohl, ich bin eher der Rugby-Typ, was?«
»Nein, ganz bestimmt nicht!«, prustete Lilly.
»Was dann?«
Lilly tat so, als taxierte sie ihn mit ernster Miene. »Fliegenfischen?«
»Ach, vergiss es, Mädel«, winkte er ab, schob sie mit einer Hand weg und holte sie mit der anderen zurück. »Ich bin einfach zu sportlich für dich.«
»Sportlich?«
Jack ließ einen nicht wirklich existierenden Bizeps spielen. »Nichts als Muskeln.«
»Klar, vom Bierglasstemmen«, grinste Lilly.
Gerade wollte sie noch etwas hinzufügen, als ihr wieder das Paar mit den Overalls ins Blickfeld geriet. Sie waren ungefähr hundert Meter entfernt stehen geblieben und steckten die Köpfe zusammen, ganz in ein Gespräch vertieft. Ihre dichten, glänzenden Haare hatten die gleiche kastanienbraune Farbe und tanzten leise im Wind. Auf einmal zog der Mann die Frau an sich. Nicht wie ein Liebespaar, sondern besitzergreifend – eher wie Vater und Tochter. Oder großer Bruder und kleine Schwester. Er umarmte sie, als hätte er Angst, sie könnte zerbrechen. Und sie überließ sich ihm rückhaltlos.
Als die Frau den Kopf zur Seite drehte, sah Lilly, dass sie sehr jung, sehr schön und sehr, sehr verängstigt war.
Jack spürte ihre Anspannung sofort.
»Alles klar mit dir?«
»Ich weiß nicht«, antwortete sie.
Er folgte ihrem Blick zu den beiden Teenagern, die jetzt direkt auf sie zukamen. Das Mädchen war ausgesprochen hübsch, mit Haut wie Sahne und mandelförmigen Augen. Auch der Junge mit seinem vollkommen ausdruckslosen Gesicht fiel Jack sofort auf.
»Kennst du die beiden?«, fragte er Lilly.
Lilly nickte. »Ja. Vom Wohnheim.«
»Was machen sie denn hier?«
»Keine Ahnung.«
Doch in Wirklichkeit wusste sie es, sie wollte es nur nicht wahrhaben.
Vielleicht hatten sie einen Job in der Schule bekommen? Einleuchtend, oder nicht? Sie wohnten in der Nähe, und schließlich konnte jeder Rasen mähen und Blätter auffegen.
Entschlossen schluckte sie ihre Sorge hinunter und winkte. »Hallo, Artan!«
Der Junge blickte nicht auf, sondern flüsterte dem Mädchen etwas zu und küsste sie flüchtig auf die Wange. Dann ging er weg, aber nicht zu Lilly, sondern auf eine Gruppe lärmender Internatsschüler zu. Das Mädchen stolperte hinter ihm her.
Jack blickte von Lilly zu dem Pärchen und wieder zurück.
»Sag doch was, Lilly. Was geht hier vor?«
Sie sah ihn an, Angst in den Augen. »Etwas Schlimmes.«
Ohne ein weiteres Wort wandten sie sich beide um und rannten auf das Paar zu. Erst als sie fast dort waren, sah Lilly den Revolver.
Der Schuss krachte, ein Geräusch, das unter dem verhangenen, matt dunkelgrauen Himmel völlig fehl am Platz wirkte.
So schnell Jack konnte, verschaffte er sich einen Überblick über die Situation. Das Mädchen hielt einen Revolver in den ausgestreckten Händen, die zitterten wie Espenlaub. Der Junge schwenkte seine Waffe hoch über dem Kopf und versuchte, nach dem Rückschlag des Revolvers wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. Auch ihm war die Panik anzusehen. Ein Junge lag am Boden. Einer der Internatsschüler.
Jemand schrie auf, dann noch jemand, und kurz darauf war die Luft erfüllt von den Entsetzensrufen der Eltern, die von der Seitenlinie auf ihre Söhne zustürzten.
»Stopp«, rief der Junge mit dem Revolver, aber sie ignorierten ihn und liefen einfach weiter.
Noch einmal rief er: »Stopp«, und richtete die Waffe auf sie.
»Bleiben Sie stehen!«, rief Jack.
Einer der Väter streckte die Hand nach seinem Jungen aus, der von oben bis unten mit Schlamm bespritzt war und laut weinte.
»Stehenbleiben! Sofort!«
Alle erstarrten. Schweigen senkte sich herab, unterbrochen nur vom erstickten Schluchzen des verletzten Jungen.
Jack breitete die Arme aus, die Handflächen nach oben, und ging auf das Mädchen zu.
»Ich bin Polizist«, sagte er. »Leg die Waffe weg.«
Das Mädchen keuchte. Ihr Körper krampfte sich zusammen, sie konnte den Revolver kaum halten, aber sie zielte weiter auf einen sommersprossigen Jungen in der Menge, der sie mit weit aufgerissenen Augen anstarrte. Jetzt wirkte er schon nicht mehr so arrogant.
»Leg die Waffe weg«, wiederholte Jack.
Sie schüttelte den Kopf.
Jack streckte den Arm aus. »Bitte.«
Vorsichtig legte er die Hand unter den Revolver. Würde er gleich sterben?
Er hielt den Atem an.
Aber das Mädchen ließ die Waffe in seine Hand sinken.
Langsam, ganz langsam wandte sich Jack dem anderen Angreifer zu. »Und du auch, Junge.«
Der Junge lachte. Hart. »Wissen Sie, was die getan haben?«
Jack warf einen Blick auf die Internatsschüler. »Warum legst du nicht die Waffe weg und erzählst es mir dann?«
»Sie weiß es«, erwiderte der Junge und wies mit der Waffe auf Lilly.
Jack hörte Lilly scharf einatmen, und eine entsetzliche Angst breitete sich in seinem Körper aus.
»Aber sie hat gesagt, niemand würde etwas unternehmen.« Mit hasserfülltem Blick sah er Lilly an. »Sie hat gesagt, die Polizei würde sich nicht darum kümmern.«
Vorsichtig, Zentimeter um Zentimeter, rückte Jack zwischen den Revolverlauf und Lilly, bis er statt ihrer sich in der Schusslinie befand.
»Vielleicht hat sie sich geirrt«, wandte er ein.
Aber der Junge schüttelte nur den Kopf, richtete seine Waffe wieder auf die Internatsschüler und nahm den größten von ihnen ins Visier. Den arroganten Rothaarigen.
»Dieses Stück Scheiße verdient es nicht zu leben«, stieß er hervor.
Im Schritt des Rothaarigen breitete sich ein feuchter Fleck aus. »Bitte schieß nicht auf mich.«
»Nimm die Waffe runter!«, rief Jack.
Doch der Junge schüttelte nur den Kopf. Fast unmerklich, aber Jack entging die Bewegung nicht. Das Gespräch war beendet.
Wie in Zeitlupe legte sich der Finger des Jungen auf den Abzug, und Jack wusste genau, was er zu tun hatte. Blitzschnell hob er die Waffe, die er in der Hand hielt, spürte ihr Gewicht, ihre Größe. Dann schloss er die Augen und feuerte zweimal. Als er die Augen langsam wieder öffnete, sah er den Jungen am Boden liegen, mit aufgerissener Schulter, Blut und Knochensplitter auf dem Overall. Eine hässliche Wunder, schlimm genug, um ihn gefahrlos zu entwaffnen, aber nicht tödlich. Doch der Junge bewegte sich nicht, und erst als Jack seinen leblosen Kopf zur Seite drehte, sah er die zweite Wunde: ein sauberer, perfekter Einschuss in der linken Schläfe.
»Bist du okay?«
Völlig verstört stand Lilly in der Tür ihres Cottages.
Vor ihr, im schattigen Halbdunkel der Abenddämmerung, stand Penny van Huysan und strich sich die sorgfältig gesträhnten Haare hinter die Ohren.
»Bist du okay?«, wiederholte sie sanft.
Auch Penny gehörte zu den Eltern von Manor Park. Eine jugendliche, sehr modebewusste Frau, die gern und viel kicherte. Sie kannte die Berufe sämtlicher Ehemänner der Manor-Park-Mütter und war in der Lage, aus zweihundert Metern Entfernung Pumps von Jimmy Choo zu identifizieren – aber sie verbrachte ihre Zeit trotzdem lieber mit Lilly als mit den anderen Supermuttis.
Sie hatten sich während der Kelsey-Brand-Geschichte angefreundet, damals, als Lillys Leben implodiert war und Penny sich als unerwartete Unterstützung erwiesen hatte. Flankiert wurde sie von Luella, die zwar Pennys Oberflächlichkeit, aber nichts von deren Charme und Einfühlsamkeit besaß.
»Lilly?«, sagte Penny. »Kannst du mich hören?«
Als Lilly immer noch nicht antwortete, wechselten Penny und Luella einen Blick und komplimentierten ihr Gegenüber ohne weitere Umstände in ihr Cottage.
»Ist Jack hier?«, erkundigte sich Penny.
Lilly schüttelte den Kopf.
Penny holte ein Glas Wasser und drückte Lilly in einen Sessel. Lilly kippte das Wasser hinunter. Sie hatte nicht mal gemerkt, dass sie Durst hatte.
»Er musste zurück aufs Revier und denen erklären, was passiert ist.«
»Und was ist passiert? Die Leute sagen, eine Gang aus dem Wohnheim wollte ein Blutbad anrichten.«
»Nein, nein«, protestierte Lilly. »Es waren nur zwei, ein Junge und ein Mädchen. Bloß zwei Kids.«
»Aber es gab eine Schießerei, oder nicht?«, fragte Luella.
Penny legte ihre Hand auf Luellas Knie.
»Der Direktor hat uns ausdrücklich gesagt, wir sollen nicht darüber tratschen.«
»Wir tratschen doch auch gar nicht«, entgegnete Luella.
»Er möchte nicht, dass die Presse davon Wind bekommt und sich auf uns stürzt.«
»Das möchte doch niemand«, meinte Luella.
Lilly konnte sehen, dass sie ganz wild darauf war, die ganze Geschichte zu erfahren. Nur aus diesem Grund war sie überhaupt mitgekommen.
»Ist Sam schon im Bett?«, fragte Penny.
»Ja. Er hat eigentlich nicht gesehen, was passiert ist, aber er war trotzdem ziemlich mitgenommen«, antwortete Lilly.
»Und was ist denn nun passiert?«, beharrte Luella.
Penny warf ihr einen warnenden Blick zu, aber Luella wedelte wegwerfend mit der Hand.
»Wir haben ein Recht darauf, es zu erfahren.«
Lilly seufzte. Luella ließ sich garantiert nicht abwimmeln, also konnte Lilly ihr genauso gut erzählen, was passiert war, ehe die Buschtrommeln in der Schule ihre Arbeit aufnahmen.
»Wie gesagt, es waren bloß zwei Kids.«
»Aber sie waren bewaffnet«, wandte Luella ein.
»Ja. Jack hat dem Mädchen die Waffe abgenommen, aber der Junge hat sich geweigert …« Sie stockte, denn sie wusste nicht recht, wie sie weitermachen sollte. »Jack musste auf ihn schießen.«
»Ist er tot?« Luella schrie beinahe.
»Ich nehme nicht an, dass Lilly seinen Puls gefühlt hat«, warf Penny ein.
»Du hast recht«, lächelte Lilly, »aber ich würde sagen, er ist tot. Die Kopfwunde war zu schlimm, er hat bestimmt nicht überlebt.«
»Dann muss Jack die Situation aber für ganz schön ernst gehalten haben«, sagte Penny.
»War sie auch. Der Junge hätte womöglich noch jemanden erschossen«, bestätigte Lilly.
Luella konnte kaum noch an sich halten. »Noch jemanden? Du meinst, er hatte schon jemanden abgeknallt?«
»Das weiß ich nicht. Der Krankenwagen hat jemanden mitgenommen.«
»Wen?«, fragte Penny.
Lilly kniff die Augen zusammen und rief sich den Jungen ins Gedächtnis, kalkweiß und noch auf der Bahre. »Einen Schüler. Einen von den Internatsknaben.«
Die drei Frauen schwiegen, und ganz langsam wurde ihnen das Ausmaß dessen bewusst, was sich in der Schule ihrer Kinder abgespielt hatte. Schließlich stand Luella auf und klopfte ihren Rock ab. Offensichtlich hatte sie die Information verarbeitet.
»Ich nehme an, wir sind alle der Meinung, dass etwas unternommen werden muss.«
»Die Polizei kümmert sich darum«, sagte Penny.
»Ich meine wegen dem Wohnheim«, erwiderte Luella.
Lilly staunte. »Was meinst du denn damit?«
Luella reckte entschlossen das Kinn. »Ich meine, dass es geschlossen werden muss.«
Wieder einmal wusste Lilly nicht, ob sie lachen oder weinen sollte.
»Es hat nichts mit dem Wohnheim oder mit den anderen Leuten zu tun, die dort wohnen«, sagte sie.
Luellas Augen blitzten. »Wie kannst du so was sagen, wenn diese Tiere zu unserer Schule marschieren und nichts anderes im Sinn haben, als unsere Kinder umzubringen?«
»So war es aber nicht«, widersprach Lilly. »Ich glaube nicht, dass das Mädchen jemanden verletzen wollte.«
»Das ist doch albern«, sagte Luella. »Niemand schleppt einen Revolver mit sich herum, wenn er nicht damit auf jemanden schießen will.«
Hilfesuchend blickte Lilly zu Penny, aber sie schüttelte den Kopf. »Das ist ein faires Argument, Lilly. Ich meine, wie würdest du dich fühlen, wenn Sam getroffen worden wäre?«
»Ich weiß, was du damit sagen willst, aber du kannst die Heimbewohner nicht alle über einen Kamm scheren«, wehrte Lilly ab.
»Die hören sich gefährlich an«, sagte Penny.
Lilly war schockiert. Von Luella erwartete sie reaktionäres Geschwätz, aber von Penny eigentlich nicht.
»Nur die beiden hatten was damit zu tun, und die hatten ihre Gründe«, wandte sie ein.
»Was denn bitte?«, erkundigte sich Luella und blähte die Nasenflügel.
Lilly wusste, dass sie die Vergewaltigung nicht erwähnen durfte, denn die Information war ihr im Vertrauen hinterbracht worden, und sie wusste außerdem auch gar nicht mit Sicherheit, ob der Vorfall etwas mit dem zu tun hatte, was heute passiert war.
»Siehst du«, triumphierte Luella und reckte das Kinn. »Es gibt keine vernünftige Erklärung, nur das Offensichtliche. Diese Leute sind nicht wie wir. Sie hassen uns. Und ich persönlich werde nicht rumstehen und warten, während eine von diesen Gangs noch mehr Schaden anrichtet.«
Als Jack endlich ins Bett ging, zitterte er immer noch.
Auf dem Revier hatte er die Sache wieder und immer wieder durchgekaut. Angesichts der Tatsache, dass eine Person bereits angeschossen war und der Junge immer noch mit der Waffe herumfuchtelte, hatte er keine andere Wahl gehabt, als auf ihn zu schießen.
»Hätten Sie den Jungen nicht handlungsunfähig machen können?«, fragte der Ermittler.
Jack schüttelte den Kopf. »Das Risiko konnte ich nicht eingehen. Wenn ich ihn nicht getroffen hätte, hätte er mich getötet.«
So war es endlos weitergegangen, bis sie ihn gegen zwei schließlich hatten gehen lassen.
»Sie haben Glück«, sagte der Ermittler. »Der Junge hatte keine Familie, also wird sich wohl niemand beklagen.«
Dann lag Jack im Dunkeln, die Decke eng um sich geschlungen, zitterte unkontrollierbar und kam sich kein bisschen so vor, als hätte er Glück gehabt.
Kapitel 3
Snow White stammte von einer langen Reihe tapferer Soldaten ab.
Ihr Grandpa hatte im Zweiten Weltkrieg gekämpft, ihr Vater war zehn Jahre lang bei der Bombenräumung in Nordirland beschäftigt gewesen. Schwierige, oft unpopuläre Entscheidungen zu treffen lag ihr im Blut.
Nachdem ihr Vater zum sechsten Mal versetzt und sie demzufolge sechs verschiedene Schulen besucht hatte, stellte sie das Klagen ein und entdeckte, dass man sich mit einem gezielten Schlag in die Fresse auch die lautesten Quälgeister von der Pelle halten konnte. Diese Erkenntnis erleichterte ihren Wechsel aufs Internat.
Jedes Mal, wenn aus dem Trupp ihres Vaters wieder einer in die Luft flog, betrank er sich nach Strich und Faden und schmetterte aus voller Kehle: »No surrender, no surrender, no surrender to the IRA.« Am nächsten Tag ging er mit Kopfweh und vollkommen heiser zur Arbeit und brachte einem neuen Kameraden bei, was er zu tun hatte.