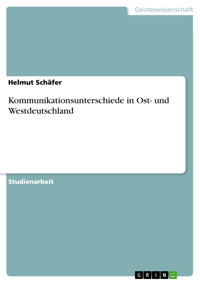15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich Politik - Politische Theorie und Ideengeschichte, Note: 1,0, Freie Universität Berlin (Institut für Politikwissenschaft - Otto-Suhr-Institut), Veranstaltung: Recht auf Faulheit - Erinnerungen an eine Utopie einer Gesellschaft ohne Arbeit, Sprache: Deutsch, Abstract: "Endlich Wochenende..." - so lautet heute der klassische Seufzer eines Erwerbstätigen, wenn er am Freitagnachmittag seinen Arbeitsplatz verlassen kann, um sich der sogenannten Freizeit hinzugeben. Die tägliche Freude auf den bevorstehenden Feierabend, der Urlaub als die "schönste Zeit des Jahres" oder das ewige Hinarbeiten auf die lang ersehnte Rente sind klare Anzeichen dafür, dass die subjektive Lebensqualität wohl nicht ausschließlich über die Lohnarbeit zu definieren ist. Vielmehr muss es gerade außerhalb der Erwerbstätigkeit Werte geben, durch die das Mensch-Sein bestimmt wird. [...] In Deutschland waren im Juli 1999 über vier Millionen Menschen als arbeitslos registriert. Bundesweit lag die Arbeitslosenquote bei 10,3 Pro¬zent. Damit steht statistisch jeder zehnte Deutsche außerhalb der Arbeitsgesellschaft, in Ostdeutschland ist es sogar fast jeder fünfte Arbeitnehmer. [...] Die vorliegende Haus-Arbeit geht der Frage nach, inwieweit der herkömmliche Begriff von Arbeit und seine gesellschaftliche Auswirkung für Gegenwart und Zukunft noch relevant sein kann. Die Anlehnung des Titels an eine Schrift von Paul Lafargue aus dem Jahr 1883 ist dabei Ausdruck der zugrundeliegenden Kernthese, dass der Gedanke an ein Recht auf Faulheit auch über 100 Jahre nach seiner erstmaligen Formulierung durch den Schwiegersohn von Karl Marx berechtigte Beachtung verdient. [...] In einem ersten Schritt [2. Kapitel] werden durch einen Exkurs zu Werken von André Gorz und Claus Offe bisherige Beschäftigungsverhältnisse und mögliche Alternativen im gesamtgesellschaftlichen Kontext der 80iger und 90iger Jahre auf-gezeigt. Eine Auseinandersetzung mit der aktuellen Arbeitsmarktsituation und den gegenwärtigen Strategien der politischen Akteure vervollständigt diese Bestandsaufnahme. Ein ursprünglich vorgesehener internationaler Vergleich zu Dänemark kann aus kapazitären Gründen in dieser Arbeit nicht mehr durchgeführt werden. Das dritte Kapitel wird dann unter soziologischen, ökonomischen und philosophischen Gesichtspunkten nach der Einordnung eines Konzepts der Faulheit zwischen Utopie und Notwendigkeit fragen. Sowohl die Probleme als auch die Chancen der Globalität und gesamtgesellschaftlicher Konzepte werden dabei der partiell-individuellen Lebensentscheidung zur Faulheit gegenüber gestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitende Vorbemerkung
2. Bestandsaufnahmen
2.1. Exkurs zu André Gorz
2.1.1 Die Nicht-Klasse der Nicht-Arbeiter
2.1.2 Heteronome und autonome Beschäftigung
2.1.3 Konto der Arbeitszeit und Grundeinkommen
2.1.4 Rolle des Staates und der Politik
2.2. Positionen von Claus Offe
2.2.1 Voll[zeit]Beschäftigung
2.2.2 Krise des Sozialstaats
2.2.3 Garantiertes Grundeinkommen
2.3 Arbeitsmarktsituation in Deutschland und gegenwärtige Strategien
2.3.1 Arbeitsmarktzahlen
2.3.2 Rückgang realer Erwerbstätigkeit
2.3.3 Das Bündnis für Arbeit
3. Vision, Utopie oder Notwendigkeit der Gegenwart und Zukunft
3.1. Probleme und Chancen der Globalität und gesamtgesellschaftlicher Konzepte
3.1.1 Globale und marktwirtschaftliche Prinzipien
3.1.2 Das Bewusstsein, die Bedeutung der Begriffe und das internalisierte Wohlstandsdenken
3.1.3 Abschied vom bisherigen sozialstaatlichen Denken der Nachkriegszeit
3.2. Individuelle Lebensentscheidung
3.2.1 Erwerbsfreizeit, Müßiggang, Weiterbildung und professionalisiertes Hobby
3.2.2 Vereinstätigkeiten und Genossenschaftskonzepte
4. Abschließend kommentierende Zusammenfassung
1. Einleitende Vorbemerkung
"Endlich Wochenende…“ lautet heute der klassische Seufzer eines Erwerbstätigen, wenn er am Freitagnachmittag seinen Arbeitsplatz verlassen kann, um sich der sogenannten Freizeit hinzugeben. Die tägliche Freude auf den bevorstehenden Feierabend, der Urlaub als die "schönste Zeit des Jahres" oder das ewige Hinarbeiten auf die lang ersehnte Rente sind klare Anzeichen dafür, dass die subjektive Lebensqualität wohl nicht ausschließlich über die Lohnarbeit zu definieren ist. Vielmehr muss es gerade außerhalb der Erwerbstätigkeit Werte geben, durch die das Mensch-Sein bestimmt wird. Auf der anderen Seite veranchaulichen diese Formulierungen jedoch auch, dass die berufliche Tätigkeit immer noch eine sehr zentrale Rolle im gesellschaftlichen Leben der Menschen spielt.
In Deutschland waren im Juli 1999 über vier Millionen Menschen als arbeitslos registriert. Bundesweit lag die Arbeitslosenquote bei 10,3 Prozent. Damit steht statistisch jeder zehnte Deutsche außerhalb der Arbeitsgesellschaft, in Ostdeutschland ist es sogar fast jeder fünfte Arbeitnehmer.[1] Zeitgleich versucht die Bundesregierung zusammen mit Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertretern im "Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit" Wege zur Bekämpfung der historisch hohen Arbeitslosigkeit zu finden. Der amtierende Bundeskanzler Schröder formulierte dieses Ziel als Wahlversprechen und macht seine Glaubwürdigkeit und den Erfolg seiner gesamten Politik von der Konsolidierung des Arbeitsmarktes abhängig.
Die vorliegende Hausarbeit geht der Frage nach, inwieweit der herkömmliche Begriff von Arbeit und seine gesellschaftliche Auswirkung für Gegenwart und Zukunft noch relevant sein kann. Die Anlehnung des Titels an eine Schrift von Paul Lafargue aus dem Jahr 1883[2] ist dabei Ausdruck der zu Grunde liegenden Kernthese, dass der Gedanke an ein Recht auf Faulheit auch über 100 Jahre nach seiner erstmaligen Formulierung durch den Schwiegersohn von Karl Marx berechtigte Beachtung verdient. Als theoretischer Gegenpol zum zentralen Arbeitsbegriff erscheint die zeitgenössische Interpretation des Rechts auf Faulheit zwar eher als Vision der Zukunft und gegenwärtige Utopie ohne konkreten Ansatz zur Realisation in Deutschland, verliert dadurch jedoch keineswegs an Aktualität.
In einem ersten Schritt [2. Kapitel] werden durch einen Exkurs zu Werken von André Gorz und Claus Offe bisherige Beschäftigungsverhältnisse und mögliche Alternativen im gesamtgesellschaftlichen Kontext der 80iger und 90iger Jahre aufgezeigt. Eine Auseinandersetzung mit der aktuellen Arbeitsmarktsituation und den gegenwärtigen Strategien der politischen Akteure vervollständigt diese Bestandsaufnahme. Ein ursprünglich vorgesehener internationaler Vergleich zu Dänemark kann aus kapazitären Gründen in dieser Arbeit nicht mehr durchgeführt werden.
Das dritte Kapitel wird dann unter soziologischen, ökonomischen und philosophischen Gesichtspunkten nach der Einordnung eines Konzepts der Faulheit zwischen Utopie und Notwendigkeit fragen. Sowohl die Probleme als auch die Chancen der Globalität und gesamtgesellschaftlicher Konzepte werden dabei der partiell-individuellen Lebensentscheidung zur Faulheit gegenüber gestellt.
2. Bestandsaufnahmen
2.1. Exkurs zu André Gorz
In seinen Schriften der 70iger und 80iger Jahre skizziert André Gorz ein Gesellschaftskonzept, in dem die Menschen nach seiner Ansicht selbstverwirklicht und befreit von bisherigen Modellen der Arbeitsgesellschaft leben könnten. Die folgenden Abschnitte erläutern die von ihm verwendete Begrifflichkeit sowie zentrale Gesichtspunkte seines Ansatzes.
2.1.1 Die Nicht-Klasse der Nicht-Arbeiter
Die Nicht-Klasse der Nicht-Arbeiter konstituiert sich bei André Gorz aus inadäquat Beschäftigten und den Menschen, die aus dem Arbeitsprozess zeitweise oder vollkommen herausgefallen sind. Nur eine kleine privilegierte Minderheit ist nach Gorz heute noch einer Arbeiterschicht im traditionellen Verständnis zuzuordnen. Immer weniger Erwerbstätige können kontinuierlich und fachspezifisch dem erlernten Beruf nachgehen, zunehmend mehr schlagen sich von einem Gelegenheitsjob zum anderen durch. Durch die Weiterentwicklung der Technik und die Veränderung ökonomischer Rahmenbedingungen werden Experten und Fachkräfte immer häufiger ins berufliche Abseits gedrängt. Das Wir-Gefühl eines gemeinsamen Produktionserfolgs und Befriedigung durch erfüllte Arbeit entsprechend der erworbenen Kompetenz weichen dem individuell erlebten beruflichen Scheitern und führen zur Entfremdung. Daraus resultiert der Rückzug in den privat verbleibenden Autonomiebereich und stellt zugleich wie schon bei Paul Lafargue[3] das Potential für gesellschaftliche Veränderung dar. Anders als beim Schwiegersohn von Marx, bei dem der Intellektuelle aus der Motivation zum Eigennutz heraus auch zunächst häufig die Tendenz zur Anpassung an das bestehende System aufweisen kann, sieht Gorz jedoch die Veränderung der Gesellschaft vornehmlich als individuellen Akt, gelebt im Müßiggang und in der Faulheit des einzelnen außerhalb der Erwerbsarbeit.
Damit ist die Nicht-Klasse ein Resultat der Krise des Kapitalismus und nicht wie die Marxsche Arbeiterklasse direkt vom Kapitalismus erzeugt. Während Marx und Engels 1848 noch von der geschichtlichen und gesellschaftlichen Rolle einer Arbeiterklasse an und für sich ausgehen[4], stellt André Gorz 132 Jahre später klar die Nicht-Existenz einer revolutionären Arbeiterklasse und damit das Fehlen eines Subjekts zur sozialistischen Revolution fest. Denn die Marxsche Idee des Proletariats ist für André Gorz zu einem realen Neoproletariat pervertiert, in dem nur noch das Ziel, zur subjektiv-individuellen Autonomie zu gelangen, existiert.
An die Stelle des damaligen Proletariats ist nach Gorz also der individuelle Neoproletarier getreten. Dieser lässt sich nicht mehr durch seine Stellung im Produktionsprozess definieren. Häufig jahrelang an Schulen und Hochschulen ausgebildet und damit für seine wechselnden Gelegenheitsarbeiten oft vollkommen überqualifiziert, identifiziert sich der Neoproletarier nicht mehr mit dem Produkt seines täglichen Schaffens. Im gesellschaftlich-ökonomischen Apparat wird der einzelne Arbeitnehmer austauschbares Rädchen im Getriebe einer [Über-]Produktion die zum Selbsterhalt immer weiteren Überfluss und neue Konsumbedürfnisse hervorbringt.