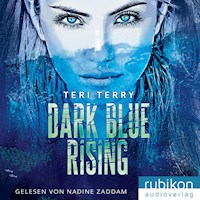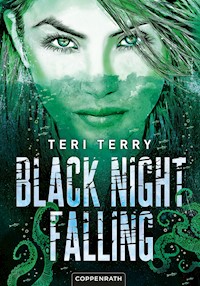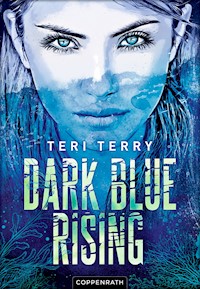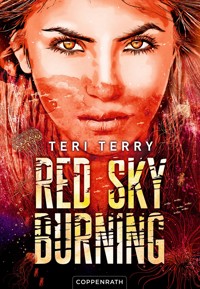
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Coppenrath Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Dark Blue Rising
- Sprache: Deutsch
Tabby ist auf der Flucht und entschlossen, das Geheimnis ihrer Herkunft zu entschlüsseln. Warum zieht das Meer sie fast schon gewaltsam an? Woher kommt dieses andere, wildere Ich, das manchmal die Kontrolle übernimmt? Und weshalb jagt "Der Kreis", eine Gruppe von Umweltterroristen, sie so unerbittlich? Die radikale Geheimorganisation hält nicht nur Tabby, sondern die ganze Welt mit weiteren Klima-Anschlägen in Atem: verheerende Hurrikans, brechende Staudämme und brennende Kohlekraftwerke lassen die Menschen verzweifeln. Während sich der Himmel blutrot verdunkelt, tauchen Tabby und ihre Freunde Denzi und Jago immer tiefer ein in einen gefährlichen Komplott. Nicht ahnend, welche wichtige Rolle sie dabei noch spielen werden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
eISBN 978-3-649-64322-7
© 2021 für die deutschsprachige Ausgabe
Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG, Hafenweg 30, 48155 Münster
Alle Rechte vorbehalten, auch auszugsweise
First published in Great Britain in 2021 by Hodder & Stoughton
Text copyright © Teri Terry, 2021
The moral right of the author has been asserted.
All characters and events in this publication, other than those clearly in the public domain, are fictitious and any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.
All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.
Originalverlag: Hodder Children’s Books, an Imprint of Hachette Children’s Group, part of Hodder & Stoughton
Originaltitel: Red Sky Burning
Aus dem Englischen von Wolfram Ströle
Umschlaggestaltung: Frauke Schneider
Lektorat: Sara Falke/Susan Niessen
Satz: Sabine Conrad, Bad Nauheim
www.coppenrath.de
Die Print-Ausgabe erscheint unter der ISBN: 978-3-649-63872-8.
Teri Terry
RED SKY BURNING
Aus dem Englischen von Wolfram Ströle
Den Klimawandel zu leugnen hat wohl mehr
mit Angst und Trägheit zu tun als mit aufrichtiger Überzeugung. Wir müssen den Regierungen der Welt etwas geben, vor dem sie noch mehr Angst haben, damit sie handeln.
Seraphina RoseWissenschaftliche ChefberaterinDer Kreis
Du treibst ein verwundetes Tier in die Enge, bis es sich bedroht fühlt?
Dann darfst du auch nicht mit einer vernünftigen Reaktion rechnen.
Cassandra PennÄlteste und SeherinDer Kreis
Inhalt
Teil 1: Denzi
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Teil 2: Tabby
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Teil 3: Denzi
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Teil 4: Tabby
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Teil 5: Denzi
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Teil 6: Tabby
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Teil 7
Kapitel 66: Denzi
Kapitel 67: Tabby
Kapitel 68: Denzi
Kapitel 69: Tabby
Kapitel 70: Denzi
Kapitel 71: Tabby
Kapitel 72: Denzi
Kapitel 73: Tabby
Kapitel 74: Denzi
Kapitel 75: Tabby
Kapitel 76: Denzi
Kapitel 77: Tabby
Kapitel 78: Denzi
Kapitel 79: Tabby
Kapitel 80: Denzi
Kapitel 81: Tabby
Kapitel 82: Denzi
Kapitel 83: Tabby
Kapitel 84: Denzi
Kapitel 85: Tabby
Kapitel 86: Denzi
Kapitel 87: Tabby
Kapitel 88: Tabby
Kapitel 89: Tabby
Kapitel 90: Tabby
TEIL 1 DENZI
1
Ich habe es nicht kommen sehen. Niemand hat das.
Aber auch wenn ich das jetzt sage, war da doch etwas in der vergangenen Nacht: ein Engegefühl in meiner Brust, ein Druck, der jeden Atemzug mühsam machte, sogar wenn ich mich gar nicht bewegte.
Ich konnte nicht schlafen und dachte, es läge am extremen Wetter. Es war heiß, schwül, die Luft stand praktisch und, ja gut, es ist Sommer, aber in England dürfte es trotzdem nicht so heiß sein. Zumindest hört man das immer, auch wenn ich eigentlich damit aufgewachsen bin: mit heißen, endlosen Sommern und dem Meer als einziger Abkühlung. Wahrscheinlich bin ich auch deshalb so ein begeisterter Schwimmer geworden.
Ich konnte also nicht schlafen und weiß noch, wie ich mich gefragt habe, warum ich Tabby nicht alles erzählt habe. Und dabei dachte ich noch nicht mal an die Sache mit dieser Penrose Clinic, die sie so beschäftigte – von der wusste ich damals noch nichts –, sondern an andere Merkwürdigkeiten, von denen sie berichtet hatte. Dass sie selbst, Isha und Zara noch nie in einem Verein trainiert hatten und trotzdem entdeckt und hierhergeholt worden waren – in ein Sommertrainingslager für Eliteschwimmer, gedacht für künftige Schwimmstars. Es war wirklich höchst seltsam, dass die Mädchen bis dahin noch keinen einzigen Wettkampf geschwommen hatten. Und auch, dass, Ariels Familie eingerechnet, zwei Mütter Geologinnen waren und zwei Väter Angestellte in Öl- und Gaskonzernen. Ich hatte gesagt, mein Vater sei Politiker – was ja auch stimmt, er sitzt im Parlament in London –, aber meine Mutter hatte ich unterschlagen.
Das tue ich meistens – sie unterschlagen. Ich nenne sie nicht einmal Mutter. Es fühlt sich komisch an, »Mum« oder auch nur »Mutter« zu einer Fremden zu sagen, deshalb verwende ich immer nur ihren Vornamen, Leila. Ich sehe sie so selten, dass sie mir mehr wie eine Gestalt aus einer Geschichte vorkommt als jemand aus meinem wirklichen Leben. Aber ich hätte Tabby immerhin sagen können, dass Leila auf der anderen Seite steht – dass sie für Big Green in Washington, D.C., arbeitet, eine Umweltdachorganisation, die gegen Öl- und Gaskonzerne wie Industria United kämpft.
Ich lag also wach, dachte nach und beschloss, Tabby am nächsten Tag von meiner Mutter zu erzählen. Außerdem könnten wir auch noch die anderen Schwimmer nach ihren Eltern fragen und herausfinden, ob es weitere Parallelen gab. Und wenn ja, überlegen, was sie zu bedeuten hatten. Es war ein Puzzle, und wenn ich nicht verstehe, wie etwas zusammenhängt, macht mich das erst recht neugierig.
Aber dann klopfte es an meiner Tür.
2
Wer kann das sein?
Mit zusammengekniffenen Augen schaue ich auf meinen Tracker. 2.40 Uhr.
Wieder das leise Klopfen.
Ich stehe auf und öffne die Tür.
Becker? Wenn ich jemand um diese Nachtzeit nicht vor meiner Tür erwartet hätte, dann unseren Lauftrainer.
Seine Haare sind verstrubbelt, als wäre er eben erst aufgestanden.
»Tut mir leid, wenn ich dich wecke, Denzi. Du hast einen Anruf – unten im Büro der Leitung. Komm mit.«
Einen Anruf. Obwohl wir nicht einmal unsere eigenen Handys benutzen dürfen und die der Schule nur einmal pro Woche? Und mitten in der Nacht?
»Wer soll das sein? Ist was passiert?«
Becker zuckt mit den Schultern. »Keine Ahnung. Sie hat nur gesagt, ich soll dich holen.«
Ich folge Becker die Treppe hinunter, durch das Eingangsfoyer und einen Gang entlang zum Leitungs-Büro.
Becker klopft und macht die Tür auf.
Sie sitzt an ihrem Schreibtisch – Christina Lang, die Leiterin der Schwimmschule – und ja, gut, ich hätte vielleicht mehr anziehen sollen als nur meine Boxershorts. Aber sie sieht mich bloß betroffen an und ich spüre einen Stich im Magen.
»Denzi, setz dich. Bitte.« Sie reicht mir das Telefon.
»Hallo?«
»Denzi?« Es ist Dad. Ich bin unendlich erleichtert, seine Stimme zu hören, gefolgt von Panik darüber, was alles passiert sein könnte.
»Was ist?«
»Deine Mutter. Ich habe keine Ahnung, wie ernst es ist, wir wissen noch nichts Genaueres – sie hatte einen Unfall. Oliver hat aus dem Krankenhaus angerufen. Sie bitten dich zu kommen.«
»Was für einen Unfall?«
»Ein Auto hat sie und ihr Fahrrad erfasst. Mehr weiß ich nicht.«
»Ach, Scheiße!«
»Kann man sagen. Also, es ist allein deine Entscheidung. Was willst du tun?«
Ich sitze nur da und sage nichts, weiß nicht, was ich sagen soll. Sie war nie für mich da, warum sollte ich also jetzt zu ihr kommen? Andererseits … falls es nun das letzte Mal ist, dass ich sie sehe?
»Denzi? Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, ein Tipp: Wann immer man sich nicht entscheiden kann, ob man etwas tun soll oder nicht – man bereut meiner Erfahrung nach in der Regel das, was man nicht getan hat.«
Und ich weiß zwar, dass er von etwas anderem spricht, aber … er hat recht.
»Dann mache ich das«, sage ich.
»Gut. Jax hat schon nach Flügen gesucht. Wir können dir einen Direktflug nach Washington um sieben buchen, wenn du es rechtzeitig nach Heathrow schaffst. Kann ich noch mal mit Christina sprechen?«
»Danke, Dad.«
Ich gebe das Telefon an Christina Lang weiter. Die beiden besprechen Einzelheiten, während meine Gedanken rasen. Meine Mutter? Ein Unfall?
Schließlich gibt Christina Lang mir das Telefon noch einmal.
»Dad?«
»Dann ist alles klar. Wir treffen dich am Flughafen und bringen dir deinen Pass. Außerdem packt Jax dir ein paar Kleider und Sachen ein.«
»Danke.«
Wir verabschieden uns und ich lege auf.
»Gut, Denzi«, sagt Christina. »Zieh dich an und sei in zehn Minuten draußen am Eingang. Becker fährt dich nach Heathrow.«
»Danke. Ihnen beiden, danke.«
Auf der Fahrt reden wir nicht viel. Es ist fast drei, als wir aufbrechen. Laut Beckers Navi brauchen wir drei Stunden. Habe ich dann noch genug Zeit, um durch die Sicherheitskontrolle zu kommen, wenn der Flug um sieben geht? Aber es ist kaum Verkehr und wir schaffen die Strecke in eher zweieinhalb Stunden.
Becker hält vor der Abflughalle.
»Noch mal danke«, sage ich.
»Kein Problem. Obwohl es das erste Mal überhaupt sein wird, dass ich den Sechs-Uhr-Lauf nicht schaffe. Ich drück dir die Daumen.«
Ich steige aus, eile im Laufschritt in die Abflughalle und denke dabei an Becker. Ich habe ihn nie so besonders gemocht, hauptsächlich, weil er immer auf den schwachen Läufern herumhackt. Vielleicht ist er ja sonst ganz okay.
Dann entdecke ich Dad und Jax.
»Schnell, das Gate schließt bald«, sagt Dad. »Ich habe dich schon eingecheckt. Hier sind Boarding Pass, Reisepass, Kreditkarten und Bargeld und dein Handy. Ich habe es aufgeladen. In Washington wirst du abgeholt. Der Fahrer wartet mit einem Schild mit deinem Namen bei den ankommenden Flügen, ja? Ich habe dir eine Nachricht mit Olivers Nummer geschickt, falls du sie brauchst.«
Er umarmt mich. Jax umarmt mich auch.
Jax gibt mir eine kleine Tasche. »Nur Handgepäck, du hast keine Zeit, einen Koffer aufzugeben«, sagt er.
»Jetzt lauf«, sagt Dad. »Wir warten noch, falls du den Flug nicht kriegst. Schreib mir. Hab dich lieb.«
»Ich dich auch.« Ich eile in Richtung Sicherheitskontrolle.
»Gib Bescheid, wenn du ankommst«, ruft Jax mir nach.
»Mach ich!« Ich drehe mich noch einmal um, winke im Laufen und verschwinde außer Sicht.
An der Sicherheitskontrolle geht es noch langsamer voran als sonst, und als ich durch bin, ist das Gate ungefähr so weit weg, wie es überhaupt geht. Ich renne, so schnell ich kann. Eine Frau in der Uniform des Flugpersonals zieht gerade die Tür zu.
»Bitte! Meine Mutter hatte einen Unfall. Ich muss den Flug unbedingt kriegen.«
Sie zögert, dann macht sie wieder auf. »Also gut. Aber du musst dich beeilen.« Ich reiche ihr Pass und Bordkarte zum Scannen.
»Danke«, sage ich und renne durch den Tunnel zum Flugzeug.
Ich bekomme meinen Platz gezeigt und sitze schon, bevor mir klar wird – ist das Business Class? Mein Gott! Das muss so kurzfristig ein Vermögen gekostet haben.
Ich schreibe Dad. Geschafft. Danke für den tollen Platz.
Hoffentlich ist alles okay. Ruf an, wenn du was brauchst oder mit jemandem reden willst.
Danke.
Ich stelle mein Handy auf Flugmodus und schnalle mich an. Es folgt die übliche Sicherheitseinweisung.
Ich war so damit beschäftigt, den Flug zu erreichen, dass mir erst jetzt, auf meinem Platz, wieder einfällt, warum ich überhaupt hier bin.
Ob es Leila gut geht? Ich habe Dad nicht gefragt, ob er etwas Neues gehört hat. Das hätte er mir doch bestimmt gesagt, oder?
Und wenn es ihr nicht gut geht … wenn ich zu spät komme?
Daran darf ich jetzt nicht denken, also konzentriere ich mich auf etwas anderes, auf das, was ich zurücklasse.
Tabby. Ich hätte ihr über Becker eine Nachricht zukommen lassen sollen. Hoffentlich sagt man ihr, warum ich weg bin. Vielleicht fällt es sonst ja niemandem auf, außer vielleicht Dickens, dem Schulkater.
Das war es also mit dem Sommertrainingslager und der Teilnahme an den nächsten Olympischen Spielen. Auch das habe ich wohl Leila zu verdanken. Aber jetzt bekomme ich ein schlechtes Gewissen, dass ich so etwas denke, wo ich doch gar nicht weiß, ob … genug. Ich versuche angestrengt, an etwas anderes zu denken.
Hoffentlich hat Dad wirklich nichts dagegen, dass ich zu ihr fliege. Er konnte mir nie sagen, was vor vielen Jahren zwischen ihm und meiner Mutter schiefgegangen ist. Ich meine, er ist schwul, und das reicht natürlich aus, eine Ehe zu beenden, wenn man es erst weiß. Aber irgendwie spüre ich, dass noch mehr dahintersteckt. Nicht dass er etwas vor mir geheim halten wollte. Es ist mehr so, als könnte er nicht ertragen, darüber zu sprechen.
Wir rollen zur Startbahn. Die Triebwerke fahren hoch, wir rasen die Piste entlang und heben schlingernd ab. Mein wie verrückt klopfendes Herz beruhigt sich allmählich.
Aber meine Gedanken rasen weiter. Ich kann in Flugzeugen nicht gut schlafen. Eigentlich schlafe ich nirgends gut ein – selbst zu Hause dauert es ewig. Aber jetzt bin ich zu erschöpft.
Und schon bin ich weg.
3
Als ich aus der Passkontrolle komme, sehe ich mich nach dem versprochenen Fahrer um, der ein Schild mit meinem Namen hochhalten soll. Da steht niemand.
Keine Panik – vielleicht ist er im Verkehr stecken geblieben. Ich lasse den Blick über die Menge wandern. Überall werden Leute mit Umarmungen und Blumen begrüßt oder von Chauffeuren. Ich bleibe zurück und überlege, was ich tun soll, wenn niemand auftaucht. Leilas Mann Oliver anrufen? Ein Taxi kann ich nicht nehmen, niemand hat mir gesagt, in welchem Krankenhaus sie liegt.
Ein Mädchen kommt auf mich zu. Sie ist groß gewachsen, sieht in dem weißen Sommerkleid auf der dunklen Haut fantastisch aus. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen und bin mir deshalb nicht ganz sicher, aber ist das meine Stiefschwester Apple? Eigentlich Apple Blossom, aber sie hat mir einmal den Arm auf den Rücken gedreht und gesagt, sie bringt mich um, wenn ich sie noch einmal so nenne. Doch, das muss sie sein: Sie winkt.
»Denzi! Hi! Willkommen in den USA.« Breites Lächeln.
»Hey, Apple. Ich habe einen Fahrer erwartet. Alles okay?«
»Soweit ich weiß. Ich habe angeboten, dich abzuholen, ich musste da raus. Ich hasse Krankenhäuser.«
Mir fällt ein, dass ihre Mutter an Brustkrebs gestorben ist. Sie zögert. »Deine Mom liegt im Koma.«
Ich schlucke. »Im Koma? Wacht sie wieder auf?«
Ihr Lächeln erlischt. »Das wissen die Ärzte ehrlich gesagt nicht. Ich fahr dich jetzt hin.«
4
Ich komme mir vor wie in einer Krankenhausserie. Leila ist an piepsende Geräte angeschlossen und Oliver hält ihre Hand.
»Danke, dass du gekommen bist, Denzi«, sagt er.
»Was ist passiert?«
»Ein Auto hat sie vom Fahrrad geholt. Sie hat sich am Kopf verletzt, obwohl sie einen Helm aufhatte, allerdings laut den Ärzten nicht schwer – sie wissen nicht, warum sie noch bewusstlos ist.«
Er lässt Leilas Hand los und steht auf. Rollt die Schultern, als hätte er sie seit Stunden nicht bewegt. »Okay, ich lass dich einen Moment mit ihr allein. Ich komme gleich wieder.« Er geht zusammen mit Apple nach draußen.
Ich setze mich auf den Stuhl am Bett. Leilas Gesicht ist blass, mit Schrammen an einer Seite. Über der Stirn ein Verband.
Ihre Miene ist vollkommen unbewegt. Um ihre Augen sind Falten, an die ich mich nicht erinnere, in den Haaren graue Strähnen. Es war, Moment – vor vier Jahren? –, dass ich sie das letzte Mal gesehen habe. Ich war dreizehn. Sie war auf Dienstreise in London. Wir haben zu Mittag gegessen und es war komisch, peinlich. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich nur aus irgendeinem Pflichtbewusstsein heraus mit mir traf, nicht weil sie es wollte. Aber vielleicht habe ich meine eigenen Gefühle in sie hineininterpretiert, keine Ahnung.
Mir ist nicht einmal klar, was ich jetzt empfinde. Obwohl, wenn sie gestorben wäre und ich nicht gekommen wäre, hätte ich mich schuldig gefühlt. Bin ich nur deshalb hier?
Während ich dasitze und zusehe, wie sie atmet, wird mir klar, dass es noch einen anderen Grund gibt. Ich hatte immer das Gefühl, dass mir etwas fehlt – vor allem, als ich kleiner war. Ich sah meine Freunde und Cousins mit ihren Müttern und fragte mich, warum meine Mutter mich nicht wollte. Sie hat mich bei meinem Vater gelassen, als ich nicht mal ein Jahr alt war, und um den Bruch noch endgültiger zu machen, hat sie auch gleich noch das Land verlassen.
Und ich habe sie nie gefragt, warum sie nicht für mich da war. Dabei, finde ich, habe ich ein Recht darauf, das zu wissen – ich bin alt genug, dass sie ehrlich mit mir sprechen kann.
Also, wahrscheinlich ist es das, was ich fühle: Sie soll leben, damit ich sie das fragen kann.
Aber es gibt noch einen Grund. Kann man etwas verlieren, das man nie gehabt hat? Keine Ahnung, aber ich will sie nicht wieder verlieren. Nicht so.
Später machen wir einen Spaziergang auf dem Krankenhausgelände, Apple und ich. Es ist ein heißer, windstiller Tag, sogar noch heißer als in letzter Zeit in England. Vielleicht kommt es mir aber auch nur wegen des Kontrasts zwischen der klimatisierten Privatklinik und draußen so vor. Ich werde das seltsame Gefühl nicht los, dass die Welt den Atem anhält, wie in Erwartung von etwas. Es macht mich gereizt und unruhig. Und vor allem sehne ich mich nach dem Meer. Danach, in seinen salzigen Tiefen ganz schnell ganz weit wegzuschwimmen und alles hinter mir zurückzulassen.
»Ich halte es in einem Krankenhauszimmer nicht lange aus«, sagt Apple. »Ich war zehn, als Mom gestorben ist. Ich werde nie vergessen, wie ich da saß und zugesehen habe, wie sie starb. Gewartet habe, bis es vorbei ist.«
»Habt ihr euch nahegestanden?«
»Natürlich, sie war meine Mom! Oh, Entschuldigung.«
»Keine Ursache. Wie kommst du mit Leila zurecht?«
Sie zuckt mit den Schultern. »Ganz gut, denke ich. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie meine Mom ersetzen wollte – sie ist nicht der Muttertyp –, aber die meiste Zeit kommen wir miteinander klar.«
»Wie war deine Mum?«
»Wie Sonnenschein. Aber nicht die Sorte.« Sie zeigt auf die Sonne, die gnadenlos auf uns herunterbrennt. »Mehr wie der erste warme Frühlingstag. Das klingt jetzt wahrscheinlich albern.«
»Überhaupt nicht.«
»Dad war sich nicht sicher, ob du kommst.«
»Leila ist trotz allem meine Mutter.« Ich spreche die Worte aus, fühle sie aber nicht. Meine Familie sind Dad und Jax, solange ich mich erinnern kann. Zwei Väter, oder ist Jax mehr so, wie meine Mutter hätte sein sollen? Wie auch immer. Mir fällt ein, dass ich gesagt hatte, ich würde anrufen, wenn ich angekommen bin.
»Ich habe vergessen, zu Hause anzurufen. Das sollte ich jetzt tun, sorry.«
»Nur zu.«
Apple geht wieder rein. Ich setze mich auf eine Bank und wähle die Nummer.
Es klingelt einmal. »Hallo?« Das ist Jax.
»Hi, ich bin’s.«
»Wie ist die Lage? Wie geht’s Leila?« Und ich erzähle ihm, was ich weiß – dass sie im Koma liegt und wir nicht Genaueres wissen. Seine Stimme klingt irgendwie angespannt.
»Ist Dad da?«
»Nein. Er hat noch zu tun, ich weiß selbst gar nicht, was es diesmal ist. Er wird traurig sein, dass er deinen Anruf verpasst hat.«
»Sag ihm, dass es mir gut geht. Und wenn es Neuigkeiten gibt, melde ich mich.«
Wir verabschieden uns. Ich frage mich, was es diesmal ist, dass Jax so besorgt klingt und Dad so spät noch arbeitet – der übliche politische Mist oder irgendeine Krise. Als Innenminister nimmt Dad oft an Sitzungen von COBRA teil, einem Ausschuss, der sich bei akuten Gefahrenlagen trifft – vor allem einer Pandemie, einem Terrorangriff oder einer Naturkatastrophe. Ich checke die BBC-Nachrichten auf meinem Handy: Es gibt keine entsprechende Meldung. Wenigstens noch nicht.
Ich werde Dad schreiben, beschließe ich. Ich öffne Signal – Dad mag es nicht, wenn ich ihm texte oder ihn mit meinem Handy auf seinem anrufe. Er sagt, man weiß nie, wer einem dabei zusieht oder zuhört. Signal ist sicher, aber meist ungeeignet, weil ich niemanden kenne, der es benutzt – außer Dad und Jax.
Bin angekommen, Leila liegt im Koma – gebe Bescheid, wenn sich etwas ändert. Bei dir alles gut?
Ich bin gerade auf dem Rückweg in die Klinik, als mein Handy vibriert.
Danke für die Nachricht. Und mir geht es gut, aber die Situation ist … spannend …! Was so ungefähr alles bedeuten kann.
Später kann Oliver Apple dazu überreden, nach Hause zu gehen. Ich soll sie doch begleiten, meint er, aber ich bin extra angereist, um hier zu sein. Also bleibe ich.
Er geht, um Kaffee zu holen. Als er weg ist, kommt eine Ärztin herein, überprüft die Geräte, an die Leila angeschlossen ist, und macht etwas an ihrem Infusionsbeutel.
»Warum liegt sie im Koma? Wacht sie wieder auf?«
»Bei Kopfverletzungen wissen wir vieles noch nicht. Vielleicht ruht sie sich einfach aus, damit ihre Verletzungen heilen können, und wacht auf, wenn sie dazu bereit ist. Rede mit ihr – das hilft vielleicht. Selbst wenn sie nicht antwortet, kann sie dich vielleicht doch hören.«
Als sie gegangen ist, die Tür hinter sich zugemacht hat, zögere ich noch. Blicke zur Tür. Oliver ist noch nicht wieder zurück.
Ich schlucke und nehme Leilas Hand. »Okay, hi, ich bin’s, Denzi. Wie geht’s? Du kannst mir wahrscheinlich nicht antworten. Länger nicht gesehen. Also, mit der Schule läuft es ganz gut. Ich mache vor allem Schwimmen.« Und ich erzähle ihr, wie sehr ich Schwimmen liebe, dass ich dabei mit mir und der Welt und meinem Platz darin im Reinen bin. Wie sehr ich mich über die Einladung zu dem Sommer-Trainingslager für Eliteschwimmer an meiner Schule gefreut habe. Mir wird plötzlich klar, dass ich Leila, soweit ich mich erinnere, nie von etwas erzählt habe, das mir wichtig ist. Und jetzt liegt sie im Koma.
»Also, so viel zu mir. Aber wenn du aufwachst, müssen wir reden. Es gibt Dinge, die ich dich fragen will, und …«
Moment! Hat sie sich bewegt? Ihre Hand – mir war, als hätte sie sich in meiner ein wenig zusammengezogen. Habe ich mir das nur eingebildet?
Hinter mir geht die Tür auf und ich drehe mich um. Es ist Oliver. Ich wende mich wieder Leila zu, sehe sie unverwandt an und versuche sie durch meine Willenskraft dazu zu bringen, dass sie aufwacht.
Ihre Lider bewegen sich, ihre Augen – stehen sie einen Spalt offen?
»Ich glaube, sie kommt gerade zu sich«, sage ich. Oliver ist mit einem Schritt neben mir. Leila öffnet die Augen und sieht mich an. Und dann Oliver.
Sie dreht den Kopf ein wenig, zuckt zusammen, leckt sich die Lippen. »Was ist denn los?«, fragt sie.
Oliver drückt die Ruftaste und kurz darauf kommen eine Schwester und ein Arzt – nicht mehr die Ärztin von vorhin. Alle lächeln. Die beiden lesen Werte ab und Oliver ruft Apple an. Ich trete einen Schritt zurück und sehe zu. Als der Arzt und die Schwester fertig sind, geht Oliver zu Leila und nimmt ihre Hand.
Der Arzt lächelt mich an. »Du musst Leilas Sohn aus England sein.«
»Ja. Ich bin Denzi.«
»Vielleicht hat sie mit dem Aufwachen gewartet, bis du da bist«, sagt die Schwester.
»Könnte es daran liegen, dass ich mit ihr geredet habe? Wie die Ärztin mir geraten hat?«
»Ärztin? Was für eine …«
»Hallo«, sagt Leila, »was ist mit mir? Der Patientin? Wann kann ich nach Hause?«
Der Arzt wendet sie sich ihr zu. »Noch nicht gleich. Wir müssen Sie zuerst gründlich untersuchen und sicherstellen, dass alles in Ordnung ist.«
Oliver fragt nach Leilas Kopfverletzungen. Der Arzt meint, es sei ungewöhnlich, dass sie ganz plötzlich aufwacht, ohne eine Änderung der Gehirnaktivität, wie sie normalerweise vorausgeht. Und dass sie jetzt verschiedene Tests und Aufnahmen machen müssten.
Leilas Augen suchen meine. Hat mein Reden etwas damit zu tun gehabt, dass sie aufgewacht ist? Unmöglich. Oder doch? Ich sehe sie an, und sie erwidert meinen Blick, und obwohl keiner von uns etwas sagt, kommt es mir vor, als hätten wir zum ersten Mal ehrlich miteinander gesprochen.
5
»Auf Leila!« Oliver hebt sein Weinglas und stößt mit Apple und dann mit mir an. »Sie hat mich wirklich zu Tode erschreckt.« Sein Handy vibriert. Er blickt auf den Bildschirm und seufzt. »Mein Herausgeber. Da muss ich ran.«
Er steht auf und geht aus dem Esszimmer. Apple langt nach der Weinflasche.
»Finger weg, Apple«, ruft er über die Schulter und sie lässt die Hand sinken.
»Er hat Augen am Hinterkopf«, sagt sie.
Ich unterdrücke ein Gähnen.
»Du bist bestimmt todmüde.«
»Es ist nicht so schlimm. Ich habe im Flugzeug ein bisschen geschlafen. Wie viel Uhr ist es denn jetzt? Zehn. Also ist es zu Hause drei Uhr morgens.«
»Aua! Bleibst du eine Weile hier?«
»Weiß nicht. Ich würde gern so bald wie möglich wieder in das Trainingslager zurück, aber bevor ich gehe, muss ich mit Leila reden.«
Oliver kommt zurück und schüttelt den Kopf.
»Was ist es diesmal?«, fragt Apple.
»Ein paar Spinner haben Briefe verschickt, in denen sie damit drohen, die ganze Welt zu zerstören, wenn wir nicht schnellstens jede Art von Kohlenstoffförderung und -emission beenden. Mein Herausgeber überlegt, ob wir einen Artikel über sie machen sollen.«
»Die verschicken Briefe?«, fragt Apple. »Wer macht das heute noch?«
»Nur paranoide Spinner, die Handys und das Internet ablehnen«, sagt Oliver.
»Was bringt es denn, die Welt zu zerstören, damit wir sie nicht durch den Klimawandel zerstören?«, frage ich.
»Ein wenig differenzierter haben sie sich schon ausgedrückt, muss man fairerweise sagen. Sie scheinen es insbesondere auf die USA und Großbritannien abgesehen zu haben. In beiden Ländern wollen sie Naturkatastrophen auslösen, schreiben sie.«
»Sind das dann noch Naturkatastrophen, wenn sie ausgelöst werden?«
»Gute Frage.«
»Warum in den USA und Großbritannien?«, fragt Apple und streckt die Hand wieder nach der Weinflasche aus, doch Oliver zieht sie weg.
»Was glaubst du?«, fragt Oliver.
Sie zuckt mit den Schultern und ich antworte. »Weil in Großbritannien die industrielle Revolution angefangen hat und die USA das Problem im Wesentlichen gar nicht zur Kenntnis nehmen.«
Oliver hebt die Augenbrauen und nickt. »So ungefähr steht es in den Briefen.«
»Und schreibst du was drüber?«, fragt Apple.
»Nur wenn tatsächlich was passiert. Aber wir haben Kontakt zu einigen Leuten in der Regierung, die heute den gleichen Brief bekommen haben. Quer durch alle Parteien.« Er zuckt mit den Schultern. »Spinner mit einer gut gefüllten Portokasse.«
Wenig später bekomme ich ein Gästezimmer gezeigt. Das Haus ist riesig – aber in den USA kommt mir sowieso alles größer und lauter vor.
Ich hole mein Handy heraus. Vor einer Weile habe ich Dad und Jax geschrieben, dass Leila aufgewacht ist, und sie haben beide geantwortet, wie sehr sie das freut. Seitdem nichts mehr.
Ich sollte nicht anrufen, es ist dort noch früh, aber ich frage mich jetzt, ob das, was Dad so spät noch beschäftigt hat, dasselbe war, wegen dem Olivers Herausgeber angerufen hat – er sprach doch von den USA und Großbritannien.
Lieber schreibe ich ihnen, statt sie anzurufen. Ich öffne Signal, aber obwohl es sicher ist, zögere ich, weil ich nicht weiß, was ich schreiben soll. Ich will nicht schreiben, was Oliver gesagt hat. Hätte er es uns vielleicht gar nicht sagen dürfen?
Ich entscheide mich für: Gehe jetzt schlafen. Gebt Bescheid, wenn es etwas Neues gibt.
Ich lege mich hin, bin aber noch so wach, dass ich nicht schlafen kann. Natürlich könnte ich dem Jetlag die Schuld daran geben, aber einzuschlafen ist mir nie leichtgefallen und in letzter Zeit scheint es noch schlimmer zu werden. Ich bin ruhelos, bedrückt, aber es liegt nicht nur an Leilas Unfall und der anderen Zeitzone. Mir fehlt etwas, etwas, das ich brauche. Zuerst habe ich gar nicht daran gedacht, weil so viel passiert ist, aber wegen der Abreise von der Schwimmschule habe ich meinen Tag im Meer verpasst. Obwohl die Schule an der Küste liegt, haben wir in Schwimmbecken trainiert, bis auf einen Tag in der Woche, an dem wir ins Meer durften – und den musste ich nun sausen lassen.
Mit einem Seufzer erinnere ich mich, wie ich mit Tabby am Schulzaun gestanden und über das endlose Blau unter uns geblickt habe. Beide sehnten wir uns nach dem Meer, aber das war nicht alles. Jedenfalls nicht für mich. Ich wollte schwimmen, aber nicht allein. Ich wollte es zusammen mit Tabby tun.
Wieder wünsche ich mir, ich hätte Becker eine Nachricht für sie mitgegeben. Sie wird merken, dass ich nicht da bin, und bestimmt nach mir fragen. Oder?
Aber vielleicht ging es ihr ja gar nicht so wie mir. Vielleicht habe ich mir das, was ich in ihren Augen gesehen habe, nur eingebildet, weil ich es sehen wollte. Und dann tauchte Nadya auf, die Sportpsychologin, und störte uns. Sonst hätte ich vielleicht etwas gesagt oder getan, keine Ahnung.
Es kam mir so vor, als ob jedes Mal, wenn ich mit Tabby allein war, zufällig jemand vom Personal vorbeikommen würde. Geradezu als wollte man uns absichtlich auseinanderhalten.
Gut, das ist jetzt paranoid und ein Versuch, der Schule die Schuld daran zu geben, dass ich mich nicht getraut habe, mit Tabby über meine Gefühle zu sprechen. Das nächste Mal, wenn ich sie sehe, tue ich es. Jetzt versuche ich erst mal, nicht an sie zu denken und meinen Kopf leer zu machen. Ich schließe die Augen und stelle mir vor, ich könnte trotzdem noch sehen. Seltsame Dinge tauchen auf und verlieren sich wieder in der Dunkelheit. Blätter bewegen sich wie in einer Brise, dahinter spähen Augen hervor und verschwinden im Dunkel …
Es ist ein Wald, ein Wald unter Wasser. Seegras, das an Felsen unter mir hängt, treibt träge in der Strömung, streift meine Haut, dass ich fröstle.
Ich habe mich versteckt.
Jemand sucht mich, will mich, mein Fleisch zwischen den Zähnen.
Aber auch mein Verfolger hat sich versteckt. Dass ich ihn nicht sehen kann, macht mir Angst. Ich werde mit ihm zusammenstoßen und nicht rechtzeitig fliehen können. Ich gerate in Panik, will nach oben schwimmen und an Land.
Nein! Genau das will er doch, dass ich aus der Deckung komme. Bleib in deinem Versteck.
Ich schwimme tiefer in den Wald hinein.
6
Wach auf!
Ich öffne die Augen, bin aber orientierungslos, nur zum Teil da, der andere Teil hat immer noch Angst und versteckt sich im Traum unter Wasser. Blitze, die durch das Fenster scheinen, blenden mich, im nächsten Moment gefolgt von einem Donnerschlag, der so laut ist, dass mir die Ohren klingeln, während ich noch gegen die Nachtbilder anblinzele. Draußen tobt ein heftiges Gewitter. Hat es mich geweckt?
Oder war es mein Handy, das im selben Moment klingelt?
Ich taste danach. »Ja?«
»Hi, Denzi.« Es ist Dad.
»Was ist los?«
»Ein Hurrikan hat Südengland heimgesucht.«
»Was? Im Ernst?«
»Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe, ich …«
»Was ist los?«
»Ich wollte nur deine Stimme hören, Denzi. Deine Schule ist betroffen, der ganze Küstenabschnitt. Eine Sturmflut hat alles komplett überrollt. Ich bin so froh, dass du nicht da warst.«
»Mein Gott! Ist jemand verletzt worden? Sind alle rausgekommen?« Tabby!
»Keine Ahnung. Ich gebe dir Bescheid, sobald ich mehr weiß. Aber das ist nicht alles, es hat außerdem …«
Ein extrem lauter Donnerschlag übertönt alles, was er noch sagt, und dann ist die Leitung tot.
Ich blicke auf den Bildschirm. Kein Netz.
Wie versteinert sitze ich da. Eben habe ich noch geschlafen, jetzt … etwas, das ich nicht begreife. Ist das wirklich passiert? Hat Dad angerufen und gesagt … ein Wirbelsturm, die Schule. Ist Tabby etwas passiert? Nein, das darf nicht sein, vollkommen ausgeschlossen …
Reiß dich zusammen! Schau auf dein Handy. Letzte Anrufe und da ist er ja: Dad hat angerufen, es war kein durch Jetlag verursachter Traum. Ich habe immer noch kein Netz, also kann ich ihn nicht zurückrufen und fragen, was er mir noch sagen wollte. Soll ich einen Festnetzanschluss suchen?
Ich drücke auf den Lichtschalter. Nichts. Auch der Strom ist ausgefallen.
Ich blicke durch das Fenster in die dunkle Nacht. Nirgends brennt Licht, bis der nächste gewaltige Blitz den Himmel erleuchtet. Noch nie habe ich solche Blitze gesehen – endlos lang und über den ganzen Himmel verzweigt. Dann bricht plötzlich der Regen los, prasselt nieder und ertränkt alles.
»Denzi!« Im Flur ruft jemand meinen Namen. Ich taste mich zur Tür und trete nach draußen. Jemand flucht, dann nähert sich eine Taschenlampe. Es ist Oliver, dicht gefolgt von Apple. »Komm. Wir gehen in den Schutzraum.«
»Den was?«
»Schutzraum! Dort sind wir sicher.«
Wieder ein Blitz und sein Gesicht … als ich es sehe, stelle ich keine weiteren Fragen, sondern steige einfach hinter ihm und Apple die Treppe hinunter. Sein Ausdruck war ganz panisch. Wir gehen durch eine Tür und dann noch eine – sie ist schwer, verstärkt? Oliver zieht sie hinter uns zu und verriegelt sie. Dann betätigt er einige Schalter und das Licht geht an.
»Wir haben einen Generator«, sagt er, sinkt auf einen Stuhl und schüttelt den Kopf.
»Dad, was ist los?«, fragt Apple.
»Ein Hurrikan. Er hat New York getroffen. Vielleicht zieht er in unsere Richtung weiter.«
»Nein, wie schrecklich!« Apple schlägt entsetzt die Hand vor den Mund. »Emmie, meine Freundin, ist dort – Shopping mit ihrer Mum.«
»An der englischen Südküste hat es auch einen Hurrikan gegeben«, sage ich. »Ich habe gerade mit meinem Dad gesprochen, aber dann wurde die Verbindung unterbrochen.«
Wir sehen uns an und scheinen alle gleichzeitig dasselbe zu denken. Apple findet die Sprache zuerst wieder. »Dad? Diese Briefe – sie haben doch von Naturkatastrophen in den USA und Großbritannien gesprochen.«
»Aber wie kann man einen Hurrikan auslösen?«, fragt Oliver. »Von zweien ganz zu schweigen.«
»Wie verrückt ist das denn?«, sage ich.
Das Licht wird plötzlich heller, wir haben offenbar wieder Strom.
»Wenn man es tatsächlich kann, werde ich es herausfinden«, sagt Oliver.
7
Oliver lässt uns im Schutzraum allein, nachdem er sämtliche Wetterberichte studiert hat. Der Hurrikan wird sich abschwächen und uns nicht erreichen. Oliver hat auch in der Klinik angerufen und dort ist alles in Ordnung, also ist Leila auch nichts passiert. Es gießt immer noch in Strömen, aber Blitze und Donner entfernen sich zusehends und verschwinden schließlich ganz.
Ich sitze neben Apple auf dem Sofa, vor den laufenden Nachrichten. Auch die Mobilfunknetze sind wieder da und ich versuche Dad anzurufen, aber es geht nur der Anrufbeantworter dran. Wenig später schreibt er, dass er in einer COBRA-Sitzung ist. Er will versuchen, so viel er kann über die Schule herauszufinden, und meldet sich so bald wie möglich wieder.
»Irgendwas Neues?«, fragt Apple und ich zeige ihr die Nachricht. »Was ist COBRA?«
»Ein Krisenausschuss, der in den Cabinet Office Briefing Rooms tagt. Bestimmt wegen des Hurrikans.«
Mich wundert, dass Dad mir mitten aus einer solchen Sitzung schreibt – vermutlich mit der Premierministerin und wichtigen Beratern.
Apple sieht auf ihr Handy und schüttelt den Kopf. Immer noch keine Antwort von ihrer Freundin aus New York. Ab und zu schließt sie die Augen und bewegt stumm die Lippen. Sie betet, sagt sie auf meine Frage. Ich bin ganz ohne Kirche aufgewachsen und fühle mich bei so was eigentlich unwohl, aber nicht heute.
In den Nachrichten ist nur noch von den Briefen die Rede, von denen Oliver uns gestern Abend erzählt hat. Jede Zeitung, jeder Fernsehsender und jedes Ministerium hat gestern einen bekommen. Absender war eine Gruppe, die sich »Der Kreis« nennt. Sie hat angekündigt, in den USA und Großbritannien Naturkatastrophen auszulösen, und bingo! – am folgenden Tag gibt es zwei Hurrikans. Die Gruppe fordert sofortige Maßnahmen zur radikalen Reduzierung der Emissionen und einen Stopp jeglicher Öl- und Gasförderung, sonst würden weitere Katastrophen folgen. Ökoterroristen nennt man sie inzwischen.
»Können die wirklich Wirbelstürme auslösen?«, fragt Apple. »Wie denn?«
»Keine Ahnung«, sage ich.
»Wenn ja, dann wäre man nirgends in Küstennähe sicher.«
»Ich will nach Hause. Kann ich deinen Laptop benutzen?«
Sie gibt ihn mir und ich suche nach Flügen. »Da geht nichts mehr. In der ganzen Gegend sind die Flüge gestrichen. Die Flughäfen haben wegen Starkwind, überfluteter Rollbahnen oder beidem geschlossen.«
Apple schiebt ihre kalte Hand in meine. Stunde um Stunde sehen wir Nachrichten.
Die Bilder sind unglaublich. In England ist es bestimmt auch schlimm, aber ein Hurrikan in New York?
Eine verheerende Katastrophe.
Angeblich war es ein Hurrikan der Stufe vier. Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu zweihundertfünfzig Stundenkilometern haben Fensterscheiben eingedrückt, Dächer abgerissen, Trümmer wie Geschosse durch die Gegend fliegen lassen, und das war noch gar nicht das Schlimmste.
Der Hurrikan drückte eine Sturmflut in den New Yorker Hafen, und der Hafen ließ das Wasser wie ein Trichter noch höher steigen, sodass fast ein Tsunami daraus wurde. Dass sowieso gerade Hochwasser war, machte alles noch schlimmer. Brooklyn und Staten Island wurden schwer getroffen. East River und Hudson überschwemmten die Südspitze von Manhattan. Straßen, U-Bahnen und Eisenbahntunnel sind mit Wasser vollgelaufen, Brücken und Tunnel nicht passierbar. Die Millionen von Einwohnern sind abgeschnitten, sitzen in der Falle, während es immer weiterregnet und das Wasser stetig steigt.
Und niemand konnte vor der Katastrophe gewarnt werden. Es ging kein Tropensturm voraus, der beobachtet und dessen Risiko eingeschätzt werden konnte, um dann die Evakuierung anzuordnen. Der Hurrikan entstand gleichsam aus dem Nichts.
Apple sieht wieder auf ihrem Handy nach. »Immer noch keine Antwort«, sagt sie.
»Vielleicht haben die dort kein Netz.«
»Vielleicht.«
»Als Dad angerufen hat, sagte er, meine Schule sei von der Sturmflut komplett überrollt worden – genau so hat er sich ausgedrückt. Da wäre ich jetzt, wenn ich nicht zu euch gekommen wäre.«
Und die vielen anderen? Konnten sie entkommen? Vor allem Tabby. Da war etwas an ihr, keine Ahnung, wie ich das erklären soll – jedenfalls muss ich sie unbedingt wiedersehen. Sie muss einfach überlebt haben!
»Wir sehen uns das hier an und es ist die schreckliche Wirklichkeit«, sagt Apple. »Und es ist genauso schrecklich und wirklich, wenn es auf den Philippinen passiert oder in der Karibik. Aber obwohl alle Experten sagen, dass so was wegen des Klimawandels in Zukunft öfter und in noch schlimmerer Form passieren wird, tut hier niemand was. Vielleicht will diese Gruppe, dieser Kreis, das rüberbringen.«
»Keine Ahnung. Vielleicht. Ist aber ganz schön drastisch, ihre Methode.«
»Vielleicht ist es das einzige Mittel. Vielleicht handeln die Regierungen ja, wenn sie von den Folgen des Klimawandels persönlich betroffen sind. Jedenfalls würde Leila das sagen.«
»Ja?«
»Du kennst sie wirklich nicht, oder?«
»Nein.«
Mein Handy klingelt. Ich blicke auf den Bildschirm und nehme ab.
»Dad?«
»Hi, Denzi. Ich hab nur einen Moment und wollte sichergehen, dass bei dir alles in Ordnung ist.«
»Ja, ich will nur wissen, was mit meiner Schule ist. Irgendwelche Neuigkeiten?«
»Tut mir leid, aber es sieht schlecht aus. Die Sturmflut hat den ganzen Küstenabschnitt unter Wasser gesetzt. Sie suchen mit Booten und Hubschraubern nach Überlebenden. Das Gebiet ist vollkommen abgeschnitten. Wenn ich noch was erfahre, gebe ich dir Bescheid.«
»Dad? Da war ein Mädchen in der Schwimmschule, sie hieß Tabby – oder auch Holly. Ich glaube, Tabby war ihr mittlerer Name. Ihren Nachnamen habe ich nicht. Ich muss dringend wissen, ob ihr etwas passiert ist.«
»Ich werde versuchen, es herauszufinden.«
Man hat einige Experten zu Wirbelstürmen ausfindig gemacht, die jetzt im Fernsehen interviewt werden. Sie reden darüber, wie ein Hurrikan entsteht und ob man ihn auslösen kann. Das glauben sie nicht – auch wenn sie keine klaren Aussagen machen, hört man es doch aus ihren Worten heraus.
»Aber wenn man einen Hurrikan nicht auslösen kann, wie kann diese Gruppe dann am Tag vorher Briefe verschicken, die damit drohen?«, fragt Apple.
»Eben. Und die Experten haben keine Erklärung dafür, warum sie das Unwetter nicht haben kommen sehen. Das war kein Sturm, der sich allmählich zu einem Hurrikan entwickelt hat, sondern der Hurrikan war plötzlich da, aus heiterem Himmel.«
Ich bin wieder an Apples Laptop und versuche das alles zu verstehen. »Hurrikans entstehen bei einer Wassertemperatur von über 26,5 Grad Celsius. Das Wasser verdampft und kondensiert, im Zentrum entsteht Unterdruck und der Wind wirbelt darum herum. Wenn man also einen Hurrikan auslösen will, muss man erst mal eine genügend große Wasserfläche erwärmen.«
»Okay, aber wie?«
»Die Meerestemperaturen sind aufgrund des Klimawandels schon höher als früher, aber nicht so hoch, dass es in unserem Fall für einen Hurrikan ausgereicht hätte. Wenn man Chemikalien wie Natrium ins Wasser kippt, heizen sie es auf, aber das würden diese Aktivisten, die die Umwelt schützen wollen, doch wohl eher nicht tun. Eine andere Möglichkeit wären Mikrowellen.«
»Mikrowellen? Dafür bräuchte man aber einen ziemlich großen Mikrowellenherd.«
»Angeblich kann man Mikrowellen auch per Fernsteuerung auslösen.«
»Das klingt alles sehr nach Science-Fiction.«
»Schon. Aber entweder sie haben die Wirbelstürme ausgelöst oder sie können sie besser voraussagen als unsere Behörden und haben sie kommen sehen und sich selbst als Urheber ausgegeben. Was klingt wahrscheinlicher?«
Apples Handy piept – eine Nachricht. Sie drückt darauf und grinst breit. »Das ist Emmie. Es geht ihr gut!« Sie bricht in Tränen aus und ich drücke ihr unbeholfen die Schulter. Ich freue mich für sie, aber ich wünsche mir eine solche Nachricht auch für mich – dringend.
Tabby, wo bist du?
8
Die Straßen sind verwüstet. Obwohl der Hurrikan gar nicht bis Washington gekommen ist, haben seine Ausläufer Bäume umgestürzt und der Starkregen hat tiefer gelegene Gebiete überflutet.
Wir konnten Leila heute deshalb nicht besuchen. Aber dann, kurz vor dem Abendessen, ist sie plötzlich zu Hause. Ein Taxi ist irgendwie durchgekommen.
»Was machst du hier?«, fragt Oliver. »Hieß es nicht, du solltest noch ein paar Tage bleiben?«
»Ich habe mich selbst ausgecheckt. Die wollen doch nur noch ein paar astronomische Tagessätze kassieren! Es geht mir gut, und ich würde durchdrehen, wenn ich noch länger dortbleiben müsste.«
Und sie sieht auch aus, als ob es ihr gut geht, wirklich. Man würde nie vermuten, dass sie vor nur einem Tag noch an piepsende Geräte angeschlossen war, für niemanden erreichbar. Selbst die Schürfwunden an der Wange sind fast verschwunden und sie trägt keinen Stirnverband mehr.
Oliver und Apple bemuttern sie, nötigen sie, sich hinzusetzen. Ich halte mich im Hintergrund, aber sie sieht mich direkt an.
»Also habe ich es mir nicht nur eingebildet: Du warst tatsächlich in der Klinik, Denzi.«
»Ja. Bin ganz schön weit gereist, um dich zu sehen.«
»Du sagtest, du hättest Fragen an mich.«
»Du hast gehört, was ich gesagt habe? Alles?«
»Ich glaube schon. Es ging vor allem ums Schwimmen. Du hast das Trainingslager verlassen, um zu kommen?«
»Stimmt. Aber Dad hat angerufen und gesagt, dass die Schule – also das Sommertrainingslager findet an derselben Schule statt, in die ich auch sonst gehe –, also, dass sie von einer Sturmflut überschwemmt wurde. Er ist heilfroh, dass ich nicht dort war.«
»Da kann er mir ja dankbar sein. Es gibt für alles ein erstes Mal.«
Da ist sie – die Feindseligkeit, die ich immer von ihr spüre. Zwar ist mir klar, dass sie mehr meinem Vater gilt und weniger mir, aber es fühlt sich nicht so an. Was habe ich mir dabei gedacht, mit ihr reden zu wollen? Es hat sich nichts geändert.
Bevor ich noch überlegen kann, was ich sagen soll, bringt Oliver das Essen herein.
Nach dem Essen gehen wir wie selbstverständlich zu den Sofas vor dem Fernseher, der schon den ganzen Tag läuft.
»Ich habe auch eine Neuigkeit für euch«, sagt Oliver. »Ich fahre morgen früh nach New York. Dann übernimmt Apple hier die Verantwortung.«
Apple klatscht in die Hände. »Endlich!«
»Nur weil Denzi irgendwann fährt und Leila vielleicht eine Gehirnerschütterung hat.«
»Was machst du in New York?«, frage ich.
»Über die Katastrophe berichten, vor allem über ihre unschönen dunklen Seiten.«
»Macht bestimmt Spaß«, sagt Apple.
»Wem wird zuerst geholfen?«, fragt Oliver. »Den Weißen, Reichen und Gutaussehenden. Wer wird vergessen? Die Armen, die Schwachen und die Farbigen, wie Apple und ich. Auch wenn die Behörden sich noch so oft zur Black-Lives-Matter-Bewegung bekennen, man muss es immer wieder herausschreien. Ich muss dort sein und sie zur Rechenschaft ziehen.«
»Woher weißt du, dass es so kommt?«
»Ich weiß es einfach.«
Leila hebt die Hand und stellt den Fernseher per Fernbedienung lauter. Wir sollen zuhören.
»… jetzt aus dem Weißen Haus.«
Der Präsident sitzt an dem großen Schreibtisch im Oval Office und sagt das Übliche zu Mitgefühl und Hilfe für die Betroffenen. Oliver tut im Hintergrund so, als müsse er sich übergeben.
»Jetzt zu der Organisation, die sich selbst ›Der Kreis‹ nennt. Wir wissen noch nicht, ob ihre Mitglieder die Stürme, die New York und England verwüstet haben, tatsächlich verursacht haben könnten. Aber wenn ja, werden sie es bereuen, so viel ist sicher. Es ist ein Anschlag nicht nur auf die große Stadt New York, sondern auf unsere Lebensart und alles, was uns Amerikanern lieb und teuer ist.«
Er redet noch eine Weile so weiter und Leila nimmt die Fernbedienung und stellt den Fernseher leiser.
»Kein einziges Wort – habt ihr das gehört?«, sagt sie. »Kein einziges Wort zum Klimawandel, zur globalen Erwärmung und so weiter.«
»Findest du es richtig, wenn man den Leuten eine Pistole an den Kopf hält, damit sie von traditionellen Autos auf Elektroautos umsteigen?«, fragt Oliver.
»Natürlich nicht.«
»Oder wie wäre es damit: Ist es richtig, den Familien die einzige Möglichkeit zu nehmen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und ihre Kinder zu ernähren? Selbst wenn sie es in der schmutzigen Industrie tun?«
»Und wenn die schmutzige Industrie ihre Kinder vergiftet, das Land verwüstet und ihnen die Möglichkeit nimmt, wie früher vom Land zu leben?«
»Ist es richtig, arme Länder daran zu hindern, sich durch Abbau von Bodenschätzen von der Armut zu befreien?«
Apple gibt mir eine Schüssel mit Popcorn. »Das ist besser als Kino«, sagt sie leise zu mir.
Oliver wirft ein Kissen nach ihrem Kopf, aber sie duckt sich und das Kissen fliegt über die Sofalehne.
»Ja«, sagt Leila. »Man muss verhindern, dass sie die Erde weiter ausbeuten, und sie dafür angemessen entschädigen.«
»Das wird nie geschehen. Es ist nicht die amerikanische Art, und ich sehe auch nicht, dass Großbritannien oder die EU Schritte in dieser Richtung unternehmen.«
»Das sollten sie aber lieber.«
»Sie werden es nicht tun. Zumal sie ja entweder leugnen, dass es überhaupt ein Problem gibt, oder es ignorieren, wenn es ihnen nicht in den Kram passt.«
Leila ballt die Fäuste. »Dieser Idiot im Weißen Haus und seine idiotischen Freunde behaupten doch, der Klimawandel sei erfunden worden als Angriff auf die amerikanische Lebensart. Was soll das überhaupt bedeuten?«
»Sich alles zu nehmen und sich nicht darum zu scheren, wem es wehtut?« Oliver wendet sich an mich. »Was hältst du von unserem Präsidenten, Denzi?«
Erwischt. »Hm, also …«
Er lacht. »Du kannst in diesem Haus alles sagen, ohne jemanden zu kränken. Aber draußen solltest du lieber aufpassen, solange du noch hier bist.«
»Ich kann nicht fassen, dass die den Klimawandel wirklich für eine Erfindung halten«, sage ich. »Trotz der Hitzewellen, der Waldbrände, der schmelzenden Gletscher und der steigenden Meeresspiegel.«
»Wenn man etwas glauben will, ist das ganz leicht«, sagt Oliver. »Außerdem erzählen die Lobbyisten der Öl- und Gasindustrie ihnen seit Jahren Unsinn.«
»Ist das überhaupt legal?«
»Natürlich. Du kannst auf dieser Seite des Großen Teichs glauben und sagen, was du willst. Die Wahrheit ist eine Ware, die man wie jede andere kaufen und verkaufen kann. Und es ist schwer, sich mit einer Industrie anzulegen, die mit ihrem Geld den Wahlkampf bezuschusst und die Politiker im Amt hält.«
»Und ist das legal?«
»Also, es gibt verschiedene Arten von legal. Es gibt immer eine Möglichkeit, das Geld dort hinzubekommen, wo man es haben will, vorausgesetzt, man hat genug davon.«
»Abgesehen von dem Quatsch, der da mehr oder weniger laut in wichtige Ohren geflüstert wird, bin ich mir zunehmend unsicher, ob wir mit dieser Situation angemessen umgehen«, sagt Leila. »Innerhalb eines Systems wie dem unseren und nach seinen Regeln zu arbeiten, bringt uns nirgendwohin. Immer wenn wir glauben, wir hätten einen Schritt nach vorne getan – eine Pipeline aufgehalten, Fracking in gefährdeten Gebieten verboten –, gehen wir anderswo zwei Schritte zurück.«
»Es ist das einzige System.«
»Dann muss es sich ändern.«
»Jawohl! Zurück zum Generalangriff auf die amerikanische Lebensart«, ruft Oliver. Während ich zuhöre, wie Oliver und Leila sich streiten, frage ich mich, wie Leila gegenüber Dad war. Dad hat zwar seine eigene Meinung, aber er drückt sie nie so direkt aus wie die beiden jetzt. Er ist immer ruhig, leise und höflich, sogar wenn niemand zuhört.
Leila und Oliver stimmen auf eine Art überein, wie Leila und Dad es nie getan haben. Von Weitem betrachtet scheinen eine gutbürgerliche Britin, die in Oxford studiert hat, und ein zynischer amerikanischer Journalist nicht gut zusammenzupassen, aber in Wirklichkeit sagen sie mit verschiedenen Akzenten in etwa dasselbe. Beide wollen für Veränderungen kämpfen, etwas bewegen, und der zurückhaltende englische Teil von mir kommt damit nicht gut zurecht, während die andere Hälfte sich wünscht, ich wäre genauso. Bin ich Dad zu ähnlich und nicht genug wie Leila? Wenn ja, wessen Schuld ist es?
In meiner Hosentasche vibriert mein Handy und ich ziehe es heraus – es ist Jax.
Hallo du, dein Dad hat mich gebeten, nach Flügen zu suchen. Sieht so aus, als würden die Flughäfen morgen wieder öffnen, ich kann dir einen buchen, der am frühen Abend geht. Ist das okay oder willst du noch eine Weile bleiben?
Ich zögere nicht lange. Selbst wenn ich nicht ins Trainingslager zurückkann, will ich doch auch nicht länger als nötig hierbleiben. Ich will – muss – immer noch schwimmen. Aber vor allem will ich nach Hause.
Morgen am frühen Abend klingt gut.
Okay, dann buche ich das und maile dir das Ticket.
Es kommt wenig später.
Ich warte, bis Oliver und Leila gleichzeitig Luft holen, und melde mich zu Wort. »Ich habe ein Ticket für einen Flug nach Hause morgen um sechs«, sage ich. »Passt das?«
»Morgens oder abends?«, fragt Apple.
»Abends.«
»Ich kann dich bringen«, sagt sie.
Bilde ich es mir ein, oder wirkt Leila enttäuscht?
Später am Abend bin ich am Handy und sehe mir alles an, was ich online über den Hurrikan finden kann, der die englische Südküste verwüstet hat. Hier in Washington drehen die Nachrichten sich fast ausschließlich um New York.
Die Karten der Nachrichtensender zeigen, dass die Schule mitten an dem Küstenabschnitt lag, der von Sturm und Sturmflut am schlimmsten betroffen war. Große Gebiete sind immer noch abgeschnitten.
Die Vorstellung, das Meer könnte an den Klippen aufsteigen und die Schule überschwemmen, kommt mir absurd vor.
Vielleicht ist Tabby gar nichts passiert. Menschen überleben immer wieder auf die unglaublichste Art und schwimmen kann sie schließlich.
Mein Handy piept.
Theo, ein Klassenkamerad, hat eine Nachricht geschickt. Er ist in den meisten meiner Kurse. Eigentlich ist er nett, aber er gehört zu denen, die immer alles über alle wissen wollen, weshalb ich ihm nie etwas erzählen mochte.
Alles klar bei dir? Hab das mit der Schule gehört. Warst du nicht diesen Sommer dort im Trainingslager?
Ich lasse mich erweichen und antworte.
Mir geht’s gut. War nicht da, als es passiert ist.
Geh auf den Schul-Chat und gib den anderen Bescheid, ja? Die machen sich Sorgen. Auch um die Lehrer und Angestellten, die den Sommer über dort waren.
Ich bekomme ein schlechtes Gewissen. Ich war so sehr mit dem Trainingslager und Tabby beschäftigt, dass ich gar nicht an die vielen Angestellten gedacht habe – in der Verwaltung, in der Küche und auf dem Gelände –, die nicht nur während der Schulzeit, sondern auch in den Sommerferien dort sind.
Ich gehe auf die Website der Schule und logge mich ein.
Dort lese ich einen kurzen Post von Mr Khan, dem Rektor. Er sagt, das gesamte Schulgelände sei von der Sturmflut überschwemmt worden. Das genaue Ausmaß der Schäden ist noch nicht bekannt und auch nicht, wer sich dort aufgehalten hat und was mit ihnen passiert ist. Sobald mehr bekannt ist, soll es ein Update geben.
Zu meiner Überraschung habe ich ganz viele Nachrichten bekommen. Ich gehöre eigentlich zu keiner Clique, aber so viele wussten, dass ich dort war, und machen sich Sorgen. Ich bin ganz gerührt.
Tut mir wirklich leid, dass ich mich nicht früher gemeldet habe. Es geht mir gut, ich war nicht da. Ich beantworte eine Nachricht nach der anderen und anschließend poste ich dasselbe noch auf der Chat-Seite.
Ich kehre zu den Nachrichten über das Unwetter zurück, aber dann bin ich das viele Elend leid und suche nach Berichten von Überlebenden. Unter anderem stoße ich auf diese Links: Mädchen von Delfinen geborgen, Das Wunder des Delfinmädchens, Durch Glück überlebt: Mädchen von Delfinen gerettet.
Es sind alles Variationen derselben Geschichte: Ein bewusstloses Mädchen wurde von Delfinen gerettet und von einem Fischer aus dem Meer gezogen. Das soll an der Küste einige Kilometer östlich von der Schule passiert sein. Ein paar unscharfe, im Regen aufgenommene Fotos scheinen ein Mädchen zu zeigen, das im Meer von nebeneinanderschwimmenden Delfinen getragen wird. Das kann doch nicht echt sein! Jemand hat das digital bearbeitet, um eine Viertelstunde lang groß rauszukommen.
Der Name des Mädchens wird nicht genannt, und das Foto von ihr ist schlecht, aber wenn ich die Augen zusammenkneife … Also, es könnte Tabby sein. Die Proportionen stimmen und sie hat dieselben langen schwarzen Haare.
Aber vielleicht klammere ich mich nur an einen Strohhalm – hoffe auf ein Wunder, auch wenn es noch so unwahrscheinlich ist, an einem Tag, an dem Wunder Mangelware sind.
Die Sonne brennt herunter. Das Geländer, an dem ich lehne, ist heiß. Ich habe den Blick nach unten auf die Wellen gerichtet, die sanft gegen die Stützen plätschern. Auf meinen Lippen ist Salz, es schmeckt wie eine Droge. Ich muss mich am Geländer festhalten, damit ich nicht draufsteige und mich mit einem Sprung vom Steg in die Tiefe stürze.
Ich will mich gerade zwingen, auf dem Pier zum Ufer zurückzukehren, um auf die sichere Weise über den Strand ins Meer zu