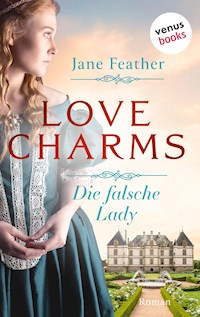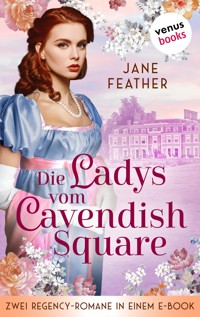4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Regency Nobles
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Erleben Sie grenzenlose Liebe und Leidenschaft im Regency-Roman »Das Begehren des Lords« von Jane Feather – jetzt als eBook bei dotbooks. Völlig unerwartet steht der Adelige Sebastian Sullivan seiner großen Liebe aus vergangenen Tagen gegenüber: Vor Jahren hat die wunderschöne Serena Grantley ihn verlassen und brach ihm damit sein Herz. Trotz dieser schmerzlichen Vergangenheit kann Sebastian nicht verhindern, dass die lang vergessen geglaubten Gefühle wieder aufflammen – stärker als je zuvor. Und auch Serena scheint nicht abgeneigt zu sein … Doch um das Erbe seiner Familie zu sichern, wird Sebastian von seinem Onkel dazu gezwungen, eine andere Frau zu heiraten. In seinen Gedanken ist aber nur Platz für Lady Serena, in deren schönen Augen ein dunkles Geheimnis verborgen liegt … »Die unvergleichliche Jane Feather überzeugt wie gewohnt mit großartigen Charakteren und einer spannenden Geschichte.« Romantic Times Begleiten Sie in der Regency-Trilogie »Das Erbe von Blackwood« die drei adeligen Brüder Jasper, Sebastian und Peregrine auf ihrer abenteuerlichen Brautschau im London des 18. Jahrhunderts. Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Das Begehren des Lords« von Romance-Bestseller-Autorin Jane Feather. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Ähnliche
Über dieses Buch:
Völlig unerwartet steht der Adelige Sebastian Sullivan seiner großen Liebe aus vergangenen Tagen gegenüber: Vor Jahren hat die wunderschöne Serena Grantley ihn verlassen und brach ihm damit sein Herz. Trotz dieser schmerzlichen Vergangenheit kann Sebastian nicht verhindern, dass die lang vergessen geglaubten Gefühle wieder aufflammen – stärker als je zuvor. Und auch Serena scheint nicht abgeneigt zu sein … Doch um das Erbe seiner Familie zu sichern, wird Sebastian von seinem Onkel dazu gezwungen, eine andere Frau zu heiraten. In seinen Gedanken ist aber nur Platz für Lady Serena, in deren schönen Augen ein dunkles Geheimnis verborgen liegt …
Über die Autorin:
Jane Feather ist in Kairo geboren, wuchs in Südengland auf und lebt derzeit mit ihrer Familie in Washington D.C. Sie studierte angewandte Sozialkunde und war als Psychologin tätig, bevor sie ihrer Leidenschaft für Bücher nachgab und zu schreiben begann. Ihre Bestseller verkaufen sich weltweit in Millionenhöhe.
Bei dotbooks erscheinen als weitere Bände der Reihe »Regency Nobles«:
»Das Geheimnis des Earls – Band 1«
»Der Kuss des Lords – Band 3«
Außerdem erscheinen in der Reihe »Die Ladys vom Cavendish Square«:
»Das Verlangen des Viscounts – Band 1«
»Die Leidenschaft des Prinzen – Band 2«
»Das Begehren des Spions – Band 3«
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2018, November 2021
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2011 unter dem Titel »A Wedding Wager« bei Pocket Books, A Division of Simon & Schuster, Inc., New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2012 unter dem Titel »Süßes Spiel der Begierde« bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2011 by Jane Feather
Copyright © der deutschen Ausgabe 2012 by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House, München
Copyright © der Neuausgabe 2018, 2021 dotbooks GmbH, München
Published by Arrangement with Jane Feather.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock sowie © Period Images / VJ Dunraven Productions
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-96655-944-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Das Begehren des Lords« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jane Feather
REGENCY NOBLESDas Begehren des Lords – Band 2
Roman
Aus dem Amerikanischen von Jutta Nickel
dotbooks.
Prolog
London, 1759
Der Schritt des jungen Mannes, der die Charles Street hinuntereilte, war so federnd wie eigentlich nur bei Verliebten. Lärmende Musik von der Piazza am Covent Garden erfüllte die Luft. Der junge Mann war groß und elegant. Den Dreispitz zierte dieselbe silberfarbene Borte wie auch seine Handschuhe, den Mantel und die Kniebundhosen aus tiefgolden schimmernder Seide, und die wohlgeformten Schenkel taten den mit goldenen Bommeln verzierten Seidenstrümpfen alle Ehre.
Es war ein wundervoller Vormittag im Mai, wie geschaffen dafür, sich auf die Suche nach der Liebe zu machen. Das Laub an den Bäumen war noch frisch und grün, noch nicht befleckt vom Schmutz der City und dem stinkenden Rauch der Seekohle, der sich unter die fauligen Gerüche der Gosse mischte. Die Fenster der Hütten standen offen und ließen kühle, angenehme Luft hinein, und die Aussicht auf den Frühlingsanbruch schien der Menschenmenge auf der Straße ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern.
Draußen vor einem großen, schmalen Haus auf halber Strecke der Charles Street blieb der junge Mann einen Moment lang stehen. Er lächelte erwartungsvoll, als er an dem Gebäude hinaufschaute. Beschwingt sprang er die paar Stufen zur Eingangstür hinauf und ließ den Türklopfer so zuversichtlich auf das Holz sausen, als würde er nicht im Geringsten daran zweifeln, dass man ihn mit offenen Armen willkommen heißen würde.
Er musste ein paar Minuten warten, bevor die Tür geöffnet wurde.
»Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, Flanagan.« Das Haar des Mannes schimmerte golden im hellen Sonnenlicht, als er den Hut lupfte und rasch an dem ältlichen Hausverwalter vorbeistob – auch diesmal wieder mit der Zuversicht eines Besuchers, den man willkommen heißen würde. In der kleinen Halle blieb er stehen. Sein Lächeln wich einem verwirrten Stirnrunzeln. Hutschachteln, Truhen und Handkoffer lagen auf dem Boden verstreut.
»Will jemand wegfahren, Flanagan?« Über die Schulter warf er dem alten Faktotum, das noch immer an der halb geöffneten Eingangstür stand, einen Blick zu.
Noch ehe der Mann antworten konnte, ertönte eine scharfe Stimme aus den Schatten hinter der Treppe.
»Ja, Sullivan, genauso ist es. Meine Stieftochter und ich reisen auf den Kontinent.« Ein Gentleman mittleren Alters mit dichtem, eisgrauen Haar und der stocksteifen Haltung eines Soldaten trat ins Licht.
»Das kommt aber reichlich plötzlich, nicht wahr, Sir?« Der Ehrenwerte Sebastian Sullivan musterte General Sir George Heyward misstrauisch. »Als ich Serena gestern Abend gesehen habe, hat sie mir nichts von einer Reise erzählt.«
»Ich darf wohl behaupten, dass Serena in meine Pläne nicht eingeweiht war«, entgegnete der General wegwerfend, »das hat sich inzwischen allerdings geändert. Ich fürchte, dass sie zurzeit nicht zur Verfügung steht. Die Vorbereitungen für unsere Abreise heute Nachmittag nehmen sie sehr in Anspruch.«
»Heute Nachmittag?« Der junge Mann sah entsetzt aus. »Ich ... ich verstehe nicht recht, General Heyward.«
Der General gönnte sich eine Prise Schnupftabak, bevor er mit einem schiefen Lächeln antwortete.
»Ich sehe auch keinen Grund, warum Sie es verstehen sollten, Sullivan. Denn es geht Sie nichts an.«
In Sebastians klaren blauen Augen flammte plötzlich der Ärger auf.
»Ich denke, dass es mich sehr wohl etwas angeht, was Serena vorhat, Sir.«
»Dann sind Sie noch schamloser, als ich es bisher für möglich gehalten habe, junger Mann. Sie können keinerlei Ansprüche auf meine Stieftochter erheben. Weder jetzt noch überhaupt irgendwann.«
Es kostete Sebastian gewaltige Anstrengung, seinen Ärger zu zügeln. Denn es war nur zu wahr. Serena war nicht Herrin ihres eigenen Lebens. Sie hatte sich dem Willen und der Autorität eines Stiefvaters zu unterwerfen, der keinen Hehl daraus machte, dass er die häufigen Besuche des Ehrenwerten Sebastian in seinem Hause kaum dulden konnte, es sei denn, sie waren den Spielzimmern im oberen Stockwerk geschuldet.
»Darf ich sie sehen, Sir?« Er bemühte sich um einen gemäßigten Tonfall.
»Sie ist zu beschäftigt, um Besuch zu empfangen«, erwiderte Sir George abweisend.
»Nein, Sir, das bin ich nicht.« Von der Treppe ertönte eine klare, helle Stimme. Die beiden Männer drehten sich abrupt um. Die junge Frau war auf halber Treppe stehen geblieben, ließ eine Hand auf dem Geländer ruhen und schaute sie mit ernster Miene an. »Komm hoch, Sebastian.« Sie ging wieder die Treppe hinauf.
Sebastian wartete nicht auf die Erlaubnis des Generals. Er rannte ihr förmlich nach, nahm zwei Stufen auf einmal. Oben angekommen drehte sie sich in Richtung eines kleinen Wohnzimmers, das zur Straße hinauszeigte. Das Fenster stand offen; unten ratterten die eisernen Räder der Kutschen über das Kopfsteinpflaster.
»Serena ... Serena, meine Liebe, was ist hier los?« Sebastian warf seinen Hut auf einen Stuhl, trat einen Schritt nach vorn und streckte die Hände aus. »Was zum Teufel hat der General gemeint, als er gesagt hat, dass ihr heute Nachmittag abreist?«
»Ja, wir reisen ab.« Sie machte keine Anstalten, seine Hände zu ergreifen. Ein paar Sekunden später ließ er sie wieder sinken und blickte Serena verwirrt an. »Ich vermute, nach Brüssel.«
»Aber warum nur?«
»Geschäftliche Angelegenheiten.« Sie zuckte die Schultern. »Sir George ist überzeugt, dass wir unser Geschäft auf dem Kontinent besser führen können. Wer bin ich, ihm zu widersprechen?«
»Serena, du darfst nicht gehen ... du kannst doch nicht ... was wird aus uns?« Wie verwundet blickte er sie an.
Wieder zuckte sie die Schultern.
»Ich glaube, dass ich eine Veränderung ganz gut gebrauchen kann, Sebastian. Abgesehen von der Tatsache, dass ich ohnehin keine Wahl habe. London wird langsam öde. Hier haben die Spieltische ihren Reiz verloren. Die Einsätze sind nicht so hoch, wie wir sie brauchen, und die Behörden sind auf unangenehme Art aufmerksam geworden. Wir müssen weiterziehen.«
»Aber was wird aus uns?«, wiederholte er mit seltsam flacher Stimme.
»Was aus uns wird?«, entgegnete sie. Ihre Augen waren auf erschreckende Weise fast violett, wirkten aber so weich und blass wie geschlagene Sahne, als sie ihn mit ausdruckslosem Blick anschaute. »Wir hatten eine vergnügliche Tändelei, mein Lieber, aber mehr auch nicht. Und bedenkt man die Umstände, hat es auch gar nicht mehr sein können. Niemals würde mein Stiefvater eine Verbindung mit einem mittellosen Aristokraten in Erwägung ziehen, noch nicht einmal dann, wenn deine Familie darüber nachdächte, eine Tochter Pharos in ihre Mitte aufzunehmen. Eine Tochter der Spielkarten.«
Sie lachte humorlos.
»Sebastian, du willst mir doch nicht weismachen, dass du jemals mehr als einen kurzen Flirt im Sinn hattest. Denn ich ganz bestimmt nicht. Sollte ich dir diesen Eindruck vermittelt haben, so tut es mir außerordentlich leid.« Sie schob eine rabenschwarze Locke fort, die sich auf ihre Wange verirrt hatte.
Sebastian war plötzlich aschfahl geworden
»Du weißt, dass es nicht wahr ist. Ich liebe dich, Serena. Und du liebst mich ... du weißt, dass es so ist.«
Ungeduldig schüttelte sie den Kopf.
»Sebastian, du bist noch so jung. Was weißt du schon von der Welt? Ich hatte befürchtet, dass du dich aufregen könntest, weshalb ich es dir persönlich sagen wollte. Aber glaube mir, ich habe dich niemals geliebt. Ich kann es mir nicht leisten, überhaupt jemanden zu lieben. Du wirst schon bald die richtige Frau finden. Aber ich kann es nicht sein.«
Zuerst quittierte er ihre Worte mit Schweigen. Dann reagierte er sehr ruhig und gefasst..
»In Wahrheit kenne ich dich nicht«, sagte er, »ich kenne dich nicht im Geringsten.« Er machte auf dem Absatz kehrt, nahm seinen Hut, verließ das Wohnzimmer und schloss leise die Tür.
Serena blieb reglos stehen. Mit einem nicht zu deutenden Blick starrte sie auf die geschlossene Tür. Das ganze Haus schien zu beben, als unten die Eingangstür ins Schloss krachte. Sie erschrak, ging zum Fenster und beobachtete, wie Sebastian in Richtung Piazza eilte, ohne sich noch einmal umzudrehen.
»Ich nehme an, dass du ganze Arbeit geleistet hast ... hast ihn zur Hölle geschickt?« Sie zuckte leicht zusammen, als sie die Stimme des Generals hinter sich hörte, versteifte die Schultern und presste die Lippen zusammen, drehte sich aber nicht um.
»Wie Sie es befohlen haben, Sir«, sagte sie mit kalter Stimme, »ganz wie befohlen.«
»Ich habe dir die Unterredung nicht aufzwingen wollen. Aber da du darauf bestanden hast, ihn zu sehen, kannst du dir höchstens selbst Vorwürfe machen, wenn sie dich peinigt. Und jetzt beeil dich, in einer Stunde brechen wir nach Dover auf.«
Kapitel 1
London, 1762
Jasper St. John Sullivan, der fünfte Earl of Blackwater, musterte seine Zwillingsbrüder mit eigenartigem Lächeln.
»Nun, meine Lieben, ich habe meinen Teil erledigt. Jetzt ist es an euch, das Testament unseres geschätzten Onkels zu erfüllen.«
Einer seiner Zwillingsbrüder starrte unverwandt auf den üppigen Teppich zu seinen Füßen, während der Ehrenwerte Sebastian Sullivan ihn anblickte und fragend die Augenbrauen hochzog.
»Nun, Perry, Jasper hat seine Braut. Was wollen wir tun, um unsere zu finden?«
»Das ist verrückt. Reif für die Irrenanstalt in Bedlam«, verkündete der Ehrenwerte Peregrine und schaute endlich auf. Gewöhnlich sahen seine tiefblauen Augen ernst aus, aber jetzt flackerte. der Spott in ihnen auf. »Bevor der alte Mann stirbt, muss jeder von uns dreien irgendwie eine Frau heiraten, die der geistigen oder moralischen Rettung bedürftig ist, um zu gleichen Teilen seinen Reichtum zu erben. Was ist das für ein Unsinn?«
»Denk doch mal an den Reichtum«, mahnte Jasper sanft und schnupfte eine Prise, »neunhunderttausend Pfund, mein lieber Perry. Das ist nicht zu verachten.« Er ließ die emaillierte Schnupftabakdose in die mit Spitze geränderte Tasche seines Mantels gleiten.
»Das ist so unermesslich viel, dass selbst der größte Geizhals nicht davon zu träumen wagte«, stimmte Sebastian zu und lachte kurz. »Und ich glaube es erst, wenn ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Jede Wette, dass es sich nur um einen teuflischen Trick handelt.«
»Solche Gedanken sind verzeihlich.« Jasper lachte leise. »Unserem verehrten Onkel steckt schließlich der Teufel im Leib. Mag er über Buße faseln, was er will. Das gilt auch für seine vollmundige Rückkehr in den Schoß der Kirche.«
»Aber können wir seinen Worten auch wirklich trauen?«, drängte Sebastian. »Er könnte sein Testament jederzeit erneuern, während wir uns abmühen, ein gefallenes Frauenzimmer auf den Pfad der Tugend zurückzuführen.«
Jasper schüttelte den Kopf.
»Nein, ich zweifle stark daran, dass er es ändern wird, Seb. Viscount Bradley hat einen merkwürdigen Sinn für Ehre, und er wird sein Vermögen der Familie nicht vorenthalten, wenn er es auch anders einrichten kann. Er will uns nur eine Weile leiden sehen.« Er stellte das Sherryglas auf den Kaminsims hinter sich. »Fünftausend Pfund hat er euch gegeben. Geld, das euch bei der Suche nach einer passenden Braut behilflich sein könnte. Ich nehme an, dass ihr den größten Teil davon noch in den Händen haltet? Ich schlage vor, dass ihr es jetzt anrührt, Wir können nicht wissen, wie lange der alte Mann noch durchhält.«
»Oh, er wird die Mühsal seiner irdischen Existenz niemals hinter sich lassen«, verkündete Sebastian, »schon aus purer Gehässigkeit.«
Sein älterer Bruder lachte.
»Stimmt, er wird so lange wie möglich durchhalten. Darauf kannst du zählen.« Auf dem Weg zur Tür schnappte er sich seinen Dreispitz und den silbernen Spazierstock. »Bitte entschuldigt mich, ich bin zum Dinner verabredet.«
Nachdem die Tür sich geschlossen hatte, schauten die Zwillingsbrüder sich einen Moment lang schweigend an.
»Und was jetzt?«, fragte Peregrine schließlich. »Bisher habe ich es vermieden, über diesen lächerlichen Vorschlag auch nur nachzudenken, aber Jasper hat recht. Und weil er seine Braut schon hat, müssen wir nun auch unseren Teil beitragen. Aber wo sollen wir nur anfangen, nach gefallenen Mädchen Ausschau zu halten? Nicht dass ich auch nur eine Minute glaube, dass Clarissa jemals zu ihnen gehört hat.«
Sebastian lachte, als er an die Ehefrau seines älteren Bruders dachte.
»Ja, ich glaube, da hast du ganz recht, Perry. Aber London strotzt nur so vor echter Ware. Du musst doch nur ein einziges Mal über die Piazza schlendern.«
»Dirnen habe ich noch nie anziehend gefunden«, behauptete sein Zwillingsbruder. »Und ich will verdammt sein, wenn ich eine heiraten sollte, Vermögen hin oder her.«
Sebastian grinste.
»Ich bin da nicht so wählerisch, Bruder. Ein wohlschmeckender Brocken einer aus besserem Hause kann recht köstlich sein. Immerhin weißt du bei ihnen, woran du bist.« Ein Schatten glitt über sein Gesicht, was dem stets aufmerksamen und stets vernünftigen Peregrine natürlich nicht entging.
Peregrine sagte nichts, obwohl er wusste, dass sein Bruder an Serena Carmichael dachte – an die Frau, die er geliebt hatte. Die Frau, die ihn ohne Erklärung beiseitegeschoben hatte. In den drei Jahren, die seit Serenas Betrug verstrichen waren, hatte Sebastian sich zwar nach Kräften amüsiert, wenn auch keine seiner Beziehungen über eine oberflächliche Tändelei hinausgegangen war. Seine Geliebten hatte er aus den Reihen der gewerbsmäßigen Dirnen ausgewählt, aus den Reihen der Operntänzerinnen und denen der Orangenverkäuferinnen, und ein- oder zweimal hatte er auch mit Kurtisanen aus den oberen Rängen der Gesellschaft geflirtet; aber niemals war etwas Ernsthaftes daraus geworden.
Sebastian stand auf und reckte sich genüsslich, bevor er zur Tür eilte.
»Also, ich mache mich jetzt auf den Weg. Harley hat zwei Kastanienbraune, die er wohl verkaufen will. Ich möchte mit die beiden gern mal ansehen. Sie würden ein gutes Gespann für diesen offenen Zweispänner abgeben, hinter dem ich schon seit einem Jahr her bin.«
»Und wie bringt das deine Suche nach der perfekten Braut voran?« Sein Bruder folgte ihm zur Tür.
»Mein lieber Bruder, für die Frauen, die wir brauchen, sind weltliche Verlockungen unwiderstehlich«, erläuterte Sebastian hochnäsig und trat hinaus auf die Stratton Street. Er rückte seinen Hut in keckem Winkel zurecht. »Kommst du mit?«
Peregrine überlegte.
»Ja, warum nicht? Heute Nachmittag habe ich sowieso nichts Interessantes mehr vor.«
»Deine Begeisterung ist schier überwältigend, Bruder.« Sebastian schwenkte den Spazierstock, als eine Kutsche vorbeifuhr.
Lord Harley wollte gerade aus dem Haus gehen, als die Brüder ankamen. Gemächlich winkte er ihnen zu.
»Seb ... Perry ... welchem Anlass verdanke ich das Vergnügen?«
»Ich würde mir gern die beiden Kastanienbraunen anschauen, Harley. Vorausgesetzt, du willst sie immer noch verkaufen.« Sebastian warf dem Kutscher eine Münze zu.
»Ja, wenn ich den richtigen Käufer finde und den richtigen Preis erzielen kann«, erwiderte Seine Lordschaft bedächtig. »Gehen wir zum Stall hinüber.«
»Hast du eine andere Verabredung?«, erkundigte sich Peregrine. »Es sieht nämlich so aus, als wolltest du eigentlich woandershin gehen.«
»Oh, das kann warten«, sagte Harley. »Am Pickering Place hat ein neues Spielhaus eröffnet. Ich dachte, ich schaue später mal dort vorbei. Man hat gesagt, es sei eine regelrechte Spielhölle.«
»Und wer führt sie?«
»Keine Ahnung. Neulinge, soweit ich unterrichtet bin. Crawley hat gestern Abend dort gespielt ... die Einsätze sollen sehr hoch sein, hat er mir gesagt.« Lord Harley bog in die Gasse ein, die an der Rückseite seines Hauses entlang zu den Stallungen führte.
Mit geübtem Blick musterte Sebastian die Pferde, die im Hof herumgeführt wurden.
»Was meinst du, Perry?«
»Ich weiß nicht. Ich glaube, Jasper würde sagen, dass sie irgendwie protzig sind.« Peregrine runzelte die Stirn, als die Tiere vor ihnen stehen blieben.
»Unsinn«, schnaubte Sebastian und beugte sich vor, um die Pferde eingehender zu mustern. Mit der Hand fuhr er an ihren Fesseln entlang und über die weichen, muskulösen Flanken. »Harley, es sind wundervolle Tiere.«
»Fünfhundert Guineas«, erwiderte Seine Lordschaft prompt. Sebastian runzelte die Stirn.
»Ich überlege es mir«, sagte er und schüttelte zögerlich den Kopf. »Eigentlich hatte ich nicht im Sinn, mehr als dreihundert auszugeben.«
»Nun, ich habe es nicht eilig, sie abzugeben.« Mit einer Handbewegung bedeutete Harley dem Stallburschen, die Tiere in den Stall zurückzuführen. »Überleg es dir und lass mich wissen, wie du dich entschieden hast.« Er spazierte durch die Gasse zum Ufer der Themse zurück. »Ich weiß nicht, was ihr noch vorhabt, aber ich bin verdammt knapp dran. Zuerst bin ich zum Dinner im Whites verabredet, und dann will ich dem Pickering Place einen Besuch abstatten. Was ist mit euch, kommt ihr mit?«
»Nein, danke«, lehnte Peregrine ab, »ich bin in der Royal Society mit ein paar Leuten zum Abendessen verabredet.«
»Astronomen oder Wissenschaftler?«, erkundigte sich Sebastian und schien über die Verabredung seines Bruders nicht im Geringsten erstaunt.
Peregrine lachte.
»Weder noch. In diesem Fall speise ich mit zwei Philosophen und einem eher mittelmäßigen Dichter.«
»Nun, dann genieße deinen Abend in guter Gesellschaft.« Sebastian schlug seinem Bruder freundschaftlich auf die Schulter. »Ich freue mich auch auf ein gutes Abendessen. Anschließend werde ich den Spielsalons am Pickering Place einen Besuch abstatten.«
»Gib nicht alles auf einmal aus«, warnte Peregrine, während er sich entfernte.
»Was hat er damit gemeint?«, fragte Harley.
Sebastian lächelte.
»Ach, das war nur ein kleiner brüderlicher Spott. Lass uns ins Whites gehen und zu Abend essen.«
Im Kaffeehaus drängte sich die Menge. Rasch wurden die beiden Männer in eine Gruppe gezogen, die an dem langen aufgebockten Tisch vor dem Kamin saß. Trotz des milden Frühlingswetters brannte ein Feuer im Kamin, um den Wasserkessel über den Flammen zu erhitzen, mit dem die Kaffeebecher wieder gefüllt werden sollten. Kellner mit gebratenem Hammel und Weinkaraffen auf den beladenen Tabletts flitzten hin und her. In einer Ecke übertönten die Schreie der aufgeregten Spieler die klappernden Würfel, in der anderen starrte eine eher ernsthafte Gruppe auf die Karten in der Hand und stieß mit leiser Stimme die Gebote aus. Sebastian ließ den Blick durch den Raum schweifen und winkte Freunden und Bekannten zu, bevor er auf die Bank vor dem Tisch glitt und seiner Begleitung mit erhobenem Krug zuprostete. Obwohl er sich rege am Tischgespräch beteiligte, war er mit den Gedanken ganz woanders. Ein Drittel von neunhunderttausend Pfund war ein beinahe unvorstellbar großes Vermögen, ganz besonders für jemanden, der nicht über private Rücklagen verfügte. Als Oberhaupt der Familie gab Jasper sein Bestes, seine Brüder mit den schwindenden Einnahmen aus den Blackwater-Ländereien flüssig zu halten; aber er beklagte sich oft darüber, dass er selbst Gefahr lief, bald ins Schuldgefängnis in Fleet oder Marshalsea geworfen zu werden. Er schien die missliche Lage auf die leichte Schulter zu nehmen, aber seine jüngeren Brüder kannten ihn nur zu gut, um nicht zu wissen, dass es sich um eine echte Bedrohung handelte. Und die Forderungen seiner verzweigten Familie, die überzeugt schien, dass seine fehlende Großzügigkeit von Knauserigkeit herrührte und nicht weitgehend aus Mittellosigkeit, verschlimmerten Jaspers Lage noch weiter.
Um an das Vermögen zu kommen, das ihr exzentrischer Onkel wie einen Köder vor ihrer Nase baumeln ließ, mussten alle drei Brüder die Bestimmungen seines Testaments erfüllen: Alle drei mussten konvertieren und eine Frau heiraten, die irgendwie vom rechten Weg abgekommen war.
Aber warum zum Teufel wartete der alte Mann mit einem solch hinterhältigen Plan auf? Jasper hatte eine Theorie, die einigermaßen schlüssig schien. Schon als er noch ein ganz junger Mann gewesen war, hatte Viscount Bradley als das schwarze Schaf der Blackwaters gegolten. Kein Mensch konnte jetzt noch sagen, wie es damals eigentlich dazu gekommen war; aber innerhalb der Familie wurde sein Name niemals ausgesprochen. Bradley hatte darauf reagiert, indem er selbst sämtliche Verbindungen zu seiner Familie gekappt und sich auf den Weg nach Indien gemacht hatte. Dort war er durch Handelsgeschäfte zu seinem riesigen Vermögen gekommen, was ihm nur noch mehr Abscheu in der Familie eintrug. Die Vorstellung eines Blackwaters im Kaufmannsstand war den eifernden Kleingeistern der gehobenen gesellschaftlichen Stände auf unaussprechliche Art zuwider, und die Gerüchte über das haltlose Leben des jungen Viscounts waren den Sittenwächtern in der Familie Anlass genug, einen Bann über ihn zu verhängen. Jasper hatte bei mehr als einer Gelegenheit säuerlich darauf hingewiesen, dass viel zu viele Familienangehörige auf geradezu entsetzliche Art an jenen herumnörgelten, die auch nur einen einzigen Zoll vom Pfad der Tugend abgewichen waren.
Jaspers Theorie bestand darin, dass der hinterhältige Plan ihres Onkels ihm dazu diente, sich bitterlich zu rächen. Indem den Blackwaters drei höchst unpassende und alles andere als aufrechte Frauen aufgezwungen wurden, konnte Bradley sich gewissermaßen lachend ins Grab legen. Und Jaspers unpassende Braut war natürlich das Kronjuwel in seinem Ränkespiel. Denn Jasper war das Oberhaupt der Familie, und seine Countess würde der Vorrang vor jeder anderen Frau in der Familie gebühren, wie hoch auch immer sie offiziell über ihr stehen würde. Die Vorstellung, dass diese Frauen gezwungen waren, einer einstigen Dirne ihre Ehre zu erweisen, war wirklich ein erstklassiger Spaß. Aber das Sahnehäubchen bestand darin, dass das Vermögen des Viscounts, das er in der schmutzigen Welt des Handels gemacht hatte, das Vermögen der gesamten Familie retten würde. Sogar die drei Brüder konnten sich an diesem Gedanken erfreuen; aber es war eine ganz andere Sache, ihn auch in die Tat umzusetzen.
»Sebastian ... Sebastian ... reich doch mal den Wein weiter, Mann. Wir verdursten beinahe hier am anderen Ende des Tisches.«
Sebastian riss sich aus seiner Tagträumerei und schubste die Karaffe über den Tisch. Er spießte ein Stück gebratenen Hammel auf seine Gabel und tunkte es ausgiebig in die Zwiebelsoße.
»Sullivan und ich wollen heute Abend die neuen Spielsalons am Pickering Place ausprobieren«, kündigte Lord Harley an und schenkte sich Wein in den Kelch. »Möchte vielleicht jemand mitkommen?«
»Die Einsätze dort bringen mein Blut zu sehr in Wallung«, brummte ein junger Mann quer über den Tisch, »und in den nächsten Monaten bin ich knapp bei Kasse.« Er verbarg die Nase im Weinkelch.
»Wenn das so ist, wäre es sehr klug, wenn du dich vom Pickering Place fernhältst, Collins«, sagte Lord Harley, »soweit ich gehört habe, führen sie dort Tische, bei denen die niedrigsten Einsätze bei tausend Guineas liegen.«
Sebastian pfiff leise. Seine persönliche Grenze für diesen Abend lag bei hundert Guineas. Er war versucht, seine Pläne zu ändern und das Haus am Pickering Place zu meiden, denn das Spiel war eigentlich gar nicht seine Sache; gleichgültig, ob er gewann oder verlor, niemals würde er in Versuchung geraten, höher zu spielen, als er sich vorgenommen hatte. Doch, ich gehe trotzdem hin, beschloss er, und wenn mir die Einsätze zu hoch werden, steige ich einfach aus.
Als das Abendessen zu Ende war, hatten Harley und er zwei weitere neugierige Spieler gewonnen. Zu viert machten sie sich auf den Weg zum Pickering Place. Sie eilten die St. James's Street hinunter, plauderten freundschaftlich in der milden Abendluft und bogen dann in den Pickering Place ein. Bei den Spielsalons handelte es sich um ein hübsches Gebäude, dessen unscheinbare Äußerlichkeit in keiner Hinsicht zu erkennen gab, welche strafbaren Handlungen hinter der imposanten Fassade verübt wurden.
Lord Harley fuhr mit dem Spazierstock über das auf Hochglanz polierte Geländer, das zu den Doppeltüren hinaufführte.
»Hier gibt es nichts, was unwillkommene Aufmerksamkeit auf sich lenkt«, bemerkte er, »die Eigentümer wissen offenbar, womit sie es zu tun haben.«
Sebastian nickte. Es war eine Sache, einen privaten Spielklub zu betreiben und nur Mitgliedern Zutritt zu gewähren; aber eine ganze andere und darüber hinaus illegal war es, mit einem solchen Klub Gewinn erwirtschaften zu wollen und ihn jedem zu öffnen, der sich den Einsatz leisten konnte. Gleichwohl verhielt es sich so, dass das Gesetz nur selten einschritt, sofern solche Häuser die öffentliche Ordnung nicht störten. Je vornehmer das Etablissement, desto höher die Einsätze und desto gehobener die Kundschaft, die sich allerdings nicht leichtfertig dem Risiko aussetzen würde, sich bei einer Razzia durch die Ordnungskräfte schnappen zu lassen.
»Sollen wir reingehen?«
Ein livrierter Lakai mit gepuderter Perücke öffnete die Tür und bat sie mit einer Verbeugung in eine Säulenhalle mit Marmorfußboden, von der aus sich eine elegante Treppe zu einer Galerie erhob, während funkelnde Kristallleuchter ihr Licht von der mit Fresken bemalten Decke tropfen ließen. Leise Musik, in die sich gedämpfte Stimmen mischten, schwebte aus dem oberen Geschoss nach unten, und die Doppeltüren zu dem großen Speisesaal rechts in der Halle standen einladend offen.
Sebastian und seine Freunde zogen den Degen aus der Scheide und legten ihn auf das lange Gestell an der Wand. In einem Etablissement, in dem das Temperament so hoch schießen konnte wie die Einsätze, stellten bewaffnete Männer ein nicht tragbares Risiko dar. Sie eilten die Treppe hinauf und oben an der Treppe durch die Doppeltüren eines großen Salons. Ein Diener bot ihnen Punsch und Champagner an, und einen Moment lang blieben sie stehen und betrachteten die Szenerie.
Der Salon war mit Spieltischen eingerichtet, zwischen denen sich die Bediensteten hin und her bewegten und mit gedämpfter Stimme die Einsätze ausriefen. Würfel klapperten, Karten knallten und sanftes Stimmengemurmel erhob sich von den Tischen. Weitere Räume öffneten sich zum Hauptsalon mit kleineren Tischen, an denen paarweise Pikett gespielt wurde.
Sebastians Begleitung wanderte fort in die Tiefen der Salons hinein, blieb hier und da an einem Tisch stehen und schätzte die Wetten ein. Er selbst hingegen verharrte an der Tür und schaute sich mit kennerischem Blick um. Die Ausgaben für ein solches Etablissement mit Kellnern, feinen Weinen und elegantem Abendessen würden schätzungsweise mindestens tausend Guineas pro Jahr betragen, rechnete er und dachte, dass die Eigentümer eine sehr erfolgreiche Bank führen mussten, um überhaupt Gewinn zu erwirtschaften. Und oft genug wurden die erfolgreichsten Spielbanken zum Vorteil genau dieser Bank in irgendeiner Weise manipuliert.
Er nippte an seinem Punsch und betrat den Raum. Nach dem ersten Schritt blieb er abrupt stehen. Eine große junge Frau in einem Kleid aus blasser, lavendelfarbener Seide, das sich über einem Unterkleid aus genau zu ihrer Augenfarbe passender violetter Seide öffnete, war am anderen Ende des Zimmers gerade dabei, zwei Karten aus der Box des Spielleiters zu ziehen. Das ungepuderte Haar war rabenschwarz; Locken umrahmten ihr Gesicht.
Wie gebannt verharrte Sebastian auf der Stelle, und beinahe wie magnetisch von seinem Blick angezogen schaute die junge Frau von den Karten auf und schickte ihren Blick quer durch den vollen Salon. Und ihr Blick traf auf seinen, und einen Moment lang war es so, als ob die verflossenen drei Jahre niemals geschehen waren – wenn man nur davon absah, dass sie schöner war als je zuvor.
Er ging einen Schritt auf sie zu. Sie senkte den Blick und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Spieltisch. Genau in diesem Moment trat General Sir George Heyward vor Sebastian.
»Nun, Sullivan, wollen Sie ein Spiel wagen?«
Aus Sebastians Blick sprach die nackte Verachtung; aber seine Stimme klang kühl und beherrscht, als er antwortete.
»Nun, dann sind Sie also vom Kontinent zurück, General.«
»Wie Sie sehen«, stimmte der General zu. »Sind Sie hergekommen, um bei uns zu spielen, Sir?«
Wieder achtete Sebastian nicht auf die Frage.
»Ihr Unternehmen muss aufgeblüht sein, Sir George, wenn Sie in der Lage sind, sich hier in London mit solcher Pracht niederzulassen.«
»Ja, das ist richtig, Sullivan. Aber ich wüsste nicht, was es Sie angeht.« Ein Lächeln huschte über die dünnen Lippen des Generals. »Gestatten Sie, dass ich Sie zu einem Tisch begleite, an dem Sie ohne jeden Zweifel ein Spiel wagen können, das Ihnen zusagt.« Er legte die Hand auf Sebastians Arm und dirigierte ihn fort von Serenas Tisch.
Sebastian sträubte sich nicht. In dem Moment, in dem er sie erblickt hatte, war der letzte Rest des Ärgers darüber, wie sie ihn das letzte Mal behandelt hatte, wieder in einer hellen Flamme aufgeschossen. Damals vor drei Jahren war er nichts als ein liebeskrankes Mondkalb gewesen, kaum vierundzwanzig Jahre alt; aber jetzt war er viel älter, klüger und erfahrener, und über die Unreife solcher Leidenschaften konnte er nur noch lachen. Weder Serena noch ihr Stiefvater hatten zu befürchten, dass er seine Aufmerksamkeiten wieder aufleben lassen würde. Ohne einen weiteren Blick in Serenas Richtung zu werfen, erlaubte er seinem Gastgeber, ihn an irgendeinen zufällig freien Tisch zu geleiten. Das Spiel selbst kümmerte ihn nicht, denn dabei drehte sich alles um das pure Glück; aber es würde ihm helfen, seine Gedanken von einer launischen, schwarzhaarigen Schönheit abzulenken.
Serena hatte sich auf die unvermeidliche Begegnung mit Sebastian vorbereitet. Dachte sie jedenfalls. Drei Jahre sind eine lange Zeit, hatte sie sich eingeredet, und: Sebastian könnte längst in eine hoffnungsvolle Familie eingeheiratet haben. In den Salons, die sie zusammen mit ihrem Stiefvater durchquert und in denen sie gespielt hatte, waren die Sullivan-Brüder niemals erwähnt worden. Die kurzen Monate ihres Liebesidylls betrachtete sie rückblickend als Traumzeit eines naiven jugendlichen Paares, das sich an der Welt der harten Tatsachen noch die Zähne auszubeißen hatte. Die letzten drei Jahre hatten sie in das Erwachsenenleben gezwungen, und ihr war klar, dass sie die Welt jetzt mit offenen Augen betrachtete, die sich vor dem im Allgemeinen falschen Spiel des Lebens nicht mehr verschlossen.
Und doch hatte sie gespürt, dass Sebastian den Raum betrat, noch bevor sie ihn gesehen hatte. Es war, als hätten die feinen Härchen auf ihrer Haut sich aufgerichtet, und ein Schauder war ihr über den Rücken gekrochen. In dem Moment, in dem ihre Blicke sich begegneten, waren die drei Jahre dahingeschmolzen. Mit dem goldfarbenen Haar und den durchdringend blauen Augen war er so attraktiv wie immer, und noch immer war er schlank und groß und in seinen Bewegungen so geschmeidig wie eine Gerte. Als er unwillkürlich einen Schritt in ihre Richtung gemacht hatte, schien ihr das Herz bis zum Hals zu schlagen. Und dann war es auch schon vorbei. Denn ihr Stiefvater hatte sich vor ihn geschoben, versperrte ihr die Sicht, und ihre Vision war verflogen.
Ihre Hände zitterten allerdings ein wenig, als sie mit den Karten arbeitete. Normalerweise berechnete sie den Einsatz sehr konzentriert, wenn die Karten vor ihr auf dem Tisch lagen, aber jetzt schweiften ihre Gedanken ab. Ruhig Blut, beschwichtigte sie sich, das Schlimmste habe ich ja schon überstanden. Die erste Begegnung galt immer als die unbehaglichste. Außerdem gab es keinerlei Notwendigkeit, überhaupt miteinander zu sprechen. Jedenfalls nicht über ein paar gemurmelte Höflichkeiten hinaus; so wie sehr entfernte Bekannte sie bei einer Verbeugung zu wechseln pflegten. Niemals wieder durfte es geschehen, dass er sie kalt erwischte.
Ihre mangelnde Aufmerksamkeit führte dazu, dass die Bank bei diesem Spiel verlor, was sie eigentlich nicht hätte zulassen dürfen. Aber sie redete sich ein, dass es andererseits auch recht nützlich sein konnte zu zeigen, dass auch die Bank nicht unbesiegbar war. Selbst eingefleischte Spieler würden sich irgendwann weigern, an einem Tisch Pharo zu spielen, an dem die Bank unausweichlich den Sieg davontrug.
Als die Uhr neun schlug, schaute sie zu den Doppeltüren, an denen sich inzwischen der Butler aufgebaut hatte, um das erste Abendessen zu verkünden. Serena lächelte in die Runde am Tisch.
»Gentlemen, darf ich vorschlagen, dass wir zum Abendessen hinuntergehen? Eine Unterbrechung des Kartenspiels wird uns alle erfrischen.«
Bereitwillig stimmten die Männer zu, legten die Karten auf den Tisch und schoben die Stühle zurück.
»Darf ich Sie begleiten, Lady Serena?« Ein junger Viscount verbeugte sich eifrig und bot ihr den Arm. Die gepuderte Perücke krönte eine engelsgleiche Miene, die die schweren Lider und die rot geränderten Augen eines Mannes Lügen strafte, der sich bereits über die zweite Flasche Burgunder hergemacht hatte.
»Vielen Dank, Lord Charles.« Serena legte ihre behandschuhte Hand auf seinen Brokatärmel und führte den Weg aus dem Salon an, die breite Treppe hinunter und in den üppig eingerichteten Speisesaal. Sie bahnte sich den Weg zwischen den Gästen hindurch, die an den Speisen knabberten, welche am langen Büffet aufgereiht waren, am Champagner nippten oder feinen Rheinwein und Burgunder tranken. Ihr Blick war überall und registrierte genau, welche Platten oder Karaffen wieder aufgefüllt werden mussten.
Auch General Heyward war überall sofort zur Stelle, wechselte deftige Worte mit den Gentlemen, machte den Ladys blumige Komplimente und schenkte die Gläser mit der größten Liebenswürdigkeit eines perfekten Gastgebers nach. Wer nicht dazugehörte, musste überzeugt sein, dass es sich um eine elegante und extravagante Privatparty mit äußerst großzügigen Gastgebern handelte und nicht etwa um eine sorgsam ausgetüftelte Unterhaltung, die einzig und allein dem Ziel diente, so viele Gäste wie möglich in die Salons im Obergeschoss zu lotsen – um sie dort auf Umwegen für das elegante Abendessen nach Kräften zur Kasse zu bitten.
Sebastian und seine Freunde waren mit der übrigen Begleitung ebenfalls in den Speisesaal gegangen. Einen Moment lang hielt er sich im Türrahmen auf. Verstohlen beobachtete er Serena, die unter dem glitzernden Licht unzähliger Kerzen ihrer Rolle perfekt gerecht wurde. Er ertappte sich dabei, dass er nach etwas suchte, was er kritisieren konnte. Ja, es mochte sein, dass sie immer noch schön war, so schön wie eh und je; aber irgendetwas hatte sich trotzdem geändert. Es war eine Härte an ihr, die es vorher nicht gegeben hatte. Außerdem glaubte er, dass ihr Lachen spröde geworden war – und diese wundervollen veilchenblauen Augen argwöhnisch. Aber das Haar glänzte immer noch in tiefem Schwarzblau, und ihre Gestalt war so elegant und würdevoll wie eh und je. Es gelang ihm nicht, den Blick von ihr zu reißen.
»Seb ... Seb ...« Lord Harley boxte ihn leicht in den Oberarm und riss ihn aus seiner Grübelei. »Bleibst du jetzt zum Essen oder nicht?«
Sebastian löste den Blick von der Frau. Gerade hatte sie über irgendetwas gelacht, wahrscheinlich über irgendeinen vermeintlichen Witz des jungen Viscounts mit Engelsgesicht, der einen großen Humpen Burgunder leerte. Einen Augenblick musste er den gewaltigen Impuls unterdrücken, zu ihr zu laufen, sie auf die Straße hinauszuzerren und zu irgendetwas zu zwingen ... zu irgendetwas, was er nicht näher beschreiben konnte ... irgendetwas sollte zwischen ihnen geschehen. Irgendetwas Echtes und Wahrhaftiges, so viel war klar. Nicht diese kalte, künstliche Trennung, die irgendwie völlig verlogen war.
»Nein«, stieß er abrupt aus, »nein, ich bleibe nicht.« Sebastian machte auf dem Absatz kehrt und eilte in die Halle zu seinem Degen, den er in die Scheide zurücksteckte, bevor er das Haus verließ. Hinter ihm fiel die Tür fest ins Schloss.
Die kühle Nachtluft machte ihm den Kopf frei, als er mit schnellem Schritt die St. James's Street hinuntereilte. Gemessen daran, was die Spieler in London gewohnt waren, war es immer noch früh, noch nicht einmal Mitternacht. Trotzdem wollte Sebastian nicht einfallen, wohin er jetzt gehen konnte. Unter den zahlreichen Unterhaltungsangeboten gab es schlicht keines, welches ihm zusagen wollte. Ihm stand nicht der Sinn nach Gesellschaft, oder jedenfalls nicht nach der seiner Freunde. Er verließ die St. James's Street und bog in eine Gasse ein. Auf halbem Weg die Gasse entlang ergoss sich Licht aus der geöffneten Tür einer Taverne; raue, fröhliche Stimmen, getränkt mit Derbheiten, erfüllten die enge Gasse.
Sebastian drängte sich durch die Menge, die die Tür blockierte. Ein schwergewichtiger Mann ergriff ihn am Arm. Sebastian drehte den Kopf und schaute den Mann, der ihm den Weg versperrte, kalt und schweigend an. Seine freie Hand ruhte auf dem Griff des Degens. Einen Moment lang standen die Männer sich wortlos gegenüber. Aber irgendetwas im Blick des jüngeren – zweifellos ein unerschrockenes Glitzern, das zu weiterer Herausforderung einzuladen schien – veranlasste den schwergewichtigen Kerl, die Hand sinken zu lassen, ein paar Worte zu murmeln, die nach einer Entschuldigung klangen, und zur Seite zu treten. Unter Einsatz seiner Ellbogen gelangte Sebastian zum grob gehobelten Tresen und verlangte einen Humpen Bier. Die Bestellung kam rasch, er trank und überflog den lauten Schankraum mit leerem Blick. Niemand näherte sich ihm.
Das Bier half kaum, seine Laune zu verbessern. Er leerte das Glas mit einer Grimasse, warf eine Münze auf den Tresen und drängelte sich wieder hinaus in die Gasse. Als er sich auf den Weg zurück in die St. James's Street machte, beschlich ihn irgendwie das merkwürdige Gefühl, das etwas in seinem Rücken war.
Er wirbelte herum und schnappte nach einem dürren Kind, das gerade wieder in die Dunkelheit der Gasse eintauchen wollte.
»Moment mal.« Sebastian verstärkte seinen Griff. Das schmutzige Waisenkind blickte mit aufgerissenen Augen ängstlich zu ihm auf.
»Entschuldigung, Sir.« Plötzlich drehte und wand sich das Kind, neigte den Kopf und biss Sebastian in die Hand. Sebastian schrie auf und ließ los. Das kleine Kerlchen duckte sich, drehte sich geschmeidig um und stob davon. Sofort wurde Sebastian klar, dass die Geldbörse in der Innentasche seines Mantels fehlte.
»Dummkopf«, schalt er sich und untersuchte seine Hand. Die Haut war nicht verletzt. Wieder ließ er den Blick durch die Gasse schweifen, aber wie erwartet war der Taschendieb nicht zu entdecken. Diese Straßenkinder waren so klein und flink, dass sie durch ein Loch in der Mauer verschwinden konnten, welches gerade mal groß genug für eine Katze war. Wenn man sich abseits in den Gassen herumtrieb, war eigentlich nichts Ungewöhnliches an der Begegnung. Sebastian beschwor sich, dass er hätte aufmerksamer sein müssen. Aber merkwürdigerweise hatte der Vorfall ihm seine sonst übliche Gelassenheit zumindest teilweise wieder zurückgebracht. Ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt.
Für den Rückweg wählte er einen breiteren Durchgang durch die St. James's Street, um zu der Wohnung zu gelangen, die er mit Peregrine in der Stratton Street teilte.
Aus den Fenstern des Wohnzimmers vorn an dem schmalen Haus schimmerte Licht. Sebastian betrat die kleine Halle.
»Perry ... bist du da?«
»Aye. Ich bin hier.«
Sebastian stieß die Tür zu dem ebenfalls kleinen, aber gemütlich eingerichteten Wohnzimmer auf. Peregrine saß lesend in einem tiefen Armsessel neben dem Kamin, in dem ein kleines Feuer den Nachtfrost vertrieb. Auf einem Tischchen neben ihm stand ein Glas mit Brandy, der im Kerzenlicht bernsteinfarben schimmerte.
Perry begrüßte seinen Bruder mit einem Lächeln und schloss das Buch über einem Finger, um die Seite nicht zu verblättern.
»'Nen guten Abend gehabt?«
Sebastian zuckte lässig die Schultern.
»Geht so.« Er schenkte sich ein Glas ein und nahm in dem Sessel neben seinem Bruder Platz. »Harley und ich sind in den Spielsalons am Pickering Place gewesen.«
Peregrine geriet in leichte Alarmstimmung. Offenbar war sein Bruder irgendwie besorgt, und das konnte nur einen einzigen Grund haben.
»Hast du zu hoch verloren?«
»Nein.« Sebastian schüttelte den Kopf. »Perry, du kennst mich doch. Ich weiß ein wenig Aufregung durchaus zu schätzen, aber es ist mir verhasst, mehr zu verlieren, als ich mir leisten kann. Am Tisch bin ich so schüchtern wie ein Kind und so verkniffen wie ein Geizhals. Das Spiel war viel zu riskant für mich. Ich schlage mehr nach Jaspers Art.«
»Stimmt, Jasper verliert auch nicht gern«, betonte Perry und streckte die Füße auf dem Kaminbock aus.
»Jasper, mein Lieber, du darfst nicht verlieren«, erwiderte sein Zwillingsbruder mit schlauer Miene, und beide lachten. Ihr älterer Bruder hatte ein Händchen für das Kartenspiel.
Sebastian ließ den Brandy in seinem Glas kreisen und betrachtete das Spiel des Lichtes auf der bernsteinfarbenen Oberfläche. Peregrine beobachtete ihn genau, bis er schließlich wieder das Wort ergriff.
»Nun, was ist los?«
Sein Bruder antwortete, ohne den Blick zu heben.
»Die Spielsalons werden von Serena und ihrem verdammten Stiefvater geleitet.«
Peregrine ahnte Böses. Ein Schauder rann ihm über den Rücken. Aufmerksam musterte er seinen Zwillingsbruder; seine böse Vorahnung wurde noch stärker. Sebastians Miene wirkte genauso trostlos wie in jenen grauenhaften Monaten vor drei Jahren. Keiner der Brüder war in der Lage gewesen, ihm in seinem Unglück so nahezukommen, dass ihm geholfen werden konnte. Dabei hatte er sich vorher auch nicht gescheut, sie an seinem Glück teilhaben zu lassen. Beinahe ein Jahr lang hatte Sebastian förmlich im Glück geschwelgt, und das mit einer Frau, die er offen und freimütig als die große Liebe seines Lebens bezeichnete. Jasper hatte seinen Bruder mit dem zweifelnden Blick des Älteren gemustert und irgendetwas über eine Hundeliebe gemurmelt; aber er hatte nichts unternommen, was Sebastians überschäumendes Glück hätte stören können. Perry hatte es genossen, wie glücklich sein Zwillingsbruder gewesen war, und er hatte sich für ihn gefreut. Schon immer hatten sie alle Höhen und Tiefen des Lebens gemeinsam durchschritten.
Und dann war irgendetwas geschehen, was Sebastians Welt hatte einstürzen lassen. Nach einigem Drängen hatte er lediglich eingestanden, dass Lady Serena zusammen mit ihrem Stiefvater das Land verlassen hatte; mehr war nicht aus ihm herauszubringen. Sie hatten ihn im Auge behalten und abgewartet, bis der Schmerz schließlich vergangen und die Leere aus Sebastians Blick gewichen war. Bis er wieder mit ganzem Herzen in die wirbelnden Geselligkeiten eingetaucht war. Eine Weile hatte er es ziemlich wild getrieben, aber nach und nach war der Sebastian, den sie kannten und liebten, wieder zum Vorschein gekommen. Er war wieder ganz der Alte geworden, der sich gern unterhalten ließ und selbst sehr unterhaltsam sein konnte.
Als Peregrine in diesem Moment die Miene seines Bruders beobachtete, befürchtete er, dass die schlimmen Zeiten wieder aufs Neue anbrachen. Er brannte beinahe vor Zorn auf die Frau, die seinen Zwillingsbruder so herzlos im Stich gelassen hatte und jetzt auftauchte, um die alten Wunden wieder aufzureißen.
»Ich schlage vor, dass du dort dann nicht mehr spielst«, sagte Peregrine so sachlich wie möglich und griff nach seinem Glas.
Sebastian hob den Blick und schenkte seinem Bruder ein kühles Lächeln.
»Wie bereits erwähnt, Peregrine, die Einsätze am Pickering Place sind zu gefährlich für mich. Sie bringen mein Blut zu sehr in Wallung.«
Kapitel 2
»Nun, ich muss schon sagen, meine Liebe, die Haube steht dir ausgesprochen gut.« Marianne Sutton nickte. Zufrieden betrachtete sie ihre einzige Tochter, obwohl deren aufgetürmte und kunstvoll gepuderte Frisur gefährlich schwankte. »Du bist wirklich ein süßes kleines Ding. Kein Wunder, dass der General einen Narren an dir gefressen hat.«
»Mama, das glaube ich gar nicht«, protestierte Miss Sutton und errötete bis in die Spitzen ihrer lockigen Haare. »General Heyward ist ... er ist viel zu sehr ... viel zu sehr an modische Frauen gewöhnt, um irgendeinen Gefallen an mir zu finden.« Eigentlich hatte sie sagen wollen, dass der General alt genug war, um ihr Großvater zu sein; auf ein junges Mädchen von kaum siebzehn Jahren, das kurz vor seiner ersten Saison in London stand, konnte er kaum anziehend wirken.
»Unsinn, mein Kind.« Mrs Sutton schlug mit dem Fächer nach ihrer Tochter. »Denk an meine Worte. Sobald der General nach London zurückgekehrt ist, wird dein Vater ihn dazu bringen, noch vor Weihnachten um deine Hand anzuhalten.« Sie seufzte genüsslich, lehnte sich in die Lederpolster des überaus modischen Landauers zurück und ließ mit der Lorgnette vor den Augen den Blick schweifen, während sie in Richtung Piccadilly fuhren und sie ihre Aufmerksamkeit darauf richtete, nichts und niemanden zu verpassen.
Da sie sich vorgenommen hatten, ihr liebes Kind wie gewünscht auf dem Heiratsmarkt zu platzieren, hatte ihr Ehemann Mr Sutton ihr erklärt, dass sie keine Gelegenheit auslassen dürfe, sich bei Londons modischer Welt einzuschmeicheln. Er würde dafür sorgen, dass ihr Unternehmen nicht an der finanziellen Ausstattung scheiterte; aber weil er ein wenig schroff und stets ausgesprochen bodenständig war, hatte er nichts dagegen, die gesellige Seite des Geschäfts seiner Frau zu überlassen – die immerhin gewisse Ambitionen hegte, wenn auch nicht in die obersten Kreise aufzusteigen, so doch wenigstens eine Stufe höher als jetzt.
»Ah, da ist Lady Barstow ...« Sie verneigte sich, lächelte einem vorbeifahrenden Landauer zu und erntete nicht mehr als ein äußerst knappes Nicken. Das Lächeln verflüchtigte sich, und ihre Stimme klang plötzlich scharf. »Was für einen trostlosen Anblick die Kutsche doch bietet. Man sollte meinen, dass Lord Barstow seiner Frau ein angemesseneres Gefährt zur Verfügung stellt. Sieht ziemlich schäbig aus.«
Abigail schwieg. Es war immer günstiger, der Zunge ihrer Mutter freien Lauf zu lassen. Sie zwängte sich in die Ecke der Kutsche und war damit zufrieden, den Blick über die vorbeifliegende Szenerie schweifen zu lassen. Seit drei Wochen erst hielt sie sich in London auf, und für sie war es immer noch eine Stadt, die Verwunderung in ihr auslöste. Niemals wurde sie müde, die Schaufenster der Läden mit den üppigen Auslagen zu betrachten oder die Ladys, denen oftmals kleine dunkelhäutige Pagen folgten, während sie versuchten, sich mit ihren weiten Reifröcken unter den Kleidern durch die engen Türen zu manövrieren. Auch die Gentlemen mit ihren gepuderten Perücken, den bestickten Mänteln und den weit aufgeschlagenen Ärmeln sowie den Juwelen besetzten Nadeln, die in den mit Spitze gearbeiteten Halstüchern steckten, waren größtenteils ganz prachtvolle Geschöpfe.
Sie sehnte sich sehr danach, zu dieser Szene zu gehören, sich wie selbstverständlich unter diesen prachtvollen Schmetterlingen zu bewegen, die Verbeugungen und Begrüßungen mit einem würdevollen Knicks und einem eleganten Kopfnicken erwidern zu dürfen. Aber noch war sie nicht in die Gesellschaft eingeführt worden. Die Saison würde erst nach der Eröffnung der Parlamentssitzungen beginnen. Im Moment war ihr geselliges Leben noch auf den Freundeskreis ihrer Eltern beschränkt und auf die paar Bekanntschaften, die sie während des zweimonatigen Aufenthalts auf dem Kontinent gemacht hatten.
Abigail interessierte sich allerdings nicht für Paris und noch weniger für Brüssel. Durch die fremde, so schnell und merkwürdig gesprochene Sprache bekam sie nichts als Kopfschmerzen, und die Menschen waren alle so arrogant und hochnäsig, dass sie sie wie Luft behandelt hatten. Außer General Sir George Heyward und seiner Stieftochter Lady Serena, ohne die Abigail wahrscheinlich schon längst an ihrer Langeweile zugrunde gegangen wäre. Aber Serena hatte sie in die Bibliotheken und die musikalischen Salons eingeführt; sie hatte Abigail beim Einkauf begleitet, hatte sie auf sanfte Art gelehrt, was ihr gut stand und was nicht. Serena war so viel weltläufiger, wusste über die vorherrschende Mode so viel besser Bescheid als Mama, dass es war, als habe sie in ihr eine ältere Schwester gefunden. Sie hatten sich versprochen, nach ihrer Rückkehr nach London in Verbindung zu bleiben. Abigail wartete jeden Tag darauf, dass es klopfte und man ihr die Visitenkarte reichte, die ihr die Tür zur Welt der Londoner Gesellschaft öffnen würde.
Aber bis jetzt hatte es nicht geklopft. Obwohl General Heyward wusste, wo sie wohnte, denn ihr Vater hatte darauf geachtet, dass er ihre Anschrift bekam, bevor sie Brüssel verließen. Vielleicht waren der General und seine Stieftochter noch gar nicht in London eingetroffen. Als die Suttons das Schiff nach Dover bestiegen hatten, waren sie immer noch in Brüssel gewesen. Diese Erklärung war jedenfalls viel angenehmer als der Gedanke, dass Lady Serena nach ihrer Rückkehr nach London ihren Schützling vollkommen vergessen hatte.
Oder mit ihrer Londoner Adresse stimmte etwas nicht. Möglicherweise handelte es sich um eine Adresse, die eine Lady, die auf sich hielt, niemals aufsuchen würde. Ständig spukte Abigail dieser Gedanke im Kopf herum. Was wusste ihr Vater schon über die eleganten Straßen, in denen die gehobene Gesellschaft wohnte? Er war nichts anderes als ein bodenständiger, gutwilliger Kaufmann aus den Midlands, der nach jahrelangen cleveren Geschäften und sorgfältigen Akquisitionen so wohlhabend geworden war, dass er dem gesellschaftlichen Ehrgeiz seiner Frau gerecht werden konnte. Ein Ehrgeiz, der in der Grafschaft Staffordshire nicht befriedigt werden konnte. Aber er wollte Marianne nicht Unrecht tun und hatte sich oft beschworen, dass die Ambitionen eher ihrer Tochter galten und weniger ihr selbst. Und William Sutton war ein sehr stolzer Vater, der für sein engelsgleiches Kind mit dem goldfarbenen Haar einfach alles tun würde.
Für Abigail wäre das Beste gerade gut genug. Daher hatte er sie auf eine höhere Töchterschule geschickt, weit weg nach Kent, wo sie unter schrecklichem Heimweh gelitten hatte. Aber dort hatte man ihr die gedehnten Vokale abgewöhnt, die in den Midlands gesprochen wurden; sie war so lange mit Büchern auf dem Kopf umhergelaufen, bis ihr Rückgrat stocksteif war und sie den Kopf wundervoll auf ihrem schwanengleichen Hals ruhen lassen konnte. Ein paar Wochen auf dem Kontinent sollten reichen, um ihre Erziehung abzurunden und sie auf ihr Debüt in London vorzubereiten. Hin und wieder hatte Marianne sich erlaubt, sich dem Traum hinzugeben, ihre Tochter sogar bei Hofe zu präsentieren, falls es ihnen irgendwie gelingen sollte, eine Patronin zu finden, die Abigail vorstellen würde. Und falls solch ein Wunder tatsächlich geschah, warum dann nicht auch Eintrittskarten für das Almack's? Das war ein Traum, den sie kaum zu träumen wagte, wie Marianne sich selbst eingestehen musste, aber die Londoner Gesellschaft umfasste schließlich mehr als nur die oberen Zehntausend. Es gab Gentlemen in Hülle und Fülle, niederen, zumeist verarmten Adel, der im Tausch gegen seinen ehrenwerten Namen gern die Hände nach dem Vermögen ausstrecken wollte, das William Suttons Tochter eines Tages gehören würde.
Eigentlich war General Sir George Heyward, dessen verstorbene Ehefrau die Witwe eines obskuren schottischen Earls gewesen war, ein wenig zu alt für Abigail. Aber seine Referenzen waren tadellos. Mit William verstand er sich großartig und stellte ihn den Gentlemen vom Militär vor, die sich in den Salons und Klubs von Brüssel herumtrieben. Seine Stieftochter Lady Serena gehörte ohne jeden Zweifel in die oberste Schublade, war für Abigail ein perfektes Vorbild und die beste Mentorin, die man sich nur wünschen konnte. Marianne schob ihre Unbehaglichkeit wegen des Alters des Generals beiseite und konzentrierte sich auf die erfreuliche Aussicht einer gut verheirateten Tochter, die Zutritt zu gesellschaftlichen Kreisen besaß, von denen sie selbst nur träumen konnte.
»Ich hoffe inständig, dass General Heyward die Karte nicht verlegt hat, die dein Vater ihm gegeben hat.« Marianne störte die Gedanken ihrer Tochter auf. Abigail erschrak.
»Er hat nicht verraten, wann er und Lady Serena nach London zurückkehren, Mama.«
»Nein ... nein, das hat er nicht. Aber inzwischen sind drei Wochen vergangen«, entgegnete Marianne verdrießlich und klopfte mit den behandschuhten Händen auf die wärmende Wolldecke über ihren Knien.
»Vielleicht gehört die Bruton Street nicht zu den Adressen, die der General gewöhnlich aufsucht.« Abigail verlieh ihrer Angst Ausdruck, versuchte aber, ihren Tonfall leicht und sorglos zu halten, ganz so, als ob sie sich einen Scherz erlaubte.
»Unsinn, meine Liebe. Dein Vater weiß aus bester Quelle, dass die Bruton Street zu den ausgesuchtesten Adressen der Stadt gehört. Und du musst zugeben, dass das Haus sehr elegant und gut möbliert ist.«
Abigail nickte. Es stimmte, obgleich sie der »besten Quelle« ihres Vaters kein besonderes Vertrauen schenkte. Sie liebte ihn sehr, aber nach den ersten Wochen im Internat in Kent hatte sie sich gezwungenermaßen eingestehen müssen, dass seine Manieren doch sehr zu wünschen übrig ließen; seine bodenständige gute Laune wirkte in eleganter Gesellschaft eher ungehobelt und bäurisch. Es war die Frage, ob diejenigen, auf deren Urteil er vertraute, sich auch unbedingt in den eleganten Kreisen der Gesellschaft bewegten.
Der Zweispänner blieb vor dem Haus in der Bruton Street stehen. Wie Abigail zugeben musste, sah es mit der leuchtenden Farbe und dem Messing, mit den glänzenden Fensterscheiben und den blühenden Blumen in den Kästen vor den Fenstern zweifellos so aus wie die Residenz eines Gentlemans. Sie folgte ihrer Mutter ins Haus, in ihrem Windschatten der Ladendiener mit den Paketen.
Beim Klang ihrer Schritte auf dem Parkett öffnete sich die Tür zur Bibliothek. In aufgeräumter Stimmung betrat William Sutton die Halle und legte sich eine Hand auf den Wanst, während er die Frauen zufrieden musterte.
»Ah, da seid ihr ja ... und seht wie immer zauberhaft aus. Was haben wir denn da ... ein paar Kinkerlitzchen, wenn die Bemerkung erlaubt ist. Ich kann mich wohl glücklich schätzen, wenn ihr mich nicht in den Bankrott treibt.« Er lachte herzlich über seinen Humor. »Nun, hattet ihr eine angenehme Ausfahrt, meine Lieben?«
»Sehr angenehm, danke, Papa.« Abigail stellte sich auf Zehenspitzen, um ihm einen Kuss auf die Wange zu drücken. »Wir werden dich schon nicht in den Ruin treiben, versprochen ... es sind nur ein Schal und ein paar neue Bänder für die alte Haube und ein Stückchen Seide, um Mamas blaues Kleid ein bisschen hübscher zu machen.«
»Oh, es war doch nur ein Witz, Liebes, das weißt du doch.« Er lachte auf und tätschelte ihr die Wange. »Für dich ist mir gerade das Beste gut genug. In der Tat, du solltest neue Hauben kaufen und nicht die alten aufbessern. Schämen Sie sich, Mrs Sutton. Ich habe doch gesagt, dass keine Kosten gescheut werden sollen.«
»Das haben wir auch nicht, mein lieber Sir.« Seine Frau besänftigte ihn mit geübten Worten. »Gehen Sie nur zurück in die Bibliothek. Ich werde Morrison anweisen, Ihnen eine leichte Mahlzeit zu richten. Seit dem Frühstück sind schon mehrere Stunden vergangen, und Sie wissen doch, wie hungrig Sie immer werden. Das Dinner wird erst um sechs Uhr abends serviert. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir jetzt nach der Uhr in London leben müssen.«
»Wie könnte ich das je vergessen?«, erwiderte William mit spöttischem Grinsen. »Ich werde nie begreifen, wie ein Mann spät zu Abend essen und sich anschließend schlafen legen kann.«
»Aber Papa, normalerweise legen sich die Leute in der Gesellschaft nicht sofort nach dem Essen schlafen. Vor zwei oder drei Uhr in der Frühe finden sie nur selten ins Bett. Manchmal sogar erst zu Sonnenaufgang.« Vergeblich versuchte Abigail, den wehmütigen Unterton in ihrer Stimme zu verschleiern, der sich bei dem Gedanken an solche Nachtschwärmerei einschlich.
Ihr Vater warf ihr einen scharfen Blick zu und schüttelte anschließend den Kopf.
»Nun, lass dir gesagt sein, ich werde niemals damit zurechtkommen. Aber ihr jungen Dinger ... ganz andere Sache ... wirklich eine ganz andere Sache. Aber ich werde es nicht zulassen, dass du wegen dieser späten Nächte bald schon verhärmt und verstört aussiehst, mein Mädchen. Denk an meine Worte.«
»Oh, das werde ich, ganz bestimmt, Papa.« Abigail knickste und lächelte ihn so an, dass die Grübchen auf der Wange zu sehen waren. Ihr Vater lachte wieder und nannte sie ein gerissenes Luder. Schließlich drehte Abigail sich um und eilte in ihr Zimmer.
Dort knüpfte sie die Bänder ihrer Haube auf und warf sie aufs Bett, bevor sie zum Fenster eilte. Auf der Straße unten war es zwar ruhig, aber trotzdem konnte sie die Geräusche Londons hören, die eisernen Räder auf dem Kopfsteinpflaster, das raue Rufen der Burschen mit ihren Karren, die Träger der Sänften, die Männer, die ihre Pasteten verkauften, die Schreie vom Bock der Kutschen, die durch den ungeregelten Verkehr gelenkt wurden.
Abigail wollte sich nicht in der Abgeschiedenheit ihres Zimmers aufhalten, ja noch nicht einmal auf der ruhigen herrschaftlichen Straße unter ihrem Fenster. Sie befand sich in London, die Welt lag ihr zu Füßen – und sie war hier eingesperrt und sollte warten, bis jemand kam und den passenden Schlüssel für die Tür in der Hand hielt. Nun gut, aber einen kleinen Spaziergang auf eigene Faust durfte sie doch wohl machen, oder? Vielleicht am Piccadilly entlang, der gar nicht weit entfernt lag, sondern gleich am Ende der Straße. Zu Hause hatte sie doch auch immer allein spazieren gehen dürfen. Warum sollte es hier also nicht in Ordnung sein?
Abigail ließ ihre Haube liegen und hoffte, keinem Diener zu begegnen, als sie leichtfüßig die Treppe hinuntereilte. Sie flog förmlich durch die Halle und öffnete die Eingangstür. Es grenzte an ein Wunder, dass niemand in die Halle gekommen war. Sie trat auf die oberste Treppenstufe und atmete tief durch. Die Stimme der Vernunft in ihr meldete sich zu Wort und beschwor sie eindringlich, es nicht zu tun, zumindest nicht ohne Begleitung. Immerhin befand sie sich in London und nicht in dem kleinen Provinzstädtchen, das sie gewohnt war. Sie hätte die Begleitung eines Lakaien verlangen können oder sogar die einer Zofe. Aber irgendwie lag ihr auch das Draufgängertum im Blut, obwohl sie normalerweise nicht diejenige war, die Grenzen überschritt. Sie warf den Kopf hin und her, genoss die Freiheit ohne Haube, und mit raschen Schritten eilte sie die Straße hinauf. Nur ein- oder zweimal schaute sie sich um, rechnete mehr oder weniger damit, dass ihr jemand nachrief und sie aufhielt. Nichts dergleichen passierte. Unentdeckt erreichte sie das Ende der Straße und wandte sich in Richtung Piccadilly.
Dort ging es schon lebhafter zu, war der Lärm der Stadt schon lauter. Neugierig blickten die Leute auf die gut gekleidete junge Frau ohne Hut, ohne Umhang und ohne Begleitung. Aber Abigail störte sich nicht daran; es ließ ihr Abenteuer nur noch aufregender werden.
Langsam schlenderte sie am Piccadilly entlang, betrachtete die Auslagen in den Schaufenstern und ignorierte die starrenden Blicke, bis ein junger Bursche in einer flammend gold- und violettfarbenen Weste sein Augenglas anhob, sie begaffte und ihr zuwinkte. Abigail warf den Kopf in den Nacken und drehte sich weg, merkte aber, dass er sich an ihre Fersen heftete. Plötzlich überfiel sie die Angst, sodass sie sich in eine schmale Einfahrt drängte und sich in einem lärmenden Hof wiederfand, der an allen vier Seiten durch die hohen Steinmauern der umliegenden Gebäude eingeschlossen war.
Panik stieg in ihr auf, während ihr Blick von einer Seite zur anderen flog. An der anderen Seite des Hofes lehnte sich ein liederliches Frauenzimmer an die Wand und beobachtete sie. Zwischen den Lippen der Frau klemmte eine Maiskolbenpfeife. Neben ihr stand ein Mann, der an einem Stück Holz schnitzte. Mit grüblerischer Miene musterten die beiden den Neuankömmling.
Abigail drehte sich um und wollte den Weg zurücklaufen, den sie gekommen war, sah sich aber dem Mann in der gestreiften Weste gegenüber.
»Sieh an, was für ein hübsches kleines Ding haben wir denn hier?«, fragte er mit unangenehm hoher Stimme, die außerdem noch einen jammernden Unterton hatte. Abigail sträubten sich die Nackenhaare.
»Lassen Sie mich durch, Sir«, verlangte sie so selbstbewusst, wie sie nur konnte. Noch nicht einmal ihr blieb das Zittern in ihrer Stimme verborgen.
»Oh, ich glaube nicht, dass ich das möchte«, entgegnete der Mann und umklammerte ihre Oberarme mit festem Griff. »Das hieße doch, dem sprichwörtlichen geschenkten Gaul ins Maul zu schauen. Was für ein Leckerbissen, der mir da direkt in die Arme läuft. Ich geb dir einen Kuss, Süße. Und du mir auch.« Er senkte den Kopf, sodass sein voller, glänzender Mund immer näher kam.
Abigail kreischte auf und trat ihm heftig gegen das Schienbein. Sie konnte den Wein in seinem Atem riechen, den Schweiß, über dem ein schweres Parfüm lag. Wieder schrie sie auf, just in dem Moment, als sein Mund sich über ihrem schloss; sie war überzeugt, in dem abscheulichen, heißen Gestank, den er ausströmte, ersticken zu müssen.
Und dann stob er von ihr fort, stürzte prustend gegen die Mauer.
»Sind Sie verletzt, meine Liebe?«, fragte eine besonnene Stimme.