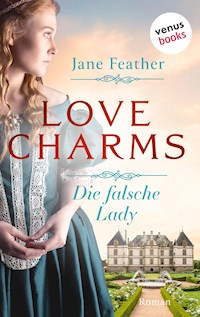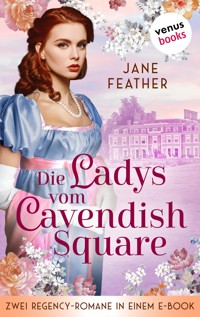4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Sein Herz erkennt die wahre Schönheit hinter ihrer Maskerade: Der Regency-Roman »Der Kuss des Lords« von Jane Feather jetzt als eBook bei dotbooks. Um das verlorene Erbe ihrer Familie zurückzuerlangen, schleicht sich die schöne Alexandra Douglas als unscheinbare Bibliothekarin verkleidet in den prächtigen Landsitz ihres Cousins ein. So lernt sie den charmanten Lord Peregrine Sullivan kennen, der dort zu Gast ist. Alexandras unbändiges Temperament fasziniert ihn so sehr, dass er sich trotz ihrer schmucklosen Erscheinung zu ihr hingezogen fühlt und alles daransetzt, mehr über sie herauszufinden. Doch Alexandra spielt ein gefährliches Spiel und darf ihre Deckung nicht auffliegen lassen. Um ihr Herz für sich zu gewinnen, muss der junge Lord alles aufs Spiel setzen … »Welch ganz und gar wunderbares Buch – spannend, humorvoll und einfach hinreißend!« Romantic Times Begleiten Sie in der Regency-Trilogie »Das Erbe von Blackwood« die drei adeligen Brüder Jasper, Sebastian und Peregrine auf ihrer abenteuerlichen Brautschau im London des 18. Jahrhunderts. Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Der Kuss des Lords« von Romance-Bestseller-Autorin Jane Feather. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Um das verlorene Erbe ihrer Familie zurückzuerlangen, schleicht sich die schöne Alexandra Douglas als unscheinbare Bibliothekarin verkleidet in den prächtigen Landsitz ihres Cousins ein. So lernt sie den charmanten Lord Peregrine Sullivan kennen, der dort zu Gast ist. Alexandras unbändiges Temperament fasziniert ihn so sehr, dass er sich trotz ihrer schmucklosen Erscheinung zu ihr hingezogen fühlt und alles daransetzt, mehr über sie herauszufinden. Doch Alexandra spielt ein gefährliches Spiel und darf ihre Deckung nicht auffliegen lassen. Um ihr Herz für sich zu gewinnen, muss der junge Lord alles aufs Spiel setzen …
Über die Autorin:
Jane Feather ist in Kairo geboren, wuchs in Südengland auf und lebt derzeit mit ihrer Familie in Washington D.C. Sie studierte angewandte Sozialkunde und war als Psychologin tätig, bevor sie ihrer Leidenschaft für Bücher nachgab und zu schreiben begann. Ihre Bestseller verkaufen sich weltweit in Millionenhöhe.
Bei dotbooks erscheinen als weitere Bände der Reihe »Regency Nobles«:
»Das Geheimnis des Earls – Band 1«
»Das Begehren des Lords – Band 2«
Außerdem erscheinen in der Reihe »Die Ladys vom Cavendish Square«:
»Das Verlangen des Viscounts – Band 1«
»Die Leidenschaft des Prinzen – Band 2«
»Das Begehren des Spions – Band 3«
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2018, November 2021
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2012 unter dem Titel »An Unsuitable Bride« bei Pocket Books, A Division of Simon & Schuster, Inc., New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Sinnliche Maskerade« bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2012 by Jane Feather
Copyright © der deutschen Ausgabe 2014 by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House, München
Copyright © der Neuausgabe 2018, 2021 dotbooks GmbH, München
Published by Arrangement with Jane Feather.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock sowie © Period Images / VJ Dunraven Productions
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-96655-945-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Kuss des Lords« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jane Feather
REGENCY NOBLESDer Kuss des Lords – Band 3
Roman
Aus dem Amerikanischen von Jutta Nickel
dotbooks.
Prolog
Januar 1763
»Aber ich verstehe das nicht.« Alexandra Douglas starrte auf die zwei Gegenstände, die der Anwalt ihr auf den Schreibtisch gelegt hatte. »Das soll unsere Erbschaft sein?« Sie berührte den schweren goldenen Siegelring und die mit Diamanten besetzte Uhrtasche, bevor sie mit einem besorgten Blick aus ihren klaren grauen Augen zu Anwalt Forsett aufschaute. »Sylvia und ich sollten nach Papas Tod jeweils zehntausend Pfund bekommen. Das hat er mir selbst gesagt.«
Der Anwalt rieb sich das Kinn. Dann räusperte er sich.
»Mistress Douglas, Ihre Lebensumstände und die Ihrer Schwester haben sich geändert, als Sir Arthur sich von Ihrer Mutter hat scheiden lassen.«
»Das ist mir wohl bewusst, Sir«, erwiderte Alexandra ein wenig streng. »Als meine Mutter das letzte Mal fortgelaufen ist, wurde ich ins Konvikt St. Catherine's gesteckt, und Sylvia musste bei unserer alten Kinderfrau bleiben. Das sind doch deutlich andere Umstände als in unserem früheren Leben in Combe Abbey. Da machen wir uns nichts vor, Sir.«
Eine Spur Mitgefühl lag im Blick des Mannes, als er seine Besucherin anschaute.
»Es gibt da noch einen Aspekt in Ihren geänderten Lebensumständen, Mistress Douglas, den Sie vielleicht noch nicht voll und ganz verstanden haben.« Wieder räusperte er sich. »Ihr rechtlicher Status hat sich ebenfalls verändert.«
Eine düstere Vorahnung erschütterte Alexandras gefasste Haltung.
»Rechtlicher Status?«, hakte sie nach.
Der Anwalt seufzte. Was für ein verabscheuungswürdiger Schlamassel. Unzählige Male hatte er seinem Mandanten Sir Arthur Douglas gesagt, dass er es seinen beiden Töchtern schuldig war, ihnen zu erläutern, was seine Scheidung für sie zu bedeuten hatte ... Aber Sir Arthur hatte sich standhaft geweigert, die Sache als dringlich einzustufen.
»Alles zu seiner Zeit, mein Lieber.« Der Anwalt hatte den brüsk ablehnenden Tonfall noch so deutlich im Ohr, als ob sein Mandant direkt vor ihm säße – und nicht tot und begraben im Mausoleum der Familie liegen würde. In Wahrheit hatte Sir Arthur der Mut gefehlt, seine Töchter über die grässliche Lage zu unterrichten, in die seine selbstsüchtigen Handlungen sie manövriert hatten. Und jetzt lag es bei seinem Anwalt, die Drecksarbeit für ihn zu erledigen.
»Ihr Vater hat die Scheidung von seiner Ehefrau, Ihrer Mutter, a vinculo matrimonii erwirkt«, fing er an.
»Was hat das zu bedeuten?«, unterbrach seine Besucherin, ehe er fortfahren konnte.
»Das, Ma'am, hat zu bedeuten, dass die fragliche Ehe von Anfang an null und nichtig ist, entweder wegen Unzucht unter Blutsverwandten oder wegen Wahnsinns oder ...« Mit leicht geröteten Wangen hielt er inne. »Oder wegen Nichtvollzugs. Sofern etwas davon zutrifft, wird die Ehe aufgelöst, als habe sie niemals existiert. In den ersten beiden Fällen werden alle Kinder aus der Verbindung für illegitim erklärt. Ihr Vater hat Ihre Mutter in absentia für wahnsinnig erklären lassen.«
Langsam begriff Alexandra, in welche Richtung die Sache führte, und aus ihrer düsteren Vorahnung entwickelte sich mehr und mehr eine schreckliche Angst.
»Sylvia und ich sind also Bastarde, Sir? Das haben Sie doch gemeint, oder?«
Seine Wangen färbten sich noch röter. Verlegen hustete er in die Hand.
»Mit einem Wort, ja, Ma'am. Und als uneheliche Kinder haben Sie rechtlich keinerlei Anspruch darauf, irgendetwas vom Anwesen Ihres Vaters zu erben. Es sei denn, es wurden besondere Vorkehrungen getroffen.«
Die junge Frau war sehr blass geworden. Aber ihre Stimme klang immer noch völlig ruhig, und der Blick war konzentriert.
»Ich darf annehmen, dass solcherlei Vorkehrungen nicht getroffen wurden?«
»Ihr Vater hatte die feste Absicht. Aber der Tod traf ihn sehr plötzlich, das heißt, noch bevor es ihm gelingen konnte, für Sie und Ihre Schwester irgendetwas anzuordnen. Jedoch ...« Anwalt Forsett öffnete die Schatulle auf dem kleinen Säulentischchen neben seinem Stuhl. »Sir Stephen Douglas, der Erbe Ihres Vaters, hat sich einverstanden erklärt, Ihnen und Ihrer Schwester jeweils fünfzig Pfund aus dem Vermögen zukommen zu lassen. Nur damit Sie über die Runden kommen, bis Sie eine Anstellung gefunden haben.« Er schob den Bankscheck über den Tisch zu Alexandra.
»Cousin Stephen?«, antwortete sie angewidert mit Blick auf den Scheck. »Das also hält er für fair?«
Der Anwalt fühlte sich sichtlich noch unbehaglicher als zuvor.
»Ich habe Sir Stephen vorgeschlagen, die Absichten Ihres verstorbenen Vaters in Ehren zu halten und Ihnen beiden jeweils einmalig die Summe von zehntausend Pfund auszuzahlen. Unglücklicherweise hat Sir Stephen die Sache anders gesehen.«
»Ja, selbstverständlich«, erwiderte sie und lächelte bitter. Alexandra hatte diesen entfernten Cousin zwar nie kennengelernt, aber auch ihr Vater hatte für seinen mutmaßlichen Erben nie ein gutes Wort übrig gehabt. Das Verlangen, Sir Stephen zu enterben, war, wie sie immer vermutet hatte, der Hauptgrund dafür, dass ihr Vater so überstürzt eine zweite Ehe eingegangen war und unbedingt einen männlichen Erben produzieren wollte.
Sie faltete den Bankscheck zusammen und stopfte ihn tief in die Tasche ihres Musselinrockes. Siegelring und Uhrentasche folgten, und schließlich erhob sie sich.
»Danke, dass Sie mir Ihre Zeit geopfert haben, Anwalt Forsett. Aber ich will Sie nicht länger in Anspruch nehmen.«
Er stand ebenfalls auf.
»Haben Sie sich Ihre nächsten Schritte schon überlegt, Ma'am?«, brachte er unbeholfen über die Lippen. »Sie müssen eine einträgliche Anstellung finden. Vielleicht kann das Konvikt Sie als Lehrerin anstellen. Oder vielleicht können Sie auch in einer respektablen Familie eine Stelle als Gouvernante antreten. Ihre Erziehung wird für Sie sprechen.«
»Dies lag zweifellos in der Absicht meines Vaters, als er mich ins Konvikt geschickt hat«, erklärte sie. Ihre Augen brannten. »Ich darf annehmen, dass es an mir ist, zusätzlich zu meinem eigenen Einkommen so viel zu verdienen, dass auch meine Schwester versorgt ist?«
»Ich könnte noch einmal mit Sir Stephen sprechen, Ma'am, an ihn appellieren ...«
»Nein, Sir«, unterbrach sie seine unbeholfene Rede, »meinen Cousin würde ich noch nicht einmal um das Schwarze unter seinen Nägeln bitten. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.«
Die Tür schloss sich hinter ihrer Grobheit. Kopfschüttelnd wischte sich der Anwalt mit einem großen Leinentaschentuch die Stirn und sank zurück auf seinen Stuhl.
Alexandra trat hinaus in den frischen Wind des Londoner Wintertages. Auf der Chancery Lane herrschte reger Verkehr. Eisenräder ratterten durch Pfützen und ließen das schmutzige Wasser aus der Gosse aufspritzen. Einen Moment lang stand sie einfach nur da; sie achtete nicht auf ihre Umgebung, wie benommen angesichts der Aussicht auf eine Zukunft, die keine Zukunft mehr war. Sie war in dem Glauben erzogen worden, dass ihre Welt sich niemals großartig ändern würde, dass sie den Pfad beschreiten würde, den andere junge Ladys in ihrer gesellschaftlichen Stellung schon vor ihr breit ausgetreten hatten. Noch nicht einmal die Scheidung ihrer Eltern – ein geradezu unerhörter Vorfall in ihren Kreisen – hatte unangemessene Sorge über den nächsten Abschnitt ihres Lebens in ihr ausgelöst. Einigermaßen zufrieden hatte sie sich im Konvikt St. Catherine's eingerichtet, nahe genug bei ihrer Schwester, die bei ihrer früheren Kinderfrau in guter Pflege war, und geduldig darauf gewartet, dass die Türen auf dem Weg ins Leben weit aufschwingen würden.
Aber stattdessen waren diese Türen gerade krachend zugeschlagen worden.
Kapitel 1
September 1763
Der Honorable Peregrine Sullivan zügelte sein Pferd oben auf den Klippen von Dorsetshire und ließ den Blick über das ruhige Wasser von Lulworth Cove schweifen. Weißliches Meerwasser spritzte durch den hufeisenförmigen Fels am Eingang und besänftigte sich wieder, als es auf den Strand zurückrollte.
Mit diesem südlichen Küstenstreifen war Peregrine nicht vertraut, denn größtenteils war er in der zerklüfteten Wildnis von Northumberland aufgewachsen, dort, wo raue Berge und hügelige Sümpfe das Landschaftsbild bestimmten. Aber hier – wo ausgedehnte Wassermassen in der Spätsommersonne glitzerten, hartes Gras oben auf der Klippe wuchs und die Luft von duftenden Nelken erfüllt war, die unter den Hufen des Pferdes zerstoben – hier fand er es viel wohltuender. Alles in allem ein angenehmerer Teil dieser Welt, dachte er, umso besser.
Müde drehte sein Pferd den Kopf und wieherte. Perry beugte sich vor und streichelte dem Tier den Nacken.
»Gleich sind wir da, Sam.« Er drückte dem Pferd die Absätze in die Flanken und drängte es weiter. Drei Tage hatte der lange Ritt von London insgesamt gedauert. Die Reisekasse des Honorable Peregrine war nicht besonders üppig gefüllt, weshalb er eine Ausgabe für die Postkutsche nicht willkommen geheißen hatte; außerdem hatte er an der Strecke nicht die Pferde wechseln und Sam dabei in einem unbekannten Stall unterstellen wollen. Daher waren sie nur langsam vorangekommen, in einem Schritt, den der Wallach bequem verkraften konnte. Inzwischen waren sie nur noch zwei Meilen von Combe Abbey entfernt, ihrem endgültigen Ziel.
Das große steinerne Gebäude auf der kleinen Anhöhe war von der Straße aus, die sich um die Klippe über dem Solent wand, ohne Schwierigkeiten zu erkennen. Es war ein beeindruckendes Gebäude mit vielen Türmen, dessen Erkerfenster in der untergehenden Sonne glühten. Gut gepflegte Grünflächen schwangen sich zur Klippe hinunter, und ein paar große Kiefern an der Grenze des Grundstücks und des Kliffs dienten als Windfang.
Perry spürte, wie Vorfreude in ihm aufkeimte. Das mächtige Gebäude barg insbesondere eine Bibliothek, und diese Bibliothek wiederum barg Schätze ... darunter einige bekannte wie etwa das Decamerone, das ihm buchstäblich das Wasser im Munde zusammenlaufen ließ, aber auch, da war er sich ganz sicher, viele unbekannte und ebenso unbezahlbare Kostbarkeiten. Sein guter Freund Marcus Crofton hatte ihm versichert, dass er sich in der Bibliothek aufhalten durfte, solange er wollte, denn ihr Besitzer Sir Stephen Douglas hatte ihm die Erlaubnis erteilt, dort nach Belieben zu schalten und zu walten.
Peregrine lenkte sein Pferd durch die Tore, die ein stämmiger Torwächter bereits geöffnet hatte.
»Das Witwenhaus befindet sich gleich hinter der ersten Kurve an der Auffahrt, Sir«, erläuterte er Peregrine. »Sie werden erwartet. Master Crofton hat angeordnet, dass ich mich um Sie kümmern soll.«
»Danke.« Perry lächelte freundlich und ritt die Auffahrt hinauf. Er freute sich nicht nur auf die Gelegenheit, die Bibliothek zu besichtigen, sondern auch auf den Besuch bei seinem alten Freund. Da sein Zwillingsbruder Sebastian mit seiner frisch angetrauten Ehefrau Lady Serena zu ausgedehnten Flitterwochen auf den Kontinent aufgebrochen war, hatte Peregrine sich eingestehen müssen, dass ihr gemeinsames Haus in der Stratton Street ihm viel zu groß und sehr einsam erschienen war. Seine Einsamkeit hatte ihn durchaus verwundert. Denn er hatte sich stets für ausgesprochen genügsam gehalten, zufrieden mit seiner eigenen Gesellschaft und der seiner Bücher. Aber es sah danach aus, als habe er sich geirrt.
Als das Witwenhaus ins Blickfeld rückte, drängte er Sam in den Trab. Das Gebäude im Queen-Anne-Stil mit einem hübschen Reetdach war nicht annähernd so beeindruckend wie die Abbey, wirkte aber recht einladend. Rauch kringelte sich aus dem Küchenschornstein, und die geöffneten Fenster in beiden Stockwerken sollten die Frische des frühen Abends einfangen. Vor dem Eingang stieg Peregrine aus dem Sattel und zog an der Klingelschnur. Er hörte, wie es im Gebäude läutete. Unverzüglich öffnete ein weißhaariger Butler die Tür, verbeugte sich und murmelte:
»Der Honorable Peregrine, wie ich annehmen darf, Sir?«
»Sie dürfen«, erwiderte Peregrine mit freundlichem Lächeln und zog sich die Handschuhe aus.
»Perry, bist du das?«, grüßte ihn eine fröhliche Stimme aus der kühlen Halle mit Eichenfußboden. Ein junger Mann ungefähr in Perrys Alter tauchte hinter dem Butler auf. »Willkommen, alter Freund.« Er streckte ihm die Hand entgegen.
Herzlich schüttelte Peregrine die Hand. Marcus Crofton kannte er schon aus der Schule. Aber während Perry unter dem Schutz seines ältesten Bruders Jasper gestanden hatte und in ständiger Begleitung seines Zwillings Sebastian aufgewachsen war, war Marcus allein in die erbarmungslosen Fluten von Westminster gestoßen worden; ihm war nichts anderes übrig geblieben, als schwimmen zu lernen oder unterzugehen. Die Blackwater-Brüder hatten ihre Protektion und ihre Freundschaften ausgedehnt. Marcus und Peregrine entdeckten ihre Leidenschaft für die Wissenschaft und freundeten sich rasch an. Einem nicht so übermäßig an der Wissenschaft interessierten Kopf wie Sebastian war es schwergefallen, die Leidenschaft seines Zwillingsbruders zu verstehen, und nachdem er es ein paar Mal versucht hatte, gab er es auf.
»Ich warte schon seit zwei Tagen auf dich. Du bist geritten?« Marcus linste über Perrys Schulter auf das Pferd, das geduldig wartete.
»Ganz gemächlich«, gab Perry zurück, »wo kann ich Sam unterbringen?«
»Oh, weiter oben an der Abbey«, sagte Marcus, »an der Abtei. Meine Mutter hat die Kosten gescheut, die Ställe wieder zu eröffnen, die zum Witwenhaus gehören. Aber Sir Stephen in seiner grenzenlosen Gastfreundschaft hat angeboten, die Abbey zu nutzen, wann und wie auch immer sie gebraucht wird«, fügte er mit einem sarkastischen Unterton hinzu, der Perry nicht entging.
»Mutter hat ihren Landauer dort untergestellt«, fuhr Marcus fort, »darüber hinaus nehmen wir seine Großzügigkeit aber nicht in Anspruch, es sei denn, ich bin dort unten auf der Jagd.« Wieder war der sarkastische Unterton nicht zu überhören. »Und für unseren Besuch, der ebenfalls die Ställe nutzt. Roddy wird ihn mitnehmen und ihn unterstellen. Kümmern Sie sich darum, Baker?«
»Selbstverständlich, Sir«, sagte der Butler und ging.
»Komm mit ins Wohnzimmer«, drängte Marcus, »nach dem langen Ritt musst du doch beinahe verdurstet sein.« Er ging voran in das Wohnzimmer, das eine heimelige und behagliche Atmosphäre verströmte; die Luft war erfüllt vom Duft der Rosen in großen Vasen, die an jedem freien Platz standen. »Perry, du musst meine Mutter entschuldigen. Die verwitwete Lady Douglas leidet unter einer angegriffenen Gesundheit und verbringt den größten Teil des Tages auf dem Sofa in ihrem Boudoir. Im Moment gönnt sie sich etwas Ruhe vor dem Dinner.« Er schenkte rubinroten Bordeaux in zwei Gläser und reichte eins seinem Gast. »Beim Dinner wirst du ihr natürlich begegnen.«
Peregrine hob das Glas zu einem Toast, mit dem er sich bedankte.
»Ich hoffe«, fügte er hinzu, »dass Lady Douglas meinen Besuch nicht als aufdringlich empfindet.«
»Oh, gute Güte, nicht die Spur, mein lieber Junge. Nichts schätzt meine Mutter mehr als Besuch. Sie mag es nur nicht, sich zu sehr anzustrengen. Aber Baker und seine Frau, die unersetzliche Mistress Baker, haben die Versorgung der Haushalte unter sich aufgeteilt, und meine Mutter hat wenig mehr zu tun, als das Riechsalz in ihre Richtung zu schwenken, und schon geschehen Wunder.« Marcus lachte auf. Es lag auf der Hand, dass er diese recht respektlose Beschreibung seines Elternteils ganz und gar nicht als beleidigend empfand.
Peregrine lächelte wissend. Seine Mutter hatte ebenfalls zu dieser kränklichen Sorte gehört, weshalb er die Situation bestens verstehen konnte.
»Ich bin Lady Douglas für ihre Gastfreundschaft nur zu dankbar. Und ich gestehe, dass ich meine Geduld kaum zügeln kann, endlich die Bibliothek zu sehen. Dein Stiefvater war als kenntnisreichster Sammler antiquarischer Bücher im ganzen Land bekannt. Wie sein Vater vor ihm.« In seinen blauen Augen funkelte die Begeisterung. Jetzt, da seine Reise zu Ende und er dem Objekt seiner Leidenschaft und seines Interesses nahe war, schien sogar die Erschöpfung zu weichen.
Wieder lachte Marcus auf. Nur zu gut kannte er die Abgründe der literarischen Begeisterung seines Freundes, wenngleich er selbst für Gebiete außerhalb der Wissenschaft kaum ein solch feuriges Interesse aufbringen konnte.
»Ich habe meine Zweifel, dass die Bibliothek unter Stephens Pflege wachsen und gedeihen wird. Sir Stephen Douglas scheint das Literaturinteresse seiner zwei Vorgänger nicht im Geringsten zu teilen. Aber du solltest schon bald Gelegenheit haben, dir die Sammlung anzusehen. Wir werden in aller Ruhe zu Hause essen. Du solltest gewarnt sein, dass wir die Uhrzeiten einhalten, die auf dem Lande üblich sind. Anschließend sind wir zu einem Abend beim Kartenspiel in die Abtei geladen. Sir Stephen lässt jeden Abend an Kartentischen spielen. Entweder mit seinen eigenen Hausgästen oder dem Landadel aus der Gegend.« Wehmütig lächelnd schüttelte Marcus den Kopf. »Ich warne dich, mein Freund. Wenn der Abend sich nicht gerade um Whist dreht, wird irgendein anderes Spiel gespielt. Sir Stephens Einsätze sind ausgesprochen hoch.«
Peregrine verspürte weder das Verlangen nach hohen Einsätzen, noch besaß er die entsprechenden Mittel. Aber wenn es darauf ankam, würde er sich natürlich darauf einlassen. Schulterzuckend schob er die Sache beiseite.
»Solange ich die Gelegenheit habe, einen Blick in das Decamerone zu werfen, werde ich mein Bestes geben.«
»Oh, was das betrifft, wird dir niemand ins Handwerk pfuschen. Nur mit dem Bibliothekar musst du dich natürlich gutstellen.«
»Bibliothekar? Es gibt einen Bibliothekar?« Perry war überrascht, dass ein Mann ohne das geringste Interesse an Büchern jemanden einstellte, dessen Aufgabe in nichts anderem bestand, als sich um selbige zu kümmern.
»Ja, sie ist schon seit einer Weile dort. Stephens Interesse an der Sammlung ist tatsächlich gering, abgesehen von ihrem Geldwert. Daher hat er Mistress Hathaway eingestellt. Sie soll die Bücher katalogisieren. Anschließend sollen sie gegen Höchstgebot verkauft werden. Was eine verdammte Schande ist. Ich bin überzeugt, dass mein Stiefvater sich im Grabe umdreht.« Marcus schüttelte den Kopf. »Erst verschwendet Sir Arthur sein ganzes Leben daran, mit größter Sorgfalt diese Sammlung zusammenzutragen, und nicht nur er, sondern vor ihm auch schon sein Vater, wie du erwähnt hast. Manche Werke sind wirklich unbezahlbar. Wie auch immer, Mistress Hathaway ist ein ziemlich graues Mäuschen, obwohl ich glaube, dass sie genau weiß, was sie tut. Trotzdem ist sie so schüchtern und zurückhaltend, dass sie bestimmt die Flucht ergreift, wenn du sie ansprichst.«
»Kaum zu glauben, dass Sir Stephen solche Kostbarkeiten gar nicht zu schätzen weiß«, bemerkte Peregrine und nippte an seinem Bordeaux.
»Um der Wahrheit die Ehre zu geben, mein Lieber«, entgegnete Marcus, »in Sir Stephen Douglas steckt mehr als nur der Hauch eines Spießbürgers. Geld ist seine größte Leidenschaft, soweit ich es beurteilen kann. Und gesellschaftlicher Aufstieg die Leidenschaft seines angetrauten Eheweibs, der unschätzbaren Lady Maude«, ergänzte er mit boshaftem Grinsen. »Stephen legt sich richtig ins Zeug, um ihren Ehrgeiz zu fördern. Er reitet mit der Hundemeute zum Landadel hinaus und bietet jedem, der in Dorset irgendetwas darstellt, die größte Gastfreundschaft an. Aber die Lady scheint seine Mühen nicht sonderlich anzuerkennen.« Er leerte sein Glas. »Ich will dir dein Zimmer zeigen. Bestimmt willst du den Staub der Straße abwaschen, ehe wir zum Dinner gehen.«
Marcus zeigte ihm den Weg nach oben in ein geräumiges Schlafzimmer auf der Rückseite des Hauses.
»John wird dich bedienen. Ich schicke ihn sofort hoch.« Er deutete auf ein Tischchen am Fenster. »Bordeaux und Madeira, falls dir danach ist. In einer halben Stunde sehen wir uns im Salon.« Die Tür schloss sich hinter ihm.
Perry ließ den Blick schweifen. Sein Reisekoffer war vom Pferd geschnallt, ausgepackt und die Kleidung bereits in den Schrank gehängt worden. Es klopfte an der Tür; ein Kammerdiener brachte einen Krug mit dampfendem Wasser und frische Handtücher.
»Guten Abend, Sir.«
»Guten Abend, John ... so ist doch Ihr Name?« Perry zog sich den Mantel aus. »Ich bin über und über mit Straßenstaub bedeckt, und ich brauche eine Rasur. Würden Sie meine Klinge schärfen?«
»Aye, Sir.« Der Kammerdiener machte sich sofort an die Arbeit mit der Klinge und dem Streichriemen, während Perry sich bis auf die Unterwäsche auszog.
Eine halbe Stunde später zeigte er sich im Salon – angemessen gekleidet in einen Anzug aus weinfarbenem Samt, schlichten weißen Strümpfen und Schnallenschuhen. Sein einziger Schmuck bestand in einem türkisfarbenen Anstecker in den Seidenfalten des Tuches an seinem Hals und einer Schließe mit demselben Stein, mit der er den einfachen Zopf in seinem Nacken zusammenhielt.
»Ah, da bist du ja, Perry. Alles zu deiner Zufriedenheit, nehme ich an.«
»Sehr sogar, vielen Dank.« Perry ergriff das Glas, prostete Marcus zu und schlenderte zu dem Erkerfenster, das über den sanften Schwung des Rasens auf den Streifen glitzernder blauer See hinauszeigte, die durch den Windfang aus Kiefern hindurch zu erkennen war. »Herrliche Kulisse, Marcus.«
»Ja, finde ich auch«, gab Marcus zurück und stellte sich neben seinen Freund. »Mein Stiefvater war ein sehr umsichtiger Landbesitzer. Der Tod traf ihn urplötzlich, ein Fieber aus dem Nichts. Innerhalb von zwei Tagen war er tot.« Er schüttelte den Kopf. »Die Ärzte konnten es kaum fassen. Er schien stark wie ein Pferd, als es ihn niederwarf. Nachdem die Tatsache nicht zu leugnen war, murmelten sie irgendetwas von einem schwachen Herzen. Aber das alles ist uns immer noch ein Rätsel. Wie auch immer, die Ländereien und die Bücher hat er in tadelloser Ordnung zurückgelassen.«
»Unglücklicherweise ...« Abrupt hielt Marcus inne, räusperte sich und wechselte das Thema.
»Falls du angeln willst, Perry, das Lachsgewässer ist gut gefüllt.«
»Wenn ich auf dem Land bin, vertreibe ich mir die Zeit am liebsten mit Angeln«, plauderte Perry leichthin, während er sich fragte, was sein Freund eigentlich gerade hatte sagen wollen.
»Gentlemen, Lady Douglas kommt die Treppe herunter,«, verkündete der Butler an der Tür.
Marcus nickte.
»Danke, Baker.« Er ging zu den Gläsern und Karaffen an der Anrichte und schenkte ein wenig Ratafia-Likör in ein zartes Kristallglas.
»Ah, meine lieben Jungen, ihr seid schon vor mir unten.« Die helle Stimme tönte aus etwas, was Perrys irritiertem Blick wie eine aufgebauschte Woge aus Seide, Chiffon und Paisleytüchern vorkam. Tief in dieser Stoffwoge glomm ein Paar hellbrauner Augen; eine schmale, sehr weiße und schwer beringte Hand tauchte auf. Perry beugte sich über die Hand.
»Lady Douglas, ich bin höchst erfreut über Ihre Gastfreundschaft.«
»Unsinn.« Unbekümmert wedelte sie mit der Hand. »Die Freunde meines lieben Marcus sind mir stets höchst willkommen.« Die Stoffwoge schwebte zu einer Chaiselongue und kam in eleganten Falten zur Ruhe, welche, nachdem sie endlich geordnet worden waren, die eher plumpe Gestalt und puppenhafte Haltung einer Lady in den mittleren Jahren enthüllte. Sie lächelte Peregrine freundlich an und tupfte sich mit einem lavendelgetränkten Taschentuch die Schläfen. »Unglücklicherweise bin ich mehr oder weniger ein Pflegefall. Sie müssen also entschuldigen, dass ich mich die meiste Zeit in meinem Zimmer aufhalte.« Sie seufzte. »Was für eine Strapaze. Aber wir müssen uns mit dem bescheiden, was uns zuteil wird. So ist es, nicht wahr, Marcus?«
»In der Tat, Ma'am«, stimmte ihr Sohn mit ernster Miene zu und reichte ihr das Glas Ratafia. »Ich hoffe, dies schenkt Ihnen ein wenig Kraft, bevor wir dinieren.«
»Oh ja, das ist wirklich ein Tonikum.« Sie nickte selbstgefällig. »Nun, Mr. Sullivan, verraten Sie mir doch, was erzählt man sich Neues in London? Wie lautet der neueste Klatsch und Tratsch?« Noch ein kleiner Seufzer, dann fügte sie hinzu: »Oh, wie sehr ich die Geschäftigkeit der Stadt doch vermisse. Aber dazu fehlt mir einfach die Kraft.«
Perry erhaschte einen Blick auf den grinsenden Marcus und zügelte sein eigenes Amüsement, während er sein Gedächtnis krampfhaft nach dem passenden Tratsch durchstöberte. Seine Schwägerin Lady Serena war stets ein Quell, der vor nützlichem Gerede nur so sprudelte ... Ihm fiel ein, was es über den Duke und die Duchess of Devonshire zu erzählen gab.
Lady Douglas lauschte mit fasziniert aufgerissenen Augen. Mit ihrem hellen, zart rötlichen Teint und dem runden Kinn ist sie wirklich eine schöne Frau, dachte Perry, sicherlich ist sie jünger, als aus ihrem kränklichen Verhalten zu schließen ist. Es gefiel ihr sehr, wie Peregrine versuchte, sie zu unterhalten, und als das Dinner angekündigt wurde, erhob sie sich mit unerwarteter Energie von der Chaiselongue und ergriff seinen Arm, damit er sie zu Tisch führen konnte.
Marcus folgte, er lächelte in sich hinein. Seine Mutter lag ihm sehr am Herzen – nur sechzehn Jahre waren sie auseinander –, und er war immer hocherfreut, wenn die Last, sie zu unterhalten, so kundig geschultert wurde wie von Perry.
Bevor Mistress Hathaway in den Salon von Combe Abbey hinunterstieg und dem Ansinnen ihres Dienstherrn folgte, den vierten Platz an einem der Whisttische einzunehmen, blieb sie vor dem Spiegel stehen und beäugte ihr Äußeres. Wie üblich hatte sie mit der Familie und deren Hausgästen zu Abend gegessen, hatte sich aber auch wie üblich rasch in ihr Schlafzimmer geflüchtet, als die Ladys aufstanden und sich in den Salon zurückzogen. Die unwillkommene Anordnung war ergangen, als die Gentlemen sich, gefüllt mit Port, zu einem Abend an die Whisttische gesetzt hatten.
Wann immer die Zahl der Gäste ungerade war, wurde sie an einen vierten Platz gerufen. Mistress Hathaway schalt sich für ihre Dummheit, eines Nachmittags, als ihr Dienstherr sie beim Pikett zu sehen wünschte, offenbart zu haben, dass sie sich beim Kartenspiel sehr geschickt anstellte. Mein Eifer hat mir noch niemals gutgetan, dachte sie verwirrt. Denn wenn sie Sir Stephen hätte gewinnen lassen, befände sie sich jetzt nicht in dieser abscheulichen Lage, sich an den Tisch setzen zu müssen, sobald ihr Dienstherr es befahl.
Sie warf einen Seitenblick auf ihr Spiegelbild, auf den kleinen, kaum sichtbaren Höcker unten in ihrem Nacken. Das Kerzenlicht fing den schwachen braunen Leberfleck unter ihrem rechten Wangenknochen ein und das störrische graue Haar über ihren Schläfen. Mistress Alexandra Hathaway seufzte, obwohl sie zufrieden nickte. Alles in Ordnung. Sie schnappte sich ihren Nasenkneifer und den Fächer von der Kommode, zog sich die schwarzen Seidenhandschuhe an und stieg die Treppe hinunter.
Als sie die Halle in Richtung Salon durchquerte, öffnete der Butler gerade zwei jungen Männern die Tür. Sie erkannte Marcus Crofton, nicht aber dessen Begleiter.
»Guten Abend, Mistress Hathaway.« Mr. Crofton grüßte sie auf seine übliche leutselige Art. Sie knickste, senkte den Blick und murmelte kaum hörbar einen Gruß.
»Gestatten Sie, dass ich meinen Gast vorstelle, Ma'am. Der Honorable Peregrine Sullivan.« Marcus deutete auf seinen Begleiter, der dem Butler Hut und Stock reichte. »Mistress Hathaway ist der gute Geist unseres Anwesens, das solltest du dir merken, Perry. Wie ich bereits erwähnt habe, katalogisiert sie den Bestand von Sir Stephens überwältigender Bibliothek.«
Peregrine war begierig darauf, die Wächterin über die Schätze der Bibliothek kennenzulernen, und verbeugte sich mit einem warmherzigen Lächeln.
»Mistress Hathaway, was für eine Ehre.«
»Sir.« Sie knickste zum zweiten Mal, mied aber seinen Blick.
Peregrine legte die Stirn leicht in Falten. Was für ein seltsames Geschöpf diese Frau doch war. Ganz und gar nicht das, was er von einem Menschen erwartete, der in der Lage war, eine solch geistige Schatzkammer zu erkennen und zu katalogisieren wie Sir Arthur Douglas' Bibliothek. Nun, der Eindruck kann täuschen, beschwor er sich.
»Ich, kann es kaum erwarten, das Exemplar des Decamerone zu sehen, Ma'am. Es soll zu Sir Stephens Sammlung gehören.« Bei seinen Worten schien Mistress Hathaway ein wenig zusammenzuzucken. Vielleicht hat aber auch nur ihr missgestalteter Nacken ihr Schmerzen bereitet, dachte Perry mit einem Anflug von Mitgefühl.
»In der Tat, Sir«, erwiderte sie nach einer kaum merklichen Pause und hob zum ersten Mal den Blick. Große graue Augen schauten ihn unter überraschend üppigen dunklen Wimpern an. »Ich würde mich freuen, Ihnen das Exemplar bei Gelegenheit zu zeigen. Im Moment jedoch erwartet mein Dienstherr mich am Whisttisch.« Sie bewegte sich zu den Doppeltüren des Salons.
Die Lady hat irgendetwas Rätselhaftes an sich, dachte Peregrine, irgendwie scheint sie leicht neben der Spur zu sein. Aber was geht mich das eigentlich an?, schob er seinen Gedanken beiseite, während er Marcus in den Salon folgte.
»Lady Douglas, darf ich Ihnen meinen Hausgast vorstellen, den Honorable Peregrine Sullivan?« Marcus beugte sich über die Hand einer steifen Frau, die ein Sacque-Kleid aus magentafarbener Seide trug, das ihr so schlaff am Leib herunterhing wie von einem Kleiderbügel. Das Dekolleté enthüllte viel blässliche sommersprossige Haut; das blassrote Haar hingegen war zu einer aufwendigen Frisur gearbeitet, deren Kringellöckchen auf der Stirn klebten, während straffe Ringellocken ihr über die entblößten kantigen Schultern fielen.
Sie nickte, beantwortete Peregrines Verbeugung mit einem Knicks und unterzog ihn einem prüfenden Blick, mit dem er offenbar als begehrenswert eingestuft wurde.
»Mr. Sullivan. Ohne Zweifel, Sie sind willkommen«, murmelte sie mit kühl zuckenden Lippen, was Peregrine mit ausreichender Einbildungskraft auch für ein Lächeln hätte halten können.
»Eine Ehre, Lady Douglas«, gab er mit tadelloser Höflichkeit zurück.
Sir Stephen Douglas war ein großer, gut gebauter Mann mit blühendem Teint. Sein Bauch drückte gegen die Silberknöpfe seiner gestreiften Weste, und die Hose aus grünem Damast spannte sich über seinen kräftigen Schenkeln.
Ein sportlicher Mann, wie Perry vermutete, als er sich vor seinem Gastgeber verbeugte, vielleicht aber den Gaumenfreuden aus der Karaffe ein wenig zu sehr zugeneigt. Wenn sein mittleres Alter sich zum Ende neigte, würde er ziemlich heruntergekommen sein. Eigentlich ein herzloser Gedanke, aber irgendetwas an dem Mann sorgte dafür, dass Perry sich die Nackenhaare sträubten, ohne dass er sagen konnte, woran es lag.
»Honorable Peregrine Sullivan, he? Wohl einer der Blackwaters.« Sir Stephen schnupfte, während er die Verbeugung erwiderte. »Mit Ihrem Bruder, dem Earl, bin ich flüchtig bekannt. Wir gehören demselben Londoner Club an. Ich kann mich jedoch nicht erinnern, Ihnen dort schon mal begegnet zu sein.«
»Ich bin fest überzeugt, dass ich mich erinnern könnte, wenn wir uns dort getroffen hätten, Sir«, erwiderte Peregrine mit einem sanften Lächeln. »Aber ich bin dem Kartenspiel nicht übermäßig zugeneigt. Blackwater auf der anderen Seite ist recht angetan.«
»Dem Kartenspiel nicht übermäßig zugeneigt ... ach was, Sir. Welcher Gentleman ist den Karten nicht zugeneigt?«, rief Sir Stephen aus und nieste den Schnupftabak energisch in sein Taschentuch.
»Wir gehören zwar zu einer seltenen Spezies, Sir Stephen, sind aber selbst in den besten Kreisen zu finden«, erwiderte Peregrine mit einem liebenswürdigen Lächeln, das den Hauch Missbilligung in seiner Stimme keineswegs verhehlte. Ein merkwürdiges Geräusch hinter seiner Schulter drang in sein Bewusstsein. Ein leichtes Husten. Schnell drehte er den Kopf, entdeckte aber nur die Bibliothekarin ganz in seiner Nähe, die ihren Fächer schwenkte und den Blick auf nichts Bestimmtes gerichtet hatte.
»Oh, gut ... sehr gut.« Verspätet schien es Sir Stephen in den Sinn zu kommen, dass er unterstellt haben könnte, seinem Gast, einem Sprössling der erhabenen Blackwaters, mangele es an den Eigenschaften eines Gentlemans. Er blinzelte ein wenig aus der Fassung geraten und stopfte sich das Taschentuch in die tiefe Tasche seiner Jacke. »Nun, wir haben drei Whisttische eingerichtet. Mistress Hathaway hat sich einverstanden erklärt, den vierten Platz am dritten Tisch zu besetzen. Ich nehme an, Sie erheben keine Einwände, Mr. Sullivan.«
»Wie könnte ich?«, erwiderte Peregrine höflich. »Sofern die Lady keinerlei Einwände erhebt, mit einem – wie er selbst zugeben muss – Amateur zu spielen.« Mit fragend hochgezogener Augenbraue schaute er die Bibliothekarin an.
»Vielleicht kann ich Ihnen als Partnerin gar nicht das Wasser reichen, Sir«, murmelte die Lady hinter ihrem Fächer, »allein in diesem Falle könnte ich mich glücklich schätzen, mich als Gegnerin eines Amateurs wiederzufinden.« Sie ging zu dem Kartentisch, der am anderen Ende des Salons aufgebaut worden war.
Peregrine schluckte überrascht angesichts der schlagfertigen Erwiderung. Sein Gastgeber hatte die leise gesprochene Bemerkung eindeutig nicht gehört und war damit beschäftigt, die Spieler den einzelnen Tischen zuzuweisen. Die Gesellschaft teilte sich. Perry nahm am dritten Tisch Platz; mit ihm ein stechend dreinblickender Gentleman in einem Anzug aus lebhaftem Türkis sowie eine Lady unbestimmten Alters, die angesichts ihres leicht rötlichen Teints und des Dekolletés ihres knallroten Kleides, das zu viel faltige Haut enthüllte, etwas zu jugendlich gekleidet war, zumal weder Teint noch Dekolleté mit Farbe oder Puder verschönert worden waren. Mistress Hathaway setzte sich eher schüchtern an ihren Platz und hielt den Blick gesenkt, als sie die Karten zogen, um die Spielpartner auszulosen.
Peregrine schätzte sich ausgesprochen glücklich, dass er mit der Bibliothekarin spielen durfte. Nicht nur, dass ihr Talent seine eigenen Unzulänglichkeiten ausgleichen würde; darüber hinaus hatte ihre sanft gemurmelte Erwiderung seine Neugier angestachelt. Hatte er sie wirklich richtig verstanden?
»Ich fürchte, Sie haben den Kürzeren gezogen, Ma'am«, murmelte er, während er sich auf den Stuhl ihr gegenüber setzte. »Aber ich werde mein Bestes geben, damit ich Sie nicht enttäusche.« Er verbarg sein Lächeln und wartete darauf, ob sie den Köder wohl schlucken würde.
Mistress Hathaway schaute ihn an. »Wenn Sie nur so gut spielen, wie Sie es wirklich können, Sir, bin ich mehr als zufrieden«, entgegnete sie. Ihre Stimme klang so sanft wie immer, ihre Miene war so demütig wie zuvor. »Ich möchte Sie aber bitten, sich zu erinnern, dass die Geldbörse einer Bibliothekarin nicht besonders dick ist.«
In ihren grauen Augen funkelte es unverkennbar amüsiert, sogar herausfordernd. Perrys Lippen zuckten. Sie hatte ihn nicht enttäuscht. Trotzdem überraschte ihn immer noch der scharfe Unterton, der gar nicht zu den Lippen dieser schäbig gekleideten, gedrückten Frau zu passen schien. Und auch an diesen Augen gab es etwas, was nicht zum Gesicht passte. Denn diese Augen waren jung, hell und sehr scharf. Er lehnte sich näher zu ihr, und sein eigener Blick wurde schärfer; sofort senkte sie den Blick auf die Karten, die sie in ihrer Hand sortierte. Er setzte sich zurück und bereitete sich darauf vor, den rechten Moment zu erwischen.
Warum um alles in der Welt hatte sie sich nur eine solche Antwort erlaubt? Alexandra verfluchte sich herzhaft für ihren dummen Impuls. Nur dass dieser Honorable Peregrine irgendetwas an sich hatte, was sie anstachelte, was sie provozierte, sich auf diese Art auf ihn einzulassen. Vielleicht lag es an seinem Wissen um das Decamerone – sie sehnte sich danach, die Bibliothek mit jemandem zu diskutieren, der ihre Freude an den Kostbarkeiten zu teilen verstand –, aber vielleicht hatte es auch damit zu tun, dass er Sir Stephens Überheblichkeit so scharf abgebügelt hatte. Woran auch immer es lag, es war ebenso lächerlich wie gefährlich. Sie biss sich in die Wange, bis der Schmerz sie ablenkte.
Schon bald wurde Perry klar, dass es sich bei seiner Spielpartnerin tatsächlich um eine Expertin handelte. Es entsprach der Wahrheit, dass er sich nie besonders zu den Karten hingezogen gefühlt hatte – es gab doch so viele andere interessante Möglichkeiten, den Abend zu verbringen –, aber er besaß ein mathematisches Gedächtnis, und nach ein paar Runden entdeckte er ein unbekanntes Vergnügen an der intellektuellen Übung dieses Gedächtnisses und dem Rechnen, in dem Mistress Hathaway zu glänzen schien. Es war überaus befriedigend festzustellen, dass sie voll und ganz übereinstimmten und genau wussten, wie der jeweils andere der Führung folgen würde.
Ein oder zwei Mal blinzelte seine Partnerin zu ihm hinüber, als sie das Spiel gemeinsam übernahmen. Dann konnte er ein Licht in ihren grauen Augen erkennen, das nicht zu der schlaffen, schwach dunkel schattierten Haut unter diesen Augen zu passen schien. Aber niemals sprach sie, es sei denn, um ihr Gebot zu nennen. Mit derselben brüsken Entschiedenheit, mit der sie die Gewinne und Verluste am Ende einer jeden Runde aufaddierte, legte sie auch die Karten auf den Tisch.
Eine beeindruckende Lady, deren äußere Erscheinung ihr tüchtiges Spiel Lügen strafte. Peregrine fragte sich, ob dieser Widerspruch sonst niemandem auffiel, als der Abend plötzlich zu Ende war und er sich mit einer beachtlichen Summe in seiner Tasche erhob. Er schüttelte seinen Gegnern die Hand, ehe er sich in Mistress Hathaways Richtung drehte. Um seine Lippen spielte ein Lächeln, als er ihr ebenfalls die Hand entgegenstreckte – nur um zu entdecken, dass der Platz hinter ihm leer war. Die Bibliothekarin war nirgends zu entdecken ... stattdessen tauchte Marcus gähnend neben ihm auf.
»Stephen stellt eine Angelexpedition für morgen zusammen«, sagte Marcus, »gleich bei Sonnenaufgang. Hättest du Lust, dich anzuschließen?«
»Aber sicher«, erwiderte Peregrine begeistert, »mir ist eher nach Angeln zumute als nach Whist.«
Marcus lachte auf.
»Für dich hat sich der Abend doch gelohnt, nehme ich an.«
»Ja«, stimmte Peregrine nachdenklich zu, »und das habe ich in nicht geringem Ausmaße dieser Mistress Hathaway zu verdanken.«
»Ja, sie ist schon eine ungewöhnliche Frau. Es gibt nicht sehr viele gute Seelen, die es auch noch mit ihrem Verstand aufnehmen können«, bekräftigte Marcus und gähnte wieder, »trotzdem, es ist gut, dass sie wenigstens so geistreich ist, ihre doch recht unglückliche Erscheinung kompensieren zu können.«
»Ja, das nehme ich auch an«, bestätigte Perry, als sie in die sternenlose Nacht hinaus- und den Weg zum Witwenhaus hinüberschlenderten.
Kapitel 2
Alexandra Douglas erreichte den sicheren Hafen ihres Schlafzimmers. Mit einem Seufzer der Erleichterung schloss sie die Tür hinter sich. Sie lehnte sich gegen die Tür und lauschte den Geräuschen der aufbrechenden Gesellschaft draußen in der Halle. Ihre Flucht hatte sie so abrupt angetreten, dass es eigentlich unhöflich war; allerdings zweifelte sie daran, dass überhaupt jemand von ihr Notiz genommen hatte. Außer vielleicht ihr blonder Whistpartner, der Honorable Peregrine Sullivan, dessen tiefblaue Augen so verwirrend durchdringend blicken konnten, dass ihr ganz unbehaglich zumute war. Aber was hätte er entdecken können?
Mit ihrer impulsiven Erwiderung hatte sie sich natürlich keinen Gefallen getan. Aus unerfindlichen Gründen hatte der Mann die sorglose Alexandra Douglas in ihr zum Vorschein gebracht – die Frau, die sie einst gewesen war. Wortgefechte hatte sie immer sehr genossen und sich lebhaft auf jeden Menschen eingelassen, der bereit war, es mit ihr aufzunehmen. Inzwischen hatte sie gelernt, ihren inneren Drang zu zügeln. Dachte sie zumindest. Manchmal war es ungeheuer schwierig, ihr wahres Selbst in diesem dumpfen Panzer ihrer Verkleidung zu verbergen. Denn unter der unscheinbaren grauen Oberfläche ihrer äußeren Verkleidung loderte die Flamme, die Alexandra Douglas hieß, so hell wie immer, und es verging kein Tag, ohne dass sie sich nicht zumindest einmal danach sehnte, sich von diesem jämmerlichen Geschäft zu befreien, auf das sie sich eingelassen hatte.
Sie prüfte nochmals, ob die Tür auch wirklich fest verschlossen war, und ging dann hinüber zum langen Spiegel, um ihr Äußeres zu betrachten. Ihre Erscheinung war immer noch in Ordnung. Nichts war ungehörig oder widerspenstig. Der Honorable Peregrine hatte sicherlich auch nichts Ungewöhnliches entdecken können. Das Spiegelbild zeigte ein geducktes Mäuschen mittleren Alters in einem altbackenen Kleid aus Kammgarn in unbestimmbarer Farbe und den unverkennbaren Leberfleck, der ihre Wange entstellte.
Wieder einmal wurde sie von einer Welle empörter Niedergeschlagenheit durchflutet. Nein, so wollte sie nicht aussehen. Was hätte der Honorable Peregrine nur gedacht, wenn er gesehen hätte, wie sie wirklich war? Plötzlich erfüllte die unvernünftige Sehnsucht ihr Inneres, ihm zu zeigen, dass das, was sie jetzt verkörperte, nichts als eine Scharade war. Mit einem leise gemurmelten Fluch zog sie sich die Nadeln aus ihrem Haar, schüttelte die streng geflochtenen und im Nacken aufgebundenen Zöpfe frei und fuhr sich mit den Fingern durch das Haar, um das Wirrwarr zu glätten.
Kurz darauf fragte sie sich, warum um alles in der Welt es sie überhaupt störte, dass jemand, der ihr vollkommen fremd war, in ihr nichts als eine hässliche alte Frau in einem schäbigen Kleid sah. Selbst wenn sie es abstoßend fand, triumphierte sie doch wegen des Erfolgs, den sie mit ihrer Verkleidung genoss, und empfand ein willkommenes Gefühl der Überlegenheit gegenüber all denen, die sie zu täuschen vermochte. Was also war anders beim Honorable Peregrine? Nicht dass es mich auch nur im Mindesten interessiert, beschwor sie sich eifrig. Nur der Plan zählte, und dieser Plan war es, den sie niemals aus den Augen verlieren durfte.
Sie rückte näher an den Spiegel und betrachtete eindringlich die grauen Strähnen, die sie kunstvoll in die kastanienbraune Masse eingewoben hatte. In ein oder zwei Tagen wäre eine Neufärbung nötig. Alexandra knöpfte ihr Kleid auf, ließ es auf die Knöchel sinken und löste die Schnüre des kleinen Kissens zwischen ihren Schulterblättern. Dann setzte sie sich an die Frisierkommode und reinigte sich das Gesicht mit einem weichen Tuch, das sie in das Wasser im Krug tunkte. Die dunklen Augenringe waren mit einem Wisch verschwunden, während das Muttermal ein wenig länger brauchte. Aber am Ende betrachtete Alexandra Douglas wieder ihr eigenes Gesicht im Spiegel und nicht das von Mistress Alexandra Hathaway.
Es war erleichternd, sich selbst wieder zurückzuhaben, wenn auch nur für eine Nacht. Kurz nach Morgengrauen würde der ganze mühselige Vorgang aufs Neue beginnen; aber im Moment spürte sie, wie die Anspannung, die die Täuschung mit sich brachte, von ihr abglitt, sobald die Verkleidung abgelegt war.
Sie stand auf, schlüpfte in eine wollene Nachtjacke und zurrte den Gürtel fest, bevor sie sich ein kleines Gläschen Madeira aus der Flasche einschenkte, die sie unten in ihrem Schrank versteckt hatte. Es wäre nicht klug, wenn die Dienstboten entdeckten, dass Sir Stephens Sekretärin und Bibliothekarin ein heimlicher Schluckspecht war. Nicht dass sie sich jemals mehr erlaubte als nur ein winziges Schlückchen zur Nacht. Nach den Anstrengungen des Tages half es ihr, sich zu entspannen, und es lockerte die strikte Beherrschung, mit der sie jede Minute an sich halten musste, die sie außerhalb der Sicherheit ihres Schlafzimmers in einer Ecke des Hauses verbringen musste.
Alex setzte sich auf die Fensterbank und blickte über den Rasen auf den silbrigen Schimmer des vom Mond erhellten Meeres. Es war eine schöne Nacht. Aber schon bald würde das Laub sich verfärben und von den Ästen fallen, und der winterliche Wind würde kräftig vom Meer her blasen. Die Winter in Combe Abbey hatte sie immer geliebt, die frostigen Felder, die nackten Bäume, die sich im böigen Wind bogen, den Geruch der Holzscheite, die in den großen Kaminen loderten. Nachdem sie und ihre Schwester aus dem Reich ihrer Kinderfrau ausgezogen waren, hatte ihr Schlafzimmer vorn im Haus gelegen; Sylvias gleich nebenan. Sir Stephens Ehefrau Lady Maude hatte die beiden Zimmer mittlerweile als Gästezimmer eingerichtet. Aber Alex war zufrieden mit ihrem kleinen Eckzimmer, denn es trennte sie vom Rest des Hauses und war leichter über die Hintertreppe erreichbar als über die große Treppe, die von der vorderen Halle aus nach oben führte.
Vor nur wenigen Monaten hatte sie sich vergnügt von einem Tag zum anderen in einer Welt bewegt, in der alles einem vorgegebenen Muster folgte. Bis zu jenem Nachmittag im Dezember ... war es wirklich möglich, dass seit diesem Nachmittag erst acht Monate vergangen waren?
Sie stützte den Ellbogen auf das Bein und das Kinn in die Hand und ließ es zu, dass ihre Erinnerung in jenen frostigen Nachmittag zurücktrieb ...
»Mistress Alexandra? Oh, da sind Sie ja. Ich habe schon überall nach Ihnen gesucht.« Das junge Dienstmädchen rückte seine Haube zurecht, als es sich unter dem nackten Zweig des Apfelbaumes hindurchduckte. Der frische Winterwind sorgte für Atemlosigkeit und rote Wangen.
»Nun haben Sie mich ja gefunden, Dorcas. Wie kann ich Ihnen helfen?« Alexandra saß auf einer Bank im verhältnismäßig geschützten Obstgarten, schloss ihr Buch über dem behandschuhten Finger und blickte auf zu dem Mädchen.
»Mistress Simmons, Miss. Die Mistress verlangt nach Ihnen.«
Alexandra erhob ihre zierliche Gestalt von der Bank und zog den Umhang fester um sich.
»Dann soll sie mich auch bekommen. Wo ist sie?«
»Im Wohnzimmer, Miss.«
Alexandra nickte.
»Danke, Dorcas.« Rasch schritt sie den kleinen Pfad zwischen den Apfelbäumen hinab; ihr Schritt erinnerte an den eines ungestümen Fohlens, das es kaum erwarten konnte, auf die Weide zu gelangen. Am Fuße eines grünen Rasenstücks, das zu einem hübschen Haus aus grauen Steinen führte, brach sie durch die gepflegten Reihen gestutzter Obstbäume. Die Sonne verstärkte den Farbton der roten Dachziegel des Hauses; einen Moment lang blieb sie stehen und genoss den Anblick. In den letzten fünf Jahren war hier ihr Zuhause gewesen. Natürlich sehnte sie sich manchmal noch nach dem Heim ihrer Kindheit, nach Combe Abbey, das oben auf den Klippen von Dorset stand und einen Blick über Lulworth Cove bot. Aber das St. Catherine's Seminary for Young Ladys hatte ihr so viel Anlass zur Dankbarkeit gegeben.
Sie spazierte in Richtung Haus zu einem Seiteneingang. Der enge Flur war erfüllt von vertrauten Gerüchen nach Bienenwachs und Lavendel, und sie konnte das Geplapper mädchenhafter Stimmen hören, das aus einem der Schulzimmer drang, als sie an einer geschlossenen Tür vorbeikam. Sie lächelte leicht – vor gar nicht langer Zeit hätte ihre Stimme sich unter die der anderen gemischt. Alexandra durchquerte die Halle und klopfte an die Tür.
»Herein.«
Alexandra trat ein und lächelte zur Begrüßung.
»Dorcas hat gesagt, dass Sie mich zu sehen wünschen, Helene.«
»Ja, meine Liebe.« Die Frau mittleren Alters hinter dem Schreibtisch setzte ihren Nasenkneifer ab und rieb sich erschöpft die Augen. »Nimm Platz.«
Alexandra gehorchte. In den vergangenen fünf Jahren hatte sie viele Stunden in diesem Zimmer verbracht, das teils Wohnzimmer, teils Schulzimmer war, und begierig jeden Brocken Wissen eingesogen, den Helene an sie weitergab. In diesem Moment jedoch verspürte sie ein zartes Zittern in sich, wie bei einem Alarm. Denn ihrer Freundin und Mentorin schien es die Sprache verschlagen zu haben ...
Einen Moment lang betrachtete Helene Simmons die junge Frau mit schweigendem Mitgefühl. Seit mehr als zehn Jahren schon gehörte ihr das St. Catherine's Seminary for Young Ladys, und sie war es gewohnt – wenn auch oft vergeblich –, junge und frivole weibliche Geister so zu erziehen, dass sie geistigen Anregungen gewachsen waren. Die jungen Mädchen, die zu ihr in Pflegschaft kamen, stammten üblicherweise aus dem Landadel und hatten die Aussicht auf gute Eheschließungen vor sich, auf die Amüsements der Saison, die langen, herzzerbrechenden Jahre des Kindergebärens. An den raffinierteren Geistesgenüssen zeigten diese Mädchen kaum Interesse, wenngleich sie auch begierig am Tanz- und Musikunterricht sowie an Lektionen zu Haltung und Benehmen teilnahmen. Alexandra Douglas war vollkommen anders gewesen.
Von jenem ersten Augenblick an, den das damals fünfzehnjährige Mädchen auf St. Catherine's verlebt hatte, war Helene bewusst gewesen, dass sie endlich einen Zögling mit Potenzial bekommen hatte. Alexandras Neugier kannte keine Grenzen; es gab nichts, wovon sie nicht fasziniert war, ob es sich nun um eine mathematische Gleichung handelte oder um eine raffiniertere Maßnahme in der Landwirtschaft, um die Feinheiten der Bienenhaltung oder die Poesie des Catullus. Für Helene war es eine pure Freude gewesen, den undisziplinierten Geist des Mädchens in die richtigen Bahnen zu lenken und es zu der höchst vollendeten jungen Frau heranreifen zu sehen, die ihr an diesem frostigen Dezembernachmittag nun am Schreibtisch gegenübersaß.
Und jetzt musste sie Alexandra eine Nachricht überbringen, die wer weiß was für Auswirkungen auf deren Zukunft haben konnte.
Je länger das Schweigen sich ausdehnte, desto unbehaglicher war Alexandra zumute. Bis Helene verkündete:
»Ich habe schlechte Neuigkeiten für dich, meine Liebe.« Sie ergriff das Pergament auf ihrem Schreibtisch. »Dies stammt vom Anwalt deines Vaters in Chancery Lane. Alexandra, es tut mir sehr leid, dir dies mitteilen zu müssen, aber dein Vater ist sehr plötzlich verstorben.«
Alex blinzelte, schluckte den Kloß in ihrem Hals hinunter.
»Papa ist tot?«
Helene nickte und schob ihr den Brief zu.
»Lies selbst, meine Liebe.«
Alexandra starrte auf die schwarze Anwaltsschrift und auf das Siegel eines Gasthauses in Chancery unten auf dem Blatt. Es war nicht mehr als die schlichte Feststellung des Todes von Sir Arthur Douglas am fünfzehnten Tag des Monats November im Jahr des Herrn 1762. Im folgenden Abschnitt hieß es nur, dass es Angelegenheiten, die Ländereien betreffend, mit Sir Arthurs Töchtern zu besprechen gebe und dass Anwalt Forsett sich freuen würde, die Reise nach Hampshire anzutreten, um besagte Angelegenheiten mit den Mistresses Alexandra und Sylvia Douglas besprechen zu dürfen, es sei denn, sie würden es vorziehen, ihn in seinen Räumlichkeiten in Chancery Lane aufzusuchen.
»Es tut mir so leid, meine Liebe«, wiederholte Helene angesichts der Blässe ihres Zöglings und des Tränenschleiers in dessen Augen.
Alexandra schüttelte den Kopf als wollte sie die Tränen verscheuchen. Seit fünf Jahren hatte sie ihren Vater nicht mehr gesehen. Jedes Jahr zu Weihnachten hatte es ein Geschenk gegeben, aber niemals einen Brief oder irgendetwas Persönliches. Anfangs hatte sie sich gefragt, womit sie und Sylvia die Feindseligkeit ihres Vaters heraufbeschworen hatten. Aber im Laufe der Zeit lernte sie, sich nicht weiter darum zu kümmern. Die letzte romantische Eskapade ihrer Mutter war für ihren Vater sicherlich entscheidend gewesen, um sich von ihren gemeinsamen Sprösslingen zu trennen; und als die Nachricht der Scheidung und seiner neuerlichen Eheschließung in Form einer knappen Notiz desselben Anwalts bei ihnen eintraf hatten seine Töchter die Situation längst akzeptiert. Für Alexandras Pflege und den Unterricht in St. Catherine's wurde regelmäßig gezahlt. Auch für Sylvias Versorgung bei ihrer früheren Kinderfrau war ohne Unterbrechungen finanziell gesorgt. Alexandra hatte vage angenommen, dass ihr Vater irgendwelche Vorkehrungen für die Zukunft getroffen hatte, und aufgehört, dessen Schweigen zu hinterfragen.
Bis zu jenem kalten Januarmorgen in der Kanzlei des Anwalts Forsett.
Alexandra riss sich zurück in die Gegenwart, in die mondhelle Nacht, in die ruhige Kammer in ihrem Rücken und die wunderbar vertrauten Geräusche des Heimes ihrer Familie. So vertraut und inzwischen doch so unbekannt ... Wieder spürte sie, wie die alte und kalte Wut in ihr aufkeimte. Wie mühsam hatte sie über die Jahre lernen müssen, ihr überschießendes Temperament zu zügeln! Sie war der geborene Hitzkopf, und es hatte zahllose unangenehme Lektionen gebraucht, das Bedürfnis in ihr zu wecken, ihr Temperament zu zügeln und es auch zügeln zu können. Über Ungerechtigkeit hatte sie sich schon immer aufgeregt; die Ungerechtigkeit, von der sie und ihre Schwester zurzeit ständig tyrannisiert wurden, drohte die hart erarbeitete Selbstbeherrschung in Grund und Boden zu stampfen.
Ein paar Sekunden lang kämpfte sie ihren stummen Kampf, so lange, bis sie spürte, wie ihre Wut sich unter die gleichermaßen kalte, aber doppelt so nützliche Entschlossenheit flüchtete. Ihr abscheulicher Cousin Stephen sollte, obgleich er es niemals erfahren würde, für seinen Geiz bezahlen, und zwar so lange, bis sie die zehntausend Pfund beisammen hatte, die ihr Vater seinen Töchtern hatte hinterlassen wollen.
Nicht dass das Geld mir oder Sylvia den Vorzug der legitimen Geburt zurückerstatten wird, dachte sie in einem neuerlichen Zornesausbruch, der sich diesmal direkt gegen ihren Vater richtete. Wie hat er seinen Töchtern das nur antun können? Alex erinnerte sich an ihn als an einen liebevollen Vater, der zwar manchmal ein wenig zerstreut wirkte; und sie erinnerte sich auch an die zahlreichen Stunden, die er und sie gemeinsam in der Bibliothek verbracht hatten ... in der Bibliothek unten in Combe Abbey, wo sie die besseren Tage ihres jungen Lebens gesehen hatte.
Ihr Vater hatte ihr all seine literarischen Kostbarkeiten präsentiert, all diejenigen, die sein Vater und er selbst angeschafft hatten. Ebenso bibliophil wie sein Vorfahr, hatte Sir Arthur dieselbe Leidenschaft in seiner Tochter erkannt. Und kaum hatte sie das Lesen gelernt, hatte er sie ermutigt, frei unter seinen Büchern auszuwählen. Sie konnte sich nicht daran erinnern, dass er angesichts der dicken Wälzer, mit denen sie die langen Winternachmittage eingerollt in der Sofaecke verbracht hatte, jemals die Brauen hochgezogen hätte. Und stets hatte er ihre Fragen zu einzelnen Büchern beantwortet – selbst dann, wie sie jetzt begriff, wenn weder der Inhalt noch ihre Neugierde dem Geist eines jungen Mädchens angemessen waren.
Dieses Wissen steht mir jetzt gut zu Gesicht, dachte sie grimmig. Wer hätte besser geeignet sein können als sie, die Wälzer in der Bibliothek für den neuen Besitzer zu katalogisieren? Sir Stephen interessierte sich lediglich für den Wert der Sammlung; aber Alexandra hatte die feste Absicht, sein Interesse zu Sylvias und ihrem eigenen Vorteil zu wenden.
Plötzlich gähnte sie und erhob sich seufzend, ließ sich die Nachtjacke von den Schultern gleiten und kletterte in das hohe Bett. Sie blies die Kerze aus, lehnte sich zurück und beobachtete das Spiel des Mondes auf der gegenüberliegenden Wand – wobei sie dem schwachen Geräusch der Wellen lauschte, die sich am Strand in der Bucht brachen. Ein Geräusch, das sie als Kind immer in den Schlaf gelullt hatte.
Aber heute Nacht war an Schlaf nicht zu denken. Sie fragte sich, ob Sylvia in ihrem bescheidenen Häuschen in Barton in der benachbarten Grafschaft Hampshire schlafen konnte. Noch nie war sie von ihrer Schwester so weit entfernt gewesen. Als Alexandra nach St. Catherine's geschickt wurde, das kurz vor Barton lag, war Sylvia bei ihrer früheren Kinderfrau geblieben, die sich auch dann noch um das körperlich beeinträchtigte Kind gekümmert hatte, als Sylvia schon lange nicht mehr in den Kinderzimmern auf Combe Abbey wohnte. Irgendwer – ihr Vater, wie sie angenommen hatten – hatte seiner zweiten Tochter und deren Pflegerin ein kleines Häuschen in Barton zur Verfügung gestellt, nur eine Viertelmeile von St. Catherine's entfernt; weder Sylvia noch Alexandra hatten seither Kontakt zu ihrem Vater gehabt.
Matty kümmerte sich hingebungsvoll um Sylvia, die seit ihrer Geburt unter einer zarten Gesundheit litt. Das Gehalt, das sie von Sir Arthur Douglas für die Pflege des Mädchens bezog, war eine willkommene Ergänzung zu ihrem kleinen Einkommen. Ohne dieses Gehalt wäre sie nicht in der Lage, Sylvia zu behalten oder die benötigte Medizin und die Säfte zu kaufen.
Alexandra wälzte sich auf die andere Seite. Die Sorge um Sylvia begleitete sie unablässig. Natürlich war ihr klar, dass Matty ihre Schwester niemals im Stich lassen würde, und die fünfzig Pfund, von denen Sir Stephen sich zu trennen bereit gewesen war, würden ihren Lebensunterhalt beinahe ein Jahr lang sichern. Aber falls es Alexandra bis dahin nicht gelungen war, in diesem Durcheinander ihres Lebens wieder Gerechtigkeit walten zu lassen, würde sie an Sylvias Zukunft gar nicht mehr zu denken wagen.
Alexandra hatte über den Vorschlag des Anwalts nachgedacht, sich eine Anstellung als Gouvernante oder Lehrerin zu suchen. Helene hatte sie nach London begleitet, war aber während Alexandras Treffen mit Anwalt Forsett im Hotel geblieben. Als sie nach Alex' Rückkehr die ganze Geschichte erfuhr, hatte sie ihrem Schützling sofort eine Stellung in St. Catherine's angeboten. Hatte betont, wie ideal die Lösung doch wäre. Alex könnte in dem Haus bleiben, an das sie sich gewöhnt hatte, in der Begleitung ihrer besten Freundin und weniger als eine Meile von ihrer Schwester entfernt.
Aber so schnell gab eine Alexandra Douglas nicht auf. Sie hatte zwar kurz darüber nachgedacht, den Vorschlag gleich im nächsten Atemzug aber wieder verworfen. Es war nicht richtig, nicht gerecht. Durch einen Gesetzestrick waren Sylvia und sie dessen beraubt worden, was ihnen eigentlich zustand. Diesen Teil würde sie sich zurückholen. Sir Stephen hätte es sich leisten können, Sir Arthurs Absichten die Ehre zu geben. Nichts als der pure Geiz hatte ihn daran gehindert. Nun, dann würde sein Geiz sich eben gegen ihn wenden, nur dass er es niemals erfahren würde.
Alexandra lächelte zaghaft und spürte, wie der Schlaf sich über ihre vertraute Entschlossenheit senkte.
Peregrine schlief den tiefen, ungestörten Schlaf eines Mannes, der die zurückliegenden Tage im Sattel eines Pferdes verbracht hatte. Im Morgengrauen weckte John ihn auf, brachte frisches Rasierwasser und Kaffee.
»Master Crofton möchte Sie in einer halben Stunde im Frühstückszimmer sehen, Sir«, verkündete der Diener, stellte seine Last ab und zog die Vorhänge zurück.
Perry rappelte sich hoch und blinzelte in den grauen Morgen.
»In dieser Herrgottsfrühe? Die Sonne ist doch noch nicht mal aufgegangen«, murmelte er, »oh ... ja, stimmt, wir gehen angeln.« Zögerlich schwang er die Beine aus dem Bett und erhob sich, reckte sich und warf einen sehnsüchtigen Blick zurück auf die Kissen. »Also bitte die Reithose, John. Und den Anzug aus grünem Kammgarn.« Er tunkte ein Tuch in heißes Wasser, hielt es sich ans Gesicht und spürte, wie das Blut wieder zu zirkulieren begann.
Rasch zog er sich an und stieg in seine strapazierfähigen Lederstiefel, die es mit der Feuchtigkeit und dem Matsch eines Flussufers durchaus aufnehmen konnten. Anschließend ging er die Treppe hinunter ins Frühstückszimmer, wo Marcus bereits ein Stück Roastbeef attackierte. Mit vollem Mund winkte er Perry einen Gruß zu und deutete auf die Anrichte, wo aus zugedeckten Tellern sanft Dampf aufstieg.
Perry bediente sich bei den Bohnen und am Schinken, schenkte sich einen Becher Ale ein und setzte sich.
»Ich hoffe, du kannst mir mit einer Angelrute aushelfen, Marcus. Ich habe meine Ausrüstung nicht dabei.«
Sein Gastgeber schluckte hinunter.
»Oh, kein Problem, mein Lieber. Angelruten habe ich mehr als genug. Der Lachs sollte heute Morgen beißen.«
»Wo treffen wir Sir Stephen?« Perry strich sich Butter auf eine dicke Scheibe Weizenbrot.
»Oben an der Abbey. Es wird eine ziemlich große Gesellschaft sein. Sir Stephen ist stolz auf seine Jagdausflüge. Man könnte glatt glauben, dass er sein ganzes Leben auf dem Lande verbracht hat.«
»Ach, hat er das nicht?« Perry war neugierig.
Marcus schüttelte den Kopf.
»Ganz und gar nicht. Und glaub mir, wenn es drauf ankommt, merkt man es auch.«
»Oh?« Fragend zog Perry die Brauen hoch.
Marcus trank einen Schluck Ale.
»Eigentlich sollte ich meinen Mund halten, aber der Mann hat nicht die geringste Ahnung, wie man Ländereien verwaltet und ein Haus führt. Sir Arthur hingegen war mit jedem Grashalm auf seinem Land vertraut. Er hat entschieden, welches Getreide wo und wann gesät wird, hat sich um seine Pächter gekümmert und um die Arbeiter ... selbst um die Dächer, die repariert werden mussten. Wer sich nicht um seine Leute kümmert, den treibt es bald in den Ruin, hat er immer zu mir gesagt.«
»Und Sir Stephen hält davon nichts?«
Marcus zuckte mit den Schultern.
»Ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er auch nur einen einzigen Gedanken daran verschwendet. Vielmehr scheint er zu glauben, dass die Ländereien schon aus eigener Kraft laufen und dass er nicht mehr zu tun hat, als sich das zu nehmen, was er von ihnen braucht. Wenn wir den Verwalter nicht hätten ... wirklich ein guter Mann ... wer weiß, wie es dann um uns stehen würde.«
»Woher ist Sir Stephen denn gekommen?«, fragte Perry.
»Aus Bristol, glaube ich. Auf jeden Fall ist er ein Stadtmensch, so viel ist sicher. Ich vermute, dass sein Zweig der Familie irgendwas mit Schiffen zu tun hat. Er gehörte aber zum verarmten Teil der Familie. Trotzdem kennt sein gesellschaftlicher Ehrgeiz keine Grenzen. Das gilt noch mehr für Lady Maude, aber sie genießen es beide, sich gegenüber dem Landadel aus der Gegend als die große Herrschaft aufzuspielen.«
Marcus berichtete mit dem umsichtigen Spott eines Mannes, der es seinerseits nicht nötig hatte, sich aufzuspielen. Perry wusste, dass der verstorbene Vater seines Freundes – der erste Ehemann der verwitweten Lady Douglas – ein Baron mit beeindruckendem Stammbaum und Ländereien gewesen war. Als jüngerer Sohn hatte Marcus beachtliche Sachkenntnis erworben.
»Vermutlich gibt es Kinder?«
»Oh, quengelnde Gören ... ich weiß gar nicht, wie viele. Aber Lady Maude schickt ständig nach dem Arzt oder verlangt, dass Sir Stephen die Kinderfrau bestraft, weil sie angeblich eines der Kinder vernachlässigt.« Marcus lachte. »Ich sage es nur ungern, aber ich möchte nicht in Stephens Haut stecken. Nicht für alles Geld der Welt.«
Peregrine ließ die Neuigkeiten kurz sinken, während er ein Stück Schinken abschnitt.