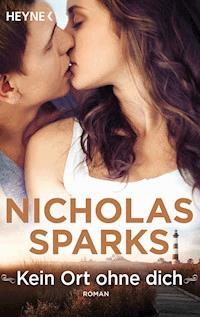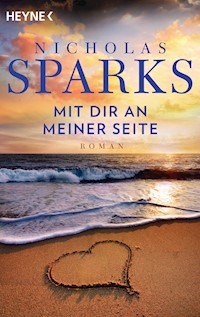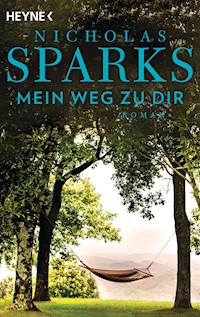18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kann die Liebe alle Grenzen sprengen?
Nach dem tragischen Tod seiner geliebten Schwester versucht der Architekt Tate Donovan wieder ins Leben zurückzufinden. Da beauftragt ihn sein bester Freund, ein Sommerhaus auf dem idyllischen Cape Cod zu entwerfen. Unterkunft findet Tate in einem charmanten Bed & Breakfast. Tate ist fasziniert von der schönen, mysteriösen Besitzerin Wren und zwischen den beiden entwickeln sich tiefe Gefühle. Doch ein gefährliches Geheimnis aus der Vergangenheit lastet auf Wren, und hinter der Kleinstadtidylle lauert zerstörerischer Hass. Tate will Wren unbedingt retten – und merkt erschüttert, dass es dafür möglicherweise bereits zu spät ist. Kann die Liebe wirklich alle Grenzen sprengen, auch die zwischen Leben und Tod?
Der international gefeierte Starregisseur M. Night Shyamalan (»The Sixth Sense«) wird den Roman mit hochkarätiger Besetzung verfilmen.
Nicholas Sparks ist ein Weltbestsellerautor und schon seit vielen Jahren ein Garant für berührende und spannende Geschichten. Viele seiner Romane wurden bereits zu Film-Blockbustern, wie z.B. »Kein Ort ohne dich« oder »Wie ein einziger Tag«.
Enthaltene Tropes: Small Town, Slow Burn
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Der Tod seiner geliebten Schwester Sylvia hat den 38-jährigen Architekten Tate in eine schwere Depression gestürzt. Nach einem längeren Klinikaufenthalt versucht er nun, im Leben wieder Tritt zu fassen. Dabei hilft ihm ein Auftrag seines besten Freundes Oscar: Er soll für ihn und seine Familie ein Traumhaus auf Cape Cod entwerfen. Tate steigt in einem stilvollen historischen Bed & Breakfast ab, dessen Eigentümerin Wren ihn schon bei der ersten Begegnung zutiefst berührt: Zu seiner eigenen Überraschung schüttet er, der sich sonst seinen Mitmenschen nie öffnet, der Fremden sein Herz aus. Auch Wren lässt ihn an ihrem Inneren teilhaben, und so entspinnen sich zwischen den beiden schnell große Gefühle. Doch die Nächte in der Unterkunft entpuppen sich für Tate als albtraumhaft, und auch das scheinbar so idyllische Städtchen birgt menschliche Abgründe. Mit zunehmendem Entsetzen merkt Tate, dass ein schreckliches Geheimnis Wren umgibt. Ein Geheimnis, das sich nicht mit dem menschlichen Verstand greifen lässt. Wagt Tate den Sprung ins Ungewisse, um Wren zu retten? Und gibt es dadurch eine Chance für ihre Liebe?
Die Autoren
Nicholas Sparks lebt in North Carolina. Mit seinen Romanen, die ausnahmslos die Bestsellerlisten eroberten und weltweit in über 50 Sprachen erscheinen, gilt er als einer der meistgelesenen Autoren der Welt. Viele seiner Bestseller wurden erfolgreich verfilmt. Alle seine Bücher sind bei Heyne erschienen.
Die Geschichte zu diesem Roman hat er gemeinsam mit M. Night Shyamalan entwickelt, dem international gefeierten Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler. Dessen Filme, darunter »The Sixth Sense«, »Signs« und »Die Legende von Aang«, haben weltweit über 3,3 Milliarden Dollar eingespielt.
NICHOLAS SPARKS
MIT M. NIGHT SHYAMALAN
Remain Was von uns bleibt
ROMAN
Aus dem Amerikanischen von Astrid Finke
Die Originalausgabe REMAIN erschien erstmals 2025 bei Random House / Penguin Random House LLC, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 by Willow Holdings, Inc.
Copyright © 2025 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Abdruck des Gedichts »As subtle as tomorrow« aus The Poems of Emily Dickinson, hg. Thomas H. Johnson, Cambridge, Mass., mit freundlicher Genehmigung von The Belknap Press of Harvard University Press, Copyright © 1951, 1955 by the President and Fellows of Harvard College. Copyright © renewed 1979, 1983 by the President and Fellows of Harvard College. Copyright © 1914, 1918, 1919, 1924, 1929, 1930, 1932, 1935, 1937, 1942, by Martha Dickinson Bianchi. Copyright © 1952, 1957, 1958, 1963, 1965, by Mary L. Hampson. Used by permission. All rights reserved.
Redaktion: Lüra – Klemt & Mues GbR
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München, nach einer Vorlage von Flamur Tonuzi unter Verwendung von Bildmaterial von Arcangel/Miguel Sobreira, iStock/Sanghwan Kim, Gettyimages/Gilbert Rondilla Photography
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-34033-9V001
www.heyne.de
www.nicholas-sparks.de
Für Theresa Park, die mich auf meinem gesamten Weg begleitet hat
Kapitel 1
Cape Cod im Mai weckt Hoffnung in den Herzen steif gefrorener New Yorker, grüne Wiesen und Meeresbrise verheißen die baldige Ankunft des Sommers. Als ich das Autofenster öffnete und den Duft der Pflanzen einatmete, staunte ich, wie weit weg mir der kalte graue Himmel und die vom Regen überfluteten Rinnsteine der Großstadt erschienen. Hier hatte der Winter sich längst zurückgezogen, und man konnte bereits von langen, sonnendurchtränkten Tagen träumen.
Ich war schon öfter auf Cape Cod gewesen, aber nie in diesem Städtchen. Als stillere, kleine Cousine des nahen Touristenmagneten Provincetown präsentierte sich Heatherington in klassischer 1950er-Atmosphäre. Pleasant Street, die Hauptstraße, war gesäumt von pittoresken Geschäften für Antiquitäten, Freizeitmode, Gourmet-Eis, Haushaltswaren, Holzspielzeug und Steinofenpizza. Eltern schoben teure Kinderwagen, Tagesausflügler standen vor den Schaufenstern, und auf einer Holzbank unter einer großen altmodischen Uhr saßen zwei ältere Herren mit Baseballkappen. Als ich anhielt, um ein paar Musiker mit Gitarren auf dem Rücken die Straße überqueren zu lassen, entdeckte ich eine Nostalgie-Apotheke mit integriertem Soda Shop, an dessen Theke einige Halbwüchsige durch lange Strohhalme Milchshakes schlürften.
Eigentlich war das alles doch zu perfekt, um echt zu sein, dachte ich lächelnd, andererseits leuchtete mir ein, dass mein bester Freund Oscar, ein Kind von Immigranten, die ein Feinkostgeschäft in Boston führten, von so einem amerikanischen Bilderbuch-Örtchen fasziniert war. Als ich weiterfuhr, sah ich rechts und links von mir gepflegte Häuser im Kolonialstil mit weißen Lattenzäunen. Heatherington war wirklich malerisch, und wie aufs Stichwort riss der Himmel auf und leuchtete so blau, dass ich die Augen zusammenkneifen musste.
Es war ein Montag, der ganz normale Beginn einer neuen Arbeitswoche, und ich war in der Stadt, um für Oscar und seine Frau Lorena ein Ferienhaus zu entwerfen und den Bau zu überwachen. An diesem Tag wollten wir zum ersten Mal im Detail über das Projekt sprechen, und ich freute mich schon auf ihre Ideen.
Ihrer Wegbeschreibung folgend, bog ich jetzt von der Pleasant Street ab. Am Stadtrand befand sich ein Festplatz mit diversen Bühnen, an denen emsig gebaut wurde. Staubige Pick-ups parkten auf dem Kies, Arbeiter wuselten herum. Die Vorbereitungen für das Mask and Music Festival am Memorial-Day-Wochenende am Ende des Monats liefen auf Hochtouren. Bei meiner Suche nach einer Unterkunft hatte ich von dieser Veranstaltung gelesen; da ich selbst nichts fand, hatte ich letztlich Oscar um Hilfe gebeten. Angeblich sollten vierzig oder fünfzig Bands in die Stadt einfallen, und es wurden bis zu zwanzigtausend Zuschauer erwartet. Auf meine Frage, was für Musik denn gespielt werde, hatte Oscar nur geschnaubt. »Woher soll ich das denn wissen? Wahrscheinlich komischer Gen-Z-Kram. Die tragen Masken!«
Ein paar Minuten später bog ich von der Straße auf einen Feldweg ab, der relativ steil anstieg. Ich fuhr langsam und orientierte mich an den Reifenspuren; mein Aston Martin hüpfte und schlingerte. Zu beiden Seiten ragten hoch Birken, Ulmen und Ahorne auf, bis ich oben auf einer Lichtung ankam.
Es war ein flaches, grasbewachsenes Plateau, umgeben von majestätischen Eichen und mit freiem Blick auf das saphirblaue Meer. Schmetterlinge flatterten über einem Büschel Löwenzahn, und es duftete intensiv nach Salzwasser, was in mir Erinnerungen an Sommer am Strand weckte. In den Bäumen zwitscherten munter die Vögel, und als ich den Kopf in den Nacken legte, sah ich einen Rundschwanzhabicht kreisen. Ich konnte kaum glauben, dass dieses Grundstück bisher noch nicht bebaut war.
Bald kam ein gigantischer Spielplatz in Sicht, der wirkte, als wäre er vom Himmel gefallen, mit Schaukeln, Klettergerüst, Sandkasten, Hüpfburg, Bällebad, diversen Rutschen und einer Burg mit farbigem Dach. Dort tummelten sich Oscars fünf Kinder, während er und Lorena von einem nagelneuen Picknicktisch aus zusahen. Wie üblich trug Oscar ein Retro-Football-Trikot, dieses Mal eines der Cleveland Browns aus den frühen 1960ern.
Nicht lange nach seinem Examen an der New York University hatte Oscar genug Gelder von Investoren – einschließlich meines Vaters, der zwar nichts auf mein eigenes unternehmerisches Geschick gab, aber großen Respekt für das meines besten Freundes hatte – aufgetrieben, um Lizenzrechte der NFL, NBA, NHL und MLB zu erwerben, zur Herstellung und Vermarktung von Kleidung. Oscars Geniestreich hatte darin bestanden, die Namen und Rückennummern aktueller Spieler auf Retrotrikots zu drucken. Er war extrem sorgfältig, was Design und Qualität betraf, und auch mit Marketing und Werbung in den sozialen Medien kannte er sich hervorragend aus, deshalb kamen die Trikots sofort gut an. So richtig durch die Decke gingen die Verkaufszahlen dann, als ein berühmter Rapper anfing, sie auf der Bühne zu tragen, und angesagte Influencer regelmäßig darüber posteten. Irgendwann meldeten sich die Konzerne, und Oscar verkaufte seine Firma für fast eine Milliarde Dollar. Es war die ultimative Erfolgsgeschichte. Seine Eltern, die ich fast als meine Pflegeeltern betrachtete, platzten beinahe vor Stolz, trugen außer Haus nur noch seine Trikots und prahlten vor ihren vielen Verwandten in den USA und in Indien mit ihrem Sohn. Oscar ließ seinen Eltern ihre Freude, aber das Geld hatte ihn und Lorena nicht grundlegend verändert.
Ich parkte neben ihren beiden Cadillac Escalades, im Vergleich zu denen mein Wagen wie ein Matchboxauto aussah. Oscar kam mit ausgebreiteten Armen auf mich zu. Wie alle anderen in seiner Familie war er ein überaus herzlicher Typ, und ich war ziemlich sicher, dass er jeden umarmte, inklusive Supermarktkassierern, seines Pool-Reinigers und sogar Betriebsprüferinnen. Ich hatte jeglichen spießigen Widerstand längst aufgegeben und erwiderte die Geste. Bevor wir uns voneinander lösten, klopfte er mir auf den Rücken.
»Da bist du ja endlich«, sagte er breit grinsend. »Wie findest du es hier?«
»Es ist unglaublich. Noch schöner als auf den Fotos, die du geschickt hast.«
Oscar sah sich mit dankbarer Miene um. »Ich kann selbst noch nicht fassen, dass ich das Grundstück ergattert habe. Ich musste gegen einen dieser arroganten Hedgefonds-Schnösel bieten, und du weißt ja, wie ungern die verlieren.« Er deutete mit dem Kopf zum Tisch. »Na los, Lorena hat schon andauernd gefragt, wann du wohl kommst.«
Im Gehen deutete ich auf den Spielplatz. »Wo ist das denn alles her?«
»Das habe ich letzte Woche aufstellen lassen. Ich dachte mir, dann haben die Kids immer was zu tun, wenn wir auf der Baustelle nach dem Rechten sehen.«
»Wie alt sind sie eigentlich inzwischen?«
»Leo ist sieben, Lalita und Lakshmi sechs, Logesh ist fünf und Luca gerade vier geworden. Ja, ich weiß, viele Ls, das kann verwirren. Das Gute ist, dass ich sagen kann ›Raus hier, ihr Ls!‹ oder ›Ruhe jetzt, alle Ls!‹«
»Lorena ist bestimmt begeistert.«
»Geht so.« Er kicherte. »Aber dass alle Namen mit L anfangen sollen, war ihre Idee, und die Kinder finden es lustig.«
Mittlerweile war Lorena aufgestanden. Sie strich sich den dunklen Pony aus der Stirn und kam auf uns zu. Sie war ein italienisch-amerikanisches Energiebündel und besaß eine Kraft und Ausdauer, bei der selbst Oscar nicht mithalten konnte. Wie er war sie sehr herzlich, aber ihre Umarmung fühlte sich an, wie in eine Daunendecke gehüllt zu werden. Hinterher hielt sie weiter meine Hände.
»Wie geht es dir?« Ihre ausdrucksvollen Augen musterten mich forschend. »Ich hab mir solche Sorgen um dich gemacht.«
»Besser«, gab ich zurück und lächelte – wie ich hoffte, überzeugend.
»Hast du mein Paket gekriegt?«
Ungefähr auf der Hälfte meines gerade beendeten Klinikaufenthalts war ein riesiger Korb voller Knabbereien, Schokolade und Bonbons eingetroffen, begleitet von einem ziemlich großen Stoffpinguin. Aus unerfindlichen Gründen (vielleicht, weil ich einmal von der Doku Die Reise der Pinguine geschwärmt hatte) glaubte Lorena, ich hätte eine Schwäche für Kaiserpinguine, und ich wollte sie nicht korrigieren.
»Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es ist okay, dass ich die Sachen mit meinen Mitbewohnern geteilt habe.«
»Na klar.« Endlich ließ sie meine Hände los. »Du siehst gut aus. Ausgeruhter als beim letzten Mal.«
»So fühle ich mich auch. Was machen die Kinder?«
»Wild wie eh und je«, seufzte sie. »Ich hätte mich nicht von Oscar zu einem fünften überreden lassen sollen. Seit Lucas Geburt ist es endgültig vorbei mit Zucht und Ordnung. Er kann sich einfach alles erlauben.«
Sie lachte gutmütig. Als sie Oscar an der NYU kennenlernte, studierte sie Wirtschaft, und sie half ihm beim Aufbau seiner Firma, bis die Zwillinge kamen, zog sich dann aber zurück, um sich um die wachsende Kinderschar zu kümmern. Ihr Haus war, wie Oscars früher, unordentlich und laut, es herrschte ein endloser Trubel. Doch Lorena kam mit dem Chaos wunderbar zurecht. Nie hatte ich sie abgekämpft oder ungeduldig erlebt.
»Lass ihn sofort los, L!«, brüllte Oscar in dem Moment, und ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen, als Lorena die Augen verdrehte. »Kleinen Moment«, sagte Oscar zu uns und marschierte zum Spielplatz. Leo hatte Logesh im Schwitzkasten, gab sich aber ganz unschuldig, für den unwahrscheinlichen Fall, dass Oscar eines der anderen Kinder gemeint hatte.
»Ich weiß nicht, wie ihr beide das schafft«, stellte ich fest. »Sehr beeindruckend.«
»Was, Kinder erziehen?« Sie täuschte Arglosigkeit vor. »Ein Kindermädchen ist eine große Hilfe, aber eigentlich ist es das Gleiche wie bei Paulie. Morgens stellt man Futter und Wasser hin, schüttet frische Streu ins Klo, und dann kümmert man sich den Rest des Tages nicht mehr darum.«
Ich lächelte. »Danke, dass ihr auf sie aufgepasst habt, während ich in der Klinik war. Wo ist sie?«
»Noch in ihrer Box in meinem Wagen«, sagte Lorena. »Das ist der neben deinem. Keine Sorge, das Fenster ist offen, aber ich war nicht sicher, wie sie reagiert, wenn ich sie raushole, sie ist ja eine reine Hauskatze.«
»Genau. Abgesehen vom Tierarzt und jetzt ihrer Zeit bei euch hat sie noch nie meine Wohnung verlassen. Wie hat sie sich denn benommen?«
»Die ersten Tage hat sie sich versteckt, aber dann war sie lieb und fröhlich, außer wenn die Kinder sie durchs Haus gejagt haben. Dann hat sie sich meistens auf die Sofalehne am Fenster zurückgezogen, weil die Kurzen da nicht drankamen. Abends, wenn sie im Bett waren, lag sie bei mir auf dem Schoß.«
»Klingt, als hätte sie dich ins Herz geschlossen.«
»Ich dachte ja immer, ich wäre eher ein Hunde-Mensch, aber ich bin absolut bekehrt«, sagte sie. »Was ich übrigens noch fragen wollte: Warum hast du sie Paulie getauft?«
»Wie meinst du das?«
»Das klingt wie ein Jungenname.«
»Als Kind mochte ich den Film Rocky sehr.«
»Warum dann nicht Adrian?«
»Weil sie wie eine Paulie aussah.«
Lorena lachte. Mittlerweile hatte Leo seinen Bruder losgelassen, und Oscar kam zurück.
»Er hat behauptet, er wollte Logesh zeigen, was er machen soll, wenn jemand gemein zu ihm ist«, sagte Oscar.
»Und du hast ihm erklärt, dass er, anstatt jemanden in den Schwitzkasten zu nehmen, eine Lehrkraft rufen oder uns Bescheid geben soll, richtig?«
»Genau.« Oscar nickte energisch. »Selbstverständlich.«
Sie sah ihn skeptisch an, dann räusperte sie sich. »Ich weiß, dass du und Oscar euch einiges zu erzählen habt, deshalb fahre ich jetzt mal mit den Kindern in die Stadt und besorge uns was zu essen. Wahrscheinlich sind sie halb verhungert. Was soll ich euch beiden mitbringen?«
»Ein Salat mit gegrilltem Hühnchen wäre toll. Oder was es eben gibt, du brauchst meinetwegen keine Umwege zu machen.«
»Für mich bitte einen doppelten Cheeseburger und Zwiebelringe«, sagte Oscar. »Und einen Schoko-Shake.«
Lorena zog amüsiert eine Augenbraue hoch. »Alles klar, zwei Salate mit gegrilltem Hühnchen, kommt sofort.«
»Aber Schatz, ich hab Hunger!«
»Dann kriegst du auch noch einen Apfel.« Sie drehte sich um und rief den Kindern zu: »Kommt bitte her, wir holen uns was zu essen!«
Die Rasselbande kümmerte sich überhaupt nicht um sie.
»Zeit fürs Fresschen, also ab ins Auto!«, brüllte Oscar.
Widerstrebend kletterten die Kinder von den Spielgeräten und liefen zu Lorenas Wagen. Wir Erwachsenen folgten ihnen, und Oscar öffnete die hintere Klappe und gab mir die Katzenbox. Ich spähte zu Paulie hinein, die mich mit riesigen, verstörten Augen ansah.
Während Oscar und Lorena die kleineren Kinder in ihre Sitze schnallten, trug ich die Box zu meinem Auto. Ich steckte die Finger durch das Gitter und begrüßte Paulie leise, aber sie war immer noch zu verängstigt oder durcheinander von der Fahrt, um sich mir zu nähern. Daher ließ ich sie in Ruhe und holte meinen Laptop, ein Notizbuch und einen Stift vom Vordersitz. Lorena winkte uns noch, als sie zurücksetzte.
Sobald wir gemeinsam an dem Picknicktisch saßen, beugte Oscar sich zu mir vor.
»Okay, jetzt, wo wir endlich unsere Ruhe haben, erzähl mir von deinen letzten zwei Wochen in der Klinik. Ich muss schon sagen, die sah ja eher aus wie eine Ferienanlage oder ein kleiner Campus als eine Therapieeinrichtung.«
»Ach, es lief weiterhin ganz gut. Und ja, es war dort alles ziemlich schick, aber kein reines Wellnessprogramm.«
Obwohl wir schon am Telefon darüber gesprochen hatten, beschrieb ich noch einmal kurz die dortige Behandlung, die vor allem auf DBT setzte, Dialektisch-Behaviorale Therapie oder auch dialektische Verhaltenstherapie. DBT, erklärte ich, konzentriere sich mehr auf Verhalten als auf Gefühle, die ja eher unbeständig oder vorübergehend seien.
»Verstehe. Und war das Essen wirklich so gut wie angepriesen?«
»Oh ja. Bei schönem Wetter haben wir am Wochenende sogar gegrillt.«
»Klingt wie White Lotus mit Therapie.«
»Na ja, es ist nicht übel dort«, bestätigte ich erneut. »Und ich hatte Gelegenheit, Aspekte meines Lebens zu erforschen, die ich lange zu ignorieren versucht hatte.«
»Du meinst, deine Richie-Rich-Kindheit und deine crazy Eltern, die dich verkorkst haben?«
»So was in der Art.«
Oscar verschränkte die Hände auf dem Tisch und musterte mich jetzt wieder ernst. »Du musst versprechen, anzurufen, wenn sich diese Dunkelheit noch mal in dir aufbaut, Tate. Ich hatte Angst um dich.«
Gerührt nickte ich, und wir schwiegen ein Weilchen in Gedenken an diese schlimme Zeit. Oscars Miene wurde allerdings bald wieder verschmitzt.
»Haben die dir übrigens helfen können, die kleine Bombe zu entschlüsseln, die deine Schwester am Ende hat platzen lassen?«
Ich zuckte die Achseln. »Die Theorie der Ärzte war, dass es sich um neurologische Anomalien handelte, weil Sylvias Organe dabei waren zu versagen.«
»Aber du hast ihr geglaubt, oder?«, ließ Oscar nicht locker.
Ich zögerte und wählte meine Worte mit Sorgfalt. »Sie hat mich nie angelogen, also muss sie selbst es geglaubt haben. Lass uns lieber mal darüber reden, wenn wir mehr Zeit haben.« Ich klappte mein Notizbuch auf. »Jetzt müssen wir ein Haus entwerfen.«
Kapitel 2
Ein knappes Jahr zuvor hatte ich meine Schwester Sylvia verloren. Nach ihrem Tod war ich in eine lähmende Depression abgeglitten, bis ich wochenlang nicht mehr aus dem Bett aufstehen, telefonieren oder mich auch nur waschen konnte. Mein einziger Anker während dieser dunklen Phase war Paulie gewesen; obwohl ich alles andere vernachlässigte, hatte ich es irgendwie geschafft, sie am Leben zu erhalten. Als Oscar schließlich an meine Wohnungstür gehämmert und mich dazu überredet hatte, mich in einer Klinik behandeln zu lassen, hatte er sie vorübergehend zu sich genommen, und dafür – und für so vieles andere – war ich ihm unendlich dankbar.
In der Klinik angekommen war ich während eines Januarblizzards, drei Tage lang hatte dichter Schneefall eine weiße Decke über die Landschaft gebreitet. Als ich damals aus dem Fenster meines Zimmers sah, hatte ich mich gefragt, wo sich wohl all die Vögel während eines solchen Unwetters verkrochen, und gedacht, dass Sylvia die Antwort darauf gewusst hätte.
Sie war fünf Jahre älter als ich gewesen und hatte eine außergewöhnlich starke Verbindung zur Natur gehabt, hatte Schönheit und Leben in allen Formen wertgeschätzt, vielleicht weil ihr in der Kindheit so vieles davon versagt geblieben war. Als sie noch klein war, schädigte ein Virus ihr Herz dauerhaft, und selbst namhafte Spezialisten aus dem ganzen Land konnten nicht viel für sie tun. Daher verließ sie in diesen Jahren unsere Wohnung an der Fifth Avenue nur selten und erhielt Privatunterricht. In ihrer Freizeit flüchtete sie sich entweder in Liebes- oder Fantasyromane oder beobachtete vom Fenster ihres Zimmers aus wehmütig die Familien, Liebespaare und Touristen unten im Central Park. Die Sehnsucht, die ich dabei in ihrer Miene sah, hatte mich stets sehr geschmerzt. Dennoch war sie in der Lage, die Welt auf eine Art und Weise zu betrachten, die mir völlig fremd war. Für Sylvia war sie voller Geheimnisse und Wunder, und damals wies sie mich oft auf faszinierende Alltäglichkeiten hin – die Muster, die von den Regentropfen auf der Fensterscheibe hinterlassen wurden zum Beispiel, oder die filigrane Symmetrie eines Spinnennetzes. Sie hatte mir erklärt, wenn ich bereit sei, die Welt um uns herum wirklich wahrzunehmen, nicht nur anzusehen, dann könne auch ich das Transzendentale erleben – was auch immer das bedeuten sollte.
Mein Psychiater Dr. Rollins sagte häufig, dass Sylvia stolz auf mich gewesen wäre, weil ich mir helfen ließ, und damit hatte er sicher recht. Die Klinik war eine teure Einrichtung mit hervorragendem Ruf, gelegen im grünen, ländlichen Connecticut. Während meines viermonatigen Aufenthalts hatte ich drei Sitzungen pro Woche bei Dr. Rollins, zusätzlich zu Gruppentherapie und Workshops. Während die meisten Patienten gegen eine Sucht ankämpften, waren ein paar Vereinzelte – wie ich – aus anderen Gründen dort. Ich hatte mich selbst eingewiesen, in dem Wissen, dass ich jederzeit wieder gehen konnte. Mittlerweile fühlte ich mich nicht mehr so, als lebte ich in einem dunklen Tunnel, war aber unsicher, ob ich wirklich geheilt war.
Ich war ja immer noch ich: Tate Donovan, achtunddreißigjähriger Architekt, der mit dem Tod seiner Schwester das einzige Familienmitglied verloren hatte, das ihm wirklich etwas bedeutete. Nach vielen Monaten physischer und mentaler Abwesenheit hatte ich mich schließlich von meinen Partnern in einem von New Yorks renommiertesten Architekturbüros abfinden lassen und war nun zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben ganz auf mich gestellt, allein und unsicher, welche Art von Zukunft mir noch offenstand.
Hätte man meine Eltern gefragt, hätten sie sich vermutlich nicht überrascht gezeigt über diese Entwicklung. Andererseits hatten sie nie zufrieden mit mir gewirkt. Sicherlich war ich nicht der einzige Mensch, der sich als Kind ungeliebt oder vernachlässigt fühlte, aber ich brauchte die Hilfe von Dr. Rollins, um zu lernen, dass ich mich von diesen Emotionen nicht auf ewig definieren lassen musste. Selbst er allerdings räumte ein, dass meine Kindheit ungewöhnlich gewesen war.
Mein Vater war der CEO eines Konglomerats gewesen, das in einer Reihe von Branchen tätig war. Bergbau. Landwirtschaft. Pharmazeutika. Öl und Gas. Luftfahrt. Obwohl ich immer noch einer der Hauptanteilseigner war, kümmerte ich mich nicht sonderlich um das Geschäft, außer bei dem Blick auf die monatlichen Kontoauszüge, die in meinem Posteingang landeten. Die Firma war von meinem Urgroßvater gegründet, von meinem Großvater ausgebaut und von meinem Vater schließlich zu einem Imperium gemacht worden. Echte Tatmenschen auf dieser Seite der Familie, zumindest hinsichtlich der Schaffung von generationenübergreifendem Wohlstand. Meine Mutter war eine wunderschöne Rumänin gewesen, die mehrere Sprachen fließend beherrscht und einst die Titelbilder von Zeitschriften geziert hatte. Als meine Eltern sich kennenlernten, arbeitete sie als Model, und ich vermutete, dass sie nur deshalb Kinder bekamen, weil von Menschen ihres Standes erwartet wurde, Erben zu produzieren. Das war aber lediglich geraten. Ich wusste es natürlich nicht.
Unsere Familie wohnte in einem Penthouse in der Upper East Side von New York. Mein Vater war selten da, er war viel auf Reisen, normalerweise geschäftlich, aber auch – wie ich später erfuhr – mit seinen diversen Geliebten. Meine Mutter begann unmittelbar nach ihrem Morgensport mit dem Trinken, stocherte in ihrem Salat, statt ihn zu essen, und besuchte abends Wohltätigkeitsveranstaltungen. Meine Schwester und ich wurden von Kindermädchen betreut, und zum Personal gehörten auch Haushälterinnen, Assistenten, ein Koch und selbst eine Frau, die zweimal die Woche kam, um Geschenke einzupacken. Ich wurde von Chauffeuren zur Privatschule gefahren, flog in Privatjets und wurde sogar anfangs, wie Sylvia, zu Hause unterrichtet, wodurch ich zunächst keinen Kontakt zu Gleichaltrigen hatte. Unsere Sommer verbrachten wir in den Hamptons in einer Villa am Meer, wo meine Eltern jeden zweiten Abend Cocktailpartys gaben, an denen meine Schwester und ich nicht teilnehmen durften. Wir sahen uns dann in unseren Zimmern Filme an oder saßen am Strand, während sich die betrunkenen Gäste am Pool vergnügten. An den seltenen Abenden, an denen wir vier zusammen zu Hause waren, hatte ich den Eindruck, dass sich meine Eltern, wenn sie Sylvia und mich ansahen, insgeheim verdutzt fragten, wer wir waren oder woher wir wohl gekommen waren.
Immerhin musste man meinen Eltern zugutehalten, dass sie Wert auf eine gute Ausbildung gelegt hatten. Nachdem eine Operation ihren Gesundheitszustand verbessert hatte, durfte Sylvia schließlich die Brearley High School besuchen, eine exklusive reine Mädchenschule ganz nah bei unserer Wohnung. Ein paar Jahre später, mit zwölf, wurde ich nach Exeter verfrachtet.
Meine Jahre im Internat veränderten mich stark. Zwar vermisste ich meine Schwester, aber das Leben im Wohnheim und die Entfernung zu meinen Eltern zwangen mich aus meinem Schneckenhaus. Im Laufe der Zeit lernte ich die Kunst des Small Talks und des ungezwungenen Gesprächs, auch wenn ich weiterhin nicht viel von mir preisgab. Dank meines wachsenden Selbstbewusstseins schaffte ich es ins Fußball- und ins Lacrosse-Team und war von Natur aus sportlich genug, die anderen Spiele zu erlernen, an denen ich als kleineres Kind nicht teilgenommen hatte. Ich glänzte in Mathe und entdeckte mein Talent fürs Zeichnen. Ich hatte sogar ein bisschen Glück bei Mädchen und war den Großteil meines letzten Schuljahrs mit Carly zusammen, die aus Newport, Rhode Island, kam. Und vor allem freundete ich mich mit einem Stipendiaten namens Oscar an und verbrachte hin und wieder das Wochenende bei seiner großen und lebhaften indischstämmigen Familie in Dorchester. Sie witzelten ständig und fielen einander laut lachend ins Wort. Wenn ich mit allen neun am Esstisch saß und jeder nach den Platten mit aromatischen Gerichten griff und dabei lustige Geschichten erzählte, hatte ich unwillkürlich das Gefühl, auf einem anderen Planeten gelandet zu sein. Oscar war derjenige, der mir beibrachte, was Freundschaft bedeutete, und bei ihm musste ich mich, wie bei meiner Schwester, nicht verstellen, sondern konnte einfach ich selbst sein.
Da ich während der Zeit im Internat und auf dem College in Yale nur in den Ferien nach Hause fuhr, blieben meine Eltern mir weiterhin fremd. Auf meiner Schulabschlussfeier dann nahm mein Vater mich beiseite und teilte mir mit, er wünsche, dass ich in seine Fußstapfen trete und in das Familienunternehmen einsteige. Vollkommen perplex schwieg ich, täuschte schließlich vor, einen Freund entdeckt zu haben, und lief davon.
Zum ersten Mal in meinem Leben widersetzte ich mich damals den Erwartungen meiner Eltern und folgte meinen eigenen Neigungen, indem ich stattdessen auf dem College Architektur als Hauptfach wählte. Im Anschluss an mein Examen zog ich in eine eigene Wohnung in der Stadt und trat eine Stelle als einfacher Zeichner in einem Architekturbüro in der Upper East Side an. Nachdem ich ein paar Jahre später noch ein Masterstudium draufgelegt hatte, wurde ich zum Partner in ebenjener Firma und entwarf für wohlhabende Kunden ihre Traumhäuser.
Sylvia studierte an der New School in New York und machte ihren Abschluss in Umweltwissenschaften. Als sie dann für eine Non-Profit-Organisation im East Village arbeitete, lernte sie über Freunde einen Mann namens Mike kennen und verliebte sich in ihn. Mein Vater bestand auf einem Ehevertrag – Mike unterrichtete an einer Privatschule Musik und war so arm wie wir reich –, obwohl unübersehbar war, dass die beiden einander vergötterten.
Nachdem der Jet unserer Eltern, als ich neunundzwanzig war, in den Atlantik gestürzt war, tröstete Mike bei der Beerdigung meine Schwester und unterstützte sie geduldig und verständnisvoll in ihrer Trauer. Er war ein wirklich feiner Mensch.
Sylvia nahm der Tod unserer Eltern damals mehr mit als mich, wobei sie sich auch nie von ihnen abgelehnt oder ungeliebt gefühlt hatte. Meine Sitzungen mit Dr. Rollins halfen mir, mich damit abzufinden, dass die beiden meine Schwester wegen ihrer gesundheitlichen Probleme möglicherweise anders behandelt hatten, dass die Vernachlässigung, die ich empfunden hatte, zumindest teilweise ihrer Besorgnis um Sylvia geschuldet gewesen war. Trotzdem glaube ich tief drinnen, dass Sylvias angeborene Gutherzigkeit einfach die Wahrnehmung meiner Eltern leicht verzerrt hatte. Sie war netter als ich, versöhnlicher und eher geneigt, in anderen nur das Beste zu sehen. Im Gegensatz zu mir hatte sie an Gott und die Geheimnisse des Unbekannten geglaubt, und auch an ein Leben nach dem Tod.
Wie tief diese Überzeugungen bei ihr reichten, sollte ich erst viel später begreifen.
Kapitel 3
Ich schlug die erste Seite meines Notizbuchs auf.
»Also, du und Lorena habt in groben Zügen besprochen, was ihr euch vorstellt, oder?«
»Mehr oder weniger. Wir haben generell immer von einem Ferienhaus geträumt, und die Kinder lieben den Strand.«
Ich legte den Kopf schief. »Habt ihr einen bestimmten Stil im Sinn? Zum Beispiel ein traditionelles Cape-Cod-Haus? Oder was Moderneres?«
»Wir wollten abwarten, was du uns empfiehlst.«
Ich nickte wissend. Viele meiner früheren Kundinnen und Kunden, alles sehr erfolgreiche Menschen, hatten in der Konzeptionsphase Schwierigkeiten gehabt. Normalerweise war das Problem der Wunsch, etwas erkennbar Besseres und anderes und Aufsehenerregenderes als die gleichermaßen reichen Nachbarn zu bauen. Oscar und Lorena hingegen dachten nicht in solchen Begriffen, sie waren weniger interessiert an einem Statussymbol als einfach an einem gemütlichen Heim.
»Sollen wir warten, bis sie zurück ist?«
»Nein, nicht nötig.«
»Also gut«, sagte ich. »Aber bevor wir ins Detail gehen, möchte ich mich noch bei dir bedanken.«
»Wofür denn?«
»Dass du mir die Gelegenheit gibst, dein Haus zu entwerfen und den Bau zu beaufsichtigen.«
»Tate …«
Ich hob eine Hand. »Mir ist bewusst, dass du mir den Auftrag gegeben hast, weil du denkst, ich brauche was Konkretes, um wieder auf die Füße zu kommen. Und es geht mir jetzt besser, vor allem auch dank dir. Ich freue mich darauf, selbstständig zu arbeiten.« Jetzt sah ich ihm tief in die Augen. »Deshalb will ich nur noch sagen, dass ich fest entschlossen bin, euch das schönste Haus zu bauen, das man sich vorstellen kann.«
Oscar lächelte. »Und das wird dir auch gelingen.«
*
Nachdem wir ein paar Grundlagen geklärt hatten – unter anderem wurden zwölf Zimmer gebraucht, damit nicht nur die Kinder, sondern auch Oscars Großfamilie, die Schwiegereltern und Freunde für längere Zeit zu Besuch kommen konnten –, traten wir an den Rand des Plateaus. Die Sonne wärmte bereits die Luft, sodass sich die Meeresbrise fast mild anfühlte. Über uns kreiste weiterhin der Habicht. Die Böschung neigte sich sanft zu dem darunter liegenden Sandstrand.
»Das Grundstück reicht bis ungefähr auf halbe Höhe.« Oscar zeigte darauf. »Ab da bis zum Strand runter ist es öffentliches Eigentum, aber wie du siehst, hat man eigentlich nur per Boot Zugang. Und der Blick ist unschlagbar.«
»Es ist fantastisch.«
»Hat es irgendeine Ähnlichkeit mit deinem in den Hamptons?« Damit meinte er das Grundstück mit dem Haus, das ich von meinen Eltern geerbt hatte.
»Nein, aber es ist genauso schön.«
Als ich die gleichmäßig plätschernden Wellen betrachtete, fiel mir links von mir eine Bewegung auf, ein Flackern am Rande meines Sichtfelds.
Diese »Visionen«, von den Ärzten periphere Oszillopsie genannt, hatten kurz nach dem Tod meiner Schwester begonnen. Neurologen im New York Presbyterian Hospital hatten mich gründlich untersucht, um sicherzugehen, dass keine genetischen Defekte oder nicht mit meiner Depression zusammenhängende Krankheiten vorlagen. Sie hatten jeden erdenklichen Test durchgeführt, ganz gleich wie teuer oder zeitaufwendig, und waren zu dem Schluss gekommen, dass mir körperlich nichts fehlte. Stattdessen vermuteten sie, wie auch Dr. Rollins später, dass es sich um ein Stresssymptom handelte, ausgelöst durch den Verlust meiner Schwester, das im Laufe der Zeit von selbst abklingen würde.
Das war aber nicht der Fall, und als das Flackern auch jetzt andauerte, verspannte sich unwillkürlich mein Nacken. Nein, dachte ich. Nicht schon wieder. Da war nichts, redete ich mir gut zu. Und doch …
Das Wabern wurde stärker, nachdrücklicher. Da ich mich nicht dagegen wehren konnte und wusste, dass es anders nicht abzustellen war, sah ich mich schließlich nach einer möglichen Ursache um. Ein schwankender Ast vielleicht, ein Wanderer, der sich verlaufen hatte, oder einfach ein über den Boden huschendes Eichhörnchen. Doch alles war vollkommen ruhig.
»Geht’s dir gut, Tate?«, unterbrach Oscar meine Gedanken. »Du bist ganz blass geworden.«
»Alles in Ordnung«, sagte ich mit einem erzwungenen Lächeln, aber als ich mich wieder dem Meer zuwandte, setzte das Wabern erneut ein, und mit ihm eine unangenehme Beklommenheit. Ignorieren war zwecklos, also drehte ich mich abermals um. Es war jedoch nichts zu entdecken.
Oscar folgte meinem Blick.
»Siehst du was?« Er musterte mich besorgt. »Dieses Flackern, von dem du erzählt hast?«
»Ach, ich bin wahrscheinlich nur müde von der Fahrt«, sagte ich ausweichend. »Nach einem Nickerchen geht es mir bestimmt besser.«
Kapitel 4
Andere fanden Sylvias ganzheitliche, beinahe mystische Sicht auf die Welt unwiderstehlich, und sie zog Freundinnen und Freunde an wie ich Fussel auf meine Kleidung. Ihr Terminkalender war immer prall gefüllt mit Verabredungen mit so vielen unterschiedlichen Leuten, dass ich gar nicht mehr versuchte, den Überblick zu behalten. Wann immer ich sie besuchte, klingelte und piepte ihr Handy unentwegt, bis sie es endlich abstellte, damit wir nicht gestört wurden. Jahre später, als ihr Gesundheitszustand sich verschlechterte und sie im Krankenhaus auf ein Spenderherz wartete, das nie kommen sollte, umkreisten sogar die Ärzte und Ärztinnen sowie das Pflegepersonal sie wie Planeten die Sonne.
Da es mir schwerer fiel, Freundschaften zu schließen, machte sie sich oft Sorgen um mich. Während meiner Zeit in Exeter rief sie regelmäßig an, schickte E-Mails und sogar handgeschriebene Briefe. In meinem Wohnheim in Yale galten ihre Carepakete voller Leckereien von Eli’s und Russ & Daughters und Dylan’s Candy Bar als legendär. Trotz ihrer Herzprobleme, und anders als meine Eltern, besuchte sie mich mehrmals im Jahr dort. Nach dem Tod unserer Eltern wurde sie nach und nach die Mom, die ich mir immer gewünscht hatte. Sie freute sich über meine beruflichen Erfolge, tadelte mich aber auch sanft wegen meines Privatlebens, denn sie wusste, dass ich die meisten Menschen, abgesehen von ihr und Oscar, auf Abstand hielt, mich hinter meiner Arbeit verschanzte. Oft drängte sie mich, mir Zeit zum Reisen zu nehmen, wie sie und Mike. Die beiden gingen auf Safaris und besichtigten Machu Picchu, sie liebten Südspanien und Mittelamerika, verbrachten manchmal im Sommer mehrere Wochen dort, wenn Mike freihatte. Sie fuhren nach Rom, London, Paris, Amsterdam und Berlin und sahen auf einer Zugreise durch Alaska Eisbären. Bei ihrer Rückkehr von diesen Abenteuern zeigte sie mir Fotos und Videos, um mich zu überreden, mich ihnen künftig einmal anzuschließen.
Trotz meines beruflichen Erfolgs hing meine Kindheit weiterhin wie ein Schatten über mir. Weil Sylvia den Verdacht hatte, dass ich depressiv war, fragte sie mich häufig, wann ich zum letzten Mal Staunen oder Ehrfurcht gespürt hatte, Empfindungen, die sie regelmäßig erlebte, und darauf wusste ich nie so recht, was ich antworten sollte. Größtenteils führte ich mein Leben so, als hakte ich Aufgaben auf einer Liste ab: Ich arbeitete viel, trieb Sport und ernährte mich gesund, fütterte meine Katze, hielt Kontakt zu Oscar, hatte das ein oder andere Date und verbrachte so viel Zeit mit meiner Schwester, wie ich konnte. Sylvia jedoch wollte mehr für mich, sie wollte, dass ich mich für die Welt öffnete, und sie war überzeugt davon, dass mich zu verlieben und mich ganz auf dieses Wunder einzulassen das Gegenmittel zu meiner Einsamkeit wäre.
Nicht, dass es mir in dieser Hinsicht an Möglichkeiten gemangelt hätte. In meinen Zwanzigern und bis Anfang dreißig hatte ich wechselnde Beziehungen, manche länger als andere, keine davon jemals ernst. Ich hatte begriffen, dass echte Beziehungen eine Bereitschaft zur Verwundbarkeit erforderten, mit der ich mich nie ganz wohlgefühlt hatte.
»Du bist zu streng«, stellte Sylvia fest, nachdem ich ihr erklärt hatte, warum wieder einmal eine Freundin sich als nicht dauerhaft kompatibel erwiesen hatte.
»Nein, ich bin nur wählerisch«, sagte ich, halb im Scherz.
Sie lachte, aber in ihrer Miene konnte ich Traurigkeit erkennen.
*
Vielleicht weil Sylvias schwache Gesundheit immer Teil unseres Lebens gewesen war, hatte ich nie ernsthaft geglaubt, dass ich sie verlieren würde. Doch die Krankheit nahm unaufhaltsam ihren Lauf. Nach mehreren zunehmend verzweifelten Behandlungsversuchen war sie schließlich ein letztes Mal ins Krankenhaus eingeliefert worden. Jede Einzelheit unserer letzten Begegnung war mir noch vollkommen klar in Erinnerung, ungetrübt von der verstrichenen Zeit.
»Hallo«, sagte ich.
Seit Stunden schlief Sylvia trotz der Neonbeleuchtung, umgeben von Blumensträußen. Hinter ihr piepten Apparate im Takt mit ihrem Herzschlag. Ihre Haut war grau, die Atmung ging flach. Mit jedem Tag wurde sie schmächtiger, und als ich jetzt an ihrem Bett saß, schäumte ich innerlich vor Wut über die Ungerechtigkeit des Ganzen. Wie konnte ein Leben rückhaltloser Freude und Großzügigkeit an diesen Punkt führen? Obwohl sie erst zweiundvierzig war, stand sie bereits seit mehr als zehn Jahren auf der Warteliste für eine Transplantation. Sie hatte Blutgruppe AB negativ, die seltenste überhaupt, und in all der Zeit hatte es kein passendes Spenderherz gegeben.
»Hallo, Tate«, flüsterte sie und wandte sich an Mike. »Kann ich ein paar Minuten allein mit meinem Bruder sprechen?«
»Natürlich«, sagte Mike. »Ich hole Kaffee und komme dann wieder.«
Als Mike weg war, schob ich meine Hand in ihre.
»Wie geht es dir?«
»Blöde Frage«, sagte sie mit einem schiefen Lächeln. »Frag mich was Richtiges, was du dich bisher nicht getraut hast.«
Ich schloss kurz die Augen. »Wie soll ich ohne dich leben?«
»Du wirst deinen Weg finden. Ich habe dafür gebetet.«
»Meinst du nicht deinen Weg?«, scherzte ich.
»Ist doch dasselbe.« Sie verzog belustigt das Gesicht, und mein Magen verkrampfte sich.
»Ich finde das so schrecklich, Syl.«
»Ich auch.« Selbst jetzt noch klang sie tröstend, als müsste sie mich unterstützen statt umgekehrt.
»Hast du Angst?«, krächzte ich.
»Nein. Ich sorge mich um Mike, und ich sorge mich um dich, aber ich freue mich auf das, was jetzt kommt.«
»Wie kannst du so was sagen?« Auch wenn ich mich immer bemüht hatte, Sylvias Glauben an Übersinnliches zu tolerieren, wurde ich jetzt von einer Ungläubigkeit erfasst, die an Zorn grenzte.
Ihre Stimme war fest. »Weil ich weiß, dass es da draußen mehr gibt.«
Darauf schwieg ich. Sylvia, die mich besser als jeder andere kannte, drückte meine Hand.
»Ich habe eine Überraschung für dich, Tate. Genauer gesagt gleich drei.«
»Nämlich?«
»Botschaften.«
»Was meinst du damit?«
»Du wirst schon sehen«, sagte sie. »Aber erst will ich dir was erzählen.« Sie wartete, bis ich ihr in die Augen sah. »Ich weiß, dass du mir nicht glauben wirst, aber tu bitte trotzdem einfach so. Schaffst du das?«
Auf mein Nicken hin fuhr sie fort: »Mom und Dad waren heute bei mir. Sie saßen auf den Stühlen da, und wir haben uns unterhalten, genau wie wir beide jetzt.«
Was sollte ich darauf erwidern?
Sylvias Versuch, die Stirn zu runzeln, verunglückte leicht. »Ich hatte dich gebeten, so zu tun, als ob, schon vergessen?«
»Na schön. Was haben sie gesagt?«
»Dass sie sich freuen, mich wiederzusehen, und dass wir bald zusammen sind.«
»Aha.«
»Gib dir ein bisschen mehr Mühe.«
»Das ist … schön?«
Sie lachte auf, was sich schnell zu einem Hustenanfall entwickelte. Nach einer Weile kam sie wieder zu Atem, und ich sah ihr an, wie viel allein das ihrem Körper abverlangte. Erst nach weiteren langen Sekunden konnte sie wieder sprechen.
»Du kannst das echt schlecht, also lasse ich einfach die Katze aus dem Sack: Es war nicht das erste Mal, dass sie mich besucht haben. Und ich habe auch andere gesehen. Weißt du noch, wie ich, als wir Kinder waren, stundenlang die Leute im Park beobachtet habe? Tja, es waren nicht nur lebendige Menschen. Manchmal erschienen mir Tote als eine Art Flackern im Augenwinkel, wie Gestalten im Hintergrund, die mich aufforderten, genauer hinzusehen. Andere waren verwaschen, ähnlich wie Schatten.« Ihre eingesunkenen Augen leuchteten. »Hin und wieder aber sahen sie vollkommen echt aus, bis sie sich in Luft auflösten.«
Es dauerte einen Moment, bis ich begriff, was sie da sagte. »Soll das etwa heißen, du siehst Gespenster?«
»Eher Geister. Oder vielleicht sind es einfach Seelen, die noch nicht aus der Welt geschieden sind. Ich bin nicht sicher, wie ich sie nennen soll. Jedenfalls habe ich den Eindruck, als wäre jeder von ihnen an unterschiedliche Regeln gebunden, und die meisten sind Besucher, immer nur ein paar Minuten lang hier, wie Mom und Dad vorhin.«
Stumm vor Verblüffung, starrte ich sie an.
»Manche von ihnen allerdings«, fuhr sie fort, »finden keinen Weg hinaus. Sie sind verstört, einige leiden sogar schreckliche Schmerzen. Ob nun ihr Tod etwas Traumatisches hatte oder es noch ungelöste Probleme gab, jedenfalls bleiben sie hier.« Ihr forschender Blick bekam etwas beinahe Fiebriges. »Und wenn sie zu lange bleiben, verblasst das Gute in ihnen, bis nur noch negative Energie übrig ist. Dann sitzen sie hier fest, auf ewig von Wut und Trauer gequält. Das sind diejenigen, denen ich immer so gern helfen wollte, nur wusste ich nicht, wie.«
Ich schluckte, unfähig, eine Entgegnung zu formulieren. Sylvia wirkte, als wäre sie bei klarem Verstand, aber das konnten doch wohl nur Wahnvorstellungen eines im Sterben liegenden Menschen sein?
»Ich weiß, dass du mir nicht glaubst, aber Mom wusste, dass ich sie sehen konnte. Sie sagte, ihre Mutter hätte dieselbe Gabe gehabt. Ich möchte dich um etwas bitten. Tu einfach, als wäre es völlig normal. Und stell keine Fragen.« Sie sah mich flehentlich an. »Ja?« Als ich nickte, winkte sie mich kraftlos näher zu sich. »Beug dich vor und mach den Mund auf.«
Das ist doch verrückt, sagte ich mir, gehorchte aber. Sie blies mir in den Mund, mit einem Atem so leicht wie eine Feder. Seltsamerweise roch er überhaupt nicht krank, wenn überhaupt, glaubte ich, einen lakritzähnlichen Duft zu erahnen, der sich sofort wieder verflüchtigte.
»Danke«, flüsterte sie und sank schwer auf ihr Kissen zurück.
»Darf ich fragen, was das sollte?«
»Weiß ich nicht. Mom hat vorhin gesagt, ich soll das machen.« Sie ließ meine Hand los und musterte mich zärtlich. »Vergiss nie, dass ich dich lieb habe.«
»Ich dich auch«, wisperte ich.
Obwohl ihre Stimme immer heiserer wurde, waren die Worte klar zu verstehen. »Du wirst dich verlieben, Tate. Und das wird dein Leben für immer verändern.«
In dem Moment kam Mike wieder ins Zimmer, mit zwei Bechern Kaffee. Er bot mir einen an, aber weil ich mich zittrig fühlte, lehnte ich dankend ab. Bald darauf verließ ich den Raum, damit die beiden allein sein konnten.
Ich taumelte durch den Flur und ließ mich auf einen Stuhl nahe dem Aufzug fallen. Als ich die Augen schloss, durchströmte mich eine Flut von Erinnerungen an Sylvia: wie sie mir als Kleinkind die Haare zauste, wie sie gebannt aus ihrem Zimmer nach draußen starrte, wie sie mich stolz anstrahlte, als ich ihr ein Haus in East Hampton zeigte, das ich entworfen hatte. Ich erinnerte mich an die Freude an ihrem Hochzeitstag und ihr ausgelassenes Lachen. Da wurde mir schlagartig bewusst, dass es keine neuen Erinnerungen mehr geben würde, und der Gedanke an diese unerträgliche Zukunft traf mich wie ein Amboss. Wie lange ich dort saß und still in meine Hände schluchzte, hätte ich nicht sagen können.
*
Am Tag bevor ich die Klinik verließ, erzählte ich Dr. Rollins diese Geschichte.
»Von ihrem letzten Besuch bei Sylvia haben Sie mir schon einmal erzählt.« Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, die Hände auf dem Bauch verschränkt.
»Ja, ich weiß. Ich kann einfach nicht aufhören, daran zu denken.«
»Glauben Sie, es hat einen Grund, dass Sie das heute noch mal ansprechen?«
»Ich fand es passend, Sie nicht? Wo ja heute mein letzter Tag ist.«
»Weil es im Grunde der Auslöser war, der zu Ihrem Aufenthalt hier geführt hat?«
»Mag schon sein«, sagte ich achselzuckend. Ich konnte nicht klar benennen, was ich empfand. »Ich weiß nicht, ich hatte wohl erwartet, dass ich alles aufgearbeitet hätte, wenn ich hier abreise. Wobei es mir auf jeden Fall besser geht als bei meiner Ankunft.«
»Sie haben hier viel geschafft, Tate. Aber Trauer zu verarbeiten, und auch viele der Fragen, die Sylvia in ihren letzten Tagen aufgeworfen hat, dauert mehr als ein paar Monate.« Er sah mich mit der Geduld und dem Mitgefühl an, die mir viele meiner Erkenntnisse entlockt hatten. »Ich habe Ihnen ja mehrere Therapeuten empfohlen. Antidepressiva und stationäre Behandlung sind nur ein erster Schritt.«
Ich versprach, am Ball zu bleiben.
»Schlafen Sie gut?«, fragte er.
Und damit waren wir wieder bei unseren normalen Sitzungsthemen. Er erkundigte sich noch nach meinen Plänen für die nächsten Tage, und ich erzählte, dass ich vorhatte, mich endlich einmal wieder um meine Post zu kümmern, mich mit meinen Buchhaltern zu treffen und wegen Oscars Hausprojekt ein paar Bauunternehmer in der Gegend von Cape Cod anzurufen, abgesehen davon mir aber nicht zu viel vornehmen wollte, bis ich in der kommenden Woche nach Massachusetts aufbräche. Er fragte, ob ich bedauere, dass ich das Architekturbüro verlassen würde, in dem ich lange gearbeitet hatte, und ich versicherte ihm noch einmal, dass dem nicht so war. Und so weiter und so fort. Meine Antworten auf diese Fragen hatten sich in den vergangenen sechs Wochen nicht geändert, und ich ging davon aus, dass das ein gutes Zeichen war.
Auf dem Weg aus dem Behandlungsraum schüttelte ich ihm die Hand und versprach, mich bei ihm zu melden, wenn ich mich wieder in meinem Alltag eingelebt hatte, und ihm zu berichten, wie es mir ging und ob ich schon einen der von ihm empfohlenen Therapeuten kontaktiert hatte. Erst als ich schon fast aus der Tür war, hörte ich ihn sich räuspern.
»Übrigens, Tate, haben Sie immer noch diese Visionen?«
Meine Miene blieb unbewegt. »Nein«, gab ich zurück.
Sein Blick war neutral, und ich hätte nicht sagen können, ob er mir glaubte.
*
Als Lorena zurückkam, warteten Oscar und ich schon wieder am Picknicktisch. Die Kinder rannten sofort auf den Spielplatz, und Oscar und ich aßen unseren Salat, bevor wir uns an die Arbeit machten. Zum Glück hatte Lorena schon konkrete Vorstellungen, aber sie stimmte überraschenderweise zwölf Zimmern zu, auch wenn das Haus dadurch deutlich größer wurde als ursprünglich geplant. Ich zeigte den beiden auf meinem Laptop Fotos und Zeichnungen von Ferienhäusern, manche von mir entworfen, die meisten nicht. Nach und nach schälte sich heraus, dass ihnen ein mit Schindeln verkleidetes, klassisches Haus am besten gefiel. Daraufhin beschrieb ich ihnen ausführlich den Ablauf eines Neubaus, die verschiedenen Phasen und deren voraussichtliche Dauer.
Als wir alle Punkte auf meiner Checkliste abgearbeitet hatten, standen wir auf und besprachen noch, wann wir uns in den nächsten zwei Tagen treffen wollten. Ich berichtete, dass ich für den kommenden Freitag bereits Termine mit drei möglichen Bauunternehmern vereinbart hatte. Da Lorena am Donnerstag mit den Kindern zum Strand wollte, beschlossen wir, uns diesen Tag frei zu halten. Oscar würde sich überlegen, was wir beide in der Zeit unternehmen konnten.
»Du findest die Unterkunft, die ich für dich gebucht habe, oder?«, fragte Oscar, während er mich an seine Brust drückte.
»Ich wünschte, du würdest bei uns in Chatham wohnen.« Lorena schubste Oscar mit dem Ellbogen weg, um mich ebenfalls zu umarmen. »Aber ich kann es dir nicht verdenken, dass du dir was Friedlicheres ausgesucht hast. Selbst an den ruhigen Tagen herrscht bei uns noch Tohuwabohu.«
Ich drückte ihren Arm. »Mir ist es lieber, näher an der Baustelle zu sein. Außerdem macht Heatherington einen unglaublich charmanten Eindruck.«
»Deshalb wollen wir ja hierher.« Oscar sah auf seine Armbanduhr. »Du solltest mal los, musst du nicht bald einchecken?«
»Ja, ich möchte nicht zu spät kommen.« Ich machte mich auf den Weg zu meinem Auto. »Danke noch mal, dass du mir die Unterkunft besorgt hast.«
»Kein Problem. Und … Tate?«
Als ich mich umdrehte, legte Oscar gerade den Arm um Lorena.
»Ruh dich ein bisschen aus, ja?«
Kapitel 5
In der Küche rührte sie sich Zucker in den Tee und beobachtete dabei geistesabwesend ein Kardinalpärchen, das auf einem Ast der alten Ulme saß, in die sie als Kind immer geklettert war. Obwohl es ein schöner Tag war, konnte sie sich nicht dazu aufraffen, nach draußen zu gehen. Normalerweise liebte sie es, im Freien zu sein. Erst neulich war sie mit dem Fahrrad in der Stadt gewesen, und der Wind im Gesicht hatte sie so entspannt wie lange nichts.
Selbst die Touristen, die schon vorzeitig für das Musikfestival angereist waren, hatten sie nicht gestört, obwohl viele von ihnen fuhren, als wäre es eine Zumutung, Rücksicht auf Fahrradfahrende zu nehmen. In der Nähe des Parks hatten zwei Straßenmusiker an gegenüberliegenden Ecken miteinander gewetteifert, zweifellos in der Hoffnung, von mächtigen Produzenten entdeckt zu werden. Es bemühten sich zwar keine Talentscouts zu ihrem kleinen Festival, aber die Künstlerinnen und Künstler und die Zuschauer brachten immerhin etwas Schwung in ihr ansonsten verschlafenes Städtchen.
Sie trank einen Schluck Tee und atmete tief durch, um die finsteren Gedanken zu verscheuchen, die sie in diesen ganzen langen Monaten heimgesucht hatten. Ihre Oma hatte dem alten Aberglauben angehangen, dass aller schlechten Dinge drei waren, sie selbst hingegen war der Ansicht, dass das nicht stimmte; bei ihr waren es vier oder sieben oder sogar zwölf gewesen. Na ja, es hing wohl davon ab, wie weit man zurückrechnete und was schlecht genug war, um gezählt zu werden. Trotzdem, in den vergangenen drei Jahren hatte sie mehr geweint als in den ersten siebenundzwanzig Jahren ihres Lebens zusammen. Sie hatte bei der Beerdigung ihrer Großmutter geschluchzt und danach noch wochenlang, und auch während des Lockdowns wegen der Pandemie, als der Tourismus am Boden lag und die Geschäfte in Heatherington, einschließlich ihres eigenen, ums Überleben kämpften. In letzter Zeit war sie nach Terminen bei ihrem Anwalt manchmal so wütend gewesen, dass sie die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Wieder nach Hause zu ziehen und sich mit ihren ehemals engsten Freunden zu zerstreiten, hatte weitere Tränen gekostet, und all das brachte sie ins ernsthafte Grübeln, ob sie Gott irgendwie verärgert hatte.
Dabei wusste sie ja, dass Gott nicht schuld war. Nein, die meisten ihrer Probleme hatte sie sich selbst zuzuschreiben. Sie hatte eben eine schlechte Menschenkenntnis, und der einzige Trost war, dass ihre Fehler sie bisher nicht gebrochen hatten. Dennoch, sie war erschöpft, und in den letzten Tagen hatte sie Airbnb-Angebote in Rom und Paris und Barcelona durchforstet, sich ausgemalt, wie sie über Märkte schlenderte und lernte, Olivenöl zu pressen. Das waren nur Träumereien, das wusste sie natürlich, aber sie sehnte sich nach einem sorglosen Leben, vorzugsweise in einer der exotischen Städte, in die sie sich in Gedanken immer versetzt hatte, und wenn nur für ein kurzes Weilchen. Warum sollte es für sie nicht auch bisschen Eat, Pray, Love geben?