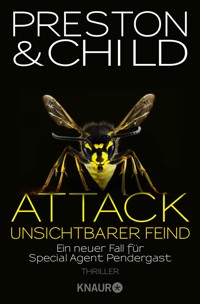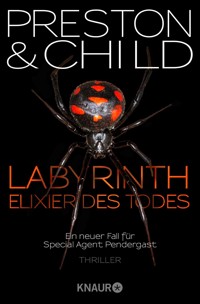9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Special Agent Pendergast
- Sprache: Deutsch
Der Schock trifft Pendergast ohne jede Vorbereitung: Seine Frau Helen, deren mysteriösen Tod er aufzuklären versucht, lebt! Aber wer liegt dann in ihrem Grab, und warum will ihr Bruder ihn ausschalten? Pendergast ermittelt unter Hochdruck. Dabei kommt er einer skrupellosen Gruppe auf die Spur, die ihre dunklen Machenschaften seit langer Zeit erfolgreich verbirgt. Um Pendergast in die Knie zu zwingen, ist ihr jedes Mittel recht – und zum ersten Mal droht der sonst stets kühl kalkulierende Ermittler, die Kontrolle zu verlieren. In der direkten Fortsetzung von "Fever" muss Special Agent Aloysius Pendergast seinen bisher schwersten und persönlichsten Fall bestehen. Hochspannung vom Feinsten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Douglas Preston und Lincoln Child
REVENGE – Eiskalte Täuschung
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Ich hatte gehofft, dass es nicht soweit kommen würde. Es ist tragisch, dass du die Sache auch nach zwölf Jahren nicht auf sich beruhen lassen kannst. Sag dein letztes Gebet.« Er hob das Gewehr, zielte und drückte ab.
Wer ist die unbekannte Tote, die in Helens Grab gefunden wurde? Und warum ist die Geburtsurkunde seiner Frau verschwunden? Wohl oder übel muss Aloysius Pendergast noch tiefer in die Geschichte Helens eindringen, von der er inzwischen ahnt, dass sie ihn niemals geliebt hat – und tatsächlich findet er Erstaunliches über sie und eine geheimnisvolle Organisation heraus, die bereit ist, alles zu tun, um ihre Spuren zu verwischen. Um Pendergast in die Knie zu zwingen, ist ihr jedes Mittel recht – und zum ersten Mal könnte der sonst so kühl kalkulierende Ermittler die Kontrolle verlieren …
Inhaltsübersicht
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
Anmerkungen der Autoren
DIE PENDERGAST-ROMANE
Gideon Crew – Unser neuer Ermittler
Unsere anderen Romane
Und für all diejenigen, [...]
Lincoln Child widmet dieses Buch seiner Tochter Veronica.
Douglas Preston widmet dieses Buch Marguerita, Laura und Oliver Preston.
1
Cairn Barrow, Schottland
Während sie die kahle Flanke des Beinn Dearg hinaufstiegen, verlor sich das große, aus Feldstein erbaute Jagdhotel Kilchurn Lodge in der Dunkelheit, bis nur noch das sanfte gelbliche Licht hinter den Fenstern durch den dunstigen Nebel drang. Als Judson Esterhazy und Special Agent Aloysius Pendergast auf der Kuppe ankamen, blieben sie stehen, schalteten ihre Taschenlampen aus und horchten. Es war fünf Uhr morgens, das allererste Licht des Tages, kurz bevor die Rothirsche zu röhren begannen.
Keiner der beiden Männer sagte ein Wort. Der Wind strich säuselnd durch die Gräser und pfiff um die durch Frost rissig gewordenen Felsen. Sie warteten, doch nichts rührte sich.
»Wir sind früh dran«, sagte Esterhazy schließlich.
»Kann sein«, antwortete Pendergast leise.
Reglos standen sie da, während im äußersten Osten ein leichter grauer Lichtschein am Horizont heraufzog, der die kargen Gipfel der Grampian Mountains wie Silhouetten erscheinen ließ und die Umgebung in ein fahles Licht tauchte. Langsam begann die Landschaft, sich aus dem Dunkel abzuzeichnen. Die von schweren und stummen Tannen umstandene Lodge lag weit hinter ihnen, die Türmchen und dicken Steinmauern waren von Nässe überzogen. Vor den beiden Männern erhoben sich die granitenen Berghänge des Beinn Dearg und verschwanden in der darüberliegenden Dunkelheit aus dem Blickfeld. Ein Bergbach floss die Hänge hinab und verwandelte sich in eine Reihe von Wasserfällen, die sich ins dunkle Wasser des dreihundert Meter unter ihnen gelegenen Loch an Duin ergossen, der in dem trüben Licht kaum sichtbar war. Zu ihrer Rechten und unterhalb von ihnen lag der Beginn einer ausgedehnten, als Foulmire, oder kurz: Mire, bekannten Moorlandschaft. Sie war überzogen von aufsteigenden Nebelschwaden, die den schwachen Geruch von Verwesung und Sumpfgas, vermischt mit dem unangenehmen Odeur verblühter Heide, zu ihnen heraufwehten.
Wortlos schulterte Pendergast wieder sein Jagdgewehr und ging, der Kontur des Berghangs folgend, leicht bergauf. Esterhazy folgte dichtauf, seine Gesichtszüge waren vom Deerstalker-Hut verdeckt und unergründlich. Je höher sie stiegen, desto deutlicher kam das Foulmire in Sicht. Begrenzt wurde das tückische Moor, das sich nach Westen bis zum Horizont erstreckte, von der glatten, dunklen Wasserfläche der ausgedehnten Insh-Marsch.
Nach einigen Minuten blieb Pendergast stehen und hob die Hand.
»Was ist denn?«, fragte Esterhazy.
Die Frage wurde beantwortet, allerdings nicht von Pendergast, sondern von einem seltsamen Laut, fremdartig und furchterregend, der aus einem nicht einsehbaren Glen heraufschallte: das Röhren eines brünftigen Rothirschs. Das Echo hallte über die Berge und Marschen wie der verlorene Schrei der Verdammten. Ein Laut voller Zorn und Angriffslust, der immer dann erklang, wenn die Hirschböcke über die Fells und Moore zogen und oftmals bis zum Tode um den Besitz eines Harems von Hirschkühen kämpften.
Das Röhren wurde von einem zweiten beantwortet, das vom Ufer des Loch heraufschallte, und dann erhob sich in einem fernen Tal ein weiterer Ruf. Dröhnend erklang das brünftige Röhren der Hirsche, eines nach dem anderen, über die weite Landschaft. Die beiden Männer horchten schweigend, merkten sich jedes einzelne Röhren und bestimmten dessen Richtung, Timbre und Kraft.
Schließlich sagte Esterhazy, dessen Stimme in dem scharfen Wind kaum zu hören war: »Der in dem Glen, das ist der Riese.«
Keine Antwort von Pendergast.
»Ich würde vorschlagen, den schnappen wir uns.«
»Der im Foulmire«, sagte Pendergast leise, »ist noch größer.«
Stille.
»Du kennst doch die Vorschrift für die Jagd hier. Das Betreten des Mire ist verboten.«
Pendergast machte eine kurze, abfällige Handbewegung. »Ich bin keiner, der sich immer an die Vorschriften hält. Du etwa?«
Esterhazy verkniff sich eine Antwort.
Sie warteten. Plötzlich verfärbte sich im Osten die Morgendämmerung rot, und das Sonnenlicht zog langsam über die karge Landschaft der Highlands. Tief unter ihnen wirkte das Foulmire jetzt wie eine Wüste aus schwarzen Sumpflöchern und sumpfigen Wasserläufen, Schwingrasenmooren und Treibsandflächen, unterbrochen von trügerischen grasbedeckten Wiesen und Tors, Hügel aus schroffem, auseinandergebrochenem Granitfels. Pendergast zog ein kleines Fernglas aus der Tasche und ließ den Blick über das Mire schweifen. Nach einer Weile reichte er das Fernglas Esterhazy. »Er steht zwischen dem zweiten und dritten Tor, achthundert Meter im Moor. Ein Einzelgänger. Kein Harem.«
Esterhazy blickte durchs Glas. »Sieht aus wie ein Zwölfender.«
»Dreizehnender«, murmelte Pendergast.
»Die Pirsch auf den im Glen wäre viel leichter. Dort hätten wir mehr Deckung. Ich bezweifle, dass wir auch nur die geringste Aussicht haben, den im Mire zu erwischen. Einmal abgesehen von dem, äh, Risiko, dort reinzugehen, sieht der uns doch schon auf eine Meile Entfernung.«
»Wir nähern uns auf einer Sichtlinie, die durch den zweiten Tor verläuft, so dass der Felshügel zwischen uns und dem Hirsch liegt. Der Wind steht günstig für uns.«
»Kann sein, aber in dem Sumpfgebiet da unten gibt es jede Menge tückische Flächen.«
Pendergast drehte sich zu Esterhazy um und schaute sekundenlang in dessen kultiviertes Gesicht mit der hohen Stirn. »Hast du etwa Angst, Judson?«
Esterhazy, der einen Augenblick lang überrascht wirkte, wischte die Frage mit einem gekünstelten Lachen beiseite. »Natürlich nicht. Aber ich überlege eben, welche Erfolgsaussichten wir haben. Warum wollen wir Zeit mit einer ergebnislosen Pirsch durchs Mire verschwenden, wenn uns da unten im Glen ein genauso kapitaler Bursche erwartet?«
Ohne zu antworten, steckte Pendergast die Hand in die Hosentasche und zog eine Ein-Pfund-Münze heraus. »Kopf oder Zahl?«
»Kopf«, sagte Esterhazy widerstrebend.
Pendergast warf die Münze, fing sie auf und legte sie auf seinen Ärmel. »Zahl. Der erste Schuss gehört mir.«
Pendergast stieg als Erster die Flanke des Beinn Dearg hinunter. Es gab hier keinen Pfad, nur zerbrochene Felsen, kurzes Gras, winzige Wildblumen und Flechten. Während die Nacht dem Morgen wich, legten sich Nebelschwaden über das Moor, schwebten über die tiefliegenden Gebiete und strömten die kleinen Hügel und schroffen Felsen hinauf.
Leise und verstohlen gingen Pendergast und Esterhazy bis zum Rand des Sumpfs hinunter. Als sie am Fuß des Beinn auf einen Corrie, einen Gletschertopf, stießen, machte Pendergast Zeichen, dass sie stehen bleiben sollten. Rotwild besaß äußerst feine Sinne, weshalb sie enorm umsichtig vorgehen mussten, damit der Hirsch sie weder sah noch hörte oder roch.
Pendergast kroch auf allen vieren zum Rand des Gletschertopfs und spähte über dessen Rand hinweg.
Der Rothirsch befand sich ungefähr dreihundert Meter entfernt und schritt langsam in den Sumpf. Wie aufs Stichwort hob er den Kopf, schnüffelte und stieß abermals sein ohrenbetäubendes Röhren aus, das zwischen den Felsen widerhallte und erstarb, dann schüttelte er seine Mähne und begann erneut, am Boden zu schnüffeln und zu grasen.
»Mein Gott«, flüsterte Esterhazy, »was für ein kapitaler Bursche.«
»Wir müssen uns beeilen«, sagte Pendergast leise. »Er geht weiter in den Sumpf.«
Unterhalb des Rands des Gletschertopfs machten sie kehrt und hielten sich außer Sichtweite, bis der Hirsch sich auf einer Linie mit einem Tor befand. Dann wandten sie sich um und pirschten sich an die Beute an, wobei sie den kleinen Felshügel als Deckung nutzten. Nach dem langen Sommer war der Boden in der Randzone des Mire einigermaßen fest, und Pendergast und Esterhazy bewegten sich schnell und leise, wobei ihnen kleine Erhebungen aus weichem Gras als Trittsteine dienten. Schließlich gelangten sie an die vom Wind abgewandte Seite des Felshügels und gingen dahinter in die Hocke. Der Wind begünstigte sie immer noch. Erneut hörten sie den Hirsch röhren – das Zeichen, dass er sie nicht gewittert hatte. Pendergast erschauderte, denn das Röhren ähnelte beim Ausklang auf unheimliche Weise dem Gebrüll eines Löwen. Er signalisierte Esterhazy, hinter dem Hügel zu bleiben, kroch den Hang hinauf und spähte vorsichtig zwischen einer Gruppe von Felsblöcken hindurch.
Der Rothirsch stand dreihundert Meter entfernt, hielt die Nase in die Luft und bewegte sich unruhig. Wieder schüttelte er die Mähne, das gefegte Geweih schimmerte. Er hob den Kopf und röhrte erneut. Ein Dreizehnender, mit mindestens einem Meter Geweihstangenlänge. Eigenartig, dass der Hirsch so spät in der Brunftzeit noch keinen größeren Harem um sich geschart hatte. Aber manche Hirsche waren eben Einzelgänger.
Pendergast und Esterhazy standen noch zu weit entfernt, um einen treffsicheren Schuss abgeben zu können. Ein einigermaßen guter Schuss würde nicht genügen; sie durften es auf keinen Fall riskieren, ein Tier von diesem Kaliber zu verwunden. Es musste ein Blattschuss sein.
Pendergast kroch den Hügel wieder hinunter, zurück zu Esterhazy. »Er ist dreihundert Meter weg, das ist zu weit.«
»Genau das hatte ich befürchtet.«
»Er ist enorm selbstsicher«, sagte Pendergast. »Weil niemand im Foulmire jagt, ist er nicht so aufmerksam, wie er es sein sollte. Der Wind bläst uns ins Gesicht, der Hirsch bewegt sich von uns fort – ich denke, wir können eine offene Pirsch wagen.«
Esterhazy schüttelte den Kopf. »Da vorn sieht der Boden ziemlich tückisch aus.«
Pendergast deutete auf eine sandige Fläche unmittelbar neben ihrem Versteck, dort war die Fährte des Rothirschs zu erkennen. »Wir folgen seiner Fährte. Wenn sich jemand im Sumpf auskennt, dann er.«
Esterhazy streckte den Arm aus. »Geh du voran.«
Sie entsicherten ihre Gewehre, krochen hinter dem Tor hervor und setzten sich in Richtung des Hirschs in Bewegung. Und in der Tat, das Tier war abgelenkt, es roch den Luftstrom, der aus nördlicher Richtung kam, und achtete kaum darauf, was sich hinter ihm befand. Sein Schnüffeln und Röhren überdeckte die Geräusche, die Pendergast und Esterhazy auf ihrer Pirsch machten.
Sie rückten äußerst vorsichtig vor und verharrten jedesmal, wenn der Hirsch stehen blieb oder den Kopf wendete. Langsam begannen sie, ihn zu überholen. Der Hirsch schritt weiter ins Mire, offenbar einer Duftspur folgend. Sie gingen in völliger Stille weiter, sprachen kein einziges Wort, hielten sich geduckt, ihre Hochland-Tarnkleidung der sie umgebenden Moorlandschaft perfekt angepasst. Der Weg, den der Hirsch einschlug, folgte fast unsichtbaren Linien einigermaßen festen Bodens, schlängelte sich zwischen Teichen mit sirupartigem Sumpf, zitterndem Morast und grasbewachsenen Wattflächen hindurch. Ob nun wegen der wenig vertrauenerweckenden Bodenbeschaffenheit, der Jagd oder aus irgendeinem anderen Grund, es lag eine zunehmende Spannung in der Luft.
Allmählich kamen Pendergast und Esterhazy in Schussdistanz: hundert Meter. Abermals blieb der Hirsch stehen, wandte sich zur Seite, schnupperte die Luft. Mit kaum merklicher Handbewegung signalisierte Pendergast, dass sie anhalten sollten, und ging vorsichtig in eine liegende Stellung. Er holte die H&H 300 nach vorn, setzte das Fernrohr ans Auge und zielte sorgfältig. Esterhazy kauerte zehn Meter hinter ihm, reglos wie ein Fels.
Pendergast spähte durchs Zielfernrohr, nahm einen Punkt vor der Schulter des Tieres ins Visier, holte Luft und wollte abdrücken.
Da spürte er, wie ihn am Hinterkopf kalter Stahl berührte.
»Tut mir leid, alter Junge«, sagte Esterhazy. »Halt das Gewehr mit einer Hand nach vorn und leg es hin. Langsam und ganz entspannt.«
Pendergast legte das Gewehr auf den Boden.
»Steh auf. Ganz langsam.«
Pendergast tat, wie ihm geheißen.
Esterhazy trat einen Schritt zurück und richtete seine Jagdwaffe auf den FBI-Agenten. Plötzlich stieß er ein Lachen aus, dessen rauher Klang über die Moorlandschaft hallte. Aus dem Augenwinkel sah Pendergast, wie der Hirsch erschrak, davonlief und schließlich im Nebel verschwand.
»Ich hatte gehofft, dass es nicht so weit kommen würde«, sagte Esterhazy. »Es ist schon verdammt tragisch, dass du auch nach zwölf Jahren keine Ruhe geben kannst.«
Pendergast sagte kein Wort.
»Du fragst dich wahrscheinlich, worum es hier geht.«
»Ehrlich gesagt, nein«, sagte Pendergast mit tonloser Stimme.
»Ich bin der Mann, nach dem du suchst. Der Unbekannte im Projekt Aves. Der, dessen Namen Charles Slade dir nicht nennen wollte.«
Keine Reaktion.
»Ich würde dir alles ja ausführlicher erklären, aber wozu? Ich mache das hier nicht gern. Aber dir ist sicher klar, dass es nicht persönlich gemeint ist.«
Immer noch keine Reaktion.
»Sag dein letztes Gebet, Schwager.«
Und dann hob Esterhazy langsam das Gewehr, zielte und drückte ab.
2
In der feuchten Luft ertönte ein leises Klicken.
»Verflucht!«, murmelte Esterhazy, entriegelte den Verschluss, nahm die defekte Patrone heraus und legte eine neue ein.
Klick.
Pendergast hob blitzartig sein Gewehr vom Boden auf und richtete es auf Esterhazy. »Deine gar nicht so schlaue List ist fehlgeschlagen. Ich habe dich seit deinem schlecht formulierten Brief, in dem du mich gefragt hast, welche Waffen ich mitbringe, in Verdacht. Ich fürchte, jemand hat die Munition in deinem Gewehr manipuliert. Und so schließt sich der Kreis: von den Platzpatronen, die du in Helens Gewehr gelegt hast, bis zu den Platzpatronen, die jetzt in deinem stecken.«
Esterhazy hantierte immer noch am Verschluss. Fieberhaft nahm er mit der einen Hand die defekten Patronen heraus, während er gleichzeitig mit der anderen in seiner Patronentasche nach neuer Munition kramte.
»Hör auf damit, oder ich bringe dich um!«, sagte Pendergast.
Aber Esterhazy ignorierte ihn. Er nahm die letzte Patrone heraus und schob eine neue in den Lauf, dann ließ er den Verschluss zuschnappen.
»Wie du willst. Die hier ist für Helen.« Pendergast drückte ab.
Ein dumpfes Kleng! erklang.
Pendergast, der die Situation sofort erkannte, drehte sich um und warf sich hinter einer Felszunge in Deckung, während Esterhazy einen Schuss abgab. Die Kugel prallte von einem Felsen ab und schlug kleine Stückchen heraus. Pendergast rollte sich weiter hinter die Deckung, warf sein Gewehr weg und zog den 32er Colt, den er als Ersatz mitgenommen hatte. Er stand auf, zielte und schoss, aber Esterhazy war schon auf der anderen Seite des kleinen Hügels in Deckung gegangen. Die Schüsse, die er abgab, prallten von den Felsen unmittelbar vor Pendergast ab.
Jetzt waren sie beide in Deckung, jeder auf einer Seite des Felshügels. Erneut hallte Esterhazys Lachen über das Land. »Sieht ganz danach aus, als ob deine gar nicht so schlaue List ebenfalls fehlgeschlagen ist. Hast du etwa geglaubt, ich würde dich mit einem funktionierenden Gewehr ins Moor hinausgehen lassen? Tut mir leid, alter Knabe, ich habe den Schlagbolzen entfernt.«
Pendergast lag auf der Seite und drückte sich schwer atmend an den Felsen. Eine Pattsituation – sie befanden sich beidseits des kleinen Hügels. Was bedeutete: Wer immer als Erster oben ankam …
Pendergast sprang auf und krabbelte spinnengleich den Tor hinauf. Er kam im selben Augenblick wie Esterhazy oben an; sie prallten aufeinander, schlangen mit aller Kraft die Arme umeinander und rangen auf dem höchsten Punkt des Felshügels, dann gingen sie zu Boden und stürzten, sich verzweifelt umklammernd, die Felswand hinunter. Pendergast schob Esterhazy von sich weg und brachte seine 32er in Anschlag, aber Esterhazy schlug mit dem Lauf seines Gewehrs danach. Die beiden Waffen klirrten wie Schwerter. Gleichzeitig löste sich aus beiden ein Schuss. Pendergast packte mit der einen Hand den Lauf von Esterhazys Gewehr, sie rangen, um in dessen Besitz zu kommen. Pendergast ließ seinen Colt fallen, wollte Esterhazy das Gewehr mit beiden Händen entreißen.
Das Handgemenge setzte sich fort, alle vier Hände auf demselben Gewehr. Die beiden Männer drehten sich und schlugen um sich, jeder versuchte, den anderen abzuschütteln. Pendergast beugte sich vor und biss Esterhazy in die Hand, tief ins Fleisch. Esterhazy schrie auf, gab Pendergast einen Kopfstoß, so dass dieser nach hinten taumelte, und versetzte ihm einen heftigen Tritt in die Seite. Durch den Zusammenprall stürzten beide Männer erneut auf das durch Frost aufgeplatzte Felsgestein, wobei ihre Tarnkleidung zerrissen wurde.
Pendergast bekam die Hand auf den Abzug, zerrte und drehte und schoss erneut, um die Waffe leer zu bekommen. Dann ließ er das Gewehr los und verpasste Esterhazy einen Faustschlag an den Schädel, während Esterhazy das Gewehr wie einen Knüppel schwang und Pendergast einen heftigen Schlag auf die Brust versetzte. Pendergast packte den Gewehrschaft und versuchte erneut, Esterhazy die Waffe zu entwinden, aber mit einer überraschenden Bewegung riss dieser Pendergast nach vorn und versetzte ihm gleichzeitig einen üblen Tritt ins Gesicht, der dem FBI-Agenten fast die Nase gebrochen hätte. Blut spritzte überall hin; Pendergast taumelte nach hinten, schüttelte den Kopf und versuchte noch, ihn klar zu bekommen, als Esterhazy sich auf ihn stürzte und ihm erneut mit dem Gewehrkolben ins Gesicht schlug. Durch den Nebel und das Blut hindurch sah er, dass Esterhazy wieder Patronen aus der Munitionstasche kramte und ins Gewehr schob.
Pendergast kickte die Gewehrmündung mit dem Fuß hoch, sprang im selben Moment, als ein Schuss erklang, zur Seite, schnappte sich seine Pistole von dort, wo sie zu Boden gefallen war, rollte sich ab und erwiderte das Feuer. Aber Esterhazy hatte sich schon hinter dem Tor in Deckung gebracht.
Pendergast nutzte die kurze Feuerpause, sprang auf und rannte den Felshügel hinunter. Dabei erwiderte er mehrmals das Feuer, damit Esterhazy in Deckung bleiben musste, solange er davonspurtete. Unten am Hügel angekommen, sprintete er ins Moor, auf eine Senke zu, wo er rasch von dichtem Nebel eingehüllt war.
Dort, umgeben von einem Schwingrasenmoor, blieb er stehen. Der Grund unter seinen Füßen wackelte eigenartig, wie Pudding. Er tastete mit der Schuhspitze herum, stieß auf festeren Boden und begab sich tiefer ins Foulmire. Dabei trat er von Hügelchen zu Hügelchen, von Stein zu Stein und versuchte, sich von den sumpfigen Flächen fernzuhalten, während er gleichzeitig möglichst viele Meter zwischen sich und Esterhazy legte. Im Laufen hörte er mehrere Schüsse aus der Richtung des Tors, die ihr Ziel jedoch weit verfehlten: Esterhazy schoss auf Schemen.
Pendergast bog in einem Dreißig-Grad-Winkel ab und verlangsamte seine Schritte. Das Moor bot kaum Deckung, nur hier und da waren Gruppen zerbrochener Felsen zu sehen; einzig der Nebel würde ihm Schutz bieten. Was bedeutete, dass er sich weiterhin im Moor versteckt halten musste.
Er bewegte sich so schnell, wie es ihm klug erschien, und blieb häufig stehen, um mit der Fußspitze zu tasten. Esterhazy würde ihm mit Sicherheit folgen, ihm blieb ja auch nichts anderes übrig. Außerdem konnte er hervorragend Spuren lesen, vermutlich sogar noch besser als er. Im Gehen zog Pendergast ein Taschentuch hervor und drückte es sich gegen die Nase, um den Blutfluss zu stillen. Er spürte, wie die Enden einer gebrochenen Rippe aufeinanderrieben – Folge des wüsten Handgemenges. Insgeheim warf er sich vor, kurz vor Verlassen des Jagdhotels sein Gewehr nicht überprüft zu haben. Die Gewehre wurden im verschlossenen Waffenraum aufbewahrt, wie es den Vorschriften entsprach. Esterhazy musste mit irgendeiner List an die Waffe herangekommen sein. Ein, zwei Minuten, dann war der Schlagbolzen entfernt. Pendergast hatte seinen Gegner unterschätzt; das würde ihm nicht noch einmal passieren.
Plötzlich blieb er stehen und inspizierte den Boden. Dort erblickte er auf einer Fläche mit Kiessand die Fährte des Hirschs, den sie aufgescheucht hatten. Pendergast horchte und spähte in die Richtung, aus der er gekommen war. Der Nebel hob sich in Fetzen aus dem Mire und gab kurz den Blick frei auf die endlose Moorlandschaft und die fernen Berge. Der Tor, auf dem er und Esterhazy miteinander gerungen hatten, lag in Nebel gehüllt, sein Verfolger war nirgends zu sehen. Über allem lag ein graues Licht, im Norden war der Himmel dunkel, hier und da zuckten Blitze – ein heraufziehendes Gewitter.
Pendergast lud seinen Colt nach und begab sich noch weiter ins Moor. Dabei folgte er der kaum erkennbaren Fährte des Hirschs, der einen unsichtbaren, nur ihm bekannten Weg nahm, der sich sehr geschickt durch Schwingrasenmoore und Flächen mit Treibsand hindurchschlängelte.
Es war noch nicht vorbei. Esterhazy war ihm dicht auf den Fersen. Aber es konnte nur ein Ende geben: Einer von ihnen würde nicht zurückkehren.
3
Pendergast folgte der zunehmend undeutlicheren Fährte des Hirschs, die sich durch die zitternden Farne des Mire schlängelte, wobei er darauf achtete, festen Grund unter den Füßen zu haben. Während das Gewitter näher kam, verdunkelte sich der Himmel, in der Ferne grollte Donner über der Moorlandschaft. Pendergast ging schnell und blieb nur stehen, um den Boden nach Anzeichen dafür abzusuchen, dass der Hirsch vorbeigekommen war. Vor allem in dieser Zeit des Jahres, nachdem im Sommer auf vielen Schwingrasenmooren frisches Gras gewachsen war und sich eine trügerische Kruste darauf gebildet hatte, die unter dem Gewicht eines Menschen einbrechen würde, war das Moor gefährlich.
Blitze zuckten über den Himmel, und es begann zu regnen, schwere Tropfen, die wirbelnd aus den bleifarbenen Wolken fielen. Der Wind frischte auf, strich raschelnd über die Heide und trug von der westlich gelegenen Insh-Marsch – einer riesigen, glatten Wasserfläche mit kleinen Inselchen und im Wind schwankendem Schilf und Röhricht – einen modrigen Geruch herauf. Knapp zwei Meilen war Pendergast der Fährte gefolgt, die allmählich in höheres und festeres Gelände führte, als er durch eine Lücke im Nebel geradeaus eine Ruine sah. Scharf umrissen vor dem Himmel und auf einer Anhöhe stehend, zeichneten sich ein alter Pferch mit einer Steinmauer und eine Schäferhütte ab, die hin und wieder von Blitzen erhellt wurden. Hinter dem Hügel lag der gezackte Rand der Marsch. Pendergast inspizierte den niedergetrampelten Stechginster und stellte fest, dass der Hirsch durch die Ruinen hindurch und weiter in Richtung des ausgedehnten Sumpfgebiets auf der anderen Seite gegangen war.
Er stieg den Hügel hinauf und erkundete rasch die Ruine. Die Hütte hatte kein Dach mehr, die Steinmauern waren teilweise eingestürzt und mit Flechten übersät, der Wind ächzte und pfiff durch das verfallene Gemäuer. Dahinter führte der Hügel hinab zu einem Sumpfgebiet, das unter einer Hülle aufsteigender Dunstschwaden versteckt lag.
Die ganz oben auf dem Hügel stehende Schäferhütte stellte eine ideale Verteidigungsstellung dar und bot freien Blick in alle Richtungen. Der ideale Ort, um einen Angreifer in den Hinterhalt zu locken oder sich gegen einen Angriff zu verteidigen. Und genau deshalb ging Pendergast daran vorbei und weiter bergab in Richtung der Insh-Marsch. Erneut nahm er die Fährte des Hirschs auf – und war kurzzeitig verwirrt. Es schien, als ob das Tier in eine Sackgasse gegangen war. Es musste sich von Pendergasts Verfolgung bedrängt gefühlt haben.
Pendergast ging am Rand der Marsch zurück und gelangte schließlich in eine Zone mit dichtem Reet, wo ein Wallberg aus Schmelzwasserkiesen ins Wasser ragte. Eine Gruppe von Felsen, von den Eiszeiten glattgeschliffen, bot wenig, aber zufriedenstellende Deckung. Er blieb stehen, holte ein weißes Taschentuch hervor, wickelte es um einen Stein und legte diesen an einen sorgfältig ausgewählten Platz hinter einen Felsen. Dann ging er daran vorbei. Hinter den Schmelzwasserkiesen fand er, wonach er gesucht hatte: einen recht flachen, unter der Wasseroberfläche liegenden Felsen, der von Schilf umgeben war. Er sah, dass der Hirsch ebenfalls hier entlanggegangen und anschließend auf die Marsch zugesteuert war.
Es war unwahrscheinlich, dass man hier, hinter dieser Wand aus Reet, in Deckung ging, aber noch unwahrscheinlicher war es, sich hier verteidigen zu wollen. Und genau deshalb eignete sich dieser Ort dafür.
Pendergast watete zu dem flachen Felsen, wobei er darauf achtete, den auf beiden Seiten befindlichen Sumpf zu meiden, und ging, gut versteckt vor allen Blicken, hinter dem Schilf in Stellung. Dort kniete er sich hin und wartete. Ein Blitz zuckte über den Himmel, gefolgt von krachendem Donner. Wieder zog von der Marsch her Nebel auf, wodurch die Ruinen auf der Anhöhe vorübergehend nicht mehr zu sehen waren. Kein Zweifel, Esterhazy würde bald eintreffen. Das Ende war in Sicht.
Judson Esterhazy blieb stehen, um den Boden zu inspizieren. Er streckte die Hand aus und befingerte einige Kiesel, die der Hirsch auf seinem Weg beiseitegeschoben hatte. Pendergasts Fußabdrücke waren längst nicht mehr so deutlich zu erkennen, aber er sah sie trotzdem, denn in der Nähe war das Erdreich flachgedrückt, die Grashalme geknickt. Pendergast war keinerlei Risiko eingegangen, sondern war dem Hirsch weiter auf dessen gewundenem Weg durchs Foulmire gefolgt. Schlau. Kein Mensch würde es wagen, hier ohne Führer reinzugehen, aber ein Hirsch war ein exzellenter Führer. Während das Gewitter heranzog, wurde der Nebel dichter; es wurde so dunkel, dass er froh war, die – sorgsam abgedeckte – Taschenlampe dabeizuhaben, damit er den Weg vor sich sehen konnte.
Pendergast hatte offensichtlich vor, ihn ins Foulmire zu locken und zu töten. Pendergast tat zwar immer wie ein vornehmer Südstaatler, aber er war der unerbittlichste Mensch, dem er je begegnet war, und ein dreckiger Mistkerl von einem Kämpfer noch dazu.
Ein Blitz erhellte das menschenleere Moor, und da sah Esterhazy auf einer Anhöhe, gut vierhundert Meter entfernt, durch eine Lücke im Nebel den gezackten Umriss einer Ruine. Er blieb stehen. Es lag auf der Hand, dass Pendergast sich dort versteckte und seine Ankunft erwartete. Er würde sich dem verfallenen Gemäuer nähern, dem Lauerer auflauern … Aber noch während er seinen geübten Blick über den Ort schweifen ließ, kam ihm der Gedanke, dass Pendergast zu intelligent war, um die naheliegende Option zu wählen.
Er konnte einfach nichts als gegeben voraussetzen.
Es gab zwar kaum Deckung in dieser kargen Landschaft, aber wenn er seine Aktionen zeitlich präzise plante, konnte er sich den dichten Nebel zunutze machen, der von der Marsch her aufzog und den nötigen Schutz bot. Wie aufs Stichwort wälzte sich erneut eine Nebelbank heran, die ihn in ihre farblose Welt des Nichts hüllte. Er hastete den Hügel in Richtung der Ruine hinauf, wobei er auf dem festeren Boden schnell vorankam. Ungefähr hundert Meter unterhalb der Kuppe ging er um den Hügel herum, damit er sich aus unerwarteter Richtung nähern konnte. Der Regen war stärker geworden, der Donner zog grollend über das Moor davon.
Er kniete sich hin und ging in Deckung, gleichzeitig riss der Nebel kurz auf, so dass die Ruine über ihm zu erkennen war. Von Pendergast war nichts zu sehen. Während der Nebel wieder näher kam, ging er, das Gewehr in der Hand, den Hügel hinauf, bis er an der Steinmauer ankam, die einen alten Pferch umgab. Er ging daran entlang und hielt sich geduckt, bis der Nebel wieder aufbrach, so dass er durch eine Lücke in der Steinmauer hindurchspähen konnte.
Im Pferch war niemand. Aber dahinter stand die Hütte ohne Dach.
Er näherte sich dem Bauwerk, indem er am Pferch entlangschlich und mit dem Kopf unterhalb der Mauer blieb. Kurz darauf stand er dicht angelehnt an der Rückseite der Hütte. Er wagte sich bis zu einem der zerbrochenen Fenster vor und wartete auf die nächste Lücke im Nebel. Der Wind frischte auf, pfiff zwischen den Feldsteinen hindurch und übertönte seine leisen Bewegungen. Er machte sich bereit. Und dann, als die Sicht ein wenig besser war, drehte er sich blitzartig zum Fenster und schwenkte dabei das Gewehr von einer Ecke der Hütte zur anderen.
Leer.
Er sprang über den Fenstersims, kniete sich in der Hütte hin und überlegte wie verrückt. Wie vermutet hatte Pendergast es vermieden, das Naheliegende zu tun. Er hatte eben nicht die strategische Anhöhe besetzt. Aber wo steckte er? Esterhazy stieß einen leisen Fluch aus. Pendergast war unberechenbar.
Als erneut eine Nebelschwade heranzog, nutzte Esterhazy die Gelegenheit, den Bereich rings um die Hütte zu inspizieren und Pendergasts Spur zu suchen. Die er auch fand, wenn auch nur mit Mühe. Wegen des starken Regens war sie bereits weitgehend verwaschen. Als er auf der anderen Seite des Hügels hinunterging, war durch die Lücken im Nebel kurz die Beschaffenheit des Geländes zu erkennen. Es handelte sich um eine Art Sackgasse – dahinter lag lediglich die Inih-Marsch. Also musste Pendergast irgendwo am Rand der Marsch in Deckung gegangen sein. Esterhazy spürte, wie ihn leise Panik ergriff. Durch die aufreißenden Nebelfetzen suchte er das Gebiet ab. Pendergast würde sich mit Sicherheit nicht im Schilf oder Röhricht verstecken. Aber da sah er einen schmalen Streifen Land, der sich bis in die Marsch erstreckte. Esterhazy zog sein Fernglas hervor und erblickte eine kleine Gruppe verstreut herumliegender Gletscherfelsen, die gerade so viel Schutz boten, dass man sich dahinter verstecken konnte. Und bei Gott, da war er: ein kleiner weißer Fleck, so eben hinter einem der Felsen auszumachen.
So hatte Pendergast sich das also gedacht. Er hatte sich hinter die einzige Deckung geflüchtet, die es weit und breit gab, und wartete dort, bis er, Esterhazy, vorbeikam, Pendergasts Spur am Rand der Marsch folgend.
Abermals hatte Pendergast für das Nicht-Offensichtliche optiert. Aber jetzt war Esterhazy klar, wie er den Plan seines Gegners durchkreuzen konnte.
Der höchst willkommene Nebel kehrte zurück. Esterhazy stieg den Hügel hinunter, und schon bald befand er sich wieder zwischen den tückischen Sümpfen des Foulmire und folgte der Doppelspur von Pendergast und dem Hirschen. Während er sich dem Rand der Marsch näherte, ging er von Hügelchen zu Hügelchen, über Flächen aus schwankendem Morast. Er betrat wieder festeren Boden, verließ den Pfad und begab sich zu einer Stelle, von wo aus er freie Schussbahn in den Bereich hinter der Felsgruppe haben würde, hinter der sich Pendergast versteckte. Er kniete hinter einem kleinen Hügel nieder und wartete, dass der Nebel aufriss, damit er seinen Schuss anbringen konnte.
Eine Minute verstrich; zwischen den Nebelschwaden tat sich eine Lücke auf. Er sah das kleine bisschen Weiß in Pendergasts Versteck. Es gehörte wahrscheinlich zu seinem Hemd und bot genug Fläche, dass er den Schuss plazieren konnte. Esterhazy hob das Gewehr.
»Aufstehen, und zwar ganz langsam«, ließ sich die körperlose Stimme vernehmen, fast so, als käme sie direkt aus dem Marschwasser.
4
Esterhazy erschrak, als er die Stimme hörte.
»Wenn du aufstehst, halt dein Gewehr in der linken Hand, weit vom Körper weggestreckt.«
Esterhazy merkte, dass er sich immer noch nicht rühren konnte. Wie hatte Pendergast ihn derart überrumpeln können?
Zwing! Die Kugel bohrte sich zwischen seinen Füßen in den Boden, so dass Erde aufspritzte. »Ich bitte dich nicht noch einmal.«
Das Gewehr in der Linken, stand Esterhazy auf.
»Lass das Gewehr fallen und dreh dich um.«
Er tat, wie ihm befohlen wurde. Und da stand Pendergast, zwanzig Meter entfernt, mit der Pistole in der Hand, und erhob sich aus einer Gruppe Schilfgras, das anscheinend im Wasser stand. Aber jetzt sah Esterhazy, dass direkt unter der Wasseroberfläche ein kleiner mäandernder Pfad aus eiszeitlichen Felsen entlangführte, der auf beiden Seiten von Schwimmsand umgeben war.
»Ich habe nur eine Frage«, sagte Pendergast, dessen Stimme im heulenden Wind verwehte. »Wie konntest du nur die eigene Schwester töten?«
Esterhazy starrte ihn nur an.
»Ich verlange eine Antwort.«
Esterhazy brachte kein Wort heraus. Doch als er in Pendergasts Miene blickte, war ihm klar: Du bist tot. Er spürte, wie sich diese unaussprechliche, kalte Todesangst wie ein nasser Umhang um ihn legte und sich mit Entsetzen, Reue und Erleichterung vermischte. Er konnte nichts mehr tun. Doch zumindest würde er Pendergast nicht die Genugtuung verschaffen, würdelos abzutreten. Nach seinem Tod würde Pendergast in den vor ihm liegenden Monaten noch genügend Schmerz und Leid erfahren. »Bring’s einfach hinter dich.«
»Also keine Erklärungen?«, fragte Pendergast. »Keine winselnden Rechtfertigungen, keine erbärmliche Bitte um Verständnis? Wie enttäuschend.« Der Finger krümmte sich am Abzug. Esterhazy schloss die Augen.
Und dann passierte es: ein plötzliches, überwältigend lautes Krachen. Esterhazy sah jäh aufblitzendes rötliches Fell, Geweihstangen – und dann brach der Hirsch durch das Schilf. Dabei streifte eine seiner Geweihstangen Pendergast und verfing sich an seiner Waffe, so dass sie im hohen Bogen ins Wasser fiel. Während der Hirsch davonsprang, geriet Pendergast ins Straucheln und schlug mit den Armen um sich. Da erkannte Esterhazy, dass Pendergast in ein Sumpfloch zu stürzen drohte, das lediglich von einer hauchdünnen Schicht Wasser überzogen war.
Esterhazy schnappte sich sein Gewehr vom Boden, zielte und schoss. Die Kugel traf Pendergast in die Brust, so dass er rücklings ins Sumpfloch geschleudert wurde. Esterhazy bereitete sich darauf vor, noch einen Schuss abzugeben. Doch einen zweiten Schuss, eine zweite Kugel – das würde er nicht erklären können. Wenn die Leiche überhaupt je gefunden wurde.
Er senkte das Gewehr. Pendergast kämpfte, der Sumpf hielt ihn fest, seine Kräfte schwanden bereits. Auf seiner Brust breitete sich ein dunkler Fleck aus. Die Kugel hatte ihn zwar nicht mitten in die Brust getroffen, aber sie hatte auch so verheerende Schäden angerichtet. Der Agent bot ein Bild des Jammers, die Kleider zerrissen und blutverschmiert, das helle Haar von Schlamm durchzogen und vom Regen dunkel geworden. Als er hustete, bildeten sich kleine Blutbläschen in seinen Mundwinkeln.
Das war’s. Esterhazy war Arzt und wusste, dass sein Schuss tödlich gewesen war. Die Kugel hatte die Lunge durchschlagen und eine klaffende Wunde hinterlassen, außerdem konnte es sein, dass die linke Schlüsselbeinschlagader zerfetzt worden war, so dass die Lunge sich schnell mit Blut füllte. Und selbst wenn Pendergast nicht unrettbar im Morast versank, er würde in wenigen Minuten ohnehin seiner Schussverletzung erliegen.
Pendergast, dem der Schlamm schon bis zur Hüfte reichte, kämpfte nicht mehr und blickte zu seinem Mörder hoch. Das eisige Funkeln in den blassgrauen Augen verriet mehr von dem Hass und der Verzweiflung, als Worte je hätten ausdrücken können, und traf Esterhazy bis ins Mark.
»Du willst eine Antwort auf deine Frage? Hier ist sie: Ich habe Helen gar nicht getötet. Sie ist noch am Leben.«
Aber er konnte es einfach nicht ertragen, auf das Ende zu warten, wandte sich ab und ging davon.
5
Das Jagdhotel ragte vor ihm auf, aus den Fenstern fiel ein verschwommenes gelbliches Licht und drang durch den strömenden Regen. Judson Esterhazy ergriff den Türklopfer aus schwerem Eisen, zog die Tür auf und betrat taumelnd die Diele, an deren Wänden Rüstungen standen und riesige Geweihe hingen.
»Hilfe! Helft mir!«
Es war Mittagszeit, die Hotelgäste standen vor einem knisternden Kaminfeuer in der großen Halle und tranken Kaffee und Tee sowie Malt aus kleinen Whiskygläsern. Sie wandten sich um und blickten ihn erstaunt an.
»Mein Freund ist erschossen worden!«
Ein dröhnender Donner übertönte kurz seine Stimme und rüttelte an den bleiverglasten Fenstern.
»Erschossen!«, wiederholte Esterhazy und sank auf dem Boden zusammen. »Ich brauche Hilfe!«
Nach einer Weile, während alle starr vor Entsetzen waren, kamen mehrere Personen zu ihm herübergeeilt. Auf dem Boden liegend, die Augen geschlossen, spürte Esterhazy, wie sich die Leute um ihn scharten, und hörte Geflüster.
»Treten Sie zurück«, ertönte die gestrenge schottische Stimme von Cromarty, dem Hotelpächter. »Er muss Luft bekommen. Treten Sie bitte zurück.«
Esterhazy wurde ein Glas Whisky an den Mund gehalten. Er trank einen Schluck, schlug die Augen auf und versuchte, sich aufzusetzen.
»Was ist denn passiert? Was wollen Sie sagen?«
Cromartys Gesicht – penibel gestutzter Vollbart, Metallgestellbrille, sandfarbenes Haar, kantiges Kinn – schwebte über ihm. Das Täuschungsmanöver war Esterhazy leichtgefallen. Er war tatsächlich von Entsetzen gepackt, ausgekühlt bis auf die Knochen, konnte sich kaum auf den Beinen halten. Er trank noch einen Schluck. Der torfige Malt kratzte zwar in der Kehle, weckte aber auch die Lebensgeister.
»Mein Schwager … wir waren auf Rotwild-Pirsch im Mire …«
»Im Mire?« Cromartys Tonfall klang plötzlich scharf.
»Ein kapitaler Bursche …« Esterhazy schluckte und versuchte, sich zusammenzureißen.
»Kommen Sie mit zum Kamin.« Cromarty fasste ihn am Arm und half ihm auf. Robbie Grant, der alte Wildhüter, kam in den Raum geeilt und ergriff Esterhazy am anderen Arm. Gemeinsam halfen sie ihm, die durchnässte, zerrissene Tarnjacke auszuziehen, und führten ihn zu einem Sessel am Kamin.
Esterhazy ließ sich darauf nieder.
»Sprechen Sie«, sagte Cromarty. Die anderen Gäste standen um sie herum, die Gesichter ganz weiß vor Schreck.
»Oben am Beinn Dearg. Wir hatten einen Rothirsch gesehen. Unten im Foulmire.«
»Aber Sie kennen doch die Vorschriften!«
Esterhazy schüttelte den Kopf. »Ja, gewiss, aber er war einfach gigantisch. Ein Dreizehnender. Mein Schwager hat darauf bestanden. Wir sind ihm bis tief ins Mire gefolgt. Bis hinunter zur Marsch. Dann haben wir uns getrennt –«
»Sind Sie denn von Sinnen?« Das fragte der Wildhüter, Robbie Grant, mit schriller Tenorstimme. »Getrennt haben Sie sich?«
»Wir mussten den Hirsch stellen. Ihn in Richtung Marsch treiben. Nebel zog auf, die Sicht war schlecht, er ist aus der Deckung gekommen … Da habe ich eine Bewegung gesehen und geschossen …« Esterhazy holte tief Luft. »Ich habe meinen Schwager mitten in die Brust getroffen …« Er schlug die Hände vors Gesicht.
»Sie haben einen Verletzten im Moor zurückgelassen?«, fragte Cromarty zornig.
»O Gott.« Esterhazy brach in unkontrolliertes Schluchzen aus. »Er ist in ein Sumpfloch gestürzt … ist darin eingesunken …«
»Moment.« Cromartys Stimme klang eiskalt. Langsam, leise, jedes einzelne Wort betonend, sagte er: »Wollen Sie mir weismachen, Sir, dass Sie ins Mire gegangen sind, dass Sie Ihren Schwager angeschossen haben und dass er in ein Sumpfloch gestürzt ist? Wollen Sie mir das erzählen?«
Esterhazy nickte wortlos. Er verbarg noch immer sein Gesicht.
»Herrgott noch mal. Kann es denn sein, dass er noch lebt?«
Esterhazy schüttelte den Kopf.
»Sind Sie ganz sicher?«
»Absolut sicher«, stieß Esterhazy keuchend hervor. »Er ist versunken. Es … es tut mir so leid!«, rief er klagend. »Ich habe meinen Schwager umgebracht!« Er schaukelte hin und her und hielt sich dabei die Hände an den Kopf. »Lieber Gott, verzeih mir!«
Betretenes Schweigen.
»Er hat den Verstand verloren«, sagte der Wildhüter leise. »Ein klarer Fall von Moorfieber.«
»Schaffen Sie die Leute raus«, sagte Cromarty unwirsch und wies auf die Gäste. Dann wandte er sich an den Wildhüter. »Robbie, ruf die Polizei.« Schließlich drehte er sich zu Esterhazy um. »Ist das hier das Gewehr, mit dem Sie Ihren Schwager angeschossen haben?« Er zeigte auf die Waffe, die Esterhazy mit hereingebracht hatte und die nun auf dem Boden lag.
Esterhazy nickte. Er fühlte sich so elend.
»Dass mir ja keiner etwas anrührt.«
Sich in gedämpftem Tonfall unterhaltend und kopfschüttelnd verließen die Gäste in murmelnden Grüppchen das Zimmer. Ein Blitz zuckte, gefolgt von knallendem Donner. Regentropfen prasselten gegen die Fensterscheiben. Esterhazy saß im Sessel, nahm langsam die Hände vom Gesicht und spürte, wie die angenehme Wärme des Kaminfeuers durch die nasse Kleidung drang. Eine ebenso wundersame Wärme kroch in sein Innerstes und verdrängte langsam den Horror. Erleichterung, ja Euphorie machte sich in ihm breit. Es war vorbei, vorbei, vorbei. Er hatte nichts mehr von Pendergast zu befürchten. Der Geist war zurück in der Flasche. Der Mann war tot. Und was Pendergasts Partner betraf, D’Agosta, und diese Polizistin aus New York, Hayward – durch den Mord an Pendergast hatte er der Schlange den Kopf abgeschlagen. Das war wirklich das Ende. Und allem Anschein nach kauften ihm die schottischen Einfaltspinsel seine Geschichte auch noch ab. Nichts konnte ans Licht kommen und irgendeine seiner Aussagen widerlegen. Er war zurückgegangen und hatte alle Patronenhülsen eingesammelt – bis auf die eine, die gefunden werden sollte. Pendergasts Gewehr und die Patronenhülsen der Schüsse, die sich während der Rangelei gelöst hatten, hatte er auf dem Rückweg in einem Sumpf versenkt, so dass sie niemals gefunden werden würden. Somit würde nur ein Rätsel bleiben: Wo war das Gewehr? Was aber erklärlich wäre. Ein Gewehr konnte durchaus dauerhaft verlorengehen, wenn es erst einmal im Mire versunken war. Die Leute wussten nichts von Pendergasts Pistole, sie hatte Esterhazy ebenfalls verschwinden lassen. Und die Spur des Hirschs ließ sich, sofern sie das Gewitter überstand, voll und ganz mit seiner Version der Geschichte in Einklang bringen.
»Verdammt noch mal«, murmelte Cromarty, ging zum Kaminsims, nahm sich eine Flasche Scotch und goss sich ein großes Glas voll. Er trank in kleinen Schlucken, schritt vor dem Kamin auf und ab und ignorierte Esterhazy.
Grant kehrte ins Zimmer zurück. »Die Polizei ist schon auf dem Weg, die Beamten kommen aus Inverness, Sir. Unterstützt von einem Spurensicherungsteam der Northern Constabulary. Und sie bringen Draggen mit.«
Cromarty drehte sich um, stellte das Glas ab, schenkte sich noch einen Whisky ein und sah Esterhazy wütend an. »Und Sie rühren sich nicht vom Fleck, bis die Beamten hier sind, Sie verfluchter Idiot.«
Noch ein Donnerschlag erschütterte das alte Jagdhotel aus Feldstein, während der Wind über die Moorlandschaft pfiff.
6
Die Polizei traf mehr als eine Stunde darauf ein; das zuckende Blaulicht der Einsatzfahrzeuge tauchte die mit Kies bestreute Auffahrt in grelles Licht. Das Gewitter war vorübergezogen, mittlerweile war der Himmel bleifarben, voll von schnell dahinziehenden Wolken. Die Polizeibeamten trugen blaue Regenjacken, Stiefel und wasserundurchlässige Hüte und stiefelten wichtigtuerisch durch die Diele mit den Steinwänden. Esterhazy sah ihnen von seinem Sessel aus zu und empfand es als beruhigend, dass sie phantasielos und behäbig wirkten.
Als Letzter betrat der leitende Beamte das Haus, er trug als Einziger keine Uniform. Esterhazy schaute ihn verstohlen an. Er war mindestens einen Meter neunzig groß und hatte eine Glatze mit einem Kranz heller Haare, ein hageres Gesicht und eine messerschmale Nase und hielt sich so stark nach vorn gebeugt, als ob er sich seinen Weg durchs Leben pflügte. Die Nase, die er gelegentlich mit einem Taschentuch betupfte, war gerade so rot, dass sie die seriöse äußere Erscheinung Lügen strafte. Er trug uralte Jagdkleidung: wasserabweisende Hose, enger Drillich-Pullover und eine offene, abgewetzte Barbourjacke.
»Hallo, Cromarty«, sagte er und streckte dem Pächter, der herbeigeeilt kam, locker die Hand entgegen.
Sie gingen zum anderen Ende des Zimmers und unterhielten sich leise, dabei blickten sie ab und zu in Esterhazys Richtung.
Schließlich kam der Polizeibeamte zu ihm herüber und setzte sich neben ihn in einen Ohrensessel. »Chief Inspector Balfour von der Northern Constabulary«, sagte er ruhig, bot ihm jedoch nicht die Hand, sondern beugte sich vor, die Ellbogen auf die Knie gelegt. »Und Sie sind also Doktor Judson Esterhazy?«
»Ganz recht.«
Balfour zog einen kleinen Stenoblock hervor. »Also gut, Doktor Esterhazy. Dann erzählen Sie doch mal, was passiert ist.«
Esterhazy erzählte seine Geschichte von Anfang bis Ende, wobei er oft innehielt, um sich zu sammeln oder seine Tränen zu unterdrücken. Balfour machte sich währenddessen Notizen. Als Esterhazy alles gesagt hatte, klappte Balfour den Notizblock zu. »Wir fahren jetzt zum Unfallort. Sie kommen mit.«
»Ich bin mir nicht sicher«, Esterhazy schluckte, »ob ich das durchstehe.«
»Aber ich«, sagte Balfour knapp. »Wir haben zwei Spürhunde dabei. Außerdem kommt Mr. Grant mit. Er kennt das Mire wie seine Westentasche.« Er stand auf und sah auf seine Uhr. »Uns bleiben noch fünf Stunden Tageslicht.«
Esterhazy stand auf. Seine Gesichtszüge verrieten, dass es ihm widerstrebte, mitzukommen. Draußen machten sich die Angehörigen des Suchteams mit Rucksäcken, Seilen und anderen Ausrüstungsgegenständen bereit. Am Ende der Kiesauffahrt führte ein Hundeführer zwei Spürhunde an der Leine auf einer Rasenfläche herum.
Eine Stunde darauf waren sie über den Berghang des Beinn Dearg hinwegmarschiert und am Rand des Foulmire eingetroffen, dessen sumpfige Abschnitte von einer unregelmäßigen Reihe von Felsen markiert wurden. Nebel lag über dem Moor. Die Sonne ging bereits unter, die endlose Landschaft verlor sich im grauen Nichts, die dunklen Sumpflöcher lagen still in der drückenden Luft, die leicht nach verwesenden Pflanzen roch.
»Doktor Esterhazy?« Balfour verschränkte die Arme vor der Brust und sah ihn stirnrunzelnd an. »Wo geht’s lang?«
Esterhazy blickte sich mit ausdrucksloser Miene um. »Es sieht alles so gleich aus.« Es hatte keinen Sinn, ihnen allzu sehr zu helfen.
Balfour schüttelte betrübt den Kopf.
»Die Hunde haben eine Fährte aufgenommen, hier drüben, Inspector.« Der Satz des Wildhüters, ausgesprochen mit einem starken schottischen Akzent, schwebte durch den Nebel. »Und ich sehe da auch was.«
»Ist das die Stelle, an der Sie ins Mire hineingegangen sind?«, fragte Balfour.
»Ich glaube, ja.«
»Also gut. Die Hunde gehen voran. Mr. Grant, Sie bleiben vorn bei ihnen. Ihr anderen folgt. Doktor Esterhazy und ich bilden den Schluss. Mr. Grant weiß, wo der Boden fest ist. Treten Sie stets in seine Fußstapfen.« Der Inspector holte gemächlich seine Pfeife hervor, die er sich eingesteckt hatte, und zündete sie an. »Und sollte jemand einsinken, rennt nicht gleich alle los wie die Trottel, sonst geht ihr selbst unter. Das Suchteam hat Seile, Rettungsringe und Teleskopstangen mit Haken, damit können wir jeden wieder rausholen, der in dem Matsch stecken geblieben ist.«
Er schmauchte seine Pfeife und sah sich um. »Mr. Grant, möchten Sie noch etwas hinzufügen?«
»Ja«, sagte der kleine, verhutzelte Mann, dessen Stimme fast so hoch wie die eines Mädchens klang, und stützte sich auf seinen Gehstock. »Wenn jemand von euch drin stecken bleibt, nicht strampeln. Ein wenig nach hinten lehnen und sich nach oben drücken lassen.« Er fixierte Esterhazy mit seinen Augen, die unter buschigen Brauen lagen, und funkelte ihn böse an. »Ich habe eine Frage an Doktor Esterhazy. Als Sie dem Hirsch durchs Mire hinterhergestiefelt sind, haben Sie da irgendwelche Landmarken gesehen?«
»Als da wären?« Esterhazys Tonfall klang verwirrt und unsicher. »Mir ist die Landschaft furchtbar leer vorgekommen.«
»Es gibt da Ruinen, Cairns und aufrecht stehende Felsbrocken.«
»Ruinen … ja, ich glaube, wir sind an ein paar Ruinen vorbeigekommen.«
»Und wie haben die ausgesehen?«
»Wenn ich mich recht entsinne«, Esterhazy runzelte die Stirn, als versuche er, sich zu erinnern, »war da ein Pferch aus Steinmauern und eine Hütte auf so einer Art Hügel, und links dahinter war, glaube ich, die Marsch.«
»Ah ja. Die alte Coombe-Hütte.« Und damit drehte sich der Wildhüter wortlos um und marschierte los durch das Gras, das Moos und die Heide, während die Spürhunde mit ihrem Führer sich beeilten, sein Tempo mitzuhalten. Er ging mit schnellen Schritten und gesenktem Kopf, schwang den Gehstock, stampfte mit seinen kurzen Beinen auf den Boden, das struppige Haar ragte wie ein weißer Kranz unter der Tweedmütze hervor.
Eine Viertelstunde lang marschierten sie schweigend weiter, die Stille lediglich unterbrochen vom Geschnüffel und Gejaule der Hunde und den leise gesprochenen Anweisungen ihres Führers. Als die Wolken sich erneut zusammenzogen und die Dämmerung sich verfrüht über die Moorlandschaft senkte, holten einige der Männer lichtstarke Taschenlampen hervor und schalteten sie an. Die Lichtstrahlen stachen durch den kalten Nebel. Esterhazy, der Unwissenheit und Verwirrung vorgetäuscht hatte, fragte sich langsam, ob sie sich vielleicht wirklich verlaufen hatten. Alles wirkte so fremd, und er erkannte nichts wieder.
Als sie abermals in eine verlassene Senke hinabstiegen, blieben die Hunde plötzlich stehen, liefen dann schnüffelnd im Kreis herum und stürmten schließlich, an den Leinen zerrend, auf eine Fährte los.
»Ruhig«, sagte der Hundeführer und zog an den Leinen, aber die Hunde waren zu aufgeregt und fingen zu bellen an – kehlige Laute, die weit über das Moor hallten.
»Was ist denn los mit den Hunden?«, fragte Balfour schroff.
»Ich weiß es nicht. Zurück. Zurück!«
»Um Himmels willen«, rief Grant schrill, »haltet sie zurück!«
»Verflucht noch mal!« Der Hundeführer zog an den Leinen, aber die Hunde reagierten, indem sie mit voller Kraft nach vorn stürmten.
»Passen Sie auf, da!«, rief Grant.
Mit einem Aufschrei blanken Entsetzens versank der Hundeführer plötzlich in einem Schwingmoor. Er brach durch die Kruste aus Torfmoos, schlug mit den Armen um sich und zappelte. Gleichzeitig mit ihm sank einer der Hunde ein, dessen Gebell sich in ein schrilles Gejaule verwandelte. Er paddelte mit den Vorderläufen und hielt den Kopf vor Angst hochgereckt.
»Hören Sie auf zu zappeln!«, brüllte Grant den Hundeführer an. Fast wäre sein Ausruf im Angstgejaule des Hundes untergegangen. »Lehnen Sie sich zurück!«
Doch der Hundeführer hatte derart panische Angst, dass er ihm keine Beachtung schenkte. »Helft mir!«, schrie er, während er weiter mit den Armen um sich schlug, so dass der Matsch in alle Richtungen spritzte.
»Holt die Stange!«, befahl Balfour.
Ein Angehöriger des Spurensicherungsteams hatte bereits seinen Rucksack abgelegt und war dabei, eine Stange mit einem großen runden Griff am einen Ende und einer breiten Schlinge aus Seil am anderen aufzuschnüren. Er ließ die Stange wie ein Teleskop aufschnappen und kniete sich am Rand des Sumpfs hin, schlang sich das Seil um die Taille und hielt dem Hundeführer das Ende mit dem Griff hin.
Der Hund jaulte und paddelte.
»Helft mir!«, rief der Hundeführer, der im Sumpf feststeckte.
»Packen Sie den Griff, Sie verdammter Idiot!«, rief Grant.
Diese schrille Anweisung schien beim Hundeführer anzukommen. Er streckte den Arm aus und packte den Griff am Ende der Teleskopstange.
»Ziehen Sie!«
Der Retter lehnte sich zurück und setzte sein ganzes Körpergewicht ein, um den Hundeführer aus dem Sumpf zu ziehen. Der Führer klammerte sich verzweifelt an den Griff. Langsam und unter lauten Sauggeräuschen tauchte der Mann auf und wurde auf festeren Boden gezogen, wo er, über und über bedeckt mit klebrigem Morast, zitternd und nach Luft schnappend liegen blieb.
Währenddessen stieß der Hund ein gespenstisches Geheul aus und paddelte und schlug mit den Vorderläufen auf den Sumpf ein.
»Werfen Sie ihm die Schlinge über den Vorderleib!«, schrie Grant.
Einer der Männer knüpfte sein Seil bereits zu einer Schlinge. Er warf sie dem Hund entgegen, aber nicht weit genug. Der Hund kämpfte und jaulte und verdrehte derart die Augen, dass das Weiße zu sehen war.
»Noch mal!«
Der Mann warf das Seil noch einmal aus, und diesmal fiel die Schlinge über den Hund.
»Festzurren und ziehen!«
Der Mann zog, aber als der Hund das Seil um seinen Hals spürte, wand und wehrte er sich so sehr dagegen, dass es von ihm abglitt.
Esterhazy schaute zu, ebenso entsetzt wie fasziniert.
»Er versinkt!«, sagte der Hundeführer, der sich langsam von seinem Schreck erholt hatte.
Ein anderer Beamter bereitete eine Schlinge vor, diese war mit einem Laufknoten im Stil eines Lassos versehen. Er kniete am Rand des Sumpflochs nieder und warf das Seil vorsichtig aus. Daneben. Er holte das Seil ein, lockerte die Schlinge und machte Anstalten, das Lasso nochmals auszuwerfen.
Doch der Hund versank immer schneller. Inzwischen ragte nur noch der Hals aus dem Sumpf, jede Sehne gespannt, das Maul eine rosafarbene Höhle, aus der ein Laut drang, der jedes Jaulen überstieg und sich in etwas verwandelte, das nicht von dieser Welt war.
»Um Himmels willen – so unternehmen Sie doch etwas!«, rief der Hundeführer.
Uuuhuuu! Uuuhuuu!, jaulte der Hund fürchterlich laut.
»Noch mal! Werfen Sie das Lasso noch mal aus!«
Wieder warf der Mann das Lasso, wieder daneben.
Und dann herrschte plötzlich – ohne jedes Gurgeln – Stille. Das letzte erstickte Jaulen des Hundes hallte über die Moorlandschaft und verklang. Der Sumpf schloss sich über ihm, die Oberfläche war wieder glatt. Ein leichtes Zittern durchlief das Sumpfloch, dann war alles still.
Der Hundeführer, der aufgestanden war, sank auf die Knie zurück. »Mein Hund! O Jesus Christus!«
Balfour blickte ihm fest in die Augen und sagte ruhig, aber mit großem Nachdruck: »Es tut mir sehr leid. Aber wir müssen weiter.«
»Aber Sie können den Hund doch nicht einfach zurücklassen!«
Balfour wandte sich zum Wildhüter um. »Mr. Grant, führen Sie uns zur Coombe-Hütte. Und Sie, Sir, holen bitte Ihren zweiten Spürhund her. Wir werden ihn noch benötigen.«
Ohne viel Aufhebens setzten sie sich wieder in Bewegung. Der Hundeführer, von dem der Schlamm nur so herabtropfte und dessen Füße in den Schuhen quatschten, ging mit dem verbliebenen Spürhund vorneweg, der allerdings so sehr zitterte, dass er für die Arbeit nicht mehr zu gebrauchen war. Grant marschierte wieder auf seinen Stummelbeinen voraus und schwang seinen Stock, wobei er nur gelegentlich stehen blieb, die Spitze mit Wucht in den Boden hieb und irgendwelches unwirsches Gebrumm von sich gab.
Zu Esterhazys Erstaunen hatten sie sich doch nicht verlaufen. Das Gelände stieg an, im schwachen Licht zeichneten sich die verfallene Hütte und der Pferch ab.
»Wo geht’s lang?«, fragte Grant ihn.
»Wir sind da durchgegangen und auf der anderen Seite runter.«
Sie stiegen die Hügel hinauf und gingen an den Ruinen vorbei.
»Hier, glaube ich, haben wir uns getrennt«, sagte Esterhazy und zeigte auf die Stelle, an der er von Pendergasts Spur abgewichen war, um ihn von der Flanke anzugreifen.
Nachdem er den Boden inspiziert hatte, brummte der Wildhüter irgendetwas und nickte.
»Gehen Sie voran«, sagte Balfour.
Esterhazy übernahm die Führung, dichtauf gefolgt von Grant, der eine starke Stablampe in der Hand hielt. Der gelbliche Lichtstrahl stach durch den Nebel und erhellte das Schilf und das Röhricht am Rand der Marsch.
»Hier.« Esterhazy blieb stehen. »Genau hier … ist er versunken.« Er zeigte auf das stille Sumpfloch an der Schwelle zur Marsch. Seine Stimme brach, er schlug die Hände vors Gesicht und schluchzte. »Es war ein Alptraum. Gott verzeih mir.«
»Alle zurückbleiben!« Balfour gebot den Leuten aus seinem Team Einhalt. »Wir stellen Scheinwerfer auf. Und Sie, Doktor Esterhazy, zeigen uns jetzt mal genau, was passiert ist. Die Forensiker untersuchen erst den Boden, danach suchen wir das Sumpfloch ab.«
»Sie wollen das Sumpfloch absuchen?«, fragte Esterhazy.
Balfour sah ihn wenig freundlich an. »Ganz genau. Um die Leiche zu bergen.«
7
Esterhazy wartete hinter dem auf dem Boden ausgelegten gelben Absperrband, während die Angehörigen des forensischen Teams – nach vorn gebeugt wie alte Frauen und im Schein einer Batterie greller Scheinwerfer, die die karge Landschaft in ein gespenstisches Licht tauchten – das Areal nach Beweismitteln durchkämmten.
Er hatte die Suche nach Beweisen mit wachsender Befriedigung verfolgt. Es war alles in Ordnung. Das Suchteam hatte die eine Messing-Patronenhülse gefunden, die er ganz bewusst zurückgelassen hatte, und trotz des starken Regens war es den Männern gelungen, einige undeutliche Spuren des Hirschs zu finden und einige Abdrücke im Heidekraut zu kartographieren, die von ihm selbst und Pendergast stammten. Darüber hinaus hatten die Männer jene Stelle gefunden, an der der Hirsch aus dem Schilf hervorgebrochen war. Alles stimmte mit der Geschichte überein, die er der Polizei erzählt hatte.
»Okay, Männer«, rief Balfour. »Packt eure Sachen zusammen, wir suchen jetzt das Sumpfloch ab.«
Esterhazy verspürte tief in sich Vorfreude wie auch Widerwillen. So grausig das Bevorstehende auch war, es wäre eine Erleichterung, mit anzusehen, wie der Leichnam seines Widersachers aus dem Schlamm gezogen wurde. Denn es wäre das Schlusskapitel der ganzen Geschichte, der Epilog zum Kampf der Titanen.
Auf einem Blatt Millimeterpapier hatte Balfour die Maße des Sumpflochs – klein, ungefähr dreieinhalb mal fünf Meter – skizziert und ein Schema eingezeichnet, nach dem es abgesucht werden sollte. Im grellen Schein der Scheinwerfer hakten die Angehörigen des Spurensicherungsteams einen klauenartigen Draggen an ein Seil – die langen stählernen Zinken funkelten fast bösartig – und brachten anschließend ein Bleigewicht an der Öse an. Zwei Männer traten einen Schritt zurück und hielten die Seilrolle, während sich ein dritter am Rand des Sumpfbeckens aufstellte. Während Balfour seine Zeichnung konsultierte und leise Anweisungen gab, warf der dritte Mann den Haken über dem Sumpf aus. Der Haken landete im Morast auf der anderen Seite, das Gewicht zog ihn nach unten. Als er schließlich auf dem Grund zum Liegen kam, begannen die beiden hinteren Männer, den Draggen wieder einzuholen. Während dieser ganz langsam durch das Sumpfbecken gezogen wurde, das Seil sich straffte und spannte, verkrampfte sich Esterhazy gegen seinen Willen.
Eine Minute später kam der Draggen an die Oberfläche, voller Schlamm und Unkraut. Das Klemmbrett in der einen Hand, untersuchte Balfour mit der anderen latexbehandschuhten Hand die Zinken und schüttelte den Kopf.
Die Männer stellten sich einen halben Meter weiter zur einen Seite auf, warfen den Draggen wieder aus, holten ihn wieder ein. Erneut Unkraut. Sie rückten wieder einen halben Meter zur Seite und wiederholten die Prozedur.
Während Esterhazy jedes Auftauchen des mit Schlamm überzogenen Draggens verfolgte, verspürte er ein zunehmend unangenehmes Gefühl in der Magengegend. Es schmerzte ihn überall, außerdem pochte die Hand, in die Pendergast ihn gebissen hatte. Die Männer näherten sich der Stelle, an der Pendergast eingesunken war. Schließlich wurde der Draggen genau über dieser Stelle abgeworfen, und das Team begann, ihn wieder einzuholen.
Der Draggen verfing sich an etwas unter der Oberfläche.
»Wir haben was gefunden«, sagte einer der Männer.
Esterhazy stockte der Atem.
»Vorsichtig jetzt«, sagte Balfour und beugte sich vor, sein Körper gespannt wie ein Flitzebogen. »Langsam und gleichmäßig.«
Ein weiterer Mann gesellte sich zur Seilmannschaft. Gemeinsam begannen die Männer, das Seil Hand über Hand einzuholen, während Balfour danebenstand und sie drängte, es ruhig angehen zu lassen.
»Das Ding kommt hoch«, brummte einer der Männer.
Die Oberfläche des Sumpflochs hob sich, der Schlamm schwappte zu den Seiten, und dann kam ein langer, baumstammähnlicher Gegenstand zum Vorschein, von Morast überzogen, unförmig.
»Macht ganz langsam«, sagte Balfour warnend.
So, als zögen sie einen großen Fisch an Land, hielten die Männer den Leichnam an der Oberfläche, während sie gleichzeitig Nylongurte und ein Netz darunterlegten.
»Alles klar. Holt ihn raus.«
Unter verstärkter Kraftanstrengung zogen sie den Leichnam vorsichtig heraus und legten ihn auf eine Plastikplane. Der Schlamm lief in dicken Rinnsalen daran hinunter. Plötzlich schlug ein derart grässlicher Gestank nach verfaultem Fleisch über Esterhazy zusammen, dass er jählings einen Schritt zurücktrat.
»Was zum Donnerwetter?«, murmelte Balfour. Er beugte sich über den Leichnam, betastete ihn mit seiner behandschuhten Hand, dann wies er einen seiner Leute an: »Spülen Sie das hier ab.«
Ein Angehöriger des Spurensicherungsteams kam herüber. Gemeinsam beugten sie sich über den missgestalteten Kopf des Tierkadavers, dann wusch der Mann den Matsch mit einer Sprühflasche ab.
Der Gestank war derart ekelerregend, dass Esterhazy die Galle hochkam. Mehrere der Männer zündeten sich hastig Zigaretten oder Pfeifen an.
Balfour richtete sich abrupt auf. »Das ist ein Schaf«, sagte er sachlich. »Zieht es beiseite und spült den Bereich hier ab, dann machen wir weiter.«
Die Männer arbeiteten schweigend, und schon bald war der Fanghaken zurück im Sumpf. Wieder und wieder suchten sie das Sumpfloch ab, wieder und wieder tauchten die Klauen des Hakens aus dem Morast auf, lediglich mit Unkraut versehen. Der Gestank des verwesten Schafs, das hinter ihnen lag, legte sich wie ein Sargtuch über die Szenerie. Esterhazy konnte seine nervöse innere Anspannung kaum noch ertragen. Wieso fanden diese Leute die Leiche nicht?
Sie gelangten zum anderen Ende des Sumpflochs. Balfour rief seine Männer ein wenig abseits zu einer Besprechung zusammen. Anschließend ging er zu Esterhazy hinüber. »Sind Sie sicher, dass Ihr Schwager hier versunken ist?«
»Natürlich.« Esterhazy versuchte, seine Stimme im Griff zu behalten, die kurz davor war zu brechen.
»Aber anscheinend finden wir nichts.«
»Er ist da unten!« Esterhazy hob die Stimme. »Sie haben doch selbst die Patronenhülse aus meiner Waffe und die Abdrücke im Gras gefunden – Sie wissen, dass das hier die richtige Stelle ist.«
Balfour sah ihn forschend an. »Das scheint tatsächlich der Fall zu sein, aber …«
»Sie müssen ihn finden! Um Himmels willen, suchen Sie das Sumpfloch noch einmal ab!«
»Das haben wir auch vor, aber Sie haben ja selbst gesehen, wie gründlich wir vorgegangen sind. Wenn sich dort unten eine Leiche befindet …«
»Die Strömungen«, sagte Esterhazy. »Vielleicht wurde er von einer Strömung fortgetrieben.«
»Es gibt hier keine Strömungen.«
Esterhazy versuchte verzweifelt, sich in den Griff zu bekommen, und atmete tief durch. Er bemühte sich, ruhig zu sprechen, bekam das Zittern aber nicht ganz aus seiner Stimme heraus. »Schauen Sie, Mr. Balfour. Ich weiß, dass die Leiche dort unten liegt. Ich habe gesehen, wie er untergegangen ist.«
Ein knappes Nicken, dann wandte sich Balfour zu seinen Leuten um. »Sucht den Sumpf noch einmal ab, diesmal im rechten Winkel.«
Leises Protestgemurmel. Trotzdem begann die Suche wieder von vorn. Der Draggen wurde von der anderen Seite ins Sumpfloch geworfen, während Esterhazy, dem die Galle fast bis zum Hals stand, die Prozedur verfolgte. Während das letzte Licht aus dem Himmel wich und der Nebel dichter wurde, warfen die Scheinwerfer gespenstische weiße Lichtstrahlen, in denen sich mehrere Gestalten bewegten, verschwommene, bizarre Schatten, als seien sie Verdammte, die im untersten Kreis der Hölle umgingen. Das kann doch gar nicht sein, dachte Esterhazy. Es war ausgeschlossen, dass Pendergast überlebt hatte und geflohen war. Völlig ausgeschlossen.
Er hätte warten sollen. Er hätte bis zum bitteren Ende warten sollen … Er drehte sich zu Balfour um. »Schauen Sie, ist es denn überhaupt möglich, dass jemand da herauskommen, sich aus einem derartigen Sumpf herausziehen kann?«