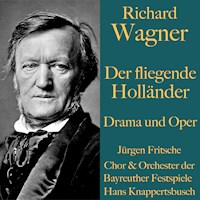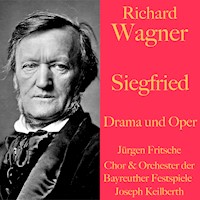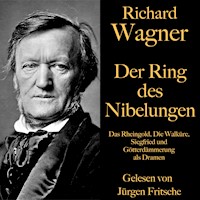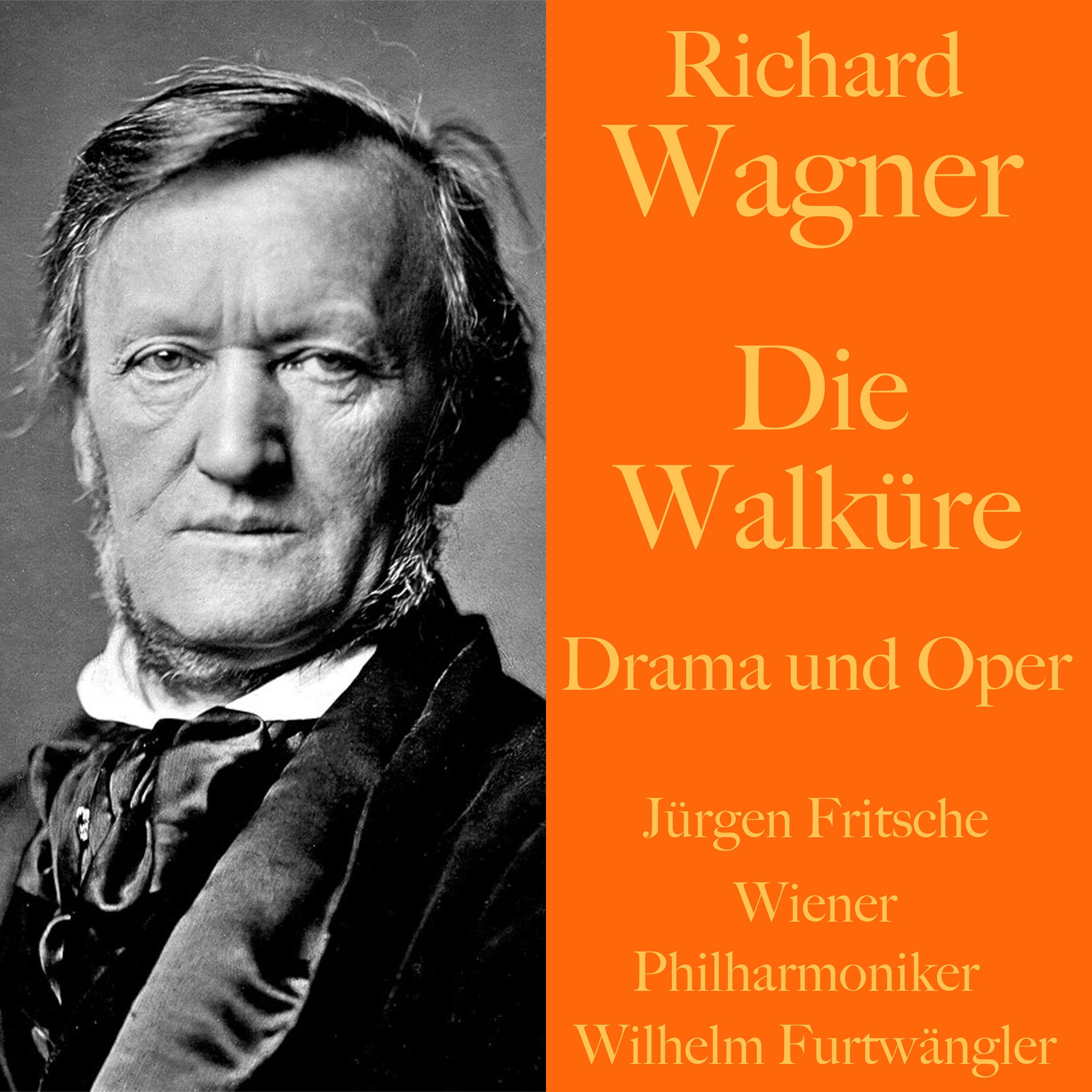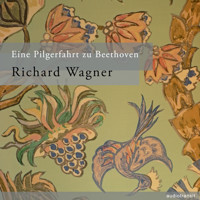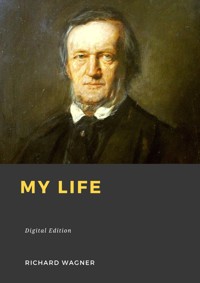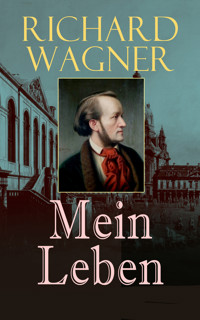Richard Wagner: Mein Leben – Teil zwei - 1 – Band 231 in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski E-Book
Richard Wagner
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: gelbe Buchreihe
- Sprache: Deutsch
Der von 1813 bis 1883 lebende Oper-Komponist Richard Wagner erzählt in diesem Buch aus seinem interessanten Leben. In Leipzig geboren, studierte er auch dort Musik. Er lebte und arbeitete danach in Würzburg, Magdeburg, Königsberg und Riga. Über eine dramatische Seereise kam er nach London und von dort nach Paris, wo er von 1839, total verarmt und verschuldet in elenden Verhältnissen vegetierte. Die triumphale Uraufführung des "Rienzi" am 20. Oktober 1842 in Dresden legte den Grundstein zu seinem Ruhm. 1843 wird er zum königlich-sächsischen Hofkapellmeister ernannt. 1849 kämpfte er beim Dresdner Maiaufstand auf der Seite der Aufständischen und musste anschließend in die Schweiz flüchten. Bis 1858 wohnte er in Zürich, die nächsten Jahre verbrachte er mit kurzen Aufenthalten an verschiedenen Orten: Venedig, Luzern, Wien, Paris, Biebrich (bei Wiesbaden), Berlin. 1864 errang er die Gunst des bayrischen Königs Ludwig II., der seine Schulden bezahlte und ihn auch weiterhin unterstützte. Da Wagner versuchte, sich in die bayrische Politik einzumischen, wurde er zeitweise aus München verbannt und zog nach Genf, dann nach Tribschen (bei Luzern). 1872 ging er nach Bayreuth und legte den Grundstein für das Festspielhaus, das 1876 eingeweiht wurde. Zur Wiederherstellung seiner Gesundheit zog Wagner 1882 nach Venedig, wo er 1883 starb. – Rezession: Ich bin immer wieder begeistert von der "Gelben Buchreihe". Die Bände reißen einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeit-Epochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Richard Wagner
Richard Wagner: Mein Leben – Teil zwei - 1 – Band 231 in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski
Band 231 in der gelben Buchreihe
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort des Herausgebers
Der Autor Richard Wagner
Richard Wagner: Mein Leben – erster Band – Beginn
Richard Wagners Vorwort
Erster Teil – 1813 – 1842
Zweiter Band
Dritter Teil – 1850 – 1861
1852
1853
1854
1855
1857
1858
1859
Die maritime gelbe Buchreihe
Weitere Informationen
Impressum neobooks
Vorwort des Herausgebers
Vorwort des Herausgebers
Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannesheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuß der Hamburger Michaeliskirche.
Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.
Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leser-Reaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band der „Seemannesschicksal“ weitere.
* * *
Diese Texte in Richard Wagners Autobiographie lesen sich teilweise durch ihre sehr langen und verschachtelten Sätze sehr kompliziert, so dass ich mich bei der Bearbeitung sehr konzentrieren musste.
* * *
2023 Jürgen Ruszkowski
Ruhestandes-Arbeitsplatz
Hier entstehen die Bücher und Webseiten des Herausgebers
* * *
Der Autor Richard Wagner
Der Autor Richard Wagner
https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/wagner.html
Wilhelm Richard Wagner, * 22. Mai 1813 in Leipzig – † 13. Februar 1883 in Venedig, war ein deutscher Komponist, Dramatiker, Dichter, Schriftsteller, Theaterregisseur und Dirigent. Mit seinen durchkomponierten Musikdramen gilt er als einer der bedeutendsten Komponisten der Romantiköniglichen
* * *
Geboren am 22. Mai 1813 in Leipzig; gestorben am 13. Februar 1883 in Venedig. Wagner war das jüngste von neun Kindern eines Polizeiaktuarius. Fünf Monate nach seiner Geburt starb der Vater; der Schauspieler und Maler Ludwig Geyer nahm sich der Witwe und der Kinder an (starb aber auch bereits 1821). Wagner begann 1831 an der Universität Leipzig ein Musikstudium, 1833 holte der Sänger Albert Wagner den jüngeren Bruder nach Würzburg, dort wurde er Chor-Einstudierer. Im Sommer 1834 engagierte ihn eine Operntruppe als Dirigenten nach Magdeburg; dort verliebte er sich in die Schauspielerin Minna Planer: er folgte ihr nach Königsberg, wo sie 1836 heirateten, dann nach Riga; vor ihren Gläubigern flüchteten sie über Norwegen und London nach Paris, wo sie von September 1839 bis April 1842 in großer Not lebten. Die triumphale Uraufführung des „Rienzi“ am 20. Oktober 1842 in Dresden legte den Grundstein zu seinem Ruhm. 1843 wird er zum königlich sächsischen Hofkapellmeister ernannt.
1849 kämpfte er beim Dresdner Maiaufstand auf der Seite der Aufständischen und musste anschließend in die Schweiz flüchten. Bis 1858 wohnte er in Zürich, die nächsten Jahre verbrachte er mit kurzen Aufenthalten an verschiedenen Orten: Venedig, Luzern, Wien, Paris, Biebrich (bei Wiesbaden), Berlin. 1864 errang er die Gunst des bayrischen Königs Ludwig II., der seine Schulden bezahlte und ihn auch weiterhin unterstützte. Da Wagner versuchte, sich in die bayrische Politik einzumischen, wurde er zeitweise aus München verbannt und zog nach Genf, dann nach Tribschen (bei Luzern). 1872 ging er nach Bayreuth und legte den Grundstein für das Festspielhaus, das 1876 eingeweiht wurde. Zur Wiederherstellung seiner Gesundheit zog Wagner 1882 nach Venedig, wo er 1883 starb.
* * *
Richard Wagner: Mein Leben – erster Band – Beginn
Richard Wagner: Mein Leben – erster Band – Beginn
https://www.projekt-gutenberg.org/wagner/meinleb1/meinleb1.html
* * *
1911 im Verlag F. Bruckmann A-G in München erschienen
* * *
Richard Wagners Vorwort
Richard Wagners Vorwort
Die in diesem Band enthaltenen Aufzeichnungen sind im Lauf verschiedener Jahre von meiner Freundin und Gattin, welche mein Leben von mir sich erzählt wünschte, nach meinen Diktaten unmittelbar niedergeschrieben worden. Uns beiden entstand der Wunsch, diese Mitteilungen über mein Leben unserer Familie, sowie bewährten treuen Freunden zu erhalten, und wir beschlossen deshalb, um die einzige Handschrift vor dem Untergang zu bewahren, sie auf unsere Kosten in einer sehr geringen Anzahl von Exemplaren durch Buchdruck vervielfältigen zu lassen. Da der Wert der hiermit gesammelten Autobiographie in der schmucklosen Wahrhaftigkeit beruht, welche unter den bezeichneten Umständen meinen Mitteilungen einzig einen Sinn geben konnte, deshalb auch meine Angaben genau mit Namen und Zahlen begleitet sein mussten, so könnte von einer Veröffentlichung derselben, falls bei unseren Nachkommen hierfür noch Teilnahme bestehen dürfte, erst einige Zeit nach meinem Tod die Rede sein; und hierüber gedenke ich testamentarische Bestimmungen für meine Erben zu hinterlassen. Wenn wir dagegen für jetzt schon einzelnen zuverlässigen Freunden den Einblick in diese Aufzeichnungen nicht vorenthalten, so geschieht dies in der Voraussetzung einer reinen Teilnahme für den Gegenstand derselben, welche namentlich auch ihnen es frevelhaft erscheinen lassen würde, irgendwelche weitere Mitteilungen aus ihnen an solche gelangen zu lassen, bei welchen jene Voraussetzung nicht gestaltet sein dürfte.
Richard Wagner
* * *
Erster Teil – 1813 – 1842
Erster Teil – 1813 – 1842
Wagners Geburtshaus in Leipzig
Leipzig Brühl
Am 22. Mai 1813 in Leipzig auf dem Brühl im „rot und weißen Löwen“, zwei Treppen hoch, geboren, wurde ich zwei Tage darauf in der Thomaskirche mit dem Namen Wilhelm Richard getauft.
Thomaskirche Leipzig
Mein Vater Friedrich Wagner, zur Zeit meiner Geburt Polizeiaktuarius in Leipzig, mit der Anwartschaft auf die Stelle des Polizeidirektors daselbst, starb im Oktober des Jahres meiner Geburt infolge großer Anstrengungen, welche ihm die überhäuften polizeilichen Geschäfte während der kriegerischen Unruhen und der Schlacht bei Leipzig zuzogen, durch Ansteckung des damals epidemisch gewordenen Nervenfiebers…
* * *
Band eins endet:
…Frau Taylor hatte sich mit der Klage über den „von mir beabsichtigten Ehebruch“ an meine Frau gewandt, dieser ihr Mitleiden gemeldet und ihre Unterstützung angeboten; die arme Minna, die nun plötzlich meinen Entschluss, von ihr fern zu bleiben, einem bis dahin von ihr nicht geargwöhnten Grund beimessen musste, wendete sich deshalb wieder klagend an Frau Taylor zurück. Hierbei hatte ein merkwürdiges Missverständnis als absichtlich angewandte Lüge mitgespielt: in einem launigen Gespräch hatte mir nämlich einmal Jessie gesagt, sie gehöre keiner anerkannten Konfession an, da ihr Vater einer besonderen Sekte angehört habe, welche weder nach dem protestantischen, noch nach dem katholischen Ritus taufe; worauf ich sie damit tröstete, dass auch ich schon mit wohl weit bedenklicheren Sekten in Berührung gekommen sei, da ich kurz nach meiner Trauung erfahren habe, dass diese in Königsberg von einem Mucker vollzogen worden wäre. Gott weiß, in welchem Sinn dies der würdigen englischen Matrone mitgeteilt worden war, kurz, sie hatte meiner Frau berichtet: ich hätte erklärt, ich sei gar nicht in gültiger Weise mit ihr getraut. Jedenfalls mochten die Rückäußerungen meiner Frau wiederum genügenden Stoff an die Hand gegeben haben, um auch Jessie in dem beabsichtigten Sinn über mich aufzuklären, und der Wirkung hiervon verdankte ich den sonderbaren Brief an meinen jungen Freund. Ich muss gestehen, dass mich nach dieser Einsicht der Dinge zuallernächst nur die Misshandlung meiner Frau empörte, und während ich nach jener Seite zu gänzlich gleichgültig darüber blieb, was man von mir meine, nahm ich sofort das Anerbieten Karls an, nach Zürich zu gehen und meine Frau aufzusuchen, um ihr die nötigen Aufklärungen zu ihrer eigenen Beruhigung zu geben. – Während ich seine Rückkunft erwartete, erhielt ich einen Brief Liszts, welcher mir den großen und auf seine ganze Gesinnung über mich und meine Zukunft entscheidenden Eindruck meldete, welchen das genaue Bekanntwerden mit der Partitur meines „Lohengrin“ auf ihn hervorgebracht. Er zeigte mir zugleich an, dass er, da ich ihm hierzu die Erlaubnis gegeben habe, mit Anspannung aller Kräfte eine Aufführung meines Werkes zur Feier des bevorstehenden Herder-Festes in Weimar in Angriff zu nehmen beabsichtige. Fast gleichzeitig schrieb mir Frau Ritter, welche im Betreff der von ihr vollkommen verstandenen Vorgänge mich wohl bitten zu müssen glaubte, dass ich diese Angelegenheit mir nicht zu sehr zu Herzen nähme. Nun kam auch Karl von Zürich zurück und sprach mit großer Wärme über das Verhalten meiner Frau. Sie habe sich, nachdem sie mich in Paris nicht angetroffen, mit seltener Energie zu fassen gewusst, nach meinem früheren Wunsch eine geräuschlose Wohnung am Züricher See gemietet und geschickt eingerichtet und sei dort verblieben, in der Hoffnung, endlich doch wieder von mir zu hören. Außerdem erzählte er mir einiges Gescheite und Freundschaftliche von Sulzer, welcher mit großer Teilnahme meiner Frau zur Seite gestanden habe. Plötzlich brach Karl aus: „Ach, das wären doch noch Menschen; mit solch einer verrückten Engländerin sei dagegen nichts anzufangen.“ Ich sagte zu alledem kein Wort und fragte ihn endlich nur lächelnd, ob er denn etwa gern nach Zürich übersiedeln möchte? Er sprang auf: „Ach ja! Heute lieber als morgen!“ „Du sollst deinen Willen haben“, sagte ich, „lass uns einpacken; ich sehe doch in allem keinen Sinn, möge es dort oder hier sein.“ Ohne ein Wort weiter über alle diese Dinge zu sprechen, reisten wir anderen Tages nach Zürich ab.
* * *
Zweiter Band
Zweiter Band
* * *
Titel und Einband gezeichnet von Heinrich Wieynk.
Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig
Dritter Teil – 1850 – 1861
Dritter Teil – 1850 – 1861
Mit gutem Glück hatte Minna bei Zürich eine Wohnung aufgefunden, welche wirklich den bei meinem Fortgang von mir so dringend geäußerten Wünschen recht geeignet entsprach. Es war dies in der Gemeinde Enge, eine gute Viertelstunde Wegs von der Stadt Zürich, in einem unmittelbar am See gelegenen Grundstück mit altbürgerlichem Wohnhaus, zum „Abendstern“ benannt und einer gutartigen alten Dame, Frau Hirzel, gehörig, wo für einen nicht teuren Mietpreis der abgeschlossene, sehr ruhige obere Stock dürftige, aber ausreichende Bequemlichkeit verlieh. Ich traf am frühen Morgen ein, fand Minna noch im Bett und vermochte sie, welche sich vor allem gegen die Annahme, dass ich nur aus Mitleid zu ihr zurückgekehrt sei, zu versichern suchte, schnell dahin zu bestimmen, nie wieder über das Vorgefallene sich mit mir besprechen zu wollen. Im Übrigen war sie ganz in ihrer Sphäre, als sie mir die Fortschritte ihrer geschickten Einrichtung zeigte; und da wir von hier an in einer, wenn auch von mannigfachen Schwierigkeiten unterbrochenen, im Ganzen aber durch längere Jahre sich doch behauptenden Zunahme unserer äußeren Verhältnisse uns befanden, breitete sich bald eine erträgliche Heiterkeit über unser häusliches Leben aus, ohne dass ich jedoch von jetzt an eine unruhige, oft heftig hervortretende Neigung zum Abbruch alles Gewohnten gänzlich unterdrücken konnte.
Zunächst halfen die beiden Haustiere, Peps und Papo außerordentlich wirksam zum häuslichen Behagen; beide liebten mich vorzüglich, oftmals bis zur Belästigung: Peps musste immer hinter mir auf dem Arbeitsstuhl liegen und Papo flatterte, wenn ich zu lange aus dem Wohnzimmer ausblieb, nach wiederholtem vergeblichem Rufen meines Namens „Richard!“ gewöhnlich zu mir in das Arbeitszimmer, wo er sich auf dem Schreibtisch aufstellte und mit Federn und Papier oft sehr aufregend sich zu schaffen machte. Er war so wohl erzogen, dass er nie einen tierischen Vogellaut von sich gab, sondern nur sprechend und singend sich vernehmen ließ. Mit dem großen Marsch-Thema des Schluss-Satzes der C-Moll Symphonie, dem Anfang der achten Symphonie in F-Dur, oder auch einem festlichen Thema aus der Rienzi-Ouvertüre, empfing er mich stets pfeifend, sobald er auf der Treppe meine Schritte hörte. Das Hündchen Peps zeichnete sich dagegen durch eine ungemeine Nervosität aus; er hieß bei meinen Freunden „Peps der Aufgeregte“, und es gab Zeiten wo man nie ein freundliches Wort zu ihm sprechen konnte, ohne ihn in Heulen und Schluchzen zu versetzen. Diese Tiere vertraten offenbar die fehlenden Kinder, und dass auch meine Frau ein fast leidenschaftliches Wohlwollen für sie empfand, bildete ein nicht unergiebiges Band des Einvernehmens zwischen uns; wogegen ein ewiger Quell von Misshelligkeiten sich in dem Verhalten meiner Frau zu der unglücklichen Natalie dahinzog. Sie hat bis zu ihrem Tod die wunderliche Verschämtheit gehabt, selbst dem Mädchen nicht zu entdecken, dass sie ihre Tochter sei. Diese hielt sich nun fortwährend für Minnas Schwester und begriff als solche nicht, warum sie sich nicht ebenbürtig behandelt sehen sollte. Indem Minna sich stets die Autorität der Mutter zuerkannte, gab sie hierfür stets dem Ärger über Natalies auffallende Missgeratenheit nach; sie war jedenfalls in dem entscheidenden Alter verzogen und vernachlässigt, körperlich und geistig schwerfällig unterrichtet geblieben: klein, und mit Neigung zur Stärke, war sie unbehilflich und einfältig. Minnas Heftigkeit und zunehmend schroffe und verhöhnende Behandlung, machte das eigentlich sehr gutmütige Mädchen mit der Zeit wirklich störrisch und feindselig gesinnt, so dass der Umgang und das Verhalten der beiden scheinbaren Schwestern oft zu den widerwärtigsten Störungen der häuslichen Ruhe führten, wogegen meine Geduld eigentlich nur von meiner inneren Gleichgültigkeit gegen alle persönlichen Beziehungen meiner Umgebung sich nährte.
Zunächst belebte meinen kleinen Hausstand die Einreihung meines jungen Freundes Karl in denselben auf angenehme Weise; er bezog ein kleines Dachstübchen über unserer Wohnung, teilte unsere Mahlzeiten, sowie meine Spaziergänge und schien eine Zeitlang wohl zufrieden damit. Bald aber bemerkte ich eine zunehmende Unruhe an ihm; allerdings fand er zeitig schon Gelegenheit, an den heftigen Auftritten, die altgewohnter Weise in meinem ehelichen Leben sich wieder einstellten, innezuwerden, wo mich der Schuh drückte, den ich mit gutmütig gleichgültiger Nachgiebigkeit auf seinen Wunsch mir wieder an den Fuß gezogen hatte. Er blieb stumm, als ich ihm eines Tages, auf erhaltene Veranlassung hierzu, in Erinnerung brachte, dass mich, als ich meine Zustimmung zu der Rückkehr nach Zürich gab, ein anderes Gefühl als das der Hoffnung auf ein freundliches Familienleben, bestimmt hatte. Außerdem aber gewahrte ich andere und wunderlichere Motive seiner Unruhe: er traf oft sehr unregelmäßig zu den Mahlzeiten ein und hatte dann nie rechten Appetit, was mich anfänglich wegen des Charakters unserer Kost in Verlegenheit setzte, bis ich dann erfuhr, dass mein junger Freund dem Zuckergebäck in den Konditorläden so übermäßig hold gesinnt war, dass ich offenbar fürchten musste, er möge sich seine Gesundheit durch ausschließlichen Genuss desselben verderben. Meine Vorstellungen hierüber schienen ihn sehr zu verstimmen; da er nun anhaltender von Hause weg blieb, glaubte ich, dass wirklich seine beschränkte Wohnung ihn belästige und vermochte es nicht, ihn vom Aufsuchen einer Privat-Wohnung in der Stadt abzuhalten.
Da ich gewahrte, dass ein zunehmendes Unbehagen ihn einnahm, war es mir lieb, ihm eine bedeutende Unterbrechung seines offenbar ihn nicht befriedigenden Aufenthaltes anbieten zu können: ich bestimmte ihn, zu der am Ende des Augusts dieses Jahres dort stattfindenden ersten Aufführung des Lohengrin einen Ausflug nach Weimar zu machen. Ich selbst lud Minna zu gleicher Zeit zu einem ersten Ausflug nach dem Rigi ein, welchen wir beide rüstig zu Fuß bestiegen. Leider gewahrte ich infolge der Anstrengung hiervon an meiner Frau zum ersten Mal die Symptome ihrer, von nun an sich immer bestimmter entwickelnden Herzkrankheit. Den Abend des 28. August, an welchem in Weimar die erste Aufführung des Lohengrins stattfand, verbrachten wir in Luzern im Gasthof „zum Schwan“, genau die Stunde des Anfangs und des vermuteten Endes an der Uhr verfolgend. Es war immer etwas Not, Missbehagen und Verstimmung bei allen solchen Versuchen meinerseits, in Gemeinschaft mit meiner Frau gemütlich erregte Stunden zu veranlassen, störend einwirkend. Die Berichte, welche ich alsbald über diese Aufführung erhielt, waren auch nicht geeignet mir ein klares und beruhigendes Bild davon zu geben. Wirklich traf Karl Ritter bald wieder in Zürich ein; er berichtete mir namentlich von szenischen Übelständen in der Aufführung, von einem sehr unglücklichen Sänger der Hauptpartie, im Ganzen aber von einer guten Wirkung.
Franz Liszt, * 22. Oktober 1811 in Raiding – † 31. Juli 1886 in Bayreuth
Am zuversichtlichsten waren die Berichte, welche mir Liszt selbst zukommen ließ: alles Unzulängliche der höchst beschränkten Mittel, die ihm für sein unvergleichlich kühnes Wagnis zu Gebote gestanden, dünkte ihn unnütz erst besonders eingestehen zu müssen, wogegen er nur den Geist des Unternehmens und die Wirkung desselben auf die mancherlei bedeutenderen Rezeptiv-Kräfte, welche er mit Sorgfalt herbeigezogen hatte, der Beachtung wert hielt.
Während alles, was sich aus diesem bedeutenden Vorgang entwickelte, allmählich in klares Licht sich stellen sollte, blieb für jetzt davon die Wirkung auf meine Lage ohne eigentliche Bedeutung. Am Unmittelbarsten beschäftigte mich die Bestimmung des mir anvertrauten jungen Freundes: er hatte auf dem Ausflug nach Weimar auch seine Familie in Dresden wiedergesehen und eröffnete mir nun bei seiner Rückkehr den lebhaften Wunsch, die praktische Karriere als Musiker ergreifen und wo möglich als Musikdirektor beim Theater angestellt werden zu wollen. Ich hatte nun gar keine Gelegenheit gehabt, seine musikalischen Fähigkeiten kennenzulernen; vor mir Klavier zu spielen weigerte er sich, doch hatte er mir eine Komposition auf ein von ihm in Stabreimen verfasstes Gedicht, „die Walküre“, vorgelegt, an der ich zwar große Unbeholfenheit, zugleich aber das Ergebnis einer sehr genauen Kenntnis der Kompositionsregeln wahrnahm.
Robert Schumann, * 8. Juni 1810 in Zwickau, Königreich Sachsen – † 29. Juli 1856 in Endenich.
Sehr deutlich zeigte sich darin der Schüler Robert Schumanns, von dem mir sein Lehrer schon früher versichert hatte, dass er von ungemeiner musikalischer Befähigung sei, da er sich eines so sicheren Gehöres und einer so schnellen Fassungskraft bei keinem anderen seiner Schüler entsinne. Ich hatte somit keinen Grund, der Zuversichtlichkeit des jungen Mannes, mit welcher er sich alle für einen Musikdirektor nötigen Fähigkeiten zutraute, etwas entgegenzusetzen. Da die Wintersaison herannahte, erkundigte ich mich nach dem Direktor des in Zürich zu erwartenden Theaters, von welchem ich erfuhr, dass er zu der Zeit noch in Winterthur sein Wesen treibe. Sulzer, wie immer, sobald man ihn um Hilfe und Rat anging, sogleich auf das Ernstlichste zu beidem bereit, veranlasste eine Zusammenkunft mit dem Theaterdirektor Kramer bei einem Gastmahl im „wilden Mann“ zu Winterthur, wo dann festgesetzt wurde, dass Karl Ritter auf meine Empfehlung hin sogar mit einem erträglichen Gehalt für nächsten Winter vom Oktober an als Musikdirektor beim Theater bestellt sein sollte. Da mein Empfohlener zugestandenermaßen Anfänger war, musste ich natürlich für seine Leistungen Garantie übernehmen, welche ich durch die unverweigerliche Verpflichtung leistete, für Ritter in der Musikdirektion einzutreten, sobald und so lange durch dessen etwa unzureichende Befähigung Störungen für den Geschäftsgang des Theaters erwachsen könnten. Karl schien sehr zufrieden. Als sich nun der Monat Oktober mit der Ankündigung der Eröffnung der diesmal „von besonderen Kunst-Intentionen geleiteten“ Theater-Unternehmung herannahte, hielt ich endlich es doch für nötig, mit meinem jungen Freund im Betreff seines Vorhabens mich zu befassen. Um ein recht bekanntes Werk für sein Debüt zu bestimmen, hatte ich den Freischütz gewählt. Karl hatte nicht den mindesten Zweifel über die Bewältigung einer so einfachen Partitur; als er nun aber seine Blödigkeit im Betreff des Klavierspiels überwinden musste, um die Oper einmal am Instrument mit mir durchzugehen, war mein Schrecken groß, da ich gewahrte, dass er auch gar keine Ahnung vom Akkompagnement hatte, sondern den Klavierauszug mit der eigentümlichen Sorglosigkeit eines Dilettanten, welcher einem Fingerversehen zulieb unbefangen einen Takt um ein Viertel verlängert, handhabte. Von der rhythmischen Präzision, von der Kenntnis des Tempos, welche einzig beim Dirigenten entscheidend sind, hatte er auch nicht die mindeste Ahnung. Da ich gar nicht wusste, was ich hierzu sagen sollte, ließ ich es in einer gewissen Betäubung und immer noch auf eine unberechenbare Explosion des Talentes des jungen Mannes zählend, zu einer Orchesterprobe kommen, für welche ich ihn vor allem mit einer großen Brille ausgestattet hatte; denn ich hatte bemerkt, dass er wegen unvermuteter Kurzsichtigkeit genötigt gewesen war, sich mit dem Gesicht so dicht auf die Noten zu lehnen, dass er hierbei unmöglich noch Orchester und Sänger unter den Augen haben konnte. Es genügte mir, den sonderbaren, bis dahin so ungemein zuversichtlichen jungen Mann in seiner Haltung am Direktionspult zu sehen, wo er trotz seines auffallend bewaffneten Auges nur unverwandt in die Partitur starrte und willenlos wie im Traum, einen sich vorgesagten Takt mit dem Stock in die Luft malte, um sogleich zu begreifen, dass ich jetzt in dem Garantie-Fall mich befand. Es war nun noch schwierig und für mich bemühend, meine Nötigung, für ihn einzutreten, dem jungen Ritter begreiflich zu machen; doch half es nichts, ich musste die Wintersaison der Kramerschen Kunst-Unternehmung einweihen und brachte mich durch den Erfolg der von mir geleiteten Aufführung des Freischütz in eine sonderbare und schwer wieder zu beseitigende Lage, dem Theater wie dem Publikum gegenüber.
An die Behauptung der Musikdirektorstelle durch Karl war offenbar nicht mehr zu denken. Sehr merkwürdigerweise fiel diese unangenehme Erfahrung aber mit einer sehr bedeutenden Wendung im Schicksal eines anderen, ebenfalls von Dresden her mir bekannten jungen Freundes, Hans von Bülow, zusammen.
Hans von Bülow, * 8. Januar 1830 in Dresden – † 12. Februar 1894 in Kairo, war ein deutscher Klavierviertuose, Dirigent und Kapellmeister.
Bereits im vergangenen Jahre hatte ich den Vater, Eduard von Bülow, als neu verheiratet in Zürich angetroffen.
Karl Eduard von Bülow, * 17. November 1803 auf Gut Berg vor Eilenburg – † 16. September 1853 auf Schloss Oetlishausen (Kanton Thurgau), war ein deutscher Novellendichter.
Er hatte sich jetzt am Bodensee niedergelassen, und von dort aus meldete mir eben Hans, welcher zuvor sich mir zum Besuch in Zürich angekündigt hatte, dass er zu seinem großen Leidwesen diesen seinen feurigsten Wunsch zu erfüllen verhindert sei. Soweit ich in seine Lage einen Einblick gewann, schien es mir, dass seine Mutter, die nun geschiedene Frau seines Vaters, um jeden Preis ihren Sohn von der Künstler-Laufbahn zurückzuhalten suchte, um ihn dagegen, mit Benutzung seiner bis dahin betriebenen juristischen Studien zum Antritt einer Karriere im Staatsdienst oder im diplomatischen Fach zu bestimmen. Seine Neigung und sein Talent drängten ihn dagegen zur Musik. Es schien nun, dass die Mutter dem Sohn bei der ihm erteilten Erlaubnis zum Besuch seines Vaters besonders eingeschärft hatte, eine Zusammenkunft mit mir zu vermeiden. Da ich jetzt erfuhr, dass auch der Vater ihn von einem Besuch in Zürich abhielt, musste ich, da andererseits dieser sich ziemlich wohlwollend gegen mich bezeigt hatte, annehmen, er mache mit dieser Erlaubnis-Verweigerung ein Zugeständnis an seine geschiedene Frau, mit welcher er nach den kaum beruhigten Kämpfen der Ehetrennung in keinerlei neuen Konflikt zu treten wünschte, selbst wenn es sich um die Entscheidung der Lebensrichtung seines eigenen Sohnes handelte. Sollte ich in dieser Annahme, welche mich allerdings bis zur vollsten Rücksichtslosigkeit bitter gegen Eduard von Bülow stimmte, geirrt haben, so war doch schon der ganze Ausdruck des Briefs, mit welchem Hans mir die grausame Notwendigkeit anzeigte, in der er sich befand, mit offenen Augen eine ihm widerstrebende Laufbahn anzutreten und somit für alle Zeiten sich in einen seelenzerplitternden Zwiespalt zu werfen, genügend, hierin einen der Fälle zu erblicken, welche, bei meiner damaligen stets leicht erregbaren Neigung zur Empörung gegen ähnlichen Zwang, mich bestimmte, in das Schicksal meines jungen Freundes in meiner Weise einzugreifen. Ich antwortete ihm in einem ausführlicheren Brief, in dem ich ihm die Wichtigkeit der Lebensphase, in welcher er sich befand, energisch bezeichnete. Namentlich der verzweiflungsvoll zerrissene Ton, in welchem er sich an mich gewandt hatte, gab mir ein Recht dazu, ihm zu Gemüte zu führen, dass es sich hier nicht nur um seine äußere Lebensrichtung, sondern um die Bestimmung seines ganzen Geistes- und Gemütslebens handelte. Ich führte ihm vor, was ich an seiner Stelle tun würde: empfände ich nämlich in mir einen wahrhaft unüberwindlichen und meine ganze Seele einnehmenden Trieb zur Künstler-Laufbahn und fühlte ich mich geneigt, lieber die größten Beschwerden und Misshelligkeiten über mich ergehen zu lassen, als mein Leben in eine falsche Bahn gelenkt zu sehen, so würde ich sofort, wenn jemand mir hierzu die Hand reichte, wie ich die meinige ihm hiermit böte, auf das Äußerste hin meinen Entschluss fassen. Wolle er trotz des Verbotes seines Vaters zu mir kommen, so möge er sofort, nach Erhaltung dieses Briefs, unter allen Umständen diesen Entschluss ausführen. Karl Ritter war glücklich, als ich ihm diesen Brief zur persönlichen Bestellung auf dem Bülow'schen Gütchen übergab. Dort angekommen, ließ er seinen Freund aus dem Haus rufen, begab sich mit ihm ins Freie, und ließ ihn meinen Brief lesen, worauf dieser sofort sich entschied, ganz wie er ging und stand, bei Sturm und Regen in rauester Jahreszeit, da beide ohne genügende Geldmittel waren, zu Fuß nach Zürich zu wandern. Da traten sie eines Tages wild und abenteuerlich mit den lautredenden Spuren der ungeheuerlichen Reise zu mir in das Zimmer. Ritter strahlte vor Freude über das gelungene Abenteuer, wogegen der junge Bülow mir eine große, ja leidenschaftliche Ergriffenheit zeigte. Ich fühlte ihm gegenüber sofort eine große und tiefe Verpflichtung, und zugleich ein wahrhaft inniges Mitleiden mit dem so krankhaft aufgeregten jungen Menschen; beides bestimmte lange Zeit mein Verhalten zu ihm.
Fürs Erste galt es durch gute und heitere Miene Trost zu geben, und Vertrauen zu erwecken. Die äußerliche Lage war schnell geordnet: Hans trat als Gleichbeteiligter in das Kontrakt-Verhältnis Karls zur Theater-Direktion ein, was für jeden eine Art von Gehalt abwarf, wogegen ich als Garant für beider Leistungen verblieb. Sogleich war eine Posse mit Musik zu übernehmen; ohne nur zu wissen um was es sich handle, trat Hans sofort an das Dirigentenpult und schwang mit wahrer Lust und größter Sicherheit den Taktstock. Nach dieser Seite hin fühlte ich mich sofort geborgen, und jeder Zweifel an des neuesten Musikdirektors Fähigkeit war augenblicklich überwunden; wogegen es schwer war, Karls aus großer Beschämung hervorgehenden Missmut über eine, offenbar über sein ganzes Leben entscheidende Aufklärung im Betreff seiner Unbefähigung zum praktischen Musiker, zu zerstreuen. Von hier an ward mir eine keimende Scheu und heimliche Abneigung des sonst so bedeutend begabten jungen Mannes gegen mich immer wahrnehmbarer. Es blieb unmöglich, ihn in der eingenommenen Stellung aufrecht zu erhalten und je wieder an das Dirigentenpult zu berufen. Andererseits entstand aber auch für Bülow bald eine nicht vorausgesehene Erschwerung seiner Stellung, und zwar dadurch, dass der Theaterdirektor und sein Personal, durch meine einmalige Orchesterdirektion verwöhnt, es fortan darauf anlegen zu müssen glaubten, mich immer wieder dazu herbeizuziehen. Noch einige Male dirigierte ich wirklich, teils um durch meine Autorität der verhältnismäßig nicht übel bestellten Oper einigen Kredit beim Publikum zu verschaffen, teils um meinen jungen Freunden und namentlich dem so sehr hierfür berufenen Bülow, durch mein Beispiel das, worauf es beim Oper dirigieren ankam, belehrend zu zeigen. Während nun Hans allen ihm verbleibenden Aufgaben sich so vollkommen gewachsen zeigte, dass ich endlich mit gutem Gewissen erklären konnte, unter keinen Umständen mehr für ihn einzutreten mich verpflichtet zu fühlen, wählte namentlich eine durch mein Lob eitel gewordene Sängerin den Weg, durch Verlegenheiten, welche sie mit absichtlicher Schikane dem jungen Dirigenten erzeugte, mich wiederum an das Pult zu nötigen. Als wir diesen Stand der Dinge einsahen, und ich des Ärgers hierüber genug hatte, kamen wir, nachdem zwei Monate dieser Praxis verflossen waren, mit der Direktion überein, das Ganze, sehr peinlich gewordene Verhältnis zu lösen. Da gleichzeitig ein bedingungsloses Engagement als Musikdirektor Hans aus St. Gallen angetragen wurde, so entließ ich die beiden jungen Leute, welche gemeinsam ihr Glück nun dort versuchen wollten, in diese nachbarliche Stadt, um für das Weitere zunächst Zeit zu gewinnen.
In die Entscheidung seines Sohnes hatte sich Herr Eduard von Bülow, wenn auch mit großer Misstimmung gegen mich, klugerweise gefügt; auf einen Brief, in welchem ich meine Handlungsweise gegen ihn zu rechtfertigen suchte, hatte er mir zwar nicht erwidert, seinen Sohn aber, wie ich erfuhr, mit versöhnlicher Gesinnung in Zürich besucht. Ich selbst besuchte im Laufe der wenigen Wintermonate, welche sie noch in St. Gallen zubrachten, einige Male die jungen Leute. Karl war mit einem Versuch, die Glücksache Ouvertüre zu Iphigenia zu dirigieren, abermals unglücklich gewesen, so dass ich ihn in düstere Grübeleien verloren und fern von aller Praxis des Lebens in ziemlich unerfreulicher Verfassung antraf, während Hans mit einem scheußlichen Personal, einem grauenhaften Orchester und in einem unwürdigen Theaterlokal, qualvollst, aber eifrigst in voller Geschäftigkeit begriffen war. Da ich dieses Elend gewahrte, ward alsbald festgestellt, dass Hans für jetzt genug getan und erlernt hätte, um seinen Beruf als praktischer Musiker auch nach dieser wichtigen Seite des Orchesterdirigenten hin außer Zweifel gestellt zu haben. Es galt jetzt nur, ihm eine würdigere Sphäre für die Geltendmachung desselben zu verschaffen. Er teilte mir mit, dass er mit Empfehlungen von seinem Vater an Freiherr von Poissl, damaligen Intendanten des Münchener Hoftheaters, versehen werden sollte.
Johann Nepumuk von Poißl, * 1783 – † 1865, war ein deutscher Komponist und Intendant.
Bald aber intervenierte auch seine Mutter mit dem Wunsch, ihren Sohn zur weiteren Ausbildung zu Liszt nach Weimar zu senden. Hiermit konnte ich denn nun am allerliebsten einverstanden sein; es gereichte mir zur wahren Beruhigung, den jungen, mir so schwer am Herzen liegenden Mann meinem großen Freund auch meinerseits herzlich empfehlen zu können.
Franz Liszt, * 22. Oktober 1811 in Raiding – † 31. Juli 1886 in Bayreuth
* * *
1851
Mit Ostern 1851 verließ er St. Gallen, um von da an, für längere Zeit der Weimarischen Hut übergeben, meiner besonderen Fürsorge enthoben zu werden. Nur Ritter blieb in melancholischer Abgeschiedenheit, und unschlüssig darüber, ob er zu mir nach Zürich, wo er unangenehmen Erinnerungen an sein verfehltes Auftreten entgegen ging, sich zurückwenden sollte, fürs erste noch in seiner Einsiedelei zu St. Gallen zurück.
Zu erfreulicheren künstlerischen Übungen, als der Aufenthalt in St. Gallen, war es dagegen bei einem Besuch der jungen Freunde während des vergangenen Winters in Zürich gekommen, wo Hans diesmal als Klavierspieler in einem Konzert der Musikgesellschaft auftrat, in welchem ich selbst, durch die Aufführung einer Beethoven‘schen Symphonie unter meiner Leitung, in gegenseitig anregender Weise mitwirken konnte. Man hatte mich nämlich in diesem Winter von neuem angegangen, mich bei den Konzertaufführungen dieser Gesellschaft mit etwas zu beteiligen; da die vorhandenen Orchesterkräfte sehr gering waren, konnte ich zu meiner Mitwirkung, welche ich je zuweilen nur auf eine Beethoven'sche Symphonie beschränkte, bloß dadurch bestimmt werden, dass man tüchtige Musiker, namentlich für die Verstärkung der Streichinstrumente, von auswärts hinzuzog. Da ich jedes Mal drei Proben bloß für die aufzuführende Symphonie verlangte, und ein Teil der Musiker von fernher besonders hierfür zusammen kam, erhielten diese Übungen eine gewisse Feierlichkeit; da außerdem die ganze Zeit, die man gewöhnlich auf eine Probe verwendet, mir ausschließlich zu der einen Symphonie zur Verwendung stand, so gewann ich hier die Muße, welche ich auf die Ausarbeitung des feineren Vortrags, da andererseits die rein technischen Schwierigkeiten nicht von großem Belang waren, verwenden konnte und gelangte so zu einer bisher mir nicht möglich gewordenen Freiheit des Vortrages, deren ich mir umso inniger bewusst wurde, als ich namentlich auch die Wirkung hiervon in überraschender Weise wahrzunehmen hatte. Ich entdeckte im Orchester selbst mehrere wahrhaft talentvolle und mit seltenem Erfolg bildsame Musiker, unter denen ich namentlich des aus untergeordneter Stellung zur ersten Stimme berufenen Oboe-Bläsers Fries erwähne, welcher seine in den Beethoven'schen Symphonien so überaus wichtige Partie bei mir ganz wie eine Gesangsstimme einüben musste. Als wir die C-Moll-Symphonie zuerst aufführten, brachte ich es mit diesem sonderbaren Menschen, welcher, als ich mich später von den Konzerten zurückzog, sogleich das Orchester verließ und Musikalienhändler wurde, dahin, dass er die kleine, mit Adagio bezeichnete Gesangsstelle auf der einen Fermate des ersten Satzes dieser Symphonie, so bedeutend und ergreifend vortrug, wie ich seitdem es nie wieder hören konnte. Dazu hatten wir in dem fein gebildeten Herrn Ott-Imhof, einem reichen patrikischen Kunstfreund und Dilettanten, einen zwar nicht sehr energischen, aber außerordentlich zart und weich betonenden Klarinettisten. Auch muss ich des ganz vorzüglichen Hornisten Bär (Franz Joseph Bähr, * 19. Februar 1770 in Deiningen – † 7. August 1819 in Wien; auch Bär oder Behr, war ein deutscher Klarinettist.) erwähnen, welcher von mir zum Kommandanten der Blechinstrumentisten bestellt wurde, auf deren Vortrag er einen sehr erfolgreichen Einfluss ausübte; ich entsinne mich nie wieder die ausgehaltenen starken Akkorde des letzten Satzes der C-Moll-Symphonie mit solch intensiver Kraft, wie damals in Zürich, ausgeführt gehört zu haben, und glaube dem nur meine frühesten Erinnerungen an ähnliche Wirkungen im Vortrage des Pariser Konservatoire-Orchesters in der „neunten Symphonie“ zur Seite stellen zu können. Die Aufführung dieser C-Moll-Symphonie wirkte auf unser Publikum, namentlich aber auf meinen vertrauten Freund, den bis jetzt der Musik abhold gewesenen Staatsschreiber Sulzer, in ganz besonders anregender Weise und begeisterte den letzteren sogar, als es der Abwehr eines Zeitungsangriffes galt, zu einer, mit völlig Platen'scher Kunst gedichteten, Satire auf den unberufenen Einsprecher.
Johann Jakob Sulzer, * 1821 – † 1897
Zu einem zweiten Konzert, zu welchem ich mich in diesem Winter noch verstand, um in ihm die „Sinfonia Eroica“ zur Aufführung zu bringen, ward, wie erwähnt, auch Bülow für einen Klaviervortrag eingeladen. Kühn, und in einem gewissen Sinn wenig selbstbedacht, wählte er hierzu die ebenso geistvolle als schwierige Bearbeitung der „Tannhäuser-Ouvertüre“ für das Klavier von Liszt; wie er im Allgemeinen damit Sensation erregte, setzte er namentlich mich über seine bereits zu hohem Grad gediehene, von mir bis daher noch nicht gebührend beachtete Virtuosität in Erstaunen und erweckte in mir das größte Vertrauen auf seine Zukunft. Bereits hatte ich ihn, wie beim Dirigieren, so auch beim Akkompagnieren als ungemein befähigt und entwickelt kennen gelernt; hierzu war im Verlauf des vergangenen Winters bereits neben den äußerlichen Schicksalen meines jungen Freundes, wie ich sie zuvor kurz bezeichnete, mancherlei Gelegenheit geboten worden. Öfters vereinigten sich Bekannte bei mir; auch ein regelmäßiger Club ward von diesen gebildet, wo es dann meistens auf die Unterhaltung abgesehen war, welche eigentlich nur durch Bülows Hilfe ermöglicht wurde. Ich trug dann selbst Geeignetes aus meinen Opern vor, welches Hans stets mit für mich wohltätigstem Verständnis begleitete. Bei solcher Gelegenheit kam es auch meinerseits zu Vorlesungen aus meinen Manuskripten; namentlich habe ich in einer andauernden Aufeinanderfolge von Abenden einem stets zunehmenden, sehr aufmerksamen Zuhörerkreis mein im Verlaufe dieses Winters geschriebenes größeres Buch „Oper und Drama“ vollständig vorgelesen.
Als ich nämlich seit meiner Rückkehr zu einiger Ruhe und Besinnung gelangt war, fasste ich endlich auch die Wiederaufnahme meiner ernstlichen Arbeiten ins Auge. An die Komposition von „Siegfrieds Tod“ zu gehen, wollte mir aber nicht zu Sinnen: der Gedanke, mit klarem Bewusstsein eine Partitur nur für das Papier zu schreiben, entmutigte mich stets von neuem; wogegen es mich immer wieder drängte, der einst zu gewinnenden Möglichkeit für die Aufführung auch solch eines Werkes, wenn auch scheinbar auf weitestem Umweg eine Grundlage zu verschaffen. Hierfür schien es mir vor allem nötig, den wenigen Freunden, welche sich nah und fern ernstlich mit meiner Kunst befassten, immer deutlicheren Aufschluss über die notwendig zu lösenden, bestimmt mir vorschwebenden, jenen aber noch kaum nur sich darstellenden Probleme zu geben. Hierzu erhielt ich eine ganz besondere Veranlassung, als eines Tages Sulzer einen Artikel über die „Oper“ in dem Brockhaus'schen Konversations-Lexikon der Gegenwart mir in der Meinung zeigte, durch die darin ausgesprochenen Ansichten mir verständig vorgearbeitet sehen zu können. Ein flüchtiger Blick in diese Arbeit zeigte mir sofort das gänzlich fehlerhafte derselben, und ich suchte Sulzer auf eben diese Grundverschiedenheit aufmerksam zu machen, welche zwischen den üblichen Ansichten sogar recht gescheiter Leute, und meiner Einsicht in das Wesen dieser Dinge bestehe. Da es mir natürlich nicht möglich war, auch durch noch so große Beredsamkeit meine Ideen hierüber im Fluge zum Verständnis zu bringen, so machte ich mich alsbald bei meiner Nachhausekunft darüber, einen geregelten Plan zu einer ausführlicheren Behandlung derselben zu entwerfen. Somit übernahm ich die Ausarbeitung dieses Buches, welches ich unter dem Titel „Oper und Drama“ veröffentlichte: eine Arbeit, welche mich mehrere Monate bis zum Februar 1851 angestrengt beschäftigte. – Den ermüdenden Eifer, welchen ich auf die Beendigung dieser Arbeit verwendete, hatte ich schließlich in grausamer Weise zu büßen: noch hatte ich nach meiner Berechnung wenige Tage angestrengten Fleißes für das Manuskript nötig, als mein guter Papagei, welcher gewöhnlich auf dem Schreibtisch mir zugesehen hatte, bedenklich erkrankte. Da er schon einige Male von gleichen Anfällen sich glücklich wieder erholt hatte, nahm ich es auch diesmal nicht so ängstlich: als meine Frau mich bat, den in einer entfernten Gemeinde wohnenden uns empfohlenen Tierarzt aufzusuchen, verschob ich dies, um nur meinen Schreibtisch nicht zu verlassen, vom nächsten auf den übernächsten Tag. Eines Abends spät wurde ich endlich mit dem verhängnisvollen Manuskript fertig: am anderen Morgen lag der gute Papo tot am Boden. Meine vollständige Untröstlichkeit über diesen traurigen Fall ward von Minna in gleich herzlicher Trauer geteilt, und in der Übereinstimmung unserer Zuneigung für die uns so nah befreundeten Haustiere begegneten wir uns in einer für unser ferneres Nebeneinanderbestehen nicht unförderlichen wirklich gemütlichen Weise.
Außer den Haustieren waren uns aber auch die älteren Züricher Freunde, über die Katastrophe meines Familien-Verhältnisses hinweg, treu und anhänglich geblieben. Als der wertvollste und bedeutendste dieser stellte sich allerdings immer mehr Sulzer heraus. Die ausgesprochenste Verschiedenheit in den intellektuellen Anlagen und Temperaments-Eigenschaften, welche zwischen uns stattfanden, schien unser Verhältnis gerade dadurch zu begünstigen, dass wir eigentlich immer nur Überraschungen an uns zu erleben hatten, welche sich, da der Grund derselben stets bedeutend war, zu den anregendsten und belehrendsten Erfahrungen gestalteten. Außerordentlich reizbar und von sehr zarter Gesundheit, war Sulzer, der gegen seine ursprüngliche Neigung in den Staatsdienst getreten war und sein Belieben der strengen Gewissenhaftigkeit der Pflichterfüllung im weitesten Sinn geopfert hatte, durch seine Bekanntschaft mit mir stärker, als es ihm erlaubt schien, in die Sphäre des ästhetischen Genusses gezogen worden. Fast hätte er sich diese Ausschweifung leichter erlaubt, wenn auch ich mit der Kunst es unschwer genommen hätte; dass ich nun aber der künstlerischen Bestimmung des Menschen eine so ungemeine, weit über den Staatszweck hinausgehende Bedeutung zuerkannt wissen wollte, brachte ihn oft ganz aus der Fassung; wogegen nun aber gerade dieser mein großer Ernst es war, der ihn wieder zu mir und meinen Anschauungen heranzog. Da dies nicht bloß zu Unterhaltungen und gemächlichen Diskussionen führte, sondern unsere beiderseitige große Reizbarkeit sehr oft die heftigsten Explosionen veranlasste, so geschah es mitunter, dass er, mit bebenden Lippen, Hut und Stock ergriff und ohne Abschied hastig davon ging. Es war nun hübsch, dass er anderen Tags sich gewiss pünktlich zur Abendstunde wieder einstellte und wir beide des Gefühls waren, als wenn gar nichts zwischen uns vorgefallen sei. Nur wenn ihn gewisse leidensvolle körperliche Zustände zur vollkommenen Einschließung für längere Tage bestimmten, war es schwer bei ihm vorzukommen, weil er ganz wütend werden konnte, wenn man ihn nach seiner Gesundheit fragte; es gab dann ein einziges Mittel ihn in gute Stimmung zu versetzen: es musste nämlich erklärt werden, man habe ihn aufgesucht um einen Freundschaftsdienst von ihm zu erbitten; wo er dann, völlig angenehm überrascht, sich nicht nur zu jeder Gefälligkeit sogleich bereit zeigte, sondern auch eine wirklich heitere und wohlwollende Miene annahm.
Wilhelm Baumgartner, * 15. November 1820 in Rorschach – † 17. März 1867 in Zürich, war ein Schweizer Chordirigent, Pianist und Komponist von Klavierstücken, Kunstliedern und Chorwerken.
Höchst auffallend stach nun neben ihm der Musiker Wilhelm Baumgartner ab: ein lustiger lebensfroher Bruder, ohne jede Neigung zur Konzentration, der gerade so viel Klavierspielen gelernt hatte, um einen guten Lehrer für so viel Stundengeld, als er gerade gebrauchte, abzugeben, recht warm und sinnig für etwas Schönes, wenn es sich nur nicht zu hoch verlor, empfand; ein treues gutes Herz, der außerdem vor Sulzer auch großen Respekt hatte, leider aber dem Hang zur Kneipe dadurch nicht entwöhnt werden konnte. – Außerdem hatten sich schon von der ersten Zeit her noch zwei Freunde dieser beiden, der tüchtige und ehrenwerte damalige zweite Staatsschreiber Franz Hagenbuch , * 31.10.1819 in Zürich, 4.9.1888 in Zürich und ein sonderbar gutmütiger, aber geistig nicht eben sehr begabter und deshalb von Sulzer nicht immer besonders schonungsvoll behandelter Advokat und damaliger Redakteur der „eidgenössischen Zeitung“, Bernhard Spyri, gesellt.
Bernhard Spyri, * 21. September 1821 – 19. Dezember 1884
– Alexander Müller, welcher durch häusliche Kalamität, körperliche Leiden, und handwerksmäßiges Stundengeben, immer mehr in Beschlag genommen war, verschwand bald gänzlich aus unserem Umgang. – Zu einem Musiker Abt fühlte ich, trotz seiner „Schwalben“, mich nicht hingezogen; auch verließ er uns bald, um in Braunschweig glänzende Karriere zu machen.
Nun war aber von außen, namentlich durch die politischen Schiffbrüche, der Züricher Gesellschaft allerhand Bereicherung zugeführt worden. Bei meiner Zurückkehr im Januar 1850 traf ich bereits den bürgerlich nicht uneleganten, aber ziemlich langweiligen Adolph Kolatschek (* 7. Mai 1821 in Bielitz, Teschener Schlesien, Herzogtum Ober- und Niederschlesien – † 16. Dezember 1889 in Wien): er fühlte sich zum Redigieren berufen, und hatte eine „deutsche Monatsschrift“ gegründet, welche den in der letzten Bewegung äußerlich Besiegten das Feld zur Fortsetzung des Kampfes auf dem inneren Gebiet des Geistes eröffnen sollte.
Franz Abt, * 22. Dezember 1819 in Eilenburg – † 31. März 1885 in Wiesbaden, war ein deutscher Komponist und Kapellmeister.
Fast schmeichelte es mir, dass ich von ihm als Schriftsteller beachtet wurde, da er dabei blieb, einem solchen Verein geistiger Kräfte, wie ihm durch seine Unternehmung eine Grundlage gegeben werden sollte, dürfte „eine Potenz wie die meinige“ nicht fehlen. Ich hatte ihm bereits von Paris aus den Aufsatz über „Kunst und Klima“ zugeschickt; jetzt nahm er willig auch einige größere Bruchstücke aus dem noch unveröffentlichten „Oper und Drama“ auf, welche mir durch ihn auch sehr anständig honoriert wurden.
Emil Palleske, * 5. Januar 1823 in Tempelburg, Pommern – † 28. Oktober 1880 in Tal bei Eisenach, war ein Schauspieler, Rezitator und Schriftsteller.
Dieser Mann ist mir noch immer in Erinnerung als die einzige Erfahrung von einem taktvollen Redakteur; er gab mir das Manuskript einer Rezension meines „Kunstwerk der Zukunft“ von einem Herrn Palleske zur Einsicht und erklärte mir, ohne meine besondere Einwilligung, die er jedoch keineswegs von mir anspreche, sie nicht abdrucken lassen zu wollen. Da ich fand, dass diese oberflächliche, gänzlich verständnislose und doch im hoffärtigsten Ton verfasste Besprechung, wenn sie gerade in dieser Zeitschrift erschien, mich jedenfalls zu einer, durch wiederholte Ausführung meiner wirklichen Thesen umständlichen und ermüdenden Erwiderung veranlassen müsste, ich aber hiergegen im höchsten Grad abgeneigt war, so ließ ich es bei Kolatscheks Entschluss, das Manuskript seinem Verfasser zu anderweitigem Abdruck zu empfehlen. – Dagegen lernte ich an Kolatscheks Seite in Reinhold Solger (Reinhold Carl Ernst Friedrich Solger, * 5. Juli 1817 in Stettin – † 11. Januar 1866 in Washington, D.C., war ein deutschamerikanischer Politiker, Gelehrter und Schriftsteller.) einen wirklich ausgezeichneten und interessanten Menschen kennen; da seinem etwas unruhigen und abenteuerlichen Wesen das Eingepferchtsein in die kleine enge Züricher Schweizer-Welt unerträglich wurde, verließ er uns bald und ging nach Nordamerika, von wo aus ich noch von seinem herausfordernden Auftreten mit Vorlesungen über die Europäischen Verhältnisse hörte.
Gewiss war es schade, dass dieser talentvolle Mann nicht dazu kam, durch bedeutendere Arbeiten sich bekannt zu machen; was er in der kurzen Zeit seines Züricher Aufenthaltes für unsere Monatsschrift schrieb, gehörte offenbar zu dem Vorzüglichsten, was jemals auf diesem Feld von einem Deutschen geleistet worden ist.
Georg Herwegh, * 31. Mai 1817 in Stuttgart – † 7. April 1875 in Lichtental, war ein revolutionärer gebürtiger deutscher Dichter des Vormärz und Übersetzer.
Im neuen Jahr 1851 gesellte sich zu diesen auch Georg Herwegh, welchen ich eines Tages zu meiner Überraschung in Kolatscheks Wohnung antraf. Die Schicksale, die ihn für jetzt nach Zürich führten, wurden mir erst später in einer etwas widerwärtig an mich herantretenden Gestalt bekannt; für jetzt gab sich Herwegh in einer gewissen aristokratischen Haltung als fein gewöhnter, üppiger Sohn seiner Zeit, dem namentlich einige stets in seiner Rede einfließende französische Interjektionen ein sonderbar vornehmes, wenigstens verwöhntes Ansehen verliehen. Doch waren sein Äußeres, sein lebhaft funkelndes Auge, und die Freundlichkeit seines Benehmens, recht wohl geeignet, einen anziehenden Eindruck auszuüben. Ich fand mich fast geschmeichelt, als er gern die Einladung zu meinen bäuerischen Abendzusammenkünften annahm, welche allerdings einige Male, als Bülow noch sie musikalisch belebte, sich ziemlich artig ausnehmen mochten, wogegen andererseits mir allerdings gar nichts geboten wurde. Als ich zu Vorlesungen aus meinen Manuskripten schritt, behauptete meine Frau, dass Kolatschek eingeschlafen wäre, und Herwegh dabei sich nur ihren Punsch habe schmecken lassen. Als ich späterhin „Oper und Drama“ in zwölf verschiedenen Abenden, wie ich erwähnte, meinen Züricher Freunden und ihren Bekannten vortrug, blieb Herwegh aus, weil er sich nicht unter diejenigen mischen wollte, für die so etwas nicht geschrieben wäre. Doch belebte sich allmählich mein Umgang mit ihm, wozu nicht nur meine Achtung vor einem kürzlich noch so sehr gefeierten Dichtertalent, sondern auch die Wahrnehmung der wirklich zarten und feinen Begabung eines wohlgebildeten Geistes beitrugen. Ich gewahrte endlich an Herwegh selbst das Bedürfnis nach meinem Umgang. Dass ich hierbei es immer nur zu den Berührungen der tieferen und ernsteren Interessen, welche mich so leidenschaftlich einnahmen, kommen ließ, schien eine veredelnde Teilnahme an diesen selbst demjenigen hervorzurufen, der, seit dem schnellen Gewinn seines Dichterruhms zu seinem großen Nachteil sich so sehr nur in den seinem ursprünglichen Naturell so ganz abliegenden Äußerlichkeiten einer trivialen Façon verloren hatte. Hierzu mochte die wachsende Bedrängnis seiner Lage, welche er bisher immer noch nach gewissen Ansprüchen auf Glanz beurteilen zu müssen geglaubt hatte, viel beitragen. Kurz, ich fand an ihm zuerst den feinen, sympathischen Verstand für meine gewagtesten Entwürfe und Ansichten, und ich musste ihm bald Glauben schenken, wenn er mir versicherte, dass er nur noch mit meinen Gedanken sich beschäftige, auf welche gewiss niemand so innig sich einließe, als er.