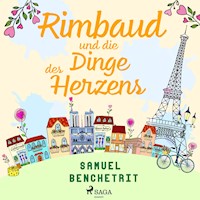7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Der »kleine Prinz« der Pariser Vorstadt. »Weißt du, Charly, im Leben muss man lieben, und zwar sehr. Man darf niemals Angst haben, zu sehr zu lieben. Diejenigen, die den Schmerz fürchten, glauben nicht an das Leben ... Verstehst du, Charly: Was auch geschieht, sieh zu, dass dein Herz immer voll ist.« Der zehnjährige Charly ist gewohnt, dass die Polizei seine Mutter aus ihrer Wohnung in dem heruntergekommenen Hochhaus holt – immer geht es um seinen Bruder Henry und dessen Drogenprobleme. Doch heute hat sie ihn zum ersten Mal in seinem Leben nicht angelächelt: Was ist passiert? Er muss sie finden, auch wenn er dafür die Schule schwänzt. Mit klopfendem Herzen läuft er durch das Viertel, erzählt von seinen Sorgen und von den zwei Frauen, die er liebt – seine Mutter und seinen heimlichen Schwarm Melanie. Und wenn er gar keine Antworten mehr findet, sucht er Zuflucht bei den Versen seines Lieblingsdichters Rimbaud ... Jeder Leser wird den lebensmutigen, weisen Charly ins Herz schließen und nicht mehr daraus entlassen. Eine moderne Fabel, die glücklich macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Ähnliche
Samuel Benchetrit
Rimbaud und die Dinge des Herzens
Roman
Aus dem Französischen von Olaf Matthias Roth
Aufbau-Verlag
Impressum
Die Originalausgabe mit dem Titel »Le cour en dehors«
erschien 2009 bei Bernard Grasset, Paris.
ISBN E-Pub 978-3-8412-0099-0
ISBN PDF 978-3-8412-2099-8
ISBN Printausgabe 978-3-351-03312-5
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Februar 2011
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die deutsche Erstausgabe erschien erstmals 2011 bei
Aufbau Taschenbuch, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
© Grasset & Fasquelle, 2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Mediabureau Di Stefano, Berlin
unter Verwendung einer Illustration von Luke Martineau /
Bridgeman Art Library und © Imagezoo / getty-images
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
Das Leben
8 Uhr
8 Uhr 20
9 Uhr 30
10 Uhr
10 Uhr 15
10 Uhr 30
10 Uhr 50
11 Uhr 10
11 Uhr 30
12 Uhr 15
13 Uhr 25
15 Uhr 40
16 Uhr 30
16 Uhr 50
17 Uhr 20
18 Uhr 10
19 Uhr 20
22 Uhr 50
23 Uhr 40
Erstes Kapitel
Das Leben
Anfangs dachte ich, Rimbaud wäre ein Wohnturm. Weil man Rimbaud-Turm sagt. Dann aber erklärte mir mein Kumpel Yéyé, dass Rimbaud ein Dichter gewesen ist. Warum man meinem Wohnturm den Namen eines Dichters gegeben hat, ist mir schleierhaft. Yéyé meinte, weil der Mann bekannt war und vor langer Zeit gestorben ist. Ich habe natürlich gleich gefragt, ob er gestorben ist, nachdem er unseren Wohnturm gesehen hat. Yéyé meinte, nein, der wäre schon viel früher gestorben. Umso besser für ihn, habe ich erwidert, weil der Turm grottenhässlich ist und Rimbaud bestimmt genervt wäre, wenn er wüsste, dass sein Name für so was genommen wird. Yéyé wandte ein, er fände es gut, wenn man seinen Namen für überhaupt irgendetwas verwenden würde. Ich fände es total daneben, in einem Yéyé-Turm zu wohnen, habe ich gesagt. Ich soll mich verpissen, war Yéyés Antwort, und mein Name wäre ja wohl auch nicht besser.
Ich heiße Charly.
»Charly-Turm, das klingt noch bescheuerter als Yéyé-Turm.«
Da musste ich ihm insgeheim recht geben, trotzdem habe ich gesagt, er soll sich selbst verpissen.
Wir haben noch eine Weile so weitergeredet, denn es gibt einen Haufen Dichter, nach denen sie in unserem Viertel irgendwelche Sachen benannt haben. Verlaine-Turm. Cité Hugo. Centre Guillaume Apollinaire. Und von all diesen Dingern ist eines hässlicher als das andere. Aber die Dichter sind ja gestorben, bevor sie davon erfahren haben, also was soll’s. Monsieur Hidalgo, irgend so ein Lehrer an der Schule, auf die mein Bruder Henry gegangen ist, sagt, es ist eine Schande, sich der Kunst zu bedienen, um Scheußlichkeiten zu verhüllen. Aber den meisten Leuten ist das egal, weil sie die Center und Türme sowieso früher oder später umtaufen. Die Bewohner des René-Char-Turms zum Beispiel sagen nie, dass sie im René-Char-Turm zu Hause sind. Die sagen »der blaue Turm«. Keine Ahnung, wie sie darauf kommen, denn der Turm ist nicht wirklich blau. Unter uns: Der Turm ist grau. Genauso ist es mit der Cité Picasso auf der anderen Seite des Einkaufszentrums. Kein Mensch spricht von der »Cité Picasso«. Obwohl es sogar eine Bushaltestelle Picasso gibt. Die Leute sagen »Viertel der Raubvögel«.
Ich schwöre Ihnen, es gibt mehr Raubvögel in dieser Gegend als Picassos.
Yéyé und ich haben uns gefragt, wie das wohl so läuft. Muss doch großartig sein, irgendwas als Erster zu sagen, und dann bleibt es für immer. Bestimmt ist der Typ, der die Cité als Erster nach den Raubvögeln benannt hat, verdammt glücklich, dass die Leute sie immer noch so nennen.
Ich würde ja gerne eine witzige Geschichte oder eine schreckliche Horror-Story erfinden, die sich alle weitererzählen. Und wenn sie dann eines Tages jemand mir erzählt, würde ich mich totlachen.
Ich würde zu dem Kerl sagen: »Krieg dich wieder ein, Mann, die Geschichte stammt von mir!«
Yéyé und ich haben versucht, uns eine auszudenken. Das war gar nicht so einfach, weil wir immer wieder bei einer Story gelandet sind, die es schon gab. Mein Bruder Henry hat mir mal etwas erzählt, bei dem es mich mindestens drei Wochen lang gegruselt hat. Er hat erzählt, dass Menschen, die an einer Überdosis gestorben sind, als Geist in den Kellern der Gebäude spuken und versuchen, einen mit ihren widerlichen Spritzen zu piken. Ich kann Ihnen sagen, danach hab ich mich geweigert, auch nur einen Schritt weiter als runter ins Erdgeschoss zu gehen. Ich habe Yéyé die Geschichte erzählt, und er meinte, das wäre ja wohl kompletter Blödsinn und mein Bruder, der selber Junkie ist, würde wahrscheinlich diese Gespenster sehen, wenn er sich einen Schuss setzt. Er soll sich verpissen, habe ich zu Yéyé gesagt, und sich um den Scheiß seines eigenen Bruders kümmern, der genauso ein Junkie ist. Er meinte, das wäre doch derselbe Scheiß, weil unsere Brüder sich immer zusammen einen Schuss setzten.
Yéyé ist das, was man sich unter einer fürchterlichen Nervensäge vorzustellen hat. Ich schwör’s Ihnen, der Typ flunkert Ihnen schon das Blaue vom Himmel herunter, wenn Sie ihn nur nach der Uhrzeit fragen. Er ist zwölf und bereits der König der Aufschneider.
Ich weiß, wovon ich rede, denn ich bin oft genug mit ihm unterwegs. Manchmal sitzt er vor unserem Turm oder in der Eingangshalle und labert die Leute schräg von der Seite an. Wenn er eine alte Frau sieht, die sich, schwer beladen mit ihren Einkaufstüten, die Treppe hinaufkämpft, ruft er, anstatt ihr zu helfen:
»Na, Madame, ist Ihr Mann immer noch nicht zurück?«
Und der Mann der Alten ist bestimmt schon tot und überhaupt. Zum Glück für mich ist Yéyé nicht mein einziger Kumpel, wir sind eine ganze eingeschworene Truppe.
Ich erinnere mich nicht mehr, wann ich meine Kumpels kennengelernt habe. Wahrscheinlich, weil wir uns schon immer gekannt haben. Sie fragen sich ja auch nicht, wann Sie Ihre Mutter kennengelernt haben. Und mit meinen Kumpels ist es genauso, wir haben uns am Tag unserer Geburt kennengelernt. Vor zehn Jahren. Auch Yéyé. Obwohl er zwei Jahre älter ist als wir. Das ist aber sein Problem. Da musste er diese zwei Jahre eben warten, und es ist nicht mal aufgefallen. Er hat sich aber auch mächtig ins Zeug gelegt und ist zwei Mal sitzengeblieben, damit er seinen Rückstand aufholt und zu uns in die Klasse kommt.
Fest steht, meine Freunde und ich, wir sind eine richtig coole Bande. Das weiß jeder hier im Viertel. Und selbst diejenigen, die uns nicht ausstehen können, finden, dass wir ziemlich beeindruckend sind.
Natürlich gibt es Unterschiede.
Wenn Madame Hank, unsere Englischlehrerin, sagt: »Ihr seid mir vielleicht eine schöne Bande!«, dann heißt das übersetzt, dass sie uns für einen Haufen Vollidioten hält. Wenn dagegen Monsieur Lorofi, unser Fußballtrainer, brüllt: »Ihr seid ’ne super Bande, Jungs!«, dann ist klar, dass wir die Größten sind, dass wir das Spiel gewonnen haben und dass wir ein phantastisches Team aus Stürmern und Mittelfeldspielern beisammenhaben.
Dazu muss man wissen, dass Freizeit für uns bedeutet, Fußball zu spielen. Würde in der Schule das zählen, was wir auf dem Platz lernen, hätten wir schon längst den Nobelpreis bekommen. Das denke zumindest ich, obwohl mein Bruder Henry behauptet, dass man in den Schulen unserer Gegend der Beste sein kann und trotzdem der Schlechteste von ganz Paris oder sonst wo ist. Vielleicht hat er recht, aber ich mag es nicht, wenn man solche Sachen sagt.
Für mich ist es hier besser als überall sonst auf der Welt.
Ich habe gar nicht vor, Ihnen mein ganzes Leben zu erzählen, aber eines sollten Sie sich wirklich merken: Ich heiße Charly. Na gut, okay, eigentlich heiße ich Charles, aber ich hasse es, wenn man mich so nennt. Und wer es versucht, kann sich darauf gefasst machen, richtig eins auf die Nase zu kriegen. Ist doch ganz einfach: Char-ly. In der Schule gibt es einige Lehrer, die mich hartnäckig so nennen, wie ich eigentlich heiße. Ihnen kann ich schlecht eins auf die Nase geben, aber glauben Sie mir, es juckt mich in den Fingern.
Na ja, wie auch immer, ich höre inzwischen gar nicht mehr hin, wenn mich jemand »Charles« nennt, ich habe ganz vergessen, dass ich gemeint sein könnte.
Mit Nachnamen heiße ich Traoré, das kommt aus Mali, logisch, meine Eltern kommen ja auch daher. Angeblich ist mein Vater wieder dorthin zurückgekehrt, aber man weiß nichts Genaues darüber. Überhaupt kann ich nicht gerade einen Aufsatz schreiben mit dem, was ich über ihn weiß. Er ist einen Monat nach meiner Geburt abgehauen und hat meine Mutter und meinen Bruder so allein im Regen stehen lassen wie die Flügelspieler von Paris Saint-Germain ihre beiden Stürmer. Mich persönlich hat das nicht berührt. Ich war gerade einen Monat alt und dachte bestimmt viel eher an die Milch in den Brüsten meiner Mutter als daran, womit mein Vater wohl seine Zeit verplemperte. Aber für meinen Bruder war das anders. Und meine Mutter ist sich sicher, dass das der Grund ist, weshalb Henry zum Junkie geworden ist und dauernd Scheiße baut. Ich glaube allerdings, dass mein Bruder ein richtiger Idiot ist und dass er Drogen nimmt, um zu vergessen, wie bescheuert er ist. Na ja, da hat wohl jeder seine eigene Theorie. Glauben Sie nicht, ich wäre herzlos, wenn ich so von meinem Bruder rede. Aber ich schwör’s Ihnen, Sie wären an meiner Stelle bestimmt schon in einer Anstalt gelandet. Ich glaube, mein Bruder ist bloß zur Welt gekommen, um mir auf den Sack zu gehen. Entschuldigen Sie, dass ich es so drastisch formuliere, aber anders lässt es sich nicht ausdrücken. Würde ich jedes Mal, wenn er mir auf die Nerven geht, einen Euro bekommen, dann wäre ich bereits Milliardär. Ich kriege aber nichts und werde umsonst verrückt.
Was ich Ihnen eigentlich erzählen wollte, ist eine Sache, die sich heute Morgen zugetragen hat. Mann, war das eine Geschichte. Darüber könnte man wahrscheinlich ein richtiges Buch schreiben. So ganz hab ich es zwar noch nicht verstanden, aber ich erzähle es Ihnen vielleicht trotzdem am besten gleich. Gewisse Dinge muss man sich von der Seele reden, sie müssen raus, sonst bilden sich im Bauch Kugeln, die schließlich explodieren. So wie es dem Vater meines Kumpels Régis Montales ergangen ist, den hat man nämlich eines Morgens tot im Bett gefunden, er badete in mindestens hundert Litern Blut. Der alte Kerl machte immer den Eindruck, als würde er wie im Märchen leben, aber die Leute sagten, er starb, weil er so traurig war, dass seine Frau ihn zehn Jahre zuvor verlassen hatte. Mein Tipp ist ja eher, dass er sich zu Tode gesoffen hat. Jedenfalls wurde Régis danach zu seiner Oma geschafft und hat inzwischen den Ruf, der gewalttätigste kleine Junge von ganz Frankreich zu sein. Bestimmt wird Régis in zwanzig Jahren über eine Riesenkugel im Bauch klagen, die dann explodiert. Genauso der Sohn von Régis, zwanzig Jahre später, und so weiter, bis die Autos fliegen können und die Pitbulls zu den vom Aussterben bedrohten Tieren gehören.
Wahrscheinlich finden Sie mich seltsam, weil ich Ihnen ein derartiges Durcheinander auftische, aber das gehört zu mir. Und genau darin liegt mein Problem. Wenn meine Mutter zum Elternabend geht, erzählen die Lehrer ihr, wie gut ich bin und so, aber zum Schluss sagen sie immer, dass ich mich mehr konzentrieren muss. Ich habe meiner Mutter gesagt, dann sollen sie die Stunden eben interessanter machen, aber sie hat mich ausgeschimpft. Meine Mutter gehört zu den Menschen, die überzeugt davon sind, dass die Schule eine Chance fürs Leben ist und dass die blöden Lehrer immer recht haben. Wenn man ihr erklären würde, an meinen Problemen wären meine Beine schuld, dann würde sie mir die bestimmt abhacken. Meine Mutter hat nie eine Schule besucht, und sie braucht mindestens drei Wochen, um einen Brief zu lesen. Als ich ihr zum ersten Mal ein Gedicht vorgelesen habe, da hat sie eine Stunde lang geheult, mir einen Geldschein in die Hand gedrückt und gemeint, sie wäre stolz auf mich. Ich wollte ihr noch einen Haufen anderer Sachen vorlesen, aber sie hat sich dran gewöhnt und zetert jetzt dauernd herum wegen meiner Konzentrationsschwierigkeiten.
Na ja, das Leben ist kein Wunschkonzert.
Am schlimmsten ist es, wenn dir jemand gerade was von deinen Konzentrationsschwierigkeiten erzählt, während du dasitzt und zuhörst, aber nach zwei Sekunden feststellst, dass du längst abgeschweift bist. Wenn man sich dann nicht schämt, ist man echt ein Vollpfosten.
Sehen Sie, schon habe ich wieder den Faden verloren. Ich muss mich behandeln lassen. Es kann doch nicht sein, dass man ständig an tausend Dinge gleichzeitig denkt. Am besten ist es, wenn ich an Mélanie Renoir denke. Also, da kann die Welt um mich herum explodieren, wenn ich an dieses Mädchen denke, kann ich meinen eigenen Pulsschlag hören, und mein Mund wird ganz trocken. Sie haut mich um. Ich würde für sie sterben, sie müsste es nur von mir verlangen. Wir haben uns Anfang des Jahres kennengelernt, als ich ans Collège Charles Baudelaire gekommen bin. Wenn man da aufgenommen wird, muss man ein Baudelaire-Gedicht auswendig lernen. Wohlgemerkt auswendig, ansonsten fliegt man gleich wieder raus. In diesem Jahr war es Der Mensch und das Meer. Ein tolles Gedicht. Baudelaire sagt eine Menge Dinge, die ich echt klasse finde.
In dem Gedicht sagt er: Du freier Mensch, du liebst das Meer voll Kraft./Dein Spiegel ist’s. In seiner Wellen Mauer/Die hoch sich türmt, wogt deiner Seele Schauer.
Das hat mir eine richtige Gänsehaut gemacht.
Wie auch immer, es wird jedenfalls ein Schüler ausgewählt, der das Gedicht vor versammelter Mannschaft im Speisesaal aufsagen muss. Sie losen aus, wer es sein soll, und wir beten dann alle, dass es einen anderen trifft. Zum Glück haben einige wirklich Pech im Leben. Damit meine ich zum Beispiel Freddy Tanquin. Dieser Typ zieht das Unglück derart an, dass er sogar im Sommer mit einem Schal um den Hals rumläuft, weil er sich sonst bestimmt erkälten würde. Wenn es vierzig Grad heiß ist und man mit Schal um den Hals aufkreuzt, hinterlässt man nicht gerade den Eindruck, ein starker Typ zu sein.
An dem Tag musste Freddy mitsamt seinem Schal vor die vollständig einberufene Schülerschaft treten.
Die Direktorin sagte: »Monsieur Tanquin wird uns nun das Gedicht von Charles Baudelaire vortragen.«
Freddy räusperte sich mindestens fünftausend Mal, bevor er ansetzte: »Der Mensch will immer mehr … von Charles Baudelaire.«
Die Schüler haben sich ausgeschüttet vor Lachen, man hätte meinen können, es gibt ein Erdbeben. Der arme Freddy, dieser Dummkopf, hatte das Gedicht nämlich nicht gelesen, und einer unserer Kumpels, Kader Halfoui, hat es ihm vorgesprochen, damit er es auswendig lernen konnte. Allerdings hatte ihm Kader irgendeinen Mist eingetrichtert, und Freddy plapperte alles brav nach, weil er dachte, Baudelaire würde immer vom Mehr reden, nicht vom Meer.
»Du geiler Mensch, du liebst ihn immer mehr, den Saft./Dein Schwanz erbebt. In seiner Wellen Mauer /Er hoch sich türmt, tropft seiner Seele Schauer.«
Die Direktorin wagte nicht, ihn zu unterbrechen, weil ja die oberen Zehntausend von der Stadtverwaltung anwesend waren und so taten, als würde sie das, was da passierte, überhaupt nicht aus der Fassung bringen. Diese Typen sind ziemlich gut darin, so zu tun, als könnte sie etwas überhaupt nicht aus der Fassung bringen. Zum Schluss haben wir so sehr gelacht, dass Freddy es gemerkt hat.
»Scheiße … Hab mir doch gleich gedacht, dass eine Seele nicht tropfen kann!«
Brüllendes Gelächter. Er ging mit der Direktorin hinaus, und wir haben ihn das ganze Jahr hier nicht mehr gesehen, den armen Trottel.
Ich mag Gedichte. Von Charles Baudelaire habe ich schon einige gelesen. Und selbst da, wo ich sie nicht verstehe, finde ich sie schön. Ich habe ja den Eindruck, es ist gar nicht so wichtig, sie ganz zu verstehen. Diese Dichter sind eben anders. Das ist wie bei Träumen, die muss man auch nicht wirklich verstehen. Das nimmt einem keiner übel.
Sehen Sie, schon wieder sind meine Gedanken in tausend verschiedene Richtungen geschossen.
Da fällt mir ein: Ich wollte Ihnen ja von Mélanie Renoir erzählen, vor allem aber davon, was mir heute Morgen passiert ist, eine üble Geschichte. Also von wegen der Sache mit Mélanie Renoir sage ich jetzt bloß, dass mich dieses Mädchen regelrecht umhaut und dass wir darüber später weiterreden.
Erst einmal konzentriere ich mich wie verrückt und fange meine Geschichte ein. Und die hat es wirklich in sich!
Alles begann heute Morgen, um acht Uhr früh.
Zweites Kapitel
8 Uhr
Morgens um acht Uhr mache ich mich auf den Weg zur Schule. Um halb neun beginnt der Unterricht, aber ich brauche eine halbe Stunde, um durch die Stadt zu fahren. Im Sommer wie im Winter. Es kann schneien oder was immer, und trotzdem muss ich um acht Uhr losfahren und durchquere die Stadt wie ein gefrorenes Würmchen. Heute Morgen war es also ungefähr acht, als ich im Aufzug stand. Die Sache ist die, dass dieses Ding ungefähr einmal alle tausend Jahre funktioniert. Und wenn es mal funktioniert, freut man sich wie ein Schneekönig.
Als die Türen im Erdgeschoss aufgingen, stand ich auf einmal vor ein paar Bullen. Sie waren zu dritt, darunter eine stramme Frau. Sie erinnerte mich an Madame Boulin, die Direktorin unserer Schule. Sie hätte glatt ihre Schwester sein können. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon aufgefallen ist, aber wenn man zwei Menschen begegnet, die sich ähneln, vermischen sich im Kopf die Bilder, und man bekommt es nicht mehr auf die Reihe, sie auseinanderzuhalten. Die Bullen und die Frau wirkten irgendwie verloren, und man merkte, dass sie sich hier nicht besonders gut auskannten.
Die Frau wandte mir den Kopf zu und machte ein Gesicht, bei dem einem das Herz in die Hose rutscht.
Sie fragte mich: »Weißt du, wo Joséphine und Henry Traoré wohnen?«
»Ähm, im Sechsten.«
Ohne ein Dankeschön, ohne einen Piep ließen sie mich vorbei, sie traten kaum zur Seite und verschwanden zielstrebig im Fahrstuhl. Mann, war das ein Schreck. Nicht, dass ich überrascht gewesen wäre, dass die Polizisten mich nach unserer Adresse gefragt hatten. Daran bin ich gewöhnt, schließlich macht mein Bruder ja ständig irgendwelche Dummheiten. Merkwürdig fand ich, dass die Frau dabei war. Und dass sie Joséphine sagte. Das ist meine Mutter. Normalerweise wollen sie Henry sprechen, und damit hat es sich. Sie bringen ihn aufs Kommissariat, und meine Mutter muss dann hin und betteln, dass er wieder freigelassen wird. Das ist ganz normal hier, und die meisten Mütter der Drogies kennen den Weg zum Kommissariat und seine widerlichen Amtsstuben auswendig. Als ich zu klein war, um allein zu Haus zu bleiben, musste ich ein oder zwei Mal mit meiner Mutter aufs Kommissariat. Mann, war das öde. Und außerdem tat es mir in der Seele weh, wie sie sich erniedrigte, um Henry freizubekommen. Anschließend führte sie uns zum Essen ins Restaurant des Einkaufszentrums aus und wirkte dann richtig glücklich, dass wir wieder zusammen waren. Ich hätte Henry ordentlich verdroschen, damit er mit seinem Blödsinn aufhört. Aber meine Mutter freut sich immer so, wenn wir alle drei zusammen sind.
Der Satz der Frau klingt mir noch im Ohr: »Weißt du, wo Joséphine und Henry Traoré wohnen?«
Die Aufzugtüren schlossen sich hinter dem Trio. Ich entschied mich, wieder hinaufzugehen und nachzusehen, was los war. Ich nahm die Treppe. Das mache ich aus Gewohnheit so. Falls der Aufzug steckenbleibt. Oder um ein Wettrennen mit meinem Kumpel Jimmy Sanchez zu machen, der in der vierten Etage wohnt. Ich bin ein verdammt guter Sprinter, müssen Sie wissen, und wenn ich wirklich voll in Form bin, schaffe ich die Stufen schneller als der Aufzug. Mein Rekord ist die siebte Etage. Um vor dem Aufzug in der Siebten anzukommen, müssen Sie ein echt guter Sprinter sein, fragen Sie mal Jimmy Sanchez. Diesmal nahm ich zwar vier Stufen auf einmal, aber ich kam trotzdem später an. Es war schließlich acht Uhr morgens, und ich bin kein so früher Vogel. Ich habe die Tür zum Treppenhaus ein wenig aufgedrückt, und da sah ich meine Mutter, wie sie vor den Bullen und der Frau stand. Meine Mutter war schon angezogen, geschminkt und alles. Bestimmt wollte sie gerade zu den Rolands zum Arbeiten gehen. Normalerweise verlässt sie das Haus um zehn nach acht, um den Bus um zwanzig nach zu erwischen. Meine Mutter muss sich immer schminken. Klar, steht ihr ja auch gut, sie legt auch nicht zu viel auf, aber ich für meinen Teil fände das doch ziemlich blöde, wenn ich mir jeden Tag meines Lebens solch ein Zeug ins Gesicht klatschen müsste. Frauen sind schon etwas Seltsames, finde ich. Die Frau bei den Polizisten war auch geschminkt, und ich stellte mir vor, wie meine Mutter und sie extra früher aufgestanden waren, um sich vollzukleistern, und dass sie sich nun mit ihrer Schminke gegenüberstanden. Die Frau zog ein Papier aus ihrer Tasche und las es meiner Mutter vor. Ich verstand nichts, aber es klang irgendwie nicht gut. Meine Mutter machte ein komisches Gesicht, sie schaute die Frau gar nicht an. Sie starrte auf das Papier. Dann sagte die Frau etwas. Meine Mutter hob den Kopf, und ich hatte den Eindruck, dass sie weinte. Es entstand eine ungemütliche Stille. Meine Mutter ging zurück in die Wohnung, und die Bullen und die Frau folgten ihr. Sie ließen die Tür nicht ins Schloss fallen, und daher dachte ich mir, sie kämen bestimmt gleich wieder heraus. Ich bemerkte, dass mir das Herz bis zum Hals schlug. Das passiert mir oft. Wenn Sie mich sehen, würden Sie denken, ich wäre kaltblütig wie eine Schlange. In Wirklichkeit bin ich eher ein Angsthase. Ich kann mich zwar ruhig und selbstsicher geben, aber das wirkt nur so. Und ich weiß, dass die meisten anderen Typen genauso sind.
Um zu überleben, muss man so tun, als wäre man absolut gefühllos.
Die Polizisten und die Frau kamen wieder heraus, mit meiner Mutter im Schlepptau. Sie machte noch immer dieses komische Gesicht, trug jetzt außerdem ihren Mantel, ihre Handtasche und eine Art Sporttasche. Ich weiß nicht mehr, woher diese Sporttasche stammt, ich glaube, sie ist von Henry, als er noch Leichtathletik machte. Sein Ding war der Sprint. Sie hätten ihn sehen sollen, er ging ab wie eine Rakete. Selbst ich wäre im Vergleich zu ihm ein lahmer Škoda gewesen. Aber die Drogen haben ihn total ausgebremst, wenn Sie verstehen, was ich meine. Jedenfalls trug meine Mutter diese Tasche, die bis oben hin vollgestopft zu sein schien. Sie zog die Tür zu, und einer der Bullen holte den Aufzug. Es war seltsam, meine Mutter mit diesen Leuten da stehen zu sehen. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, irgendwie passte das nicht zusammen. Meine Mutter blickte geradeaus, so als ob nichts wäre. Sie kann das gut, so gucken, als ob nichts wäre. Sie könnte im Rathaus arbeiten und Politik machen. Aber wenn man sie kennt wie ich, sieht man sofort, ob sie sich Sorgen macht. Und während sie so dastand und auf den Fahrstuhl wartete, konnte sie so unbeteiligt dreinschauen, wie sie wollte – ich sah genau, dass sie sich verdammt große Sorgen machte.
Und dann drehte sie sich plötzlich zu mir um und sah mich an. Ich spürte, wie mir das Herz stehenblieb. Dabei hat mich meine Mutter bestimmt schon tausend Mal angeschaut. Ich glaube sogar, sie schaut mich ständig an. Manchmal sitzen wir ganz friedlich vor dem Fernseher, und ich bemerke, dass meine Mutter zu mir herüberschaut. Selbst wenn das Programm spannend ist, schaut sie zu mir herüber. Ich war ein wenig verlegen, als sie mich an der Tür zum Treppenhaus stehen sah. Nicht deshalb, weil ich eigentlich unterwegs zur Schule hätte sein sollen, sondern weil ich mich fast wie ein Dieb versteckte. Außerdem weiß ich, dass meine Mutter mir die Angst vom Gesicht ablesen kann. Ich kann mich verstellen, wie ich will, und tausend Mal erzählen, wie großartig das Leben ist – wenn mich etwas ängstigt, sieht sie es sofort.
Da ich so verlegen war, als sie mich entdeckte, habe ich ein Lächeln aufgesetzt. Ein breites Grinsen. Ich muss wohl ziemlich blöd ausgesehen haben. Mit der Angst eines kleinen Jungen, der nicht begreift, was los ist, und darüber das Lächeln von einem Klassenprimus. Manchmal verrenkt man sich schon zu komischen Grimassen. Vor allem, wenn man nur Bahnhof versteht. Außerdem liegt mir Lächeln ohnehin nicht so. Es gibt ja Leute, die lächeln die ganze Zeit. Mann, gehen mir solche Typen auf die Nerven! Wie dieser Anthony Meltrani, der ständig wie ein Grenzdebiler grinst. Wenn Sie dem auf der Straße begegnen, grinst er garantiert vor sich hin. Wenn’s regnet, grinst er, dieser Idiot. Fahrkartenkontrolle – er grinst. Ich bin mir sicher, selbst nachts, wenn er schläft, hat er diese Banane quer über dem Mund.
Meine Mutter stutzte kurz und betrachtete meine verbogene Silhouette. Und dann tat sie etwas Unglaubliches. Wäre es nicht meine Mutter gewesen, ich hätte sie für ein Monster gehalten. Sie lächelte nicht zurück, wie sie es sonst immer tut, egal, wie und wo sie mich sieht!
Sie wandte einfach den Kopf ab. Einfach so. Kein Zwinkern, kein Irgendwas. Sie wandte einfach nur den Kopf ab. Als würde ich gar nicht existieren. Dann kam auch schon der Aufzug, sie sind eingestiegen, ich hörte, wie die Türen sich schlossen, und erkannte an dem Geräusch, dass sie nach unten fuhren.
Was war denn das jetzt bloß für eine Geschichte?
Mein Herz klopfte weiterhin im Rhythmus von wildem Gewehrfeuer. Immer in dem Augenblick, in dem man am wenigsten damit rechnet, passieren die verrücktesten Dinge. Du machst dich gerade ganz ruhig auf den Weg zur Schule, und plötzlich schneien eine Horde Bullen und eine Tante herein, die deiner Schuldirektorin gleicht wie ein Ei dem anderen, kassieren deine Mutter ein, und du weißt nicht einmal, wohin sie sie bringen. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte einen Radiergummi oben auf dem Kopf, um einen Tag noch mal von vorn beginnen zu können.
Ich beschloss, zurück in unsere Wohnung zu gehen. Seit Beginn des Jahres besaß ich meinen eigenen Schlüsselbund, und meine Mutter ging mir dauernd auf den Wecker mit ihren Geschichten von wegen Vertrauen und so. Aber im Grunde blieb ihr keine andere Wahl: Seit ich auf die höhere Schule gehe, komme ich nachmittags oft vor ihr nach Hause.
Meine Hand zitterte wie die von einem alten Mann, ich bekam den Schlüssel nicht ins Schloss. Als ich es endlich hinkriegte, bemerkte ich, dass die Tür gar nicht verriegelt war. Vielleicht hatte meine Mutter das absichtlich getan, für den Fall, dass Henry oder ich unseren Schlüssel vergessen hätten. Oder vielleicht nur, weil sie es selbst vergessen hatte. Ich öffnete die Tür, und das Komische daran war, dass ich den Eindruck hatte, unsere eigene Wohnung wie ein Einbrecher zu betreten. Bestimmt, weil ich gerade die Bullen gesehen hatte, und außerdem, weil ich ja eigentlich in der Schule hätte sein müssen.
Ich lief quer durchs Wohnzimmer, um aus dem Fenster zu schauen, von dem aus man den Eingang unseres Gebäudes sehen kann. Ich machte das Fenster nicht richtig auf, nur eine Handbreit, und drückte meinen Kopf in den Spalt. Gerade kam meine Mutter mit den Polizisten und der Frau aus unserem Wohnturm. Draußen war sonst niemand, das ist oft so um die Uhrzeit, die einen sind arbeiten, und die anderen schlafen. Gut, dass da keiner war, denn meine Mutter hätte es bestimmt nicht gern gehabt, wenn jemand sie zusammen mit diesen Leuten gesehen hätte. Sie gingen bis zum Bürgersteig, wo ein Kleintransporter der Polizei geparkt stand. Einer der Polizisten öffnete die Schiebetür und ließ meine Mutter einsteigen. Die Frau ist auch hinten eingestiegen, hat sich neben meine Mutter gesetzt, die beiden Polizisten vorne.
Als der Wagen losfuhr, versuchte ich, meine Mutter durch die Scheibe zu sehen, doch es gelang mir nicht.
Ich hatte das Gefühl, ich würde sie nie wiedersehen.
Drittes Kapitel
8 Uhr 20
Zu den Dingen, die ich im Leben am meisten mag, gehört das Schlafzimmer meiner Mutter. Ich liebe es, dort herumzustöbern. Sie hat eine Menge Sachen, die ich gern berühre und in die Hand nehme.
Ich ließ mich auf den Stuhl vor ihrer Frisierkommode sinken. Das Ding sieht eigentlich eher aus wie ein Schreibtisch, aber sie nennt es nun mal Frisierkommode. Der Stuhl ist sehr bequem. Sie hat ihn mit Kissen gepolstert und ein Tuch über die Lehne gebreitet. Da saß ich also und schaute aus dem Fenster. Seltsam, aus diesem Fenster hat man einen ganz anderen Blick als aus den übrigen Fenstern in der Wohnung. Das Wohnzimmer, die Küche und Henrys und mein Zimmer gehen nach vorne, auf den Eingangsbereich unseres Wohnturms hinaus. Meine Mutter hingegen sieht auf eine Siedlung mit Einfamilienhäusern, dahinter liegt der Sportplatz.
Der Frisiertisch hat zwei kleine Schubladen. In der rechten bewahrt meine Mutter ihren ganzen Schmuck auf: Ketten, Reife und Ringe, ein Armband, in das der Vorname meines Bruders eingraviert ist, eine Medaille mit der Aufschrift »+qu’hier – que demain« – mehr als gestern, weniger als morgen –, unzählige Anhänger und Ohrringe. Manchmal, wenn ich genug Zeit habe, probiere ich alles an. Dann sehe ich aus wie ein Rapper … Na ja, eben wie ein Rapper, der sich den Schmuck seiner Mutter unter den Nagel gerissen hat. In der linken Schublade liegen Briefe, Rechnungen, Garantien und mein Personalausweis. Also, mein Personalausweis ist ja auch so eine Sache, mit der ich mich stundenlang beschäftigen könnte. Meine Mutter will nicht, dass ich da rangehe, als wenn dieses Dokument das einzig Wertvolle in unserer Wohnung wäre. Auf dem Foto muss ich ungefähr fünf sein, habe einen Afro-Look allererster Güte, vorn fehlen mir zwei Schneidezähne, und ich grinse wie bescheuert in die Kamera. Ich bin echt süß auf dem Bild. Wirklich, ich schwör’s Ihnen. Heute strahle ich nicht mehr so. Wenn Sie meine Klassenfotos eins neben das andere legen, werden Sie feststellen, dass dieses Strahlen von Jahr zu Jahr mehr aus meinem Gesicht verschwindet. Das geht wahrscheinlich allen so. Als Kind bringt einen alles zum Lachen, und als alter Mensch ist es genau das Gegenteil: Man findet immer etwas zum Meckern. Zumindest trifft das auf die Alten hier in der Cité zu, die schimpfen so viel, dass ich oft ganz deprimiert bin.
Heute Morgen, weil meine Mutter ja weg ist, wollte ich mich noch mal in Ruhe umsehen. Um eine Erklärung zu finden. Ich bin also den Stapel Papiere in der linken Schublade durchgegangen und auf den Brief meines Vaters gestoßen. Den letzten, den er meiner Mutter geschrieben hat. Obwohl ich ihn in- und auswendig kenne, habe ich ihn noch einmal gelesen. Er schreibt ihr, dass er gut in Mali angekommen ist und dass ihn Freunde der Familie bei sich aufgenommen haben. Dass er sich gleich am nächsten Tag eine Arbeit suchen wird, um so rasch wie möglich Geld schicken zu können. Dass er uns sehr liebt und wir ihm sehr fehlen, schreibt er auch noch.
Der Brief ist so alt wie ich, zehn Jahre, und seitdem ist nie wieder etwas gekommen. Absolute Funkstille. Als meine Mutter einmal bei der Familie meines Vaters angerufen hat, erzählte man ihr, er wäre doch nur für einen Monat gekommen und längst zurück in Frankreich. Nie wieder hat sie danach auch nur versucht, ihn ausfindig zu machen.
Eines Abends sprach ich sie darauf an. »Glaubst du, Papa ist tot?«
»Ich weiß es nicht, Charly.«
»Und wenn er nicht tot ist, was glaubst du, wo er ist?«
»Ich weiß es nicht.«
»Warum willst du es nicht wissen?«