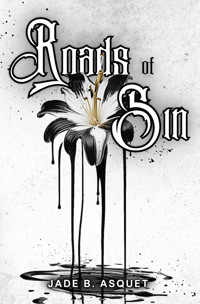
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Adina kennt nur ein Leben: das der Elaren, einer strengen Glaubensgemeinschaft, deren Traditionen und Regeln ihr jeglichen Kontakt zur Außenwelt verbieten. Ihr Mann Elijah, Pfarrer und Prophet der Gemeinschaft, beschert ihr hinter verschlossenen Türen die Hölle auf Erden. Missbraucht, gedemütigt und ohne Hoffnung, wagt Adina eines Nachts das Unmögliche: Sie flieht in die erbarmungslose Wüste von New Mexico. Dort, am Rande der Verzweiflung, wird sie von Reaper gefunden – dem Präsidenten des berüchtigten Satan Skulls MC. Reaper ist ein Mann ohne Skrupel, ein Teufel auf einem Motorrad, für den Schmerz eine Waffe ist. Er bringt Adina in den Club, überzeugt, dass sie in seiner Welt nicht überleben wird. Doch er unterschätzt sie. Während sie langsam beginnt, in dieser rauen Umgebung Wurzeln zu schlagen, entdeckt sie, was Freiheit wirklich bedeutet. Zwischen den Bikern, die wie Brüder füreinander einstehen, findet Adina etwas, das sie nie erwartet hätte: ein Zuhause, Freundschaft – und vielleicht sogar einen Mann, der ihr Herz wieder schlagen lässt. Doch Reaper kämpft mit seinen eigenen Dämonen. Er glaubt, dass er zu düster und Adina zu gebrochen ist, um ihr je das geben zu können, was sie verdient. Gefangen zwischen Schatten, Gewalt und der aufkeimenden Hoffnung auf ein neues Leben, muss Adina lernen, für sich selbst zu kämpfen – und die Leidenschaft eines Mannes zu akzeptieren, der genauso gefährlich ist wie der Abgrund, aus dem er sie gerettet hat. Doch Adinas Vergangenheit ist ihnen näher, als sie ahnen, und Elijah wird nicht zulassen, dass sie ihm entkommt. Roads of Sin ist der dunkle und sinnliche Dark-Romance-Auftakt der "Satan Skulls-Reihe" über Flucht, Neuanfang und die unerwartete Kraft der Liebe. Zwischen den Grenzen von Gesetz und Gesetzlosigkeit, Unschuld und Sünde, stellt sich die Frage: Kann eine gebrochene Frau in einer Welt voller Gefahr heilen – und ein Mann, der nichts zu verlieren hat, sie retten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
ROADS OF SIN
____________________________________________________________________________
SATAN SKULLS
EINS
JADE B. ASQUET
1. Auflage, 2025
Copyright © 2025 JADE B. ASQUET
Alle Rechte vorbehalten.
Herausgeber
Jade B. Asquet
Kontakt
Obere Dorfstraße 7
02763 Zittau
Deutschland
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede unberechtigte Vervielfältigung, Verbreitung oder Weitergabe ist ohne schriftliche Zustimmung des Autors untersagt.
resme, das ist für dich.
Ohne dich würde es dieses Werk nicht geben.
Und egal, wo du gerade bist
– ich hoffe, es geht dir gut.
Inhaltswarnung
Dieses Buch enthält Themen und Darstellungen, die für einige Leser:innen verstörend oder belastend sein könnten. Dazu gehören:
- Explizite sexuelle Inhalte
- Häusliche Gewalt
- Mord und Tod
- Trauer und Verlust
- Kriminalität und Waffenbesitz
- Sexuelle Belästigung
- Missbrauch
Kapitel 1
Ich hatte ihn doch nicht umgebracht. Oder doch?
Nein.
Nein, er hatte geatmet und sich dabei auf dem getäfelten Holzboden des Wohnzimmers gewunden.
Elijah lebte.
Aber er hatte geblutet, als ich panisch davongerannt war, um mir die Autoschlüssel zu dem grauen Volvo in der Auffahrt zu schnappen. Er gehörte ihm, nur gelegentlich war es mir erlaubt, damit zu fahren, um den Anschein zu wahren, dass wir eine gleichgestellte, harmonische Ehe führten. Aber diese Ehe war weit entfernt von erfüllt und gesittet, denn mein Mann setzte alles daran, mir hinter den verschlossenen Türen unseres Zuhauses die Hölle auf Erden zu bereiten. Für jede Minute abseits dieser vier Wände und außerhalb seiner Reichweite, war ich dankbar.
Oft kamen diese Momente nicht vor. Einen Beruf übte ich nicht aus, hatte ich doch nie eine Ausbildung abgeschlossen oder eine höhere Schule besucht, was die Abhängigkeit von meinem Mann verstärkte. Stattdessen war es meine Aufgabe, ihm bei seiner Arbeit zu helfen. Elijah war Pfarrer hier in St. Johns, unser ranghöchstes Glaubensmitglied und als seine Frau band mich das gleichermaßen fest an diese Gesellschaft. Hielt er Predigen ab oder führte Bibellesungen durch, lag meine Verantwortung bei der Kirchenkasse, die, aufgrund der unausgesprochenen Regel der Gemeinde, jedes Mitglied müsse mindestens zehn Prozent seines Einkommens an das Gotteshaus abtreten, stets prall gefüllt war.
Ihr kirchlicher Glaube, die Bindung zu Gott, war für alle Elaren der zentrale Schwerpunkt des Universums. Das höchste Gut, um den ihr ganzes Leben kreiste.
Auch für mich. Zumindest bis zu diesem Abend.
Nur in einem ärmellosen, wadenlangen Nachthemd aus dem Haus zu rennen, zu fliehen, ohne eine wirkliche Vorstellung zu haben, wohin mich die nackten Füße tragen könnten, schien mir bis vor wenigen Stunden ein schier undenkbares Vorhaben zu sein. Obwohl ein Entreißen aus den Fängen meines Ehemannes seit Jahren in mir brannte, ähnlich Evas Verlangen vom Baum der Erkenntnis zu kosten.
Ich hatte mich ins Bett entschuldigt, aber weiter wie bis zur Tür war ich nicht gekommen. Elijahs Finger packten den hellen cremefarbenen Stoff meines Kleids so fest, dass der Saum riss. Was in ihm vorging, wusste ich nie und ich hatte vor langer Zeit aufgehört sein inneres Wesen zu ergründen. Seine faulige Verderbtheit würde mich sonst infizieren.
Mich gepackt, drang seine Zunge forsch in meinen Mund, nahm mir dabei die Luft zum atmen, bis ich würgte. Die Furcht umschlang meine Kehle, schnürte den grazilen Hals. Jedes Mal versuchte ich, seinem Griff zu entkommen, wehrte mich, aber auch jetzt drückten sich seine Finger grob in das Fleisch meines Oberarms. Frische blaue Male würden sich zu den anderen gesellen. Einen Überlebensinstinkt hatte ich nie besessen, zumindest nahm ich es an, hatte ich doch grundsätzlich zu große Angst und unterwarf mich freiwillig.
Aber ich lag falsch.
Nichts ahnend erfasste das Adrenalin meinen Körper, schoss durch ihn hindurch, wie ein Krieger, der in der drohenden Niederlage auf das Schlachtfeld trat und seine Truppen mit dem entscheidenden Schlag seines Schwertes zum Sieg führte. Diese Waffe, meinen Triumph, griff ich mit den Händen und schmetterte Elijah den blauen Blumentopf gegen den Schädel. Die weißen Margariten zerfielen in ihre Einzelteile, wie herbstliche Baumkronen in einem Windstoß.
Mein Aufbruch blieb von den umliegenden Nachbarn sicher nicht unentdeckt. Hier in St. Johns hatten selbst die Gartenzwerge Ohren.
Alle sagten, wir wären glücklich und führten eine Bilderbuchbeziehung, für die sie schwärmten.
Oh, Adina. Du musst doch platzen vor Ehrgefühl, einen Mann wie ihn zu haben.
Ja, die meisten Frauen beneideten mich dafür, eine so stattliche Partie abbekommen zu haben. Mein Gatte war ohne Frage ein begehrenswerter Vertreter des männlichen Geschlechts, der mich mit dem charismatischen Lächeln, den satten ebenholzfarbigen Haaren und Augen, die an leuchtendes Pulver aus Smaragden und Saphiren erinnerten, direkt in die Falle gelockt hatte. In der Zeit des Werbens war er rücksichtsvoll und zärtlich, mein eigenes Glück hatte ich kaum begreifen können. Aber sobald er mich mit diesem funkelnden Versprechen eines Rings an sich band, offenbarte er sein wahres Wesen.
Seitdem verging kein Tag ohne Beschimpfungen, Hassreden, Handgreiflichkeiten oder Schläge. Aber von der häuslichen Gewalt bekamen selbst die Zwerge im Vorgarten nichts mit. Bis auf gelegentliche Ohrfeigen erlitt ich Verletzungen ausschließlich an Stellen, die man, aufgrund der langen Ärmel unserer Blusen und der knöchelumspielenden Säume der Röcke, nicht sah. Niemand erahnte etwas.
Im Vergleich zu den Abscheulichkeiten, die das Schlafzimmer zierten, waren all die schmerzhaften Übergriffe jedoch ertragbar. Dieses grässliche Bett mit seinem verspottenden Blümchenüberzug war kein Rückzugsort zum Entspannen und Krafttanken, sondern eine Folterbank. Ein Schauplatz grausamer Schandtaten. Meiner Unschuld hatte mich Elijah auf erniedrigende Manier beraubt, mich heulend und blutend in diesen Laken zurückgelassen.
Doch trotz all des Leides gab ich nie ihm die Schuld, sondern mir. Die Heilige Schrift lehrte uns, dass es die göttliche Pflicht der Frau sei, ihrem Partner alle Wünsche zu erfüllen und ihn zu befriedigen. Seine Vergehen waren gerechtfertigt. Normal. Für jeden war dieser Akt demnach qualvoll oder könnte es sein, zumindest nahm ich es an. Sexualität wurde unter Elaren totgeschwiegen, den Zweck, Kinder zu zeugen, bekamen wir nicht einmal in der Schule gelehrt, sondern erfuhren ihn in dem Moment, in dem es zu spät war. Fleischeslust nur praktiziert, sobald ein Paar den Bund fürs Leben eingegangen war.
Die Welt da draußen, in der junge Menschen sich nachts aus Häusern stahlen, ihren ersten Kuss in der Schule erlebten oder ihre Jugend in vollen wilden Zügen auskosteten, waren für mich Ammenmärchen. Nie hatte ich die Grenzen unseres Städtchens zuvor überschritten.
Meine Flucht hatte kein genaues Ziel, denn die größte Priorität lag darin, größtmögliche Distanz zwischen mir und meinem Gatten zu erreichen. Ich hatte ihn geschlagen, ihm schwerwiegende Verletzungen zugeführt. Es war nichts im Vergleich zu den Wunden, die meinen Körper zeichneten, aber die Grausamkeiten, die er mir für diesen Ungehorsam antun würde, könnten mich ins Grab bringen.
Aus dem spärlichen Wissen, dass uns im Naturkundeunterricht vermittelt wurde, war mir bekannt, wo sich unsere Stadt innerhalb der Wüstenstaaten befand. New Mexico war das nächstgelegene Regierungsgebiet, weshalb ich St. Johns in südlicher Richtung verließ. Ein Telefon besaß ich nicht, und so blieb mir nur die Orientierung anhand von Straßenschildern.
Tränen überströmten unaufhörlich meine Wangen, mir war kalt vor Furcht, aber das Zittern ließ sich nicht unterbinden, egal wie hoch ich die Heizung im Auto aufdrehte. Die Konzentration lag auf meinem Fuß, der das Gaspedal wie einen Ziegelstein nach unten drückte, und der Wagen wie ein Lichtkegel durch die Nacht rauschte.
Sobald Albuquerque, die Hauptstadt New Mexicos, auf einem der Schilder auftauchte, folgte ich dem Straßenlauf. Er brachte mich auf eine riesige, mehrspurige Straße, auf der die Autos einem unkontrollierten Schwarm Bienen glichen. Links an mir rauschten immer wieder Fahrzeuge vorbei, sie hupten oder leuchteten mit ihren Scheinwerfern auf, aber ich wusste nicht, was sie mir damit zu verstehen geben wollten. Es überforderte mich, weshalb ich diese Straße bei der nächsten Möglichkeit gleich wieder verließ.
Das willkürliche Abbiegen auf meinem Weg, weil ich mutmaßte so die Chance zu verringern, aufgespürt zu werden, brachte mich zurück auf eine verlassene Straße in der Einöde. Hier kam mir kaum noch ein Auto entgegen und in der Ferne, war nichts außer Dunkelheit. Keine Straßenlaternen oder ein Lichtschein am Horizont, der auf eine naheliegende Stadt hindeutete. Meine Orientierung hatte ich vollständig verloren, ebenso wie das Zeitgefühl, weshalb ich einen raschen Blick auf die Uhr neben dem Tacho riskierte. Der winzige Augenblick meiner Unaufmerksamkeit genügte, dass sich ein Tier unbeachtet aus dem Gestrüpp löste. Ich erschrak und riss das Lenkrad herum, um auszuweichen, aber bei der Geschwindigkeit kam der Wagen ins Schlingern. Das Heck schlug aus und das Auto kam im Wüstengeröll zum Stehen.
_________
Mein Schädel dröhnte, als ich wieder das Bewusstsein erlangte. Scharf sog ich die Luft ein und löste den Kopf, der am Armaturenbrett klebte. Der Airbag hatte nicht ausgelöst und meine kalten Finger ertasteten die brennende Stelle an der Stirn, bis sie von Blut benetzt waren. Mit dem Geruch von Eisen kamen die Erlebnisse in einem Peitschenhieb zurück. Panisch versuchte ich, den Wagen wieder zu starten, doch nichts rührte sich.
»Nein, nein, nein!« Ein wimmernder Schlag gegen das Lenkrad.
Mein hilfesuchender Blick glitt zum Beifahrersitz und in das Handschuhfach, aber darin verbarg sich nichts, dass mir helfen würde. Wenn es aus mir unerfindlichen Gründen ein Telefon hier drin gab - wen hätte ich anrufen sollen? Hier zu warten war ebenfalls keine Option.
Ich unternahm einen letzten Versuch, den Motor zum Laufen bringen – vergeblich.
Ohne länger Zeit zu vergeuden, sprang ich aus dem Auto. Für einen Augenblick überlegte ich, ob es schlauer wäre, in die Wüste zu laufen und abseits der Straße zu bleiben. Es minimierte die Wahrscheinlichkeit gefunden zu werden, dezimierte gleichzeitig aber meine Überlebenschancen drastisch. Ich könnte mich verlaufen und bei den eisigen Temperaturen einen qualvollen Tod sterben. Die Wüste vermochte tagsüber warm und unbarmherzig sein, doch in der Nacht war sie weitaus gefährlicher. Zum aktuellen Zeitpunkt saß mir der Schock tief in den Knochen und schirmte mich damit vor der kalten Luft ab, die mich in starkem Wind traf. Viel Zeit blieb mir dennoch nicht.
Schon nach einigen Metern entlang der Straße schlang ich die dünnen Arme um den Oberkörper, um mit kräftigem Rubbeln der Hände die entblößte Haut zu wärmen. Es half nicht sonderlich, ebenso wenig wie das Zittern meiner Glieder.
Doch ich blieb nicht stehen.
Lieber starb ich hier draußen aufgrund von Erfrierungen, anstatt zurückzugehen. Alles wäre besser, als wieder in Elijahs Hände zu geraten. Selbst der Tod. Er streckte seine Finger mit jedem Schritt gieriger nach mir aus, bis die Kälte meine zierliche Gestalt übermannen würde und mich ihm auslieferte. Bis dahin lief ich weiter.
Inzwischen bildete mein Atem winzige Kristalle, die Luft in den Lungen schien zu gefrieren und schlug sich in Form von dichtem Nebel nieder. Er glitzerte.
In der Ferne tauchte ein Licht auf dem dunklen Asphalt auf – ich vermutete ein Auto, aber es war ein einzelner Scheinwerfer. Wenngleich mein Verstand ebenfalls kriechend erstarrte, war mir klar, dass es sich bei diesem Licht weder um meinen Mann noch die Polizei handelte. Es war ein Motorrad.
In hoher Geschwindigkeit raste es auf mich zu, doch es wurde langsamer. Ob das ein positives Omen war, vermochte ich nicht zu sagen, aber ich blieb wie angewurzelt stehen, um den Fahrer zu beobachten, der an mir vorbei rollte.
Er war groß, beinah so monströs wie das Zweirad unter ihm. Genaueres erkannte ich nicht, aber der Mann, seine Statur war zu gewaltig für ein weibliches Wesen, musterte mich ebenso. Das spürte ich auf der Haut.
Wie sah das für ihn aus, wenn mitten in der Nacht eine junge Frau, spärlich bekleidet und verletzt allein an der Straße entlang lief? Sonderlich viel dachte er sich nicht, denn nach einigen Augenblicken sah ich ihm hinterher, wie er weiter fuhr.
Hätte ich an seiner Stelle angehalten?
Sicher war ich mir nicht, dennoch breitete sich eine Enttäuschung in mir aus. Mit Fremden, Menschen, die außerhalb unserer Elarengemeinde lebten, war es nie zu Kontakt gekommen, aber selbst, wenn ich mich davor fürchtete, hätte mir dieser Unbekannte eventuell helfen können. Jetzt war es zu spät.
Ich lief weiter, das stechende Gefühl des Gerölls unter den Fußsohlen war inzwischen in der Taubheit, die vom Erdboden meine Knöchel emporkroch, untergegangen. Gehen wurde schwerfälliger, zum Rennen fehlte mir die Kraft, aber ich brauchte sie, als sich ein warmer gelblicher Lichtkegel zu meinen Füßen ergoss. Hinter mir näherte sich ein Fahrzeug.
»Hey!«
Die Stimme gehörte nicht Elijah.
Sie riss mich an einer unsichtbaren Leine zurück, brachte mich zum Stehen, nachdem ich durch einen Dornenbusch in die Prärie abtauchen wollte. Neben mir hielt ein Motorrad.
Der Fremde hatte umgedreht.
Seine Größe und die seines Gefährts hatte ich von der anderen Straßenseite erkannt, aber direkt neben mir, war der Unterschied weitaus gewaltiger. Ein Motorrad kannte ich nur von Bildern und Erzählungen, in denen uns schon im Kindesalter beigebracht wurde, dass man sich von solchen Personen fernhielt. Jemand auf so einer Höllenmaschine war kein guter Mensch. Eher ein Gauner und Frevler, vom Teufel besessen. Und doch hatte ich vorhin kurz an seine Hilfe geglaubt.
»Alles okay bei dir?«
Seine Stimme erinnerte an rauchiges Leder. Einerseits herb und anschmiegsam, aber durchzogen von etwas Rauem, als wäre er durch das Leben abgenutzt. Der Klang wärmte mich, obwohl ich bei dem tiefen Ton auch einen Schritt zurückwich.
»Ich... uhm-«
Die Worte erstarben, kaum das sie über meine aufgeplatzten Lippen traten und ich schluckte schwer. Ich verneinte seine Frage schweigend.
Nichts war okay. Wenn ich nicht hier draußen den Tod im Frost fand, dann drohte er mir, sobald mich die falsche Person entdeckte.
»Kann ich dich wohin mitnehmen?«, erkundigte er sich.
Die Haare, die mir immer wieder ins Gesicht geweht wurden, strich ich mir hinter die Ohren und riskierte einen genaueren Blick auf den Mann. Er wirkte alles andere als vertrauenswürdig, mehr wie die Personifikation der Gefahr und Sünde selbst. Dunkle Kleider, die einen breiten, stämmigen Körperbau verbargen, Hände voller Ringe und einen Bart, den ich aufgrund des Schattens, der ihn umhüllte, nicht vollständig ausmachen konnte. Er trug nicht einmal einen Helm!
Alles an ihm schrie mich an, mich fernzuhalten. Das verlangte mein vom elarischen Glauben geschliffener Geist. Doch der hatte mich auch die restlichen Jahre an den albtraumbehafteten Ort gefesselt, dem ich vor wenigen Stunden entkommen war. Nicht auf ihn zu hören, schien mich meiner Freiheit näher zu bringen, als ich es für möglich gehalten hatte.
Zaghaft nickte ich: »Können Sie mich einfach von hier weg schaffen?« Um was anderes konnte ich ihn nicht bitten, denn die Welt hier draußen war für mich ein unerforschtes Rätsel. »Je weiter, desto besser.« Es war nichts mehr wie ein gebrochenes Hauchen und ein flehender Blick.
Vielleicht würde mein Mut, Worte mit einem Fremdling zu wechseln, um den ich sonst einen hohen Bogen gemacht hätte, belohnt werden, oder aber ich würde es in wenigen Augenblicken bereuen.
Einen Moment schien er zu überlegen, bis seine Hand durch seine Haare strich und er auf meine Bitte einging. »Spring auf«, brummte er und rutschte auf seinem Bike nach vorn. »Ich bring dich zu uns. Da kannst du heute Nacht pennen.«
Das ein Mitnehmen bedeutete, auf seiner Maschine zu sitzen, realisierte ich erst jetzt, aber ein Zurück, gab es nicht mehr.
Von den Temperaturen und meiner Unsicherheit versteift, schwang ich ein Bein über das Monstrum und nahm Platz. Das mangelnde Vertrauen und die Skepsis gegenüber diesem Gefährt bemerkte er, denn er griff nach meinen Armen und zog sie um seine Taille. »Festhalten.«
Dieser Anweisung gehorchte ich ohne Widerstand, drückte mich sogar regelrecht an ihn. Der Stoff an seinem Rücken war angenehm warm auf meiner Haut. Mein Herz hingegen, schlug wild gegen den Brustkorb, als hätte es nicht gedroht vor Minuten damit aufzuhören. Nie war ich einem anderen Mann so nah gekommen, denn selbst unter Freunden gab es bei uns keine Umarmungen oder dergleichen. Nicht zwischen den Geschlechtern.
»Es ist nicht weit«, sprach er und ich glaubte, so etwas wie Mitgefühl in seiner Stimme zu vernehmen.
Seinem Versprechen folgend, endete die Fahrt nach einer kleinen Weile. Weit entfernt von der Zivilisation war ich beim Unfall demnach nicht, doch zu Fuß hätte ich sie nie lebendig erreicht.
Mein körperlicher Zustand verschlechterte sich durch den harten Fahrtwind zunehmend, die steifen Finger konnten sich inzwischen nicht einmal mehr an seiner Jacke festhalten. Die Taubheit kroch mir über die Haut und drang in alle Gliedmaßen ein. Einzig mein Kopf schien noch zu funktionieren, damit ich eine Ahnung hatte, wo mich der Mann hinbrachte. Unser Ziel war eine große, von einzelnen Laternen und Scheinwerfern bestrahlte Anlage, die völlig verloren am Straßenende wirkte. Meine Wangen, bis eben klebten sie an seinem Rücken, löste ich und versuchte trotz der unscharfen Sicht ein genaueres Bild zu erkennen.
Das wohl vollständig umzäunte Areal wuchs größer und zwischen einigen kleineren Gebäuden, thronte ein zweistöckiges Haus, dass hell erleuchtet den Mittelpunkt bildete. Wir steuerten direkt darauf zu. Der Unbekannte - vorerst taufte ich ihn auf den Namen Judas, dem biblischen Apostel nachempfunden, der Jesus verriet, da ich selbst nicht wusste, ob ich diesem Mann trauen durfte - hatte von einem uns gesprochen. Es gab mehr von seiner Sorte. Hieß das, er wohnte womöglich hier?
Im Schritttempo passierten wir ein riesiges Tor, dass zwei Männer hinter uns zuschoben. Zuerst schenkte ich ihnen keine große Beachtung, bis mir das Gewehr auf der Schulter des einen auffiel.
Gott bewahre!
Mein Herz würde vor Panik aufgescheucht klopfen, hätte mich die Kälte nicht längst sämtlicher Kräfte beraubt. Judas zu trauen, war vielleicht doch ein größerer Fehler, als angenommen.
Vor dem Holzhaus kamen wir zum Stehen, der Motor erstarb und das monotone Summen an meinen Beinen verebbte. Ich musste absteigen, so wie er, doch kaum verschwand die körperliche Stütze vor mir, hielt ich mich nicht aufrecht. Das Kältezittern hatte sich zu einer Muskelstarre gewandelt.
»Achtung.« Männliches Brummen, jemand griff meine Schultern.
Unfähig die Berührung abzuschütteln, fielen meine Augen zu. Ich fühlte mich schläfrig, abwesend. Eine ungewohnte Wärme breitete sich über meinem Rücken aus, streichelte die leblosen Arme, bevor ich den Boden unter den Füßen verlor.
Kapitel 2
Zu sterben, schien mir jetzt der friedvollste Weg von allen zu sein.
Über den Tod hatte ich nie groß nachgedacht, der eigene verschreckte mich nicht, sondern erfüllte meine Seele mit Sehnsucht. Tot war ich sicher. Geschützt vor all den grausigen Erinnerungen, den nicht enden wollenden Qualen. Wenn mir diese ungeplante Flucht misslang, dann war der Tod mein letzter Ausweg. Wie mir jedoch schien, hatte ich den Kampf bereits verloren, denn um mich herum lauerte nichts außer leerer Dunkelheit. Womit ich nicht rechnete, war das Gefühl von Wärme und Ruhe. Im Jenseits sollte ich frei von Empfindungen sein, zumindest so die Erwartung. Stattdessen schwebte ich auf einer weichen Wolke, durchflutet von Leichtigkeit und ich war nicht allein. Leises, unverständliches Flüstern drang an meine Ohren, die Stimme gehörte aber zu keiner Person, die ich im Himmel erwartete.
»Hey, Kleine.«
Worte wie ein Weckruf. Sie brachten Leben in meine Gliedmaßen zurück, die jegliche Schwerelosigkeit verloren.
Konzentriert schlug ich die Lider auf, blinzelnd, weil das Licht ungewohnt grell war. Nachdem meine Augen geschärft waren, gleichermaßen wie alle Sinne, die zuvor geschlafen hatten, traf mich die Erkenntnis wie ein gleißend heller Blitz: Ich lag in einem fremden Zimmer.
Die Decke begrüßte mich in einem verwaschenen Pfirsichton, anders als bei der Frucht selbst dachte ich dabei nicht an wärmende Südlandsonne auf der blassen Haut, sondern an die hellen Kissenbezüge meiner Mutter. Hannah Reyes war eine begabte Konifere an der Nähmaschine. Zur Linken bot sich mir der Ausblick auf ein grau-blaues Wolkenspiel am Himmel durch zwei große Fenster, die beinah die gesamte Wand einnahmen.
»Guten Morgen«, ertönte wieder diese Stimme.
Kaum drehte ich den Kopf, tauchte das Antlitz einer Frau auf, die neben meinem Bett stand und eine Tasse in ihren Händen hielt. Wilde, schulterlange Haare, die von unbändigen vollen Locken in früheren Jahren zeugten, ließen nur erahnen, dass sie einer Dame im mittleren Alter gehörten, weil das satte Schwarz von dezentem Quecksilber durchzogen war. Sie trug die Zeichen der Zeit mit Würde.
Mit einem fürsorglichen Lächeln auf den kirschrot bemalten Lippen setzte sie sich und hielt mir die dampfende Tasse hin. »Ich hatte schon Sorge, du würdest gar nicht mehr aufwachen.«
Vor meinen Augen zogen die Momente der Flucht vorbei. Die Bewusstlosigkeit hatte mich ergriffen, sobald wir diesen Ort erreicht hatten. Ein Ort, mir gänzlich unbekannt und voll Fremder, die Waffen über ihren Schultern trugen und Motorräder fuhren. Die Decke beiseite zu schlagen, meinen zierlichen Körper auf Spuren von Gewalt zu überprüfen, die mir einer dieser Menschen im wehrlosen Schlaf hätte zufügen können, war ein impulsiver Akt. Ein notwendiger, um meinen aufgeschreckten Geist zu beruhigen.
Die Erkenntnis, dass ich nicht mehr das zerschlissene Baumwollhemd trug, Arme und Beine stattdessen in einer weichen grauen Hose und einem dicken Pullover steckten, besänftigte mich dagegen nicht.
»Wer hat mich umgezogen?«
Ich klang fremd, meine Stimme war kratzig und aufgescheucht. Fast schon alarmiert.
»Das war ich. Du warst stark unterkühlt und hast die ganze Nacht geschlafen.« Abermals hielt sie mir die heiße Flüssigkeit unter die Nase. »Tee«, war die schlichte Erklärung.
Ich kannte Tee, trank ihn trotzdem selten. Dieser hier schmeckte nach Kräutern und einer zarten Note von Limone.
Immer noch war ihr Lächeln mitfühlend, aber darin schwang jetzt ein Funken Erleichterung mit. »Na siehst du, ist doch gar nicht so schwer. Du wirst sicherlich auch Hunger haben.« Dem Grau ihrer Iriden folgte ich zu einem Tablett bestückt mit Waffeln, Rührei, Toast und einer Schüssel Früchte unter der ich Joghurt vermutete. Mein Mund wurde wässrig.
Die Frau vermochte ich nicht zu kennen, aber mein Vertrauen in sie war ausreichend genug, um das Essen anzunehmen, nach dem ich mich inzwischen verzehrte. Obgleich es den gesunden Ansprüchen meiner Glaubensreligion entsprach oder nicht.
»Ich bin übrigens Mandy.« Sie hatte gewartet, bis das Ei runtergeschlungen war und die Waffeln das nächste Ziel des Speiseplans darstellten. »Verrätst du mir auch deinen Namen?«
Ein kurzes Zögern.
»Adina.«
»Du hast mir einen ziemlichen Schrecken eingejagt, Mädchen, als der Präs dich mitten in der Nacht bewusstlos hier rein geschleppt hat. Ich dachte schon, er hätte jemanden angefahren«, sagte sie.
Sie nannte Judas bei einem Titel, den ich nicht kannte. Dessen Ursprung ließ sich nur erahnen, aber ich legte mich innerlich auf einen fest: Präsident. Doch von was? Welchem Vorsitzenden einer ominösen, satanistischen Sekte war ich in die Finger gefallen?
Mandy erhob sich, die winzigen Steinchen auf ihrem dunkelblauen Oberteil, ähnlich wie Sterne am nächtlichen Firmament, funkelten im Sonnenlicht. »Ich sage ihm, dass du wach bist.«
Damit verschwand sie.
Lauf!
Mein Unterbewusstsein hatte mir diesen Befehl innerhalb der letzten vier Jahre so oft zugeschrien, dass ich mich fragte, wieso es mir überhaupt weiterhin Anweisungen gab, wenn ich sie stets ignorierte. Zumindest bis gestern Nacht.
Doch anders als in dem grauen Häuschen, dessen Holz in den Abendstunden so trügerisch friedvoll schimmerte, obwohl jede Ecke voll blutbehafteter, schreiender Andenken steckte, kannte ich nicht einen Winkel des Gebäudes, in dem ich mich jetzt befand. Bis vor die Zimmertür würde ich kommen, doch was sich dahinter verbarg, welche Menschen oder Überraschungen dort auf mich warteten, war ein Rätsel. Ein Ratespiel, von dem ich es besser fand, es nicht zu lösen. Nicht sofort.
Die Waffeln waren vertilgt - woher sollte ich wissen, ob ich so schnell wieder etwas Essbares bekäme - ehe ein Klopfen an der Tür Besuch ankündigte. Mandy kam herein. »Reaper will dich sehen.«
Alles, woran ich denken konnte, war der Name des Fahrers. Judas war kein biblischer Verräter, sondern der Bote des Todes höchstpersönlich. Damit schwankte die Waage in der Debatte, ob ich gestern einem rettenden Schutzengel oder der Ausgeburt Satans in die Arme gelaufen war, erneut.
Reaper.
Das Schaukeln intensivierte sich, sobald der Türrahmen hinter Mandy von einem Riesen in Schwarz gesprengt wurde. Seine Größe empfand ich gestern schon als gewaltig, doch hier wurde mir das volle Ausmaß bewusst. Seine Füße steckten in schweren Stiefeln, die Jeans leuchtete heller in einem verwaschenen Anthrazit, aber das schlichte mitternachtsfarbene T-Shirt vollendete den düsteren Look, den die von Tattoos überzogenen und von der Sonne gebräunten Arme unterstrichen. Aber das war nichts im Vergleich zu seinen Augen. Übernatürlich, wie zersplittertes Eis in einem Sturm aus reinem Weiß und elektrisierendem Blau. Iriden, so klar und eiskalt, würde ich kein zweites Mal begegnen. Sie hoben sich von dem fremdartigen Aussehen ab und gleichzeitig passten sie mit ihrer frostigen Farbe zu seiner Ausstrahlung.
Ich hatte den Schock seines Anblicks noch nicht überwunden, als er die Hand hob und sie durch sein aschiges braunes Haar strich. Es war an den Seiten kurz geschoren, das Haupthaar jedoch lang genug, damit Finger sich darin verlieren konnten.
»Schön zu sehen, dass du noch die Kurve gekriegt hast. Ich hätte ungern eine fremde Leiche in meinem Chapter.« Eine Stimme, wie raues, anschmiegsames Leder.
Er war es. Dieser Mann hatte mich mitgenommen, mir ein Dach über dem Kopf angeboten.
Im Moment brachte ich nichts anderes als ein Nicken zustande, er schloss indes die Tür. »Wie fühlst du dich?«, fragte er.
Verloren. Verschüchtert. Schlapp. Keine Antworten, mit denen er etwas anfangen könnte.
»Müde«, flüsterte ich.
Er nickte. »Der Doc hat dich wieder zusammengeflickt.« Mit einem Blick sah er auf meine Stirn.
Die Platzwunde hatte ich gänzlich vergessen. Dafür klebte an meiner Schläfe aktuell eine Kompresse, die mit einem dünnen Verband um den Schädel befestigt war.
»Tut es weh?«, hakte Mandy nach.
»Nein.«
»Gut«, mehr sagte Reaper nicht, als er die Arme vor der breiten Brust verschränkte, bis die Haut über seinen Muskeln spannte. »Heute hast du Schonfrist. Ruh dich aus und iss was, bevor du mir gleich wieder aus den Schuhen kippst. Morgen will ich dich sprechen.« Den strengen Ton hatte ich gestern schon vernommen, doch heute stand vor mir ein Mann, dessen Autorität nie in Frage gestellt wurde. Das Ebenbild eines Oberhaupts.
In Demut senkte ich den Kopf, mein gehorsames Nicken deutete ihm an, dass ich seine Anweisung verstanden und ihr nachkommen würde. Was anderes war mir im Angesicht einer Autoritätsperson nie beigebracht worden.
»Iss dein Frühstück auf, ich bin gleich wieder da.« Im Gegensatz zu seiner tiefen, unbeugsamen Stimme wirkte Mandys wie ein beruhigendes Glockenspiel im Wind.
Beide verließen das Zimmer und mir entwich zittrig der Atem, der sich in meinen schmerzenden Lungen festgeklammert hatte. Reaper hatte mich nicht wie Elijah bedrängt oder mir gedroht, dennoch knechtete mich seine autoritäre Aura ebenso, wie die meines Mannes.
Es war ein Fehler ihm zu vertrauen.So gern ich diese Entscheidung nicht bereuen wollte, aber dem Einwand konnte ich nichts entgegensetzen. Meine Überlegung dem elarischen Glauben, allen damit verbundenen Regeln und Weltvorstellungen zu entsagen, hatte mich vom Regen in die Traufe geführt.
Nach nicht einmal zwei Minuten, meine Augen hatten am Sekundenzeiger der Uhr neben der Tür geklebt, kam Mandy zurück. Sie sah auf das weiterhin halbvolle Frühstückstablett und um ihren Mund bildeten sich weiße Falten. Es kommentieren, tat sie ungeachtet dessen nicht. »Ich dachte mir, dass dir eine heiße Dusche sicher gut tut.« In ihren Händen hielt sie zwei flauschige graue Handtücher, die notwendige Seife und andere Artikel hatte sie auch gleich dabei.
Meine schwachen Knochen waren wieder aufgetaut, aber die Möglichkeit sie unter warmem Wasser zu entspannen, mir den trockenen Wüstensand aus den Haaren zu massieren, klang höchst verlockend.
Mandy schien kein Problem mit meinem geringen Kommunikationsdrang zu haben, sie wartete geduldig, bis ich das Bett verlassen und in die bereitgestellten Hausschuhe geschlüpft war. Hier im Zimmer befand sich keine zweite Tür, nur die, die hinaus auf den Flur führte, den wir betraten. Links von meinem Raum lag ein weiterer, genau wie gegenüber. Den Korridor hinunter machte ich zusätzliche zwei Türen auf der rechten Seite aus, linksseitig passierten wir eine breite Treppe ins Untergeschoss. Musik und einige Stimmen aus gemurmelten Gesprächen drangen über sie nach oben.
»Du kannst das Bad jederzeit benutzen. Aktuell wohnt außer dir niemand hier, also gehört es ganz dir«, erklärte sie mir.
Wir blieben am Ende des Ganges stehen, der eine Biegung nach links vollzog, bis er an einer roten Metalltür endete. Vor uns lag eine weitere der dunklen nusshölzernen Türen wie im Rest des Flures.
»Ruf mich, wenn du etwas brauchst.« Wieder hoben sich ihre Mundwinkel zu einem sanften Lächeln, doch Mandy drehte sich rum und ging.
»Vielen Dank!«, platzte es aus mir.
Sie blieb stehen, wandte sich mir nochmal zu. »Schon okay, Kleine.«
»Kann... ich das irgendwie wieder gut machen?«
Reaper machte mir Angst, er ließ mich an meiner Zuflucht in dieser Fremde zweifeln, aber Mandy hatte ein gutes Herz.
»Ich lass mir was einfallen womit du dich revanchieren kannst.« Ein kleines Schmunzeln, dann verschwand sie.
Betrat man das Badezimmer, war es ratsam, nicht allzu schwungvoll vorzugehen, sonst lief man Gefahr in eine der grauen Trennwände der Toiletten zu laufen, die sich parallel zur Tür aufreihten. Drei Stück an der Zahl, zwei Urinale, die hinter der letzten Kabine versteckt waren. Ein Gemeinschaftsbad für alle, Frauen wie Männer.Mandy war nicht bewusst, wie sehr sie mich mit der Information, dass ich hier momentan allein wohnte, beruhigte. Die Toiletten stellten das geringere Problem da, bis ich nach wenigen Schritten den linken schmalen Gang entlang, drei Duschkabinen hinter der dicken, mit cremefarbenen Fliesen verzierten Mauer entdeckte. Vor anderen Menschen zu duschen, sich gar zu entkleiden, widersprach allen Regeln von moralischer Sittsamkeit und Anstand, auf die Elaren wert legten. Bereits der Gedanke, dass mir eine fremde Frau die Kleider gewechselt, meinen Körper in vollkommener Nacktheit betrachtet hatte, bereitete mir Unbehagen. Ich betete, dass die mitbewohnerlose Wohnsituation noch eine Weile unverändert blieb. Ein Risiko nahm ich dennoch nicht in Kauf und verriegelte die Flurtür mit dem Schlüssel im Schloss.
Nach einer ausführlichen Wäsche, wohl darauf bedacht den Verband an meiner Stirn - die Binde hatte ich lieber abgenommen - vor der Nässe zu schützen, stand ich an der Spiegelfront, die sich über der Zeile aus Waschbecken gegenüber der Duschkabinen erstreckte.
Das Weiß der Kompresse ließ meinen Teint fahl und grau erscheinen. Nur die Wärme des Wassers sorgte für farbige Flecken auf den eingefallenen Wangen. Ich war diesen trüben Ausdruck der blauen Augen gewohnt, die mir entgegen starrten. Das Fehlen jeglichen Glanzes in meiner Ausstrahlung, die Mitglieder der Gemeinde immer faszinierte, wenn sie mich früher als freundliche, unbekümmerte Jugendliche bezeichneten, war zur Normalität geworden. Dass diese Wesensveränderung nicht doch dem ein oder anderen Bewohner St. Johns aufgefallen war, bezweifelte ich nicht, nur Ansprechen würde es niemand.
Hose und Pullover zog ich mir wieder über, die feuchten Strähnen hingen mir wirr auf dem Kopf, wodurch ich das erste Mal den Sinn einer Kapuze begriff, die ich mir tief ins Gesicht zog. Ehe ich das Bad verließ, spähte mein wachsamer Blick in den Gang. Er war leer. Über die Treppe ergoss sich weiterhin ein Schwall aus Rockmusik und Gemurmel, doch ich kam der Neugier nicht nach, die zugern einen Blick über die Brüstung geworfen hätte, und verschwand in meinem Zimmer.
Auf dem Bett begrüßte mich ein neues Tablett mit Essen: dampfende Suppe, bei deren roter Farbe ich auf Tomaten tippte, sowie Brot und Nachtisch. Nichts davon rührte ich an, mein durch das winzige Frühstück nicht ausreichend gestillter Hunger trieb mich zwar dazu, doch vorerst trat ich an die Fenster. Unter mir präsentierte sich eine weitreichende Landschaft aus Wellblechdächern und unterschiedlichen Behausungen, zwischen denen sich ein festgelegtes Netz aus sandigen Wegen schlängelte. Alles begrenzt durch einen Zaun, der in vereinzelten Ecken hindurch spähte.
Ich befand mich in dem zweistöckigen Haus, das ich gestern Nacht in dem spärlichen Lichtermeer erkannt hatte. Bis auf wenige Ausnahmen war keines der umliegenden Gebäude so groß wie dieses hier. So viel sicherer mir meine aktuelle Lage im ersten Gedanken nicht vorkommen mochte, so war sie es nach genauerem Überlegen. Alles wäre besser, als weiterhin unter einem Dach mit Elijah gefangen zu sein.
Das Essen verspeiste ich aus diesem Grund auch vollständig. Für Misstrauen war jetzt kein Platz.
Die Tür meines Zimmers schloss ich dennoch ab, um den nötigen Schlaf so lange und erholsam wie möglich zu gestalten. Gereinigt und gesättigt, verkroch ich mich unter der Decke, die zu einem warmen, schützenden Kokon wurde. Ich schlief nach wenigen Herzschlägen ein.
Kapitel 3
Trotz der Strapazen war ich früh auf den Beinen.
Die Sonne küsste kaum den Horizont, aber all die Stunden an Schlaf hatten sämtliche Energiereserven aufgefüllt. Die physische Anstrengung der Flucht und die Folgen der Unterkühlung hatten meinen Körper gezwungen, sich ungeteilt seiner Genesung zu widmen. Dem Kopf blieb somit keine Gelegenheit, mich mit Alpträumen und wahnhaftigen Rückblicken zu geiseln, die jede Nacht meine Begleiter waren.
Sobald das Sonnenlicht den Tag einläutete, verließ ich das Bett.
Im gesamten Haus war es gespenstisch still: Keine Musik oder Menschen, nur meine Schritte, die für ein unkontrolliertes Knacken der Holzdielen sorgten. Im Badezimmer machte ich mich mit Hilfe der Zahnbürste und einer Haarbürste, die sich unter den Hygieneartikeln von Mandy fanden, frisch. Die Kleidung tauschte ich hingegen nicht. In der kleinen rustikalen Kommode meines Zimmers hatte ich weitere Sachen gefunden, allerdings warf das eher die Frage auf, ob dieser Schlafraum nicht in Wahrheit jemandem gehörte, der augenblicklich nicht zuhause war. Außer dem Bett mit den hellbraunen Überzügen, einer Lampe auf dem danebenstehenden Beistelltisch und einem großen Spiegel war der Raum nicht weiter möbliert. Sollte hier jemand wohnen, schien er kein begeisterter Innenarchitekt zu sein, der seine eigene Note meisterte, auszudrücken.
»Adina?« Ein Klopfen an meiner Zimmertür. »Bist du wach?«
Ich öffnete der einzigen Person, der ich an diesem Ort annähernd traute. Mandy begrüßte mich – wieder mit einem Aufgebot an Leckereien in ihren Händen.
»Guten Morgen«, brachte ich heraus und lächelte mutig.
»Du siehst schon weitaus erholter aus. Hast du gut geschlafen?«
Nickend bejahte ich ihre Frage.
Sie kam herein, das Tablett setzte sie ab und stellte dabei erfreut fest, dass die Schüsseln von gestern leer waren. Zum Frühstück servierte sie mir an diesem Morgen gebratene Baconstreifen, Pancakes und Früchte. Entgegen meinen eigenen, sehr gut ausgeprägten, Kochkünste war es lange her, seit ich derart üppige Mahlzeiten vorgesetzt bekam.
Ich wäre eine Närrin es zu verschmähen.
»Danke.«
»Dein Dank sollte nicht mir gelten.« In ihren Augen lag ein belehrender Ausdruck, ähnlich der einer Erzieherin, die ihre Schüler zum selbstständigen Denken anregte. »Der Präs war derjenige, der dich vor dem Tod bewahrt hat.«
»Ich weiß«, gestand ich uns beiden. Den Dank würde er erhalten, sobald die Zeit für mein Gespräch mit ihm gekommen war.
Mit dem Teller Pancakes, die ich zuvor klein geschnitten hatte, saß ich auf der Bettkante.
Während des Essens entfernte Mandy die Kompresse an meinem Kopf. »Der Doc wollte sich das gestern nochmal ansehen. Vor ihm solltest du wirklich keine Bedenken haben.« Sie sprach die verschlossene Tür an. Entgegen meiner Befürchtung bohrte sie aber nicht weiter nach dem Grund. »Scheint gut zu verheilen«, murmelte sie.
Dessen überzeugte ich mich selbst mit einem flüchtigen Blick in den Spiegel. Die Haut um den tiefroten Riss war leicht geschwollen und violett verfärbt, die Wunde an sich längst von einer Kruste überzogen.
»Wann will er mich sprechen?« Lieber brachte ich es schnell hinter mich, anstatt Stunden darauf zu bangen.
Mandy hingegen schüttelte den Kopf. »Erstmal isst du in Ruhe und dann bring ich dich runter. Ihr habt noch genug Zeit euch zu unterhalten, denn du scheinst nicht so als hättest du Pläne von hier weg zu kommen.«
Ich hatte weder Pläne noch Vorstellungen. Diesen Ort zu verlassen war durchaus mein Ansinnen, aber ein Ziel, dessen Zeitpunkt und Ausmaß ich jetzt nicht einzuschätzen imstande war, gab es bisher nicht.
Zwischen uns breitete sich Stille aus die mich weitaus mehr bedrückte, weil ich ihre prüfenden, stahlgrauen Augen auf mir spürte. Die Haut in meinem Nacken bekam eine Gänsehaut, sie kribbelte, ähnlich der Momente, in denen mir Gefahr durch Elijah drohte. Eine Art Warnmechanismus.
»Ich weiß nicht was einem armen Ding wie dir passiert ist, aber,« Mandy stemmte die Hände seufzend in die Hüften, »wir sind nicht diejenigen, vor denen du dich fürchten solltest.«
Nie würde diese Frau verstehen, welche Schandtaten ich durchlebt hatte, und doch zeigte sie mir, wie deutlich sie durchschaute, dass meine größte Furcht nicht ihr oder den Menschen hier galt. Das ich vor einem größeren Unheil davonlief.
»Ich bin noch nie jemandem wie euch begegnet«, gestand ich. Die Pancakes waren inzwischen verputzt.
»Jemandem wie uns? Glaube mir, wenn ich dir eines sage: Du bist für uns auf gleichem Maße sonderbar.«
Mir fiel es wie Schuppen von den Augen: Nicht nur ich traf hier auf Fremdlinge. Mit meinem Einverständnis, Reaper zu begleiten, hatte ich das Aufeinanderprallen zweier Welten beschwört, die weiter entfernt voneinander waren wie Himmel und Hölle.
»Hör mal«, setzte sie an und sank neben mir auf die Matratze, »Das Unbekannte säht immer Bedenken, ganz gleich welchen Ausmaßes. Wichtig ist, ob wir den Schwanz einziehen oder der Angst erhobenen Hauptes den Mittelfinger zeigen.«
Ihre vulgäre Sprache schockierte mich, doch ihre Botschaft kam an.
»Wie .. zeigt man einen Mittelfinger?«
Mandy brach in schallendes Gelächter aus. Meine ernst gemeinte Frage schien sie zu erheitern. »Das bringe ich dir noch früh genug bei, Kindchen.«
_________
Heute lernte ich es nicht mehr. Nach dem Frühstück sah sie es als wichtiger an, mich neu einzukleiden.
»Gehören die Sachen niemandem?«
Sie zog kopfschüttelnd ein dünnes weiß-schwarz gestreiftes Oberteil aus dem obersten Schubfach. »Das meiste davon sind Fundsachen oder Leihgaben. Wir haben immer etwas vorrätig für Besucher oder Übernachtungsgäste.«
So wie mich. Das erklärte zumindest die eingeschweißten Verpackungen an Unterwäsche und Socken, die neu und nicht gebraucht schienen. Aus eben diesem Fach drückte sie mir jeweils ein Stück in die Hände. Socken, einen bügellosen BH aus beigefarbener Spitze und ein ...
»Wo ist der Rest?«, fragte ich entsetzt.
In meinen Fingern drehte ich das winzige schwarze Dreieck, dass ein Höschen darzustellen versuchte.
»Bei deinem ollen Nachthemd hätte ich mir denken können, dass du sowas nicht kennst. Selbst meine Oma sah flotter aus.« Sie tauschte den Stofffetzen gegen ein Modell, das ich längst trug. Breitere Riemchen und einen Hauch mehr Baumwolle. Immer noch zu wenig, aber was anderes schien es nicht zu geben.
Schweigend wartete ich den Rest ihrer Ausbeute ab, die ebenso nüchtern ausfiel wie zuvor. Frauen des Elarismus trugen weibliche, hochgradig konservative Kleidung bestehend aus weiten langen Röcken, bedeckten Armen und hochgeschlossenen Krägen. Alles, was sich mir hier bot, waren kurzärmlige Oberteile, Stoffe wie Jeans oder Leder und Stücke, die meinen Körper betonten, anstatt ihn zu verstecken. Mandys Wahl einer hellen, relativ locker sitzenden Stoffhose und dem gestreiften Sweatshirt entpuppte sich als die akzeptabelste Option.
»Zieh dich um, dann bringe ich dich zum Präs.«
Das Geschirr sammelte sie auf dem Tablett und nahm es wieder mit.
Ihrer Anweisung kam ich nach, an das Gefühl meiner eingefassten Beine hatte ich mich schon gewöhnt und musste mir sogar eingestehen, dass es mir gefiel. Es war weitaus praktischer und bot mehr Bewegungsfreiraum als wallende Kleider. Zuvor hatte ich Hosen immer nur bei sportlichen Aktivitäten getragen.
Dem Blick in den Spiegel folgte ungeachtet dessen Erschütterung. Gestern war ich mit dem Empfinden meiner Umgebung beschäftigt, dass ich mich in einem derartigen ungewohnten Outfit nicht begutachtet hatte. Dafür jetzt umso präziser. Vor mir stand keine Elarin mehr. Ich glich einem Außenweltler, deren Auftreten und Aussehen ich anhand einiger Dokumentationen aus der Schule kannte. Den einzigen Ausdrücken, die ich je von einem Leben fern unserer Gemeinde gesammelt hatte. Ich kam mir kurz fremd vor, aber der Funke Aufregung blieb nicht unentdeckt. Wie ein kleines, persönliches Abenteuer.
»Ich habe schon mit ihm gesprochen.«
Das Holz des Treppengeländers unter Mandys Finger war von einer tiefen Maserung durchzogen, die einzelnen Streben mit Schnitzereien verziert. »Solltest du es wollen, finden wir hier eine Aufgabe für dich. In der Küche vielleich«, schlug sie mir vor.
Es klang wie ein Jobangebot. Doch das war nebensächlich im Vergleich zu der Option, die sie mir damit versprach. Mein Sinnen von diesem Ort zu fliehen wie aus meinem Zuhause fand seinen Kern in der Annahme, dass man mich hier festhalten würde. Mich mit Ketten aus Worten und Gewalt in einen Käfig sperrte. Mandy verriet mir, dass man mir möglicherweise eine Wahl ließ.
Der Raum am Fuße der Stufen präsentierte sich in der Gestalt einer Art Lokal. Große und kleinere Tischen, an denen ich wenige Gäste erhaschte, die in ihr Frühstück versunken waren, reihten sich willkürlich zwischen einigen Holzbalken auf. Musikboxen und ein Fernsehbildschirm in einer der Ecken an der Decke sorgten für die nötige Unterhaltung, um Besucher länger an ihrem Platz zu halten, damit sie weiter Geld für Essen und Drinks ausgaben. Diese kamen von der Bar, die sich mit ihrem schwarzen Holztresen über eine ganze Wand zog und das Herzstück zu bilden schien.
Reapers Verantwortung für diesen Ort wurde mir ins Gedächtnis gerufen, sobald wir vor einer Tür mit simpler Beschriftung aus goldenen Metallbuchstaben standen: Präsident. Meine Vermutung war korrekt gewesen.
Anstatt mich darüber zu freuen, wuchs der Druck auf meinen abgemagerten Schultern. Sein Titel klang mächtig, seine Person wirkte einschüchternd. Mandy hatte sich zurückgezogen, bis ihre schlanke Gestalt hinter der Bar verschwand. Zögerlich und viel zu sanft, klopfte ich. Ein Räuspern sollte den wachsenden Kloß in meiner Kehle lösen, während ich auf ein Zeichen wartete.
Oder erwartete er, dass ich ohne Aufforderung eintrat? Nein, besser nicht.
»Komm rein.«
Seine tiefe Stimme erteilte meiner Hand Anweisungen, die den Knauf drehte und mir langsam ein geräumiges, lichtdurchflutetes Büro offenbarte, voller Regale und Akten. Und Reaper, der hinter einem massiven Schreibtisch auf mich wartete. »Setz dich.«
Das rustikale, von dezenter Urigkeit unterlegte Flair des Obergeschosses zog sich über die Bar bis in dieses Zimmer fort. Ebenso wie der Geruch von Rauch und Ethanol, den ich seit gestern in der Nase hatte, ihn aber erst hier unten entschlüsselte. Vor meinem Eintreten hatten seine Lederstiefel auf dem Tisch geruht, eine Geste, die von Desinteresse und Langeweile zeugte, doch jetzt zog er sie herunter.
Ich nahm auf dem Sessel ihm gegenüber Platz, zwei ungleiche Menschen, die sich einen Moment zu lange ansahen. Gletscherseen trafen auf tiefe Weltmeere.
»Adina, richtig?«
Meinen Namen in einem so rauen, männlichen Ton zu hören, war ungewohnt. Doch das Mandy ihm diese Information anvertraute, hatte ich erwartet. Ebenso wie dieses Gespräch.
»Erzähl mir, was passiert ist. Ich will alles hören«, forderte er mich kühl auf.
Den Blick heftete ich auf meine Finger, die anfingen nervöse Ringkämpfe im Schoß auszufechten. Er wollte die Wahrheit hören, die war ich ihm zusammen mit meinem Dank schuldig, dennoch wäre es keinesfalls taktvoll, ihm die ganze Geschichte zu erzählen. Mit allen schmutzigen Details.
»Es.. es gab einen Streit und ich bin von Zuhause abgehauen.« Durch dichte Wimpern vergewisserte ich mich seiner Aufmerksamkeit. »Ich verlor die Kontrolle über den Wagen und bin von der Straße abgekommen. Das Auto war hin, also bin ich zu Fuß weiter. Bis ... ihr mich gefunden habt«, erzählte ich und ließ die Schultern hängen. »Dank dafür. Ohne Sie hätte ich die Nacht nicht überlebt.«
»Nenn mich nicht so.«
Voller Überraschung starrte ich ihn an.
»Siezen. Da fühle ich mich wie ein alter, seniler Knacker.«
Nie hatte man mich gemaßregelt, weil ich jemanden mit Respekt und Ehrfurcht ansprach, zumal er deutlich älter, wie ich wirkte. Aber der brummende Unterton, gepaart mit dem beinah genervten Augenrollen, sprach davon, dass es ihm nicht gefiel.
»Wie alt bist du, Adina?«, stellte er die naheliegendste Frage.
»Vierundzwanzig.«
»Woher kommst du? Und wovor bist du abgehauen?«
Meine Unterlippe zog ich zwischen die Zähne und kaute leicht auf dieser herum. Eine schlechte Angewohnheit, die von Nervosität und Unsicherheit zeugte. Sein Kreuzverhör war hartnäckig und obwohl ich nichts zu verbergen hatte, nichts Bösartiges verbrochen hatte, außer meinem Ehemann den Schädel einzuschlagen, fühlte ich mich ertappt. In die Ecke gedrängt und durchleuchtet, wie ein krimineller Schund, dem man die Taschen mit Diebesgut ausleerte.
Für einen Moment waren meine dunkelblauen Augen sicher mit Sorge gefüllt, doch Schwäche an einem unbekannten Ort wie diesem zu zeigen, vor Menschen, die ich nicht einschätzen konnte, war keine Option. Es galt die Fassung zu wahren.
»Aus Arizona. Eine kleine Gemeinde namens St. Johns.« Der Nagel meines Daumens splitterte aufgrund der Spielereien. »Ich bin vor meinem Mann geflohen.«
Nach mehr Details durfte er nicht fragen, denn ich würde sie ihm nicht geben können. Gott war der Einzige, dem ich die täglichen Gräueltaten in stillen Gebeten anvertraute. Ihm schüttete ich meine Seele aus, in dem Vertrauen, dass er mich dafür nie öffentlich an den Pranger stellen würde. Mich nicht für lächerlich hielt, dass ich einem noblen, hoch angesehenen Mitglied der Gemeinde derartiges barbarisches, allen voran unrechtes, Verhalten unterstellte.
Reaper kannte Elijah nicht. Ihm gegenüber blieb mein Mund aus bloßer Scham verschlossen. Befleckt fühlte ich mich schon lange nicht mehr, eher verdreckt, überzogen von einer morastigen, verseuchten Kruste, die selbst mit dem höchsten Maß an Seifenwasser und Reinigungsmittel nicht zu entfernen wäre.
»Kann ich dir auch eine Frage stellen?«, flüsterte ich.
Zum ersten Mal verrutschte seine starre und prüfende Miene, eine Braue hob sich auf seiner hohen Stirn, doch er nickte.
»Wo bin ich hier?«
Ich entlockte Reaper mit dieser Frage eine weitere Regung: ein belustigtes Zucken seiner Mundwinkel. »Oh Kleines, wo fange ich da an?«
Sein Kosename ließ mich aufhorchen, einen Ähnlichen hatte Mandy verwendet. Mit einem Meter sechzig empfand ich mich nicht als klein, sondern durchschnittlich. In der Gegenwart eines Riesen wie ihm schien ein derartiger Titel hingegen plausibel.
»Du befindest dich in meinem Chapter.« Er griff nach einer Pappschachtel vor ihm auf dem Schreibtisch und zog eine Zigarette aus dieser, die er sich in den Mund steckte und anzündete. »Unserem Hauptsitz.«
Er schob mir die Packung rüber, eine stille Einladung, die ich kopfschüttelnd ablehnte.
»Wer ist uns?«
»Die Satan Skulls. Ein Motorrad Club.«
Männer wie er, die höllische Maschinen auf zwei Rädern fuhren.
»Wir sind wie eine Glaubensgemeinschaft. Brüder. Wir arbeiten und leben hier zusammen, ähnlich einer große Familie«, fügte er hinzu.
Ich bezweifelte, dass seine Vorstellungen einer Religionsgemeinschaft meinen ähnelten. Deutete er an, dass sie hier doch dem Fürst der Hölle frönten, wie ich es aufgrund ihres Auftretens und nun auch des Namens annahm?
»Seid ihr Satanisten?«
Die Worte waren gesprochen, ehe ich sie aufhalten konnte.
Mir fror das Gesicht ein, er hingegen grinste, sodass in seinem dichten Bart eine Reihe schneeweißer Zähne auftauchte. »Nein«, beruhigte er mich. »Wir glauben an Freiheit. Die Leidenschaft zu unseren Bikes ist das, was uns verbindet.«
Ganz verstand ich das Ausmaß dieser Worte nicht, doch das war nicht notwendig. Ich glaubte ihm.
Mit einem weiteren Zug an seiner Zigarette inhalierte er den giftigen Rauch, ließ ihn entweichen und drückte den Stummel in einer Schale aus. Ich observierte seine Bewegungen, bis das Prickeln in meinem Nacken aufflammte. Er beobachtete mich.
»Du hast keine Ahnung, wo du hin sollst.« Eine brummende Feststellung.
Er kannte die Geschichte, die Hintergründe meiner Flucht nicht, aber er war scharfsinnig genug, um zu realisieren, was es bedeutet hatte, als ich ihn des Nachts am Straßenrand fragte, ob er mich wegbringen konnte. Mir war das Ziel egal, solange es eines gab.
»Möchtest du bleiben?«
Ein Klingeln in meinen Ohren, der Herzschlag, der kurz ins Stolpern kam. Ein Ausbruch aus diesem neuen Käfig war nicht nötig. Wenn ich es wünschte, durfte ich freiwillig gehen. Aber wollte ich das?
»Mandy meinte, dass ich vielleicht etwas helfen könnte«, meinte ich. Dieses kleine, ungewohnte Fleckchen Land war immer noch besser als die große, fremde Welt.
Reaper nickte. Er schien einen Augenblick abzuwägen, ob er bei seinem Vorschlag blieb oder er überlegte, welche Tätigkeit für mich am besten geeignet war. »Sie soll auf dich aufpassen. Die Männer können hier ganz schön tabulos sein bei Frischfleisch.«
Seine Wortwahl ließ mich sichtbar zusammenzucken. Mir war trotz meiner konservativen Lebensweise bewusst, was eine derartige Äußerung implizierte. Männer, wie ungezähmte Raubtiere, die sich an mir laben würden.
»Scheiße, bei dir muss man echt aufpassen was man sagt.« Ein frustrierter Seufzer. »Hör zu, Adina. Meine Jungs sind anständig und werden dich mit Respekt behandeln, ansonsten sagst du es mir. Der Ton bei uns ist schlichtweg...ruppiger.«
War ihm bewusst, wie wenig Sinn das ergab? Wie konnte er die Leute als tabulos und gleichzeitig anständig und respektvoll bezeichnen? Es ließ sich für mich nicht unter einen Hut bringen, ganz gleich wie sehr ich es zu verstehen versuchte.
»Wenn du etwas brauchst, lass es Mandy wissen. Sie wird sich gut um dich kümmern, bis du hier deinen Platz gefunden hast.«
Die Tür hinter mir wurde geöffnet.
»Präs.«
Die tiefe Baritonstimme gehörte einem jungen Mann Ende zwanzig mit warm schimmernder Haut aus Ocker. Er musterte mich mit dunklen in Obsidian glänzenden Augen, aber sein wachsamer Blick galt in der nächsten Sekunde wieder seinem Vorgesetzten. »Es gibt Neuigkeiten.«
Reaper stand auf, seine kühlen Augen richtete sich auf mich. »Such Mandy. Vielleicht hat sie schon eine Aufgabe für dich.«
Die freundliche, diskrete Art, mir zu sagen, dass unsere Unterhaltung ein Ende hatte. Und das ich hierbleiben würde.
»Danke für das Gespräch.« Ein letztes Mal betrachtete ich den tätowierten Riesen auf der anderen Seite des Tisches, bevor ich mich entschuldigte und das Zimmer verließ.
Meiner Aufgabe, die Frau mit den schwarzen Locken zu suchen, kam ich nicht nach. Sie wartete bereits am Bartresen auf mich, die Augen auf die Bürotür geheftet, weshalb ich zu ihr ging.
»Er meinte ich kann dir ruhig helfen, aber ... soll vorsichtig sein«, informierte ich sie.
Die Entwicklung freute sie, aber statt mir Arbeit zu geben, hielt sie es für ratsamer mich herumzuführen. Dem stimmte ich zu.
Das Chapter war größer, als zu Beginn vermutet, was mir auch ohne ausreichende Erkundungstour durch das Areal bewusst wurde. Mandy zeigte mir lediglich die Räumlichkeiten des Clubhauses und unterzog mich anschließend einem Crashkurs, der über das Leben hier aufklärte. Aktuell bewohnten knapp fünfzig Mitglieder diese Niederlassung, Kinder nicht mit inbegriffen. Die Vorstellung, ein Kind in einem verruchten Umfeld wie diesem großzuziehen, erschien mir makaber, doch den Gedanken behielt ich für mich. Der MC, eine Abkürzung des Motorradclubs, welcher mir im Laufe des Tages immer wieder unter die Augen kam, hatte noch weitere Angehörige, die sich auf zwei zusätzliche Chapter verteilten oder in den umliegenden Städten wohnten. Das Haupthaus bildete das Zentrum der Clubaktivitäten, einerseits aus wirtschaftlicher Sicht aufgrund der Bar, aber auch in der Funktion des zentralen Treffpunktes. Die Chapel, keine Kirche, wie ich unter Bedauern hatte feststellen müssen, war die Bezeichnung für den Versammlungsraum der Mitglieder. Hier wurden Besprechungen und wöchentliche Mitgliederversammlungen abgehalten – so wie heute Abend.
Mandy, Chefin dieser Bar, sah es als die passende Gelegenheit an mich einzuarbeiten. Ohne jegliche Erfahrung in der Gastronomie platzierte sie mich hinter dem Tresen, die Aufgabe bestand darin Bestellungen abzuarbeiten und Drinks zu mischen. Mein erster und uneingeschränkter Kontakt mit Alkohol. Das erkannte Mandy ebenfalls.
Ich befürchtete, sie würde frustriert aufgeben mir beizubringen, wie ich Bier zapfte oder die Getränke den richtigen Gläsern zuordnete, doch sie blieb geduldig. Nachsichtig. Ihre Beharrlichkeit wurde mit Stolz belohnt, kaum das ich unter ihrem prüfenden Blick, aber ohne ihre Hilfe, eine Bestellung servierte.
»Nächstes Mal etwas zügiger, aber du schlägst dich besser, als erwartet.«
Ihre unterschwellige Kritik vermochte nicht, mich von meinem emotionalen Hoch herunterzuholen. Trotz der Tätigkeit in der Kirche stellte diese Aufgabe den ersten richtigen Job dar, den ich absolvierte, ungeachtet dessen, ob ich bezahlt wurde oder nicht. Meine Bezahlung bestand in der Verpflegung und dem Zimmer, das ich weiterhin bewohnen würde.
Mit fortschreitender Stunde füllte sich das Lokal. Clubanhänger, Pendler und Stammkundschaft vermischten sich zu einem bunten Grüppchen an Gästen. Ihr Erscheinungsbild aus dunkler Kleidung, Bärten und vielen Tattoos wäre genug, um die Mitglieder vom Rest abzuheben, aber zweifellos identifizieren ließen sie sich anhand ihrer Markenzeichen: den Jacken und Lederkutten, alle gebrandmarkt mit dem gleichen Symbol und Namen. Ein Schädel, verhüllt in einem Umhang mit Kapuze und umringt von tanzenden Flammen.
Die Satan Skulls.
Mandy hatte mir Reapers Worte bestätigt. Die Menschen hier, egal welchen Alters, verband die Liebe und Begeisterung zu Motorrädern. Mit Reaper in der Rolle des Präs als Oberhaupt. Wie Elijah bildete er den Kopf einer ganzen Gemeinde, auf dessen Schultern die Verantwortung lag. Und doch glich er schon äußerlich mit keiner Zelle meinem Ehemann.
»Wieso gehst du dich nicht umziehen?« Mandys rot lackierte Nägel, die farblich dem Anblick ihrer schmalen Lippen glichen, schlossen sich um die Arbeitsplatte des Tresens.
»Muss ich etwas Bestimmtes tragen?«, hakte ich mit gehobenen Augenbrauen nach. Ich hatte angenommen die Stoffhose und das Shirt weiter anbehalten zu können. Arbeitskleidung, bis auf eine Schürze, oder gar Uniformen gab es nicht.
»Schätzchen«, schmunzelte die Ältere, das flüssige Metall ihrer Augen strahlte, »Wir haben hier einen gewissen Ruf zu wahren und mir wurde aufgetragen auf dich aufzupassen. So zugeknöpft fällst du hier erst recht auf. Die beste Tarnung bleibt Anpassung, also machen wir aus dir ein hübsches kleines Chamäleon.«
Diese Frau schien Gefallen daran zu finden, mich einzukleiden, denn sie folgte mir nach oben und wühlte wie heute Morgen in der alten Kommode. Ihre morgendliche Kleiderwahl war passabel ausgefallen, daher hoffte ich auf ähnlich treffsicheres Geschick. Sie fand einige Stücke, die sie mir in die Hand drückte und ihre eigenen vor den Brüsten verschränkte. Abwartend, ohne sich zu rühren.
»Jetzt hab dich nicht so. Ich bin doch kein Kerl«, lachte sie.
Sich vor jemandem umzuziehen, hatte mit dem Geschlecht nichts zu tun, zumindest sah ich es so. Zugegebenermaßen hatte sie mich bereits nackt gesehen - obgleich ohne meine Zustimmung – und kannte damit jeden Winkel dieses Körpers. Etwas zu verbergen, gab es nicht mehr. Den Rücken wandte ich ihr dennoch zu, ehe ich ihre Auswahl überstreifte.
Ein Spiegel war nicht notwendig, um zu erkennen, dass sie dieses Mal nicht tauglich war. Meine Augen weiteten sich, sobald ich an mir hinab starrte. Blankes Entsetzen war alles, was mich durchströmte. Ein knapper, mehr als enger Rock in sattem Schwarz, gepaart mit einem korallenroten, bauchfreien Oberteil klebte an den zarten Rundungen. Nie hätte ich meinen Körper willentlich betont, aber für die Menschen hier, allen voran die Damen, schien es so selbstverständlich wie für mich das Anziehen eines Unterhemdes unter einer Bluse.
»Das kann ich nicht tragen«, hauchte ich qualvoll und schlang die dünnen Arme um den flachen, entblößten Bauch.
Mandys Brauen zogen sich skeptisch zusammen und sie trat kopfschüttelnd auf mich zu. »Man sieht eh nur deinen Oberkörper und irgendwie passt das Top zu dir. Ist schon süß«, schmunzelte sie und deutete auf die kleine Schrift auf meinem rechten Busen. Angel Baby. Verhöhnend, nicht süß.
Schwer schluckte ich. »Das geht nicht«, betonte ich erneut. Ich fühlte mich unwohl und bloßgestellt. Nicht verwunderlich, wenn mehr Teile meiner Haut entblößt anstatt verhüllt waren.
Die Barchefin seufzte, erfreut über den Protest meinerseits schien sie nicht, aber nach einer weiteren, dieses Mal wortlosen Debatte reichte sie mir die Hose von vorhin. Das Oberteil war weiterhin problematisch, doch mit bedeckten Beinen stieg mein Wohlfühlfaktor um das doppelte.
Hilfreich war zudem der Anblick der anderen Frauen. Mandy trug beispielsweise einen gewagten Lederlook mit Korsage, der den Akzent auf ihre Oberweite legte. An ihrer Stelle wäre ich bleich vor Bangnis, die Brüste könnten aus den haltenden Körben herauspurzeln, obwohl mein Dekolleté schmächtiger ausfiel als ihres, im Zimmer geblieben. Doch sie strömte Sicherheit und Selbstbewusstsein aus. Einen Stolz, der sie umwerfend machte.
Die Erkenntnis half mir, den Raum mit sichtbarem Bauchnabel zu verlassen. Wenn ich an dem Top zerrte, war er sogar zeitweilig bedeckt.
Kapitel 4
Der Anblick der offenherzig bekleideten Schönheiten in diesem Raum, alle strahlend vor Wildheit, die auch ohne die Kleidung aus Leder und Jeans spürbar wäre, lenkte mich nicht genug ab, um zu übersehen, dass ich von einem Großteil der Anwesenden angestarrt wurde. Zuvor hatten Gäste gestarrt, weil ich neu war. Das unbekannte Gesicht in ihren Reihen. Jetzt verfolgten mich schaulustige Blicke, kaum das wir am Fuße der Treppe angekommen waren, zumal die Besucherzahl der Bar in den letzten Minuten explodiert zu sein schien.
Renn zurück!
Nie hätte ich die Hosen tragen sollen und erst recht das enge Shirt gegen einen Pullover tauschen müssen. Wieso hatte ich Mandys Urteilsvermögen vertraut, geglaubt ich würde jetzt unauffälliger sein und mich einfügen?
Reaper unterbrach den Gedanken.
Er verließ den Tisch, an dem er bis eben saß und kam auf uns zu, die Miene hart wie Stahl, die Stirn verdüstert. Ein Gesichtsausdruck wie dieser war mir vertraut und er bedeutete nie etwas Gutes. Den Charakter des Präs kannte ich nicht, aber das er mir geholfen hatte, mir eine Aussicht auf ein neues Leben bot, vergaß ich in diesem Augenblick.
Starre ergriff Besitz von meinem Körper, es kostete mich ein hohes Maß an Willensstärke, mir ins Gedächtnis zu rufen, dass es nicht Elijah war, der auf mich zustürmte. Ein einziger Gedanke war dennoch präsent: Ich würde Schmerzen spüren.
Allein deshalb zuckte ich heftig zusammen, kaum das er meinen Arm packte und wegzerrte.
»Was hat sie da an?« Scharfes Knurren.
Ich kniff die Augen fest zu, voll Sehnsucht und Hoffnung erfüllt, dass alles gleich wieder vorbei wäre und ich nicht zu lange litt. Schlagartig gab er meinen Arm frei. Ich wich zurück, presste mich zwei Meter von den beiden entfernt an die vertäfelte Wand.
»Was sie da an hat, ist ja wohl offensichtlich, oder?« Mandy deutete kurz auf mich, aber ihre Augen durchbohrten Reaper ernst. Sie klang erbost. »Ich soll auf sie aufpassen und das tue ich.«
»Also läuft sie hier halb nackt herum?«
»Sie läuft rum wie die anderen«, fauchte sie und bot ihrem Oberhaupt die Stirn, obwohl sie ihm selbst um mindestens eine Kopflänge unterlegen war. »Was fällt deiner Meinung nach mehr auf in einem Strauß schwarzer Rosen: eine weiße oder eine schwarz angemalte Lilie?«
Eine Lilie stellte nicht meine persönliche Wahl eines Selbstbildes dar, aber ich verstand, was die schwarzhaarige Bardame mit dieser Metapher auszudrücken versuchte. Ich sollte zumindest den Anschein erwecken, dazu zugehören.
»Sie sieht jetzt wenigstens halbwegs aus wie von unserem Schlag. Natürlich wird auffallen, dass sie neu ist, aber so werf‘ ich diesen ausgehungerten Kerlen wenigstens nicht gleich das unschuldige, blutjunge Mädel vor die Füße«, hing sie zischend dran.
»Ich ... kann mir sicherlich noch eine Jacke oder ähnliches drüberziehen«, war mein leiser Vorschlag.
Beide drehten zeitgleich ihre Köpfe, in Mandys Augen las ich das eindeutige Nein und dennoch löste ich mich von dem Holz, um nach oben zu sprinten. Reapers aufgebrachte Reaktion jagte mir mehr Respekt und Scheu ein als sie. Und er hatte mir deutlich zu verstehen gegeben, was er von meinen Klamotten hielt. Er schien wie ich zu begreifen, dass so ein Look nicht zu mir passte. Die einzige Winzigkeit, die wir gemein hatten.
Zuerst hatte ich beabsichtigt, mir das gestreifte Shirt von heute Morgen überzuziehen, doch der erste Blick in die Kommode fiel auf eine graue Sweatjacke mit Kapuze. Vielversprechend. Sowohl Torso wie Arme waren wieder bekleidet.
»Besser?«
Der Präs und Mandy, die unverändert im Gang neben der Treppe standen, musterten mich. Sie schien alles andere als begeistert, da sie sich die Schläfen rieb und laut seufzte, er hingegen taxierte mich finster: »Wesentlich.«
»Schön, von mir aus. Aber Präs«, die Barchefin hob den Finger ins Gesicht ihres Vorsitzenden, »beschwer dich nicht, wenn die ersten Männer rumgröhlen sie solle sich ausziehen. Und jetzt entschuldige mich bitte – wir müssen einige durstige Kehlen stopfen.«
Er blockierte ihr den Weg.
»Beherrsche dich.« Eine scharfe Drohung auf ihre aufsässigen Worte.
Ich hätte mich vor Demut gewunden, wäre auf die Knie gesunken, doch Mandy schien vollkommen unbeeindruckt zu sein. Sie legte die Hand unbeirrt an meinen Rücken und schob mich an ihm vorbei an die Bar.
Die Schicht dort übernahmen wir nicht mehr zu zweit. Eine großgewachsene Frau, mit weicher Haut aus Kakao und Schokolade, hohen Wangenknochen und winzigen nachtschwarzen Locken stellte sich mir als Mandys exotische Stellvertreterin vor. Tiara schenkte mir nicht weiter Beachtung, ihre Aufmerksamkeit lag ungeteilt bei ihrem Job. Sie war professionell, flink und schien genau zu wissen, welchen Ton die Männer hier hören wollten.





























