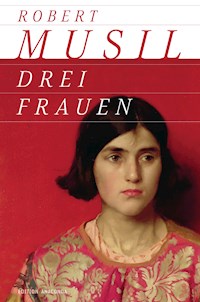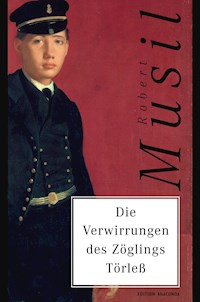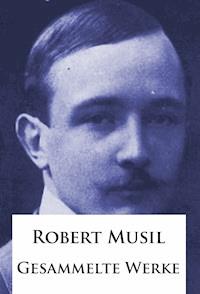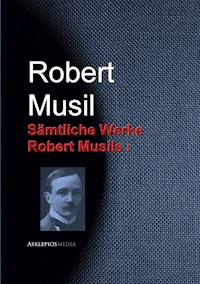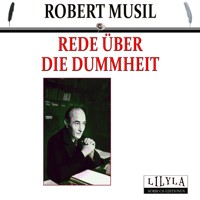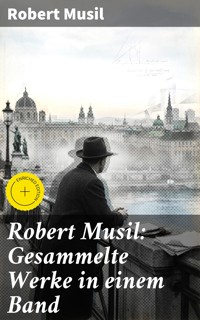
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Robert Musil: Gesammelte Werke in einem Band" wird der Leser in die komplexe Gedankenwelt eines der bedeutendsten Autoren des 20. Jahrhunderts eingeführt. Musils Werke sind geprägt von einer tiefgehenden Analyse der menschlichen Existenz, des Zwanges zur Selbstfindung und der Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Umbrüchen seiner Zeit. Sein literarischer Stil vereint analytische Schärfe und poetische Sprachkraft, wodurch seine Prosa sowohl philosophische Reflexion als auch emotionale Tiefe vermittelt. Musils Erzählungen, Essays und Fragmenten spiegeln das Ringen mit den Herausforderungen der Aufklärung und Moderne wider und formen ein eindringliches Kaleidoskop der damaligen intellektuellen Strömungen. Robert Musil (1880-1942) war ein österreichischer Schriftsteller, der in einem Umfeld von politischer Instabilität und gesellschaftlichen Veränderungen aufwuchs. Sein vielseitiger Background als Ingenieur und sein Interesse an Psychologie und Philosophie prägten seine literarische Arbeit und führten zu einer tiefen Auseinandersetzung mit Themen wie Identität, Freiheit und der Natur der Menschheit. Musils unvollendeter Roman "Der Mann ohne Eigenschaften" gilt als Meisterwerk und zeigt seine innovative Herangehensweise an Narrative und Charakterentwicklung. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für die literarischen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts interessieren oder Musils eigenen Weg zur explorativen Literatur nachverfolgen möchten. Es bietet einen umfassenden Zugang zu seinen bahnbrechenden Ideen und lädt dazu ein, sich mit den Fragen auseinanderzusetzen, die auch in der heutigen Zeit von zentraler Bedeutung sind. Erleben Sie die Faszination und Dichte eines Autors, dessen Werke im Spannungsfeld zwischen Kunst und Philosophie stehen. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine umfassende Einführung skizziert die verbindenden Merkmale, Themen oder stilistischen Entwicklungen dieser ausgewählten Werke. - Die Autorenbiografie hebt persönliche Meilensteine und literarische Einflüsse hervor, die das gesamte Schaffen prägen. - Ein Abschnitt zum historischen Kontext verortet die Werke in ihrer Epoche – soziale Strömungen, kulturelle Trends und Schlüsselerlebnisse, die ihrer Entstehung zugrunde liegen. - Eine knappe Synopsis (Auswahl) gibt einen zugänglichen Überblick über die enthaltenen Texte und hilft dabei, Handlungsverläufe und Hauptideen zu erfassen, ohne wichtige Wendepunkte zu verraten. - Eine vereinheitlichende Analyse untersucht wiederkehrende Motive und charakteristische Stilmittel in der Sammlung, verbindet die Erzählungen miteinander und beleuchtet zugleich die individuellen Stärken der einzelnen Werke. - Reflexionsfragen regen zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der übergreifenden Botschaft des Autors an und laden dazu ein, Bezüge zwischen den verschiedenen Texten herzustellen sowie sie in einen modernen Kontext zu setzen. - Abschließend fassen unsere handverlesenen unvergesslichen Zitate zentrale Aussagen und Wendepunkte zusammen und verdeutlichen so die Kernthemen der gesamten Sammlung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Robert Musil: Gesammelte Werke in einem Band
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Dieses Buch vereint Robert Musils Werk in einem Band und macht seine literarische Welt in ihrer ganzen Breite zugänglich. Es führt von Prosa und Stücke über Kleine Prosa, Aphorismen, Autobiographisches bis zu Essays und Reden, weiter zur Kritik und kulminiert in Der Mann ohne Eigenschaften mit Erstem und Zweitem Buch. Die Anordnung ermöglicht Orientierung innerhalb eines Œuvres, das gleichermaßen erzählerische Kraft, intellektuelle Präzision und formale Experimentierfreude zeigt. Zugleich bietet die Sammlung einen Überblick über Hauptwerke, Nebenarbeiten und Werkstatttexte, sodass Entwicklungslinien, wiederkehrende Motive und stilistische Verfahren in ihrer Wechselwirkung sichtbar werden.
Ziel dieser Ausgabe ist es, Musils literarisches Denken in seiner Gesamtdynamik zu zeigen: als Bündelung von Kunstformen, als Folge verschiedener Schreibsituationen und als zusammenhängende Erkundung der Moderne. Sie lädt dazu ein, die Wege vom frühen Erzählen über dramatische Versuche und lyrische Gelegenheiten bis zur großen Romanarchitektur nachzuzeichnen. Ebenso macht sie die essayistische und kritische Arbeit sichtbar, durch die Musil seine ästhetischen und ethischen Fragen öffentlich verhandelte. Indem die Sammlung Stimmen, Register und Gattungen zusammenführt, entsteht ein Panorama der Werkentwicklung, das zugleich den inneren Zusammenhang einer konsequenten Suche nach Genauigkeit erkennen lässt.
Im Bereich Prosa und Stücke begegnet man der frühen Prosa, in der zentrale Tonfälle und Motive erkennbar werden, sowie den Stücke, die Musils Sinn für szenische Verdichtung und gedankliche Konstellationen erproben. Lyrisches, Widmungen zeigen den Autor in knapper Form, auf Anrufung, Geste und gelegentliche Feier konzentriert. Diese Abteilung spiegelt Musils Drang, Formen zu testen und Ausdrucksweisen zu schärfen: Erzählen, das intellektuell gespannt bleibt, dramatische Situationen, die Ideen dramatisieren, und lyrische Miniaturen, die Empfindung und Reflexion bündeln. Sie bildet den Auftakt zu einer Entwicklung, die in größere, essayistisch durchwirkten Konstruktionen mündet.
Die Abteilung Kleine Prosa, Aphorismen, Autobiographisches versammelt die Werkstatt des Denkens: Nachlaß zu Lebzeiten und Vorstufen dazu, Erzählungen 1923–1932, Glossen 1921–1932 sowie Prosa-Fragmente aus dem Nachlass. Hinzu treten Aphorismen, Motive – Überlegungen, die Stichworte zu den «Aufzeichnungen eines Schriftstellers» und Zur Person – Zum Werk. Hier wird Musils Verfahren besonders durchsichtig: kurze Formen, die präzise Wahrnehmungen isolieren, Notate, die Begriffe prüfen, und autobiographisch getönte Selbstverständigungen. Dieses Ensemble zeigt, wie sehr die kleine Form als Labor der großen diente, indem sie Material, Einsichten und Tonlagen probierte und neugierig offenhielt.
In Essays und Reden entfaltet sich Musils öffentliche Reflexion. Die Essays verbinden Analyse, Beispiel und gedanklichen Versuch zu einer Prosa der Prüfung. Die Reden dokumentieren seine Fähigkeit, Einsicht und Ansprache auszubalancieren. Essayistische Fragmente geben Einblick in Bewegungen des Denkens, bevor sie in abschließende Formen gebunden sind. Themenfelder reichen von Fragen der Literatur und Kunst bis zu Überlegungen über Erkenntnis, Ethik und gesellschaftliche Organisation. In diesen Texten zeigt sich ein Autor, der nicht feststellt, sondern ausprobiert, der Begriffe auf Belastbarkeit testet und Theorie am Konkreten misst – präzise im Ausdruck, offen im Verfahren.
Die Sektion Kritik bündelt Musils Stellungnahmen zur Zeitkunst: Kritik. Literatur – Theater – Kunst (1912–1930) zeigt die Kontinuität seiner Beobachtung; Referate und Hinweise April – Juli 1923 legen die Arbeit am laufenden Betrieb des Feuilletons offen. Antworten zu Umfragen 1914–1933 dokumentieren situative Selbstpositionierungen, Nachträge und Kritik-Entwürfe ergänzen das Bild um skizzenhafte Ansätze. Diese Texte bezeugen Musils wache Aufmerksamkeit für ästhetische Maßstäbe, institutionelle Kontexte und die Genauigkeit des Urteils. Sie korrespondieren mit den Essays und zeigen, wie kritisch-analytische Genauigkeit nicht im Widerspruch zur literarischen Gestaltung steht, sondern deren Voraussetzung bildet.
Der Mann ohne Eigenschaften, mit Erstem und Zweitem Buch vertreten, bildet den Schwerpunkt des erzählerischen Spätwerks. Der Roman verbindet erzählerische Szenen mit gedanklichen Passagen und macht das Nachdenken selbst zum Gegenstand der Form. Er vermisst Möglichkeiten des Handelns und Erkennens, untersucht die Relationen zwischen Wertordnungen und Erfahrung und stellt Beobachtung, Analyse und Empfindung in ein spannungsvolles Gleichgewicht. Damit schließt er an die Versuchsanordnung der Essays an, ohne auf die Anschauung der Erzählung zu verzichten. In dieser Sammlung erscheint das Werk im Kontext seiner vorbereitenden Formen und seiner kritischen Resonanzen besonders lesbar.
Über die Gattungen hinweg kehren Motive wieder, die Musils Schreiben tragen: die Spannung zwischen Präzision und Lebendigkeit, zwischen Regel und Ausnahme, zwischen Person und Ordnung. Der Blick richtet sich auf Verfahren des Urteilens, auf die Sprache der Wissenschaften ebenso wie auf die Zwischentöne des Alltags. Musil interessiert, wie Begriffe Wirklichkeit strukturieren und wie Wirklichkeit sich ihnen entzieht. Diese thematische Konstanz erzeugt die innere Einheit der Sammlung. Sie erlaubt, in der kleinen Beobachtung das große Denken mitzulesen und im großen Entwurf die methodische Strenge zu erkennen, die auch die kurzen Formen prägt.
Stilistisch kennzeichnen Musils Prosa Genauigkeit, Ironie und eine kontrollierte Experimentierfreude. Seine Sätze zielen auf begriffliche Klarheit, ohne Anschaulichkeit preiszugeben. Die Textarchitektur wechselt zwischen Verdichtung und Öffnung, von aphoristischer Kürze zur weit ausschwingenden Reflexion. Dramatische und lyrische Formen schärfen den Sinn für Rhythmus, Blickführung und dialogische Spannung. Fragmentsammlungen und Glossen zeigen eine Ästhetik des Probierens, die dennoch auf Formstrenge achtet. Dieses Zusammenspiel erzeugt eine unverwechselbare Tonlage: analytisch und sinnlich, präzise und tastend, skeptisch und neugierig. In der Gesamtheit der Sammlung wird dieser Stil in seinen Variationen gut nachvollziehbar.
Ein Leitprinzip der Sammlung ist der Essayismus – das Denken im Modus des tastenden Versuchs. Er prägt die Essays und Reden, aber auch die Glossen, Aphorismen und den großen Roman. Statt fertiger Systeme bietet Musil Prüfarrangements: Hypothesen, die an Beispielen erprobt werden, Kategorien, die sich an Erfahrung messen lassen. Diese Haltung verbindet die Abteilungen miteinander. Sie erklärt, warum Notiz, Skizze, Entwurf und elaborierte Form keine Gegensätze bilden, sondern Stufen eines Verfahrens. Der Leser begegnet einer Literatur, die ihre Mittel reflektiert und ihre Ergebnisse offen hält, ohne an Schärfe zu verlieren.
Die Struktur des Bandes unterstützt unterschiedliche Lektürewege. Wer Entwicklungen verfolgen möchte, kann von den frühen Prosastücken über Erzählungen 1923–1932 und Glossen 1921–1932 zu den großformatigen Arbeiten fortschreiten und dabei thematische Verdichtungen beobachten. Wer Formen vergleichen will, liest quer: Stücke neben Kritik-Entwürfen, Aphorismen neben essayistischen Fragmenten, um Kontraste und Resonanzen zu erkennen. Die Abteilungen Zur Person – Zum Werk und die Stichworte zu den «Aufzeichnungen eines Schriftstellers» eröffnen eine Innenperspektive auf Entscheidungen und Motive. So entsteht ein Raum, in dem Orientierung möglich ist, ohne die produktive Offenheit der Lektüre zu schmälern.
In ihrer Gesamtheit zeigt diese Ausgabe einen Autor der Moderne, dessen Werk durch intellektuelle Strenge, formale Vielfalt und ethische Aufmerksamkeit besticht. Sie bringt das weithin bekannte mit dem selten gelesenen Musil ins Gespräch: den Romancier, den Dramatiker, den Essayisten, den Kritiker, den Notizenschreiber. Damit wird ein differenziertes, durch Nuancen reiches Porträt sichtbar, das auch gegenwärtige Fragen nach Urteilskraft, Verantwortung und Sprachgenauigkeit berührt. Der Band lädt zu Erstbegegnung und Wiederentdeckung ein: als verlässliche Grundlage, um das große Projekt zu lesen, und als Fundus, in dem Nebenwege und Nebenstimmen leuchten.
Autorenbiografie
Robert Musil (1880–1942) war ein österreichischer Schriftsteller der literarischen Moderne, dessen Werk die Spannungen der untergehenden Habsburgermonarchie bis in die Katastrophen des 20. Jahrhunderts reflektiert. Bekannt ist er vor allem für den unvollendeten Roman Der Mann ohne Eigenschaften, der zu den maßgeblichen Projekten europäischer Prosa des 20. Jahrhunderts zählt. Musil verband philosophische Skepsis mit analytischer Genauigkeit und experimentellen Formen, wodurch er eine eigene Poetik zwischen Essay, Erzählung und Roman entwickelte. Sein Schreiben kreist um Erkenntnis, Moral und die Möglichkeiten des Ichs in einer komplexen Gesellschaft. Trotz wiederkehrender materieller Unsicherheiten prägte er nachhaltig die deutschsprachige Literatur.
Ausgebildet wurde Musil zunächst an Militär- und Technischen Schulen der Habsmonarchie; anschließend studierte er Maschinenbau an der Technischen Hochschule in Brünn. In den folgenden Jahren wandte er sich den Geisteswissenschaften zu und belegte in Berlin und Wien Philosophie, Psychologie und Logik. Prägend waren für ihn die wissenschaftliche Kultur seiner Zeit, insbesondere der Empirismus und die Erkenntnistheorie um Ernst Mach, sowie die moralphilosophischen Herausforderungen nach Nietzsche. Diese doppelte Sozialisation – technische Präzision und philosophische Reflexion – wurde zum Markenzeichen seines Stils. Musil verstand Literatur als Erkenntnismittel und näherte sich der Moderne über Sprachskepsis, formale Strenge und eine kritische Beobachtung gesellschaftlicher Systeme.
Seinen literarischen Durchbruch erzielte Musil mit Die Verwirrungen des Zöglings Törleß, erschienen in den 1900er-Jahren. Der Debütroman etablierte ihn als scharfen Analytiker psychischer und sozialer Dynamiken und zeigte bereits sein Interesse an Grenzerfahrungen zwischen Rationalität und Irrationalität. Es folgten die Novellen sammelnden Vereinigungen, die sein Spektrum zwischen innerem Monolog und essayistischer Reflexion erweiterten. Früh arbeitete Musil an einer Prosa, die die Formen mischt und den Erzähler als Forscher begreift. In Artikeln und Rezensionen profilierte er sich zudem als präziser Beobachter der Moderne, ohne sich einer Schule oder einem Manifest unterzuordnen, was seine Unabhängigkeit innerhalb der literarischen Avantgarden unterstreicht.
Im Ersten Weltkrieg diente Musil als Offizier. Die Erfahrung des industrialisierten Kriegs verstärkte sein Misstrauen gegenüber leeren Abstraktionen und technokratischer Hybris. In Essays formulierte er das Programm einer Verbindung von Genauigkeit und Seele, das die Kluft zwischen Rationalität und Wertorientierung adressiert. In den 1920er-Jahren erschienen das Schauspiel Die Schwärmer sowie Prosabände wie Drei Frauen und Vinzenz und die Freundin bedeutender Männer. Diese Arbeiten festigten seinen Ruf als anspruchsvoller Autor, blieben jedoch kommerziell begrenzt. Gleichwohl fand Musil Resonanz in literarischen Zeitschriften und Debatten, in denen seine methodische Strenge und sein skeptischer Humanismus als Gegenentwurf zu Ideologisierung und ästhetischem Effekt galten.
Ende der 1920er-Jahre begann Musil mit Der Mann ohne Eigenschaften, einem groß angelegten Romanprojekt. Die ersten Teile erschienen 1930, weitere folgten Anfang der 1930er-Jahre. Das Werk verbindet erzählerische Szenarien mit Reflexion, untersucht den Möglichkeitssinn des modernen Subjekts und kartiert die Zerfaserung gesellschaftlicher Ordnungen. Der offene, essayistische Aufbau verweigert einfache Resolutionen und macht das Projekt anfällig für Langsamkeit und permanente Umarbeitung. Zeitgenössisch wurde es von einem wachsenden, aber nicht massenhaften Publikum gelesen. Musil hielt beharrlich an der Formidee fest und arbeitete fortlaufend an Varianten, Exposés und Kapiteln, die den unvollendeten Charakter des Unternehmens bis zuletzt bestimmten.
Die politischen Umbrüche der 1930er-Jahre erschwerten Musils Arbeit erheblich. Seine Bücher wurden im nationalsozialistisch dominierten Deutschland nicht mehr verbreitet; öffentliche Auftritte und Einnahmen brachen weg. Nach der Machtübernahme in Österreich verließ er das Land und lebte in der Schweiz, wo er unter prekären Bedingungen weiter am Roman und an Essays arbeitete; ein Teil seiner kürzeren Prosa erschien unter dem Titel Nachlass zu Lebzeiten. Musil blieb in seinen Veröffentlichungen einer aufgeklärten Skepsis verpflichtet und kritisierte die Anziehungskraft irrationaler Heilslehren. Zugleich hielt er an der Überzeugung fest, dass nur eine genaue und zugleich wertbewusste Sprache die Verwerfungen der Gegenwart angemessen darstellen könne.
Musil starb 1942 in der Schweiz. Sein Roman blieb Fragment, doch der Nachlass wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts editorisch erschlossen und prägte die Wahrnehmung des Gesamtwerks. Heute gilt er als Schlüsselfigur der europäischen Moderne, deren analytische Prosa und essayistische Romanform maßgeblich die Theorie des Romans beeinflusst haben. Begriffe wie Möglichkeitssinn sind in den kulturwissenschaftlichen Diskurs eingegangen. Neueditionen und kritische Ausgaben haben die Werkgenese sichtbar gemacht und die Lektüre erleichtert. In Forschung und Literaturbetrieb bleibt Musils Werk ein Referenzpunkt für die Verbindung von intellektueller Genauigkeit, formaler Experimentierlust und ethischer Fragwürdigkeit moderner Lebensformen.
Historischer Kontext
Robert Musil (6. November 1880, Klagenfurt – 15. April 1942, Genf) schrieb in und über eine Epoche tiefgreifender Umbrüche: das Ende der Habsburgermonarchie 1918, die Krisen der Ersten Republik Österreich, die autoritären Regime der 1930er Jahre und das Exil. Seine in Wien, Berlin und später in der Schweiz entstandenen Arbeiten – Prosa, Stücke, Essays, Kritiken und Nachlass-Fragmente – spiegeln die Spannungsfelder zwischen kaiserlich-königlicher Ordnung und moderner Massengesellschaft. Die Sammlung bündelt Texte von den frühen 1900er Jahren bis in die Exilzeit, sodass sich Entwicklungen politischer Institutionen, Wissenschaftskulturen und ästhetischer Verfahren quer durch sein Œuvre verfolgen lassen und Werkgruppen über gemeinsame historische Konstellationen miteinander verschränkt werden.
Musils Ausbildung prägte seine literarische Beobachtungsweise. Nach dem Besuch der Militär-Oberrealschule in Mährisch-Weißkirchen (heute Hranice) studierte er an der Technischen Hochschule in Brünn (Brno) Maschinenbau und wandte sich anschließend der Psychologie und Philosophie zu. 1908 wurde er an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin (heute Humboldt-Universität) bei Carl Stumpf promoviert; die Auseinandersetzung mit Ernst Machs Erkenntnistheorie ist ein roter Faden. Das wissenschaftliche Ethos – Präzision, Experiment, Modellbildung – informiert nicht nur Romane und Erzählungen, sondern auch Essays, Glossen und aphoristische Notate. Die Nähe zu methodischem Denken erklärt die wiederkehrende Prüfung von Begriffen wie Ursache, Möglichkeit, Gesetz und Erfahrung in allen Textsorten.
Das kulturelle Klima des Wiener Fin de Siècle bot Musil ein Labor der Moderne. Die Wiener Secession (1897), Gustav Klimt, Adolf Loos’ Kritik des Historismus (1908) und Arnold Schönbergs Schritt zur Atonalität (um 1908/1912) markieren eine Verschiebung von repräsentativer Form zu experimenteller Struktur. Sigmund Freuds Traumdeutung (1900) verändert die Begriffe von Bewusstsein und Begehren; Karl Kraus’ Die Fackel (ab 1899) schult Sprachskepsis und Medienkritik. Diese Konstellation prägt Musils frühe Prosa ebenso wie spätere theoretisch-essayistische Reflexionen. Die Sammlung zeigt, wie Kunstanschauungen, technische Innovationen und psychologische Theorie in Motiven, Denkfiguren und stilistischen Verfahren miteinander verkeilt werden.
Die späte Habsburgermonarchie, oft als Kakanien bezeichnet, war ein Vielvölkerstaat zwischen administrativer Rationalität und politischer Zentrifugalkraft. Unter Kaiser Franz Joseph I. (Regierungszeit 1848–1916) stabilisierte eine mächtige Bürokratie das Imperium, während Nationalbewegungen – von Böhmen bis Galizien – es zugleich aushöhlten. Das Attentat von Sarajevo am 28. Juni 1914 leitete den Krieg ein, der 1918 den Zerfall brachte. Diese Gemengelage liefert den historischen Hintergrund für Musils Dauerinteressen: die Dialektik von Ordnung und Kontingenz, die Instabilität sozialer Rollen, die Ambivalenz institutioneller Vernunft. Sie durchziehen Prosa, Theatertexte und Essays, unabhängig vom jeweiligen Entstehungsjahr.
Musils Werk ist in die transnationale Öffentlichkeit des deutschsprachigen Feuilletons eingebettet. Netzwerke reichten von Wien nach Berlin und Prag; Zeitschriften wie Die Neue Rundschau (Berlin) und die Prager Presse (ab 1921) boten Resonanzräume für Essays, Glossen und Kritik. Kontakte und Reibungen mit Autoren wie Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Karl Kraus, Rainer Maria Rilke oder Hermann Broch gehören zum intellektuellen Klima, in dem poetische und diskursive Prosa ineinandergreifen. Die Periodizität des Zeitungsbetriebs formt zudem Musils kurze Formen: Glossen der Jahre 1921–1932 und kritische Beiträge 1912–1930 reagieren auf Ereignisse, Debatten und Aufführungen in Echtzeit und erproben Stil- und Denkvarianten.
Der Erste Weltkrieg (1914–1918) ist biografisch und werkgeschichtlich ein Einschnitt. Musil wurde 1914 eingezogen, diente als Offizier an der italienischen Front und versah später Stabsdienste; der Krieg konfrontierte ihn mit der Diskrepanz zwischen technischer Rationalisierung und moralischer Orientierungslosigkeit. Diese Erfahrung verschiebt auch die Schwerpunkte der Essays und Kritiken: Massenmedien, Kriegspsychologie, Propaganda, Bürokratie und Frontalltag werden zu Prüfsteinen für Sprache und Urteil. Die in den 1920er Jahren verfassten Reflexionen und Prosastücke tragen Spuren militärischer Organisation, statistischer Denkmuster und der Frage, wie eine säkularisierte Gesellschaft Sinn und Verantwortung unter den Bedingungen moderner Organisation herstellt.
Nach 1918 formierte sich in Wien die Erste Republik; soziale Experimente prägten das sogenannte Rote Wien (1919–1934), von kommunaler Wohnbaupolitik bis zur Gesundheitsreform. Der Karl-Marx-Hof (Bau 1927–1930) steht emblematisch für diese Modernisierung. Gleichzeitig erschütterten Krisen – Inflation, Arbeitslosigkeit, die Julirevolte 1927 – die fragile Demokratie. Diese Spannungen spiegeln sich in Musils publizistischen Interventionen der 1920er Jahre, in denen Kulturpolitik, Theaterpraxis und urbane Lebensformen verhandelt werden. Die Sammlung zeigt, wie Musils kritische Diagnosen die ästhetische Moderne mit sozialer Reform und politischer Öffentlichkeit verschalten, ohne in Programmatik zu erstarren.
Das philosophische Feld der Zwischenkriegszeit war von Erkenntniskritik und Sprachreflexion geprägt. In Wien formierte sich der Wiener Kreis (ab Mitte der 1920er Jahre; Moritz Schlick, Rudolf Carnap), dessen Logischer Empirismus an Mach anknüpfte. Musil, geschult in Berlin bei Carl Stumpf und vertraut mit William James’ Pragmatismus, nahm diese Konstellation aufmerksam wahr, ohne ihr anzugehören. Seine Essays, Notate und aphoristischen Motive setzen auf präzise Begriffsarbeit, prüfen den Status von Tatsachen- und Werturteilen und beobachten, wie Sprache Welt konstruiert. So bildet die Sammlung eine Landkarte gelehrter Debatten, die poetische Imagination und methodische Skepsis produktiv verbindet.
Parallel verdichten sich Diskurse zu Geschlecht, Sexualität und Subjektivität. Freudsche Psychoanalyse (Wien, ab 1900), forensische Psychologie und Sexualwissenschaft (Havelock Ellis, in Deutschland Magnus Hirschfeld) verschoben Normen und sprachen Tabus an. In Österreich wurde 1918 das allgemeine Wahlrecht inklusive Frauenwahlrecht eingeführt; die Neuordnung von Ehe-, Berufs- und Bildungsrollen setzte sich in den 1920ern fort. Musils literarische und essayistische Arbeiten reagieren darauf mit mikrologischen Beschreibungen von Gefühl und Wahrnehmung, in denen soziale Erwartungen, intime Selbstprüfung und wissenschaftliche Modelle miteinander ringen. Die Dramen- und Prosaexperimente dieser Zeit reflektieren die psychopolitischen Verschiebungen ohne psychologischen Reduktionismus.
Die Weltwirtschaftskrise nach 1929 traf den Buch- und Theatermarkt hart. Gleichwohl erschienen 1930 in Berlin das erste Buch eines Großprojekts bei Rowohlt und 1933 eine Fortführung; das Vorhaben blieb unvollendet und wurde später aus dem Nachlass gesichert. Die ökonomische Prekarität verdeutlicht, wie abhängige Produktionsbedingungen Formentscheidungen mitprägen: Zeitungsfeuilleton, Vorabdruck, Vortrag, Radioansprache und Buchausgabe stehen in einem pragmatischen Austausch. Auch die Sammlung mit Essays, Reden, Glossen und Kritik dokumentiert die Mobilität von Texten über Gattungs- und Mediengrenzen hinweg – eine strukturelle Reaktion auf krisenhafte Öffentlichkeit und institutionelle Unsicherheit.
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland 1933 verschärften sich Zensur und Berufsverbote; der österreichische Autor verlor den wichtigsten Buchmarkt. In Österreich radikalisierte sich die Politik: 1933 schaltete Bundeskanzler Engelbert Dollfuß das Parlament aus, im Februar 1934 kam es zum Bürgerkrieg, 1934 setzte der Ständestaat ein. Nach dem Anschluss am 13. März 1938 floh Musil in die Schweiz. Diese Konstellation betrifft alle Werkgruppen: Publikationschancen brachen ein, Vortrags- und Theaterwege verengten sich, und Kommentarformen – Essay, Glosse, Notat – gewannen als flexible, situationsfähige Reaktionsweisen an Bedeutung, während größere Projekte unter Exilbedingungen stockten.
Im Schweizer Exil lebte Musil zunächst in Zürich, später in Genf; die Jahre 1938–1942 waren von materieller Unsicherheit und intensiver Arbeit am Nachlass geprägt. Kürzere Prosa und essayistische Stücke wurden neu geordnet; 1936 waren bereits späte Prosastücke unter dem Titel Nachlass zu Lebzeiten erschienen. Nach Musils Tod 1942 sicherte Martha Musil die Manuskripte. Die editorische Aufarbeitung – maßgeblich durch Adolf Frisé, der ab den 1950er Jahren in Hamburg (Rowohlt) musilphilologische Standards setzte – machte Entwurfs- und Fragmentbestände zugänglich. Die heutige Sammlung verdankt diesem Sicherungsprozess ihre besondere Tiefenschicht: Entstehungsgeschichte wird selbst zum Gegenstand der Lektüre.
Die Verschiebung der kulturellen Institutionen zwischen 1912 und 1933 – Theaterdirektionen, Kritikerforen, Zeitschriften, Verlage – rahmt Musils Tätigkeit als Beobachter. Seine Kritiken zu Literatur, Theater und Kunst (1912–1930), Referate und Hinweise aus 1923 sowie Antworten auf Umfragen (1914–1933) zeigen den Übergang von einer liberalen zu einer politisch polarisierten Öffentlichkeit. Dabei wird die Funktion des Kritikers als prüfende Instanz sichtbar: nicht normativ abschließend, sondern hypothetisch abwägend. Diese Haltung korrespondiert mit den Essays und Reden, in denen die Begriffe Fortschritt, Nation, Europa und Kulturpolitik unter wechselnden historischen Signalen neu kalibriert werden.
Die Theaterlandschaft, mit Wien (Burgtheater, Deutsches Volkstheater) und Berlin (Deutsches Theater unter Max Reinhardt) als Zentren, war ein Experimentierfeld zwischen Naturalismus, Expressionismus und Neuer Sachlichkeit. Regieästhetik, Ensemblepraxis und Bühnenraum veränderten die Erwartungen an dramatische Form und Sprache. Musils Stücke entstanden in diesem Spannungsfeld; seine Theaterkritiken beobachten Spielweisen, Publikumsreaktionen und Repertoirepolitiken. Die Sammlung macht sichtbar, wie dramatische Entwürfe, Aufführungserfahrungen und analytische Kommentare sich an historischen Debatten über Sinn und Zweck des Theaters reiben – vom Bildungsanspruch bis zur Massenunterhaltung – und wie daraus Maßstäbe für szenische Wahrheit und sprachliche Genauigkeit abgeleitet werden.
Technik und Rationalisierung durchziehen Musils Schreiben als Stoff und als Denkmodell. Elektrifizierung, Verkehrssysteme, Vermessung, Statistik und Industrieverwaltung prägen die Lebenswelt der Jahre 1900–1930 ebenso wie den Wortschatz von Verwaltung und Presse. Als Ingenieur geschult, beobachtete Musil die Versuche, soziale Prozesse nach Art technischer Systeme zu organisieren, und ihre Paradoxien. Essays, Glossen und aphoristische Motive thematisieren die Kollision von Messbarkeit und Sinn, von Zahl und Wert. Die Sammlung zeigt so, wie technische Metaphern in poetische Verfahren übergehen und wie literarische Formen die blinden Flecken einer vermeintlich lückenlosen Rationalität freilegen.
Eine zentrale Konstante ist Musils Plädoyer für den Essay als Denkform. In Essays, Reden und essayistischen Fragmenten erprobt er die Methode des tastenden Urteils: Hypothese, Vergleich, Beispiel, Revision. Diese Poetik des Vorläufigen verbindet sich mit Notizheften, Motivreihen und Aphorismen, die unter Stichworte und Überlegungen fallen. Dadurch wird der Schreibprozess selbst historisch situiert: als Reaktion auf Ereignisse, als Erprobung alternativer Möglichkeiten und als Arbeit an Begriffen. Die Sammlung dokumentiert diese essayistische Verfassung literarischer Moderne, in der Erkenntnis nicht als System, sondern als bewegliches Gefüge aus Beobachtung, Selbstkritik und Montage erscheint.
Die Rezeption nach 1945, verstärkt seit den 1950er Jahren durch editorische Sicherung und wissenschaftliche Kommentierung, machte Musil zu einer Leitfigur der literarischen Moderne im deutschsprachigen Raum. Spätere Autoren – von Heimito von Doderer über Thomas Bernhard bis W. G. Sebald – begegnen seinem methodischen Skeptizismus und seiner Formkraft. Historisch gelesen, vereint die Sammlung Erfahrungsräume von Kakanien bis Exil, Diskurse von Mach bis Freud, Institutionen von Feuilleton bis Burgtheater. Sie bietet damit nicht nur einen Überblick über Gattungen, sondern ein Panorama europäischer Kulturgeschichte 1900–1942, in dem Musils präzises Denken und seine poetische Experimentlust ein dauerhaftes Koordinatensystem bilden.
Synopsis (Auswahl)
Frühe Prosa
Frühe Novellen und Erzählungen, die mit psychologischer Genauigkeit Reifung, Sexualität und moralische Grenzerfahrungen erkunden. Stilistisch tastet Musil zwischen Realismus und Experiment, bereits mit dem Spannungsfeld von Exaktheit und Gefühl.
Stücke
Die Dramen sezieren bürgerliche Beziehungen, Karrierezwänge und Sprache als soziale Maske. Satire und analytische Präzision verbinden sich zu Studien der Moderne.
Lyrisches, Widmungen
Kurze Gedichte und Widmungen als poetische Miniaturen der Wahrnehmung. Motive wie Vergänglichkeit, Liebe und poetologische Selbstreflexion stehen im Zentrum.
Nachlaß zu Lebzeiten
Miniaturen, Prosaskizzen und essaynahe Stücke, die Alltagsbeobachtung mit gedanklicher Schärfe verbinden. Zentral sind Wahrnehmung, Konvention, Technik und das Möglichkeitsdenken.
Vorstufen zum Nachlaß zu Lebzeiten
Varianten und Entwürfe zu den Stücken des Nachlaß-Bandes. Sie zeigen die Werkstatt des Autors und alternative Perspektiven auf zentrale Motive.
Erzählungen 1923–1932
Spätere Erzählungen und Novellen über Begehren, das Fremde und fragile Identitäten. Subtile Psychologie trifft auf experimentelle Erzählformen.
Glossen 1921–1932
Zeitdiagnostische Kolumnen zu Politik, Kultur und Alltagsphänomenen der Zwischenkriegszeit. Ironisch-nüchtern legt Musil Denkgewohnheiten und Sprachschablonen frei.
Prosa-Fragmente aus dem Nachlass
Unvollendete Erzählansätze, Figuren- und Szenenskizzen. Viele Motive verweisen auf das Romanprojekt und vertiefen das Verhältnis von Möglichkeit und Wirklichkeit.
Aphorismen
Konzise Denkstücke über Moral, Erkenntnis, Liebe und Gesellschaft. Prägnante Formulierungen bündeln Musils Ethik der Genauigkeit und Skepsis.
Motive – Überlegungen
Notate zu Themen, Leitbildern und Strukturfragen des Werks. Sie kartieren Spannungsfelder zwischen Wissenschaft, Mystik, Utopie und Alltag.
[Stichworte zu den «Aufzeichnungen eines Schriftstellers»]
Stichwortartige Registereinträge und Notizzettel zu Lektüren, Projekten und Motiven. Sie geben Einblick in Planung, Begriffsfelder und Assoziationsketten.
Zur Person – Zum Werk
Autobiographische Splitter, Selbstzeugnisse und Kommentare zur Poetik. Musil positioniert sich gegenüber Zeitgenossen und erläutert Arbeitsweise und Zielsetzungen.
Essays
Grundlegende Aufsätze zu Ästhetik, Gesellschaft, Politik und Wissenschaft, die den Essayismus als Denkhaltung profilieren. Analytische Präzision verbindet sich mit ethischer Sensibilität und skeptischer Offenheit.
Reden
Öffentliche Vorträge und Ansprachen, in denen Musil zeitdiagnostische Thesen zuspitzt. Themen reichen von Dummheit und Irrationalität bis zur Rolle der Kunst im modernen Staat.
Essayistische Fragmente
Unabgeschlossene oder skizzenhafte Gedankengänge, die spätere Essays vorbereiten. Sie zeigen die tastende, probierende Methode des essayistischen Denkens.
Kritik. Literatur – Theater – Kunst (1912–1930)
Rezensionen und Essays zu Büchern, Aufführungen und bildender Kunst, die Maßstäbe der genauen Kritik vorführen. Musil prüft Formen, Sprache und Denkgehalt der Moderne.
Referate und Hinweise April – Juli 1923
Kurze Anzeigen, Zusammenfassungen und Hinweise zu Neuerscheinungen und Kulturereignissen. Momentaufnahmen einer kritischen Redaktionstätigkeit.
Antworten zu Umfragen 1914–1933
Selbstauskünfte in Presseumfragen zu Krieg, Nation, Kunst und Öffentlichkeit. Sie dokumentieren Musils nüchterne Skepsis gegenüber Ideologien und Schlagworten.
Nachträge
Ergänzende Rezensionen, Notate und Kleinsttexte, die Lücken schließen und Positionen abrunden.
Kritik-Entwürfe
Skizzen und Varianten zu Rezensionen, die Bewertungsmaßstäbe und Argumentationswege in Entstehung zeigen.
ERSTES BUCH
Ulrich, der Mann ohne Eigenschaften, wird 1913 in die Parallelaktion des habsburgischen Kakanien gezogen; Salons, Bürokratien und Ideenkämpfe liefern das Panorama. Zwischen Möglichkeitssinn und Wirklichkeitssinn erkundet der Roman gesellschaftliche Ideologien und individuelle Rollen.
ZWEITES BUCH
Mit der Wiederbegegnung mit der Schwester Agathe verschiebt sich der Fokus von der Gesellschaftsanalyse zur Suche nach einer anderen Zuständlichkeit. Liebe, Ethik und Erkenntnis werden in einer experimentellen Lebensform erprobt; die Handlung öffnet sich stärker ins Fragmentarische und Denkende.
Robert Musil: Gesammelte Werke in einem Band
PROSA UND STÜCKE
prosa und stücke
[zurück]
FRÜHE PROSA
→Die Verwirrungen des Zöglings Törleß
→Vereinigungen
→ Die Vollendung der Liebe
→ Die Versuchung der stillen Veronika
→ Das verzauberte Haus [Ältere Fassung zur «Versuchung der stillen Veronika», 1908]
→ Die Versuchung der stillen Veronika [Fragment – vor 1908]
→Drei Frauen
→ Grigia
→ Die Portugiesin
→ Tonka
STÜCKE
→Die Schwärmer
→ 1. Aufzug
→ 2. Aufzug
→ 3. Aufzug
→Vinzenz und die Freundin bedeutender Männer
→ 1. Akt
→ 2. Akt
→ 3. Akt
→Vorspiel zu dem Melodrama «Der Tierkreis»
LYRISCHES, WIDMUNGEN
→1. Lyrisches
→ Isis und Osiris
→ Heimweh
→ An ein Zimmer
→ Das Namenlose
→ Die Hitze
→ Dernburg
→ [Schön ist die Zeit]
→2. Widmungen
→ Thomas Mann zum 60. Geburtstag am 6. Juni 1935
→ An Otto Pächt In einem Exemplar des «Nachlaß zu Lebzeiten» «zu Weihnachten 1935»
→ An «E. u B F:» [Erna und Bruno Fürst]
→ An Bernard Groethuysen
→ In einem Exemplar von «Die Verwirrungen des Zöglings Törleß»
Frühe Prosa
Die Verwirrungen des Zöglings Törleß
[Wiener Verlag, 1906]
«Sobald wir etwas aussprechen, entwerten wir es seltsam. Wir glauben in die Tiefe der Abgründe hinabgetaucht zu sein, und wenn wir wieder an die Oberfläche kommen, gleicht der Wassertropfen an unseren bleichen Fingerspitzen nicht mehr dem Meere, dem er entstammt. Wir wähnen eine Schatzgrube wunderbarer Schätze entdeckt zu haben, und wenn wir wieder ans Tageslicht kommen, haben wir nur falsche Steine und Glasscherben mitgebracht; und trotzdem schimmert der Schatz im Finstern unverändert.»Maeterlinck
Eine kleine Station an der Strecke, welche nach Rußland führt.
Endlos gerade liefen vier parallele Eisenstränge nach beiden Seiten zwischen dem gelben Kies des breiten Fahrdammes; neben jedem wie ein schmutziger Schatten der dunkle, von dem Abdampfe in den Boden gebrannte Strich.
Hinter dem niederen, ölgestrichenen Stationsgebäude führte eine breite, ausgefahrene Straße zur Bahnhofsrampe herauf. Ihre Ränder verloren sich in dem ringsum zertretenen Boden und waren nur an zwei Reihen Akazienbäumen kenntlich, die traurig mit verdursteten, von Staub und Ruß erdrosselten Blättern zu beiden Seiten standen.
Machten es diese traurigen Farben, machte es das bleiche, kraftlose, durch den Dunst ermüdete Licht der Nachmittagssonne: Gegenstände und Menschen hatten etwas Gleichgültiges, Lebloses, Mechanisches an sich, als seien sie aus der Szene eines Puppentheaters genommen. Von Zeit zu Zeit, in gleichen Intervallen, trat der Bahnhofsvorstand aus seinem Amtszimmer heraus, sah mit der gleichen Wendung des Kopfes die weite Strecke hinauf nach den Signalen der Wächterhäuschen, die immer noch nicht das Nahen des Eilzuges anzeigen wollten, der an der Grenze große Verspätung erlitten hatte; mit ein und derselben Bewegung des Armes zog er sodann seine Taschenuhr hervor, schüttelte den Kopf und verschwand wieder; so wie die Figuren kommen und gehen, die aus alten Turmuhren treten, wenn die Stunde voll ist.
Auf dem breiten, festgestampften Streifen zwischen Schienenstrang und Gebäude promenierte eine heitere Gesellschaft junger Leute, links und rechts eines älteren Ehepaares schreitend, das den Mittelpunkt der etwas lauten Unterhaltung bildete. Aber auch die Fröhlichkeit dieser Gruppe war keine rechte; der Lärm des lustigen Lachens schien schon auf wenige Schritte zu verstummen, gleichsam an einem zähen, unsichtbaren Widerstande zu Boden zu sinken.
Frau Hofrat Törleß, dies war die Dame von vielleicht vierzig Jahren, verbarg hinter ihrem dichten Schleier traurige, vom Weinen ein wenig gerötete Augen. Es galt Abschied zu nehmen. Und es fiel ihr schwer, ihr einziges Kind nun wieder auf so lange Zeit unter fremden Leuten lassen zu müssen, ohne Möglichkeit, selbst schützend über ihren Liebling zu wachen.
Denn die kleine Stadt lag weitab von der Residenz, im Osten des Reiches, in spärlich besiedeltem, trockenem Ackerland.
Der Grund, dessentwegen Frau Törleß es dulden mußte, ihren Jungen in so ferner, unwirtlicher Fremde zu wissen, war, daß sich in dieser Stadt ein berühmtes Konvikt befand, welches man schon seit dem vorigen Jahrhunderte, wo es auf dem Boden einer frommen Stiftung errichtet worden war, da draußen beließ, wohl um die aufwachsende Jugend vor den verderblichen Einflüssen einer Großstadt zu bewahren.
Denn hier erhielten die Söhne der besten Familien des Landes ihre Ausbildung, um nach Verlassen des Institutes die Hochschule zu beziehen oder in den Militär-oder Staatsdienst einzutreten, und in allen diesen Fällen sowie für den Verkehr in den Kreisen der guten Gesellschaft galt es als besondere Empfehlung, im Konvikte zu W. aufgewachsen zu sein.
Vor vier Jahren hatte dies das Elternpaar Törleß bewogen, dem ehrgeizigen Drängen seines Knaben nachzugeben und seine Aufnahme in das Institut zu erwirken.
Dieser Entschluß hatte später viele Tränen gekostet. Denn fast seit dem Augenblicke, da sich das Tor des Institutes unwiderruflich hinter ihm geschlossen hatte, litt der kleine Törleß an fürchterlichem, leidenschaftlichem Heimweh. Weder die Unterrichtsstunden, noch die Spiele auf den großen üppigen Wiesen des Parkes, noch die anderen Zerstreuungen, die das Konvikt seinen Zöglingen bot, vermochten ihn zu fesseln; er beteiligte sich kaum an ihnen. Er sah alles nur wie durch einen Schleier und hatte selbst untertags häufig Mühe, ein hartnäckiges Schluchzen hinabzuwürgen; des Abends schlief er aber stets unter Tränen ein.
Er schrieb Briefe nach Hause, beinahe täglich, und er lebte nur in diesen Briefen; alles andere, was er tat, schien ihm nur ein schattenhaftes, bedeutungsloses Geschehen zu sein, gleichgültige Stationen wie die Stundenziffern eines Uhrblattes. Wenn er aber schrieb, fühlte er etwas Auszeichnendes, Exklusives in sich; wie eine Insel voll wunderbarer Sonnen und Farben hob sich etwas in ihm aus dem Meere grauer Empfindungen heraus, das ihn Tag um Tag kalt und gleichgültig umdrängte. Und wenn er untertags, bei den Spielen oder im Unterrichte, daran dachte, daß er abends seinen Brief schreiben werde, so war ihm, als trüge er an unsichtbarer Kette einen goldenen Schlüssel verborgen, mit dem er, wenn es niemand sieht, das Tor von wunderbaren Gärten öffnen werde.
Das Merkwürdige daran war, daß diese jähe, verzehrende Hinneigung zu seinen Eltern für ihn selbst etwas Neues und Befremdendes hatte. Er hatte sie vorher nicht geahnt, er war gern und freiwillig ins Institut gegangen, ja er hatte gelacht, als sich seine Mutter beim ersten Abschied vor Tränen nicht fassen konnte, und dann erst, nachdem er schon einige Tage allein gewesen war und sich verhältnismäßig wohl befunden hatte, brach es plötzlich und elementar in ihm empor.
Er hielt es für Heimweh, für Verlangen nach seinen Eltern. In Wirklichkeit war es aber etwas viel Unbestimmteres und Zusammengesetzteres. Denn der «Gegenstand dieser Sehnsucht», das Bild seiner Eltern, war darin eigentlich gar nicht mehr enthalten. Ich meine diese gewisse plastische, nicht bloß gedächtnismäßige, sondern körperliche Erinnerung an eine geliebte Person, die zu allen Sinnen spricht und in allen Sinnen bewahrt wird, so daß man nichts tun kann, ohne schweigend und unsichtbar den anderen zur Seite zu fühlen. Diese verklang bald wie eine Resonanz, die nur noch eine Weile fortgezittert hatte. Törleß konnte sich damals beispielsweise nicht mehr das Bild seiner «lieben, lieben Eltern» – dermaßen sprach er es meist vor sich hin – vor Augen zaubern. Versuchte er es, so kam an dessen Stelle der grenzenlose Schmerz in ihm empor, dessen Sehnsucht ihn züchtigte und ihn doch eigenwillig festhielt, weil ihre heißen Flammen ihn zugleich schmerzten und entzückten. Der Gedanke an seine Eltern wurde ihm hiebei mehr und mehr zu einer bloßen Gelegenheitsursache, dieses egoistische Leiden in sich zu erzeugen, das ihn in seinen wollüstigen Stolz einschloß wie in die Abgeschiedenheit einer Kapelle, in der von hundert flammenden Kerzen und von hundert Augen heiliger Bilder Weihrauch zwischen die Schmerzen der sich selbst Geißelnden gestreut wird. –––
Als dann sein «Heimweh» weniger heftig wurde und sich allgemach verlor, zeigte sich diese seine Art auch ziemlich deutlich. Sein Verschwinden führte nicht eine endlich erwartete Zufriedenheit nach sich, sondern ließ in der Seele des jungen Törleß eine Leere zurück. Und an diesem Nichts, an diesem Unausgefüllten in sich erkannte er, daß es nicht eine bloße Sehnsucht gewesen war, die ihm abhanden kam, sondern etwas Positives, eine seelische Kraft, etwas, das sich in ihm unter dem Vorwand des Schmerzes ausgeblüht hatte.
Nun aber war es vorbei, und diese Quelle einer ersten höheren Seligkeit hatte sich ihm erst durch ihr Versiegen fühlbar gemacht.
Zu dieser Zeit verloren sich die leidenschaftlichen Spuren der im Erwachen gewesenen Seele wieder aus seinen Briefen, und an ihre Stelle traten ausführliche Beschreibungen des Lebens im Institute und der neugewonnenen Freunde.
Er selbst fühlte sich dabei verarmt und kahl, wie ein Bäumchen, das nach der noch fruchtlosen Blüte den ersten Winter erlebt.
Seine Eltern aber waren es zufrieden. Sie liebten ihn mit einer starken, gedankenlosen, tierischen Zärtlichkeit. Jedesmal, wenn er vom Konvikte Ferien bekommen hatte, erschien der Hofrätin nachher ihr Haus von neuem leer und ausgestorben, und noch einige Tage nach jedem solchen Besuche ging sie mit Tränen in den Augen durch die Zimmer, da und dort einen Gegenstand liebkosend berührend, auf dem das Auge des Knaben geruht oder den seine Finger gehalten hatten. Und beide hätten sie sich für ihn in Stücke reißen lassen.
Die unbeholfene Rührung und leidenschaftliche, trotzige Trauer seiner Briefe beschäftigte sie schmerzlich und versetzte sie in einen Zustand hochgespannter Empfindsamkeit; der heitere, zufriedene Leichtsinn, der darauf folgte, machte auch sie wieder froh, und in dem Gefühle, daß dadurch eine Krise überwunden worden sei, unterstützten sie ihn nach Kräften.
Weder in dem einen noch in dem andern erkannten sie das Symptom einer bestimmten seelischen Entwicklung, vielmehr hatten sie Schmerz und Beruhigung gleichermaßen als eine natürliche Folge der gegebenen Verhältnisse hingenommen. Daß es der erste, mißglückte Versuch des jungen, auf sich selbst gestellten Menschen gewesen war, die Kräfte des Inneren zu entfalten, entging ihnen.
Törleß fühlte sich nun sehr unzufrieden und tastete da und dort vergeblich nach etwas Neuem, das ihm als Stütze hätte dienen können.
Eine Episode dieser Zeit war für das charakteristisch, was sich damals in Törleß zu späterer Entwicklung vorbereitete.
Eines Tages war nämlich der junge Fürst H. ins Institut eingetreten, der aus einem der einflußreichsten, ältesten und konservativsten Adelsgeschlechter des Reiches stammte.
Alle anderen fanden seine sanften Augen fad und affektiert; die Art und Weise, wie er im Stehen die eine Hüfte herausdrückte und beim Sprechen langsam mit den Fingern spielte, verlachten sie als weibisch. Besonders aber spotteten sie darüber, daß er nicht von seinen Eltern ins Konvikt gebracht worden war, sondern von seinem bisherigen Erzieher, einem doctor theologiae und Ordensgeistlichen.
Törleß aber hatte vom ersten Augenblicke an einen starken Eindruck empfangen. Vielleicht wirkte dabei der Umstand mit, daß es ein hoffähiger Prinz war, jedenfalls war es aber auch eine andere Art Mensch, die er da kennen lernte.
Das Schweigen eines alten Landedelschlosses und frommer Übungen schien irgendwie noch an ihm zu haften. Wenn er ging, so geschah es mit weichen, geschmeidigen Bewegungen, mit diesem etwas schüchternen Sichzusammenziehen und Schmalmachen, das der Gewohnheit eigen ist, aufrecht durch die Flucht leerer Säle zu schreiten, wo ein anderer an unsichtbaren Ecken des leeren Raumes schwer anzurennen scheint.
Der Umgang mit dem Prinzen wurde so zur Quelle eines feinen psychologischen Genusses für Törleß. Er bahnte in ihm jene Art Menschenkenntnis an, die es lehrt, einen anderen nach dem Fall der Stimme, nach der Art, wie er etwas in die Hand nimmt, ja selbst nach dem Timbre seines Schweigens und dem Ausdruck der körperlichen Haltung, mit der er sich in einen Raum fügt, kurz nach dieser beweglichen, kaum greifbaren und doch erst eigentlichen, vollen Art etwas Seelisch-Menschliches zu sein, die um den Kern, das Greif-und Besprechbare, wie um ein bloßes Skelett herumgelagert ist, so zu erkennen und zu genießen, daß man die geistige Persönlichkeit dabei vorwegnimmt.
Törleß lebte während dieser kurzen Zeit wie in einer Idylle. Er stieß sich nicht an der Religiosität seines neuen Freundes, die ihm, der aus einem bürgerlich-freidenkenden Hause stammte, eigentlich etwas ganz Fremdes war. Er nahm sie vielmehr ohne alles Bedenken hin, ja sie bildete in seinen Augen sogar einen besonderen Vorzug des Prinzen, denn sie steigerte das Wesen dieses Menschen, das er dem seinen völlig unähnlich, aber auch ganz unvergleichlich fühlte.
In der Gesellschaft dieses Prinzen fühlte er sich etwa wie in einer abseits des Weges liegenden Kapelle, so daß der Gedanke, daß er eigentlich nicht dorthin gehöre, ganz gegen den Genuß verschwand, das Tageslicht einmal durch Kirchenfenster anzusehen und das Auge so lange über den nutzlosen, vergoldeten Zierat gleiten zu lassen, der in der Seele dieses Menschen aufgehäuft war, bis er von dieser selbst ein undeutliches Bild empfing, so, als ob er, ohne sich Gedanken darüber machen zu können, mit dem Finger eine schöne, aber nach seltsamen Gesetzen verschlungene Arabeske nachzöge.
Dann kam es plötzlich zum Bruche zwischen beiden.
Wegen einer Dummheit, wie sich Törleß selbst hinterher sagen mußte.
Sie waren nämlich doch einmal ins Streiten über religiöse Dinge gekommen. Und in diesem Augenblicke war es eigentlich schon um alles geschehen. Denn wie von Törleß unabhängig, schlug nun der Verstand in ihm unaufhaltsam auf den zarten Prinzen los. Er überschüttete ihn mit dem Spotte des Vernünftigen, zerstörte barbarisch das filigrane Gebäude, in dem dessen Seele heimisch war, und sie gingen im Zorne auseinander.
Seit der Zeit hatten sie auch kein Wort wieder zueinander gesprochen. Törleß war sich wohl dunkel bewußt, daß er etwas Sinnloses getan hatte, und eine unklare, gefühlsmäßige Einsicht sagte ihm, daß da dieser hölzerne Zollstab des Verstandes zu ganz unrechter Zeit etwas Feines und Genußreiches zerschlagen habe. Aber dies war etwas, das ganz außer seiner Macht lag. Eine Art Sehnsucht nach dem Früheren war wohl für immer in ihn zurückgeblieben, aber er schien in einen anderen Strom geraten zu sein, der ihn immer weiter davon entfernte.
Nach einiger Zeit trat dann auch der Prinz, der sich im Konvikte nicht wohl befunden hatte, wieder aus.
Nun wurde es ganz leer und langweilig um Törleß. Aber er war einstweilen älter geworden, und die beginnende Geschlechtsreife fing an, sich dunkel und allmählich in ihm emporzuheben. In diesem Abschnitt seiner Entwicklung schloß er einige neue, dementsprechende Freundschaften, die für ihn später von größter Wichtigkeit wurden. So mit Beineberg und Reiting, mit Moté und Hofmeier, eben jenen jungen Leuten, in deren Gesellschaft er heute seine Eltern zur Bahn begleitete.
Merkwürdigerweise waren dies gerade die übelsten seines Jahrganges, zwar talentiert und selbstverständlich auch von guter Herkunft, aber bisweilen bis zur Roheit wild und ungebärdig. Und daß gerade ihre Gesellschaft Törleß nun fesselte, lag wohl an seiner eigenen Unselbständigkeit, die, seitdem es ihn von dem Prinzen wieder fortgetrieben hatte, sehr arg war. Es lag sogar in der geradlinigen Verlängerung dieses Abschwenkens, denn es bedeutete wie dieses eine Angst vor allzu subtilen Empfindeleien, gegen die das Wesen der anderen Kameraden gesund, kernig und lebensgerecht abstach.
Törleß überließ sich gänzlich ihrem Einflusse, denn seine geistige Situation war nun ungefähr diese: In seinem Alter hat man am Gymnasium Goethe, Schiller, Shakespeare, vielleicht sogar schon die Modernen gelesen. Das schreibt sich dann halbverdaut aus den Fingerspitzen wieder heraus. Römertragödien entstehen oder sensitivste Lyrik, die im Gewande seitenlanger Interpunktionen wie in der Zartheit durchbrochener Spitzenarbeit einherschreitet: Dinge, die an und für sich lächerlich sind, für die Sicherheit der Entwicklung aber einen unschätzbaren Wert bedeuten. Denn diese von außen kommenden Assoziationen und erborgten Gefühle tragen die jungen Leute über den gefährlich weichen seelischen Boden dieser Jahre hinweg, wo man sich selbst etwas bedeuten muß und doch noch zu unfertig ist, um wirklich etwas zu bedeuten. Ob für später bei dem einen etwas davon zurückbleibt oder bei dem andern nichts, ist gleichgültig; dann findet sich schon jeder mit sich ab, und die Gefahr besteht nur in dem Alter des Überganges. Wenn man da solch einem jungen Menschen das Lächerliche seiner Person zur Einsicht bringen könnte, so würde der Boden unter ihm einbrechen, oder er würde wie ein erwachter Nachtwandler herabstürzen, der plötzlich nichts als Leere sieht.
Diese Illusion, dieser Trick zugunsten der Entwicklung fehlte im Institute. Denn dort waren in der Büchersammlung wohl die Klassiker enthalten, aber diese galten als langweilig, und sonst fanden sich nur sentimentale Novellenbände und witzlose Militärhumoresken.
Der kleine Törleß hatte sie wohl alle förmlich in einer Gier nach Büchern durchgelesen, irgendeine banal zärtliche Vorstellung aus ein oder der anderen Novelle wirkte manchmal auch noch eine Weile nach, allein einen Einfluß, einen wirklichen Einfluß, nahm dies auf seinen Charakter nicht.
Es schien damals, daß er überhaupt keinen Charakter habe.
Er schrieb zum Beispiel unter dem Einflusse dieser Lektüre selbst hie und da eine kleine Erzählung oder begann ein romantisches Epos zu dichten. In der Erregung über die Liebesleiden seiner Helden röteten sich dann seine Wangen, seine Pulse beschleunigten sich und seine Augen glänzten.
Wie er aber die Feder aus der Hand legte, war alles vorbei; gewissermaßen nur in der Bewegung lebte sein Geist. Daher war es ihm auch möglich, ein Gedicht oder eine Erzählung wann immer, auf jede Aufforderung hin, niederzuschreiben. Er regte sich dabei auf, aber trotzdem nahm er es nie ganz ernst, und die Tätigkeit erschien ihm nicht wichtig. Es ging von ihr nichts auf seine Person über, und sie ging nicht von seiner Person aus. Er hatte nur unter irgendeinem äußeren Zwang Empfindungen, die über das Gleichgültige hinausgingen, wie ein Schauspieler dazu des Zwanges einer Rolle bedarf.
Es waren Reaktionen des Gehirns. Das aber, was man als Charakter oder Seele, Linie oder Klangfarbe eines Menschen fühlt, jedenfalls dasjenige, wogegen die Gedanken, Entschlüsse und Handlungen wenig bezeichnend, zufällig und auswechselbar erscheinen, dasjenige, was beispielsweise Törleß an den Prinzen jenseits alles verstandlichen Beurteilens geknüpft hatte, dieser letzte, unbewegliche Hintergrund, war zu jener Zeit in Törleß gänzlich verloren gegangen.
In seinen Kameraden war es die Freude am Sport, das Animalische, welches sie eines solchen gar nicht bedürfen ließ, so wie am Gymnasium das Spiel mit der Literatur dafür sorgt.
Törleß war aber für das eine zu geistig angelegt und dem anderen brachte er jene scharfe Feinfühligkeit für das Lächerliche solcher erborgter Sentiments entgegen, die das Leben im Institute durch seine Nötigung steter Bereitschaft zu Streitigkeiten und Faustkämpfen erzeugt. So erhielt sein Wesen etwas Unbestimmtes, eine innere Hilflosigkeit, die ihn nicht zu sich selbst finden ließ.
Er schloß sich seinen neuen Freunden an, weil ihm ihre Wildheit imponierte. Da er ehrgeizig war, versuchte er hie und da, es ihnen darin sogar zuvorzutun. Aber jedesmal blieb er wieder auf halbem Wege stehen und hatte nicht wenig Spott deswegen zu erleiden. Dies verschüchterte ihn dann wieder. Sein ganzes Leben bestand in dieser kritischen Periode eigentlich nur in diesem immer erneuten Bemühen, seinen rauhen, männlicheren Freunden nachzueifern, und in einer tief innerlichen Gleichgültigkeit gegen dieses Bestreben.
Besuchten ihn jetzt seine Eltern, so war er, solange sie allein waren, still und scheu. Den zärtlichen Berührungen seiner Mutter entzog er sich jedesmal unter einem anderen Vorwande. In Wahrheit hätte er ihnen gern nachgegeben, aber er schämte sich, als seien die Augen seiner Kameraden auf ihn gerichtet.
Seine Eltern nahmen es als die Ungelenkigkeit der Entwicklungsjahre hin.
Nachmittags kam dann die ganze laute Schar. Man spielte Karten, aß, trank, erzählte Anekdoten über die Lehrer und rauchte die Zigaretten, die der Hofrat aus der Residenz mitgebracht hatte.
Diese Heiterkeit erfreute und beruhigte das Ehepaar.
Daß für Törleß mitunter auch andere Stunden kamen, wußten sie nicht. Und in der letzten Zeit immer zahlreichere. Er hatte Augenblicke, wo ihm das Leben im Institute völlig gleichgültig wurde. Der Kitt seiner täglichen Sorgen löste sich da, und die Stunden seines Lebens fielen ohne innerlichen Zusammenhang auseinander.
Er saß oft lange – in finsterem Nachdenken – gleichsam über sich selbst gebeugt.
Zwei Besuchstage waren es auch diesmal gewesen. Man hatte gespeist, geraucht, eine Spazierfahrt unternommen, und nun sollte der Eilzug das Ehepaar wieder in die Residenz zurückführen.
Ein leises Rollen in den Schienen kündigte sein Nahen an, und die Signale der Glocke am Dache des Stationsgebäudes klangen der Hofrätin unerbittlich ins Ohr.
«Also nicht wahr, lieber Beineberg, Sie geben mir auf meinen Buben acht?» wandte sich Hofrat Törleß an den jungen Baron Beineberg, einen langen, knochigen Burschen mit mächtig abstehenden Ohren, aber ausdrucksvollen, gescheiten Augen.
Der kleine Törleß schnitt ob dieser Bevormundung ein mißmutiges Gesicht, und Beineberg grinste geschmeichelt und ein wenig schadenfroh.
«Überhaupt» – wandte sich der Hofrat an die übrigen – «möchte ich Sie alle gebeten haben, falls meinem Sohne irgend etwas sein sollte, mich gleich davon zu verständigen.»
Dies entlockte nun doch dem jungen Törleß ein unendlich gelangweiltes: «Aber Papa, was soll mir denn passieren?!» obwohl er schon daran gewöhnt war, bei jedem Abschiede diese allzu große Sorgsamkeit über sich ergehen lassen zu müssen.
Die anderen schlugen indessen die Hacken zusammen, wobei sie die zierlichen Degen straff an die Seite zogen, und der Hofrat fügte noch hinzu: «Man kann nie wissen, was vorkommt, und der Gedanke, sofort von allem verständigt zu werden, bereitet mir eine große Beruhigung; schließlich könntest du doch auch am Schreiben behindert sein.»
Dann fuhr der Zug ein. Hofrat Törleß umarmte seinen Sohn, Frau von Törleß drückte den Schleier fester ans Gesicht, um ihre Tränen zu verbergen, die Freunde bedankten sich der Reihe nach, dann schloß der Schaffner die Wagentür.
Noch einmal sah das Ehepaar die hohe, kahle Rückfront des Institutsgebäudes, – die mächtige, langgestreckte Mauer, welche den Park umschloß, dann kamen rechts und links nur mehr graubraune Felder und vereinzelte Obstbäume.
Die jungen Leute hatten unterdessen den Bahnhof verlassen und gingen in zwei Reihen hintereinander auf den beiden Rändern der Straße – so wenigstens dem dicksten und zähesten Staube ausweichend – der Stadt zu, ohne viel miteinander zu reden.
Es war fünf Uhr vorbei, und über die Felder kam es ernst und kalt, wie ein Vorbote des Abends.
Törleß wurde sehr traurig.
Vielleicht war daran die Abreise seiner Eltern schuld, vielleicht war es jedoch nur die abweisende, stumpfe Melancholie, die jetzt auf der ganzen Natur ringsumher lastete und schon auf wenige Schritte die Formen der Gegenstände mit schweren glanzlosen Farben verwischte.
Dieselbe furchtbare Gleichgültigkeit, die schon den ganzen Nachmittag über allerorts gelegen war, kroch nun über die Ebene heran, und hinter ihr her wie eine schleimige Fährte der Nebel, der über den Sturzäckern und bleigrauen Rübenfeldern klebte.
Törleß sah nicht rechts noch links, aber er fühlte es. Schritt für Schritt trat er in die Spuren, die soeben erst vom Fuße des Vordermanns in dem Staube aufklafften, – und so fühlte er es: als ob es so sein müßte: als einen steinernen Zwang, der sein ganzes Leben in diese Bewegung – Schritt für Schritt – auf dieser einen Linie, auf diesem einen schmalen Streifen, der sich durch den Staub zog, einfing und zusammenpreßte.
Als sie an einer Kreuzung stehen blieben, wo ein zweiter Weg mit dem ihren in einen runden, ausgetretenen Fleck zusammenfloß, und als dort ein morschgewordener Wegweiser schief in die Luft hineinragte, wirkte diese, zu ihrer Umgebung in Widerspruch stehende, Linie wie ein verzweifelter Schrei auf Törleß.
Wieder gingen sie weiter. Törleß dachte an seine Eltern, an Bekannte, an das Leben. Um diese Stunde kleidet man sich für eine Gesellschaft an oder beschließt ins Theater zu fahren. Und nachher geht man ins Restaurant, hört eine Kapelle, besucht das Kaffeehaus. Man macht eine interessante Bekanntschaft. Ein galantes Abenteuer hält bis zum Morgen in Erwartung. Das Leben rollt wie ein wunderbares Rad immer Neues, Unerwartetes aus sich heraus …
Törleß seufzte unter diesen Gedanken, und bei jedem Schritte, der ihn der Enge des Institutes nähertrug, schnürte sich etwas immer fester in ihm zusammen.
Jetzt schon klang ihm das Glockenzeichen in den Ohren. Nichts fürchtete er nämlich so sehr wie dieses Glockenzeichen, das unwiderruflich das Ende des Tages bestimmte – wie ein brutaler Messerschnitt.
Er erlebte ja nichts, und sein Leben dämmerte in steter Gleichgültigkeit dahin, aber dieses Glockenzeichen fügte dem auch noch den Hohn hinzu und ließ ihn in ohnmächtiger Wut über sich selbst, über sein Schicksal, über den begrabenen Tag erzittern.
Nun kannst du gar nichts mehr erleben, während zwölf Stunden kannst du nichts mehr erleben, für zwölf Stunden bist du tot …: das war der Sinn dieses Glockenzeichens.
Als die Gesellschaft junger Leute zwischen die ersten niedrigen, hüttenartigen Häuser kam, wich dieses dumpfe Brüten von Törleß. Wie von einem plötzlichen Interesse erfaßt, hob er den Kopf und blickte angestrengt in das dunstige Innere der kleinen, schmutzigen Gebäude, an denen sie vorübergingen.
Vor den Türen der meisten standen die Weiber, in Kitteln und groben Hemden, mit breiten, beschmutzten Füßen und nackten, braunen Armen.
Waren sie jung und drall, so flog ihnen manches derbe slawische Scherzwort zu. Sie stießen sich an und kicherten über die «jungen Herren»; manchmal schrie eine auch auf, wenn im Vorübergehen allzu hart ihre Brüste gestreift wurden, oder erwiderte mit einem lachenden Schimpfwort einen Schlag auf die Schenkel. Manche sah auch bloß mit zornigem Ernste hinter den Eilenden drein; und der Bauer lächelte verlegen, – halb unsicher, halb gutmütig, – wenn er zufällig hinzugekommen war.
Törleß beteiligte sich nicht an dieser übermütigen, frühreifen Männlichkeit seiner Freunde.
Der Grund hiezu lag wohl teilweise in einer gewissen Schüchternheit in geschlechtlichen Sachen, wie sie fast allen einzigen Kindern eigentümlich ist, zum größeren Teile jedoch in der ihm besonderen Art der sinnlichen Veranlagung, welche verborgener, mächtiger und dunkler gefärbt war als die seiner Freunde und sich schwerer äußerte.
Während die anderen mit den Weibern schamlos – taten, beinahe mehr um «fesch» zu sein, als aus Begierde, war die Seele des schweigsamen, kleinen Törleß aufgewühlt und von wirklicher Schamlosigkeit gepeitscht.
Er blickte mit so brennenden Augen durch die kleinen Fenster und winkligen, schmalen Torwege in das Innere der Häuser, daß es ihm beständig wie ein feines Netz vor den Augen tanzte.
Fast nackte Kinder wälzten sich in dem Kot der Höfe, da und dort gab der Rock eines arbeitenden Weibes die Kniekehlen frei oder drückte sich eine schwere Brust straff in die Falten der Leinwand. Und als ob all dies sogar unter einer ganz anderen, tierischen, drückenden Atmosphäre sich abspielte, floß aus dem Flur der Häuser eine träge, schwere Luft, die Törleß begierig einatmete.
Er dachte an alte Malereien, die er in Museen gesehen hatte, ohne sie recht zu verstehen. Er wartete auf irgend etwas, so wie er vor diesen Bildern immer auf etwas gewartet hatte, das sich nie ereignete. Worauf …? … Auf etwas Überraschendes, noch nie Gesehenes; auf einen ungeheuerlichen Anblick, von dem er sich nicht die geringste Vorstellung machen konnte; auf irgend etwas von fürchterlicher, tierischer Sinnlichkeit; das ihn wie mit Krallen packe und von den Augen aus zerreiße; auf ein Erlebnis, das in irgendeiner noch ganz unklaren Weise mit den schmutzigen Kitteln der Weiber, mit ihren rauhen Händen, mit der Niedrigkeit ihrer Stuben, mit … mit einer Beschmutzung an dem Kot der Höfe … zusammenhängen müsse … Nein, nein; … er fühlte jetzt nur mehr das feurige Netz vor den Augen; die Worte sagten es nicht; so arg, wie es die Worte machen, ist es gar nicht; es ist etwas ganz Stummes, – ein Würgen in der Kehle, ein kaum merkbarer Gedanke, und nur dann, wenn man es durchaus mit Worten sagen wollte, käme es so heraus; aber dann ist es auch nur mehr entfernt ähnlich, wie in einer riesigen Vergrößerung, wo man nicht nur alles deutlicher sieht, sondern auch Dinge, die gar nicht da sind … Dennoch war es zum Schämen.
«Hat das Bubi Heimweh?» fragte ihn plötzlich spöttisch der lange und um zwei Jahre ältere v. Reiting, welchem Törleß’ Schweigsamkeit und die verdunkelten Augen aufgefallen waren. Törleß lächelte gemacht und verlegen, und ihm war, als hätte der boshafte Reiting die Vorgänge in seinem Innern belauscht.
Er gab keine Antwort. Aber sie waren mittlerweile auf den Kirchplatz des Städtchens gelangt, der die Form eines Quadrates hatte und mit Katzenköpfen gepflastert war, und trennten sich nun voneinander.
Törleß und Beineberg wollten noch nicht ins Institut zurück, während die andern keine Erlaubnis zu längerem Ausbleiben hatten und nach Hause gingen.
Die beiden waren in der Konditorei eingekehrt.
Dort saßen sie an einem kleinen Tische mit runder Platte, neben einem Fenster, das auf den Garten hinausging, unter einer Gaskrone, deren Lichter hinter den milchigen Glaskugeln leise summten.
Sie hatten es sich bequem gemacht, ließen sich die Gläschen mit wechselnden Schnäpsen füllen, rauchten Zigaretten, aßen dazwischen etwas Bäckerei und genossen das Behagen, die einzigen Gäste zu sein. Denn höchstens in den hinteren Räumen saß noch ein vereinzelter Besucher vor seinem Glase Wein; vorne war es still, und selbst die feiste, angejährte Konditorin schien hinter ihrem Ladentische zu schlafen.
Törleß sah – nur so ganz unbestimmt – durch das Fenster – in den leeren Garten hinaus, der allgemach verdunkelte.
Beineberg erzählte. Von Indien. Wie gewöhnlich. Denn sein Vater, der General war, war dort als junger Offizier in englischen Diensten gestanden. Und nicht nur hatte er wie sonstige Europäer Schnitzereien, Gewebe und kleine Industriegötzen mit herübergebracht, sondern auch etwas von dem geheimnisvollen, bizarren Dämmern des esoterischen Buddhismus gefühlt und sich bewahrt. Auf seinen Sohn hatte er das, was er von da her wußte und später noch hinzulas, schon von dessen Kindheit an übertragen.
Mit dem Lesen war es übrigens bei ihm ganz eigen. Er war Reiteroffizier und liebte durchaus nicht die Bücher im allgemeinen. Romane und Philosophie verachtete er gleichermaßen. Wenn er las, wollte er nicht über Meinungen und Streitfragen nachdenken, sondern schon beim Aufschlagen der Bücher wie durch eine heimliche Pforte in die Mitte auserlesener Erkenntnisse treten. Es mußten Bücher sein, deren Besitz allein schon wie ein geheimes Ordenszeichen war und wie eine Gewährleistung überirdischer Offenbarungen. Und solches fand er nur in den Büchern der indischen Philosophie, die für ihn eben nicht bloß Bücher zu sein schienen, sondern Offenbarungen, Wirkliches, – Schlüsselwerke wie die alchimistischen und Zauberbücher des Mittelalters.
Mit ihnen schloß sich dieser gesunde, tatkräftige Mann, der strenge seinen Dienst versah und überdies seine drei Pferde fast täglich selber ritt, meist gegen Abend ein.
Dann griff er aufs Geratewohl eine Stelle heraus und sann, ob sich ihr geheimster Sinn ihm nicht heute erschlösse. Und nie war er enttäuscht, so oft er auch einsehen mußte, daß er noch nicht weiter als zum Vorhof des geheiligten Tempels gelangt sei.
So schwebte um diesen nervigen, gebräunten Freiluftmenschen etwas wie ein weihevolles Geheimnis. Seine Überzeugung, täglich am Vorabend einer niederschmetternd großen Enthüllung zu stehen, gab ihm eine verschlossene Überlegenheit. Seine Augen waren nicht träumerisch, sondern ruhig und hart. Die Gewohnheit, in Büchern zu lesen, in denen kein Wort von seinem Platze gerückt werden durfte, ohne den geheimen Sinn zu stören, das vorsichtige, achtungsvolle Abwägen eines jeden Satzes nach Sinn und Doppelsinn, hatte ihren Ausdruck geformt.
Nur mitunter verloren sich seine Gedanken in ein Dämmern von wohliger Melancholie. Das geschah, wenn er an den geheimen Kult dachte, der sich an die Originale der vor ihm liegenden Schriften knüpfte, an die Wunder, die von ihnen ausgegangen waren und Tausende ergriffen hatten, Tausende von Menschen, die ihm wegen der großen Entfernung, die ihn von ihnen trennte, nun wie Brüder erschienen, während er doch die Menschen seiner Umgebung, die er mit allen ihren Details sah, verachtete. In diesen Stunden wurde er mißmutig. Der Gedanke, daß sein Leben verurteilt sei, ferne von den Quellen der heiligen Kräfte zu verlaufen, seine Anstrengungen verurteilt, an der Ungunst der Verhältnisse vielleicht doch zu erlahmen, drückte ihn nieder. Wenn er aber dann eine Weile betrübt vor seinen Büchern gesessen war, wurde ihm eigentümlich zumute. Seine Melancholie verlor zwar nichts von ihrer Schwere, im Gegenteil, ihre Traurigkeit steigerte sich noch, aber sie drückte ihn nicht mehr. Er fühlte sich mehr denn je verlassen und auf verlornem Posten, aber in dieser Wehmut lag ein feines Vergnügen, ein Stolz, etwas Fremdes zu tun, einer unverstandenen Gottheit zu dienen. Und dann konnte wohl auch vorübergehend in seinen Augen etwas aufleuchten, das an den Aberwitz religiöser Ekstase gemahnte.
Beineberg hatte sich müde gesprochen. In ihm lebte das Bild seines wunderlichen Vaters in einer Art verzerrender Vergrößerung weiter. Jeder Zug war zwar bewahrt; aber das, was bei jenem ursprünglich vielleicht nur eine Laune gewesen war, die ihrer Exklusivität halber konserviert und gesteigert wurde, hatte sich in ihm zu einer phantastischen Hoffnung ausgewachsen. Jene Eigenheit seines Vaters, die für diesen im Grunde genommen vielleicht doch nur den gewissen letzten Schlupfwinkel der Individualität bedeutete, den sich jeder Mensch – und sei es auch nur durch die Wahl seiner Kleider – schaffen muß, um etwas zu haben, das ihn vor anderen auszeichne, war in ihm zu dem festen Glauben geworden, sich mittels ungewöhnlicher seelischer Kräfte eine Herrschaft sichern zu können.
Törleß kannte diese Gespräche zur Genüge. Sie gingen an ihm vorbei und berührten ihn kaum.
Er hatte sich jetzt halb vom Fenster abgewandt und beobachtete Beineberg, der sich eine Zigarette drehte. Und er fühlte wieder jenen merkwürdigen Widerwillen gegen diesen, der zuzeiten in ihm aufstieg. Diese schmalen dunklen Hände, die eben geschickt den Tabak in das Papier rollten, waren doch eigentlich schön. Magere Finger, ovale, schön gewölbte Nägel: es lag eine gewisse Vornehmheit in ihnen. Auch in den dunkelbraunen Augen. Auch in der gestreckten Magerkeit des ganzen Körpers lag eine solche. Freilich, – die Ohren standen mächtig ab, das Gesicht war klein und unregelmäßig, und der Gesamteindruck des Kopfes erinnerte an den einer Fledermaus. Dennoch – das fühlte Törleß, indem er die Einzelheiten gegeneinander abwog, ganz deutlich – waren es nicht die häßlichen, sondern gerade die vorzüglicheren derselben, die ihn so eigentümlich beunruhigten.
Die Magerkeit des Körpers – Beineberg selbst pflegte die stahlschlanken Beine homerischer Wettläufer als sein Vorbild zu preisen – wirkte auf ihn durchaus nicht in dieser Weise. Törleß hatte sich darüber bisher noch nicht Rechenschaft gegeben, und nun fiel ihm im Augenblicke kein befriedigender Vergleich ein. Er hätte Beineberg gern scharf ins Auge gefaßt, aber dann hätte es dieser gemerkt, und er hätte irgendein Gespräch beginnen müssen. Aber gerade so – da er ihn nur halb ansah und halb in der Phantasie das Bild ergänzte – fiel ihm der Unterschied auf. Wenn er sich die Kleider von dem Körper wegdachte, so war es ihm ganz unmöglich, die Vorstellung einer ruhigen Schlankheit festzuhalten, vielmehr traten ihm augenblicklich unruhige, sich windende Bewegungen vor das Auge, ein Verdrehen der Gliedmaßen und Verkrümmen der Wirbelsäule, wie man es in allen Darstellungen des Martyriums oder in den grotesken Schaubietungen der Jahrmarktsartisten finden kann.
Auch die Hände, die er ja gewiß ebensogut in dem Eindrucke irgendeiner formvollen Geste hätte festhalten können, dachte er nicht anders als in einer fingernden Beweglichkeit. Und gerade an ihnen, die doch eigentlich das Schönste an Beineberg waren, konzentrierte sich der größte Widerwille. Sie hatten etwas Unzüchtiges an sich. Das war wohl der richtige Vergleich. Und etwas Unzüchtiges lag auch in dem Eindrucke verrenkter Bewegungen, den der Körper machte. In den Händen schien es sich nur gewissermaßen anzusammeln und schien von ihnen wie das Vorgefühl einer Berührung auszustrahlen, das Törleß einen ekligen Schauer über die Haut jagte. Er war selbst über seinen Einfall verwundert und ein wenig erschrocken. Denn schon zum zweitenmal an diesem Tage geschah es, daß sich etwas Geschlechtliches unvermutet und ohne rechten Zusammenhang zwischen seine Gedanken drängte.
Beineberg hatte sich eine Zeitung genommen, und Törleß konnte ihn jetzt genau betrachten.
Da war tatsächlich kaum etwas zu finden, das dem plötzlichen Auftauchen einer solchen Ideenverknüpfung auch nur einigermaßen hätte zur Entschuldigung dienen können.
Und doch wurde das Mißbehagen aller Unbegründung zu Trotz immer lebhafter. Es waren noch keine zehn Minuten des Schweigens zwischen den beiden verstrichen, und dennoch fühlte Törleß seinen Widerwillen bereits auf das äußerste gesteigert. Eine Grundstimmung, Grundbeziehung zwischen ihm und Beineberg schien sich darin zum ersten Male zu äußern, ein immer schon lauernd dagewesenes Mißtrauen schien mit einem Male in das bewußte Empfinden aufgestiegen zu sein.
Die Situation zwischen den beiden spitzte sich immer mehr zu. Beleidigungen, für die er keine Worte wußte, drängten sich Törleß auf. Eine Art Scham, so als ob zwischen ihm und Beineberg wirklich etwas vorgefallen wäre, versetzte ihn in Unruhe. Seine Finger begannen unruhig auf der Tischplatte zu trommeln.
Endlich sah er, um diesen sonderbaren Zustand loszuwerden, wieder zum Fenster hinaus.
Beineberg blickte jetzt von der Zeitung auf; dann las er irgendeine Stelle vor, legte das Blatt weg und gähnte.
Mit dem Schweigen war auch der Zwang gebrochen, der auf Törleß gelastet hatte. Belanglose Worte rannen nun vollends über diesen Augenblick hinweg und verlöschten ihn. Es war ein plötzliches Aufhorchen gewesen, dem nun wieder die alte Gleichgültigkeit folgte …
«Wie lange haben wir noch Zeit?» fragte Törleß.
«Zweieinhalb Stunden.»
Dann zog er fröstelnd die Schultern hoch. Er fühlte wieder die lähmende Gewalt der Enge, der es entgegenging. Der Stundenplan, der tägliche Umgang mit den Freunden. Selbst jener Widerwille gegen Beineberg wird nicht mehr sein, der für einen Augenblick eine neue Situation geschaffen zu haben schien.
«… Was gibt es heute zum Abendessen?»
«Ich weiß nicht.»
«Was für Gegenstände haben wir morgen?»
«Mathematik.»
«Oh? Haben wir etwas auf?»