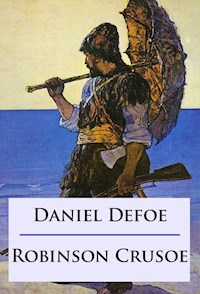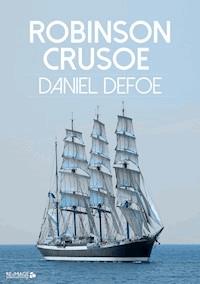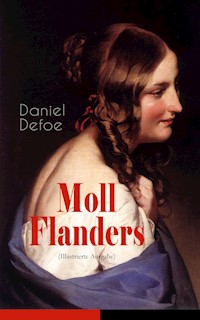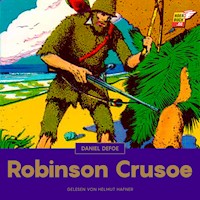
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: hoerbuch.cc
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Penguin Edition
- Sprache: Deutsch
Der Kultklassiker unter den Abenteuerromanen
Robinson Crusoe, eine der populärsten Gestalten der Weltliteratur, gilt seit unzähligen Generationen als Inbegriff des Abenteurers und Überlebenskünstlers. Das 1719 erschienene Buch über einen gestrandeten, ganz auf sich allein gestellten Menschen, der sich in der Wildnis aus dem Nichts eine neue Existenz erschaffen muss, hat sich längst als zeitlos erwiesen. Doch Daniel Defoes Roman ist viel mehr als eine gut geschriebene Abenteuergeschichte – sie wirft grundlegende Fragen nach dem Wesen unserer Spezies und unserer Zivilisation auf. An diesem Helden zeigt Defoe exemplarisch, welche grundlegenden Bewusstseinsveränderungen einer durchmachen muss, um sich zu einem echten Menschen auszubilden. Sein Robinson Crusoe reift vom gottlosen Seefahrer zum humanen Aufklärer, von einem ungestümen jungen Hitzkopf zu einem verantwortungsbewussten Charakter. Erst durch diese existenzielle Dimension gewinnt der Roman, der dem Autor sechzigjährig zu Weltruhm verhalf, seine wahre Tiefe und Bedeutung.
PENGUIN EDITION. Zeitlos, kultig, bunt. – Ausgezeichnet mit dem German Brand Award 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Große Emotionen, große Dramen, große Abenteuer – von Austen bis Fitzgerald, von Flaubert bis Zweig. Ein Bücherregal ohne Klassiker ist wie eine Welt ohne Farbe.
Daniel Defoe (1660–1731) wurde in London als Sohn eines Fleischers geboren und versuchte sich in mehreren Berufen. Ein heftiger Angriff auf die anglikanische Kirche brachte ihn an den Pranger, wo ihm das Volk jedoch begeistert zujubelte. Mit seinem auf einer Insel gestrandeten Romanhelden schuf er eine der populärsten Gestalten der Weltliteratur.
«Welch ein Erzähler! Welcher Reichtum an Erfindung! Welche Kenntnis des menschlichen Herzens! … Ein Erbauungsbuch mit den Mitteln des Schelmenromans; Kino zur Christenlehre!» Hermann Bahr
«Die innere Wandlung Robinson Crusoes vom gedanken- und gottlosen Seefahrer zum frommen Haushalter seiner Seele und humanen ‹Wildenbekehrer›, vom blind lebensgierigen jungen Trotzkopf zum reifen, seiner Verantwortung vor Gott bewussten Mann gibt der Erzählung erst die rechte Kraft.» Hans Reisiger
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
Daniel Defoe
Leben und wunderbare Abenteuer des
ROBINSON CRUSOE
Seemanns aus York
der 28 Jahre lang ganz einsam auf einer unbewohnten Insel an der Küste Amerikas nahe der Mündung des großen Stromes Orinoko lebte, wohin er als einziger Überlebender der ganzen Mannschaft durch Schiffbruch verschlagen war; nebst einem Bericht über seine ebenso wunderbare Befreiung durch Piraten. Beschrieben von ihm selbst.
Roman
Aus dem Englischen übersetzt und mit einem Nachwort von Hans Reisiger
Die Originalausgabe erschien 1719
unter dem Titel «The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner».
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe by Manesse Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Regg Media in Adaption der traditionellen Penguin Classics Triband-Optik aus England
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel GmbH
ISBN 978-3-641-28615-6V001
www.penguin-verlag.de
Ich wurde geboren im Jahre 1632 in der Stadt York von guter, zwar nicht landeingesessener Familie; mein Vater nämlich war ein Ausländer, aus Bremen gebürtig, und hatte sich zuerst in Hull niedergelassen. Nachdem er sich dort als Kaufmann ein ansehnliches Vermögen erworben, gab er sein Geschäft auf und übersiedelte nach York, von wo er meine Mutter gefreit hatte, deren Familie, mit Namen Robinson, dortzulande sehr wohlgeachtet war und nach der ich Robinson Kreutzner genannt wurde. Nach der üblichen Art der Engländer, die Worte zu verunstalten, nennt man uns und nennen und schreiben wir selbst uns jetzt Crusoe, und so nannten mich auch immer meine Kameraden.
Ich hatte zwei ältere Brüder, deren einer Oberstleutnant in einem englischen Regiment zu Fuß in Flandern war und in der Schlacht bei Dünkirchen gegen die Spanier fiel. Was aus meinem zweiten Bruder wurde, habe ich ebenso wenig je erfahren, wie meine Eltern erfuhren, was aus mir wurde.
Da man mich, als den dritten Sohn des Hauses, zu keinerlei Hantierung anhielt, begann sich mein Kopf schon sehr früh mit schweifenden Gedanken anzufüllen: mein Vater, der schon hochbejahrt war, hatte mich alles lernen lassen, was man eben durch häusliche Erziehung und in einer öffentlichen Schule lernen kann, und hatte im Sinn, einen Juristen aus mir zu machen; ich aber hatte nur den einzigen Wunsch, zur See zu gehen, und diese meine Begier trieb mich so hitzig gegen den Willen, ja gegen das Gebot meines Vaters und gegen alles Flehen und Zureden meiner Mutter und meiner Freunde an, dass es schien, als habe mich ein Dämon beim Wickel meiner eigenen Wünsche gefasst, um mich dem elendigen Leben zuzuschleppen, das mir bevorstand.
Mein Vater, ein kluger und gesetzter Mann, gab mir manchen ernsten, vortrefflichen Rat gegen mein von ihm wohlbemerktes Vorhaben. Er rief mich eines Morgens in sein Zimmer, an das ihn die Gicht fesselte, und stellte mich sehr warm über diesen Gegenstand zur Rede. Er fragte mich, was ich denn, außer bloßer Wanderlust, für Gründe hätte, mein Vaterhaus und Vaterland zu verlassen, wo mir die Zukunft offenstehe und die Aussicht winke, durch Arbeit und Fleiß in aller Behaglichkeit und Annehmlichkeit mein Glück zu machen. Er sagte, auf Abenteuer in die Fremde zu gehen, um durch Unternehmungen hochzukommen und sich berühmt zu machen, die vom gemeinen Wege abwichen, das sei etwas entweder für Stiefkinder oder für ungewöhnliche Günstlinge des Schicksals, für mich aber sei all das zu hoch oder zu gering; ich gehöre zum Mittelstände des Lebens, der seiner langen Erfahrung nach der beste Stand in der Welt sei, am zuträglichsten für das Glück eines Menschen, gesichert vor dem Elend, den Entbehrungen, Mühen und Leiden des handwerkenden Teiles der Menschheit und frei von dem Hochmut, der Üppigkeit, dem Ehrgeiz und Neid ihrer Höhen. Wie groß dieses Glück sei, könne ich, sagte er, daran erkennen, dass alle anderen Menschen diese Lebensart mit Neid betrachteten. Selbst Könige hätten schon oft darüber geklagt, wie viel Leiden es mit sich bringe, für große Dinge geboren zu sein, und hätten gewünscht, sie wären in der Mitte zwischen den beiden Extremen, zwischen hoch und niedrig, gestanden. Dass dies das wahre Glück sei, bezeuge auch der weise Salomon, wenn er zu Gott bete, ihm weder Armut noch Reichtum zu geben.
Wenn ich recht zusähe, würde ich immer finden, dass die Unglücksfälle des Lebens an den oberen und unteren Teil der Menschheit verteilt sind, dass aber der mittlere Stand am wenigsten zu leiden hat und nicht so vielen Übeln ausgesetzt ist wie der höhere oder niedere Teil der Menschheit; nein, nicht so vielen Unbehagen und Gebrechen des Leibes und der Seele unterworfen wie diejenigen, welche durch lasterhaftes Leben, Üppigkeit und Ausschweifungen auf der einen Seite oder durch harte Arbeit, Mangel am Notwendigen und schlechte oder ungenügende Ernährung auf der anderen Seite Krankheit und Ungemach über sich bringen, als natürliche Folge ihrer Lebensweise; ich würde finden, dass der Mittelstand des Lebens für Tugenden und Freuden aller Art geschaffen ist, dass Frieden und Genügen die Begleiter mittlerer Verhältnisse sind; dass Mäßigkeit, Ruhe, Gesundheit, Geselligkeit, alle angenehmen Zerstreuungen und alle wünschenswerten Vergnügungen die Segnungen sind, die der mittlere Lebensstand im Gefolge hat; dass auf diese Art die Menschen still und gemächlich durch die Welt und in Seelenruhe wieder aus ihr hinausgehen, nicht übermäßig geplagt von Hand- oder Kopfarbeit, nicht versklavt an die Fron ums tägliche Brot oder gehetzt von schwierigen Verhältnissen, die der Seele den Frieden und dem Körper die Ruhe rauben, noch besessen von der Leidenschaft des Neides oder heimlich brennendem Ehrgeiz nach großen Dingen; nein, in angenehmen Verhältnissen gleiten sie sowohl durch die Welt, genießen mit Verstand das Süße des Lebens ohne das Bittere, fühlen, dass sie glücklich sind, und lernen durch die Erfahrung jeden Tages immer besser, es zu sein.
Danach drang er ernstlich und aufs Liebevollste in mich, doch nicht den Naseweis zu spielen und mich nicht selber in Nöte zu stürzen, gegen die von Natur und durch die Lebensverhältnisse, in die ich geboren, vorgesorgt sei. Ich habe es nicht nötig, mir mein Brot zu suchen; er wolle für mich sorgen und mir zu der Lebensweise behilflich sein, die er mir soeben anempfohlen; und wenn ich nicht höchst glücklich und zufrieden würde in der Welt, so könne es nur mein Verhängnis oder meine eigene Schuld sein, die es verhindere; er habe seine Pflicht erfüllt und mich vor Schritten gewarnt, von denen er wisse, dass sie nur zum Unheil wären, und wasche seine Hände in Unschuld; kurz, er wolle mir alles Liebe antun, wenn ich seinem Rat folgte und daheim bliebe, hingegen keine Hand rühren, um mir im Unglück zu helfen, wenn ich in die Fremde zöge. Zum Schluss stellte er mir meinen älteren Bruder zum Exempel vor, dem er ebenso ernstlich vom Kriegshandwerk in den Niederlanden abgeraten, den aber trotz allem Zureden seine jugendliche Begier ins Feld getrieben habe, wo er getötet worden; und obwohl er nicht aufhören würde, für mich zu beten, so fürchte er doch, Gott werde mir keinen Segen geben, wenn ich diesen tollen Schritt täte, und ich würde dereinst Muße genug haben, über meinen Eigensinn nachzudenken, wenn niemand mehr da sein werde, mich zu retten.
Ich sah bei diesem Beschluss seiner Rede, die wahrhaft prophetisch war, obschon ich annehme, dass mein Vater selbst sich dessen nicht bewusst war, ich sah, sage ich, wie ihm die Tränen reichlich übers Gesicht liefen, zumal als er von meinem gefallenen Bruder sprach. Und als er darauf kam, dass ich Muße genug zur Reue, aber keinen Beistand haben würde, war er so bewegt, dass er seine Rede abbrach und zu mir sagte, sein Herz sei so voll, dass er nicht weiter zu mir sprechen könne.
Diese Rede ging mir aufrichtig ans Herz – wie hätte es auch anders sein können? –, und ich nahm mir vor, gar nicht mehr ans Reisen zu denken, sondern nach meines Vaters Wunsch im Nest zu bleiben. Aber, o weh, in ein paar Tagen war alles wieder verschwitzt, und ein paar Wochen später beschloss ich, um ferneren Ermahnungen meines Vaters aus dem Wege zu gehen, kurzerhand ihm davonzulaufen. Gleichwohl trieb ich’s hiermit nicht so hastig, wie mir’s die erste Hitze eingab, sondern nahm meine Mutter zu einer Stunde, wo sie mir milder schien als gewöhnlich, beiseite und sagte ihr, wie meine Gedanken so ganz und gar danach stünden, die Welt zu sehen, dass ich keine Ausdauer für irgendetwas anderes hätte und dass mein Vater daher besser täte, mir seine Einwilligung zu geben, als mich zu zwingen, ohne sie davonzugehen; dass ich jetzt achtzehn Jahre und somit zu alt sei für einen Handlungslehrling oder Advokatengehilfen, dass ich gewiss sei, meine Lehrzeit nicht auszuhalten, sondern meinem Meister noch vorher davonzulaufen und zur See zu gehen, und dass ich, wenn sie meinen Vater bestimmen wolle, mir nur eine einzige Reise in die Fremde zu vergönnen, nie wieder weggehen wolle und verspräche, durch verdoppelten Fleiß die vertane Zeit wieder einzuholen, falls mir dann die Reiselust vergangen sei.
Dies brachte meine Mutter in Aufregung; sie sagte, sie wüsste, dass es ganz nutzlos sei, mit meinem Vater über derlei zu reden; er wisse viel zu gut, was zu meinem Besten sei, als dass er zu etwas für mich so Unheilvollem seine Zustimmung geben würde, und sie verstehe gar nicht, wie ich an so etwas denken könne nach einer solchen Unterredung, wie ich sie mit ihm gehabt habe, und nach all dem Liebevollen und Zärtlichen, was er zu mir gesagt habe. Kurzum, wenn ich mich selber verderben wolle, so sei mir nicht zu helfen; aber ihre Einwilligung werde ich niemals haben, darauf könne ich mich verlassen; sie werde keinen Finger dazu rühren, und ich würde niemals sagen können, dass meine Mutter zu etwas Ja gesagt habe, was mein Vater nicht gewollt.
Trotz der Weigerung meiner Mutter, die Sache vor meinen Vater zu bringen, berichtete sie ihm dennoch, wie ich hernach erfuhr, meine ganze Unterredung mit ihr, und mein Vater sagte nach großer Erschütterung seufzend zu ihr: «Der Junge könnte glücklich werden, wenn er zu Hause bliebe; wenn er aber wegläuft, wird er das unglückseligste Menschenkind werden, das je geboren wurde. Ich kann dazu nicht Ja sagen.»
Es dauerte dennoch fast ein Jahr, ehe ich ausbrach, obwohl ich unterdessen für alles Zureden, ins Geschäft einzutreten, hartnäckig taub blieb und häufig mit meinem Vater und meiner Mutter darüber stritt, dass sie so ganz und gar gegen etwas waren, wozu es mich doch so hinzog. Als ich aber eines Tages in Hull war, übrigens derzeit ohne einen Gedanken ans Weglaufen, und einer meiner Kameraden, der mit seines Vaters Schiff nach London wollte, mir zuredete, mit ihnen zu fahren, indem er mir den üblichen Seemannsköder vorhielt, die Reise solle mich nicht einen Heller kosten – da fragte ich weder Vater noch Mutter mehr, schickte auch kein Wort einer Nachricht an sie, sondern überließ es dem Zufall, ob sie etwas davon erführen oder nicht, und ging, ohne um Gottes oder meines Vaters Segen zu bitten, blind gegen alle Umstände und Folgen, in einer Unglücksstunde, am 1. September 1651, an Bord eines nach London bestimmten Schiffes.
*
Niemals, glaube ich, hat eines jungen Wagehalses Unglück früher begonnen oder länger gewährt als das meine. Das Schiff war kaum aus dem Humber hinaus, als der Sturm zu blasen und die Wellen fürchterlich zu steigen begannen, und, da ich nie zuvor auf See gewesen, so war ich unsäglich krank am Leibe und geängstigt im Herzen: Ich fing nun an, ernstlich zu bedenken, was ich getan und wie gerecht mich nun die Strafe des Himmels treffe, weil ich so schändlich mein Vaterhaus verlassen und meine Pflicht aus den Augen gesetzt. Aller gute Rat meiner Eltern, meines Vaters Tränen und meiner Mutter Flehen kamen mir lebendig in den Sinn, und mein Gewissen, das damals noch nicht so verhärtet war wie später, warf mir die Verachtung guten Rates und die Verletzung meiner Pflicht gegen Gott und meinen Vater vor.
Mittlerweile wuchs der Sturm, und die See schwoll gewaltig an, obwohl nicht so, wie ich es hernach oft, ja sogar nur wenige Tage später, erlebte. Aber es war genug, um mich zu erschüttern, da ich ein Neuling war und nie dergleichen gesehen hatte. Bei jeder Welle dachte ich, sie würde uns verschlingen und das Schiff würde, jedes Mal wenn es in den Abgrund sank, nicht wieder emportauchen. Und in dieser Todesangst tat ich viele Gelübde, ich wolle, wenn es nur Gott gefiele, mein Leben aus dieser einen Fahrt zu erretten, und ich nur einmal wieder meinen Fuß aufs trockne Land setzen dürfe, unverweilt nach Hause zu meinem Vater eilen und nie wieder, solange ich lebte, ein Schiff betreten; ich wollte seinem Rate folgen und nie wieder so ins Unglück rennen. Jetzt sah ich ein, wie richtig alles war, was er über den Mittelstand des Lebens gesagt hatte; wie behaglich er all seiner Tage gelebt hatte und niemals Stürmen auf See oder Gefahren an der Küste ausgesetzt gewesen war, und ich beschloss, recht als ein reuiger verlorener Sohn, zu meinem Vater heimzukehren.
Diese weisen und vernünftigen Gedanken währten, solange der Sturm währte, und sogar noch etwas länger. Aber am nächsten Tage hatte sich der Wind gelegt, und die See war ruhiger, und ich begann mich ein wenig an sie zu gewöhnen. Dessen ungeachtet war ich den ganzen Tag über sehr ernst, zumal ich immer noch ein wenig seekrank war. Aber gegen Nacht klarte das Wetter auf, der Wind war vorbei, und ein wunderbar schöner Abend kam; die Sonne ging ganz klar unter und ging am nächsten Morgen ebenso auf; und da wir nur schwachen Wind hatten und glatte See, so dünkte mir das alles so lieblich, wie ich nichts zuvor geschaut.
Ich hatte in der Nacht gut geschlafen und war nun nicht mehr seekrank, sondern sehr vergnügt und besah mir verwundert das Meer, das tags zuvor so wild und schrecklich gewesen war und nun so kurze Zeit danach so still und heiter sich zeigte. Und damit mein guter Vorsatz ja nicht etwa von Dauer wäre, kommt nun mein Kamerad, der mich auf die Fahrt gelockt hatte, zu mir, und: «Nun, Bob», spricht er, mich auf die Schultern schlagend, «wie geht dir’s jetzt? Ich wette, du hattest das Herz in den Hosen gestern Nacht wegen der Mütze voll Wind!» – «Mütze voll Wind?», sagte ich. «Es war ein schrecklicher Sturm.» – «Ein Sturm, du Tropf?», erwiderte er. «Nennst du das einen Sturm? Ein Quark war das! Gib uns bloß ein gutes Schiff und raume See, und wir pfeifen auf so ein Lüftchen. Du Landratte! Komm, wir machen uns eine Bowle Punsch und ersäufen den Schreck. Siehst du, was für prachtvolles Wetter jetzt ist?» Um dieses trübe Stück meiner Geschichte kurz zu machen: Wir steuerten den alten Seemannskurs, der Punsch wurde gebraut und ich damit betrunken gemacht, und in dieser verruchten einzigen Nacht ersäufte ich alle meine Reue, alle meine Gedanken über mein voriges Betragen, alle meine Vorsätze für die Zukunft. Mit einem Wort: Wie mit dem Nachlassen des Sturmes die See wieder glatt und still wurde, so vergaß ich, als die Aufregung vorbei und meine Angst, von der See verschlungen zu werden, verflogen war, alle die Versprechungen und Gelübde, die ich in meiner Not getan hatte, völlig und überließ mich wieder ganz meinen früheren Wünschen. Zwar kam mir hernach noch ab und zu die Besinnung, und die ernsthaften Gedanken meldeten sich wieder hie und da; aber ich schüttelte sie ab und wehrte mich dagegen wie gegen die Pest, hielt mich ans Saufen und an lustige Kumpanei und meisterte so diese Rückfälle (wie ich sie nannte) bald, sodass ich in wenigen Tagen einen so vollkommenen Sieg über mein Gewissen errungen hatte, wie nur irgendein junger Mensch, den es zwickt, sich wünschen mag. Aber es stand mir noch eine andere Prüfung bevor, und die Vorsehung hatte, wie gewöhnlich in solchen Fällen, beschlossen, mir gar keine Entschuldigung zu lassen. Denn da das eben Erlebte mich noch nicht zu wandeln vermocht hatte, sollte das mir Bevorstehende der Art sein, dass auch der ärgste und verhärtetste Bösewicht sowohl die Größe der Gefahr als auch der göttlichen Gnade an sich erkennen musste.
Am sechsten Tage unserer Fahrt kamen wir auf der Reede vor Yarmouth an. Da wir Gegenwind und stilles Wetter hatten, waren wir seit dem Sturm nur wenig vorwärtsgekommen. Hier mussten wir vor Anker gehen, und hier lagen wir nun, weil der Wind immer noch uns entgegen, will sagen aus Südwest, stand, sieben oder acht Tage lang. Mittlerweile kamen noch viele andere Schiffe von Newcastle her auf dieselbe Reede, in der die Schiffe gewöhnlich auf guten Wind stromaufwärts warteten.
Wir hätten jedoch nicht so lange gelegen, sondern wären mit der Flut stromaufwärts gerückt, wenn nicht der Wind sehr stark und nach vier oder fünf Tagen noch viel stärker geblasen hätte. Da indessen diese Reede für so gut gilt wie ein Hafen und der Ankergrund vortrefflich und unser Ankergeschirr sehr stark war, so versahen sich unsere Leute nicht der geringsten Gefahr, sondern verbrachten ihre Zeit nach Seemannsweise mit Schlafen und Lustbarkeit. Aber am achten Tage morgens wurde der Wind noch stärker, und wir hatten alle Hände voll zu tun, um unsere Marsstengen niederzuholen und alles dicht- und festzumachen, damit das Schiff so ruhig wie möglich vor Anker läge. Um Mittag stieg die See sehr hoch, unser Schiff tauchte vornüber, etliche Seen schlugen über das Deck, und wir dachten ein- oder zweimal, unser Anker sei losgerissen; worauf unser Kapitän den Notanker ausbringen ließ, sodass wir nun vor zwei Ankern voraus lagen. Auch wurden die Ankertaue länger hinausgelassen.
Der Sturm raste nunmehr in Wahrheit mit furchtbarer Gewalt, und ich begann Schrecken und Bestürzung in den Gesichtern unserer Leute selber zu gewahren. Den Kapitän, so wachsam er auch auf dem Posten war, das Schiff zu sichern, hörte ich doch, als er neben mir zu seiner Kabine aus und ein ging, mehrere Male leise zu sich selber sagen: «Herr, sei uns gnädig, wir sind alle verloren, wir sind alle hin», und dergleichen. Während dieses ersten Tumults lag ich dumpf und stumpf in meiner Kabine im Zwischendeck und kann nicht beschreiben, wie mir war: Ich konnte nicht wohl wieder, wie beim ersten Mal, es mit der Reue halten, die ich so sichtlich mit Füßen getreten und gegen die ich mich verhärtet hatte; ich meinte, die Bitternis des Todes sei vorüber und es würde dieses Mal nicht so schlimm werden. Als aber, wie eben beschrieben, der Kapitän selber an mir vorbeikam und sagte, wir seien alle verloren, erschrak ich entsetzlich: Ich sprang auf, aus meiner Kabine hinaus und schaute mich um; aber so etwas Schauerliches hatte ich nie gesehen! Die See ging haushoch und brach alle drei oder vier Minuten über uns herab. Bekam ich den Blick frei, so konnte ich ringsumher nichts als Jammer und Not sehen: Zwei unweit von uns verankerte Schiffe hatten, weil sie zu schwer beladen waren, ihre Masten über Bord gekappt, und unsere Leute schrien, ein Schiff, das etwa eine Meile uns voraus vor Anker gelegen, sei gesunken. Zwei andere Schiffe waren von den Ankern losgerissen worden und aus der Reede auf gut Glück in die offene See gejagt, und zwar ohne einen einzigen stehenden Mast. Die leichten Schiffe hatten es am besten, weil sie nicht so stark schlingerten; aber zwei oder drei von ihnen trieben doch los und jagten, dicht an uns vorbei, nur ihr Sprietsegel vor dem Wind, ins offne Meer hinaus.
Gegen Abend baten der Steuermann und der Hochbootsmann unseren Kapitän, den Fockmast kappen zu lassen, was er gar nicht zugeben wollte. Als aber der Hochbootsmann schwur, wenn er es nicht täte, würde das Schiff sinken, ließ er’s geschehen. Und als sie den Fockmast abgehauen, stand der Großmast so lose und erschütterte das Schiff so, dass sie ihn auch abhauen und klar Deck machen mussten.
Jeder kann sich denken, in was für einen Zustand ich bei alledem war, ich, der Neuling, der zuvor schon bei viel geringerem Anlass solche Angst ausgestanden hatte. Doch wenn ich jetzt, nach so langer Zeit, meinen damaligen Gemütszustand noch wiederzugeben vermag, darf ich sagen, mein Entsetzen darüber, dass ich meinen guten Vorsätzen untreu geworden und zu meinem gottlosen ersten Entschluss zurückgekehrt war, war zehnmal größer als meine Angst vor dem Tode selbst; und dies, zusammen mit dem grausigen Sturm, brachte mich in einen Zustand, den ich mit keinen Worten zu beschreiben vermag. Aber das Schlimmste war noch gar nicht da. Der Sturm hielt mit solcher Wut an, dass die Seeleute selber gestanden, einen ärgeren hätten sie nie gesehen. Unser Schiff war gut, aber tief geladen und schlingerte dermaßen, dass die Leute etliche Mal schrien, es würde sich leck arbeiten. Es war gut, dass ich nicht wusste, was «leck arbeiten» bedeutete. Jedoch sah ich, indes der Sturm weiterraste, etwas, was man nicht oft zu sehen bekommt: nämlich den Kapitän, den Hochbootsmann und einige andere Verständigere im Gebet knien, jeden Augenblick gewärtig, dass das Schiff in die Tiefe sänke.
Mitten in der Nacht schrie zu all unserer anderen Not ein Mann, der hinuntergestiegen war, um nachzuschauen, dass wir ein Leck hätten; ein anderer schrie dazu, vier Fuß Wasser stünden im Raum. Alle Mann wurden an die Pumpe gerufen. Bei diesem Wort erstarb mir das Herz im Leibe, und ich fiel rücklings von meinem Bett, worauf ich saß, in die Kabine hinein. Die Leute rüttelten mich jedoch auf und riefen, ich hätte vorher zu nichts getaugt und könne jetzt pumpen so gut wie die andern; worauf ich mich aufraffte, zur Pumpe stolperte und aus Leibeskräften pumpte. Während dieser Arbeit sichtete der Kapitän ein paar leichte Kohlenschiffe, die losgetrieben waren und in See liefen und an uns vorbeikommen mussten, und befahl, einen Schuss als Notsignal zu feuern. Da ich nicht wusste, was das bedeuten solle, war ich so bestürzt, dass ich meinte, das Schiff sei geborsten oder sonst etwas Fürchterliches geschehen. Mit einem Wort: Ich sank ohnmächtig nieder. Da in diesem Augenblick jeder nur an sein eigenes Leben dachte, so kümmerte sich niemand um mich und mein Geschick, sondern ein anderer trat an die Pumpe, stieß mich mit dem Fuß beiseite und ließ mich für tot liegen, und es dauerte geraume Zeit, bis ich wieder zu mir kam.
Wir pumpten weiter, aber das Wasser stieg im Raume, und es war offenbar, dass das Schiff sinken würde. Der Kapitän fuhr daher fort, Notschüsse zu feuern, und ein leichtes Schiff, das just vor uns den Sturm, der allmählich abzuflauen begann, heil überstanden hatte, wagte es, uns ein Boot zu Hilfe zu schicken. Mit knapper Not kam das Boot an uns heran; aber es war uns nicht möglich, an Bord zu kommen, da das Boot nicht längsseit zu gehen vermochte, bis endlich unsere Leute der Bootsbesatzung, die aus Leibeskräften und mit Lebensgefahr ruderte, ein Tau mit einer Boje zuwarfen, das sie so lang schießen ließen, bis jene es nach großer Arbeit und Gefahr endlich ergriffen. Wir holten sie bis dicht unter das Heck des Schiffes auf und stiegen alle in das Boot.
Wir konnten nicht daran denken, ihr eigenes Schiff zu erreichen, so wurden wir alle einig, das Boot treiben zu lassen und nur so viel als möglich auf das Ufer hinzusteuern, und unser Kapitän versprach ihnen, wenn das Boot an dem Strand zerschellte, wolle er es ihnen bezahlen. So fuhren wir, teils rudernd, teils treibend, nordwärts der Küste zu, fast bis Winterton-Ness.
Wir waren kaum eine Viertelstunde von unserem Schiff weg, so sahen wir es sinken. Ich gestehe, ich konnte kaum die Augen dahin wenden, als die Matrosen mir sagten, das Schiff gehe unter; denn seit dem Augenblick, wo sie mich in das Boot geschleppt hatten, war mein Herz in mir wie tot, teils vor überstandenem Schreck, teils vor Entsetzen, was mir noch bevorstünde.
Während so das Bootsvolk an den Rudern sich mühte, uns an die Küste zu bringen, konnten wir, wenn unser Boot oben auf den Wellen saß, eine große Menge Volks an der Küste entlang laufen sehen, um uns beizustehen, wenn wir näher kämen. Aber das ging nur sehr langsam vonstatten; wir konnten das Ufer erst erreichen, als wir an dem Leuchtturm von Winterton-Ness vorbei waren, wo die Küste westwärts gegen Cromer zurücktritt, sodass das hohe Land die Heftigkeit des Windes etwas abschwächte. Hier ruderten wir hinein und gelangten alle, wenn auch nur unter großen Schwierigkeiten, heil an Land. Wir wanderten dann zu Fuß nach Yarmouth, wo wir als Schiffbrüchige mit großer Menschenfreundlichkeit aufgenommen wurden, sowohl von den Behörden der Stadt, die uns gute Quartiere zuwiesen, als auch von privaten Kaufleuten und Schiffseigentümern, und wo uns so viel Geld gegeben wurde, dass wir nach Belieben entweder nach London oder zurück nach Hull gelangen konnten.
Hätte ich nun so viel Verstand gehabt, nach Hull zurück und von da nach Hause zu gehen, so wär mir’s zum Glück gewesen, und mein Vater hätte, nach dem Gleichnis unseres Heilandes, wohl auch das gemästete Kalb für mich geschlachtet; denn anfangs hatte sich das Gerücht verbreitet, das Schiff, auf dem ich von Hull abgefahren, sei auf der Reede von Yarmouth gesunken, sodass es lange Zeit dauerte, bis er die Gewissheit erhielt, dass ich nicht ertrunken sei.
Aber mein Unstern trieb mich jetzt mit unwiderstehlicher Hartnäckigkeit weiter, und obwohl meine Vernunft und mein ruhigeres Urteil mir zu wiederholten Malen laut zuriefen, nach Hause zu gehen, hatte ich doch nicht die Kraft, es zu tun. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, und will auch nicht eben behaupten, ein geheimer, übermächtiger Ratschluss treibe uns an, Werkzeuge unseres eignen Verderbens zu werden und mit offenen Augen hineinzulaufen. Jedenfalls tat ich so gegen die ruhige Überlegung meiner innersten Gedanken und den offensichtlichen beiden Lehren zum Trotz, die mir bei meinem ersten Versuch erteilt worden waren.
Mein Kamerad, der zuvor zu meiner Verstockung mitgeholfen und der der Sohn meines Kapitäns war, war jetzt noch weniger obenauf als ich. Als er mich in Yarmouth, wo wir in verschiedenen Quartieren lagen, zum ersten Mal nach zwei oder drei Tagen traf, kam mir sein Ton verändert vor. Er sah recht niedergeschlagen aus und fragte mich kopfschüttelnd, wie es mir ginge. Und sein Vater, dem er erzählte, wer ich sei und dass ich diese Fahrt nur zur Probe mitgemacht habe, wandte sich mit sehr ernstem und bekümmertem Ton zu mir und sagte: «Junger Mann, Ihr solltet nie wieder zur See gehn, Ihr solltet das als ein deutliches und sichtbares Zeichen nehmen, dass Ihr nicht zum Seefahrer bestimmt seid.» – «Warum, Herr?», sagte ich. «Wollt Ihr denn auch nicht mehr zur See gehen?» – «Das ist etwas anderes», sagte er, «es ist mein Beruf und also meine Pflicht. Da Ihr aber diese Reise nur zur Probe gemacht habt, so seht Ihr, was für einen Vorgeschmack der Himmel Euch gegeben hat von dem, was Ihr noch zu erwarten habt, wenn Ihr darauf besteht. Vielleicht seid Ihr die Ursache zu unserem ganzen Unglück wie Jona auf dem Schiff nach Tharsis. Sagt», fuhr er fort, «wer seid Ihr, und weshalb seid Ihr zur See gegangen?» Hierauf erzählte ich ihm meine Geschichte. Als ich fertig war, brach er in wunderliche Verwünschungen aus. «Was habe ich getan», schrie er, «dass ein so verfluchter Bösewicht auf mein Schiff gekommen ist? Nicht für 1000 Pfund würde ich meinen Fuß wieder auf dasselbe Schiff mit Euch setzen.» Dies war, wie gesagt, nur ein Ausbruch seines Gemütes, das noch durch den Kummer über seinen Verlust bewegt war, und ging weit über seine Befugnisse mir gegenüber hinaus. Späterhin redete er jedoch wiederum sehr ernst mit mir, ermahnte mich, zu meinem Vater heimzukehren und die Vorsehung nicht zu meinem Unheil zu versuchen; ich möge die sichtbare Hand des Himmels gegen mich erkennen – «und, junger Mann», sagte er, «glaubt mir, wenn Ihr nicht heimkehrt, so wird Euch, wohin Ihr auch geht, nichts als Unheil und Enttäuschung treffen, bis Eures Vaters Worte an Euch erfüllt sind».
Wir gingen bald darauf auseinander; denn ich gab ihm nur wenig zur Antwort und sah ihn nicht wieder; wohin er ging, weiß ich nicht. Was mich angeht, so reiste ich, da ich etliches Geld im Sack hatte, über Land nach London. Dort und unterwegs hatte ich noch manchen Kampf mit mir selber, welchen Lebensweg ich einschlagen solle, nach Hause oder auf die See. Gegen das Nachhausegehen sperrte sich die Scham, und es stand mir gleich vor Augen, wie die Nachbarn über mich lachen würden und wie demütigend es sein würde, meinen Vater, meine Mutter, ja überhaupt irgendjemand wiederzusehen; wie ich denn seitdem oft beobachtet habe, wie ungereimt und unvernünftig die Menschen, besonders die jungen, sich in solchen Fällen verhalten, wo doch die Vernunft sie leiten sollte: nämlich dass sie sich nicht schämen zu sündigen und dennoch sich schämen zu bereuen; dass sie sich der Tat nicht schämen, um deretwillen sie mit Recht für Toren gehalten werden, wohl aber der Umkehr, die ihnen doch allein dazu verhelfen könnte, wieder als verständige Leute zu gelten.
In diesem Zustand verharrte ich indessen einige Zeit und wusste nicht recht, was ich anfangen und welchen Lebensweg ich einschlagen sollte. Ich hatte noch immer einen unüberwindlichen Widerwillen dagegen, nach Hause zurückzukehren, und nachdem ich eine Weile in London gesessen hatte, verblasste die Erinnerung an die ausgestandene Not, und die an sich schon geringe Lust zur Heimkehr verging mir immer mehr, bis ich schließlich jeden Gedanken daran zum Teufel jagte und mich nach einer Seereise umsah.
Der böse Geist, der mich zuerst aus meinem Vaterhause wegtrieb, der mir den ungebärdigen und unreifen Gedanken eingab, in der weiten Welt mein Glück zu machen, und der mir diesen Wahn so aufdrängte, dass er mich taub machte für allen guten Rat und für das Flehen und sogar für den Befehl meines Vaters – dieser selbe böse Geist, sage ich, verlockte mich auch zu der unseligsten aller meiner Unternehmungen, und so ging ich an Bord eines nach der afrikanischen Küste bestimmten Schiffes oder, wie unsere Seeleute es gemeinhin nennen, eines Guineafahrers.
Es war mein großes Missgeschick bei all diesen Abenteuern, dass ich mich nicht als Matrose anheuern ließ; auf diese Art hätte ich zwar etwas härter als sonst arbeiten müssen, aber zugleich hätte ich doch die Pflichten und den Dienst eines Seemanns erlernt und mich vielleicht mit der Zeit zum Maat oder Steuermann oder gar Schiffskapitän emporgearbeitet. Aber wie es allezeit mein Schicksal war, mich für das Falsche zu entscheiden, so auch hier; denn da ich Geld im Sack und gute Kleider am Leibe hatte, ging ich immer nur als feiner Herr an Bord, sodass ich nichts zu tun hatte und auch nichts lernte. Zu meinem Glück geriet ich in London in treffliche Gesellschaft, was bei so jungem Blut, das führerlos in der Welt umherschweift, nicht immer der Fall ist, da für gewöhnlich der Teufel hurtig ist, ihm seine Fußangeln zu stellen. Bei mir aber ging es anders; ich machte sogleich die Bekanntschaft eines Kapitäns, der mit seinem Schiff von Guinea kam und nun, da es ihm dort wohl geglückt war, im Begriff stand, zum zweiten Male hinzufahren. Da er an meinem Umgang, der zu jener Zeit nicht unergötzlich war, Gefallen fand und hörte, der Sinn stände mir in die weite Welt, so eröffnete er mir, wenn ich mit ihm gehen wolle, so solle mich die Reise nichts kosten; ich solle sein Messegast und Begleiter sein, und wenn ich etwas an Waren mitnehmen wolle, so könnte ich für meine eigene Tasche damit Handel treiben, und es würde mir vielleicht glücken.
Ich griff zu, schloss enge Freundschaft mit diesem Kapitän, der ein ehrlicher, aufrichtiger Mann war, und trat die Reise mit ihm an. Ich nahm ein kleines Kapitälchen in Waren mit, das ich durch die uneigennützige Redlichkeit meines Freundes sehr beträchtlich vermehrte, nämlich etwa 40 Pfund Sterling in allerhand Tand und Kram nach seinem Geheiß. Diese Summe hatte ich mithilfe einiger Verwandter zusammengebracht, denen ich schrieb und die, wie ich glaube, meinen Vater oder wenigstens meine Mutter beredeten, mir so viel zu meiner ersten Unternehmung zu bewilligen.
Dies war von allen meinen Reisen die einzige, die ich glücklich nennen mag. Das habe ich der Treue und der Ehrlichkeit meines Freundes, des Kapitäns, zu verdanken, unter dem ich mir auch eine ziemliche Kenntnis der Mathematik und der Schifffahrtskunde erwarb und lernte, wie man den Kurs des Schiffes bestimmt, wie man eine Observation macht, kurz, all das, was ein Seemann braucht; denn da es ihm Freude machte, zu lehren, so machte es mir auch Freude, zu lernen. Mit einem Wort: Diese Reise machte mich zu einem Seemann und Kaufmann zugleich; denn ich brachte fünf Pfund und neun Unzen Gold für mein Teil nach Hause, die mir in London fast 300 Pfund Sterling einbrachten. Aber ebendies füllte mir auch den Kopf mit den hochfliegenden Gedanken, die mich dann so tief ins Elend brachten.
Doch auch auf dieser Reise hatte ich mein Teil Not auszustehen, besonders dadurch, dass ich beständig krank war, da mich die unmäßige Hitze des Klimas in ein heftiges Fieber warf; denn dieser Handel spielte sich vornehmlich an der Küste von 15 Grad nördlicher Breite bis zur Linie ab.
*
Ich war nun ein gemachter Guineafahrer, und da mein Freund zu meinem großen Unglück bald nach seiner Heimkehr starb, entschloss ich mich, dieselbe Reise noch einmal zu machen, und schiffte mich auf demselben Fahrzeug ein mit einem, der auf der vorigen Reise sein Maat gewesen war und nun den Befehl über das Schiff hatte. Dies war die unseligste Reise, die je ein Mensch getan; denn obgleich ich von meinem neu erworbenen Reichtum nur etwa 100 Pfund Sterling mitnahm, 200 aber bei meines Freundes Witwe, die es ehrlich mit mir meinte, stehen ließ, so geriet ich doch auf dieser Fahrt in das schrecklichste Unglück. Es fing so an:
Während unser Schiff den Kurs auf die Kanarischen Inseln zuhielt oder vielmehr zwischen diese Inseln und die afrikanische Küste, wurde es im Morgengrauen von einem türkischen Piraten aus Salee überrascht, der mit vollen Segeln Jagd auf uns machte. Auch wir spannten jeden Fetzen Leinwand aus, soviel unsere Rahen und Masten nur tragen konnten, um klarzukommen; da wir aber erkannten, dass der Pirat uns den Rang ablaufen und uns in wenigen Stunden einholen würde, rüsteten wir uns zum Kampfe. Unser Schiff führte zwölf, der türkische Hund jedoch achtzehn Stücke.
Gegen drei Uhr nachmittags war er uns auf dem Halse, und da er aus Versehen, anstatt quer an unserm Heck, gerade an unserm Halbdeck vorbeilief, richteten wir acht unserer Geschütze dorthin und gaben ihm eine volle Breitseite, die ihn veranlasste beizudrehen, nachdem er unser Feuer erwidert und uns überdies mit einer Musketensalve aus zweihundert Rohren überzogen hatte. Dennoch wurde kein Mann von uns getroffen, da wir uns alle in Deckung hielten. Er schickte sich zu einem neuen Angriff an und wir uns zur Abwehr; diesmal aber legte er sich uns auf der anderen Seite an Bord, und sechzig Mann enterten unsere Decks und begannen sogleich auf sie und das Tauwerk einzuhauen. Wir bewillkommneten sie zwar mit Musketen, Picken, Pulverkisten und dergleichen und jagten sie zweimal vom Deck hinunter. Allein, um dieses traurige Stück unserer Geschichte kurz zu machen, als unser Schiff verstümmelt und drei der Unsrigen getötet, acht verwundet waren, mussten wir uns ergeben und wurden alle als Gefangene nach Salee, einem Hafen der Mauren, geschleppt.
Die Behandlung, die ich dort erfuhr, war nicht so schlimm, wie ich anfangs befürchtet, auch wurde ich nicht ins Land hinein an des Kaisers Hof gebracht wie die andern, sondern von dem Piratenkapitän als seine eigene Beute zurückbehalten und zu seinem Sklaven gemacht, weil ich jung und flink und für seine Zwecke geschickt war. Ich war durch diese jähe Verwandlung von einem Kaufmann in einen elenden Sklaven ganz überwältigt und gedachte jetzt der prophetischen Rede meines Vaters, und dass die Hand Gottes nun auf mir liege und es ohne Gnade um mich geschehen sei. Aber das alles sollte nur ein Vorgeschmack des Jammers sein, den ich noch zu erleiden hatte, wie aus meiner Geschichte erhellen wird. Da mich mein neuer Patron und Herr in sein Haus genommen hatte, hoffte ich, er würde mich auch mitnehmen, wenn er wieder in See ginge, wo ihn über kurz oder lang das Schicksal ereilen würde, von einem Spanier oder Portugiesen aufgegriffen zu werden, wobei ich dann befreit werden würde. Aber diese Hoffnung wurde bald zu Wasser; denn wenn er ausfuhr, ließ er mich an Land zurück, um seinen kleinen Garten zu betreuen und die üblichen Sklavendienste im Hause zu verrichten; und wenn er von seinem Kreuzer heimkam, musste ich in der Kajüte schlafen, um das Schiff zu hüten.
Hier brütete ich unablässig über meine Flucht und wie ich sie am besten bewerkstelligen könnte, fand aber nicht die geringste Möglichkeit dazu. Denn ich hatte keine lebendige Seele, der ich davon reden konnte und die mit mir sich aufs Meer hinaus gewagt hätte; da war kein Mitsklave, kein Engländer, Irländer noch Schotte, nur ich ganz allein, sodass ich zwei Jahre lang mich zwar oft an der Einbildung ergötzte, aber nicht den geringsten Weg sah, um ihn zu verwirklichen.
Nach zwei Jahren ereignete sich jedoch etwas Besonderes. Mein Patron lag schon seit längerer Zeit als sonst zu Hause, ohne sein Schiff instand zu setzen, weil, wie ich hörte, sein Geldbeutel knapp war, und fuhr derweil regelmäßig ein- oder zweimal in der Woche, wenn schönes Wetter war, mit der Schiffspinasse auf den Fischfang. Dabei nahm er stets mich und einen Jungen, den sie den Mowesko nannten, mit zum Rudern. Wir brachten ihn dabei immer in sehr vergnügte Laune, und ich zeigte mich sehr geschickt beim Fischen, sodass er mich manchmal auch mit einem Mauren, einem Verwandten von ihm, und dem jungen Mowesko ausschickte, ihm ein Gericht Fische zu holen.
Einmal geschah es, als wir an einem ganz stillen Morgen ausfuhren, dass wir in so dicken Nebel kamen, dass wir die Küste aus den Augen verloren, obwohl wir nur eine halbe Stunde weit davon entfernt waren. Wir ruderten aufs Geratewohl den ganzen Tag und auch die Nacht und fanden am Morgen, dass wir seewärts anstatt auf die Küste zu gefahren waren. Wir kamen jedoch wieder glücklich an Land, wenn auch mit großer Mühe und einiger Gefahr, da der Wind am Morgen recht kräftig zu wehen begann; besonders knurrte uns allen der Magen gewaltig.
Durch dieses Missgeschick gewarnt, beschloss unser Patron, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Und da er noch das Langboot von unserm gekaperten Schiff liegen hatte, nahm er sich vor, nicht wieder ohne einen Kompass und einigen Mund Vorrat zum Fischen zu fahren. Er befahl daher seinem Schiffszimmermann, der auch ein englischer Sklave war, einen kleinen Wohnraum oder Kajüte mitten in das Langboot einzubauen, wie auf einer Barke, mit Raum dahinter, um zu steuern und die Großschote einzuholen, und Raum davor für ein oder zwei Mann, um die Segel zu bedienen. Das Boot führte ein Gigsegel oder, wie wir es nennen, Hammelschultersegel, und der Klüverbaum lief über die Kajüte hin. Diese war sehr klein und niedrig und bot nur Raum für ihn und ein oder zwei Sklaven zum Schlafen und für einen Tisch zum Essen sowie für etliche kleine Schränke, um ein paar Flaschen Branntwein sowie Brot, Reis und Kaffee zu verstauen.
Mit diesem Boot fuhren wir häufig zum Fischen aus. Einmal hatte er sich vorgenommen, mit zwei oder drei vornehmen Mauren des Ortes zum Vergnügen oder zum Fischfang auszufahren, und hatte außergewöhnliche Anstalten dazu getroffen. Er hatte über Nacht einen größeren Vorrat an Lebensmitteln als sonst an Bord geschickt und mir befohlen, drei Flinten mit Pulver und Blei bereitzuhalten, um sich auch mit Vogelschießen zu ergötzen.
Ich richtete alles her, so wie er es befohlen hatte, und wartete am nächsten Morgen mit dem sauber gewaschenen Boot, Flagge und Wimpel gehisst. Nach einiger Zeit kam jedoch mein Patron allein an Bord, sagte mir, seine Gäste hätten Geschäfte halber abgesagt, und befahl mir, mit dem maurischen Jungen und einem anderen Mauren allein auszufahren und ein paar Fische zu fangen, da seine Freunde bei ihm zu Hause zu Abend speisen würden.
In diesem Augenblick schossen mir meine alten Freiheitsgedanken wieder durch den Kopf; denn nun sah ich, dass ich Aussicht hätte, ein kleines Schiff in meine Gewalt zu bekommen, und als mein Herr fort war, begann ich mich nicht zum Fischen, sondern zu einer Seereise zu rüsten, obwohl ich nicht wusste und überhaupt nicht daran dachte, wohin ich steuern sollte. Nur weg von hier wollte ich, gleichviel wohin.
Meine erste Sorge war, wie ich dem Mauren auf gute Art befehlen könnte, noch mehr Proviant an Bord zu schaffen. Ich sagte ihm also, es schicke sich nicht, dass wir unserm Patron das Brot wegäßen; ja freilich, sagte er und holte einen großen Korb Zwieback und drei Krüge Süßwasser. Ich wusste, wo die Flaschenkiste meines Patrons stand, die unverkennbar auch von einer englischen Prise stammte, und brachte sie ins Boot, während der Maure an Land war. Ich verstaute auch einen großen Klumpen Bienenwachs, über fünfzig Pfund schwer, nebst einem Knäuel Bindfaden und Zwirn, einem Beil, Säge und Hammer, die mir hernach alle sehr nützlich waren, zumal das Wachs für Kerzen. Ich drehte ihm noch eine Nase, und er ließ sich wiederum übertölpeln. Er hieß Ismael, mit Rufnamen Muley oder Moly; so rief ich: «Moly, wir haben die Flinten unseres Herrn im Boot, könntest du nicht etwas Pulver und Schrot holen? Vielleicht können wir auf eigene Faust ein paar Alken (eine Art großer Seevögel) schießen!» – «Ja», sagte er, «ich will es holen.» Und wirklich brachte er einen großen Lederbeutel, der etwa anderthalb Pfund Pulver oder mehr enthielt, sowie einen zweiten, fünf bis sechs Pfund schweren, mit Schrot und einigen Kugeln, und verstaute beide in das Boot.
So segelten wir, mit allem Nötigen versehen, zum Fischen aus dem Hafen hinaus. Das Kastell am Hafeneingang kannte uns und kümmerte sich nicht um uns. Als wir eine knappe englische Meile von dem Hafen weg waren, holten wir die Segel ein und machten uns ans Fischen. Der Wind blies von Nordnordost, also meinem Wunsche entgegen: Denn hätte er von Süden gestanden, so hätte ich mir zugetraut, die spanische Küste oder zum wenigsten die Bai von Cadiz zu erreichen; mein Entschluss aber stand fest, von diesem grässlichen Ort, wehe der Wind aus welchem Loch er wolle, zu fliehen und alles andere dem Schicksal zu überlassen.
Als wir eine Weile gefischt und nichts gefangen hatten – denn wenn ich etwas an der Angel hatte, zog ich nicht hoch, damit er’s nicht sähe –, sagte ich zu dem Mauren: «So geht es nicht, hier bringen wir nichts nach Hause, wir müssen uns weiter hinaus legen.» Er ahnte nichts Böses, nickte und setzte, da er vorn im Boot war, die Segel. Ich, der das Ruder hielt, steuerte das Boot fast eine deutsche Meile weiter in See, drehte dann wie zum Fischen bei, gab dem Jungen das Ruder, ging nach vorn, wo der Maure stand, und indem ich so tat, als ob ich mich hinter ihm nach etwas bückte, fasste ich ihn unversehens mit meinem Arm unter seinen Kniekehlen und schmiss ihn glatt über Bord ins Meer. Er kam gleich wieder hoch, denn er schwamm wie ein Kork, schrie zu mir und flehte, ich möchte ihn wieder einnehmen, er wolle mit mir bis in alle Welt gehen. Er schwamm so mächtig hinter dem Boot her, dass er mich sehr bald würde eingeholt haben, da wir nur wenig Wind hatten; ich ging also in die Kajüte, holte eine der Vogelflinten, wies sie ihm und rief, ich hätte ihm nichts zuleide getan und würde es auch nicht tun, wenn er Ruhe gäbe. «Aber», sagte ich, «du schwimmst gut genug, um an Land zu kommen, die See ist ruhig, und ich will dir nichts tun. Wenn du aber dem Boot nahe kommst, schieß ich dich durch den Kopf; denn ich bin entschlossen, meine Freiheit zu haben.»
So machte er kehrt und schwamm der Küste zu, und ich zweifle nicht, dass er sie erreicht hat, denn er war ein vortrefflicher Schwimmer.
Ich hätte ja auch den Jungen über Bord werfen und den Mauren mit mir nehmen können; aber ich durfte ihm nicht trauen. Als er davon war, wandte ich mich zu dem Jungen, der Xury genannt wurde, und sagte zu ihm: «Xury, willst du mir treu bleiben, so werde ich einen großen Mann aus dir machen; wenn du dir aber nicht übers Gesicht streichen und mir bei Mahomet und seines Vaters Bart Treue schwören willst, muss ich dich auch ins Meer werfen.» Der Junge lächelte mich an und redete so unschuldig, dass ich ihm nicht misstrauen konnte, und schwor mir treu zu sein und mit mir durch die ganze Welt zu gehen.
Solange ich in Sicht des schwimmenden Mauren war, steuerte ich geradenwegs der hohen See zu, hart am Wind, damit sie denken sollten, ich sei auf die Meerenge zugefahren, wie ohnedies jeder vernünftige Mensch annehmen musste; denn wer hätte glauben können, wir seien nach Süden gesegelt zu der Barbarenküste, wo ganze Völker von Schwarzen uns unfehlbar mit ihren Kanoes umzingeln und umbringen würden und wo wir keinen Schritt an Land tun könnten, ohne von wilden Tieren oder noch wilderen Menschen ohne Erbarmen gefressen zu werden?
Allein am Abend, sobald es dunkel wurde, veränderte ich meinen Kurs und steuerte geradenwegs nach Süd zu Ost, immer etwas mehr nach Ost haltend, um unter der Küste zu bleiben; und da ich einen hübschen steifen Wind hatte und glatte See, machte ich so gute Fahrt, dass ich glaube, als ich am nächsten Tage um drei Uhr nachmittags Land sichtete, konnte ich nicht weniger als hundertfünfzig Meilen südlich von Salee sein, also weit über des Kaisers von Marokko oder irgendeines andern Königs Gebiet hinaus; denn es war keine lebendige Seele zu erblicken.
Aber der Schreck vor den Mauren und die Angst, ihnen wieder in die Hände zu fallen, steckte mir noch so in den Knochen, dass ich nicht an Land oder vor Anker ging, sondern, da der Wind anhielt, noch fünf Tage lang so weitersegelte. Als er aber dann nach Süden sprang, nahm ich an, dass, wenn sie etwa auf mich Jagd machten, sie es nunmehr auch aufgeben würden. Also wagte ich es, an Land zu gehen und in der Mündung eines kleinen Flusses, ich wusste nicht, wo oder was für eines, noch unter welcher Breite und bei welchem Volk, zu ankern. Was ich vor allem brauchte, war Trinkwasser. Es war Abend, als wir in diese Bucht kamen, und wir beschlossen, sobald es dunkel würde, ans Ufer zu schwimmen und die Gegend zu erkunden; aber kaum war es Nacht, so hörten wir ein so grässliches Getöse vom Bellen, Brüllen und Heulen wilder Tiere uns unbekannter Art, dass der arme Junge vor Angst beinahe starb und mich anflehte, nicht vor Tag ans Ufer zu gehen. «Gut, Xury», sagte ich, «dann will ich’s nicht tun; aber vielleicht werden wir am Tage Menschen zu sehen bekommen, die noch schlimmer sein werden als diese Löwen!» – «Dann», sagte Xury lachend, «wir geben sie Schuss, machen sie laufen weg!» – Ich war froh, den Jungen so lustig zu sehen, und ich gab ihm aus der Flaschenkiste unseres Patrons einen Schluck zur Stärkung. Schließlich war Xurys Rat gut, ich nahm ihn an, wir warfen unsern kleinen Anker aus und lagen die ganze Nacht über still; ich sage still, denn wir schliefen nicht, und nach zwei bis drei Stunden sahen wir großmächtige Bestien, deren Namen wir nicht nennen konnten, von allerhand Gattung zum Ufer herabkommen und ins Wasser springen, wo sie sich mit Behagen wälzten, um sich abzukühlen; und sie vollführten ein so scheußliches Geheul, wie ich mein Lebtag nicht gehört habe.
Xury hatte schreckliche Angst und ich auch. Aber unser Entsetzen stieg noch, als wir eines dieser gewaltigen Geschöpfe auf unser Boot zuschwimmen hörten. Sehen konnten wir es nicht; aber wir konnten an seinem Schnaufen erkennen, dass es ein riesiges, wildes Ungeheuer war; Xury meinte, es sei ein Löwe, und es mag auch wirklich einer gewesen sein. Der arme Kerl schrie mir zu, wir sollten den Anker lichten und davonrudern. «Nein, Xury», sagte ich, «wir können unser Ankertau mit der Boje länger auslassen und seewärts halten; weit können sie uns nicht folgen.» Kaum hatte ich das gesagt, als ich die Bestie zwei Ruderlängen weit vor uns auftauchen sah, was mir etwas in die Glieder fuhr: Doch lief ich eilends zur Kajüte, nahm mein Gewehr und schoss auf das Vieh, worauf es augenblicklich kehrtmachte und wieder ans Ufer schwamm.
Unmöglich aber vermag ich den fürchterlichen Lärm, das grässliche Schreien und Heulen zu beschreiben, das der Knall des Büchsenschusses sowohl am Ufer hin als höher landeinwärts aufstörte. Ich möchte wahrhaftig glauben, diese Geschöpfe hatten nie so etwas gehört. Das überzeugte mich vollends, dass wir in der Nacht nicht an Land gehen dürften und dass es auch am Tage noch ein fragwürdiges Unternehmen sein würde.
Sei dem, wie ihm wolle, wir mussten am Ende irgendwo nach Wasser ans Ufer gehen; denn wir hatten keinen Tropfen mehr an Bord. Wann und wo wir das bewerkstelligen sollten, war die Frage. Xury sagte, wenn ich ihn gehen lassen wolle, so würde er versuchen, Wasser zu finden, und es mir bringen. Ich fragte ihn, warum er denn gehen wolle? Warum ich nicht gehen und er im Boot bleiben solle? Darauf antwortete er so treuherzig, dass ich ihn für immer lieb gewann. «Wenn wilde Männer kommen», sagte er, «essen mich, du weggehn.» – «Gut, Xury», sagte ich, «wir wollen beide gehen, und wenn die Wilden kommen, werden wir sie totschießen, und sie sollen keinen von uns fressen.» Somit gab ich Xury ein Stück Zwieback zu essen und einen Schluck aus einer der Flaschen des Patrons, und wir holten das Boot so nah, als uns gut schien, ans Ufer auf und wateten mit nichts als unseren Waffen und zwei Wasserkrügen an Land.
Ich getraute mich nicht, das Boot aus den Augen zu lassen, aus Furcht, es könnten Wilde mit ihren Kanoes den Fluss herab kommen; aber der Junge erspähte eine Senkung landeinwärts und pirschte sich dorthin, und nach einer Weile sah ich ihn wieder zu mir zurückgerannt kommen. Ich glaubte, er sei von einem Wilden verfolgt oder von einem wilden Tier erschreckt, und rannte ihm entgegen, um ihm beizustehen; aber als ich näher kam, sah ich etwas über seiner Schulter hängen; das war ein Tier, das er geschossen, ähnlich einem Hasen, nur von anderer Farbe und mit längeren Läufen. Wir waren dessen ungeachtet sehr froh darüber, und es gab leckeres Fleisch. Die größte Freude aber, die Xury mitbrachte, war die Nachricht, dass er gutes Wasser gefunden und keinen Wilden gesehen hatte.
Später fanden wir freilich, dass wir uns im Wasser nicht hätten zu sorgen brauchen; denn etwas höher aufwärts an dem Bach, wo wir waren, fanden wir das Wasser süß, als die Flut, die nur eine kurze Strecke weit hereinströmte, wieder abgelaufen war. So füllten wir unsere Krüge und taten uns gütlich an dem erlegten Hasen und machten uns dann auf den Weg, da wir in dieser Gegend keinerlei Fußstapfen menschlicher Wesen gesehen hatten.
Da ich zuvor schon einmal an dieser Küste gewesen war, so wusste ich wohl, dass die Kanarischen und die Kapverdischen Inseln nicht weit davon ab lägen. Weil ich aber keine Instrumente hatte, um die Breite zu bestimmen, unter der wir waren, so konnte ich sie nicht ausfindig machen; sonst wäre mir das gewiss geglückt. So aber blieb mir nur die Hoffnung, wenn ich mich längs der Küste hielt, bis wo die englischen Kauffahrer liefen, so würde ich vielleicht eines ihrer Schiffe treffen, das uns aufnähme. Nach meiner Berechnung musste der Ort, wo ich jetzt war, das Land sein, das zwischen dem Reich des Kaisers von Marokko und der Heimat der Neger wüst und nur von wilden Tieren bewohnt sich hinstreckt, da die Neger es aus Furcht vor den Mauren verlassen und sich mehr nach Süden gezogen haben, die Mauren aber es wegen seiner Unfruchtbarkeit nicht besiedeln mögen und weil überdies alle beide sich vor der ungeheuer großen Anzahl von Tigern, Löwen, Leoparden und anderen grimmigen Geschöpfen fürchten, die dort hausen, sodass die Mauren es bloß zur Jagd brauchen, auf die sie wie in einer Heerschar ziehen, zwei- oder dreitausend Mann auf einmal. Und wirklich sahen wir denn auf beinahe hundert englische Meilen hin nichts als ein wüstes, unbewohntes Land bei Tag und hörten nichts als das Heulen und Brüllen wilder Tiere bei Nacht.
*
Ein-oderzweimalvermeinteich unter Tags den Pik von Teneriffa zu sehen, der der höchste Gipfel des Gebirges Teneriffa auf den Kanarischen Inseln ist, und es lockte mich mächtig, darauf loszufahren, um ihn vielleicht zu erreichen. Nachdem ich es aber zweimal versucht hatte und widrige Winde mich zurückwarfen, auch die See zu hoch ging für meine Nussschale, blieb ich bei meinem ersten Beschluss, mich längs der Küste zu halten.
Ich musste, nachdem wir diese Gegend hinter uns hatten, mehrere Male wegen frischen Wassers landen. Und einmal besonders, an einem frühen Morgen, legten wir uns unter einer kleinen Landspitze, die ziemlich hoch war, vor Anker und blieben still liegen, um die Ebbe abzuwarten, die just begann, als plötzlich Xury, dessen Augen offenbar eifriger umherwanderten als die meinen, mich leise rief und mir sagte, es wäre am besten, wenn wir weiter weg vom Ufer führen; «denn», sagte er, «schau, dort drüben liegt ein schreckliches Ungeheuer an dem Hügel und schläft fest!» – Ich sah, wohin er zeigte, und erblickte in der Tat ein schreckliches Ungeheuer; denn es war ein furchtbarer, großer Löwe, der da am Ufer im Schatten eines Stückes von dem Hügel lag, das über ihn hing. – «Xury», sagte ich, «geh du ans Ufer und töte ihn.» – Xury machte ein entsetztes Gesicht und sagte: «Ich töten! Er mich essen, ein Mundvoll!» – So sagte ich nichts weiter, hieß ihn nur still liegen und nahm unsere größte Flinte, die fast so groß wie eine Muskete war, und lud sie mit einem kräftigen Schuss Pulver und zwei Stück Eisen; dann lud ich ein zweites Gewehr mit zwei Kugeln und das dritte, denn wir hatten drei, mit fünf kleineren Kugeln. Ich zielte mit der ersten Flinte ihm scharf auf den Kopf; aber er lag so mit seinem Fuß über der Nase, dass die Eisen sein Bein am Knie trafen und ihm den Knochen zerschlugen. Anfangs fuhr er knurrend auf; als er aber merkte, dass sein Bein gebrochen sei, sank er wieder hin, erhob sich dann von Neuem auf die Beine und stieß das grässlichste Gebrüll aus, das ich je gehört habe. Ich war ein wenig bestürzt, dass ich ihn nicht in den Kopf getroffen hatte; ich griff jedoch augenblicklich zur zweiten Flinte und feuerte, obwohl er fortzuhinken begann, noch einmal und schoss ihn in den Kopf, und das Herz lachte mir, als ich sah, wie er mit nur wenigem Schnaufen umsank und nach Leben schnappend dalag. Nun fasste sich Xury ein Herz und wollte gern an Land. – «Gut», sagte ich, «geh!» – Da sprang der Bursch ins Wasser und schwamm, eine kleine Flinte in einer Hand haltend, mit der anderen Hand ans Ufer, ging nahe an das Untier heran, setzte ihm das Mundloch der Flinte ans Ohr und schoss es nochmals durch den Kopf, was ihm vollends den Rest gab.
Da hatten wir nun zwar ein Wildbret, aber wir konnten’s nicht essen, und es reute mich sehr, drei Schuss Pulver an eine Kreatur vertan zu haben, die uns nichts nütze war. Doch Xury sagte, er wolle etwas von ihm haben, kam an Bord zurück und bat mich, ihm das Beil zu geben. «Wozu, Xury?», fragte ich. – «Ich abschneiden sein Kopf», sagte er. Abschneiden sein Kopf gelang ihm nicht; aber er hieb ihm einen Fuß ab und brachte ihn mit, und er war ungeheuer groß.
Ich bedachte mich jedoch, dass vielleicht sein Fell auf die eine oder andere Weise uns von Nutzen sein könnte, und beschloss, es ihm, wenn möglich, über die Ohren zu ziehen. So machten Xury und ich uns daran, ihn zu bearbeiten; aber Xury verstand das Handwerk viel besser als ich; ich kam nur schwer damit zurecht. Wir hatten wirklich alle beide den ganzen Tag zu tun; aber endlich hatten wir ihn ausgepellt. Wir breiteten das Fell auf dem Dach unserer Kajüte aus, die Sonne trocknete es in ein paar Tagen, und ich benutzte es nachher, um darauf zu liegen.
Nach diesem Aufenthalt fuhren wir zehn bis zwölf Tage lang südwärts weiter. Wir aßen nur sehr sparsam von unserem Mundvorrat, der stark zusammenschmolz, und gingen nur an Land, wenn wir frisches Wasser brauchten. Mein Vorhaben dabei war, zu dem Fluss Ganbia oder Senegal zu gelangen, das heißt also irgendwo in die Nähe des Kap Verde. Dort hoffte ich, europäischen Schiffen zu begegnen. Glückte mir das nicht, so blieb mir nichts anderes übrig, als auf die Suche nach den Inseln hinauszufahren oder bei den Negern umzukommen. Ich wusste, dass alle Schiffe aus Europa, die nach der Küste von Guinea oder nach Brasilien oder Ostindien fuhren, dieses Kap oder diese Inseln umsegelten. Mit einem Wort: Ich setzte mein ganzes Schicksal auf die Möglichkeit, entweder einem Schiff zu begegnen oder zugrunde zu gehen.
Nachdem ich diesem Entschluss, wie gesagt, etwa zehn Tage lang gefolgt war, begann ich zu merken, dass das Land bewohnt war. An zwei oder drei Stellen sahen wir im Vorbeisegeln Menschen am Ufer stehen und uns anschauen; wir konnten auch erkennen, dass sie kohlschwarz und splitternackt waren. Einmal bekam ich Lust, zu ihnen an Land zu gehen; aber Xury beriet mich besser und sagte: «Nicht geh, nicht geh!» Dennoch hielt ich näher nach dem Ufer hin, damit ich mit ihnen reden könnte, und sah, dass sie eine gute Strecke weit am Strande entlang neben mir herliefen. Ich erkannte, dass sie keine Waffen in den Händen hatten, außer einem, der einen langen, dünnen Stock trug, wie Xury sagte, eine Lanze, mit der sie auf eine ziemliche Weite sicher zu treffen wüssten. So hielt ich mich in einigem Abstand und redete mit ihnen, so gut ich konnte, durch Zeichen; ganz besonders machte ich Zeichen, dass ich gerne etwas zu essen hätte; sie winkten, ich solle mein Boot anhalten, so wollten sie mir Speise holen. Hierauf ließ ich meine Segel etwas nieder und legte bei, und zwei von ihnen rannten ins Land hinauf und kamen in weniger als einer halben Stunde zurück und brachten zwei Stücke gedörrtes Fleisch und einiges Korn, wie sie es im Lande haben. Wir waren uns zwar über die Natur dieser zwiefachen Mahlzeit nicht klar, wollten sie aber gerne annehmen. Wie sollten wir jedoch an sie herankommen? Denn ich getraute mich nicht zu ihnen ans Ufer, und sie waren ebenso bange vor uns; sie fanden jedoch einen für beide Teile unbedenklichen Ausweg; denn sie brachten’s herab an den Strand, legten’s nieder, liefen wieder davon und blieben in gehöriger Entfernung stehen, bis wir’s an Bord geholt hatten. Dann kamen sie wieder nahe an uns heran.