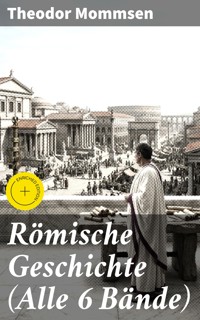
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In "Römische Geschichte" präsentiert Theodor Mommsen ein umfassendes Werk, das die Entwicklung des römischen Reichs von seinen Anfängen bis in die Spätantike detailreich nachzeichnet. Mommsens Prosa ist durch eine klare Struktur, analytische Tiefe und historischen Kontext geprägt, was das Verständnis der komplexen politischen und sozialen Strukturen der Antike erleichtert. Seine Fähigkeit, historische Ereignisse lebendig darzustellen, macht das Werk nicht nur informativ, sondern auch literarisch ansprechend. Durch seine kritische Analyse der Quellen und die umfassende Darstellung der römischen Kultur, Gesellschaft und Staatsform hat Mommsen die Geschichtsschreibung nachhaltig geprägt. Theodor Mommsen, ein deutscher Historiker und Nobelpreisträger, gilt als einer der bedeutendsten Antike-Experten seiner Zeit. Sein Interesse an der römischen Geschichte wurde durch sein tiefes Verständnis der klassischen Sprachen und seine Leidenschaft für das alte Rom genährt. Mommsens Engagement für die Wissenschaft und seine Fähigkeit, komplexe historische Zusammenhänge verständlich zu machen, motivierten ihn dazu, ein solches monumentales Werk zu verfassen, das als Referenzwerk seiner Epoche gilt. Für alle, die sich für die antike Welt und ihre Einflüsse auf die moderne Gesellschaft interessieren, ist "Römische Geschichte" von Theodor Mommsen ein unverzichtbares Werk. Es bietet nicht nur tiefgreifende Einblicke in die römische Geschichte, sondern auch in die Wurzeln europäischer Zivilisation und politischer Systeme. Leser können sich auf eine fesselnde Entdeckungsreise durch die Höhepunkte und Tiefpunkte des römischen Imperiums freuen. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine umfassende Einführung skizziert die verbindenden Merkmale, Themen oder stilistischen Entwicklungen dieser ausgewählten Werke. - Die Autorenbiografie hebt persönliche Meilensteine und literarische Einflüsse hervor, die das gesamte Schaffen prägen. - Ein Abschnitt zum historischen Kontext verortet die Werke in ihrer Epoche – soziale Strömungen, kulturelle Trends und Schlüsselerlebnisse, die ihrer Entstehung zugrunde liegen. - Eine knappe Synopsis (Auswahl) gibt einen zugänglichen Überblick über die enthaltenen Texte und hilft dabei, Handlungsverläufe und Hauptideen zu erfassen, ohne wichtige Wendepunkte zu verraten. - Eine vereinheitlichende Analyse untersucht wiederkehrende Motive und charakteristische Stilmittel in der Sammlung, verbindet die Erzählungen miteinander und beleuchtet zugleich die individuellen Stärken der einzelnen Werke. - Reflexionsfragen regen zu einer tieferen Auseinandersetzung mit der übergreifenden Botschaft des Autors an und laden dazu ein, Bezüge zwischen den verschiedenen Texten herzustellen sowie sie in einen modernen Kontext zu setzen. - Abschließend fassen unsere handverlesenen unvergesslichen Zitate zentrale Aussagen und Wendepunkte zusammen und verdeutlichen so die Kernthemen der gesamten Sammlung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Römische Geschichte (Alle 6 Bände)
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Ein roter Faden aus Macht und Gesetz zieht sich durch den Staub der römischen Straßen. In dieser Spannung zwischen Gewalt und Ordnung, Ehrgeiz und Institution, hebt Theodor Mommsen den Blick vom Pflaster der Stadt auf die Welt, die Rom formte – und von Rom geformt wurde. Seine Römische Geschichte erzählt den Aufstieg eines Gemeinwesens, das sich vom lokalen Verband zur imperialen Ordnung entfaltete, und fragt zugleich nach dem Preis dieser Größe. Nicht als bloße Chronik, sondern als dramatische Vermessung politischer Möglichkeiten entfaltet das Werk jene Kräfte, die Republiken tragen – und zuweilen zerreißen.
Dass Mommsens Werk als Klassiker gilt, liegt an einer seltenen Verbindung: philologische Strenge, juristische Schärfe und erzählerische Kraft greifen ineinander. Der Autor erhielt 1902 den Nobelpreis für Literatur, eine Auszeichnung, die nicht nur Gelehrsamkeit, sondern die literarische Wirkungskraft dieser Geschichtsschreibung honorierte. Generationen von Leserinnen und Lesern fanden hier eine Prosa, die die antike Welt nicht museal einfriert, sondern zum Sprechen bringt. Übersetzungen und Neuauflagen machten die Römische Geschichte zu einem Bezugspunkt weit über die Fächergrenzen hinaus; sie prägte die Vorstellung davon, wie die römische Vergangenheit geschrieben und erinnert werden kann.
Theodor Mommsen (1817–1903), Jurist, Epigraphiker und Historiker, begann die Römische Geschichte in den 1850er Jahren zu veröffentlichen; die ersten Bände erschienen 1854 bis 1856. Später ergänzte er das Projekt mit den umfangreichen Studien zu den Provinzen des römischen Reiches, die 1885 herauskamen. Viele moderne Ausgaben präsentieren das Gesamtunternehmen in sechs Bänden und verbinden die republikanische Erzählung mit den großräumigen Analysen der Kaiserzeit. Der Publikationskontext war eine Zeit intensiver wissenschaftlicher Institutionalisierung; Mommsen stand im Zentrum dieser Bewegung und verband Forschung, Editionstätigkeit und Öffentlichkeit zu einem einflussreichen Ganzen.
Inhaltlich entfaltet das Werk die römische Geschichte von den frühen Formationen über die republikanische Ordnung bis hin zu den Umbrüchen, die den Übergang zur Monarchie vorbereiteten. Es schildert politische Strukturen, soziale Konflikte, militärische Expansion und die Entwicklung des Rechts. Die späteren Studien zu den Provinzen weiten den Blick auf Verwaltung, Wirtschaft und kulturelle Verflechtungen des Imperiums von der Zeit Caesars bis in die Epoche Diokletians. So entsteht ein Doppelporträt: Rom als politische Maschine im Zentrum – und Rom als vielgestaltiger Verbund an seinen Rändern. Details treten zurück zugunsten von Form, Idee und langer Linie.
Mommsens Absicht ist programmatisch: Er will die antike Welt nicht nur überliefern, sondern ihre innere Logik freilegen. Als Jurist denkt er Institutionen vom Gesetz her, als Historiker untersucht er Kräfteverhältnisse, als Philologe prüft er Worte und Überlieferungen. Sein Ziel ist es, politische Erfahrung lesbar zu machen – wie Entscheidungen, Interessen und Strukturen ein Gemeinwesen formen. Zugleich sucht er ein Publikum jenseits enger Fachkreise: Bildungsbürgerliche Leserschaften sollten die Antike nicht als Zitatenschatz, sondern als Erfahrungsraum begreifen. So verbindet das Werk diagnostische Genauigkeit mit einem erzählenden Gestus, der Sinn stiftet, ohne zu fabulieren.
Die Qualität der Darstellung liegt im Ton. Mommsen schreibt mit Energie, präzisem Vokabular und dramaturgischem Takt. Er porträtiert Akteure, ohne ins Anekdotische zu verfallen, und ordnet Ereignisse, ohne sie zu nivellieren. Sein Blick auf Staatsmänner und Institutionen ist zugleich bewundernd und prüfend, und seine Urteile, oft scharf, zielen auf Verständlichkeit. Der Stil lädt zum Mitdenken ein, weil er Komplexität nicht verdeckt, sondern strukturiert. Dabei bleibt der Erzähler präsent: Er begründet, wägt, vergleicht – und findet Formulierungen, die das Faktische tragen, ohne es zu überhöhen. So entsteht ein erzählerischer Sog, der Forschung zur Lektüre macht.
Als Klassiker wirkte die Römische Geschichte weit in die Literatur- und Wissenschaftsgeschichte hinein. Sie setzte Maßstäbe für die Verbindung von Quellenkritik und erzählerischer Geschlossenheit, prägte Lehrpläne und öffentliche Debatten und machte die römische Vergangenheit zu einem Labor politischer Begriffe. Spätere Autorinnen und Autoren, in der Geschichtsschreibung ebenso wie in Essayistik und Roman, nahmen an ihrer Spannung zwischen Idee und Faktum Maß. Dass Mommsen die Antike als Gegenwart der Vernunft zu zeigen vermochte, öffnete Wege für moderne, problemorientierte Darstellungen, die das Kontingente der Geschichte sichtbar machen und dennoch eine Form von Notwendigkeit in den Entwicklungen erkennen lassen.
Methodisch stützt sich Mommsen auf ein breites Spektrum an Quellen: literarische Überlieferung, Inschriften, Münzen, juristische Texte, administrative Zeugnisse. Als maßgeblicher Mitbegründer des Corpus Inscriptionum Latinarum verband er editorische Arbeit mit synthetischer Darstellung; die philologische Werkstatt bleibt im Hintergrund spürbar. Vergleiche mit griechischen und neuzeitlichen Staatsformen schärfen den Blick für römische Besonderheiten. Chronologie, Topografie und Wirtschaftsdaten erscheinen nicht als Beiwerk, sondern als tragende Elemente. Diese Verwebung gibt der Erzählung Dichte: Das große Bild gewinnt Kontur aus vielen kleinen, gesicherten Beobachtungen, die die Plausibilität des Ganzen tragen.
Gerade weil das Werk stark ist, provoziert es Widerspruch. Manche Deutungen – etwa die Einschätzungen großer Akteure oder die Bewertung republikanischer Krisen – spiegeln Perspektiven des 19. Jahrhunderts und sind heute diskutiert worden. Der nationale Deutungsrahmen, die teleologische Versuchung und eine mitunter prononcierte Bewunderung für politische Tatkraft wurden kritisch befragt. Doch gerade diese Reibung erhält das Buch lebendig: Es zwingt zur Position, ohne sich in Zeitgeschmack aufzulösen. Die Faktentreue, die analytische Spannkraft und die erzählerische Durchbildung machen es weiterhin zu einem Ausgangspunkt, an dem neue Fragen produktiv ansetzen können.
Die heutige Relevanz liegt auf der Hand. Wer über die Fragilität republikanischer Ordnungen, die Dynamik sozialer Konflikte, die Ambivalenz von Expansion oder die Integrationsleistung eines Vielvölkerreiches nachdenkt, findet hier begriffliche Werkzeuge und anschauliche Fälle. Mommsens Betonung von Recht und Verwaltung eröffnet Perspektiven auf Institutionen als Träger politischer Dauer – und auf ihr Zerbrechen. Ebenso erhellt die Provinzenperspektive Fragen von Zentrum und Peripherie, von kultureller Übersetzung und ökonomischer Verdichtung. Dass all dies in klarer, bildkräftiger Prosa geschieht, macht die Lektüre nicht nur ergiebig, sondern auch anhaltend fesselnd.
Als Lesende begegnen wir einem Werk, das das Ganze will und das Einzelne ernst nimmt. In der Gliederung über mehrere Bände hinweg bietet sich die Möglichkeit, Wege zu wählen: chronologisch, thematisch, oder mit einem Fokus auf die Provinzen als Resonanzraum des Imperiums. Hilfreich ist, die Argumentlinien mitzulesen – wie eine institutionelle Innovation politische Folgen zeitigt, wie militärische Entscheidungen soziale Strukturen verändern. Karten, Register und Anmerkungen sind dabei keine Nebensache, sondern Leseinstrumente. Wer so vorgeht, entdeckt in der Fülle die Ökonomie des Buches: seine Kunst, Stoff zu ordnen, ohne ihn zu glätten.
Am Ende steht ein Versprechen, das dieses Buch einlöst: Geschichte als Erkenntnisform, die die Gegenwart erhellt. Mommsens Römische Geschichte vereint Sachkenntnis, Urteilskraft und erzählerische Form zu einer Darstellung, die Maßstäbe setzt – und Maß hält. Sie zeigt, wie aus Konflikten Ordnung entsteht, und wie Ordnung Konflikte hervorbringt. Sie lehrt, Institutionen zu denken und Menschen nicht zu vergessen. Darin liegt ihre dauerhafte Anziehungskraft. Als Klassiker bleibt sie offen für neue Lektüren, weil sie das Wesentliche freilegt: die Kräfte, die Gemeinwesen tragen, und die Ideen, die sie zu bewahren suchen.
Synopsis
Theodor Mommsens Römische Geschichte umfasst sechs Bände und verbindet erzählende Darstellung mit systematischer Analyse. Ausgehend von der Landschaft Italiens und den italischen Völkern zeichnet das Werk den Aufstieg Roms von der Stadtgemeinde zur mediterranen Großmacht nach und verfolgt die politische Entwicklung bis zum Ende der Republik. Die letzten Bände behandeln in thematisch und regional gegliederten Kapiteln die Provinzen von Caesar bis Diokletian. Mommsen stützt sich auf literarische Quellen, Inschriften, Rechtstexte und Münzen und legt besonderes Gewicht auf Institutionen, Recht und Verwaltung. Ziel ist es, die Kräfte und Strukturen sichtbar zu machen, die römische Expansion, Integration und dauerhafte Ordnung ermöglichten.
Zu Beginn beschreibt das Werk die Voraussetzungen römischer Staatlichkeit: Siedlungsraum Latium, Nachbarschaft zu Etruskern und Griechen, frühe Sakral- und Familienordnung. Die Königszeit erscheint als formative Phase für Heerwesen, Senat und Volksversammlung. Mit dem Übergang zur Republik rückt die innere Verfassung in den Fokus: Magistraturen mit Kollegialität und Annuität, die Rolle der Nobilität, Patronage und Klientel. Der Konflikt der Stände strukturiert die ersten Jahrhunderte, von der Abwehr patricischer Vorrechte bis zur politischen Gleichstellung der Plebejer. Parallel festigt Rom seine Vorherrschaft im latinischen Bund und entwickelt rechtliche Formen, die Loyalität und Bindung der Verbündeten sichern.
Es folgt die Darstellung der italischen Kriege, in denen Rom militärische und organisatorische Überlegenheit ausbaut. Die Latinische Erhebung, die Samnitenkriege und die Begegnung mit Pyrrhos zeigen die Anpassungsfähigkeit römischer Taktik und Institutionen. Kolonien, Straßenbau und gestufte Bürgerrechte integrieren eroberte Gebiete, während Bundesverträge Autonomie mit Dienstpflichten verbinden. Rom etabliert ein Netz aus Munizipien und Kolonien, das Rekrutierung, Steuerung und Versorgung erleichtert. Die Bewältigung der Pyrrhossiege und der Abschluss der italienischen Einigung markieren den Übergang von der regionalen zur mediterranen Politik und schaffen die Voraussetzungen für Seekrieg, Fernexpeditionen und einen dauerhaften Zugriff auf Ressourcen.
In der Auseinandersetzung mit Karthago vollzieht sich der Schritt zur Seemacht. Der Erste Punische Krieg begründet eine Flotte und die ersten überseeischen Provinzen. Der Zweite Punische Krieg, geprägt durch Hannibals Feldzug und römische Verluste, endet durch strategische Ausdauer, Bündnistreue Italiens und Scipios Offensive in Afrika. Der Dritte Punische Krieg beseitigt Karthago als Rivalen. Rom erwirbt Sizilien, Sardinien, Spanien und Afrika und begegnet den Folgekosten imperialer Herrschaft: Massensklaverei, Latifundien, Migration nach Rom und neue Konflikte zwischen Senatoren, Rittern und bäuerlicher Bevölkerung. Die Grundzüge der Provinzialverwaltung entstehen als Antwort auf diese Herausforderungen.
Parallel expandiert Rom in den griechischen Osten. Die Makedonischen Kriege, die Neuordnung Griechenlands und die Übernahme von Pergamon führen zur Provinz Asia. Mommsen beleuchtet die Beziehungen zu hellenistischen Königreichen, die Rolle römischer Gesandtschaften und die wachsende Einflussnahme ohne unmittelbare Annexion. Steuerpacht und Finanzverwaltung fördern den Aufstieg des Ritterstandes und verschärfen Interessenkonflikte. Kulturell verstärkt sich der Austausch: griechische Bildung, Kunst und Religion prägen Eliten und Städte. Zugleich treten Missstände der Provinzverwaltung, Erpressung und Prozesspolitik hervor, die nach Reformen rufen. So verknüpft sich außenpolitische Expansion mit inneren Spannungen und rechtlichen Innovationen.
Die folgenden Kapitel behandeln die innenpolitische Krise der späten Republik. Die Brüder Gracchus versuchen mit Agrar-, Getreide- und Gerichtsgesetzen soziale Schieflagen zu korrigieren und Machtbalance zu verschieben. Der Bundesgenossenkrieg erweitert das Bürgerrecht auf Italien und verändert die Rekrutierungsbasis. Marius professionalisiert das Heer und verschiebt Loyalitäten hin zu Feldherren. Sullas Diktatur reagiert mit Verfassungsreformen, Proskriptionen und einer Neuordnung der Gerichtshöfe, stabilisiert jedoch die Konkurrenz der Machtblöcke nicht dauerhaft. Parteikämpfe, Patronage und Gewaltpolitik prägen das politische Leben. Strukturelle Defizite der republikanischen Ordnung treten offen zutage und bereiten den Boden für monokratische Lösungen.
Aus der Blockade der Institutionen entstehen außerordentliche Kommanden und informelle Bündnisse. Pompeius’ Erfolge im Osten, Crassus’ Ressourcen und Caesars Aufstieg münden im Ersten Triumvirat. Caesars gallischer Krieg erweitert den Machtbereich und stärkt seine klientelären Bindungen. Der Konflikt mit dem Senatslager eskaliert in den Bürgerkrieg; militärische Entscheidung und politische Amnestien gehen mit administrativen Neuordnungen einher. Als Diktator bündelt Caesar Kompetenzen, reformiert Kalender, Provinzen, Senatszusammensetzung und das Bürgerrechtsregime. Die Ermordung beendet das Programm abrupt, lässt aber zentrale Probleme ungelöst. Mommsen stellt Caesar als Kulminationspunkt einer Entwicklung dar, in der republikanische Formen imperialer Herrschaft weichen.
Die letzten Bände wenden sich den Provinzen vom Zeitalter Caesars bis zu Diokletian zu und ordnen das Reich aus der Peripherie her. Dargestellt werden Verwaltungsstrukturen von senatorischen und kaiserlichen Provinzen, die Rolle von Statthaltern, Räten und Stadtkörpern sowie die Verzahnung von ius civile, ius gentium und kaiserlichen Reskripten. Steuerwesen, Naturalabgaben und die Trennung von Militär- und Zivilgewalt werden systematisch erläutert. Das Heer erscheint als Sicherungs- und Integrationsfaktor, Straßen, Flotten und Kurierwesen als Infrastruktur imperialer Kohäsion. Ausweitung des Bürgerrechts, Wirtschaftsnetze und der Kaiserkult zeigen Mechanismen der Angleichung bei fortbestehender regionaler Vielfalt.
Ein breiter Überblick über die Regionen verdeutlicht unterschiedliche Pfade der Romanisierung. Gallien und Spanien entwickeln städtische Netzwerke und Mischkulturen; Britannien und die germanischen Grenzen illustrieren die Spannungen von Expansion und Limesverteidigung. Im Donau- und Balkanraum prägen Militärpräsenz und Neuansiedlungen die Landschaft. Afrika und Ägypten erscheinen als agrarische Kernräume, der Osten mit Kleinasien und Syrien als dicht urbanisierte Zonen. Mommsen skizziert Krisen des dritten Jahrhunderts, Usurpationen und ökonomische Belastungen, bevor Diokletians Reformen Verwaltung, Steuern und Heeresorganisation neu ordnen. Das Werk schließt mit der Einsicht, dass römische Dauerhaftigkeit auf rechtlich-institutioneller Integration und adaptiver Provinzialpolitik beruht.
Historischer Kontext
Theodor Mommsens Römische Geschichte entfaltet sich in einem weiten zeitlichen Bogen vom sagenumwobenen Königszeitalter Roms bis zur Festigung der kaiserzeitlichen Provinzverwaltung im 3. Jahrhundert n. Chr. Als geographischer Rahmen dienen zunächst Latium und Mittelitalien mit dem Tiber als Lebensader; später umfasst der Horizont das gesamte Mittelmeer von Hispanien bis Syrien und von Britannien bis Ägypten. Schauplätze wie Rom, Karthago, Korinth, Numantia, Athen, Syrakus und Jerusalem markieren die Wegpunkte imperialer Expansion. Die Umweltbedingungen – fruchtbare Ebenen Latiums, die Apenninen, maritime Routen – strukturieren die römische Militärlogistik, Kolonisationsmuster und Handelsnetze, die Mommsen konsequent historisch-politisch interpretiert.
Das Buch spielt in einer Welt tiefgreifender institutioneller Wandlungen: von der Monarchie der Könige (traditionell 753–509 v. Chr.) über die res publica mit jährlich wechselnden Magistraten bis zum Prinzipat, der nach 27 v. Chr. monarchische Realität unter republikanischer Form schafft. Es ist zugleich eine mediterrane Konnektivitätsgeschichte, in der Rom mit Etruskern, Latinern, Samniten, Griechen und Karthagern konkurriert und schließlich die hellenistische Staatenwelt absorbiert. Mommsen verknüpft Raum und Zeit, indem er die politische Organisation – Bürgerrecht, Bundesgenossensystem, Provinzverwaltung – als Motor territorialer Integration analysiert; seine Darstellung lotet dabei die Spannungen zwischen Zentrum und Peripherie systematisch aus.
Die Königszeit (trad. 753–509 v. Chr.) umfasst die Stadtgründung, frühe Institutionen und den Einfluss etruskischer Herrscher (Bau der Cloaca Maxima, templum auf dem Kapitol). 509 v. Chr. führte die Vertreibung Tarquinius Superbus zur Republik mit zwei Konsuln, imperium und Amtskollegialität. Früh expandierte Rom in Latium, formte den Latinischen Bund neu und schuf sakrale und politische Bindungen. Historisch sind viele Details legendarisch; doch die Umstellung auf republikanische Gewaltenteilung ist gesichert. Mommsen trennt quellenkritisch Mythos von Verfassungsgeschichte und betont, wie das frühe Zusammenspiel von Senat, Volksversammlung und Magistraten die spätere römische Staatsbildung prägte.
Der Ständekonflikt (494–287 v. Chr.) reorganisierte die römische Gesellschaft. Die erste Sezession der Plebs (494) schuf das Tribunat; die Zwölftafelgesetze (451/450) kodifizierten Recht. Die Licinisch-Sextischen Gesetze (367) öffneten das Konsulat; die Lex Hortensia (287) verlieh Plebisziten Gesetzeskraft für alle Bürger. Dazwischen stabilisierten die leges Valeriae Horatiae (449) die Provokationsrechte. Diese Reformsequenz integrierte Plebeier in die nobilitas und reduzierte innerstädtische Gewalt. Mommsen deutet sie als schrittweise Institutionalisierung sozialer Konflikte und als Voraussetzung für Roms Fähigkeit, Ressourcen aus einem erweiterten Bürgerkörper planvoll für Krieg, Kolonisation und Verwaltung zu mobilisieren.
Die Samnitenkriege (343–341, 326–304, 298–290 v. Chr.) und der Lateinische Krieg (340–338) entschieden die Vorherrschaft in Mittel- und Süditalien. Mit Infrastrukturprojekten wie der Via Appia (ab 312) und Militärkolonien band Rom eroberte Gebiete. Der Pyrrhoskrieg (280–275) – Heraclea (280), Asculum (279), Beneventum (275) – beendete den griechischen Widerstand in Italien. Ergebnis war ein systematisch gestaffeltes Bundesgenossensystem, das Kontingente und Abgaben regelte. Mommsen würdigt diese Phase als Labor römischer Bündnispolitik: Die Kombination aus Bürgerrechtspolitik, Landzuweisungen und Kolonien begründete die strukturelle Überlegenheit gegenüber rivalisierenden Stammes- und Stadtstaatverbünden.
Der Erste Punische Krieg (264–241 v. Chr.) brachte den Übergang zur Seeherrschaft. Rom baute eine Flotte, siegte bei Mylae (260) und den Ägatischen Inseln (241) über Karthago; Ecnomus (256) demonstrierte operative Reichweite. Die Folge waren die ersten überseeischen Provinzen: Sicilia (ab 241) sowie Sardinien und Korsika (238). Der Frieden belastete Karthago mit Tribute, förderte dessen Expansionsdrang in Iberien. Mommsen zeichnet den Krieg als strategische Lernkurve Roms: organisatorische Anpassungsfähigkeit und politische Kohäsion ermöglichten den Sprung vom italienischen Hegemon zum imperialen Akteur.
Der Zweite Punische Krieg (218–201 v. Chr.) kulminierte im Marsch Hannibals über die Alpen (218) und Katastrophen wie Trasimenus (217) und Cannae (216). Mit der Fabius-Strategie, der Bindung italischer Verbündeter und Siegen in Hispanien stabilisierte Rom; Publius Cornelius Scipio schlug Hannibal bei Zama (202). Der Frieden machte Karthago zum Klientelstaat, Rom gewann Hegemonie im Westmittelmeer. Mommsen interpretiert diese Krisenzeit als Bewährungsprobe der römischen Institutionen: Die Fähigkeit, Niederlagen politisch zu absorbieren und strategisch zu innovieren, begründet nach seiner Darstellung den langfristigen imperialen Erfolg.
Im Osten besiegte Rom Makedonien und die Seleukiden: Cynoscephalae (197 v. Chr.) gegen Philip V., Magnesia (190) gegen Antiochos III., Pydna (168) gegen Perseus. 146 v. Chr. wurden Korinth zerstört und der griechische Widerstand gebrochen; Karthago fiel im selben Jahr. Macedonia wurde 148 Provinz, Asia 129 aus Attalos’ Testament. Diese Siege transformierten Rom zur mediterranen Vormacht und verlagerten die Politik auf den griechischsprachigen Osten. Mommsen betont die administrativen Konsequenzen: Tribut, Zehntpacht und die Stellung der publicani intensivieren die Interaktion zwischen Hauptstadt, Provinzen und den aufstrebenden Reiterordnungen.
Die Eroberungen des 2. Jahrhunderts v. Chr. erzeugten eine sozioökonomische Schieflage: Kriegsbeute, Sklavenimporte und Pachtverträge förderten Latifundien; Kleinbauern verarmten, urbanes Proletariat wuchs. In Sizilien brachen Sklavenkriege aus (135–132, 104–100). Die Reiter (equites) nutzten die Gerichtshöfe und Steuerpachten zur Bereicherung. Diese strukturellen Spannungen erzeugten Reformdruck. Mommsen verknüpft diese Entwicklungen mit dem Zerfall republikanischer Konsensmechanismen: Der Gegensatz zwischen oligarchischer Nobilität, Reiterinteressen und plebejischen Ansprüchen bildet den Hintergrund seiner Analyse der folgenden Reform- und Bürgerkriegsära.
Die Gracchenzeit markiert den Reformversuch: Tiberius Sempronius Gracchus (Tribun 133 v. Chr.) stellte mit der Lex Sempronia agraria die Neuverteilung des ager publicus an landarme Bürger in Aussicht; seine Absetzung und Tötung (133) signalisierten den Eintritt politischer Gewalt. Gaius Gracchus (Tribun 123–121) schuf eine Getreideversorgung, siedelte Kolonien und stärkte die equites in den Geschworenengerichten; sein Bürgerrechtsprojekt für italische Verbündete scheiterte. 121 endete sein Reformprogramm mit Blutvergießen. Mommsen deutet die Gracchen als rationalen, aber gescheiterten Versuch, die Republik sozial und administrativ zu modernisieren.
Der Jugurthinische Krieg (112–105 v. Chr.) gegen Numidiens Jugurtha offenbarte Senatskorruption; Marius übernahm 107 das Kommando, Sulla trat als fähiger Unterführer hervor. Kurz darauf bedrohten Kimbern und Teutonen Italien; Marius’ Siege bei Aquae Sextiae (102) und Vercellae (101) retteten Rom. Mit den marianischen Reformen (Kohortenordnung, Rekrutierung verarmter Bürger) professionalisierte sich das Heer – mit wachsender Klientelbindung an Feldherren. Mommsen analysiert diese Militärsozialisation als Strukturbruch: Das stehende Heer stärkt persönliche Kommandogewalt und beschleunigt die Politisierung der Armee, ein Kernmoment der späteren Bürgerkriege.
Der Bundesgenossenkrieg (91–88 v. Chr.) endete mit der Lex Iulia (90) und Lex Plautia Papiria (89), die das Bürgerrecht auf Italiens Verbündete ausdehnten. Sulla marschierte 88 erstmals auf Rom, führte Krieg gegen Mithridates VI., kehrte zurück, siegte im Bürgerkrieg und etablierte als Diktator (82–79) Proskriptionen sowie eine Senatsverfassung: Tribunenrechte wurden beschnitten, die Gerichte dem Senat zurückgegeben. Nach seinem Rücktritt (79) blieb die Ordnung instabil. Mommsen verurteilt die oligarchische Selbstverhärtung und die Gewalt als Symptom des Systemversagens, erkennt aber die Tragweite administrativer Neuordnung an.
Die Revolte des Spartacus (73–71 v. Chr.) erschütterte Italien, wurde von Crassus niedergeschlagen; Pompeius konsolidierte den Norden. Mit der Lex Gabinia (67) erhielt Pompeius ein außerordentliches Kommando gegen Piraten, die binnen Monaten eliminiert wurden; die Lex Manilia (66) übertrug ihm den Krieg gegen Mithridates. Zwischen 66 und 62 reorganisierte er den Osten, schuf die Provinzen Syria (64) und Bithynia et Pontus (63), ordnete Klientelreiche. Mommsen zeigt, wie außerordentliche Imperien die Norm sprengen: administrative Effizienz wuchs, doch die Balance republikanischer Kompetenzen zerfiel, was die Bühne für Caesar bereitete.
Die Catilinarische Verschwörung (63 v. Chr.) wurde von Cicero aufgedeckt und niedergeschlagen; sie beleuchtet die Krise urbaner Politik. 60 schlossen Caesar, Pompeius und Crassus das Erste Triumvirat; Caesar erlangte das Konsulat (59) und erhielt Gallia Cisalpina und Illyricum, später Gallia Transalpina. In den Gallischen Kriegen (58–50) schlug er Ariovistus (58), die Belger (57) und Vercingetorix bei Alesia (52); er überschritt den Rhein (55, 53) und landete in Britannien (55, 54). Mommsen preist Caesars organisatorisches Genie und interpretiert Gallien als Experimentierfeld einer spätrepublikanischen Integrations- und Provinzpolitik.
Mit dem Rubikon (49 v. Chr.) begann der Bürgerkrieg: Caesar siegte bei Pharsalos (48), Thapsus (46) und Munda (45). Als dictator perpetuo (44) reformierte er Kalender (46), Kolonisation, Provinzverwaltung und das Senatsgefüge; die Ermordung an den Iden des März (44) beendete sein Programm. Das Zweite Triumvirat (43) siegte bei Philippi (42) und mündete über Actium (31) in Augustus’ Ordnung (27). Mommsen schließt die politische Erzählung im Kern mit Caesar, entfaltet aber in den späteren Bänden die Provinzen unter den Cäsaren: Er zeigt deren Verwaltungsverdichtung vom 1. bis zum 3. Jahrhundert und die langfristigen Integrationsmechanismen.
Mommsens Werk funktioniert als Zeitkritik des 19. Jahrhunderts, indem es römische Oligarchie, Reformstau und Gewaltspiralen als Spiegel der Gegenwart deutet. Er schrieb die Hauptbände 1854–1856, nach den Revolutionen von 1848/49 und vor der Reichsgründung 1871, als in Preußen der Verfassungskonflikt (1862–1866) die Machtfrage zwischen Krone und Parlament zuspitzte. Sein Lob effizienter, rechtlich gebändigter Exekutivgewalt – paradigmatisch an Caesar – kontrastiert mit der Anklage gegen aristokratische Obstruktion (Sulla, Senatsoligarchie). Die römische Bürgerrechtspolitik in und nach dem Bundesgenossenkrieg erscheint als politisches Lehrstück gegen exklusiven Nationalismus und für staatsbürgerliche Integration.
Die Darstellung sozialer Ungleichheit – Latifundien, Sklavenarbeit, Provinzausbeutung – zielt bei Mommsen auf strukturelle Kritik: Sie brandmarkt ökonomische Konzentration und fiskalische Privilegien der publicani als Nährboden politischer Korruption. Im Kaiserzeit-Blick auf Provinzen zeigt er, wie Recht, Munizipalwesen und Infrastruktur soziale Mobilität ermöglichen können. Vor dem Hintergrund des Kaiserreichs nach 1871, der Antisozialistengesetze (ab 1878) und zeitgenössischer Exklusionsdiskurse insistiert Mommsen auf Bürgergleichheit und Verwaltungsethik; seine positive Bewertung der Ausweitung des Bürgerrechts (bis zur Constitutio Antoniniana 212) fungiert als Gegenentwurf zu klassen- und konfessionspolitischer Spaltung und warnt zugleich vor militarisierter Machtpolitik.
Autorenbiografie
Theodor Mommsen (1817–1903) gilt als einer der prägendsten Altertumswissenschaftler des 19. Jahrhunderts. Als Historiker, Jurist und Philologe verband er erzählerische Kraft mit philologischer Genauigkeit und begründete Maßstäbe für die Erforschung der römischen Welt. Sein Werk reicht von monumentalen Darstellungen der römischen Geschichte bis zu grundlegenden Studien des römischen Staats- und Strafrechts. Zugleich war er ein Pionier der Epigraphik: Inschriften wurden für ihn zu erstklassigen historischen Quellen. Für die literarische und wissenschaftliche Wirkung seiner Darstellung der Antike erhielt er 1902 den Nobelpreis für Literatur. Bis heute prägt Mommsens Ansatz Quellenkritik, Institutionengeschichte und eine lebendige, zugleich präzise Darstellung.
Aufgewachsen im damals schleswigschen Norden, studierte Mommsen an der Universität Kiel klassische Philologie und Rechtswissenschaft. Früh orientierte er sich an historisch-philologischen Methoden, wie sie durch Barthold Georg Niebuhr popularisiert worden waren. Ein staatliches Stipendium ermöglichte ihm in den 1840er-Jahren längere Aufenthalte in Italien. Dort sammelte und entzifferte er lateinische Inschriften, übte sich in systematischer Autopsie antiker Zeugnisse und gewann das Handwerkszeug einer quellengesättigten Antikenforschung. Die Erfahrung im Feld, verbunden mit sprachlicher Virtuosität, prägte sein wissenschaftliches Profil dauerhaft. Erste Veröffentlichungen zu Inschriften wiesen bereits die Richtung: weg von bloßer Kompilation, hin zu kritischer Edition und historischer Interpretation.
Die akademische Laufbahn begann in den Revolutionsjahren 1848/49 mit einer Professur in Leipzig, wo Mommsen zugleich publizistisch in die politischen Debatten eingriff. Konflikte mit den Behörden führten Anfang der 1850er-Jahre zu seinem Weggang. Er lehrte anschließend in Zürich und Breslau, bevor er in den späten 1850er-Jahren nach Berlin berufen wurde. Dort arbeitete er eng mit der Preußischen Akademie der Wissenschaften zusammen und legte die organisatorischen Grundlagen für das Corpus Inscriptionum Latinarum, eine systematische Sammlung lateinischer Inschriften. Das Projekt verband philologische Akribie mit großräumiger Forschungspraxis und wurde zum langfristigen Zentrum seiner Arbeit, getragen von Teams, Reisen und Editionstechnik.
Seine Römische Geschichte machte Mommsen einem breiten Publikum bekannt. Die ersten Bände erschienen in den 1850er-Jahren und schilderten die römische Republik bis zu Caesar mit stilistischer Energie und deutlicher Wertung. Die Darstellung verband politische Analyse, Sozialgeschichte und institutionelle Entwicklung mit engem Blick auf die Quellen. Sie löste Bewunderung wie Widerspruch aus, begründete aber seinen Rang als Historiker von europäischer Wirkung. In den 1880er-Jahren folgte ein Band über die römischen Provinzen von Caesar bis Diokletian, der den Blick auf Verwaltung und Regionalität schärfte. Auch in Übersetzungen prägte das Werk Vorstellungen von Rom und blieb über Generationen präsent.
Parallel zur großen Erzählung entwickelte Mommsen ein System römischer Rechts- und Staatslehre. Das mehrbändige Römische Staatsrecht entstand in den 1870er- und 1880er-Jahren als umfassende Analyse von Verfassung, Magistraturen und Rechtsformen der römischen Republik und des frühen Prinzipats. Mit dem Römischen Strafrecht legte er 1899 eine eigenständige, bis heute einflussreiche Studie zu Normen, Verfahren und Deliktlehre vor. Charakteristisch ist die Verbindung aus epigraphischen Zeugnissen, literarischer Überlieferung und juristischer Argumentation. Diese Arbeiten etablierten Standards der Quellenkritik und eine Terminologie, die die Altertumswissenschaft ebenso prägte wie die vergleichende Rechtsgeschichte.
Mommsen verstand Gelehrsamkeit als öffentliches Amt. Er beteiligte sich an liberalen Debatten, wirkte zeitweise als Abgeordneter in preußischen und reichsdeutschen Gremien und bezog Position zu Fragen von Rechtsstaatlichkeit und Bürgerrechten. In den frühen 1880er-Jahren trat er im sogenannten Antisemitismusstreit mit dem Essay Auch ein Wort über unser Judenthum für rechtliche Gleichstellung und gegen Ressentiments ein. Zugleich leitete er Großunternehmen der Forschung, voran das Corpus Inscriptionum Latinarum, und prägte die Berliner Wissenschaftskultur. Die internationale Resonanz seines Werks kulminierte 1902 in der Verleihung des Nobelpreises für Literatur, der seinen Rang als stilbildender Historiker offiziell anerkannte.
In seinen späten Jahren setzte Mommsen die Arbeit an Editionen und Rechtsstudien fort und blieb eine Autorität des Faches. Er starb zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Berlin; sein wissenschaftliches Vermächtnis wirkte unmittelbar durch Schüler, Editionen und institutionelle Strukturen weiter. Das Corpus Inscriptionum Latinarum wächst bis in die Gegenwart und macht die epigraphische Methode, die er prägte, international fruchtbar. Moderne Bewertungen betonen einerseits die suggestive Kraft seiner Caesar-Deutung und andererseits die Perspektiven seiner Zeit. Ungeachtet solcher Relativierungen gilt Mommsen als Begründer einer Quellenwissenschaft, die Genauigkeit, Reichweite und sprachliche Form exemplarisch verbindet.
Römische Geschichte (Alle 6 Bände)
Erster Band
Bis zur Abschaffung des römischen Königtums
Τά παλαίστερα σαφώς μέν ευρείν διά χρόνου πλήθος αδύνατα ήν. Εκ δέ τεκμηρίων ων επί μακρότατον σκοπούντί μοι πιστεύσαι ξυμβαίνει ου μεγάλα νομίζω γενέσθαι, ούτε κατά τούς πολέμους οίτε ες τά άλλα.
Die älteren Begebenheiten ließen sich wegen der Länge der Zeit nicht genau erforschen; aber aus Zeugnissen, die sich mir bei der Prüfung im großen Ganzen als verläßlich erwiesen, glaube ich, daß sie nicht erheblich waren, weder in bezug auf die Kriege noch sonst.
(Thukydides)
1. Kapitel
Einleitung
Rings um das mannigfaltig gegliederte Binnenmeer, das tief einschneidend in die Erdfeste den größten Busen des Ozeans bildet und, bald durch Inseln oder vorspringende Landfesten verengt, bald wieder sich in beträchtlicher Breite ausdehnend, die drei Teile der Alten Welt scheidet und verbindet, siedelten in alten Zeiten Völkerstämme sich an, welche, ethnographisch und sprachgeschichtlich betrachtet, verschiedenen Rassen angehörig, historisch ein Ganzes ausmachen. Dies historische Ganze ist es, was man nicht passend die Geschichte der alten Welt zu nennen pflegt, die Kulturgeschichte der Anwohner des Mittelmeers, die in ihren vier großen Entwicklungsstadien an uns vorüberfährt: die Geschichte des koptischen oder ägyptischen Stammes an dem südlichen Gestade, die der aramäischen oder syrischen Nation, die die Ostküste einnimmt und tief in das innere Asien hinein bis an den Euphrat und Tigris sich ausbreitet, und die Geschichte des Zwillingsvolkes der Hellenen und der Italiker, welche die europäischen Uferlandschaften des Mittelmeers zu ihrem Erbteil empfingen. Wohl knüpft jede dieser Geschichten an ihren Anfängen an andere Gesichts- und Geschichtskreise an; aber jede auch schlägt bald ihren eigenen abgesonderten Gang ein. Die stammfremden oder auch stammverwandten Nationen aber, die diesen großen Kreis umwohnen, die Berber und Neger Afrikas, die Araber, Perser und Inder Asiens, die Kelten und Deutschen Europas, haben mit jenen Anwohnern des Mittelmeers wohl auch vielfach sich berührt, aber eine eigentlich bestimmende Entwicklung doch weder ihnen gegeben noch von ihnen empfangen; und soweit überhaupt Kulturkreise sich abschließen lassen, kann derjenige als eine Einheit gelten, dessen Höhepunkt die Namen Theben, Karthago, Athen und Rom bezeichnen. Es haben jene vier Nationen, nachdem jede von ihnen auf eigener Bahn zu einer eigentümlichen und großartigen Zivilisation gelangt war, in mannigfaltigster Wechselbeziehung zueinander alle Elemente der Menschennatur scharf und reich durchgearbeitet und entwickelt, bis auch dieser Kreis erfüllt war, bis neue Völkerschaften, die bis dahin das Gebiet der Mittelmeerstaaten nur wie die Wellen den Strand umspült hatten, sich über beide Ufer ergossen und, indem sie die Südküste geschichtlich trennten von der nördlichen, den Schwerpunkt der Zivilisation verlegten vom Mittelmeer an den Atlantischen Ozean. So scheidet sich die alte Geschichte von der neuen nicht bloß zufällig und chronologisch; was wir die neue Geschichte nennen, ist in der Tat die Gestaltung eines neuen Kulturkreises, der in mehreren seiner Entwicklungsepochen wohl anschließt an die untergehende oder untergegangene Zivilisation der Mittelmeerstaaten wie diese an die älteste indogermanische, aber auch wie diese bestimmt ist, eine eigene Bahn zu durchmessen und Völkerglück und Völkerleid im vollen Maße zu erproben: die Epochen der Entwicklung, der Vollkraft und des Alters, die beglückende Mühe des Schaffens in Religion, Staat und Kunst, den bequemen Genuß erworbenen materiellen und geistigen Besitzes, vielleicht auch dereinst das Versiegen der schaffenden Kraft in der satten Befriedigung des erreichten Zieles. Aber auch dieses Ziel wird nur ein vorläufiges sein; das großartigste Zivilisationssystem hat seine Peripherie und kann sie erfüllen, nimmer aber das Geschlecht der Menschen, dem, so wie es am Ziele zu stehen scheint, die alte Aufgabe auf weiterem Felde und in höherem Sinne neu gestellt wird.
Unsere Aufgabe ist die Darstellung des letzten Akts jenes großen weltgeschichtlichen Schauspiels, die alte Geschichte der mittleren unter den drei Halbinseln, die vom nördlichen Kontinent aus sich in das Mittelmeer erstrecken. Sie wird gebildet durch die von den westlichen Alpen aus nach Süden sich verzweigenden Gebirge. Der Apennin[1] streicht zunächst in südöstlicher Richtung zwischen dem breiteren westlichen und dem schmalen östlichen Busen des Mittelmeers, an welchen letzteren hinantretend er seine höchste, kaum indes zu der Linie des ewigen Schnees hinansteigende Erhebung in den Abruzzen erreicht. Von den Abruzzen aus setzt das Gebirge sich in südlicher Richtung fort, anfangs ungeteilt und von beträchtlicher Höhe; nach einer Einsattlung, die eine Hügellandschaft bildet, spaltet es sich in einen flacheren südöstlichen und einen steileren südlichen Höhenzug und schließt dort wie hier mit der Bildung zweier schmaler Halbinseln ab. Das nördlich zwischen Alpen und Apennin bis zu den Abruzzen hinab sich ausbreitende Flachland gehört geographisch und bis in sehr späte Zeit auch historisch nicht zu dem südlichen Berg- und Hügelland, demjenigen Italien, dessen Geschichte uns hier beschäftigt. Erst im siebenten Jahrhundert Roms wurde das Küstenland von Sinigaglia bis Rimini, erst im achten das Potal Italien einverleibt; die alte Nordgrenze Italiens sind also nicht die Alpen, sondern der Apennin. Dieser steigt von keiner Seite in steiler Kette empor, sondern breit durch das Land gelagert und vielfache, durch mäßige Pässe verbundene Täler und Hochebenen einschließend gewährt er selbst den Menschen eine wohl geeignete Ansiedelungsstätte, und mehr noch gilt dies von dem östlich, südlich und westlich an ihn sich anschließenden Vor- und Küstenland. Zwar an der östlichen Küste dehnt sich, gegen Norden von dem Bergstock der Abruzzen geschlossen und nur von dem steilen Rücken des Garganus inselartig unterbrochen, die apulische Ebene in einförmiger Fläche mit schwach entwickelter Küsten- und Strombildung aus. An der Südküste aber zwischen den beiden Halbinseln, mit denen der Apennin endigt, lehnt sich an das innere Hügelland eine ausgedehnte Niederung, die zwar an Häfen arm, aber wasserreich und fruchtbar ist. Die Westküste endlich, ein breites, von bedeutenden Strömen, namentlich dem Tiber, durchschnittenes, von den Fluten und den einst zahlreichen Vulkanen in mannigfaltigster Tal- und Hügel-, Hafen- und Inselbildung entwickeltes Gebiet, bildet in den Landschaften Etrurien, Latium und Kampanien den Kern des italischen Landes, bis südlich von Kampanien das Vorland allmählich verschwindet und die Gebirgskette fast unmittelbar von dem Tyrrhenischen Meere bespült wird. Überdies schließt, wie an Griechenland der Peloponnes, so an Italien die Insel Sizilien sich an, die schönste und größte des Mittelmeers, deren gebirgiges und zum Teil ödes Innere ringsum, vor allem im Osten und Süden, mit einem breiten Saume des herrlichsten, großenteils vulkanischen Küstenlandes umgürtet ist; und wie geographisch die sizilischen Gebirge die kaum durch den schmalen "Riß" (Ρήγιον) der Meerenge unterbrochene Fortsetzung des Apennins sind, so ist auch geschichtlich Sizilien in älterer Zeit ebenso entschieden ein Teil Italiens wie der Peloponnes von Griechenland, der Tummelplatz derselben Stämme und der gemeinsame Sitz der gleichen höheren Gesittung. Die italische Halbinsel teilt mit der griechischen die gemäßigte Temperatur und die gesunde Luft auf den mäßig hohen Bergen und im ganzen auch in den Tälern und Ebenen. In der Küstenentwicklung steht sie ihr nach; namentlich fehlt das Inselreiche Meer, das die Hellenen zur seefahrenden Nation gemacht hat. Dagegen ist Italien dem Nachbarn überlegen durch die reichen Flußebenen und die fruchtbaren und kräuterreichen Bergabhänge, wie der Ackerbau und die Viehzucht ihrer bedarf. Es ist wie Griechenland ein schönes Land, das die Tätigkeit des Menschen anstrengt und belohnt und dem unruhigen Streben die Bahnen in die Ferne, dem ruhigen die Wege zu friedlichem Gewinn daheim in gleicher Weise eröffnet. Aber wenn die griechische Halbinsel nach Osten gewendet ist, so ist es die italische nach Westen. Wie das epirotische und akarnanische Gestade für Hellas, so sind die apulischen und messapischen Küsten für Italien von untergeordneter Bedeutung; und wenn dort diejenigen Landschaften, auf denen die geschichtliche Entwicklung ruht, Attika und Makedonien, nach Osten schauen, so sehen Etrurien, Latium und Kampanien nach Westen. So stehen die beiden so eng benachbarten und fast verschwisterten Halbinseln gleichsam voneinander abgewendet; obwohl das unbewaffnete Auge von Otranto aus die akrokeraunischen Berge erkennt, haben Italiker und Hellenen sich doch früher und enger auf jeder andern Straße berührt als auf der nächsten über das Adriatische Meer. Es war auch hier wie so oft in den Bodenverhältnissen der geschichtliche Beruf der Völker vorgezeichnet: die beiden großen Stämme, auf denen die Zivilisation der Alten Welt erwuchs, warfen ihre Schatten wie ihren Samen der eine nach Osten, der andere nach Westen.
Es ist die Geschichte Italiens, die hier erzählt werden soll, nicht die Geschichte der Stadt Rom. Wenn auch nach formalem Staatsrecht die Stadtgemeinde von Rom es war, die die Herrschaft erst über Italien, dann über die Welt gewann, so läßt sich doch dies im höheren geschichtlichen Sinne keineswegs behaupten und erscheint das, was man die Bezwingung Italiens durch die Römer zu nennen gewohnt ist, vielmehr als die Einigung zu einem Staate des gesamten Stammes der Italiker, von dem die Römer wohl der gewaltigste, aber doch nur ein Zweig sind.
Die italische Geschichte zerfällt in zwei Hauptabschnitte: in die innere Geschichte Italiens bis zu seiner Vereinigung unter der Führung des latinischen Stammes und in die Geschichte der italischen Weltherrschaft. Wir werden also darzustellen haben des italischen Volksstammes Ansiedelung auf der Halbinsel; die Gefährdung seiner nationalen und politischen Existenz und seine teilweise Unterjochung durch Völker anderer Herkunft und älterer Zivilisation, durch Griechen und Etrusker; die Auflehnung der Italiker gegen die Fremdlinge und deren Vernichtung oder Unterwerfung; endlich die Kämpfe der beiden italischen Hauptstämme, der Latiner und der Samniten, um die Hegemonie auf der Halbinsel und den Sieg der Latiner am Ende des vierten Jahrhunderts vor Christi Geburt oder des fünften der Stadt Rom. Es wird dies den Inhalt der beiden ersten Bücher bilden. Den zweiten Abschnitt eröffnen die Punischen Kriege; er umfaßt die reißend schnelle Ausdehnung des Römerreiches bis an und über Italiens natürliche Grenzen, den langen Status quo der römischen Kaiserzeit und das Zusammenstürzen des gewaltigen Reiches. Dies wird im dritten und den folgenden Büchern erzählt werden.
2. Kapitel
Die ältesten Einwanderungen in Italien
Keine Kunde, ja nicht einmal eine Sage erzählt von der ersten Einwanderung des Menschengeschlechts in Italien; vielmehr war im Altertum der Glaube allgemein, daß dort wie überall die erste Bevölkerung dem Boden selbst entsprossen sei. Indes die Entscheidung über den Ursprung der verschiedenen Rassen und deren genetische Beziehungen zu den verschiedenen Klimaten bleibt billig dem Naturforscher überlassen; geschichtlich ist es weder möglich noch wichtig festzustellen, ob die älteste bezeugte Bevölkerung eines Landes daselbst autochthon[4] oder selbst schon eingewandert ist.
Wohl aber liegt es dem Geschichtsforscher ob, die sukzessive Völkerschichtung in dem einzelnen Lande darzulegen, um die Steigerung von der unvollkommenen zu der vollkommneren Kultur und die Unterdrückung der minder kulturfähigen oder auch nur minder entwickelten Stämme durch höher stehende Nationen soweit möglich rückwärts zu verfolgen. Italien indes ist auffallend arm an Denkmälern der primitiven Epoche und steht in dieser Beziehung in einem bemerkenswerten Gegensatz zu anderen Kulturgebieten. Den Ergebnissen der deutschen Altertumsforschung zufolge muß in England, Frankreich, Norddeutschland und Skandinavien, bevor indogermanische Stämme hier sich ansässig machten, ein Volk vielleicht tschudischer Rasse gewohnt oder vielmehr gestreift haben, das von Jagd und Fischfang lebte, seine Geräte aus Stein, Ton oder Knochen verfertigte und mit Tierzähnen und Bernstein sich schmückte, des Ackerbaues aber und des Gebrauchs der Metalle unkundig war. In ähnlicher Weise ging in Indien der indogermanischen eine minder kulturfähige dunkelfarbige Bevölkerung vorauf. In Italien aber begegnen weder Trümmer einer verdrängten Nation, wie im keltisch-germanischen Gebiet die Finnen und Lappen und die schwarzen Stämme in den indischen Gebirgen sind, noch ist daselbst bis jetzt die Verlassenschaft eines verschollenen Urvolkes nachgewiesen worden, wie sie die eigentümlich gearteten Gerippe, die Mahlzeit- und Grabstätten der sogenannten Steinepoche des deutschen Altertums zu offenbaren scheinen. Es ist bisher nichts zum Vorschein gekommen, was zu der Annahme berechtigt, daß in Italien die Existenz des Menschengeschlechts älter sei als die Bebauung des Ackers und das Schmelzen der Metalle; und wenn wirklich innerhalb der Grenzen Italiens das Menschengeschlecht einmal auf der primitiven Kulturstufe gestanden hat, die wir den Zustand der Wildheit zu nennen pflegen, so ist davon doch jede Spur schlechterdings ausgelöscht.
Die Elemente der ältesten Geschichte sind die Völkerindividuen, die Stämme. Unter denen, die uns späterhin in Italien begegnen, ist von einzelnen, wie von den Hellenen, die Einwanderung, von anderen, wie von den Brettiern und den Bewohnern der sabinischen Landschaft, die Denationalisierung geschichtlich bezeugt. Nach Ausscheidung beider Gattungen bleiben eine Anzahl Stämme übrig, deren Wanderungen nicht mehr mit dem Zeugnis der Geschichte, sondern höchstens auf aprioristischem Wege sich nachweisen lassen und deren Nationalität nicht nachweislich eine durchgreifende Umgestaltung von außen her erfahren hat; diese sind es, deren nationale Individualität die Forschung zunächst festzustellen hat. Wären wir dabei einzig angewiesen auf den wirren Wust der Völkernamen und der zerrütteten, angeblich geschichtlichen Überlieferung, welche aus wenigen brauchbaren Notizen zivilisierter Reisender und einer Masse meistens geringhaltiger Sagen, gewöhnlich ohne Sinn für Sage wie für Geschichte zusammengesetzt und konventionell fixiert ist, so müßte man die Aufgabe als eine hoffnungslose abweisen. Allein noch fließt auch für uns eine Quelle der Überlieferung, welche zwar auch nur Bruchstücke, aber doch authentische gewährt; es sind dies die einheimischen Sprachen der in Italien seit unvordenklicher Zeit ansässigen Stämme. Ihnen, die mit dem Volke selbst geworden sind, war der Stempel des Werdens zu tief eingeprägt, um durch die nachfolgende Kultur gänzlich verwischt zu werden. Ist von den italischen Sprachen auch nur eine vollständig bekannt, so sind doch von mehreren anderen hinreichende Überreste erhalten, um der Geschichtsforschung für die Stammverschiedenheit oder Stammverwandtschaft und deren Grade zwischen den einzelnen Sprachen und Völkern einen Anhalt zu gewähren.
So lehrt uns die Sprachforschung drei italische Urstämme unterscheiden, den iapygischen, den etruskischen und den italischen, wie wir ihn nennen wollen, von welchen der letztere in zwei Hauptzweige sich spaltet: das latinische Idiom und dasjenige, dem die Dialekte der Umbrer, Marser, Volsker und Samniten angehören.
Von dem iapygischen Stamm haben wir nur geringe Kunde. Im äußersten Südosten Italiens, auf der messapischen oder kalabrischen Halbinsel, sind Inschriften in einer eigentümlichen verschollenen Sprache1 in ziemlicher Anzahl gefunden worden, unzweifelhaft Trümmer des Idioms der Iapyger[2], welche auch die Oberlieferung mit großer Bestimmtheit von den latinischen und samnitischen Stämmen unterscheidet; glaubwürdige Angaben und zahlreiche Spuren führen dahin, daß die gleiche Sprache und der gleiche Stamm ursprünglich auch in Apulien heimisch war. Was wir von diesem Volke jetzt wissen, genügt wohl, um dasselbe von den übrigen Italikern bestimmt zu unterscheiden, nicht aber, um positiv den Platz zu bestimmen, welcher dieser Sprache und diesem Volk in der Geschichte des Menschengeschlechts zukommt. Die Inschriften sind nicht enträtselt, und es ist kaum zu hoffen, daß dies dereinst gelingen wird. Daß der Dialekt den indogermanischen beizuzählen ist, scheinen die Genetivformen aihi und ihi entsprechend dem sanskritischen asya, dem griechischen οιο anzudeuten. Andere Kennzeichen, zum Beispiel der Gebrauch der aspirierten Konsonanten und das Vermeiden der Buchstaben m und t im Auslaut, zeigen diesen iapygischen in wesentlicher Verschiedenheit von den italischen und in einer gewissen Übereinstimmung mit den griechischen Dialekten. Die Annahme einer vorzugsweise engen Verwandtschaft der iapygischen Nation mit den Hellenen findet weitere Unterstützung in den auf den Inschriften mehrfach hervortretenden griechischen Götternamen und in der auffallenden, von der Sprödigkeit der übrigen italischen Nationen scharf abstechenden Leichtigkeit, mit der die Iapyger sich hellenisierten: Apulien, das noch in Timaeos' Zeit[3] (400 Roms, [350]) als ein barbarisches Land geschildert wird, ist im sechsten Jahrhundert der Stadt, ohne daß irgendeine unmittelbare Kolonisierung von Griechenland aus dort stattgefunden hätte, eine durchaus griechische Landschaft geworden, und selbst bei dem rohen Stamm der Messapier zeigen sich vielfache Ansätze zu einer analogen Entwicklung. Bei dieser allgemeinen Stamm- oder Wahlverwandtschaft der Iapyger mit den Hellenen, die aber doch keineswegs so weit reicht, daß man die Iapygersprache als einen rohen Dialekt des Hellenischen auffassen könnte, wird die Forschung vorläufig wenigstens stehen bleiben müssen, bis ein schärferes und besser gesichertes Ergebnis zu erreichen steht2. Die Lücke ist indes nicht sehr empfindlich; denn nur weichend und verschwindend zeigt sich uns dieser beim Beginn unserer Geschichte schon im Untergehen begriffene Volksstamm. Der wenig widerstandsfähige, leicht in andere Nationalitäten sich auflösende Charakter der iapygischen Nation paßt wohl zu der Annahme, welche durch ihre geographische Lage wahrscheinlich gemacht wird, daß dies die ältesten Einwanderer oder die historischen Autochthonen Italiens sind. Denn unzweifelhaft sind die ältesten Wanderungen der Völker alle zu Lande erfolgt; zumal die nach Italien gerichteten, dessen Küste zur See nur von kundigen Schiffern erreicht werden kann und deshalb noch in Homers Zeit den Hellenen völlig unbekannt war. Kamen aber die früheren Ansiedler über den Apennin, so kann, wie der Geolog aus der Schichtung der Gebirge ihre Entstehung erschließt, auch der Geschichtsforscher die Vermutung wagen, daß die am weitesten nach Süden geschobenen Stämme die ältesten Bewohner Italiens sein werden; und eben an dessen äußerstem südöstlichen Saume begegnen wir der iapygischen Nation.
Die Mitte der Halbinsel ist, soweit unsere zuverlässige Überlieferung zurückreicht, bewohnt von zwei Völkern oder vielmehr zwei Stämmen desselben Volkes, dessen Stellung in dem indogermanischen Volksstamm sich mit größerer Sicherheit bestimmen läßt, als dies bei der iapygischen Nation der Fall war. Wir dürfen dies Volk billig das italische heißen, da auf ihm die geschichtliche Bedeutung der Halbinsel beruht; es teilt sich in die beiden Stämme der Latiner einerseits, anderseits der Umbrer mit deren südlichen Ausläufern, den Marsern und Samniten und den schon in geschichtlicher Zeit von den Samniten ausgesandten Völkerschaften. Die sprachliche Analyse der diesen Stämmen angehörenden Idiome hat gezeigt, daß sie zusammen ein Glied sind in der indogermanischen Sprachenkette, und daß die Epoche, in der sie eine Einheit bildeten, eine verhältnismäßig späte ist. Im Lautsystem erscheint bei ihnen der eigentümliche Spirant f, worin sie übereinstimmen mit den Etruskern, aber sich scharf scheiden von allen hellenischen und hellenobarbarischen Stämmen, sowie vom Sanskrit selbst. Die Aspiraten dagegen, die von den Griechen durchaus und die härteren davon auch von den Etruskern festgehalten werden, sind den Italikern ursprünglich fremd und werden bei ihnen vertreten durch eines ihrer Elemente, sei es durch die Media, sei es durch den Hauch allein f oder h. Die feineren Hauchlaute s, w, j, die die Griechen soweit möglich beseitigen, sind in den italischen Sprachen wenig beschädigt erhalten, ja hie und da noch weiter entwickelt worden. Das Zurückziehen des Akzents und die dadurch hervorgerufene Zerstörung der Endungen haben die Italiker zwar mit einigen griechischen Stämmen und mit den Etruskern gemein, jedoch in stärkerem Grad als jene, in geringerem als diese angewandt; die unmäßige Zerrüttung der Endungen im Umbrischen ist sicher nicht in dem ursprünglichen Sprachgeist begründet, sondern spätere Verderbnis, welche sich in derselben Richtung wenngleich schwächer auch in Rom geltend gemacht hat. Kurze Vokale fallen in den italischen Sprachen deshalb im Auslaut regelmäßig, lange häufig ab; die schließenden Konsonanten sind dagegen im Lateinischen und mehr noch im Samnitischen mit Zähigkeit festgehalten worden, während das Umbrische auch diese fallen läßt. Damit hängt es zusammen, daß die Medialbildung in den italischen Sprachen nur geringe Spuren zurückgelassen hat und dafür ein eigentümliches, durch Anfügung von r gebildetes Passiv an die Stelle tritt; ferner daß der größte Teil der Tempora durch Zusammensetzungen mit den Wurzeln es und fu gebildet wird, während den Griechen neben dem Augment die reichere Ablautung den Gebrauch der Hilfszeitwörter großenteils erspart. Während die italischen Sprachen wie der äolische Dialekt auf den Dual verzichteten, haben sie den Ablativ, der den Griechen verlorenging, durchgängig, großenteils auch den Lokativ erhalten. Die strenge Logik der Italiker scheint Anstoß daran genommen zu haben, den Begriff der Mehrheit in den der Zweiheit und der Vielheit zu spalten, während man die in den Beugungen sich ausdrückenden Wortbeziehungen mit großer Schärfe festhielt. Eigentümlich italisch und selbst dem Sanskrit fremd ist die in den Gerundien und Supinen vollständiger als sonst irgendwo durchgeführte Substantivierung der Zeitwörter.
Diese aus einer reichen Fülle analoger Erscheinungen ausgewählten Beispiele genügen, um die Individualität des italischen Sprachstammes jedem anderen indogermanischen gegenüber darzutun und zeigen denselben zugleich sprachlich wie geographisch als nächsten Stammverwandten der Griechen; der Grieche und der Italiker sind Brüder, der Kelte, der Deutsche und der Slave ihnen Vettern. Die wesentliche Einheit aller italischen wie aller griechischen Dialekte und Stämme unter sich muß früh und klar den beiden großen Nationen selbst aufgegangen sein; denn wir finden in der römischen Sprache ein uraltes Wort rätselhaften Ursprungs, Graius oder Graicus, das jeden Hellenen bezeichnet, und ebenso bei den Griechen die analoge Benennung Οπικός, die von allen, den Griechen in älterer Zeit bekannten latinischen und samnitischen Stämmen, nicht aber von Iapygern oder Etruskern gebraucht wird.
Innerhalb des italischen Sprachstammes aber tritt das Lateinische wieder in einen bestimmten Gegensatz zu den umbrisch-samnitischen Dialekten. Allerdings sind von diesen nur zwei, der umbrische und der samnitische oder oskische Dialekt, einigermaßen, und auch diese nur in äußerst lückenhafter und schwankender Weise bekannt; von den übrigen Dialekten sind die einen, wie der volskische und der marsische, in zu geringen Trümmern auf uns gekommen, um sie in ihrer Individualität zu erfassen oder auch nur die Mundarten selbst mit Sicherheit und Genauigkeit zu klassifizieren, während andere, wie der sabinische, bis auf geringe, als dialektische Eigentümlichkeiten im provinzialen Latein erhaltene Spuren völlig untergegangen sind. Indes läßt die Kombination der sprachlichen und der historischen Tatsachen daran keinen Zweifel, daß diese sämtlichen Dialekte dem umbrisch-samnitischen Zweig des großen italischen Stammes angehört haben, und daß dieser, obwohl dem lateinischen Stamm weit näher als dem griechischen verwandt, doch auch wieder von ihm aufs bestimmteste sich unterscheidet. Im Fürwort und sonst häufig sagte der Samnite und der Umbrer p, wo der Römer q sprach – so pis für quis; ganz wie sich auch sonst nahverwandte Sprachen scheiden, zum Beispiel dem Keltischen in der Bretagne und Wales p, dem Gälischen und Irischen k eigen ist. In den Vokalen erscheinen die Diphthonge im Lateinischen und überhaupt den nördlichen Dialekten sehr zerstört, dagegen in den südlichen italischen Dialekten sie wenig gelitten haben; womit verwandt ist, daß in der Zusammensetzung der Römer den sonst so streng bewahrten Grundvokal abschwächt, was nicht geschieht in der verwandten Sprachengruppe. Der Genetiv der Wörter auf a ist in dieser wie bei den Griechen as, bei den Römern in der ausgebildeten Sprache ae; der der Wörter auf us im Samnitischen eis, im Umbrischen es, bei den Römern ei; der Lokativ tritt bei diesen im Sprachbewußtsein mehr und mehr zurück, während er in den andern italischen Dialekten in vollem Gebrauch blieb; der Dativ des Plural auf bus ist nur im Lateinischen vorhanden. Der umbrisch-samnitische Infinitiv auf um ist den Römern fremd, während das oskisch-umbrische, von der Wurzel es gebildete Futur nach griechischer Art (her-est wie λέγ-σω) bei den Römern fast, vielleicht ganz verschollen und ersetzt ist durch den Optativ des einfachen Zeitworts oder durch analoge Bildungen von fuo (ama-bo). In vielen dieser Fälle, zum Beispiel in den Kasusformen, sind die Unterschiede indes nur vorhanden für die beiderseits ausgebildeten Sprachen, während die Anfänge zusammenfallen. Wenn also die italische Sprache neben der griechischen selbständig steht, so verhält sich innerhalb jener die lateinische Mundart zu der umbrisch-samnitischen etwa wie die ionische zur dorischen, während sich die Verschiedenheiten des Oskischen und des Umbrischen und der verwandten Dialekte etwa vergleichen lassen mit denen des Dorismus in Sizilien und in Sparta.
Jede dieser Spracherscheinungen ist Ergebnis und Zeugnis eines historischen Ereignisses. Es läßt sich daraus mit vollkommener Sicherheit erschließen, daß aus dem gemeinschaftlichen Mutterschoß der Völker und der Sprachen ein Stamm ausschied, der die Ahnen der Griechen und der Italiker gemeinschaftlich in sich schloß; daß aus diesem alsdann die Italiker sich abzweigten und diese wieder in den westlichen und östlichen Stamm, der östliche noch später in Umbrer und Osker auseinander gingen.
Wo und wann diese Scheidungen stattfanden, kann freilich die Sprache nicht lehren, und kaum darf der verwegene Gedanke es versuchen, diesen Revolutionen ahnend zu folgen, von denen die frühesten unzweifelhaft lange vor derjenigen Einwanderung stattfanden, welche die Stammväter der Italiker über die Apenninen führte. Dagegen kann die Vergleichung der Sprachen, richtig und vorsichtig behandelt, von demjenigen Kulturgrade, auf dem das Volk sich befand, als jene Trennungen eintraten, ein annäherndes Bild und damit uns die Anfänge der Geschichte gewähren, welche nichts ist als die Entwicklung der Zivilisation. Denn es ist namentlich in der Bildungsepoche die Sprache das treue Bild und Organ der erreichten Kulturstufe; die großen technischen und sittlichen Revolutionen sind darin wie in einem Archiv aufbewahrt, aus dessen Akten die Zukunft nicht versäumen wird, für jene Zeiten zu schöpfen, aus welchen alle unmittelbare Überlieferung verstummt ist.
Während die jetzt getrennten indogermanischen Völker einen gleichsprachigen Stamm bildeten, erreichten sie einen gewissen Kulturgrad und einen diesem angemessenen Wortschatz, den als gemeinsame Ausstattung in konventionell festgestelltem Gebrauch alle Einzelvölker übernahmen, um auf der gegebenen Grundlage selbständig weiter zu bauen. Wir finden in diesem Wortschatz nicht bloß die einfachsten Bezeichnungen des Seins, der Tätigkeiten, der Wahrnehmungen wie sum, do, pater, das heißt den ursprünglichen Widerhall des Eindrucks, den die Außenwelt auf die Brust des Menschen macht, sondern auch eine Anzahl Kulturwörter nicht bloß ihren Wurzeln nach, sondern in einer gewohnheitsmäßig ausgeprägten Form, welche Gemeingut des indogermanischen Stammes und weder aus gleichmäßiger Entfaltung noch aus späterer Entlehnung erklärbar sind. So besitzen wir Zeugnisse für die Entwicklung des Hirtenlebens in jener fernen Epoche in den unabänderlich fixierten Namen der zahmen Tiere: sanskritisch gâus ist lateinisch bos, griechisch βούς; sanskritisch avis ist lateinisch ovis, griechisch όις; sanskritisch açvas, lateinisch equus, griechisch ίππος; sanskritisch hansas, lateinisch anser, griechisch χήν; sanskritisch âtis, griechisch νήσσα, lateinisch anas; ebenso sind pecus, sus, porcus, taurus, canis sanskritische Wörter. Also schon in dieser fernsten Epoche hatte der Stamm, auf dem von den Tagen Homers bis auf unsere Zeit die geistige Entwicklung der Menschheit beruht, den niedrigsten Kulturgrad der Zivilisation, die Jäger- und Fischerepoche, überschritten und war zu einer wenigstens relativen Stetigkeit der Wohnsitze gelangt. Dagegen fehlt es bis jetzt an sicheren Beweisen dafür, daß schon damals der Acker gebaut worden ist. Die Sprache spricht eher dagegen als dafür. Unter den lateinisch-griechischen Getreidenamen kehrt keiner wieder im Sanskrit mit einziger Ausnahme von ζέα, das sprachlich dem sanskritischen yavas entspricht, übrigens im Indischen die Gerste, im Griechischen den Spelt bezeichnet. Es muß nun freilich zugegeben werden, daß diese von der wesentlichen Übereinstimmung der Benennungen der Haustiere so scharf abstechende Verschiedenheit in den Namen der Kulturpflanzen eine ursprüngliche Gemeinschaft des Ackerbaues noch nicht unbedingt ausschließt; in primitiven Verhältnissen ist die Übersiedelung und Akklimatisierung der Pflanzen schwieriger als die der Tiere, und der Reisbau der Inder, der Weizen- und Speltbau der Griechen und Römer, der Roggen- und Haferbau der Germanen und Kelten könnten an sich wohl alle auf einen gemeinschaftlichen ursprünglichen Feldbau zurückgehen. Aber auf der andern Seite ist die den Griechen und Indern gemeinschaftliche Benennung einer Halmfrucht doch höchstens ein Beweis dafür, daß man vor der Scheidung der Stämme die in Mesopotamien wildwachsenden Gersten- und Speltkörner3 sammelte und aß, nicht aber dafür, daß man schon Getreide baute. Wenn sich hier nach keiner Seite hin eine Entscheidung ergibt, so führt dagegen etwas weiter die Beobachtung, daß eine Anzahl der wichtigsten hier einschlagenden Kulturwörter im Sanskrit zwar auch, aber durchgängig in allgemeinerer Bedeutung vorkommen: agras ist bei den Indern überhaupt Flur, kûrnu ist das Zerriebene, aritram ist Ruder und Schiff, venas das Anmutige überhaupt, namentlich der anmutende Trank. Die Wörter also sind uralt; aber ihre bestimmte Beziehung auf die Ackerflur (ager), auf das zu mahlende Getreide (granum, Korn), auf das Werkzeug, das den Boden furcht wie das Schiff die Meeresfläche (aratrum), auf den Saft der Weintraube (vinum) war bei der ältesten Teilung der Stämme noch nicht entwickelt; es kann daher auch nicht wundernehmen, wenn die Beziehungen zum Teil sehr verschieden ausfielen und zum Beispiel von dem sanskritischen kûrnu sowohl das zum Zerreiben bestimmte Korn als auch die zerreibende Mühle, gotisch quairnus, litauisch girnôs ihre Namen empfingen. Wir dürfen darnach als wahrscheinlich annehmen, daß das indogermanische Urvolk den Ackerbau noch nicht kannte, und als gewiß, daß, wenn es ihn kannte, er doch noch in der Volkswirtschaft eine durchaus untergeordnete Rolle spielte; denn wäre er damals schon gewesen, was er später den Griechen und Römern war, so hätte er tiefer der Sprache sich eingeprägt, als es geschehen ist.
Dagegen zeugen für den Häuser- und Hüttenbau der Indogermanen sanskritisch dam(as), lateinisch domus, griechisch δόμος; sanskritisch vêças, lateinisch vicus, griechisch οίκος; sanskritisch dvaras, lateinisch fores, griechisch θύρα; ferner für den Bau von Ruderbooten die Namen des Nachens – sanskritisch nâus, griechisch ναύς, lateinisch navis – und des Ruders – sanskritisch aritram, griechisch ερετμός, lateinisch remus, tri-res-mis; für den Gebrauch der Wagen und die Bändigung der Tiere zum Ziehen und Fahren sanskritisch akshas (Achse und Karren), lateinisch axis, griechisch άξων, αμ-αξα; sanskritisch iugam, lateinisch iugum, griechisch ζυγόν. Auch die Benennungen des Kleides – sanskritisch vastra, lateinisch vestis, griechisch εςθής – und des Nähens und Spinnens – sanskritisch siv, lateinisch suo; sanskritisch nah, lateinisch neo, griechisch νήθω – sind in allen indogermanischen Sprachen die gleichen. Von der höheren Kunst des Webens läßt dies dagegen nicht in gleicher Weise sich sagen4. Dagegen ist wieder die Kunde von der Benutzung des Feuers zur Speisenbereitung und des Salzes zur Würzung derselben uraltes Erbgut der indogermanischen Nationen und das gleiche gilt sogar von der Kenntnis der ältesten zum Werkzeug und zum Zierat von dem Menschen verwandten Metalle. Wenigstens vom Kupfer (aes) und Silber (argentum), vielleicht auch vom Gold kehren die Namen wieder im Sanskrit, und diese Namen sind doch schwerlich entstanden, bevor man gelernt hatte, die Erze zu scheiden und zu verwenden; wie denn auch sanskritisch asis, lateinisch ensis auf den uralten Gebrauch metallener Waffen hinleitet.
Nicht minder reichen in diese Zeiten die Fundamentalgedanken zurück, auf denen die Entwicklung aller indogermanischen Staaten am letzten Ende beruht: die Stellung von Mann und Weib zueinander, die Geschlechtsordnung, das Priestertum des Hausvaters und die Abwesenheit eines eigenen Priesterstandes sowie überhaupt einer jeden Kastensonderung, die Sklaverei als rechtliche Institution, die Rechtstage der Gemeinde bei Neumond und Vollmond. Dagegen die positive Ordnung des Gemeinwesens, die Entscheidung zwischen Königtum und Gemeindeherrlichkeit, zwischen erblicher Bevorzugung der Königs- und Adelsgeschlechter und unbedingter Rechtsgleichheit der Bürger gehört überall einer späteren Zeit an. Selbst die Elemente der Wissenschaft und der Religion zeigen Spuren ursprünglicher Gemeinschaft.
Die Zahlen sind dieselben bis hundert (sanskritisch çatam, ékaçatam, lateinisch centum, griechisch ε-κατόν, gotisch hund); der Mond heißt in allen Sprachen davon, daß man nach ihm die Zeit mißt (mensis). Wie der Begriff der Gottheit selbst (sanskritisch devas, lateinisch deus, griechisch θεός) gehören zum gemeinen Gut der Völker auch manche der ältesten Religionsvorstellungen und Naturbilder. Die Auffassung zum Beispiel des Himmels als des Vaters, der Erde als der Mutter der Wesen, die Festzüge der Götter, die in eigenen Wagen auf sorgsam gebahnten Gleisen von einem Orte zum andern ziehen, die schattenhafte Fortdauer der Seele nach dem Tode sind Grundgedanken der indischen wie der griechischen und römischen Götterlehre. Selbst einzelne der Götter vom Ganges stimmen mit den am Ilissos und am Tiber verehrten bis auf die Namen überein – so ist der Uranos der Griechen der Varunas, so der Zeus, Jovis pater, Diespiter der Djâus pitâ der Veden. Auf manche rätselhafte Gestalt der hellenischen Mythologie ist durch die neuesten Forschungen über die ältere indische Götterlehre ein ungeahntes Licht gefallen. Die altersgrauen geheimnisvollen Gestalten der Erinnyen sind nicht hellenisches Gedicht, sondern schon mit den ältesten Ansiedlern aus dem Osten eingewandert. Das göttliche Windspiel Saramâ, das dem Herrn des Himmels die goldene Herde der Sterne und Sonnenstrahlen behütet und ihm die Himmelskühe, die nährenden Regenwolken zum Melken zusammentreibt, das aber auch die frommen Toten treulich in die Welt der Seligen geleitet, ist den Griechen zu dem Sohn der Saramâ, dem Saramêyas oder Hermeias geworden, und die rätselhafte, ohne Zweifel auch mit der römischen Cacussage zusammenhängende hellenische Erzählung von dem Raub der Rinder des Helios erscheint nun als ein letzter unverstandener Nachklang jener alten sinnvollen Naturphantasie.
Wenn die Aufgabe, den Kulturgrad zu bestimmen, den die Indogermanen vor der Scheidung der Stämme erreichten, mehr der allgemeinen Geschichte der alten Welt angehört, so ist es dagegen speziell Aufgabe der italischen Geschichte, zu ermitteln, soweit es möglich ist, auf welchem Stande die graecoitalische Nation sich befand, als Hellenen und Italiker sich voneinander schieden. Es ist dies keine überflüssige Arbeit; wir gewinnen damit den Anfangspunkt der italischen Zivilisation, den Ausgangspunkt der nationalen Geschichte.
Alle Spuren deuten dahin, daß, während die Indogermanen wahrscheinlich ein Hirtenleben führten und nur etwa die wilde Halmfrucht kannten, die Graecoitaliker ein korn-, vielleicht sogar schon ein weinbauendes Volk waren. Dafür zeugt nicht gerade die Gemeinschaft des Ackerbaues selbst, die im ganzen noch keineswegs einen Schluß auf alle Völkergemeinschaft rechtfertigt. Ein geschichtlicher Zusammenhang des indogermanischen Ackerbaus mit dem der chinesischen, aramäischen und ägyptischen Stämme wird schwerlich in Abrede gestellt werden können; und doch sind diese Stämme den Indogermanen entweder stammfremd oder doch zu einer Zeit von ihnen getrennt worden, wo es sicher noch keinen Feldbau gab. Vielmehr haben die höher stehenden Stämme vor alters wie heutzutage die Kulturgeräte und Kulturpflanzen beständig getauscht; und wenn die Annalen von China den chinesischen Ackerbau auf die unter einem bestimmten König in einem bestimmten Jahr stattgefundene Einführung von fünf Getreidearten zurückführen, so zeichnet diese Erzählung im allgemeinen wenigstens die Verhältnisse der ältesten Kulturepoche ohne Zweifel richtig. Gemeinschaft des Ackerbaus wie Gemeinschaft des Alphabets, der Streitwagen, des Purpurs und andern Geräts und Schmuckes gestattet weit öfter einen Schluß auf alten Völkerverkehr als auf ursprüngliche Volkseinheit. Aber was die Griechen und Italiker anlangt, so darf bei den verhältnismäßig wohlbekannten Beziehungen dieser beiden Nationen zueinander die Annahme, daß der Ackerbau, wie Schrift und Münze, erst durch die Hellenen nach Italien gekommen sei, als völlig unzulässig bezeichnet werden. Anderseits zeugt für den engsten Zusammenhang des beiderseitigen Feldbaus die Gemeinschaftlichkeit aller ältesten hierher gehörigen Ausdrücke: ager αγρός, aro aratrum αρόω άροτρον, ligo neben λαχαίνω, hortus χόρτος, hordeum κριθή, milium μελίνη, rapa ραφανίς, malva μαλάχη, vinum οίνος, und ebenso das Zusammentreffen des griechischen und italischen Ackerbaus in der Form des Pfluges, der auf altattischen und römischen Denkmälern ganz gleich gebildet vorkommt, in der Wahl der ältesten Kornarten: Hirse, Gerste, Spelt, in dem Gebrauch, die Ähren mit der Sichel zu schneiden und sie auf der glattgestampften Tenne durch das Vieh austreten zu lassen, endlich in der Bereitungsart des Getreides: puls πόλτος, pinso πτίσσω, mola μύλη, denn das Backen ist jüngeren Ursprungs, und wird auch deshalb im römischen Ritual statt des Brotes stets der Teig oder Brei gebraucht. Daß auch der Weinbau in Italien über die älteste griechische Einwanderung hinausgeht, dafür spricht die Benennung "Weinland" (Οινοτρία), die bis zu den ältesten griechischen Anländern hinaufzureichen scheint. Danach muß der Übergang vom Hirtenleben zum Ackerbau oder, genauer gesprochen, die Verbindung des Feldbaus mit der älteren Weidewirtschaft stattgefunden haben, nachdem die Inder aus dem Mutterschoß der Nationen ausgeschieden waren, aber bevor die Hellenen und die Italiker ihre alte Gemeinsamkeit aufhoben. Übrigens scheinen, als der Ackerbau aufkam, die Hellenen und Italiker nicht bloß unter sich, sondern auch noch mit anderen Gliedern der großen Familie zu einem Volksganzen verbunden gewesen zu sein; wenigstens ist es Tatsache, daß die wichtigsten jener Kulturwörter zwar den asiatischen Gliedern der indogermanischen Völkerfamilien fremd, aber den Römern und Griechen mit den keltischen sowohl als mit den deutschen, slawischen, lettischen Stämmen gemeinsam sind5, 6





























