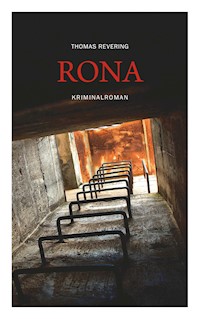
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Bankangestellte Hans-Jörg Calma ist fassungslos: Ein anonymer Anrufer fordert ihn auf, einen ehemaligen Freund Calmas zu töten, der wegen Unfallflucht mit Todesfolge im Gefängnis sitzt. Wenn Calma versagt, so droht der Erpresser, werde er sechs Menschen töten und, so leid es ihm tue, auch Calma selbst. Als Kommissar Rothenburg davon erfährt, muss er feststellen, dass der Anrufer mit dem Morden schon angefangen hat. Während Calma das Problem auf eigene Faust lösen will, wagt Rothenburg ein höchst riskantes Spiel. "Rona" ist der zweite Fall des Münsteraner Kommissars Nikolaus Rothenburg. Seinen ersten Fall "Blinder Fisch" hat er bereits 2013 gelöst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Revering wurde 1964 in Münster/Westfalen geboren. Nach dem Studium der Neueren Geschichte und Politikwissenschaften arbeitete er als Lektor und Redakteur in Berlin, Bonn und Hamburg. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg und freut sich über jedes Tor des 1. FC Köln.
„Rona“ ist der zweite Fall für den Münsteraner Kommissar Nikolaus Rothenburg. Den ersten Fall „Blinder Fisch“ (Emons-Verlag, Köln 2013) löste er bereits vor einigen Jahren.
„Wenn Bitterkeit im Herzen ist, wird Zucker im Mund kein Leben süßer machen.“
(Israelisches Sprichwort)
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Teil 2
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 32
Prolog
Woensdrecht/Niederlande, Juni 1982
Er hatte es niemals für möglich gehalten, dass man 25 000 Menschen auf einmal verachten konnte.
Man konnte die Nachbarin von gegenüber verachten, die nur noch mit einer Sonnenblume im Haar und lilafarbenen Pumphosen mit Blümchenmuster aus dem Haus ging. Oder beispielsweise den tumben Jan Klaasen, der ein eingefleischter Fan von Feyenoord Rotterdam war und morgens um sieben Uhr Hassgesänge auf Ajax Amsterdam brüllte. Oder, obwohl süß anzuschauen, die kleine Lotte aus dem Erdgeschoss, die wegen jeder kleinsten Fliege ein kreischendes Heulkonzert veranstaltete.
Aber 25 000 Menschen, von denen er vermutlich 24 900 noch nicht einmal kannte? Wie konnte das sein?
Er war nicht nur in seiner Abschlussklasse dafür bekannt, dass er sich aus allem heraushielt und dass er noch nie gegen irgendetwas demonstriert hatte. Nicht gegen Sparpläne der Regierung, nicht gegen den Bau von Umgehungsstraßen durch Naturschutzgebiete und schon gar nicht gegen den NATO-Doppelbeschluss. Es würde ihn also keiner erkennen auf dem Sportgelände von Woensdrecht, wo sich wieder die Massen versammelt hatten, um gegen die Stationierung von amerikanischen Cruise Missiles auf dem nahegelegenen Flugplatz zu demonstrieren. Dennoch, jedes Mal, wenn er glaubte seinen Namen zu hören, zuckte er zusammen und schnürte die Kapuze seines dunklen Parkas noch enger um das Gesicht.
Tagelanger Regen und Tausende von Füßen hatten das Gelände in eine einzige Matschlandschaft verwandelt. Gesunder Rasen war nicht mehr zu erkennen, kleine Reststücke im Morast glichen armseligen grünen Oasen, die nur darauf warteten, von erbarmungslosen Gummistiefeln zertreten und in den Matsch gestampft zu werden. Zwischen tiefen Pfützen und von den Organisatoren eilig herbeigeschafften Holzplanken stapelten sich leere Bierbecher, Dosen und ketchupbeschmierte Frittenschalen. Hilflose Ordner zählten einen statistischen Durchschnittswert von 1,4 Alkoholleichen pro 50 Quadratmetern. Von der Bühne am Ende des Fußballplatzes dröhnte die Musik so laut, dass sogar noch Anwohner in dem 25 Kilometer entfernten Roosendaal das Wummern der Bässe spüren konnten.
Kurzum: Wer es nicht besser wusste, hätte meinen können, er befände sich auf einem Rockkonzert, Untergattung Heavy Metal. Aber die 25 000 Menschen hatten sich versammelt, um ein Fest zu feiern für den Frieden, mit Bier von Heineken, Musik von Van Halen und Reden von prominenten deutschen Grünen.
In dieser Reihenfolge, wohlgemerkt.
Ihm selbst waren die Raketen scheißegal. Und er war fest davon überzeugt, dass diese Einstellung für mindestens die Hälfte der anwesenden Leute galt. Brauchte man sonst so viele Bierwagen? Ihnen kam es doch mehr darauf an, in der Anonymität der Masse mal wieder richtig die Sau rauszulassen, ohne hinterher aufräumen zu müssen. Bier trinken, kiffen, Musik hören, mit der Freundin knutschen oder mit der Freundin von der Freundin, egal, linke Parolen kreischen – eben ein bisschen Woodstock in der niederländischen Provinz.
Aber diese Einstellung war es gar nicht, warum er die Menge verachtete. Er verachtete sie, weil ihr etwas gehörte, das er gerne besessen hätte.
Der Regen prasselte unablässig auf die Menschenmenge nieder. Er beschloss, eine Portion Fritten zu kaufen, und watete durch den Schlamm zur nächsten Bude. Etwas Gutes hatten diese vielen Irren hier ja an sich, dachte er und lächelte vor sich hin. Die Leute waren teilweise so schrill und skurril bekleidet, dass er mit seiner schützenden Sonnenbrille nicht auffiel, obwohl die Sonne seit vier Tagen nicht gesehen worden war. Seine schweren Armeestiefel, die er als heimlichen persönlichen Protest gegen die Demonstration angezogen hatte, blieben bei jedem Schritt im tiefen Matsch stecken. Laut fluchend suchte er den Weg durch die bunten Gestalten hindurch zu seinen Pommes. Als er endlich vor der Frittenbude stand, stellte er genervt fest, dass er sich an einer langen Schlange würde anstellen müssen.
Er wischte sich den Regen aus dem Gesicht und ging rechts um den Wagen herum zum Bauzaun, der das Gelände eingrenzte. Die Gitter waren die einzige Möglichkeit, sich einmal anzulehnen und die Beine zu entlasten, es sei denn, man setzte sich einfach in den Schlamm. Der Zaun gab etwas nach, als er sich anlehnte, aber er spürte, wie gut es seinen Beinen tat. Er war eben kein Sportler und seine dünnen Beine mussten einen langen, schlaksigen Körper tragen. Er drehte den Kopf nach rechts und warf einen gelangweilten Blick auf die Szene, die sich fünf Meter neben ihm abspielte.
In einer Nische zwischen Bauzaun und einem Bauwagen sah er einen völlig besoffenen, nackten und vom Schlamm besudelten Mann, der verzweifelt versuchte, sich mit einer Hand am Zaun festzuhalten und zu pinkeln. Seine Hand rutschte andauernd vom Gitter ab, was dazu führte, dass er mit seinem Kopf gegen den Zaun fiel und Mühe hatte, sich auf den Beinen zu halten.
Er grinste boshaft und überlegte, ob er etwas tun sollte. Normalerweise würde man sich jetzt diskret verdrücken oder wenigstens nicht hinschauen, aber er hatte plötzlich Lust bekommen, diesem typischen Mitglied der friedensliebenden Protestmeute eins auszuwischen, seiner Verachtung sozusagen ein Gesicht zu geben. Eine günstigere Gelegenheit würde sich ihm so schnell nicht bieten. Wahrscheinlich hatte der Friedensfreak es gerade einer Schlampe besorgt, vermutlich Betje Koenen, der selbsternannten Petra Kelly von Woensdrecht, die noch keinen halbwegs gutgebauten Mann zwischen 16 und 45 ausgelassen hatte. Mit etwas Glück war sie sogar noch in der Nähe, und man könnte ja lässig fragen, ob man auch mal ran dürfte, es war ja schließlich so eine Art Woodstock hier. Hübsch war Betje ja, sie durfte bloß nicht den Mund aufmachen.
Er verbarg sich hinter einem dicken Metallpfosten, schielte vorsichtig nach rechts und beobachtete den Mann weiter. Ihm wurde schnell klar, dass er sich gar nicht verstecken musste. Der Kerl war so sternhagelvoll, dass er es nicht einmal schaffte, seinen Schwanz ordentlich festzuhalten, so dass ihm der stinkende und dampfende Urin über seine Beine lief und eine dünne Spur durch den Schlamm zog. Der Regen und der ohrenbetäubende Lärm der Musik raubten ihm wohl noch zusätzlich die Sinne, wenn sie denn nicht sowieso schon komplett ausgefallen waren. Sein Blick fiel auf den schlammfreien Hals des Mannes.
Er erstarrte. Nein, das durfte nicht wahr sein.
Doch, das war er! Ein Traum!
Er schüttelte den Kopf und schaute noch einmal genau hin. Nein, es gab keinen Zweifel, er war es! So ein Tattoo gab es kein zweites Mal. Seine allgemeine Verachtung schlug augenblicklich in blanken, persönlichen Hass um. Jetzt hatte er ihn, dieses Schwein, der sich genommen hatte, was eigentlich ihm gehörte.
Er rieb sich heftig den Regen aus dem Gesicht und überlegte fieberhaft. Fünf Meter neben ihm war eine der dicken Flutlichtsäulen, rasch drehte er sich um und verschwand dahinter. Er japste vor Aufregung und sah sich suchend auf dem Boden um. Irgendwo hier musste doch das liegen, was er jetzt brauchte. Aber er sah nur Schlamm und Dreck. Und dann den Stein.
Er hob ihn auf und betrachtete ihn nachdenklich. Er war so groß wie ein Pflasterstein, hatte an einer Seite aber eine spitze Kante, die etwa fünf Zentimeter hervorstand. Perfekt, dachte er. Jetzt musste er nur noch auf den richtigen Augenblick warten. Er schielte um den Mast. Wieder perfekt: Der Typ zog gerade eine Unterhose aus dem Dreck und versuchte sie anzuziehen. In den nächsten Sekunden oder besser Minuten würde der Friedensaktivist keine Hand frei haben, um sich zu wehren, wobei er bezweifelte, dass der Kerl auch mit vier Händen dazu noch in der Lage gewesen wäre.
Er sah sich kurz um und vergewisserte sich, dass sich niemand für ihn und sein Vorhaben interessierte. Dann schnellte er hinter dem Mast hervor, war mit vier Schritten bei dem Typen und zog ihm den Stein mit aller Kraft von hinten über den Schädel.
Der Mann sackte ohne einen Laut zusammen und fiel mit dem Gesicht nach vorne in den schwarzen Matsch. Aus seinem Hinterkopf spritzte eine Fontäne aus Blut und Hirnwasser in den Morast. Er zog den Stein durch eine Pfütze, rubbelte ihn mit nassem Sand ab und warf ihn über den Bauzaun in einen Müllcontainer. Mit seinen Armeestiefeln schaufelte er so viel Schlamm über den leblosen Körper, dass er nach einer Weile vollständig bedeckt war. Zufrieden schaute er auf das Grab für den Mann, den er gehasst hatte. Den er getötet hatte, weil er sich genommen hatte, was ihm nicht gehörte. Jetzt hatte er die Quittung dafür bekommen.
Er legte seine ganze Verachtung in seinen Gesichtsausdruck und spuckte auf den kleinen Erdhügel. Für den hier unten war das Leben vorbei. Für ihn selbst würde es jetzt erst beginnen. Er wusste jetzt, wohin seine Reise gehen würde.
Dann stellte er sich ruhig in die Schlange und kaufte Fritten mit Ketchup.
TEIL 1
1
Münster, Juni 2010
Ich will, dass er stirbt, dachte Marie.
Dass er elendig verreckt.
Sie nahm den kleinen Bilderrahmen aus dem Regal und starrte mit leeren Augen auf das Foto. Sie wusste nicht, wie oft sie das Bild schon in die Hand genommen hatte, sie wusste nur, dass es der einzige Sinn ihres neuen Lebens war, es zu betrachten, immer und immer wieder. Das überflüssige, traurige Leben, das vor einem Jahr begonnen hatte. Das wertlose, triste Leben ohne Rona, ihre kleine, über alles geliebte Tochter.
Warum sie, und warum nicht er?, überlegte sie zum vierten Mal, seit sie vor einer Stunde den Frühstückstisch abgeräumt hatte. Er hatte ihr Leben zerstört, von einer Sekunde auf die andere. Dafür saß er jetzt gemütlich im Knast, nur noch lächerliche vier Jahre, las Bücher, schaute Fernsehen und soff munter weiter. Irgendwann würde er wieder frei und eine Bedrohung für jemand anderen sein. So war das Leben draußen, sie wollte nichts mehr damit zu tun haben bis, … ja, bis es ihn endlich erwischte. Auf diesen Tag wartete sie. Was sollte sie auch sonst tun?
Rona war ein aufgewecktes, lebenslustiges Mädchen gewesen, ihr Lachen riss alle Umstehenden mit. Ihre schwarze Kinderbrille hatte ihr einen schon fast altklugen Zug verliehen, obwohl sie nie großspurig oder allwissend aufgetreten war. Sie liebte Jahrmärkte und Vergnügungsparks wie das Legoland im dänischen Billund, wo das Foto aus dem Bilderrahmen entstanden war. Es zeigte Marie und Rona, wie sie zusammen in einem Kanu eine Wasserrutsche hinunterschossen, ihre Hände nach oben gerissen und den Mund vor Lachen weit aufgesperrt.
Die pure Lebensfreude, Mutter und Tochter im Glück vereint. So hatte Marie sich die letzte Reise vor Ronas Einschulung vorgestellt, eine fröhliche Reise an die Nordsee, die nicht schöner sein konnte und schließlich in der Katastrophe endete.
Eine automatische Kamera hatte das Foto geschossen, Nummer 234 an der Kasse. Rona war die Aufnahme ein wenig peinlich gewesen, aber Marie hätte ein ganzes Monatsgehalt ihres Jobs als Friseurin für das Foto gegeben. Umgerechnet drei Euro genügten aber.
Marie stand vor dem Regal und wünschte sich ihre Tränen zurück. Sie wollte wieder um ihre tote Tochter weinen können, so wie es doch alle Mütter machen, aber irgendwann im Frühjahr war die Tränenquelle ausgetrocknet. Einfach so, ohne besonderen Anlass. Vielleicht war das der Moment gewesen, als in ihr der Wunsch keimte, dass er sterben solle. Sie wusste es nicht mehr, es war ihr auch egal.
Ich will, dass er stirbt.
Sie ging in Ronas altes Zimmer. Nichts hatte sie verändert, sogar eine halb mit Wasser gefüllte Trinkflasche stand noch an ihrem Bett. Marie holte tief Luft und krallte ihre Fingernägel so tief in die Handflächen, dass es schmerzte. Die Tür des Kleiderschranks war halb offen, sie holte ein T-Shirt heraus und roch daran. Obwohl es gewaschen war, konnte sie Ronas süßlich kindlichen Geruch deutlich wahrnehmen. Sie vergrub ihr Gesicht in dem Stück Stoff und atmete den Duft tief ein. Noch vor ein paar Wochen hätte sie in diesem Moment vor Schmerz geschrien und getobt, hätte ihrem neuen Lebensgefährten erst auf die Brust getrommelt und ihn dann weggestoßen. Sie wäre mit einem kreischenden Gebrüll wieder auf den Flur gelaufen und hätte sich bäuchlings auf ihr Bett geworfen, nachdem sie die Schlafzimmertür mit einem lauten Knall zugeschmissen hätte.
Doch jetzt war sie ruhig, und Lars war zur Arbeit. Zum Glück, wie Marie fand. Wenn er nicht so oft fort wäre, könnte sie sich eine Beziehung auch nicht vorstellen. Sie brauchte die Ruhe, um zu trauern, um sich zu erinnern an den einzigen Menschen, den sie je geliebt hatte. Rona würde immer den ersten Platz in ihrem Leben behalten, das war klar. Wer ihr zerbrochenes Herz erobern wollte, musste sich auf ewig mit Platz zwei begnügen. Wie Lars.
Lars Wilkens wusste von Anfang an, auf welches Drama er sich einlassen würde, als er für sich entschied, mit Marie zu leben. Er hatte ihr Auto repariert, einen alten VW-Polo, der fast mehr Öl als Benzin verbrauchte. Der Abschleppdienst hatte das Auto nach dem Unfall zu seiner Werkstatt gefahren, aber Marie war erst drei Wochen nach Ronas Beerdigung dort aufgetaucht. Sie hatte wortlos die Rechnung bezahlt und ihn gebeten, den Wagen zu ihr nach Hause zu fahren und dann den Verkauf abzuwickeln. Für nichts in der Welt hätte sie sich noch einmal in dieses Unglücksauto hineingesetzt.
Lars Wilkens war gekommen – und geblieben. Noch am selben Abend stand er frisch geduscht und in lässigen Jeans vor ihrer Haustür, den Autoschlüssel und eine Flasche Rotwein in der Hand, einen Kaufvertrag für den Polo und eine CD von Portishead in der Tasche. Marie schien nicht sonderlich erstaunt und schaffte es zum ersten Mal seit Ronas Tod, beim Anblick eines anderen Menschen nicht sofort loszuheulen. Sie hatten sich stundenlang am Esstisch gegenübergesessen und wenig geredet, Musik gehört, getrunken. So lange, bis Lars’ Rückenschmerzen so schlimm wurden, dass er sich entschuldigte und einen Spaziergang durch die Wohnung unternahm. Er hatte Marie gebeten, Ronas Zimmer sehen zu dürfen, und zu ihrer Überraschung hatte sie ohne Zögern eingewilligt. Sie hatte weiter am Esstisch gesessen, den Blick starr auf das Rotweinglas gerichtet. Als Lars nach einer halbe Stunde wieder in die Küche kam, war sie am Tisch eingeschlafen, den Kopf auf einen Arm abgelegt, das leere Glas noch fest mit einer Hand umschlossen. Er hatte sie in ihr Schlafzimmer getragen und zugedeckt, bekleidet wie sie war. Dann ging er ins Gästezimmer, zog sich Jeans und Strümpfe aus, schrieb eine SMS an die Werkstatt und legte sich ins Bett.
Marie wusste genau: Wenn diese Geschichte auch nur einen Funken anders abgelaufen wäre, würde Lars heute immer noch in seiner Bruchbude in Coerde hausen, sich jeden Abend eine Pizza reinziehen und gegen 21 Uhr auf ein Bier in seine Eckkneipe gehen, wie schon die zehn Jahre zuvor. Sie hatte sich gewundert, dass er so durchtrainiert war und auch durchaus kluge Dinge sagen konnte, nicht hochtrabend und unverständlich, sondern beruhigend, fragend und aufmunternd. Was sie an ihm aber am meisten schätzte, war sein Schweigen. Kein desinteressiertes oder hilfloses Schweigen wie bei Clemens, ihrem Ex-Mann, sondern die außerordentliche und seltene Fähigkeit, im richtigen Moment einfach mal die Klappe zu halten. Dafür mochte sie ihn und darum hatte sie ihn schließlich gebeten, zu ihr zu ziehen.
Marie legte das T-Shirt wieder zurück in den Schrank und strich es glatt, ein gelbes Shirt mit einer keck schauenden Wassernixe. Meine kleine Nixe Rona, dachte sie und musste schlucken. Okay, es war wieder genug für den Moment, sie merkte, dass sie dringend frische Luft brauchte, die Erinnerung schnürte ihr die Kehle zu.
Von draußen war Kindergeschrei zu hören. Als sie das Fenster öffnete, um den frischen Wind hereinzulassen, schlug ihr eine Welle fröhlichen Geplappers entgegen. Um diese Uhrzeit war der Spielplatz des Südparks stets von den Kitas der Umgebung besucht, wenn, wie heute, die Sonne schien. Die Örtlichkeit war ideal: kaum einsehbar, weit weg vom Autoverkehr, und sowohl der Sandkasten als auch die Bänke für die Erzieherinnen lagen im Schatten.
Ein blondes Mädchen rannte von der Kinderhorde weg über die Wiese in ihre Richtung, blickte zu ihr herauf und lächelte. Marie kannte sie gut, Pauline Greetens, die Tochter ihrer Nachbarin, Ronas beste Freundin. Marie ahnte, was kommen würde, und wollte schnell das Fenster schließen, aber es war zu spät. Pauline war bildhübsch, rotzfrech und noch ziemlich frei von Feingefühl.
„Hallo, Marie, gehen wir heute wieder Rona besuchen?“
Sie schüttelte leicht den Kopf und schloss wortlos das Fenster. Minutenlang blieb sie regungslos stehen und starrte Pauline durch das geschlossene Fenster an. Dann senkte sich ihr Blick und fiel auf ihre Hände. Ihre Finger hatten sich wie von selbst gegeneinander gepresst und angefangen zu zittern.
Nein, so konnte es nicht weitergehen. Kein normaler Mensch hält so etwas aus, dachte sie, kein Mensch. Sie ballte die Faust, rannte zum Telefon und rief einen treuen Kunden an, dem sie tags zuvor abgesagt hatte. Für einen Moment überlegte sie, Lars zu bitten nach Hause zu kommen. Er würde sie vorsichtig in den Arm nehmen und beruhigen, ihr gut zureden und sich um sie kümmern. War es das, was sie jetzt brauchte?
Sie wusste es nicht.
Sie wusste gar nichts mehr.
2
„Pack ihn dir“, brüllte Hauptkommissar Nikolaus Rothenburg seinem Nebenmann zu. Der Mann stöhnte, machte einen Satz nach vorne, hob zur Abschreckung die Arme und versuchte dem anlaufenden Zwei-Meter-Riesen den Weg abzuschneiden. Aber der Riese war nicht nur ein Riese, sondern auch flink und beweglich. Er täuschte eine Bewegung nach links an und zog blitzschnell rechts an seinem Gegenspieler vorbei. Direkt vor Rothenburg stieg er hoch und knallte den Ball unhaltbar in den Winkel.
Frank Lütjens stand nach Luft schnappend am Freiwurfkreis und hatte die Hände auf die Knie gestützt. „Wenn gleich nicht Schluss ist, kotz ich.“
Der Riese kam lächelnd auf ihn zu und gab ihm einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter. „Hör einfach auf zu rauchen.“
„Ich rauche gar nicht“, japste Lütjens. „Meine Lunge ist zu klein.“
Der Trainer erlöste ihn schließlich. „Okay, das war’s. Wir sehen uns Freitag.“
Nach dem Duschen gingen sie wie immer noch auf ein oder zwei Bier in die Sportler-Schänke, eine finstere Kaschemme mit einer skurrilen Bedienung und den besten Bratkartoffeln mit Speck in Münster. Rothenburg und Polizeireporter Lütjens setzten sich, wie gewohnt, etwas abseits an den Rand des langen, für die Mannschaft reservierten Tisches, um ungestört reden zu können. Kellnerin Tamara hatte sich heute eine Glatzenperücke mit aufgesetztem lilafarbenen Skinheadkamm übergestülpt. Sie summte Auf der Reeperbahn …, als sie das Essen servierte. Rothenburg zwinkerte ihr belustigt zu.
„Wie war’s in Schweden? Wie geht’s Lisa?“, fragte Lütjens, während er sich eine Gabel Bratkartoffeln in den Mund schob.
Rothenburg zuckte mit den Schultern. „Gut. Sie lässt dich lieb grüßen.“
Zwei Wochen hatte Rothenburg in Schweden bei seiner Frau Lisa Eriksson und ihrem gemeinsamen Sohn Frederik verbracht. Die erste Woche hatte er wie verabredet in einer kleinen Pension am Hafen von Varberg gewohnt. Ein nettes Ehepaar führte diese Bed & Breakfast-Unterkunft und war ganz wild darauf, mit einem leibhaftigen Kriminalpolizisten über die Möglichkeit eines perfekten Mordes zu plaudern. Rothenburg hatte deshalb oft Mühe gehabt, sich loszueisen, um mit seinem Sohn fischen oder paddeln zu gehen und sich am Abend mit Lisa hinzusetzen, Wein zu trinken und zu reden. Einen Ausflug zu dritt hatte Lisa nicht gewollt – noch nicht, wie sie erklärte. Schließlich wolle man doch keine heile Familie vorgaukeln, wo keine sei, oder?
Natürlich nicht, hatte Rothenburg gesagt. Ganz wie sie meine.
Nach einer Woche hatte Lisa schließlich eingeräumt, dass die Pension albern sei, und hatte ihrem Ehemann das Gästezimmer zur Verfügung gestellt.
„Sie braucht noch Zeit“, sagte Rothenburg zu Lütjens, „schließlich ist sie schon vier Jahre weg. Da kann man doch nicht nach einer Woche wieder in die Kiste gehen, als wenn nichts gewesen wäre.“
„Dir geht’s doch gar nicht um die Kiste“, entgegnete Lütjens, „du willst sie doch für immer zurückholen. Da muss man sowieso strategischer vorgehen. Das mit der Pension war schon mal ganz gut. Was hast du ihr denn in Aussicht gestellt?“
„Aussicht?“
Lütjens seufzte. „Warum ist sie denn abgehauen? Doch weil du nie da warst, dich nicht fünf Minuten um die Kinder kümmern konntest. Wenn du ihr keine Veränderung in deinem Leben anbietest, wird sie keine Veranlassung haben zurückzukommen.“
„Was soll ich denn machen?“ Rothenburg legte Messer und Gabel hin und lehnte sich zurück. „Ich kann doch nicht in Teilzeit gehen. Ich bin Leiter der Mordkommission.“
„Du musst auf Zeit spielen“, sagte Lütjens mit vollem Mund. „Sieh mal, Frederik ist doch jetzt zehn und Svenja 13 Jahre, oder? Ihr ist das sowieso egal, wo wer lebt und mit wem, um sie braucht ihr euch also weniger zu kümmern. Bleibt noch Frederik. In ein paar Jahren wird es bei ihm ähnlich sein. Bis dahin musst du mit deinem Chef Kollau etwas aushandeln. Weniger Wochenendbereitschaft, Viertagewoche, was weiß ich. Wenn es sich einer leisten kann, dann doch wohl du nach deinen Erfolgen in den letzten Jahren.“
„Er wird nicht zustimmen.“
„Doch, er wird. Sonst lässt du dich versetzen.“
„Wohin denn? Ich will nicht weg aus Münster.“
Lütjens stöhnte. „Mann, bist du schwer von Begriff, du drohst doch nur damit. Du wirst sehen, er wird gar nicht anders können als einzuwilligen, wenn er dich sonst nicht halten kann.“
Rothenburg zuckte mit den Schultern und stocherte lustlos in seinen Bratkartoffeln. Sie waren vorzüglich wie immer angerichtet und dufteten köstlich, aber irgendwie war ihm der Appetit vergangen. Die zweite Woche in Schweden war herrlich gewesen. Lisa hatte sich schließlich von Frederik doch überreden lassen, zu dritt etwas zu unternehmen. Sie hatten Ausflüge in Naturreservate gemacht und zwei Nächte am Skärsjönsee gecampt, in einem Zelt und mit Frederik in der Mitte.
Rothenburg hatte Lisa oft verstohlen beobachtet. Man sah es ihr einfach an, ob sie sich wohlfühlte oder nicht, und er hatte den Eindruck, dass es ihr wenigstens nicht völlig egal war, dass er nun da war und um sie warb. Dass sie sich wohlfühlte oder gar freute, war vielleicht etwas viel verlangt fürs erste Mal nach langer Zeit. Seine Hände hatten gezittert, als sie sich zum Abschied umarmt und sie ihm einen Kuss auf die Wange gegeben hatte. Immerhin, ein schöner Erfolg, hatte er gedacht. Aber jetzt, wieder in Münster und über 800 Kilometer von Lisa weg, schien es ihm so, als wenn sich nichts geändert hätte. Die Mutter schickte Frederik jetzt vermutlich zu Bett, und er war nach wie vor nicht da. Verdammt, dachte Rothenburg.
Lütjens nahm ihm den Teller Bratkartoffeln weg. „Gib her, ich kann noch. Wo wohnt eigentlich Svenja gerade?“
„Sie ist für drei Wochen zu einer Freundin gezogen. Ein paar Tage Ruhe hab ich also noch.“
Der Zwei-Meter-Riese kam zu ihnen und klopfte auf den Tisch. „Ich muss los, ihr Stützen der Gesellschaft“, grinste er. „Wir sehen uns am Freitag in alter Frische.“
Rothenburg lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. „Mal sehen“, murmelte er.
Rothenburg wachte am nächsten Morgen mit einem flauen Gefühl im Magen auf. Der zweite Tag im Polizeipräsidium Münster nach seinem Urlaub würde noch weitaus unangenehmer werden als der erste, soviel stand fest. Er hasste es, einem Menschen wehtun zu müssen. Noch mehr hasste er es, wenn dieser Mensch krank war. Und es ging sozusagen gar nicht, wenn dieser Mensch ein langjähriger Kollege war, den er sehr schätzte.
Aber es musste wohl sein.
Gestern hatten wie üblich alle Kollegen Rothenburg erstmal ordentlich auf die Schulter geklopft und ihm versichert, wie froh sie wären, dass er wieder im Lande sei. „Nach zwei Wochen … ich glaub euch kein Wort“, hatte er gesagt. Dann hatte er sich von seinem Team den Stand der laufenden Fälle vortragen lassen. Klaus Gromzki untersuchte den angeblichen Selbstmord eines Rechtsanwalts, der für eine Immobilienfirma gearbeitet hatte. Irene Franta und Andreas Briesch ermittelten in einer Schießerei in einer schäbigen Bahnhofskneipe, bei der zwei Gäste mit einer abgesägten Schrotflinte durchlöchert worden waren. Unter dringendem Tatverdacht stand der Wirt der Spelunke, Chef einer kriminellen Organisation mit Namen SATO.
„Ehrlich gesagt“, begann Briesch und rückte seine schwarze Hornbrille zurecht, „wäre es wirklich nicht schade gewesen, wenn es den Wirt auch erwischt hätte. So ein widerliches Schwein habe ich selten gesehen. Selbst in der U-Haft führt er sich auf wie der letzte Henker.“
„Ich habe von ihm gehört“, nickte Rothenburg, während er die Akte studierte. „Kriegen wir ihn dran?“
„Schwierig“, antwortete Irene Franta. „Es sind sowohl seine als auch noch nicht identifizierte Fingerabdrücke auf der Tatwaffe. Zeugen gibt es natürlich keine. Das heißt, es gibt schon eine, eine Frau, die in einer Ecke ein Bier getrunken hat. Sie hat uns einige Dinge erzählt. Aber die wird niemals vor Gericht aussagen, sie arbeitet für ihn.“
Für einen Augenblick sah Rothenburg seine Kollegin als Eva Marie Saint im Hitchcockklassiker Der unsichtbare Dritte im Speisewagen sitzen und ihm hingebungsvoll sexy eine Ladung Zigarettenqualm ins Gesicht pusten. Vor Jahren hatte er ihr gestanden, dass sie für ihn so aussehe und das Charisma habe wie diese amerikanische Schauspielerin, die er so verehrte. Franta hatte es hingenommen und einfach als Kompliment gesehen. Mehr war da nicht, wie er ihr und sich selbst versicherte.
Franta trat ihm gegen den Unterschenkel und lachte. Sie wusste, was er dachte. Rothenburg zuckte zusammen, räusperte sich und gab Briesch ein Zeichen fortzufahren.
Briesch ratterte in seiner unnachahmlichen Art die weiteren Fakten herunter. Die Toten waren ebenfalls SATO-Mitglieder, die dem Wirt angeblich viel Geld für überlassene Prostituierte schuldeten und dies nicht vereinbarungsgemäß zurückzahlen konnten. Sie waren in die Kneipe gekommen und hatten um Zahlungsaufschub gebeten. Der Wirt hatte nur den Kopf geschüttelt, sein Gewehr hervorgeholt und die beiden abgeknallt wie Kaninchen.
„Das ging alles innerhalb von Sekunden“, erklärte Briesch. „Tür auf, drei Wörter und peng, peng. Das war’s.“
Peng, peng?, dachte Rothenburg. Wie bei Bonanza?
„Staatsanwalt Rabbel versucht gerade, die Frau zu einem Zeugenschutzprogramm zu überreden“, fuhr Franta fort, „was reichlich schwierig werden dürfte. Die Frau ist zugleich Pferdchen und Ehefrau.“
Rothenburg schüttelte fassungslos den Kopf. Was für Abgründe!
Dann klingelte sein Telefon.
Im Büro von Polizeipräsident „Kaiser“ Wilhelm Kollau erwartete ihn neben dicker Zigarrenluft und dem Polizeichef auch die Polizeipsychologin Dr. Johanna Vossler. Rothenburg mochte sie nicht besonders. Bei den wenigen Begegnungen, die sie bisher hatten, hatte Vossler sich stets als bürokratische und humorlose Zicke herausgestellt. Frederik hatte sie im letzten Winter als Fräulein Rottenmeier bezeichnet, als er seinen Vater im Präsidium besuchte. Eine perfekte Beschreibung, wie Rothenburg fand. Einmal hatte er hochkonzentriert eine Minute lang versucht sich vorzustellen, wie Vossler sich wohl beim Sex anstellen würde, aber seine Fantasie reichte dafür nicht aus.
Polizeichef Kollau spulte zunächst ein paar freundliche Urlaubsfloskeln ab, bevor er mit seinem Anliegen herausrückte.
„Nun gut, mein lieber Rothenburg, kommen wir zur Sache. Mir liegt hier ein ärztliches Gutachten von Frau Dr. Vossler vor, in dem die Dienstfähigkeit Ihres Kollegen Klaus Gromzki … sagen wir einmal … stark angezweifelt wird.“
„Bitte?“, fragte Rothenburg ungläubig. „Was ist das denn für ein Unsinn? Wie kommt Dr. Vossler dazu, ein solches Gutachten anzufertigen?“
Dr. Vossler hatte ihre Hände artig auf dem Tisch gefaltet und sah ihn mit spitzem Mund an. „Es gab Beschwerden und Hinweise. Er selbst hat sich schon vor Monaten nach den Möglichkeiten einer Kur erkundigt. Da ist es meine Pflicht als Amtsärztin, ihm die nötige Fürsorge des Dienstherrn zukommen zu lassen.“
Sie hätte Politikerin werden sollen, dachte Rothenburg. Aber weit weg von Münster.
„Um was geht es hier denn eigentlich? Was hat er? Burnout?“ fragte er grimmig.
Polizeichef Kollau kam um den Tisch herum und legte ihm eine Hand auf die Schulter. „Aber, mein lieber Rothenburg, das wissen Sie doch selber am besten, nicht wahr?“
Rothenburg kniff die Augen zusammen. „Nein.“
Dr. Vossler lachte kurz laut auf. „Herr Hauptkommissar, Ihr Kollege Gromzki hat Depressionen, nicht zu knapp übrigens, und ist in diesem Zustand nicht fähig, in einer Mordkommission zu arbeiten. Das sehen Sie doch wohl ein, oder?“
„Ich sehe gar nichts ein“, entgegnete Rothenburg wütend. „Wollen Sie damit sagen, dass Klaus meschugge ist, oder wie?“
Dr. Vossler schüttelte hochmütig den Kopf. „Sie verstehen offensichtlich überhaupt nichts von Medizin und Psychologie. Depression kommt in Schüben, und ich war vorletzte Woche Zeuge eines solchen Schubs. Er wollte sich bei mir Informationen für einen Kuraufenthalt abholen, aber er saß nur da und brachte kaum ein Wort heraus. Eine Stunde habe ich versucht, mit ihm zu reden, herauszubekommen, was los ist mit ihm. Keine Chance! Es tut mir leid, Herr Hauptkommissar, aber ich muss Ihren Kollegen dienstunfähig schreiben. Alles weitere werde ich dann in Absprache mit dem Herrn Polizeipräsidenten und – soweit nötig – auch mit Ihnen veranlassen.“
Hexe, dachte Rothenburg.
„Sie wollen ihn also in eine Klapse abschieben. Sehe ich das richtig? Das kommt gar nicht in Frage!“
Polizeichef Kollau zog sich einen Stuhl heran und setzte sich direkt neben Rothenburg. „Herr Rothenburg! Erstens: Wir schieben Gromzki nicht ab, sondern lassen ihn eine Zeit lang in einer modernen Klinik beobachten. Dann werden wir sehen, was die Fachleute sagen. Zweitens: Sie haben das nicht zu entscheiden, sondern Frau Dr. Vossler und ich. Drittens: Klaus Gromzki hat sich bei den Ermittlungen im Fall dieses Immobilienanwalts dicke Patzer geleistet. Und viertens: Horchen Sie doch bitte mal in sich hinein, ob Sie vielleicht den einen oder anderen Hinweis auf eine mögliche Depression nicht auch schon bemerkt haben. Vielleicht haben Sie es ja als schlechte Laune oder miese Phase abgetan, anstatt den Dingen auf den Grund zu gehen. Ich gebe zu, dass es für einen medizinischen Laien schwierig ist, eine Depression zu erkennen. Aber dafür haben wir ja unsere tüchtigen Amtsärzte, nicht wahr?“
Bei den letzten Worten hob er den Kopf und schaute Dr. Vossler lächelnd an.
Rothenburg hatte die letzten Worte nicht mehr wahrgenommen und starrte nachdenklich aus dem Fenster. Kollau hatte insofern Recht, als dass es ihm in der Tat schon mehrfach aufgefallen war, dass Gromzki sich merkwürdig geistesabwesend verhalten hatte. Keine Haltung, die man einfach bei einem nachdenkenden Kommissar erwarten würde, sondern ein leeres Starren auf einen Punkt, meistens auf einen weißen an einer weißen Wand. Hinzu kam seine pessimistische und negative Lebenseinstellung.
Doch, wenn man es ganz nüchtern betrachtete, war da was.
Einen Schnitzer hatte Gromzki sich allerdings bei ihm noch nie erlaubt. Deshalb hatte Rothenburg auch seine grimmige Miene und brummigen Kommentare ertragen. Er war einfach ein gründlicher Polizist, schwierig im Nehmen zwar, aber das war schließlich seine, Rothenburgs Sache. Wenn Gromzki jetzt allerdings Mist gebaut hatte …
„Was hat er denn verbockt?“, fragte Rothenburg.
Kollau stand auf und hob die Arme. „Er hat womöglich Spuren verwischt. Er hat sich ohne Handschuhe am Seil und am Hals des Toten zu schaffen gemacht. Und dann hat er noch zugelassen, dass eine Meute von Pressefotografen Aufnahmen von dem baumelnden Anwalt machen konnte. So etwas können wir uns einfach nicht erlauben. Das geht nicht!“
Rothenburg nickte. „Ich spreche morgen mit ihm. Heute hat er frei.“
Kollau schüttelte den Kopf. „Es tut mir leid, aber das wird nichts mehr nützen. Unsere Entscheidung ist gefallen. Ich habe eine Verantwortung, sowohl der Öffentlichkeit als auch Gromzki gegenüber. Er ist ab sofort krankgeschrieben.“
Klaus Gromzki war ein kleiner, leicht untersetzter Mann mit schütterem grauen Haar. Er hatte tiefe Ringe unter den Augen und blickte sein Gegenüber schuldbewusst an.
Rothenburg fühlte sich alles andere als wohl in seiner Haut. In der Nacht hatte er hin und her überlegt, wie er seinem Kollegen die Nachricht beibringen sollte, dass er für die Polizei Münster zurzeit nicht mehr tragbar war. Sollte er sich auf die Seite des Polizeichefs und dieser dämlichen Ärztin stellen und ihm vorbeten, wie wichtig ein gesunder Gromzki für die Polizei Münster sei? Dass er, Rothenburg, eine Fürsorgepflicht für ihn habe und sich nichts sehnlicher wünsche, als dass er in ein paar Wochen wieder gesund in seinem Büro sitze? Dass es ihnen ja nur darum gehe, ihn vor weiteren Fehlern zu bewahren, mit denen er womöglich bald selbst nicht klarkomme?
Oder sollte er ihm einfach die Wahrheit sagen? Klaus, du bist depressiv, und Depression ist eine sehr ernst zu nehmende Krankheit. Ich habe schon oft überlegt, was mit dir los ist, aber ich habe es aus Bequemlichkeit und weil du gute Arbeit leistest, immer vor mir hergeschoben, etwas zu unternehmen. Wenn du noch etwas von deinem Leben haben willst, musst du dich behandeln lassen. Schließlich hast du noch sieben Jahre bis zur Pensionierung. Entweder du machst das jetzt oder Kollau schmeißt dich raus!
Er erinnerte sich an Besprechungen, in denen Gromzki alle Diskussionspunkte mit einer großen Portion Misstrauen versah, sämtliche Ermittlungsansätze anzweifelte und jeden Verdächtigen am liebsten hinter Gittern gesehen hätte. Aber dann gab es auch den Gromzki, der sich ohne besondere Aufforderung daranmachte, wichtige Indizien zu sammeln und Beweisstücke sicherzustellen. Rothenburg wusste immer noch nicht, wie Gromzki einen Brief so schnell hatte finden können, der beim vergangenen Mordfall eine entscheidende Rolle gespielt hatte.
„Ich weiß schon Bescheid“, sagte Gromzki leise, „du musst dich hier nicht herumquälen. Heute Abend packe ich meine Sachen. Ich glaube nicht, dass ich wiederkomme.“
Rothenburg schüttelte den Kopf. „Du bist krank, Klaus, nicht entlassen. Das ist ein Unterschied.“
Gromzki rieb sich die Hände an den Hosenbeinen. „Ich bin weder blöd noch irre noch sonstwas. Ich habe halt nur manchmal diese Aussetzer, da bin ich dann nicht mehr ich. Ich sehe nichts mehr vor mir und bin unfähig, auch nur ‚piep’ zu sagen, geschweige denn in der Lage, vernünftig zu handeln.“
„Und darum sind dir diese Fehler passiert?“
„Ja, klar, nur deswegen. Ich hab mir natürlich in den Arsch gebissen, als ich wieder klar war und erfahren habe, was ich verbockt hab. Aber da war es wohl schon zu spät. Und mein Pech, dass du nicht da warst.“
„Du glaubst, ich hätte es wahrscheinlich irgendwie geradegebogen“, sagte Rothenburg, „aber irgendwann …“
„Ich weiß“, sagte Gromzki tonlos. „Heißt das, dass du zustimmst?“
Rothenburg zuckte mit den Schultern. „Es ist egal, ob ich zustimme oder nicht, die Sache ist beschlossen. Du solltest aber wissen, dass ich eine Behandlung auch befürworte, und zwar nicht wegen dieser Fehler, sondern weil ich will, dass du bald gesund wiederkommst, ordentlich arbeitest und in sieben Jahren deine Pension genießen kannst. Punkt!“
Er sah ihn streng an. Er tat ihm leid, keine Frage. Gromzki hatte weder Frau noch Kinder, nur einen Bruder, der irgendwo bei Bremen wohnte. Keinen Menschen, der ihn besuchen würde in der Klinik. Vielleicht ab und zu der Krankenhauspfarrer.
„Wann gehst du in die Klinik?“
„In zwei Wochen. Vorher ist angeblich kein Platz frei, sagt Vossler. Es gibt jede Menge Irre in Münster.“
Rothenburg wurde wütend. „Hör auf, Mann. Das will ich nicht hören. Noch einmal: Du hast Depressionen und bist nicht meschugge. Und wenn du dich jetzt weiter so gehen lässt, kündige ich dir unsere Freundschaft. Ich erwarte, dass du im Krankenhaus mitspielst. Reiß dich zusammen, Klaus! Je mehr du an dir arbeitest, desto schneller bist du wieder hier. Hier wartet eine Aufgabe auf dich, wenn du wieder gesund bist, vergiss das nicht. Du wirst hier dringend gebraucht. Und hier warten nette Kollegen darauf, dass Klaus Gromzki seine brummigen Kommentare abgibt.“
Gromzki nickte. „Ich verstehe. Ich gebe alles.“
„Gut, das erwarte ich auch von dir. Und jetzt erzähl mir von diesem toten Anwalt. Schließlich muss ich da jetzt wohl ran.“
Gromzki wischte sich mit dem Finger eine Träne weg und setzte sich gerade hin. Dann rückte er die Akte zurecht und erzählte.
3
Staatsanwalt Christian Rabbel schaute auf die Uhr. 15 Uhr, Zeit, bald die Sachen zu packen und die Kinder abzuholen. Mittwochs hatte er immer Kinderdienst, seine Frau Susanne, eine Altenpflegerin, hatte heute Spätdienst und würde vor 22 Uhr nicht zurück sein. Zu Beginn seiner Laufbahn hatte er Schwierigkeiten gehabt, seinen Vorgesetzten einen flexiblen Dienstplan abzutrotzen. Jedes Mal musste er nachfragen und auf den Knien rutschen, wenn er eine halbe Stunde eher nach Hause musste. Das änderte sich erst mit dem Einzug einer Leitenden Oberstaatsanwältin in das Chefbüro der Behörde. Seitdem konnte Rabbel seinen Dienst weitgehend mit dem Familienkalender unter einen Hut bringen, dringende Termine und wichtige Ermittlungen natürlich ausgenommen. Und was dringend und wichtig war, bestimmte seit einiger Zeit er selbst. Dieses Standing hatte er sich mittlerweile erworben.
Er blätterte noch einmal im Gesprächsprotokoll seiner Unterredung mit der Ehefrau und dem Paradepferdchen des SATO-Wirtes, Doris Konlaczyk, in Prostituierten- und Zuhälterkreisen auch heimlich Die dumme Dolores genannt. Die Frau war ein echter Kotzbrocken und schlau wie ein Melkeimer, aber die einzige Chance, eine Verurteilung des Wirtes zu erreichen. Rabbel schlug Seite 3 auf, die es ihm besonders angetan hatte.
KO: Ich sagte schon, ich sag nichts.
RA: Gut, Sie wissen, dass Sie Ihren Ehemann nicht belasten müssen. Sie können die Aussage verweigern.
KO: Ich weiß, was ich kann, du Arsch. Ich kann dir mal was Tolles zeigen, Kleiner? Soll ich?
RA: Danke. Wenn Sie sich allerdings entschließen sollten, eine Aussage gegen Ihren Mann zu machen und Sie befürchten Repressalien …
KO: Was sind Pissalien? Red gefälligst Deutsch, du kleiner Wichser!
RA: Repressalien sind eine Art Rachemaßnahmen, zum Beispiel Feuer legen, berauben, entführen, foltern, erschrecken …
KO (schreit laut auf): Erschrecken? Will’ste mich verarschen, du pissiger Behördenscheißer? Umbringen wird er mich, der Wolf, er wird mich in Stücke reißen oder mir die Möpse abschneiden oder so. Erschrecken – dass ich nicht lache. Ham’se dir ins Hirn geschissen, oder was?
RA: Also scheinen Sie in der Tat Repressalien zu fürchten. Gut, wenn Sie im Falle einer Aussage Angst vor Ihrem Mann haben, dann können wir Sie nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ZSHG in einem Zeugenschutzprogramm unterbringen. Sie bekommen neue Papiere, eine neue Identität, gehen vielleicht ins Ausland. Wir richten es eben so ein, dass Ihr Mann Sie nicht finden kann.
KO: Vergessen Sie’s, Kleiner.
RA: Ihr Mann hat zwei Menschen erschossen.
KO: Ich saaaage nichts! Hörst du mir eigentlich zu, du Pisser?
RA: Kannten Sie die Toten?
KO: Klar kannt ich die. Die haben nur Scherereien gemacht, von morgens bis abends. Und Wolf haben sie einen Haufen Geld geschuldet. Das hätte der nie zurückgekriegt. Bei denen lief der Laden nich so, wie er laufen sollte. Kapierst’e?
RA: Hat er sie nur deswegen umgebracht? Wegen des Geldes?
KO: Na klar wegen dem Geld. Die wären doch nächste Woche wieder angekommen und hätten um Kies gebettelt …
Staatsanwalt Rabbel legte grinsend das Protokoll zur Seite und überlegte, was er mit diesem Theaterstück anfangen sollte. Als Doris Konlaczyk gemerkt hatte, dass sie sich verplappert hatte, war sie aufgestanden, hatte gegen Tisch und Stühle getreten und erst aufgehört vor Wut zu brüllen, als sie vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft stand und von zwei Streifenpolizisten zur Mäßigung gerufen wurde. Immerhin, dachte Rabbel, sie hat es gemerkt. So ganz doof konnte sie ja dann doch nicht sein.
Die Aussage an sich war allerdings nicht allzu viel wert, das wusste er natürlich. Klar, er konnte dem Richter das Protokoll inoffiziell zeigen und der Richter würde ihm sicherlich glauben, zumal er das Gespräch auch auf Tonband aufgenommen hatte. Wovon Doris Konlaczyk wiederum nichts ahnte. Vor Gericht verwerten konnte er beides nicht.
Es blieb nur eine Möglichkeit, aber die war ziemlich heikel und für Doris Konlaczyk nicht gerade ungefährlich: Er musste ihr vorher versichern, dass sie nur als normale Zeugin geladen sei und ihr dann im Prozess so zusetzen, dass sie sich so verplapperte wie heute und unter den Ohren der Richter ihren Ehemann belastete. Wenn es klappte, musste man sie danach natürlich schleunigst aus dem Verkehr ziehen und nach Turkmenistan verschiffen. Wenn’s schiefging, würde der Wirt bald die nächsten wilden Kaninchen schießen.
Eigentlich eine spannende Sache, wenn er es recht bedachte.
Marie saß vor ihrem Computer und tippte lustlos auf der Tastatur herum. Schon wieder hatte eine Kundin kurzfristig abgesagt, wegen angeblicher Erkrankung des Kindes. Marie glaubte ihr nicht. In letzter Zeit hatte sich die Zahl der Absagen auffällig erhöht, bald würde sie ernste finanzielle Schwierigkeiten bekommen. Warum um alles in der Welt wandten sich ihre Kunden nur von ihr ab? War ihre Laune während der Termine wirklich so unausstehlich? Sie wussten doch alle, was ihr widerfahren war, und nahmen doch bestimmt Rücksicht darauf. Aber vielleicht war die Schonzeit jetzt abgelaufen, die Leute erwarteten wieder eine fröhliche Marie, die um sie herumtänzelte, ihre Scheren und Kämme schwang und mit ihrem einnehmenden Charme jede Situation meisterte. Sie nahm sich doch vor jedem Kunden fest vor, sich zusammenzureißen und für diese eine Stunde ihr Leid zu verdrängen. Wenigstens ein Stückchen wieder die alte Marie zu sein. Anscheinend gelang es ihr nicht so, wie das viele von ihr erwarteten.
Marie löschte den Eintrag in ihrem Online-Terminplaner elephanty.com. Der nächste Kunde würde erst gegen Mittag kommen, ein gesetzter Herr mit schütterem Haar, wenig genug zu tun. Also wieder drei Stunden, in denen sich ihre Gedanken nur um die eine Person drehen würden. Sie überlegte kurz, ob sie einen kurzen Blick hinunter in den Park wagen sollte. Vielleicht waren die Kinder mittlerweile eingetroffen, um die letzten kühlen Augenblicke des Tages zu nutzen. Sie horchte, aber sie hörte keine Stimmen. Vermutlich war es den Kindern schon jetzt zu heiß.
Sie gab die URL der Onlineausgabe der Münsteraner Neuen Presse ein und überflog die erste Seite. Niedersachsens Ministerpräsident Wulff soll neuer Bundespräsident werden. Mir doch egal, dachte Marie. Was würde er schon für sie tun können? Bundesverdienstkreuz für Vitali Klitschko. Wer war das noch mal? Ach so, ein Boxer. Und die werden geehrt? Nicht zu fassen. Mann erschießt in Brüssel Richterin und Justizangestellten.
Marie hob die Augenbrauen. Das klang nach einer Tat aus Rache und durchaus interessant. Ein Albaner hatte in einem Brüsseler Gericht die Gerichtspräsidentin und einen Justizbeamten getötet, weil die Richterin im Prozess um das Sorgerecht für seine Kinder zugunsten der Ehefrau entschieden hatte. Marie presste die Lippen aufeinander und verschränkte die Hände hinterm Kopf. Konnte das auch ihr Weg sein?
Einen Menschen töten, weil Rona getötet worden war?
Das hieße: Aufgeben, Abschied nehmen, Abtreten.
Entsetzt spürte sie, dass ihr dieser Gedanke nicht total abwegig und absurd erschien. Bislang wollte sie nur, dass er starb, der Schuldige, der Mörder, der Zerstörer ihres Lebens. Alle anderen Menschen waren ihr gleichgültig, es war egal, ob sie da waren oder nicht, ob sie anriefen oder nicht, ob sie Mitleid zeigten oder nicht. Erst Lars hatte es vor wenigen Monaten geschafft, durch seine Zurückhaltung und Zurücknahme eine Art Vertrauen zu gewinnen, das für ein einfaches Zusammenleben genügte. Aber mehr auch nicht.
Marie wusste, wenn sie Ronas Mörder selbst töten wollte, musste sie noch vier Jahre warten. Bis dahin kam sie nicht an ihn heran. Allerdings waren ihre Gedanken noch so wirr, dass sie für sich noch gar nicht endgültig entschieden hatte, ob sie es nun selbst tun würde oder es jemand anderem – liebend gerne auch schon vorher – überlassen sollte.
Oder war dieser törichte Gedanke nur der Ausdruck ihres unendlichen Leids? Marie war vor dem schrecklichen Ereignis eine intelligente, lebensfrohe und tolerante Frau gewesen, wahrscheinlich waren das die niederländischen Gene, die sie in sich hatte. Nie wäre sie auf den Gedanken gekommen, einem Menschen Schaden zuzufügen oder ihn gar zu töten. Ronas Tod hatte alles verändert, ihr Menschenbild, ihre Lebenseinstellung und ihre persönliche Perspektive. Die existierte einfach nicht mehr. Und wer keine Perspektive mehr für sich sieht, hat auch nichts zu verlieren.
Marie seufzte. Die Grübeleien machten sie wahnsinnig, und es wollte einfach kein Ende nehmen. Warum passierte nicht einfach irgendetwas, was sie wenigstens einen Millimeter weiterbrachte? Sie schüttelte traurig den Kopf, schaltete den Rechner aus und ging ins Bad. Vor dem Spiegel erschrak sie. Kein Wunder, dass die Kunden ihr davonliefen.
Sie war einmal eine schöne Frau gewesen, genaugenommen bis vor einem Jahr. Der Leiter des Kindergartens hatte sie einmal mit der verstorbenen Schauspielerin Barbara Rudnik verglichen, für ihn, so sagte er, die beeindruckendste Frau Deutschlands. Marie war nicht sicher, ob der Leiter das wirklich ernst meinte, zumal er bei dem Elternfest des Kindergartens schon einiges getrunken hatte. Aber sie hatte ähnliche Komplimente schon oft gehört, auch die Vergleiche mit Barbara Rudnik. Keine Frage, Rudnik war eine besonders schöne Frau gewesen mit einer Ausstrahlung, die viel Raum für Rätsel und Geheimnisvolles ließ.
Aber sie? Marie?
Geheimnisse? Ausstrahlung?
Gewiss, äußerlich sahen sie sich schon sehr ähnlich. Auch Marie hatte blau-graue Augen und blonde lange Haare, die gleichen Gesichtszüge, hohe Wangenknochen und ein verschmitztes Lächeln. Aber was war schon ein Rätsel an ihr?
Von Barbara Rudnik war Marie jetzt so weit entfernt wie Burkina Faso vom Nordpol. Ihre Augen waren gerötet, der Blick vollkommen leer. Die Haut war schlaff und eingefallen, die Poren vergrößert, ein leichter Fettfilm schimmerte ihr im Spiegel entgegen. Marie fing an zu zittern. Erst leicht, dann wurde es schnell stärker. Innerhalb von Sekunden explodierte ihre Seele.
„Neeeeeiiiiinnnnnn!“ Mit aller Kraft schrie sie ihr Spiegelbild an. Sie trommelte gegen die Wand und riss Handtücher vom Haken. Minutenlang bearbeitete sie Wände, Duschkabine und Tür, bis sie schließlich merkte, dass ihr langsam die Kräfte ausgingen. Vor der Badewanne sank sie schluchzend auf die Knie und ließ die Arme über den Innenrand der Wanne fallen.
„Ich … will … nicht … mehr!“
Es war schließlich der gesetzte Herr mit dem schütteren Haar, der sie über zwei Stunden später exakt in dieser Stellung im Badezimmer fand und den Notarzt verständigte.
4
Der Teil des Wohnraums, den man in dieser Wohnung wahrscheinlich Küche nennen würde, war mindestens 20 Quadratmeter groß. In der Mitte stand eine Koch- und Arbeitsinsel mit Herd, Spüle und Spülmaschine in einer großzügig ovalen Form und knallroten Fronten. Selbst die Dunstabzugshaube war in dieser grellen Farbe gehalten, die Arbeitsplatten dagegen pechschwarz. Die Wand seitlich zum Fenster war eine einzige Küchenzeile, ebenfalls mit einer roten Front. Kommissar Andreas Briesch zählte je zwei Backöfen und Mikrowellen in Brusthöhe, außerdem drei deckenhohe Hochschränke für Geschirr und Vorräte und noch zwei frei stehende Unterschränke, auf denen sich drei exklusive Kaffee- und Espressomaschinen befanden. Alle Arbeitsbereiche waren durch ein ausgetüfteltes System von Halogenspots perfekt ausgeleuchtet.
Küche und Essbereich wurden durch eine etwa zwei Meter breite Theke abgetrennt. Gegessen wurde vermutlich an dem wuchtigen Eichentisch, an dem vier mit schwarzem Leder bezogene Stühle standen. Auf dem Tisch war eine große Schale mit frischem Obst.
Eine Luxusküche mit Geschmack, geräumig und funktional. Hier musste das Kochen, Essen und Quatschen einfach Spaß machen.
Normalerweise. Aber nicht heute.
Seit dem frühen Morgen lagen zwei junge Männer in einer ansehnlichen Blutlache direkt vor dem Herd. Rothenburg schätzte die Toten auf Mitte Dreißig. Ihre Körper waren wie ein „T“ angeordnet, ihre Brust bestand nur noch aus Fleischfetzen. Man konnte erahnen, dass beide Männer noch vor Stunden ein hübsches und freundliches Gesicht gehabt haben mussten, jetzt war darin nur noch blankes Entsetzen zu lesen. Bekleidet waren beide mit einer schwarzen Stoffhose und einem weißen Unterhemd.
„22 Messerstiche! Mein Gott“, murmelte Rothenburg fassungslos und setzte sich auf einen Stuhl.
„Pro Leiche, macht also insgesamt 44“, korrigierte Andreas Briesch. Irene Franta verdrehte die Augen.
Rothenburg rieb sich das Gesicht. Hier musste ein Wahnsinniger am Werk gewesen sein, purer Hass musste den oder die Täter getrieben haben. Kein einigermaßen normaler Mensch stach derartig bestialisch seine Mitmenschen ab. Außer vielleicht die beknackten Anhänger von Charles Manson.
„Klärt mich auf“, bat er, „wo bin ich hier und wer sind diese Männer?“
„Die Toten sind Adrian Jensen und Mirko Tönnies“, sagte Briesch, während er in seinem Notizbuch blätterte, „36 und 32 Jahre alt. Jensen ist der neue Shootingstar unter den hiesigen Architekten, Tönnies ist beim Jugendamt tätig und Jensens Lebensgefährte. Sie wohnen beide hier, sagt die Haushaltshilfe, die die beiden gefunden hat. Offensichtlich wollten sie zeitig frühstücken und dann irgendwohin fahren, weil Tönnies heute seinen freien Tag hat. Tja, und dann muss ihnen der Täter in die Quere gekommen sein.“ Er schaute sich in der Küche um und nickte anerkennend. „Nicht schlecht, die Küche. Aber ein Spiegelei wird hier genau so schmecken wie bei mir in meiner Bruchbude.“
„Vermutlich. Todeszeitpunkt?“
„Gegen sechs, halb sieben, vermutet Dr. Machalle.“
Rechtsmediziner Dr. Sebastian Machalle hatte vor seinem Medizinstudium Alte Geschichte studiert und war bekannt für seine gewagten Exkurse in die Welt der Antike. Er kniete gerade neben den Toten und untersuchte die Fingernägel. Machalle war großgewachsen, hager und trug mit Vorliebe Sakkos, die ihm drei Nummern zu groß waren, wenn er nicht gerade wie jetzt den Schutzanzug anhatte.
„Ein doppelter Cäsarmord“, sagte er, während er sich ächzend erhob. „Allerdings leidet der Mörder wohl an Dyskalkulie.“
„Was ist das und woran sehen Sie das?“, fragte Rothenburg ungeduldig.
„Cäsar wurde meines Wissens mit 23 Stichen ermordet, diese hier mit 22. Dyskalkulie ist Rechenschwäche.“
Seine Nerven möchte ich haben, wünschte sich Rothenburg.
„Gibt es Kampfspuren?“
Dr. Machalle nickte. „Unter den Fingernägeln sind jede Menge Hautschuppen. Daraus lässt sich eine feine DNA-Probe herstellen. Allerdings werde ich Schwierigkeiten haben, die inneren Organe näher zu untersuchen. Da ist nicht mehr viel übrig. Der Täter muss in tobender Wut zugestochen haben. Mindestens zehn der Stiche waren tödlich, der Rest war nur noch wahllose Raserei.“
„Bei beiden gleich?“
„Ja, völlig identische Stichspuren. Man könnte es fast schon systematisch nennen. Unglaublich.“
„Wer war zuerst tot?“
Dr. Machalle schüttelte den Kopf. „Kann ich beim besten Willen nicht sagen. Der zeitliche Abstand muss minimal sein, vielleicht zwei oder drei Minuten, höchstens. Das Blut hat bei beiden dieselbe Konsistenz, und auch alle anderen Symptome lassen auf einen nahezu gleichzeitigen Tod schließen.“
Er zuckte die Schultern. „Vielleicht finden die Kollegen noch einen Hinweis.“
„Schwierig“, meldete sich Polizeitechniker Sven Behle zu Wort, der sich zu ihnen gesellt hatte. Behle war 38 Jahre alt und hatte eine Lockenpracht, die an beste Hippiezeiten erinnerte. Es gab im gesamten Polizeibezirk Münster keinen Menschen, der sich besser mit Elektronik auskannte als er und gleichzeitig die bodenstämmigen Techniken zur Spurensicherung beherrschte.
„Mau, sozusagen sehr mau“, fuhr er fort. „Wir haben zwar die Tatwaffe, ein langes Fleischermesser. Aber es stammt hier aus der Küche und hat nicht einen einzigen Fingerabdruck. Einbruchspuren gibt es auch nicht, der Täter muss normal geklingelt haben und dann hereingelassen worden sein. Diese Wohnungstür kriege noch nicht mal ich auf, die hat WK 6.“
„WK 6? Da braucht man ja einen Panzer. War Jensen ein Neurotiker?“
Behle zuckte die Schultern. „Er war ein Stararchitekt. Vielleicht hatte er hier wichtige Pläne oder Verträge deponiert. Keine Ahnung.“
Er führte Rothenburg zu der Blutlache, in der deutlich ein Fußabdruck zu sehen war. „Hier ist der Mörder mit Einweg-Überschuhen herumgelaufen, die draußen in der Mülltonne liegen. Wir werden sie natürlich untersuchen, aber ich verwette mein Gehalt darauf, dass wir nichts finden werden.“
Rothenburg hockte sich hinunter zu den Gesichtern der Toten. Sie sahen friedlich aus, seit Machalle ihnen die Augen geschlossen und das Entsetzen so genommen hatte. Friedlich und fast kindlich unschuldig. Was hatten Jensen und Tönnies bloß getan, dass sie so grausam sterben mussten?
Er erhob sich und sah sich suchend um. „Wo ist denn bitte die Haushaltshilfe?“, rief er ziellos in die Küche. Franta zog ihn heraus aus der Küche und ging mit ihm ein paar Meter auf den breiten Flur.
„Da hinten rechts ist das Gästezimmer. Elisa Scalfatto liegt völlig fertig auf dem Sofa und wartet auf dich.“
Das Gästezimmer war in etwa so groß wie Rothenburgs gesamte Wohnung. Wandhohe Regale waren vollgestopft mit Büchern und Fachzeitschriften. Die wenigen freien Stellen an den Wänden waren mit kunstvollen Fotografien von bedeutenden Bauwerken bedeckt. Rothenburg trat an ein Regal und zog wahllos einen dicken Wälzer heraus: Schuld und Sühne von Dostojewski.
Alter Schwede, dachte er, wo bin ich denn hier?
Ein ächzendes Geräusch aus der hinteren Ecke ließ ihn leicht zusammenzucken. Elisa Scalfatto hatte es tatsächlich ohne Hilfe geschafft, sich vom Schlafsofa aufzurichten. Mit schweren Schritten ging sie auf ihn zu.
Alter Schwede, dachte Rothenburg noch einmal. Was kommt denn da für ein Schiff?
Er schätzte Scalfattos Lebendgewicht auf mindestens 150 Kilo brutto. Ihre langen schwarzen Haare hatte sie sich hochgesteckt, das neongelbe Oberteil hing schlaff über einer schwarzen Pumphose und ging ihr bis zu den Knien. Sie verschränkte die Arme vor ihren ausladenden Brüsten und sah den Kommissar mit gefährlich funkelnden Augen an.
Nein, dachte Rothenburg. Das hier mach ich auf keinen Fall.
Das hier macht Irene.
Noch während er den Telefonhörer langsam auf die Gabel legte, wurde ihm plötzlich schrecklich übel und heiß.
Genau genommen schwitzte Hans-Jörg Calma auf einmal wie ein Schwein, was nur zum Teil an der warmen Junisonne lag, die unbarmherzig und direkt in sein Gesicht schien und bereits jetzt um neun Uhr einen Vorgeschmack auf einen heißen Tag gab. Er rutschte auf seinem Gesundheitsstuhl unruhig hin und her und zog ein Feuchttuch nach dem anderen aus der gelben Spenderbox. Ohne Unterbrechung liefen ihm dicke Schweißtropfen über die Stirn und den Nacken und Rücken hinunter. Er erwog einen Augenblick, sein Hemd auszuziehen und sich am Waschbecken mit kaltem Wasser zu erfrischen. Aber schließlich konnte nach einem kurzen Klopfen jeder sein Büro betreten, vom Leiter der Kreditabteilung über Kollegen bis zur Sekretärin und dem Mann von der Poststelle. Nicht auszudenken, wenn Rebecca Kleinhues hereinplatzte und ihn mit nacktem Oberkörper und nassem, nach hinten gelegten Haar vor dem Spiegel sah. Rebecca Kleinhues hatte in der Filiale der Münsteraner Genossenschaftsbank den Ruf eines rücksichtslosen Vamps, sowohl im Dienst als auch privat. Hartnäckigen Gerüchten zufolge nutzte sie ihren Spielraum bei der Bewilligung eines Kredits gnadenlos aus, wenn ihr ein Antragsteller gefiel. Sobald die Überprüfung der finanziellen Verhältnisse abgeschlossen und der Kredit bewilligt war, kam sie wie Rumpelstilzchen angetrabt, um sich ihren Lohn zu holen.
Calma hatte nicht die geringste Ahnung, was Kleinhues über ihn dachte, aber er hatte auch nicht die geringste Lust, es gerade jetzt herauszufinden. Schweren Herzens ließ er sein Hemd also an und beschränkte sich darauf, sich die Achseln mit den Feuchttüchern zu trocknen.
Der Kerl meinte es anscheinend wirklich ernst.
Vielleicht. Es konnte natürlich auch ein mieser Scherz sein. Aber daran glaubte er schon jetzt nicht mehr ernsthaft. Nein, der Kerl würde seine Ankündigung wahrmachen, das stand fest. Calma starrte auf den Zettel, auf dem er sich während des Telefonats Notizen gemacht hatte.
Rolf Trenschel soll sterben. Sein Leben für sechs Leben, für jedes Jahr eins. Ich hab schon mal angefangen, als du noch faul im Bett gelegen hast. Du stehst auch auf der Liste. Als Nummer 4 oder 5. Rolf Trenschel soll sterben.
Seine hohe Stimme hatte zittrig und nervös geklungen, trotzdem hatte er ihm eindeutig klar gemacht, dass Calma während des Telefonats zu schweigen hatte.
Ich sag es nur einmal. Ich rate dir also, sei still!
Calma hatte keine Mühe, nichts zu sagen.
Alles verstanden? Keine Polizei! Sonst bist du der nächste! Du hörst von mir. Ende!
Klick.
Calma legte die Hände an die Schläfen und versuchte, angestrengt nachzudenken. Okay, sagte er sich, jetzt ganz ruhig. Denke nach!
Was steht auf dem Zettel? Lies genau!
Rolf Trenschel soll sterben.
Warum um Himmels willen sollte Rolf sterben? Rolf war doch sein Freund. Oder sollte er besser sagen: gewesen? Bis zu dieser blöden Geschichte letztes Jahr, das war das Ende ihrer Freundschaft gewesen. Aber gut, es war nun mal passiert, und Calma hatte für sich die Konsequenzen gezogen und einen dicken Schlussstrich unter die letzten zehn Jahre gezogen. Mit keinem aus seiner illustren Runde hatte er noch zu tun. Noch im Gerichtssaal hatte er den anderen signalisiert, dass endgültig Schluss sei, dass sie von ihm absolut nichts mehr zu erwarten hätten.
Und er war mächtig stolz darauf, dass er diesen Entschluss bis zum heutigen Tage bedingungslos durchgezogen hatte. Was die anderen so trieben, hatte ihn ab der Urteilsverkündung nicht mehr interessiert. Er hatte aufgeräumt in seinem Leben, hatte die leeren Wohnungen gekündigt, die Kneipen gewechselt, war einem Sportverein beigetreten und hatte sich in einem Kinderhospiz als Ehrenamtlicher angemeldet.
Was Rolf Trenschel verbockt hatte, würde ihm jetzt nicht mehr passieren.
Aber der büßte ja für seine Dummheit. Nicht besonders viel, wie Calma fand, aber immerhin so viel, dass er Zeit zum Nachdenken finden würde, wenn sein zugedröhntes Hirn es noch zuließ.
Aber nun war irgendein bescheuerter Erpresser offensichtlich der Meinung, dass Rolf es nicht mehr verdiente, am Leben zu sein. Aber warum sollte ausgerechnet er, der einfache Bankangestellte Hans-Jörg Calma, dafür sorgen, dass Rolf von dieser Welt verschwand?
Er stutzte. Erpresser? War es wirklich eine Erpressung? Erpresser fordern etwas und bieten etwas, meistens stehen Forderung und Angebot in keinem ausgewogenen Verhältnis. Die Forderung hier war eindeutig: Trenschel sollte beseitigt werden. Aber wie sollte man das um Himmels willen denn anstellen? Man musste als Opfer einer Erpressung doch wenigstens die Chance haben, die Forderung zu erfüllen – wenigstens zum Schein. Aber so …
Und was bot der Anrufer überhaupt? Insgesamt sollten sechs Menschen ihr Leben lassen, einer war bereits tot, wenn er die Worte richtig interpretierte – war das Leben der restlichen fünf das Angebot?
Oder würden alle sechs Menschen sowieso sterben? Sein Leben für sechs Leben, für jedes Jahr eins. Noch fünf, und er würde bald dran sein.





























