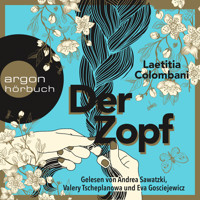4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Feelings
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Sommerwohlfühllektüre um die große Liebe, Hochzeit und Rosen! Die Floristin Helen ist mit ihrem Leben höchst unzufrieden – bis sie unerwartet von ihrer Großmutter ein altes Haus mit verwildertem Rosengarten erbt. Gemeinsam mit Freunden und Verwandten nutzt sie das Anwesen, um ein Rundum-Paket für Traumhochzeiten anzubieten! Die alte Kutsche ihres Nachbarn Hannes wäre das i-Tüpfelchen auf ihrem Hochzeitskonzept – allerdings scheint Hannes ein etwas schwieriger Mann zu sein … Ein federleichter und romantischer Roman! »Rosenhochzeit« von Lilly-Marie Engel ist ein eBook von feelings*emotional eBooks. Mehr von uns ausgewählte erotische, romantische, prickelnde, herzbeglückende eBooks findest Du auf unserer Facebook-Seite. Genieße jede Woche eine neue Geschichte - wir freuen uns auf Dich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Ähnliche
Lilly-Marie Engel
Rosenhochzeit
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Sommerwohlfühllektüre um die große Liebe, Hochzeit und Rosen!
Die Floristin Helen ist mit ihrem Leben höchst unzufrieden – bis sie unerwartet von ihrer Großmutter ein altes Haus mit verwildertem Rosengarten erbt. Gemeinsam mit Freunden und Verwandten nutzt sie das Anwesen, um ein Rundum-Paket für Traumhochzeiten anzubieten! Die alte Kutsche ihres Nachbarn Hannes wäre das i-Tüpfelchen auf ihrem Hochzeitskonzept – allerdings scheint Hannes ein etwas schwieriger Mann zu sein … Ein federleichter und romantischer Roman!
Inhaltsübersicht
1
Frau Hanke, es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber Sie sind mit Abstand die miserabelste Verkäuferin und Floristin, die ich je hatte.«
»Aber …«, stotterte ich und schluckte.
»Ich weiß, ich habe Ihrem Vater versprochen, Sie unter meine Fittiche zu nehmen«, unterbrach mich Herr Wessel, »aber Sie müssen doch selber sehen, dass Sie so ganz und gar nicht zu unserem geschäftlichen Konzept und unseren gehobenen Anforderungen passen.«
»Oh. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Herr Wessel, ich …«
»Mädchen, Ihr biederer Landhausstil ist ja wirklich zuckersüß, und ich muss zugeben, dass Sie ein geschicktes Händchen haben und nettes Zeug herstellen, aber unsere Klientel ist eher an modernes Design gewöhnt und verlangt nach besonderer Qualität, nicht nach biederen Hausfrauenbasteleien. Das, was Sie herstellen, ist einfallslos, viel zu bunt und hat keinen wahren Stil.«
»Oh, ich …«
»Und was gar nicht geht, Frau Hanke, sind Ihre Wohltätigkeiten! Oder glauben Sie, ich bekomme nicht mit, dass Sie die eine oder andere Blume verschenken!«
»Das mach ich doch nur, weil manche Kunden so traurig und so einsam sind. So eine winzig kleine Freude tut den Menschen gut. Sind ja nur Blümchen, nichts Teures. Außerdem stärkt es die Kundenbindung. Und ich zahle den Betrag stets aus eigener Tasche«, verteidigte ich mich lahm.
Herr Wessel sah mich streng und tadelnd an, sodass ich seinem eisernen Blick kaum standhalten konnte. Ich hatte immer geglaubt, in ihm so eine Art Mentor zu sehen, der mit Wohlwollen auf seine Angestellten schaut und sich über kreative Lebendigkeit freut, aber sein Blick war jetzt eiskalt. Seine massige Gestalt drückte Wut und Ärger aus, ja er wirkte regelrecht bedrohlich. Seine wohlformulierten Worte waren voller Sarkasmus und trafen mich völlig unvorbereitet. Die herbe Kritik war beleidigend und herabwürdigend. Meine Ohren glühten, mein Puls raste, meine Wangen verfärbten sich dunkelrot, als er jetzt laut schnaubte.
»Wir sind nicht das Sozialamt! Und Sie sind das auch nicht! Sie können mit Ihrer Sozialromantik hier keine Punkte gewinnen. Ich erwarte von meinem Personal ein einwandfreies Verhalten fern von Unterschichtentendenzen. Unsere Klientel ist weder traurig noch einsam. Das sind hochgestellte Persönlichkeiten, die unseren außerordentlichen, kompetenten und exklusiven Service in Anspruch nehmen, den wir uns gut bezahlen lassen. Was nichts kostet, ist nichts wert. Unsere Ware wird den allerhöchsten Erwartungen gerecht! Unsere Kreationen sind ultramodern. Wie unsere Kunden.«
Sprachlos starrte ich ihn an.
»Unsere Kunden vertragen keinen Kitsch!«, bellte er.
Herr Wessels Rüge machte sich als quälender Druck in meiner Magengegend breit und trieb mir die Tränen in die Augen. Ich blinzelte heftig, um Haltung zu bewahren und nicht in Tränen auszubrechen.
»Ich weiß, dass Sie es nur gut meinen in Ihrer jugendlichen Naivität«, lenkte Herr Wessel ein, »doch ich denke, es ist zu unser aller Besten, wenn wir Ihren Vertrag hiermit auflösen. Sie wissen, dass dies von beiden Seiten ohne Begründung und mit sofortiger Wirkung möglich ist, schließlich sind Sie in der Probezeit.«
»Ich weiß«, sagte ich keuchend.
Da war sie nun dahin, meine einmalige Chance im Blumenhaus Wessel. Ich schämte mich für mein Versagen und dachte an Papa, der sich bei Herrn Wessel, einem Bekannten seines besten Freundes, für mich eingesetzt hatte. Papa hatte mir diese Stelle besorgt, um wieder in der Nähe der Familie im Großraum Stuttgart leben zu können. Und nun brachte ich ihm nach nur vier Wochen Schande.
Wütend und enttäuscht presste ich die Lippen zusammen und versuchte, Herrn Wessel fest anzusehen.
»Und wenn ich Ihnen noch einen guten Rat mitgeben darf, Frau Hanke. Ziehen Sie aufs Land und versuchen dort Ihr Glück. In den ländlichen Regionen wird solide, aber langweilige Handarbeit noch geschätzt. Dort wird Ihr altmodischer kunterbunter Stil sicher Anklang finden, aber nicht hier in einer Großstadt wie Stuttgart.«
Sein Urteil war vernichtend für mich. Ich konnte kaum fassen, wie respektlos er über meine Arbeit sprach. Je eher ich hier wegkam, desto besser.
»Gut«, entgegnete ich trocken, »wie Sie wollen. Es tut mir leid, dass ich nicht Ihren Erwartungen entspreche. Ich werde auf der Stelle gehen, jetzt gleich. Den Lohn für die vier Wochen können Sie mir auf mein Konto überweisen. Auf Wiedersehen, Herr Wessel.«
Hocherhobenen Hauptes verließ ich die Verkaufsräume mit den silbrig glitzernden Vasen, dem grauen Granit und den gläsernen Elementen an den Wänden. Der nüchterne und farblose Stil dieser Menschen, die sich für etwas Besseres hielten und naserümpfend über alles herzogen, was nicht dem modernen Business entsprach, widerte mich sowieso an.
Das Blumenhaus Wessel mit seinem arroganten Inhaber und seiner herzlosen Ausstrahlung konnte mir gestohlen bleiben.
Herr Wessel lief mir in den Sozialraum hinterher.
»Sie können jetzt nicht gehen, Frau Hanke. Außer Ihnen ist niemand im Laden. Sie werden gefälligst heute noch hierbleiben.«
»Nein!«, sagte ich mit fester Stimme. »Sie haben mir soeben zu verstehen gegeben, was Sie von mir und meiner Arbeit halten. Sie haben mir gekündigt. Ich werde nicht länger hierbleiben.«
Herr Wessel stemmte die Fäuste in die Seiten und baute sich drohend vor mir auf.
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Papa diesen fiesen Menschen persönlich kannte. Andernfalls hätte er nie diese Empfehlung ausgesprochen. Jetzt hieß es, nicht zusammenzubrechen und ganz ruhig zu bleiben.
»Wenn Sie jetzt gehen, ziehe ich Ihnen diesen Tag vom Lohn ab!«
»Tun Sie, was Sie nicht lassen können.«
»Ich verklage Sie wegen Diebstahls! Sie haben wertvolles Eigentum des Blumenhauses Wessel verschenkt und somit gestohlen.«
Nun wurde mir heiß und kalt. Wie gut, dass ich die Blumen, die ich an die Kunden verschenkt hatte, selbst bezahlt hatte.
»Das können Sie nicht! Ich habe die Blumen gekauft. Die Kasse stimmt. Und nirgends steht, dass ich nicht auch Kunde dieses Blumenhauses sein kann. Lassen Sie mich jetzt bitte durch!«
Dieser Mensch konnte mich nicht mehr aufhalten. Sollte er doch sehen, wie er Petra oder Marion, die sonst noch hier arbeiteten, auftreiben konnte. Zur Not musste er selbst die Kunden bedienen.
Ich schnappte meine persönlichen Sachen und floh, so schnell ich konnte, auf die Königsstraße, die Haupteinkaufsmeile in Stuttgart. Völlig erschöpft blieb ich am Schlossplatz stehen und setzte mich auf eine freie Bank mit Blick auf das Stuttgarter Schloss.
Was für eine bittere Niederlage! Dieser Wessel hatte mich wie eine dumme Gans heruntergeputzt. Dabei besaß ich durchaus Berufserfahrung. Ich war vor Jahren meinem damaligen Freund nach Konstanz gefolgt, hatte dort die Lehre zur Floristin begonnen und abgeschlossen und hatte danach am Bodensee gearbeitet. Doch dann war die Beziehung zu Tom in die Brüche gegangen, und ich wollte wieder in der Nähe meiner Familie leben, vor allem auch deswegen, weil Mamas Gesundheit seit einiger Zeit schwächelte. Außerdem vermisste ich meine Cousine Martha und ihre Brüder. Als Einzelkind war ich mit ihnen aufgewachsen. Und natürlich mit meiner einzigartigen Oma Cara, mit der ich besonders viel Zeit verbringen durfte, da sie immer wieder auf uns Kinder aufgepasst hatte.
Mein Vater hatte mir zunächst die Einzimmerwohnung in Stuttgart besorgt und dann mitgeholfen, nach einer passenden Stelle für mich zu suchen. Ein Jahr lang hatte ich in einer kleinen Blumenhandlung in Esslingen ausgeholfen, bis mich der Tipp mit dem Blumenhaus Wessel aus Stuttgart erreichte. Dort hatten sie nach einer Ganztagskraft gesucht, was mir gerade recht gewesen war. Endlich konnte ich wieder richtig Geld verdienen und auf eigenen Beinen stehen.
Vier Wochen lang hatte dieser Traum gehalten.
Natürlich hatte ich sofort gemerkt, dass das Blumenhaus Wessel einen Stil vertrat, der mir so ganz und gar widerstrebte. Aber ich hatte gehofft, durch Freundlichkeit und Lebendigkeit einen Gegenpart zu der chromblitzenden Erstarrung, die innerhalb der nackten Betonwände des Blumenhauses herrschte, zu setzen. Ich hatte gehofft, dass meine Kreativität Anklang fand und das Spektrum des Angebots erweiterte. Mein Anliegen war gewesen, eine Ergänzung zu dieser lieblosen Nüchternheit zu bieten. Die Kunden des Blumenhauses waren wohlhabende Businessleute oder Neureiche gewesen, aber in ihren Herzen konnte ich bei manchen von ihnen dieselbe Leere finden wie in all den anderen, die mit bedrücktem Blick über die Straßen hetzten. Sie kannten dieselben Regungen wie jeder Mensch, und es war mir stets eine besondere Freude gewesen, für ein paar Sekunden in ihren Gesichtern ein freudiges Aufblitzen zu erkennen, wenn ich ihnen eine kleine Blume des Trostes überreichte. Diese paar Euro hatten mich nicht arm gemacht und die Kunden vergessen lassen, welch Kummer in ihnen herrschte. Und alle hatten dann sogleich versprochen, wiederzukommen. Für mich war dies ein Zeichen gewesen, mit meinem Engagement richtigzuliegen. Doch Herr Wessel mochte wohl keine mitdenkenden, innovativen Mitarbeiter. Er hatte mich entlassen und dafür gesorgt, dass mein Blick jetzt genauso leer und frustriert war wie der so manch eines Kunden.
Obwohl die Sonne schien und der grüne Rasen vor dem Schloss den einen oder anderen Passanten einlud, sich auf dem frischen Grün niederzulassen, konnte ich mich nicht mehr an diesem hellen Tag Anfang Juni erfreuen.
Soeben war ich tief verletzt worden. Dass er mich entlassen hatte, hatte mich gar nicht so hart getroffen, denn so etwas kommt immer wieder vor. Aber dass er dermaßen abfällig über meinen Stil gesprochen hatte, kränkte mich sehr. In diesem Moment wäre es mir lieber gewesen, er hätte einen Vorwand gefunden, um mich elegant loszuwerden. Aber seine knochentrockene, harte Ehrlichkeit hatte mich tief getroffen.
Ich wusste, dass ich schon immer ein Talent für Blumen und Pflanzen gehabt und bereits als Kind Kränze geflochten und Blumengebinde arrangiert hatte. Es war so einfach, die Schönheit der Natur zu lieben und mit ihr kreativ zu wirken. All meine Leidenschaft, meine Lebendigkeit und meine Liebe zu Farben und Formen steckten in meiner Arbeit. Und Herr Wessel hatte mich einfach abgekanzelt wie ein dummes Schulmädchen.
Die Sonne schien mir fröhlich ins Gesicht, doch mir liefen die Tränen hinunter und tropften in meine langen dunkelblonden Haare, die ich nun wie einen Vorhang vor mein Antlitz schob, damit niemand meine Tränen sehen konnte.
Umständlich suchte ich in meiner Handtasche ein Taschentuch und den kleinen Handspiegel. Meine dunkelblaue Wimperntusche war durch die Tränen zerronnen und lief mir in bläulichen Bächen die Wangen hinab. Der kleine Handspiegel zeigte mir ein rot verweintes Gesicht mit einer rot angelaufenen Nase und hellblauen Augen mit monsterhaften Blauschattierungen darunter. Mit ein wenig Spucke rieb ich die schlimmsten Spuren weg. Dann putzte ich mir die Nase und strich mir die Haare hinter die Ohren.
Meine weiße Hose und die teure Seidenbluse waren ebenfalls von den Tränen verschmutzt. Diese Sachen hatte ich mir für Wessels Blumenhaus kaufen müssen. Alle Mitarbeiterinnen waren zu diesem Kleidungsstil verpflichtet worden, um edel und elegant zu wirken, dabei war es nur unpraktisch, denn beim Umgang mit Pflanzen und Blumen war es beinahe unmöglich, immer blütenweiß zu bleiben. Darum besaßen auch alle Mitarbeiterinnen mehrere weiße Kleidungsstücke.
Das Kapitel Blumenhaus Wessel war also endgültig vorbei, und so straffte ich die Schultern und atmete noch einmal tief ein und aus, bevor ich mich von der Bank erhob und mich mitten am Tag auf den Heimweg machte.
Meine Wohnung lag im Stuttgarter Waldgebiet, in Sillenbuch, einer besseren Gegend in der Nähe des Fernsehturms, die ich mit der U-Bahn erreichte. Eigentlich war es beinahe unerschwinglich, in diesem Stadtteil eine bezahlbare Wohnung zu finden, aber meine Eltern hatten das Wunder möglich gemacht und mal wieder ihre Beziehungen spielen lassen. Das kleine Apartment unterm Dach in einer nostalgischen Jugendstilvilla war unglaublich gemütlich und reichte völlig aus, um in Stuttgart wieder Fuß zu fassen. Meine Vermieterin war eine sehr nette ältere Dame, die im ersten Stock der Villa in der Zweizimmerwohnung lebte und stets für einen kleinen Plausch nach Feierabend aufgelegt war. Sie schätzte es, wenn ich ihr im Garten half, zumal ihre Mieter im Erdgeschoss mit ihren beiden Kindern kaum Zeit dafür hatten. Ich packte gerne mal mit an und konnte hilfreiche Tipps geben, wenn es um Blumenthemen ging. Dafür war die Miete wirklich absolut fair berechnet und weit unter dem üblichen Mietspiegel angesetzt.
Frau Hügele, die mir sonst immer fröhlich zulächelte, wenn ich nach Hause kam, empfing mich heute mit einer so traurigen Miene, dass ich mir sofort Sorgen um sie machte. Sogleich vergaß ich meine eigene Misere.
»Frau Hügele, was ist denn mit Ihnen los? So betrübt habe ich Sie schon lange nicht mehr gesehen. Ist was passiert?«
Frau Hügele senkte den Kopf und vermied es, mir in die Augen zu blicken. Es war offensichtlich, dass sie etwas bedrückte, was ihr wohl sehr unangenehm war. Dass sie mich nicht direkt anschauen konnte, passte gar nicht zu ihrer sonst freundlichen Art.
»Es tut mir so leid, Frau Hanke, wirklich. Ich wünschte, es wäre anders.«
Nun wurde ich stutzig. »Alles in Ordnung?«, fragte ich.
»Nein, ganz und gar nicht.«
»Wollen Sie es mir nicht erzählen? Sie wissen doch, dass ich immer ein offenes Ohr für Sie habe.«
»Ach, Frau Hanke …«, sagte sie nur und wagte nun endlich, den Blick zu heben.
Ihre traurigen Augen waren ganz feucht. Sie fuhr sich mit der rechten Hand, die noch in einem Gartenhandschuh steckte, über das ansonsten so gepflegte Gesicht und hob bedauernd die Schultern. »Es tut mir unendlich leid, Frau Hanke«, wiederholte sie und sah mich zerknirscht an.
»Nun rücken Sie schon raus mit der Sprache! Wo drückt der Schuh?«
»Ich muss Ihnen kündigen, Frau Hanke. Leider.«
»Nein!«, entfuhr es mir. Ich glaubte, mich verhört zu haben. Das konnte nicht sein! Erst die Kündigung der Arbeitsstelle, jetzt die Kündigung der Wohnung! Welch böser Geist hatte es auf mich abgesehen?
Noch bevor ich etwas sagen konnte, fuhr Frau Hügele fort: »Mein Sohn wird sich scheiden lassen. Das ist traurig genug. Aber seine Frau, meine Schwiegertochter, macht ihm Schwierigkeiten. Die beiden können nicht mehr lange unter einem Dach leben. Er braucht bald eine eigene Wohnung.«
»Eigenbedarf also«, flüsterte ich tonlos.
»Es tut mir wirklich so leid, Frau Hanke. Aber ich kann den Bremers mit den beiden Kindern nicht kündigen. Außerdem wäre die Vierzimmerwohnung im Erdgeschoss viel zu groß für meinen Sohn. Und in meiner Zweizimmerwohnung ist kaum Platz für zwei Personen. Bleibt also nur Ihr Apartment.«
»Ich verstehe.«
»Glauben Sie mir, es wäre mir auch lieber, alles wäre anders gekommen.«
»Mir auch.«
»Tja, ich habe nun mal nur dieses eine Haus. Sie leben alleine, Frau Hanke. Sie werden bald eine neue Wohnung finden. Ganz bestimmt. Sie müssen nicht Hals über Kopf ausziehen. Die gesetzlichen Fristen gelten natürlich.«
Ich seufzte und dachte daran, wie schnell sich das Leben ändern konnte, sozusagen von einer Sekunde auf die andere.
»Ich wollte es Ihnen persönlich sagen, bevor ich die Kündigung schreibe. Glauben Sie mir, es ist eine Notlage. Günther ist doch mein einziger Sohn.«
»Sie müssen sich nicht rechtfertigen, Frau Hügele. So ist das Leben, nicht wahr? Es ist doch selbstverständlich, dass Sie Ihren Sohn wieder nach Hause holen. Es war auf jeden Fall schön, bei Ihnen zu wohnen, ehrlich. Ich werde schon was anderes finden.«
Ich mochte Frau Hügele. Dass es ihr wirklich aufrichtig leidtat, war ihr anzusehen. Trotzdem konnte ich nicht verhindern, dass mir wieder die Tränen in die Augen traten. Das Leben war ungerecht.
Frau Hügele tätschelte meinen Arm. »Nicht weinen, junge Frau, nicht weinen.«
»Doch«, schluchzte ich und lag plötzlich in ihren Armen. Sturzbäche an Tränen flossen über meine Wangen. Mein ganzer Frust brach aus mir heraus.
Frau Hügele streichelte mich und flüsterte mir tröstende Worte zu, die ich gar nicht richtig verstand. Zwei Köpfe kleiner als ich, legte sie beide Arme um mich und wartete in Ruhe mit mir ab, bis es mir wieder besser ging. Dann setzten wir uns auf die Holzbank im Garten, und ich erzählte ihr von den Beleidigungen und der Kündigung im Blumenhaus Wessel.
»Und jetzt komm ich auch noch mit der Kündigung der Wohnung. Das ist wirklich zu viel.«
»Das konnten Sie nicht wissen.«
»Nein, konnte ich wirklich nicht. Es tut mir trotzdem leid.« Wir schwiegen eine Weile, dann beteuerte sie, dass sie den arroganten Wessel mit seinem Größenwahn noch nie hatte leiden können. »Dort wirkt alles künstlich, selbst die lebendigste Blume. Und dieses entsetzliche Grau überall! Alles so Schickimicki. Nur für Bessere. Seien Sie froh, dass Sie dort fort sind. Sie wären da niemals glücklich geworden.«
Nun, so konnte man es auch sehen. Aber Frau Hügele hatte recht, irgendwann würde ich dankbar sein, dem Wessel und seiner nüchternen Atmosphäre entkommen zu sein.
»Sie sind doch viel zu kreativ für so einen traurigen Laden. Sie wären dort wie eine Primel eingegangen.«
Ich musste zum ersten Mal an diesem Tag lächeln.
»Stimmt«, erwiderte ich.
»Und jetzt, da Sie die Wohnung auch bald los sind, sind Sie frei! Sie können gehen, wohin Sie wollen. Wohin Ihr Herz Sie trägt.«
Ich wusste, dass sie das sagte, um sich selbst zu beschwichtigen und ihr Gewissen zu beruhigen, aber es war in diesem Moment für mich in Ordnung. Frau Hügele war kein schlechter Mensch. Sie reagierte eben auch auf die Wendungen des Lebens wie jeder andere.
»Was ist mit Ihrem Sohn?«, fragte ich, um endlich von meinem Schicksal abzulenken.
Frau Hügele erzählte mir, wie traurig sie war, dass ihr Sohn sich scheiden ließ und dass die Schwiegertochter alle Register zog, um Unfrieden zu stiften.
»Das bedrückt mich sehr«, gab sie zu, und nun war es an mir, sie zu trösten.
»Wer weiß, zu was es gut ist«, orakelte ich. »Vielleicht trifft Ihr Sohn bald auf eine Frau, die ihn so lieben kann, wie er ist, und gerne mit ihm ihr Leben teilt.«
»Das sagen Sie so nett, Frau Hanke.«
»Das meine ich wirklich so. Vielleicht ist das jetzt die ganz große Chance für ihn. Er muss jetzt nur noch durchhalten und den Scheidungskrieg überstehen. Aber bei Ihnen im Elternhaus hat er ja ganz gute Karten. Das Apartment unterm Dach ist wundervoll. Er wird sich dort wohlfühlen.«
Frau Hügele nickte. »Das haben Sie schön gesagt, liebe Frau Hanke.«
Ich drückte ihre Hände. »Sie haben mich doch auch gerade wieder aufgebaut.«
»Na ja, nachdem ich Ihnen die Bleibe weggenommen habe, war ich Ihnen das schuldig. Wenigstens das. Aber ich bin wirklich überzeugt, dass Sie bald eine bessere Arbeit und ein wunderschönes Zuhause finden werden.«
Mit diesen Worten verabschiedeten wir uns voneinander.
Ich ging ins Haus und fuhr mit meinen Händen über das glatt polierte Holzgeländer. Langsam stieg ich die Treppe hinauf und dachte dabei noch einmal über die letzten Stunden nach, die meinem Leben eine neue Wendung gegeben hatten. Wessels verletzende Worte schmerzten nicht mehr ganz so schlimm. Dennoch war es ein harter Schlag. Noch nie in meinem Leben hatte jemand verheerendere Worte über meine Arbeit geäußert. Auch wenn ich tief in mir wusste, dass Wessel unrecht hatte und eine sehr eingeschränkte Sicht der Dinge von sich gab, wirkten seine Beleidigungen wie Gift für mein Selbstbewusstsein. Wessel hatte etwas geschafft, was bisher noch nie jemand geschafft hatte. Er hatte Zweifel in meinem Herzen gesät. Ich begann, an meinem Stil und meinem Wirken zu zweifeln, mich selbst zu hinterfragen und darüber nachzugrübeln, ob ich als Floristin wirklich meiner Bestimmung im Leben folgte.
Mit einem hatte Herr Wessel auf jeden Fall recht, ich war keine geborene Verkäuferin. Das Verkaufen war so gar nicht mein Talent. Ich sah mich eher als kreative Künstlerin, die aus Blumen und Blüten, aus Zweigen, Blättern, Früchten und Accessoires wundersame Dekorationsgebilde erschuf und den Menschen damit Freude bereitete. Genau das war der Antrieb meines Tuns, meine Begeisterung und Leidenschaft. Aber ohne das Verkaufstalent, wie es zum Beispiel meine Cousine Martha besaß, würde ich wohl kaum auf einen grünen Zweig kommen, schon gar nicht in der Großstadt.
Nachdenklich setzte ich mich auf mein Sofa und nahm den Raum noch einmal ganz bewusst wahr. Dieses kuschelige Apartment würde bald nicht mehr zu mir gehören.
Eine Welle des Selbstmitleids umspülte mich und ließ mich seufzen. Fast kam es mir wie ein böser Traum vor, dass ich meine Arbeit und meine Wohnung innerhalb weniger Stunden verloren hatte. Wie schnell sich doch alles ändern konnte! Aber immerhin war ich gesund, hatte eine wunderbare Familie und würde sicher bald einen Neuanfang machen können. Das Leben ging schließlich weiter. Mit diesem tröstenden Gedanken kuschelte ich mich in die Kissen meines Sofas und versuchte, mich zu entspannen. Doch ich war immer noch zu aufgewühlt und zu wütend auf Herrn Wessel, um gänzlich zur Ruhe zu kommen. Ein Telefonat mit meiner Cousine Martha würde mir jetzt guttun. Martha und ich waren nämlich nicht nur Cousinen, sondern auch Freundinnen. Während meiner Zeit am Bodensee war sie es gewesen, die ich am meisten vermisst hatte. Sie war mir wie eine Schwester, eine enge Freundin und Vertraute. Obwohl sie so anders war als ich, konnten wir miteinander lachen, alles austauschen und uns aufeinander verlassen. Marthas Talent, die Dinge ganz pragmatisch zu sehen, alles gut zu planen und stets die Übersicht zu bewahren, half mir, mich nicht nur schüchtern hinter meiner Kreativität zu verstecken, sondern meine Werke auch selbstbewusst zu präsentieren. Martha hatte mir beigebracht, stolz auf mein Können zu sein, wie auch sie stolz auf ihre Fähigkeiten war. Als selbstständige Weddingplanerin verband sie kreative Ideen mit Durchsetzungskraft und dem nötigen Biss, sich von anderen abzuheben. Das bewunderte ich stets an ihr, während sie mein Einfühlungsvermögen zu schätzen wusste und mich immer mal wieder um Rat fragte, wenn sie mit schwierigen Kundenwünschen zu tun hatte. Ich wusste meistens eine Lösung, auch für verzwickte Situationen zwischen den Hochzeitspaaren und ihren Eltern.
Per WhatsApp fragte ich Martha, ob sie Zeit für ein Gespräch habe, und sie antwortete sofort. Also rief ich sie an und schilderte ihr sogleich die schlechten Neuigkeiten.
»Mist!«, tönte es. »Das tut mir aber echt leid für dich. Du hast wirklich was Besseres verdient als diesen Wessel. Soll er mal sehen, wie er so schnell eine bessere Floristin bekommt. Der stellt sich so eine Designerschnepfe vor, dabei wollen die Leute was mit Herz, vor allem hier im Ländle.«
»Danke, Süße, das ist lieb von dir. Dein Trost tut mir gut.«
»Ich kann verstehen, wie’s dir geht, und dann auch noch das mit der Wohnung. Aber dafür bist du frei und kannst dir eine neue suchen, sobald du wieder eine Stelle hast, nahe am Arbeitsplatz. Das hat wirklich Vorteile.«
Von dieser Seite hatte ich die Lage noch gar nicht betrachtet. Aber Martha hatte recht, eine Wohnung in der Nähe der Arbeitsstelle hatte immense Vorteile.
»Außer dass es schwierig ist, in der Stadt immer gleich eine bezahlbare Bleibe zu finden«, griff Martha den Faden wieder auf und unterbrach meine Gedanken.
»Stimmt«, erwiderte ich seufzend.
»Aber du musst ja nicht direkt in Stuttgart arbeiten. Gärtnereien gibt es überall, und Blumenläden auch. Da wird sich schon was für dich auftun.«
»Ich hasse Veränderungen, vor allem, wenn sie so plötzlich kommen.«
»Ich weiß, da bist du ganz anders als ich. Aber dort, wo du jetzt warst, hattest du wirklich keine Zukunft. Ich hatte von Anfang an ein komisches Gefühl. Der Laden ist ja wie geschleckt, und der Wessel macht krampfhaft auf Purismus. Das wird der Blumenvielfalt nie und nimmer gerecht. Wenn ich da nur an meine Kunden denke! Die wollen aus der Vielfalt der Möglichkeiten schöpfen können.«
Ich mochte es, wenn Martha ins Schwärmen kam und von ihren Hochzeitspaaren erzählte. Dann blitzten ihre blaugrünen Augen vergnügt und schelmisch. Im Moment konnte ich sie zwar nicht sehen, aber an ihrem Ton erkannte ich mal wieder, wie sehr sie ihren Beruf liebte. Wie schade, dass die Gärtnereien, mit denen sie zusammenarbeitete, im Augenblick keine Floristin brauchten.
»Ich kann ja mal nachfragen, ob eine meiner Gärtnereien vielleicht doch jemanden braucht«, sprach Martha meine Gedanken aus. »Das wäre natürlich ideal. Die sind alle unheimlich nett und kreativ. Da kommt jedes Brautpaar auf seine Kosten. Letztens hatten wir sogar einen Brautstrauß aus Gewürzen und Heilkräutern, stell dir vor!«
»Warum auch nicht?«
»Ja, den hätte man locker verkochen können. Orangefarbene Rosen, Thymian, Rosmarin, Minze, Lavendel und Ahornblätter, gebunden wie ein Biedermeierstrauß und duftend, dass man richtig Appetit bekommen hat. Die Braut ist schließlich Heilpraktikerin.«
»Prima Idee. Hätte von mir sein können. Am Bodensee habe ich auch oft Kräutersträuße mit Blüten gebunden.«
»Wir finden schon einen Job für dich, ganz bestimmt.«
»Ja«, erwiderte ich lahm. Für heute war mein Enthusiasmus ziemlich gebremst.
»Weißt du was«, schlug Martha jetzt vor, »ich hole dich ab, und dann machen wir uns einen richtig schönen Abend. Was meinst du?«
»Hm, ich weiß nicht.«
»Aber ich! Das bringt dich auf andere Gedanken. Du musst jetzt raus aus deinem Loch. Wir werden einen wunderbaren Abend haben.«
»Na ja … Gib mir eine Minute zum Überlegen, in Ordnung?«
»Wie du willst, Helen. Ich könnte in einer Dreiviertelstunde bei dir sein.«
»Also gut, überredet. Hier hänge ich sowieso nur rum und weiß nichts mit mir anzufangen.«
»Bis gleich also. Tschüss, Süße.«
Wir beendeten das Gespräch, und ich eilte sogleich ins Bad, um mich ein wenig aufzumöbeln und die Haare hochzustecken. Dann trug ich neue Wimperntusche auf und flocht mir ein hellblaues Band in die Haare, das perfekt zu meiner Augenfarbe passte. Das kleine Lächeln, das um meine Lippen spielte, vertrieb meine düsteren Gedanken vollends.
Da ich kein eigenes Auto besaß, holte mich Martha wie versprochen zu Hause ab. Ihr hellroter Mercedes Kombi war mit ihrem Logo bestückt und machte Werbung für ihre »Happy Hochzeitsplanung – außergewöhnliche Ideen für einzigartige Hochzeiten«. Martha hatte in Esslingens Altstadt in einem windschiefen Haus in einer mittelalterlichen Gasse eine schnuckelige Wohnung und auch ihr kleines Büro. Um mich abzuholen, musste sie hinauf auf die Filderebene fahren und dann den Landkreis verlassen. Sillenbuch, als Stuttgarter Stadtteil direkt an der Landkreisgrenze zu Esslingen, war gut zu erreichen. Und da der übliche Berufsverkehr noch nicht eingesetzt hatte, war sie sogar früher da als geplant, was aber nichts ausmachte, da ich schon im Garten auf sie wartete.
»Hi«, begrüßten wir uns und umarmten uns. Marthas schulterlange rotblonde Locken kitzelten mich in der Nase, sodass ich niesen musste.
»Keine Erkältung, nur deine Locken«, beschwichtigte ich schnell.
»Kein Problem, ich bin fit wie ein Turnschuh. Mich bringt so schnell nichts aus dem Gleichgewicht. Und jetzt lass uns los. Was hältst du von einem Bummel durch Esslingen?«
»Prima«, stimmte ich fröhlich zu und setzte mich auf den Beifahrersitz.
»Ich dachte an eins der Cafés am alten oder neuen Rathaus. Oder auf der Brücke. Und dann können wir hoch zur Burg, um die Kalorien wieder abzustrampeln.«
Ich kicherte. Im Gegensatz zu mir musste Martha immer wieder mit den Pfunden kämpfen. Sie hatte aber auch einen unstillbaren Drang zu süßem Gebäck, was ihr Leben in Esslingens Altstadt und den zahlreichen Cafés nicht einfacher machte. Andererseits war sie sehr sportlich und konnte ihre Schlemmereien wieder ausgleichen. Ich hingegen war weder sehr sportlich, noch hatte ich einen Hang zu Süßigkeiten. Nur selten hatte ich Lust auf ein »süßes Stückle«, wie man im Schwabenland sagte. Entsprechend ließen meine Rundungen zu wünschen übrig, aber das kümmerte mich kaum. Ich hatte mich mit meinem Bohnenstangenaussehen gut arrangiert.
Martha und ich sahen unseren Müttern ähnlich, die zwar Schwestern waren, aber gar nicht wie Geschwister ausschauten. Meine Mutter war groß, strohblond und ziemlich dünn. Marthas Mutter war zwar ebenfalls groß, aber mit einer eher fraulichen Figur und mit einem lockigen Wuschelkopf gesegnet, der dafür sorgte, dass ihre rotblonden Locken manchmal wirr vom Kopf abstanden. Auch Martha und ihre Brüder mussten mit ihren wilden Locken kämpfen, während ich nur kurz mit einem feinzinkigen Kamm durch meine extrem glatten und dünnen Haare streichen musste, um gekämmt auszusehen.
»Oma Cara geht es nicht gut«, sagte Martha plötzlich.
»Echt? Was hat sie?«, fragte ich erschrocken.
»Anscheinend eine Lungenentzündung, sagt Mama. Und Fieber. Wohl eine Grippe. Aber mehr weiß ich auch nicht.«
»Oje, das klingt nicht gut. Meinst du, wir sollten sie besuchen?«
»Nein, sie will und braucht ihre Ruhe. Da ist sie ganz eigen. Wir kennen sie ja. Wenn sie krank ist, will sie sich zurückziehen. Aber Mama schaut regelmäßig nach ihr. Und deine Mama auch. Also ist sie in besten Händen.«
»Das hoffe ich«, murmelte ich nachdenklich.
Oma Cara war die Mutter unserer Mütter. Sie war schon immer eine ganz eigentümliche Frau, sehr kreativ, mutig, autonom und willensstark. Sie hatte ihre Töchter alleine großgezogen und sich mit einem Kindermodelabel selbstständig gemacht. Die Kleidungsstücke waren so hübsch, dass es genügend Kunden gab, die sich für ihre Kinder das eine oder andere Teil anfertigen ließen. Manchmal musste Oma ganze Nächte durcharbeiten, um den Aufträgen gerecht zu werden. Und manchmal beschäftigte sie auch die eine oder andere Näherin im Ort, die die Näharbeit vervollständigte. Dennoch wunderten wir uns manchmal, wie sie es schaffte, allein von ihrer Arbeit leben zu können. Zwar waren meine Cousine, meine Cousins und ich in ihren Kleidern aufgewachsen, um auf ihre Designerstücke aufmerksam zu machen, aber wir wussten nie so genau, wie sie es geschafft hatte, sich und ihre Töchter ohne Hilfe und finanzielle Unterstützung durchzubringen. Bei den heutigen Lebenshaltungskosten war es uns ein Rätsel, wie sie ohne andere Einkünfte durchgekommen war. Und sie hatte immer ein Geheimnis um den Vater ihrer beiden Töchter, die zweieiige Zwillinge waren, gemacht. Beharrlich hatte sie geschwiegen, wenn sie danach gefragt wurde.
Oma hatte als junge Frau im katholischen Neuhausen auf den Fildern gelebt. Dieser Ort war für seine wilden Fastnachtsaktivitäten bekannt. Angefangen von aufwendigen und anspruchsvollen Prunksitzungen bis hin zur Weiberfastnacht, zum Sturm auf das Rathaus und dem Fastnachtsumzug mit Hexen, Beelzebuben und anderen Furcht einflößenden Masken und Fratzen, war die Neuhausener Fasnet, wie sie hier im Raum genannt wurde, ein wirklich ausgelassenes Spektakel. Und Oma hatte sich hinter der Behauptung versteckt, sie habe sich betrunken von einem unbekannten Maskenträger schwängern lassen. Auch das Geburtsdatum ihrer Töchter mit der Fastnacht als Zeugungstermin stimmte überein. Aber wirklich geglaubt hat diese seltsame Geschichte niemand aus der Familie. Omas Töchter hatten es irgendwann aufgegeben, nach ihrem Vater zu fragen. Sie hatten geheiratet und eigene Familien gegründet. Meine Mutter Christina hatte allerdings nur ein Kind bekommen, mich. Nach der Entbindung hatte sie eine Ausschabung erhalten, wobei zu viel Gewebe abgetragen worden war, weshalb sie keine Kinder mehr austragen konnte. Dafür hatte Tante Veronika gleich drei Kinder bekommen.
Martha und ich setzten uns in das kleine Café auf der Brücke in der Fußgängerzone und beobachteten grinsend die vorbeischlendernden Passanten. Anschließend bummelten wir durch die Altstadt und gönnten uns die Aussicht von der Burg hinunter auf die Stadt.
Als Martha mich zurück nach Sillenbuch fuhr, war es draußen immer noch hell. Schließlich lockte der Juni mit Helligkeit und Gemütlichkeit und tauchte die Stadt in rotgoldenes Abendlicht. Ich liebte diese sommerliche Stimmung. Für mich hätte es immer Juni sein können, warm, hell und voller Blumen und Blüten. Der Juni war mein liebster Monat im Jahr.
Ich atmete tief ein und aus und dankte Martha für die Ablenkung und die Tour durch Esslingens mittelalterliche Gassen. Am Gartentor winkte ich ihr so lange nach, bis ihr Wagen nicht mehr zu sehen war. Dann begab ich mich in mein Apartment und machte es mir gemütlich.
Um mich vor dem Schlafengehen nicht mehr mit den Kündigungen auseinanderzusetzen, klickte ich auf Netflix, einem Anbieter für internationale TV-Serien und Filme, meine Lieblingsserie Reign an. Ich tauchte in die fantastisch aufbereitete Version von Mary Stewart im Originalton mit deutschen Untertiteln ein. Erst als mir die Augen zufielen und ich kein Wort mehr von den Untertiteln lesen konnte, schaltete ich aus und legte mich ins Bett.
Doch der Schlaf wollte sich trotz meiner Müdigkeit nicht einstellen. Ich wälzte mich von der einen auf die andere Seite und wurde immer unruhiger. Es war mir, als ob die Kündigungen nur der Anfang von einer ganz neuen, nicht stressfreien Veränderung in meinem Leben wären. Mein Bauchgefühl meldete sich und schlug Alarm. Große Herausforderungen würden auf mich zukommen, das ahnte ich. Ob ich wollte oder nicht, das Leben würde die eine oder andere Überraschung für mich bereithalten. Ich fühlte mich wie auf einem Pulverfass. Ein ängstliches Grauen schlich über meinen Nacken und bereitete mir Gänsehaut. Ich schalt mich selbst, machte die Nachttischlampe an und setzte mich im Bett auf, um meine Nerven zu beruhigen. Doch irgendetwas lauerte auf mich, ohne sich zu erkennen zu geben. Irritiert legte ich mich wieder hin und knipste die Lampe aus. Vielleicht würde es mir jetzt gelingen, endlich einzuschlafen. Doch das ungute Gefühl blieb bei mir und legte sich wie ein Schatten auf mein Gemüt.
Meine Nervosität begleitete mich schließlich in den Schlaf hinein und machte auch vor wilden Träumen keinen Halt. Und so erwachte ich ziemlich zerschlagen und mit diesem ziemlich unheimlichen Gefühl, das ich ganz und gar nicht zuordnen konnte.
Noch bevor ich mir einen Kaffee machte, klingelte mein Telefon.
»Oma Cara ist heute Nacht gestorben«, teilte mir meine Mutter mit trauriger Stimme mit.
2
Mit einem Schlag war ich wach. Nun wusste ich, was meine Unruhe zu bedeuten hatte. Oma Cara war tot!
Ich konnte es nicht fassen. Heiße Tränen liefen mir lautlos über die Wangen. Meine Mutter schluchzte ebenfalls in den Hörer.
»Es ging alles ganz schnell«, wisperte sie. »Noch vor ein paar Tagen war sie fit wie immer. Ich begreife es nicht.« Ihre Stimme brach. Sie schnäuzte sich und hustete ein paarmal.
»O Mama, das kann doch nicht wahr sein! Nicht Oma Cara!«
»Doch, Kind. Diese Sommergrippe war tückisch. Tante Veronika war bei ihr, als sie einfach aufhörte zu atmen. So gegen Mitternacht.«
Das war genau die Zeit gewesen, in der ich diese unerklärliche Unruhe gespürt hatte. Als hätte ich es geahnt.
Obwohl ich unendlich traurig war, war die Unruhe verschwunden. Ein friedliches Gefühl breitete sich in mir aus.
»Oma geht es gut«, flüsterte ich und hielt dann erschrocken die Hand vor den Mund, was meine Mutter ja nicht sehen konnte.
»Das glaube ich auch«, erwiderte sie, als hätte sie meine Gedanken gelesen. Dann fing sie wieder an zu weinen.
Auch mir liefen die Tränen weiterhin über die Wangen. Oma Cara war ein wichtiger Teil meines Lebens gewesen. Ihre Unabhängigkeit, ihr kreatives Wirken und ihr Charme hatten mich stets begeistert. Sie war gar nicht wie eine herkömmliche Großmutter gewesen, sondern eine Frau, die wusste, was sie wollte, und die ganz authentisch war. Zu uns Kindern war sie immer liebevoll gewesen, aber sie hatte nie mit uns typische Kinderspiele gespielt. Sie hatte uns immer zum selbstständigen Denken und einer unkonventionellen Lebensweise angehalten. Am meisten hatte Martha von ihr profitiert, während ich eher zurückhaltend im Wesen blieb. Das konnte auch Oma Cara nicht ändern. Dennoch ging sie ganz persönlich auf mich ein und förderte meine Kreativität.
»Du bist ein Teamplayer, Helen«, hatte sie oft zu mir gesagt. »Such dir Menschen, die an deiner Seite sind und mit denen du zusammen etwas aufbauen kannst. Dann wirst du dich wohlfühlen und kannst dich ganz und gar deiner Kunst widmen. Martha und ich sind eher dazu gemacht, alleine etwas durchzuboxen. Du kannst das zwar auch, aber es kostet dich zu viel Kraft. Mach es dir deshalb einfach, ganz deinem Naturell entsprechend.«
Ich hatte ihre Worte immer noch im Ohr. Unvorstellbar, dass Oma Cara nicht mehr da war! Sie war einfach gegangen, ohne Abschied. Einfach so. Mitten aus dem Leben heraus. Ich würde sie nie wiedersehen, nie mehr mit ihr reden können oder ihr beim Entwerfen von neuen Schnitten zusehen. Unglaublich!
Für mich war Oma Cara beinahe unsterblich gewesen, eine Frau, die alles schaffte, was sie wollte, und die immer stark und unantastbar erschienen war. Nun war sie tot!
Einen Moment lang fühlte ich mich so unbeschreiblich elend, dass ich keine Worte für diese Pein hatte. So gelang es mir auch nicht, tröstende Worte für meine Mutter zu finden, die immer noch vor sich hin schniefte.
Mama schien zu merken, dass sie mich mit ihrer Trauer überforderte, denn sie hielt abrupt inne, entschuldigte sich beinahe schroff und beendete das Gespräch mit der banalen Floskel, sie müsse sich jetzt zusammen mit ihrer Schwester um die Formalitäten und alles Weitere kümmern.
Ein paar Sekunden später war ich ganz alleine mit meiner Trauer und wusste nicht, was ich tun sollte. Der Schock saß so tief, dass ich nach ein paar lähmenden Minuten planlos im Apartment herumlief und keinen Nerv hatte, zu duschen oder mich anzuziehen. Erst viel später gelang es mir, mich wieder auf die Belanglosigkeit des Alltags einzulassen. Und noch viel später telefonierte ich mit meinen Cousins Andreas und Alexander, mit Martha, Tante Veronika und Onkel Hans. Alle wussten Bescheid. Wir würden uns nun gemeinsam um die Formalitäten, die Beerdigung und die Auflösung des Hausstands kümmern.
Da Oma Cara in einer kleinen Mietwohnung in dem idyllischen Ort Beuren, gelegen am Rande der Schwäbischen Alb, lebte, war der Weg nicht weit, um sich vor Ort um alles zu kümmern. Als Arbeitslose hatte ich ja jetzt genügend Zeit, um mich tatkräftig einzusetzen und meiner Mutter sowie meiner Tante unter die Arme zu greifen.
So verbrachten wir alle zusammen die nächsten Tage damit, die Beerdigung zu organisieren und uns von Oma Cara würdig zu verabschieden.
Oma hatte in einem Ordner vermerkt, dass sie sich im Falle ihres Ablebens eine unkonventionelle Trauerfeier wünsche, ein ganz eigenes Ritual ohne religiösen Hintergrund. Als Freigeist war sie nie Mitglied einer Kirche oder Glaubensgemeinschaft gewesen, hatte sich stets davon ferngehalten, um ihr eigenes Leben als alleinerziehende Mutter und Künstlerin führen zu können.
Sie hatte verfügt, dass die Feier von einer Zeremonienmeisterin und freien Rednerin gestaltet werden und meine Blumenkunst dabei eine wesentliche Rolle spielen sollte. Die Adresse der Zeremonienmeisterin hatte sie säuberlich niedergeschrieben, sodass ich nur anerkennend den Kopf schütteln konnte. Sie hatte wirklich an alles gedacht. Außerdem hatte sie den Ordner stets gut sichtbar in ihrem Regal stehen gehabt, sodass wir sofort über ihre Wünsche Bescheid wussten. Sie wollte ein Grab unter einem Baum, was durchaus machbar war, weil einige Gemeinden schon einen Friedwald für diese Wünsche bereitstellten.
Martha und ich sollten uns also um diesen Teil ihrer Verfügung kümmern und uns mit der freien Rednerin in Verbindung setzen, während die offiziellen Formalitäten wie Einäscherung und Bestattung von unseren Eltern organisiert werden sollten.
Omas Ordner enthielt darüber hinaus den Hinweis auf ein Testament, das in einem Bankschließfach hinterlegt war und um das sich meine Eltern ebenfalls kümmern wollten. Den Schlüssel und die Vollmacht dazu fanden wir ebenfalls in ihrem Ordner. Allerdings glaubte niemand von uns, dass Oma uns irgendwelche Reichtümer hinterließ. Wir vermuteten ein eher originelles und künstlerisches Schreiben, das uns über den Verbleib ihrer Stoffe, Schnitte und so mancher Kleinigkeiten informieren würde.
Wie sehr wir uns täuschten, konnte zu diesem Zeitpunkt keiner ahnen. Tatsächlich hinterließ Oma uns ein kleines Vermögen. Und sie enthüllte auch endlich ihr großes Geheimnis, nämlich den Vater ihrer Töchter.
Wir standen alle in Omas Wohnzimmer, als mein Vater den Letzten Willen unserer Großmutter vorlas. Der Inhalt des gesamten Bankschließfachs lag vor uns auf Omas Esstisch.
»Ihr Lieben«, so begann ihr Testament, »nun ist es also so weit. Ein Teil von mir ist weitergezogen in eine noch unbekannte Ebene, die mir aber ebenso aufregend erscheinen wird wie dieses Leben, das ich nun hinter mir gelassen habe. Es tut mir unendlich leid, nicht mehr bei Euch zu sein. Aber jeder von uns ist eben nur für eine Weile auf der Welt.
Ich weiß, Ihr habt immer geglaubt, ich sei bettelarm. Aber das war ich nie! Allerdings war ich zu stolz, um das Vermögen, das ich im Lauf der Jahre angesammelt habe, für mich zu verbrauchen. Denn es war nicht wirklich mein Vermögen. Ich hatte hingegen den Ehrgeiz, es ganz alleine zu schaffen und von meiner Hände Arbeit zu leben. Und das ist mir tatsächlich gelungen. Liebe Christina, liebe Veronika, ich habe stets geschwiegen und Euch die Existenz Eures Vaters vorenthalten. Die Geschichte, die Ihr kennt, ist eine Lüge. Ich tat dies, um andere Menschen zu schützen, und ich hoffe, dass Ihr mir das eines Tages verzeihen könnt. Es wird Euch vielleicht schockieren, aber ich war als junge Frau jahrelang die Geliebte eines sehr reichen älteren Mannes, der verheiratet und Vater von drei Kindern war. Wir führten ein Doppelleben, bis er ins Ausland versetzt wurde und mit seiner Familie wegziehen sollte. Da war ich schon schwanger mit Euch beiden Mädchen. Werner wollte seine Familie für mich und Euch verlassen, aber das wollte ich nicht. Außerdem hatte das Schicksal anderes mit ihm vor, als seine Frau schwer erkrankte. Er nahm sie also mit ins Ausland, pflegte sie und schickte mir regelmäßig Geld für Euch, was ich angelegt habe. Nie habe ich auch nur einen Pfennig davon angerührt. Auch wollte ich nicht, dass Werner Kontakt mit uns aufnahm, um seine kranke Frau und seine anderen Kinder zu schützen. Werners Frau starb einige Jahre später, aber ich lehnte es ab, nun seine Frau zu werden und ihm ins Ausland zu folgen. Ich hätte hier alles aufgeben müssen, was ich mir schwer erarbeitet habe. Ich tauge zudem nicht fürs Eheleben, sondern bin durch und durch Künstlerin, und meine Unabhängigkeit geht mir über alles. So lebte ich weiter mit dieser Lüge und schwor mir, dass Ihr erst nach meinem Ableben von Werner erfahren sollt, der nun auch schon seit über zehn Jahren tot ist. Ihr habt nun eigene Familien und liebevolle Ehemänner, worüber ich sehr dankbar bin. Lange habe ich überlegt, ob ich mein Geheimnis nicht mit ins Grab nehmen soll, aber es fühlt sich besser an, Euch schließlich die Wahrheit zu sagen!«
Eisiges Schweigen lag in der Luft, als wir uns entsetzt und verstört anblickten. Mein Vater, der eine Atempause brauchte, griff sich an die Stirn und wischte sich die Schweißtropfen weg. Er war genauso schockiert wie wir alle.
»Ich habe es geahnt«, sagte meine Mutter hart. »Ich wusste immer, dass Mutter lügt. Aber dass sie so dreist sein konnte, das kann ich nicht glauben! Es ist unfassbar.« Ihr wütender Vorwurf lag wie eine schwere Decke über uns.
»Lies weiter, Robert!«, befahl meine Tante mit belegter Stimme. Ihr düsterer Blick drückte ebenfalls alles andere als Zustimmung aus.