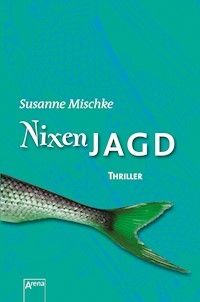9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Arena Thriller
- Sprache: Deutsch
Toni ist einfach nur froh, von zu Hause auszuziehen. Endlich in den eigenen vier Wänden! Ralph, ihrem kontrollsüchtigen Stiefvater, ist sie ein für alle Mal entkommen. Doch die alte Villa, die sie mit drei Mitbewohnern teilt, birgt ein abscheuliches Geheimnis: Vor zwanzig Jahren wurde ein Mädchen auf brutale Weise darin ermordet. Und der verurteilte Täter ist seit Kurzem wieder auf freiem Fuß.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Autor
Susanne Mischke,Jahrgang 1960, konnte mit vier »Max und Moritz« auswendig, mit acht Jahren entschloss sie sich zu publizieren: eine Geschichte über ihren Hamster für die Vitakraft-Packung. Das Werk wurde nie gedruckt. Aus Verlegenheit studierte sie BWL. Ein zweiter Schreib-Anlauf hatte mehr Erfolg. Seit 1993 arbeitet sie als freie Schriftstellerin und wurde 2001 mit dem Frauen-Krimipreis der Stadt Wiesbaden ausgezeichnet. Zahlreiche ihrer Romane sind Bestseller geworden, darunter auch »Zickenjagd«, »Nixenjagd«, »Waldesruh« und »Rosengift«, ihre vier Jugendthriller.
Titel
Susanne Mischke
Röslein stach
Impressum
Erste Veröffentlichung als E-Book 2012 © 2012 Arena Verlag GmbH, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Covergestaltung: Frauke Schneider ISBN 978-3-401-80124-7www.arena-thriller.deMitreden unter forum.arena-verlag.de
1.
Bis zu diesem Morgen war Antonias Leben so zäh verlaufen wie ein langweiliger Schwarz-Weiß-Film. Doch nun saß sie am Frühstückstisch und brachte vor Aufregung keinen Bissen hinunter. Gerade verabschiedete ihre Mutter Ralph mit Küsschen rechts, Küsschen links und noch einem Küsschen auf den Mund. Antonia schüttelte sich innerlich bei dem Gedanken, wie man einen Mann wie Ralph – wenig Haar, wenig Kinn, viel Bauch – küssen konnte. Sie wartete, bis sie seinen Wagen wegfahren hörte. Zum Glück würden sie ihn für den Rest der Woche los sein, er reiste zu einer Messe nach Berlin. So musste Antonia es erst einmal nur mit ihrer Mutter aufnehmen. Sie trank einen Schluck Kaffee, nahm ihren ganzen Mut zusammen und sagte: »Mama, ich will ausziehen!«
Noch während sie es aussprach, wurde ihr mulmig zumute. Sie hatte sich auf sehr dünnes Eis gewagt. Aber jetzt gab es kein Zurück mehr.
Ihre Mutter, die gerade Ralphs marmeladenverschmierten Teller abräumte und in die Spülmaschine stellte, richtete sich auf und drehte sich zu ihrer Tochter um, eine tiefe Falte zwischen ihren Augenbrauen. »Wie bitte? Was ist denn das für ein Unsinn?«
Mit einer Reaktion wie dieser hatte Antonia gerechnet, dennoch merkte sie, wie sich ein Kloß in ihrer Kehle bildete. Nicht heulen, beschwor sie sich, jetzt bloß nicht losheulen! Sie hatte sich fest vorgenommen, während des folgenden Gesprächs vernünftig und ruhig zu bleiben, damit ihre Mutter sie ernst nehmen würde. Aber in letzter Zeit fiel es ihr immer schwerer, sich zu beherrschen, egal, ob es um eine neue Klamotte oder die Erlaubnis für eine Party ging, die sie sich erstreiten musste. Ungewollt und überfallartig stiegen beim geringsten Anlass diese verdammten Tränen in ihr hoch. Das Fatale daran war, dass ihre Mutter und Ralph ihr unterstellten, das Weinen wäre eine Masche von ihr, um ihren Willen durchzusetzen. Und natürlich schalteten sie dann erst recht auf stur. Doch obwohl Antonia klar war, dass die Heulerei alles nur verschlimmerte, war sie völlig machtlos dagegen.
Auch jetzt hatte ihre Stimme schon wieder diesen verdächtigen, zittrigen Unterton. »Ich will ausziehen. Ich will nicht jeden Morgen eine Dreiviertelstunde bis zur Schule fahren.«
Nach den Sommerferien würde Antonia in die elfte Klasse kommen. Antonias jetzige Schule besaß jedoch keine Oberstufe. Die meisten ihrer Mitschüler, die das Abitur machen wollten, würden dafür ab August in die nächstgelegene Gesamtschule am Stadtrand Hannovers gehen, was jeden Tag eine umständliche Fahrt mit Bus und S-Bahn bedeutete.
»Was willst du dann? Die Schule schmeißen? Bei deinen guten Noten?«
»Ich möchte die Oberstufe am Helene-Lange-Gymnasium in Hannover-Linden besuchen und dort will ich auch wohnen.« So, jetzt war es raus. Antonia fühlte sich, als hätte man ihr gerade eine schwere Last abgenommen.
Doris Reuter sah ihre Tochter an. In ihrem Blick lag Verwirrung, Zorn und – was war das – Angst? Dann schüttelte sie den Kopf und lachte bitter auf. »Und woher soll ich das Geld nehmen, um dem Fräulein eine Stadtwohnung zu finanzieren? Sehe ich aus wie eine Millionärin?«
Nein, wie eine Millionärin sah ihre Mutter wirklich nicht aus. Ihre Jeans und das T-Shirt hatten schon deutlich bessere Zeiten gesehen und ihr dunkles Haar, dem die Dorffriseurin einen rigorosen Kurzhaarschnitt verpasst hatte, müsste mal wieder nachgefärbt werden. Auch sonst ging es in der Familie nicht luxuriös zu: Die Lebensmittel stammten von Aldi, auch Antonias heiß geliebtes Toastbrot, und das hässliche kleine Haus, in dem sie lebten, gehörte Ralph. Ralph mit ph. Ein Name, der klang wie das Geräusch, das entsteht, wenn eine Hängematte reißt. Ralph war der Mann ihrer Mutter. So nannte ihn Antonia in Gedanken: Der Mann meiner Mutter. Nicht etwa Papa, was ihm sicher gefallen hätte, zumindest hatte er es ihr angeboten. Aber sie wollte die vertrauliche Anrede für ihren richtigen Vater reservieren, auch wenn sie keine Ahnung hatte, wo dieser sich aufhielt, ob er noch lebte und ob er überhaupt von ihrer Existenz wusste. Antonia war sicher, dass er eines Tages auftauchen würde. Zumindest verging kein Tag, an dem sie nicht an ihn dachte, fiktive Lebensläufe für ihn entwarf und sich den Moment ihrer Begegnung in rosaroten Tönen ausmalte. Ihre Mutter hüllte sich, was das Thema Vaterschaft anging, in Schweigen. Je bohrender Antonias Fragen mit den Jahren geworden waren, desto ablehnender hatte sie reagiert.
Antonia jedoch fühlte sich wie ein Puzzle, bei dem die Hälfte der Teile fehlte. Nicht einmal ein Foto hatte sie von ihrem Erzeuger. Vermutlich hatte sie dessen Haar- und Augenfarbe geerbt, denn in der Familie ihrer Mutter hatte niemand rötliches Haar und blaugrüne Augen. Der Rest aber war wie eine Leinwand, auf die man nach Belieben Bilder malen konnte.
Vor fünf Jahren hatten sich Antonias Mutter Doris und Ralph Reuter kennengelernt und kurz darauf waren Antonia und ihre Mutter zu ihm aufs Dorf gezogen, wo er bei einer Reparaturwerkstatt für Landmaschinen arbeitete. Antonia, die bis dahin ihre Kindheit in der Südstadt von Hannover verbracht hatte, hatte sich mit allen Mitteln dagegen gewehrt. Sie wollte nicht in eine andere Schule, wollte nicht von ihren Freundinnen getrennt werden und schon gar nicht auf dieses langweilige Dorf ziehen. Und am allerwenigsten wollte sie unter einem Dach mit Ralph leben. Sogar in einen Hungerstreik war sie getreten, den sie immerhin vier Tage durchgehalten hatte. Vergeblich.
»Du gewöhnst dich schon an die neue Umgebung, es ist doch schön da draußen, kein Lärm, kein Gestank. Wir werden einen Garten haben, du wirst neue Freunde finden und Ralph hat dich wirklich gern. Gib ihm wenigstens eine Chance«, hatte ihre Mutter sie gebeten. Bald nach dem Umzug hatten Doris und Ralph geheiratet, was Antonia mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis genommen hatte. Ralph hatte sogar vorgeschlagen, sie zu adoptieren, damit alle in der Familie einen gemeinsamen Namen tragen würden, aber dagegen hatte Antonia ebenfalls vehement protestiert. Denn wie sollte ihr richtiger Vater sie jemals finden, wenn sie ihren Nachnamen wechselte? Wenigstens in dieser Angelegenheit wurde ihr Protest gehört: Ralph verzichtete auf die Adoption und Antonia durfte ihren Nachnamen Bernward behalten, während ihre Mutter nun Doris Reuter hieß.
Antonia hatte Ralph von Anfang an nicht leiden können und sie war sicher, dass es Ralph umgekehrt genauso ging. Ihre gegenseitige Abneigung war vermutlich das Einzige, das sie gemeinsam hatten, auch wenn Ralph gegenüber Antonias Mutter so tat, als läge ihm Antonias Wohlergehen am Herzen. Es war nicht so, dass Ralph Antonia schlecht behandelte, sie konnte ihm keine konkreten Untaten vorwerfen. Aber Antonia hatte feine Antennen, sie spürte, dass sie für ihn nur das lästige Anhängsel ihrer Mutter war. Also blieb Antonia am Abend meist in ihrem Zimmer, las, chattete oder sah fern. Den Fernseher hatte ihr Ralph geschenkt. Es war ein altes Röhrengerät, das er wahrscheinlich für zehn Euro gebraucht gekauft hatte. Antonia wusste: Das war seine Art, sich seine Stieftochter nach Feierabend vom Hals zu halten. Knickerig war er zu allem hin auch noch. Das einzig brauchbare »Geschenk«, das sie je von ihm erhalten hatte, war sein abgelegtes Fotohandy gewesen, nachdem er seinen Vertrag verlängert und ein neues bekommen hatte. Mit einer leisen Wehmut dachte Antonia an die Zeit zurück, als es noch keinen Ralph gegeben und sie die Abende mit ihrer Mutter auf dem großen Sofa verbracht hatte; lesend oder fernsehend, aber jedenfalls zusammen. Doch ihre Beziehung zu ihrer Mutter war seit Ralph deutlich distanzierter geworden. Selbst wenn Ralph auf Reisen war, blieb Antonia in ihrem Zimmer. Wie ein Wellensittich, der sich an seinen Käfig gewöhnt hatte und mit der offenen Tür nichts anzufangen wusste.
Manchmal hörte Antonia spät am Abend von unten herauf laute Stimmen. Sie stritten. Dann hoffte Antonia jedes Mal inständig, dass die zwei sich trennen und sie und ihre Mutter wieder in die Stadt ziehen würden. Vor etwa einem Jahr schienen sich ihre Hoffnungen zu erfüllen, als ihre Mutter am Tag nach einem solchen Streit ihr bläulich verfärbtes Auge unter einer großen Sonnenbrille zu verstecken versuchte. Damals war Antonia überzeugt gewesen, dass ihre Koffer gepackt sein würden, wenn sie aus der Schule zurückkam. Doch nichts dergleichen geschah. So oft und heftig sich Ralph und ihre Mutter auch stritten, schienen sich die beiden doch immer wieder zu versöhnen. Worum sich die Streitereien drehten, wusste Antonia nicht. Sie hatte sich angewöhnt, ihre Kopfhörer aufzusetzen und Musik zu hören, wenn es unten mal wieder rundging. Sie fragte auch nicht nach. Bestimmt stritten sie ihretwegen, denn oft genug nörgelte Ralph, sie sei egoistisch und verzogen, und dann fing ihre Mutter jedes Mal an, sie zu verteidigen, während Antonia dachte: Soll er doch von mir denken, was er will, mir ist es egal.
Entgegen der Prophezeiung ihrer Mutter hatte sich Antonia in ihrem neuen Zuhause nie wohlgefühlt. Hier war es einfach nur öde. Es gab keinerlei Abwechslung, vom Fußballplatz und der dort herumlungernden Dorfjugend mal abgesehen. Aber das waren Gestalten, denen Antonia lieber aus dem Weg ging. Und von wegen »kein Krach und kein Gestank«! Irgendwo knatterte immer ein Trecker, jaulte eine Motorsäge, schnurrte ein Rasenmäher oder bellte ein Köter. Zur Erntezeit umkreisten riesige Mähdrescher nächtelang das Dorf, bei Westwind roch es erbärmlich nach Schweinemist. Der süßlich-dumpfe Geruch kam von einer monströsen Schweinemastanlage außerhalb des Ortes und von der Gülle, die in regelmäßigen Abständen ausgebracht wurde. Dann konnte man sich kaum draußen aufhalten und manchmal glaubte Antonia, dass sogar ihre Kleidung und die Handtücher im Badezimmer nach Schweinescheiße rochen. Was durchaus sein konnte, da ihre Mutter die Wäsche gerne draußen, »an der frischen Luft«, aufhängte. Vermutlich hatte sich der Gestank schon in ihren Poren festgesetzt und sie würde diesen Dorfgeruch nie mehr loswerden.
Es war schwierig gewesen, neue Freunde zu finden. Die Jugendlichen aus dem Dorf kannten sich alle von klein auf und akzeptierten Antonia nicht. Antonia wiederum hatte auch kein großes Interesse an ihnen gezeigt. Inzwischen zwar sie mit zwei, drei Mädchen aus ihrer Schule locker befreundet, aber selbst die wohnten nicht im Ort, sondern in den umliegenden Nachbardörfern. Antonia verbrachte viel Zeit im Netz. Das Internet war ihr Draht zum Rest der Welt. Es vermittelte ihr das tröstliche Gefühl, am Leben der anderen teilhaben zu können, irgendwie dazuzugehören, auch wenn sie an diesem tristen Ort hier festsaß. Ohne Internet, das war ihr klar, würde sie ihr Leben wohl kaum ertragen.
Über Facebook hatte sie seit einigen Monaten wieder Kontakt zu Freundinnen aus ihrer Kinderzeit in der Südstadt aufgenommen. So war Antonia auch auf die Idee auszuziehen gekommen: Katharina Buchmann, Katie genannt, war vor zehn Jahren zusammen mit Antonia eingeschult worden. Sie hatten in der Grundschule nebeneinander gesessen und waren dicke Freundinnen gewesen. Kürzlich hatte Katie beschlossen, die Schule nach der zehnten Klasse zu verlassen, und in den nächsten Tagen würde sie eine Lehre als Tontechnikerin beginnen. Vor zwei Wochen schon hatte ihr Katie voller Begeisterung mitgeteilt, dass sie in eine WG gezogen sei. »Es ist eine alte Villa am Lindener Berg. Bisschen baufällig, aber okay. Und total billig, mit allem Drum und Dran kostet das Zimmer nur zweihundert Euro. Es ist übrigens noch eins frei…«
»Das wird meine Mutter nie erlauben!«, war Antonias erste Reaktion gewesen. Aber Katie hatte entgegnet: »Dann frag sie doch gar nicht. Meine Eltern waren auch dagegen, aber was wollen sie groß machen? Sie können mich ja schließlich nicht anbinden. Und inzwischen finden sie es ganz okay.«
»Aber du verdienst bald schon dein eigenes Geld, ich nicht«, hatte Antonia erwidert.
»Du kannst doch jobben«, hatte Katie vorgeschlagen. »Und du kriegst bestimmt Schüler-BAföG. Überleg es dir. Dann wären wir zu viert, es wohnen noch zwei Jungs im Haus.«
Katies Worte waren Antonia nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ausziehen! Jetzt! Sie war völlig fasziniert von diesem Gedanken.
Als sie in Ralphs Haus gezogen waren, hatte Antonia im Stillen beschlossen, noch am Tag ihres achtzehnten Geburtstags wieder zurück in die Stadt zu ziehen. An diesem Gedanken hatte sie sich festgehalten, wie ein Häftling, der die Tage bis zu seiner Entlassung herunterzählt. Doch auf einmal schien der lang gehegte Traum zum Greifen nah. Sie musste lediglich ein paar Hürden überwinden…
Gleich nach dem Gespräch mit Katie hatte Antonia im Internet über das Thema Schüler-BAföG recherchiert und herausgefunden, dass die Voraussetzungen, es zu bekommen, gut für sie standen: Das nächste Gymnasium lag so weit von ihrem Dorf entfernt, dass ein Umzug in die Stadt gerechtfertigt war. Auch wenn es ihr im Grunde egal war, ob sie an einer Gesamtschule oder einem Gymnasium ihr Abitur machte oder ob sie einen langen Schulweg hätte: Antonia wollte einfach weg aus diesem Dorf, weg von Ralph, zurück in die Stadt.
Katie mailte Fotos. Antonia war begeistert. Hinter einem romantisch verschnörkelten Eisenzaun stand eine prächtige Villa aus der vorigen Jahrhundertwende. Was machte es schon aus, dass der Putz stellenweise schon ein wenig abbröckelte und das freie Zimmer ein recht enger Schlauch zu sein schien. Egal! Wenn man das Ganze hübsch einrichtete, könnte es ein kleines Paradies sein. Ihr Paradies. Schließlich hatte sie Katie angerufen und sie gebeten, das Zimmer für sie freizuhalten. Sie würde noch diese Woche mit ihrer Mutter sprechen.
»Aber beeil dich, wir kriegen ständig Nachfragen«, hatte Katie gedrängt und dann gesagt: »Mensch, Toni, zieh das durch, das wäre so cool!«
Cool. Das sagt sich so leicht, dachte Antonia nun, unter dem erbosten Blick ihrer Mutter. Sie holte tief Luft und hörte sich dann sagen: »Du musst mir keine Stadtwohnung bezahlen. Ich will kein Geld von euch.« Das euch hatte abfälliger geklungen als beabsichtigt und sie bemerkte, wie ihre Mutter dabei zusammenzuckte. Etwas gemäßigter fuhr sie fort: »Ich werde einen BAföG-Antrag stellen und jobben. Und wohnen werde ich bei Katie in ihrer WG, das ist nicht teuer.«
Zwar hatte ihre Stimme zuletzt brüchig wie Zwieback geklungen, aber sie hatte es geschafft, ihre Argumente vorzubringen, ohne in Tränen auszubrechen. Sie war stolz auf sich – ganz egal, was nun passieren würde.
»Das alles hast du hinter meinem Rücken angezettelt?« Die Fassungslosigkeit war ihrer Mutter deutlich anzuhören.
»Was heißt ›angezettelt‹? Ich habe mich nur informiert, im Internet. Katie hat mir das Zimmer reserviert, ich soll mich noch diese Woche entscheiden. Ich muss mich ja auch rechtzeitig bei der Schule anmelden.«
»Wer ist Katie?«
»Katharina Buchmann, sie ging früher in meine Klasse. Sie hat uns doch früher ganz oft besucht, sag bloß, du weißt das nicht mehr?«
Hatte ihre Mutter ihr früheres Leben schon so sehr aus ihrem Gedächtnis getilgt, dass sie sich nicht einmal mehr an die beste Freundin ihrer Tochter erinnerte? Antonia schluckte ihren Ärger darüber hinunter und erklärte: »Sie fängt jetzt eine Lehre an, ihre Eltern haben auch nichts dagegen, dass sie in eine WG zieht.« Dass Katie fast ein Jahr älter war als Antonia, ließ sie bewusst unter den Tisch fallen. Aber ihre Mutter ging ohnehin nicht darauf ein, sondern ereiferte sich jetzt: »Ausziehen? Wie stellst du dir das vor? Das werde ich auf gar keinen Fall erlauben!«
»Wieso denn nicht? Wenn ich statt des Abiturs eine Lehre machen würde, müsste ich ja auch in die Stadt ziehen, hier gibt es ja nichts.« Unwillkürlich wurde nun auch Antonias Stimme laut: »Und schließlich bin ich auch nicht gefragt worden, ob ich in dieses Scheißdorf ziehen will, zu deinem Macker…«
Klatsch! Die Ohrfeige traf Antonia an der linken Wange. Vor Schreck stieß sie ihre Tasse um, der Kaffee lief über die Tischplatte und tropfte auf die gelblichen Bodenfliesen.
Antonia sprang auf, rannte hinauf in ihr Zimmer und schloss die Tür hinter sich ab. Ihre Wange brannte, Tränen liefen ihr übers Gesicht. Sie fühlte sich gedemütigt, aber gleichzeitig war ihr klar, dass diese Ohrfeige den Schlusspunkt hinter ihr bisheriges Leben gesetzt hatte. In einem Haus, in dem sie geschlagen wurde, würde sie nicht länger bleiben.
»Entschuldige, ich… das wollte ich nicht«, hörte Antonia ihre Mutter durch die Tür rufen. »Antonia, mach bitte auf! Es tut mir leid.«
Antonia versuchte, ihre Mutter, die gegen die Tür hämmerte, zu ignorieren. Mit zitternden Händen nahm sie ihr Handy aus der Schultasche und tippte eine SMS an Katie: Ich nehme das Zimmer. Als sie auf Senden drückte, war ihr erneut ein wenig flau im Magen, doch sie spürte auch, wie der fest um sie geschlossene Kokon der vergangenen Jahre von ihr abfiel und sich eine völlig neue Perspektive auftat. Ja, sie würde ein neues Leben anfangen. Ein selbstbestimmtes, neues Leben in der Stadt, in einer angenehmen Atmosphäre, ohne kleinliche Vorschriften, ohne Ralph…
»Antonia, lass uns miteinander reden!«
Reden? Jetzt wollte sie reden? All die Jahre hatte sich alles nur um Ralph gedreht, es war ihr egal gewesen, wie einsam Antonia sich hier gefühlt hatte, und jetzt also wollte sie reden. Antonia fand, dass alles gesagt war. Die Arme um die Knie geschlungen, setzte sie sich auf ihr Bett und wartete, bis ihre Mutter das Klopfen und Rufen aufgab. Dann raffte sie ihre Schulsachen zusammen und lief die Treppe hinunter, vorbei an der Küche. Als sie Antonia hörte, drehte sich ihre Mutter nach ihr um. »Antonia, warte!«
Sie hatte geweint, das sah Antonia, und es versetzte ihr wider Erwarten einen Stich.
»Du kannst mich doch hier nicht allein lassen!« Ihre Stimme klang flehend, so hatte sie ihre Mutter noch nie reden hören. Jedenfalls nicht mit ihr.
Was sollte das denn nun wieder bedeuten, sie allein lassen? Soll sie doch froh sein, kann sie ihren Ralph endlich ungestört genießen – und so viel würde sich für ihre Mutter doch gar nicht ändern, sie hatte Antonia doch während der letzten Jahre ohnehin kaum wahrgenommen. Sie antwortete nicht und blieb auch nicht stehen. Ohne ein Wort des Abschieds ging sie zur Haustür, schloss ihr Fahrrad auf und fuhr davon. Sie würde zu spät zur Schule kommen, aber was machte das jetzt noch aus, wo die Schule in drei Tagen zu Ende war? An der ersten Kreuzung piepste es in ihrer Schultasche. Eine SMS von Katie. Super, ich freu mich!
Mit schwarzer Tinte setzte Frau Dr. Tiedke ihre Unterschrift unter die Entlassungspapiere des Patienten Leopold Steinhauer. Der Mann war sechzig Jahre alt und hatte die letzten zwanzig Jahre seines Lebens in der forensischen Abteilung des Landeskrankenhauses Wunstorf verbracht. Anfangs hielt sie die Unterbringung in einer Einzelzelle der geschlossenen Abteilung für notwendig, immerhin galt der Mann als gefährlich und unberechenbar. Aber da er sich gut benahm und auch irgendwann zu seiner Tat bekannte, gewährte ihm Frau Dr. Tiedke mit der Zeit immer mehr Lockerungen. Steinhauer war ihr stets höflich begegnet, er hatte nie eine Sitzung verweigert, hatte klaglos alle verordneten Medikamente geschluckt und sich auch sonst geradezu mustergültig verhalten. Er betreute einen Teil des Patientengartens. Von Frühling bis Herbst fand man ihn fast nur dort. Alle Gartenbesucher waren sich einig, dass seine Parzelle mit Abstand der schönste Teil des Gartens war, ein kleines Paradies. Im Winter malte er und hörte dazu klassische Musik.
In seinem vorigen Leben war er Professor für zeitgenössische Malerei an der Fachhochschule Hannover gewesen. Nachdem er in der Klinik wieder zu malen begonnen hatte, waren seine Bilder regelmäßig von seinem Galeristen abgeholt worden. Sie verkauften sich noch besser und vor allen Dingen teurer als vor seiner Verurteilung. Besonders die »rote Serie«. Steinhauer würde die Klinik nicht als armer Mann verlassen.
Mit der Zeit hatte sich zwischen Leopold Steinhauer und Frau Dr. Tiedke eine Art Freundschaft entwickelt – natürlich mit der notwendigen Distanz, die die Beziehung zwischen Psychiater und Patient erforderte. Niemals hatte die Therapeutin ihm etwas über ihr Privatleben erzählt. Dennoch wurde sie das Gefühl nicht los, dass er vieles über sie wusste. Steinhauer war einfühlsam, klug und charmant, dabei aber niemals anzüglich. Sie hatten oft über Pflanzen gesprochen, aber auch über Malerei, Literatur und Politik. Da er die Tageszeitungen und Magazine, die im Aufenthaltsraum auslagen, regelrecht verschlang, wusste er stets über das Weltgeschehen Bescheid. Er war ihr stets ein angenehmer Gesprächspartner gewesen und ganz im Geheimen musste sich Frau Dr. Tiedke eingestehen, dass sie ihren Lieblingspatienten wohl vermissen würde.
Vor zwanzig Jahren hatte Leopold Steinhauer ein Mädchen ermordet.
Aufgrund der Umstände der Tat hatte sein Anwalt vor dem Landgericht Hannover auf vorübergehende Schuldunfähigkeit plädiert und war damit durchgekommen. Somit war Steinhauer eine Haftstrafe erspart worden und er war stattdessen hier, in der Psychiatrie, gelandet.
Frau Dr. Tiedke seufzte, als sie die Akte zuklappte. Sie hatte schon einige Patienten wie Steinhauer therapiert und schließlich, nach zahlreichen Begutachtungen über Jahre hinweg, in die Freiheit entlassen. Die meisten dieser ehemaligen Straftäter waren sauber geblieben und führten ein unauffälliges, normales Leben. Aber eben nicht alle. Trotz guter Prognose wurden manche doch rückfällig, mitunter erst nach Jahren. Das war das Restrisiko, mit dem die Gesellschaft leben musste.
Steinhauers Prognose war jedoch so günstig, wie es selten bei einem Patienten vorkam, darin waren sich die Wunstorfer Ärzte mit dem externen Gutachter einig. Seine Entlassung war eine logische Konsequenz daraus, das Risiko denkbar gering. Und doch, ein geringer Zweifel blieb immer.
2.
Antonias letzte Schultage fühlten sich an wie ein seltsamer Zwischenzustand. Das Alte war in Gedanken schon abgestreift, das Neue noch nicht da. Ihre Freundinnen Sina, Maja und Constanze fanden es schade, dass Antonia sie verließ.
»Verräterin«, sagte Maja und Antonia wusste, dass sie das nicht nur scherzhaft gemeint hatte.
»Wir können uns doch in der Stadt treffen und durch die Klubs ziehen«, sagte Antonia, wohl ahnend, dass sie die drei nicht mehr oft sehen würde. Vielleicht gar nicht mehr.
Immerhin schafften es Antonia und ihre Mutter, am Freitagmorgen versöhnt auseinanderzugehen. Antonia hatte am Abend zuvor ihr Jahreszeugnis auf dem Küchentisch liegen lassen. Daraufhin war ihre Mutter in ihr Zimmer gekommen, hatte sie für ihre guten Noten gelobt und ihr gesagt, dass sie sehr stolz auf sie wäre. Sie hatten sich umarmt und für einen kurzen Augenblick war wieder alles so gewesen wie früher. Außer, dass sie beide geweint hatten.
Jetzt begleitete Frau Reuter ihre Tochter bis zur Bushaltestelle und half ihr, die zwei schweren Sporttaschen zu tragen.
»Du weißt, du kannst jederzeit wiederkommen.«
»Ich muss eh noch mein Fahrrad holen«, sagte Antonia.
»Ich meine später. Wenn es nicht funktioniert oder wenn du nicht zurechtkommst. Versprich mir, dass du das tun wirst, Antonia!«
Sie versprach es und dachte dabei: Niemals!
»Was ist mit Ralph?«, fragte sie. Er würde voraussichtlich heute Abend von seinem Messebesuch zurückkommen. Wusste er eigentlich schon von ihrem Auszug, hatte ihre Mutter ihm Bescheid gesagt? Aber interessierte Antonia das eigentlich noch? Nicht wirklich. Ralph würde es bestimmt nicht bedauern, sie los zu sein, genau wie umgekehrt.
Im Grunde war es ihr ganz recht, dass sie sich nicht von ihm verabschieden musste. Er wäre ja doch nur dagegen gewesen, hätte tausend Bedenken geäußert, und sei es nur, um sie zu schikanieren.
Ihre Mutter war plötzlich seltsam verlegen geworden. »Das mit Ralph kläre ich schon. Ich… ich werde ihm erst einmal sagen, dass du bei meiner Mutter wohnst. Sonst…« Der Satz blieb unvollendet. Antonia sah ihre Mutter verwundert an, doch bevor sie nachfragen konnte, kam schon der Bus. Sie umarmten sich, ihre Mutter weinte und auch Antonia hatte Tränen in den Augen, als der Bus anfuhr. Durch die schmutzige Scheibe sah sie ihre Mutter, die im Wartehäuschen der Haltestelle stand und zaghaft winkte. Wie klein und zerbrechlich sie plötzlich aussah. Irgendwie verloren. Und einsam. Unsinn, sagte sich Antonia und bekämpfte den aufkommenden Trennungsschmerz mit Sarkasmus: Sie ist nicht einsam, sie hat doch ihren Ralph und er hat sie nun für sich ganz allein. Und ich werde mein neues Leben genießen.
Katies Bilder hatten nicht getrogen. Das Haus ließ trotz seiner etwas renovierungsbedürftigen Fassade ahnen, dass es einmal eine stolze, vornehme Villa gewesen war. Efeu wucherte im Vorgarten, durch den ein mit Platten markierter Weg über drei Stufen zur Haustür führte. Eine späte Rose neigte sich anmutig über den rostigen Zaun mit den teilweise abgebrochenen Spitzen. Ein Idyll – rein optisch. Denn als Antonia mit ihren zwei Taschen vor ihrem zukünftigen Zuhause stand, wurde ihr schlagartig klar, warum die Miete hier so günstig war. Als die Villa erbaut worden war – 1892, wie eine in den Putz eingeritzte Zahl im Giebel verriet –, war der Lindener Berg eine noble, großbürgerliche Gegend gewesen. Heute sah es hier jedoch ganz anders aus, auch wenn die Villen geblieben waren – die Eleganz vergangener Zeiten war passé. Denn gleich unterhalb des Berges verlief die B6, die auf dieser Seite der Stadt Westschnellweg hieß. Nur einen Steinwurf entfernt brauste der Verkehr stadtein- und stadtauswärts, sodass ein ständiges Rauschen in der Luft lag, das nahezu alle anderen Geräusche erstickte. Daran änderte auch die hohe Böschung nichts, in die die vierspurige Fahrbahn eingebettet war.
Unwillkürlich musste Antonia an die Worte ihrer Mutter denken, als sie gestern Nachmittag gefragt hatte, ob Antonia sich das Zimmer denn überhaupt schon mal angesehen hätte.
»Nur Fotos«, hatte Antonia gesagt. Erleichtert darüber, dass das Eis zwischen ihnen geschmolzen war, hatte Antonia ihr die Bilder auf ihrem Laptop gezeigt.
»Und das soll nur zweihundert Euro kosten? Da ist doch bestimmt irgendein Haken dran«, hatte ihre Mutter vermutet.
Und das also war der sprichwörtliche Haken: der Lärm der B6. Hätte mir Katie ruhig sagen können, grollte Antonia. Aber hätte sich Antonia davon wirklich abschrecken lassen? Nein! Was ist schon ein bisschen Verkehrsrauschen, verglichen mit dem Schweinemistgestank, dem sie gerade entronnen war – und gegen Ralph! Mit diesem Gedanken stieß Antonia die Gartenpforte auf, die in den Angeln quietschte. Immerhin wurde dieses Geräusch nicht vom Lärm verschluckt. Sie durchquerte den Vorgarten und drückte auf den rostigen Klingelknopf neben der schweren dunklen Holztür. Sie musste dreimal klingeln, ehe ein Schatten hinter der vergitterten Milchglasscheibe auftauchte und die Tür geöffnet wurde. Ein Junge, er war schätzungsweise zwei, drei Jahre älter als Antonia, stand vor ihr. Das hätte Katie mir auch sagen können, durchfuhr es Antonia bei seinem Anblick.
»Hi, ich bin Toni, also eigentlich Antonia… ich bin… ich sollte… Katie hat…«
Was stottere ich denn so herum?, ärgerte sich Antonia. Kann ich keinen ordentlichen Satz mehr bilden, nur weil mir ein halbwegs… nein, ein ziemlich… Quatsch!, ein wahnsinnig gut aussehender Typ die Tür aufmacht? Seine blaugrauen Augen, beschattet von langen, dichten Wimpern, musterten Antonia, als stünde sie zum Verkauf. Dann lächelte er und sagte: »Ah, das Küken ist da. Komm rein.«
Mit klopfendem Herzen hob Antonia ihre Taschen auf und stellte sie in den Flur. Die Haustür fiel dumpf ins Schloss und es war, als hätte sie eine Gruft betreten: kühl und still. Totenstill. So kam es Antonia zumindest vor, nachdem das Toben des Verkehrs draußen geblieben war. Der Flur war dunkel, sie konnte kaum etwas erkennen, außer einem riesigen, halb blinden Spiegel mit einem breiten Rahmen aus geschnitztem Holz. Es roch ein wenig muffig und abgestanden, vermutlich wurden wegen des Krachs selten die Fenster aufgemacht.
»Ich bin Robert.«
»Toni.«
Er lächelte, wobei zwei Grübchen auf seinen blassen Wangen entstanden. »’tschuldige, dass es so lang gedauert hat, ich habe gerade gepennt.« Er fuhr sich mit seinen langen Fingern durch die dunklen Locken, die ihm sogleich wieder in die Stirn fielen. Antonia blieb dabei fast das Herz stehen. »Macht doch nichts«, hauchte sie, und da ihr beim besten Willen nichts anderes einfiel, fragte sie: »Ist Katie nicht da?«
»Die kommt heute erst spät, die muss bei einer Veranstaltung Stühle schleppen und Kabel legen. Kaffee?«
»Gerne.«
Sie folgte ihm in die Küche. Die Möbel darin sahen aus, als hätte man sie vom Sperrmüll oder aus dem Sozialkaufhaus zusammengesucht. Es gab einen alten Gasherd mit eingebrannten Resten um die Kochstellen herum. Und einen Toaster! Antonia liebte Toastbrot, sie verschlang täglich eine halbe Packung davon. Ein Haufen schmutzigen Geschirrs stand neben der Spüle. Also keine Spülmaschine. Aber das war egal. Im Moment war Antonia alles egal – außer Robert. Robert war mit Abstand der attraktivste Typ, den sie seit Langem gesehen hatte – wenn man einmal von Robert Pattinson aus der Twilight-Saga absah, mit dessen Postern ihr Zimmer in Ralphs Haus zugepflastert gewesen war. Aber der war ja irgendwie nicht echt und außerdem völlig unerreichbar. Dieser Robert dagegen… Irgendwie sah er dem Film-Vampir sogar ähnlich oder bildete sie sich das nur ein? Nein, tatsächlich: diese makellose helle Haut, die dunklen Locken… Nur seine Nase war schmaler als die des Schauspielers, ebenso die Augenbrauen. Ein Bartschatten umspielte seine Wangen, was ihm etwas Verwegenes gab. Und auch noch derselbe Vorname! Irre, das alles.
Von der Küche aus konnte man durch eine Glastür in den Garten auf der Rückseite des Hauses blicken. Er schien groß zu sein und ziemlich verwildert. Hohe, viel zu dicht gewachsene Büsche umsäumten Beete voller Unkraut und eine Fläche, die vielleicht einmal ein Rasen gewesen war. In der Mitte stand ein Kirschbaum, an dem reife Früchte hingen. Blühende Strauchrosen verliehen dem Ganzen eine romantische Note. Weit hinten stand ein etwas windschiefer Schuppen, halb verdeckt von einem stattlichen Rhododendron. Ein Zaubergarten, dachte Antonia und wunderte sich, wie sie auf dieses schnulzige Wort gekommen war. Offenbar gingen die Hormone schon mit ihr durch, nach gerade mal zwei Minuten mit ihrem neuen Mitbewohner – das konnte ja noch spannend werden!
Robert schraubte einen fleckigen Espressokocher auseinander und klopfte das alte Kaffeepulver in den Mülleimer, der in einer Ecke stand und bereits überquoll. Antonia beobachtete ihn dabei. Diese kräftigen Hände mit den langen Fingern! Hat die Welt je schönere Männerhände gesehen? Sie ertappte sich bei dem Wunsch, er möge sie mit diesen Händen berühren, streicheln… Reiß dich zusammen, Toni!
Er stellte die Kanne auf die Herdplatte. Aus dem babyblauen Schrank über der Spüle, dessen Glasscheibe einen Sprung hatte, nahm er zwei Tassen, was Antonia ausnutzte, um seine Rückansicht in Augenschein zu nehmen. Nein, wirklich nicht übel. Aber bestimmt hatte der längst eine Freundin. Oder mehrere. Ganz gewiss hatte so einer nicht auf ein sechzehnjähriges Landei gewartet. Verdammt, wie sollte sie das nur aushalten, in einer WG mit so einem Jungen zu wohnen? Sie seufzte tief.
»Heimweh?«
»Was?«
»Dieser schwermütige Seufzer eben.«
»Quatsch, Heimweh!«, wehrte Antonia ab. »Ich bin doch kein kleines Kind mehr!«
»Na ja…«
»Ich werde bald siebzehn. Und du?«
»Neunzehn.«
»Studierst du?«, forschte Antonia.
»Ich mache gerade ein soziales Jahr. Essen auf Rädern ausfahren und so. Meine Tour ist für heute zu Ende, deshalb hatte ich mich hingelegt. Ist immer recht stressig, die alten Leute quatschen dir die Ohren voll, dabei erzählen sie jeden Tag dasselbe.«
»Ich will dich nicht stören. Zeig mir nur mein Zimmer, dann komm ich schon zurecht.«
»Nur keine Hektik«, meinte Robert. »Erst mal einen Willkommenskaffee.« Er hatte sich hingesetzt und drehte sich eine Zigarette.
»Auch eine?«, fragte er, als er damit fertig war.
Antonia schüttelte den Kopf.
»Es darf übrigens im ganzen Haus geraucht werden, nur nicht im Bad.«
»Ich rauche nicht.«
»Du bist aber hoffentlich keine von diesen radikalen Nichtraucherinnen, oder?«
Antonia beeilte sich, dies zu verneinen. Robert nickte zufrieden und riss ein Streichholz an.
Eine Fliege summte am Fenster, die Gasflamme fauchte leise, der Espressokocher gab schlurfende Geräusche von sich. Ein paar Tropfen fielen auf die Herdplatte, wo sie zischend verdampften. Der Rauch des Tabaks, die verbrannten Tropfen Kaffee – das alles zusammen roch irgendwie nach… nach Freiheit! Antonia lehnte für einen Moment den Kopf gegen die zitronengelb gestrichene Wand. Sie lächelte und hatte den Gedanken, dass sie diesen Moment ihr Leben lang nicht vergessen würde.
»Bist du müde?«, fragte Robert.
Sie machte die Augen auf. »Nein. Nur glücklich«, gestand sie und schämte sich schon im nächsten Moment für ihre Offenheit. Nur glücklich, mein Gott, Antonia, so was Uncooles sagt man doch nicht zu einem Typen, den man kaum kennt! »Der ländlichen Hölle entronnen«, setzte sie hinzu.
»Ich weiß, was du meinst«, grinste Robert. »Ich komme aus Isernhagen. Das ist auch ziemlich ländlich.«
Antonia kannte den Ort vom Durchfahren. Ein Nobelvorort; Geländewagen vor schick renovierten Fachwerkgehöften und dahinter, auf den Weiden, Pferde. Das konnte man mit ihrem Schweinedorf nicht einmal annähernd vergleichen, aber sie hütete sich, ihm das zu sagen.
Der Kaffee war fertig. Er goss die rabenschwarze Brühe in die zwei Tassen.
»Milch? Zucker?«
Antonia nickte. Er stellte alles vor sie auf die zerkratzte Tischplatte, die ein klein wenig klebte. Eine Generalreinigung der Küche wäre mal wieder angesagt, erkannte Antonia, und: Lieber Himmel, ich denke schon wie meine Mutter!
Nur mit viel Milch und Zucker war der Kaffee genießbar. Wie konnte Robert dieses fiese Gebräu schwarz trinken?
»Schmeckt er dir?«
»Ausgezeichnet!«
»Ich bin nämlich der Einzige im Haus, der einen annehmbaren Kaffee kochen kann«, verkündete Robert und zog an seiner Zigarette. Stille breitete sich aus, nur eine Wanduhr mit vergilbtem Zifferblatt, die über der Tür hing, tickte die Zeit herunter.
»Es ist so ruhig hier drin – ich meine… wenn man bedenkt, wie laut es draußen ist.« Unwillkürlich hatte Antonia geflüstert.
»Der gute Herr Krüger hat schalldichte Fenster einbauen lassen, sonst hätte er den alten Kasten wohl gar nicht vermieten können.«
»Ah«, sagte Antonia nur.
Robert schaute sie abschätzend von der Seite an und grinste, bis Antonia verlegen zurücklächelte. Er nahm einen tiefen Zug, lehnte sich entspannt in seinem Stuhl zurück und blies den Rauch aus. Antonia rührte einen dritten Löffel Zucker in den Kaffee, aber er schmeckte immer noch bitter.
Dann fragte Robert: »Hat Katie dir eigentlich gesagt, dass das hier ein Mörderhaus ist?«
Ein dezenter Gong ertönte, als Leopold Steinhauer die Galerie betrat. Er schaute sich um. Ein paar schlechte Aquarelle von Blumen, wahrscheinlich der Selbstverwirklichungstrip einer gelangweilten Hausfrau, ein Russe, der versuchte, die alten Impressionisten zu imitieren, allerdings mit viel zu grobem Pinselstrich und viel zu grellem Licht auf den Motiven. Es schüttelte ihn.
Von seinen Bildern konnte er nur eines entdecken, er hatte es vor einem halben Jahr gemalt, es war überwiegend in Blautönen gehalten, ein Versuch, wegzukommen von seinen roten Bildern, die in der Kunstszene ein Begriff waren.
»Die roten laufen einfach besser.«
Arnold Krüger war aus dem Kabuff getreten, das er sein Büro nannte. Er kam auf seinen Besucher zu, mit weit ausgebreiteten Armen, eine übertriebene Geste, wie Steinhauer fand. Oder war es inzwischen Mode, dass sich Männer umarmten? Krüger war ursprünglich einer seiner Studenten gewesen, jedoch als Maler völlig untalentiert, was er zum Glück irgendwann eingesehen hatte. Daraufhin war er Galerist geworden. Im Verkaufen von Bildern war er gut, er wusste, wie man die Kundschaft einwickelte. Steinhauer streckte ihm förmlich die Hand entgegen. Die von Krüger fühlte sich an wie ein kalter Fisch.
»Du bist also wieder draußen.« Der Galerist rang sich ein Lächeln ab. »Ganz? Ich meine… für immer?«
»Ja, endgültig.«
»Hast du schon eine Wohnung?«
»Ja.«
Ein unrenovierter Altbau, vierter Stock, in Linden-Mitte, aber das geräumige Wohnzimmer besaß drei große Fenster zur Südseite. Ideal zum Malen. Der Vermieter, ein Pole, hatte keine Fragen gestellt.
»Kann ich dir sonst irgendwie helfen?« Krüger fuhr sich verlegen durch sein Haar, das schon etliche kahle Stellen aufwies. Das, was noch vorhanden war, war etwas zu gleichmäßig dunkelbraun, wenn man bedachte, dass Krüger schon Mitte vierzig war. Steinhauers Anwesenheit schien ihn nervös zu machen, er plapperte drauflos: »Deine letzten beiden Bilder habe ich vorige Woche verkauft. Eins ging an einen Landtagsabgeordneten und das andere an einen Arzt. Weißt du, es lohnt sich gar nicht, sie aufzuhängen, ich habe eine Warteliste, die Leute reißen sie mir quasi aus den Händen. Ich wollte dir eigentlich heute noch einen Scheck schicken, aber nun bist du ja da, dann mache ich ihn gleich fertig, dann kannst du ihn…«
»Wie viel?«, schnitt Steinhauer den Redeschwall brüsk ab.
»Fünfzehntausend. Für beide. Also… nach Abzug der fünfzig Prozent Provision plus Umsatzsteuer. Ich gebe dir selbstverständlich noch eine Quittung.«
»Gut.« Er folgte Krüger in dessen Büro. Der Galerist setzte sich in seinen protzigen Chefsessel und bekritzelte einen Scheck, den er Steinhauer aushändigte.
Er war überzeugt, dass Krüger ihn betrog. Bestimmt verkaufte er seine Bilder seit Jahren für einen weit höheren Preis als den, den er ihm nannte. Aber Geld bedeutete ihm inzwischen nicht mehr allzu viel und trotz der Machenschaften seines Galeristen hatte er genug davon.
»Du wirst doch weitermalen? Sag mir nicht, dass du aufhören willst! Du bist mein bestes Pferd im Stall, ohne dich kann ich zumachen. Das, was hier rumhängt, sind peanuts…«
»Es ist grauenhaft«, stellte Steinhauer richtig. »Ja, ich male weiter. Ich möchte, dass du im nächsten Frühjahr eine große Vernissage für mich organisierst.«
Krügers massiger Körper entspannte sich sichtlich. »Schön. Das freut mich zu hören. Und das Haus…«, begann er.
»Lass alles so, wie es ist«, sagte Steinhauer. Dann hob er die Hand zum Gruß und trat hinaus in die Sonne.
Robert drückte seine Zigarette aus und stand auf. »Schlossführung!«
Antonia war froh, die Küche verlassen zu können, ohne ihren Kaffee austrinken zu müssen. Sie durchquerten den Flur und standen vor zwei geräumigen Zimmern, die durch eine breite Flügeltür miteinander verbunden waren. Im hinteren Raum befanden sich zwei schäbige, durchgesessene Sofas, ein Sessel und ein monströser alter Fernseher. Das vordere Zimmer beherbergte einen langen Tisch, der antik aussah, und einen Mix aus sechs Stühlen, alte und neue, keiner glich dem anderen. Über dem Tisch hing ein Kronleuchter, dessen geschliffene Kristallglassteine bunte Flecken an die Wände warfen. Beide Zimmer hatten große, bogenförmige Fenster, die zur Straße zeigten. Sie wurden eingerahmt von Gardinen aus schwerem weinrotem Samt. Die Decke zierten breite Stuckleisten.
»Der Salon«, erklärte Robert. »Fernsehzimmer, Ess- und Debattierzimmer.«
Trotz der großen Fenster war es in den beiden Räumen düster. Das mochte an den Tapeten liegen: dunkle Farbtöne mit goldbronzen schimmernden Ornamenten. Die Tapeten und die Vorhänge sind bestimmt mehr als hundert Jahre alt, spekulierte Antonia. Und der Kristalllüster wahrscheinlich auch. Sie fröstelte ein wenig und musste sich eingestehen, dass die Atmosphäre dieser Räume geradezu einschüchternd auf sie wirkte.
»Cool«, sagte sie schließlich, da Robert offenbar auf einen Kommentar ihrerseits zu warten schien.
Über eine breite Holztreppe gelangten sie hinauf in die erste Etage. Von einem dämmrigen Flur gingen fünf Türen ab. Robert deutete auf die Tür an der Stirnseite. »Mein Domizil.« Er wies nach rechts: »Katies Höhle«, und nach links: »Mathes Bude.« Mathe war Matthias, ein weiteres Mitglied der WG, das wusste Antonia von Katie.
»Und hier: das Bad!«
Es war winzig und bestand nur aus Klo und Dusche, alles leicht angegammelt und es roch feucht. Neben dem Bad lag das freie Zimmer, das Antonia bewohnen sollte. Es war ungefähr fünf Meter lang, aber nur halb so breit. Auch hier müffelte es etwas. Die Wände bedeckte eine Raufasertapete, die zahlreiche Bohrlöcher aufwies. Irgendjemand hatte sie fliederfarben gestrichen – nicht gerade Antonias Geschmack. Quer über die Decke lief ein Riss im Putz, in den Ecken hingen dicke graue Spinnweben. Die Holzdielen waren teilweise beschädigt und vom ehemals weißen Lack, mit dem man sie versiegelt hatte, war an den viel begangenen Stellen kaum noch etwas zu sehen. Ein hässlicher Kleiderschrank stand an der rechten Wand, an der linken lehnte eine fleckige Matratze.
»Das traute Heim«, witzelte Robert. »Zimmer mit Aussicht auf den Tod.«
Antonia steuerte auf die Glastür am anderen Ende zu, denn als Erstes musste hier mal gelüftet werden. Die Tür führte hinaus auf einen Balkon, von dem aus man den Vorgarten, die Straße und dahinter das ansteigende Gelände des alten Lindener Bergfriedhofs im Blick hatte. Allerdings war »Balkon« etwas übertrieben, es war lediglich ein halbrunder Austritt mit einem verschnörkelten, rostigen Geländer. Ein Klappstuhl würde darauf mit Ach und Krach Platz finden. Sie dachte flüchtig an ihr altes Zimmer, das fast doppelt so groß gewesen war. Aber das hier war etwas Eigenes, hier konnte sie tun und lassen, was sie wollte, und mit ein bisschen Gips und Farbe…
»Komm, wir sind noch nicht fertig!«, unterbrach Roberts Stimme ihre Gedanken. Neugierig folgte sie ihm eine schmale Treppe hinauf, die vor einer Tür endete.
»Das Mörderzimmer«, verkündete Robert mit einer weit ausholenden Armbewegung. Er kam Antonia in diesem Moment vor wie ein Butler, der Gäste durch ein Spukschloss führt. Sie standen in einem großen Zimmer mit auf halber Höhe schräg zulaufenden Wänden. Es war dunkel darin und es roch wie auf einem Dachboden im Sommer. Anstatt das Licht anzuknipsen, öffnete Robert das Fenster, das zur Gartenseite zeigte. Ehe er das tun konnte, musste er allerdings noch drei Tontöpfe mit vertrockneten Hanfpflanzen wegräumen. »Das war mal so ein Versuch…«, erklärte er. »Aber hier oben vergisst man gerne mal, sie zu gießen.« Er stieß die Fensterläden auf. Sofort strömte das Rauschen des Westschnellwegs ins Zimmer, das nun in ein grünliches, von Blättern gefiltertes Licht getaucht wurde. Antonia erkannte die Schemen von Möbeln: Bett, Stuhl, Schreibtisch, Schrank, Kommode. Sie waren mit weißen Tüchern abgedeckt, was in dem dämmrigen Licht gespenstisch wirkte. Spinnweben hatten sich überall breit gemacht. Es sah aus, als befände sich das Zimmer in einem hundertjährigen Schlaf.
»Wieso ist das das Mörderzimmer?«, fragte sie.
»Hier drin wurde ein Mädchen ermordet.« Sein Ton war ernst geworden.
»Wann war das?«, fragte Antonia und wich unbewusst ein paar Schritte zurück in Richtung Tür.
»Schon ewig her, in den Neunzigern oder so.«
»Hat sie hier drin gewohnt?«
»Ja, wahrscheinlich. Sie war Studentin. Nur ein paar Jahre älter als du.«
»Dann sind das noch ihre Sachen?«
Robert zuckte mit den Achseln. »Vielleicht hat sie es auch möbliert gemietet.«
»Sitzt er im Gefängnis?«
»Wer?«
»Na, der Mörder.«
»Der Mörder…« Robert dehnte das Wort mit sichtlichem Genuss. »Wahrscheinlich. Obwohl – vielleicht ist er schon wieder draußen, vorzeitig entlassen, wer weiß? Er könnte praktisch jeden Moment wieder auftauchen.«
Einem Reflex gehorchend schaute Antonia sich um. Robert bemerkte es und musste lachen. Offenbar machte er sich einen Spaß daraus, ihr Angst einzujagen.
»Blödsinn«, murmelte Antonia, und um Robert zu beweisen, wie unbeeindruckt sie war, ging sie auf eines der Möbelstücke zu und hob das Tuch an. Eine Staubwolke wirbelte auf. Es war ein zierlicher Sekretär aus dunklem rötlichem Holz mit Einlegearbeiten und gedrechselten Beinen. Antonias Großmutter besaß ein ähnliches Möbel, daher wusste sie, dass das Holz Mahagoni war. Eigentlich ein schönes Stück, vielleicht sogar eine Antiquität. Sie zog die mittlere der drei Schubladen auf.
»Was willst du darin finden? Ein blutiges Messer?« Ein spöttisches Lächeln zuckte um seine Mundwinkel.
Die Schublade war natürlich leer, ebenso wie die anderen beiden. Antonia verzichtete darauf, sich die restlichen Möbel näher anzusehen, legte das Tuch wieder über den Schreibtisch und meinte: »Es ist ein schönes Zimmer. Warum wohnt hier keiner von euch?«
Robert stieß ein kurzes Lachen aus. »Na, weil es das Mörderzimmer ist. Ich jedenfalls möchte nicht in einem Raum schlafen, in dem jemand erstochen wurde. Was heißt ›erstochen‹. Es muss ein übles Gemetzel gewesen sein.«
Antonias Blick wanderte automatisch zum Fußboden, als wollte sie die Holzdielen nach Blutflecken absuchen. »Du verarschst mich doch bloß«, wehrte sie schließlich unwirsch ab.
»Wenn du mir nicht glaubst, dann zieh doch hier ein. Es ist groß, hell – und Möbel sind auch da«, schlug Robert vor. »Du sparst dir IKEA.« Antonia zögerte. Auch wenn sie die Zimmer der anderen drei Bewohner noch nicht gesehen hatte, so war dieses hier bestimmt eines der schönsten im ganzen Haus. Es musste also tatsächlich etwas nicht in Ordnung sein damit, sonst hätte es sich längst einer der anderen unter den Nagel gerissen.
»Ich bleibe lieber unten«, entschied Antonia.
»Ein weiser Entschluss.«
Wenn er lächelte, so schelmisch wie jetzt, war er fast unwiderstehlich. Antonia musste sich zusammennehmen, um ihn nicht dauernd anzustarren.
»Möchtest du noch den Keller sehen?«, fragte er.
Ihr »Nein« kam ein wenig zu hastig, sie merkte es, als sie sah, wie Robert in sich hineinkicherte. Er nahm sie bestimmt nicht ernst. Sie hatte nicht vergessen, dass er sie vorhin »Küken« genannt hatte.
»Ich würde jetzt gerne kurz duschen und dann meine Sachen auspacken.«
»Ja, klar. Gehen wir wieder runter.«
Antonia verspürte eine unerklärliche Erleichterung, als sie das seltsame Zimmer wieder verließ und Robert hinter ihr die Tür zumachte.
Sie war gerade dabei, ein frisches Laken über die nicht sehr appetitliche Matratze zu ziehen, als sie Katies Stimme hörte.
»Toooniiii!«
Sie ließ alles stehen und liegen und rannte die Treppe hinunter. Im Flur prallten Antonia und Katie aufeinander und umarmten sich eine halbe Minute lang. Dann streckte Katie die Arme aus, wobei sie Antonia noch immer an den Händen hielt, und sie musterten sich gegenseitig von oben bis unten. Katie hatte sich kaum verändert. Sie war noch immer recht klein, fast einen Kopf kleiner als Antonia, aber ihr Körper war muskulös und ihre Bewegungen voller Schwung und Energie. Ihr dichtes dunkles Haar war kurz und fransig geschnitten. Seit Kurzem zierte ein Piercing ihren Nasenflügel, ein kleiner Stein, so hellblau wie ihre Augen. Antonia hatte den Nasenschmuck schon auf Facebook bewundert, aber in natura sah er noch hübscher aus. Das Markanteste an Katie war jedoch ihre Stimme. »Wie eine Blechbüchse«, hatte mal ein Mitschüler gelästert und der Vergleich passte.
»Toni, Toni, das ist ja echt ein Ding!«
»Du siehst toll aus«, sagte Antonia und das stimmte auch. Katie trug einen sehr kurzen Minirock über einer blickdichten schwarzen Strumpfhose, dazu pinkfarbene Sneakers und ein mehrlagiges T-Shirt in Türkistönen. Verglichen mit ihr sehe ich aus, als käme ich gerade aus dem Stall, erkannte Antonia und schämte sich für ihre Billig-Jeans. Aber leider werde ich in nächster Zeit wohl nicht viel Geld übrig haben, um mir neue Klamotten zu kaufen, realisierte sie im selben Moment.
Sie hatten sich gerade in der Küche hingesetzt und Katie berichtete von ihren ersten Erfahrungen als Auszubildende, als der vierte WG-Bewohner eintraf. Matthias studierte im ersten Semester Informatik an der Leibniz-Uni. Er war ein ehemaliger Schulkamerad von Robert, wirkte aber im Vergleich zu diesem recht unscheinbar: dünnes blondes Haar, helle Wimpern, Sommersprossen. Sein rundes Gesicht mit den randlosen Brillengläsern bildete einen irritierenden Gegensatz zu seinem hoch aufgeschossenen, knochigen Körperbau. Antonia begrüßte er etwas steif mit den Worten »Ja, dann – willkommen«. Danach verschwand er in seinem Zimmer. »Voll der Streber und Mädchen gegenüber total schüchtern, aber ganz okay«, flüsterte Katie Antonia zu. Die beiden saßen in der Küche und schnippelten nach Roberts Anweisung Gemüse für eine Spaghettisoße, während sich Robert eine Zigarette drehte. »Du musst wissen, der maestro lässt die niederen Arbeiten gerne von anderen verrichten«, lästerte Katie.
»Ihr könnt froh sein, dass hier wenigstens einer kochen kann«, gab Robert zurück. »Du und Mathe, ihr würdet doch nur von Chips und Fertigpizza leben und dabei fett werden.«
Katie winkte ab und sagte zu Antonia: »Er kocht wirklich gut, aber nur ohne Fleisch. Lass dich von Robert nie dabei erwischen, wie du ein Würstchen isst, sonst hält er dir stundenlang eine Standpauke. Er ist nämlich ein eingefleischter Vegetarier.« Sie kicherte. Auch Antonia lachte in sich hinein.
»Sehr witzig!« Robert verdrehte die Augen. »Was ist jetzt, wo bleiben die Zwiebeln?«
»Gleich. Verdammte Hacke, sind die scharf!« Katie wischte sich eine Träne von der Wange und beugte sich dann wieder über das Schneidebrett, auf dem sie gerade eine Zwiebel in Würfel zerteilte.
»Ich mag Fleisch eh nicht besonders gerne«, sagte Antonia und wunderte sich über sich selbst. Was tat sie da? Sie log, um Robert zu gefallen! In Wirklichkeit mochte sie Döner, Hamburger und Hotdogs sehr. Und wenn Ralph im Sommer den Grill angeworfen hatte, war ihr jedes Mal das Wasser im Mund zusammengelaufen. Sie mochte nur kein Schweinefleisch, weil sie dann den Gestank zu riechen glaubte, der jeden Tag durch das Dorf zog… Die Erinnerung daran ließ sie schaudern, während Robert einen Vortrag über die tierquälerischen Bedingungen der Massentierhaltung vom Stapel ließ, den Katie spöttisch unterbrach: »Nicht schon wieder, kennen wir doch alles.«
Es war schon nach acht Uhr, als sie alle zusammen an dem großen Tisch Platz nahmen und Antonia merkte, wie hungrig sie war. Robert hatte die Soße mit Kräutern aus dem Garten verfeinert, sie schmeckte richtig gut und die Nudeln waren auf den Punkt gekocht.
»Echt klasse«, lobte sie Roberts Kochkünste und Matthias und Katie stimmten ihr zu.
Robert stand auf, legte die rechte Hand über seine Brust und deutete eine kleine Verbeugung an. »Danke, danke, danke!« Er setzte sich wieder hin. »Aber, Freunde, ich muss euch etwas mitteilen.« Er machte eine kleine Kunstpause, was Katie nutzte, um die Augen in Richtung Decke zu rollen.
»Die Lage ist ernst. Herr Krüger, unser werter Vermieter, hat mich angerufen und gemeckert, dass der Garten aussehen würde wie Sau – womit er, wenn man ehrlich ist, auch echt recht hat. Wir müssen morgen eine verschärfte Gartenaktion durchziehen, sonst gibt’s Stress.«