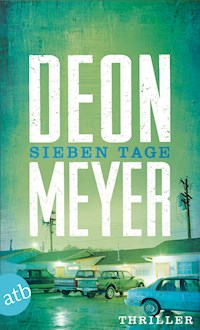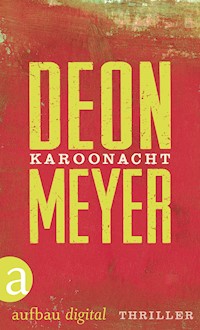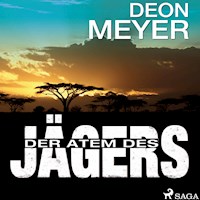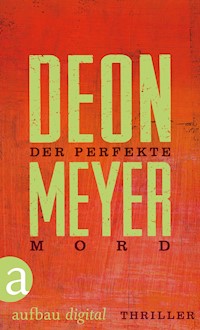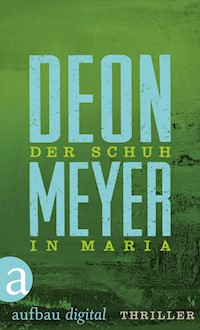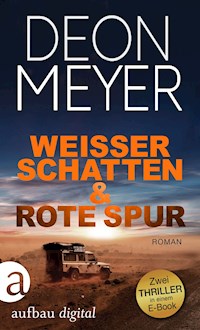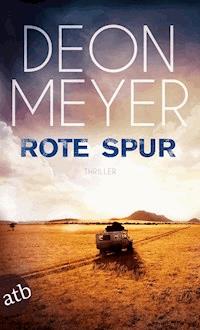
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Bodyguard-Lemmer-Serie
- Sprache: Deutsch
Blutige Spuren.
Es ist nur ein Gerücht: ein islamistischer Anschlag in Südafrika. Doch warum gelingt es dem Geheimdienst nicht, Genaueres herauszufinden? Warum fährt die CIA schweres Geschütz auf? Deon Meyer legt hier einen aktuellen, atemberaubenden Roman vor. Eine Schmugglerin führt alle hinters Licht, eine Agentin verliebt sich in den Falschen, und ein Drogenboss geht über Leichen. Mittendrin der Bodyguard Lemmer, für den das Motto gilt: „Nicht ich suche Ärger – der Ärger sucht mich.“ ...
„Versuchen Sie es: Nehmen Sie dieses Buch in die Hand und legen Sie es dann wieder weg. Versuchen Sie es. Man schafft es einfach nicht. Ich bin ein Profi, und nicht mal ich konnte es.“ Don Winslow.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 798
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Deon Meyer
Rote Spur
Roman
Aus dem Afrikaans von Stefanie Schäfer
Impressum
Die Originalausgabe mit dem Titel
Spoor
erschien 2010 auf Afrikaans bei Human & Rousseau, Cape Town.
Die englische Ausgabe mit dem Titel
Trackers
erschien 2011 bei Hodder & Stoughton, London.
ISBN E-Pub 978-3-8412-0341-0
ISBN PDF 978-3-8412-2341-8
ISBN Printausgabe 978-3-352-00810-8
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Oktober 2011
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die deutsche Erstausgabe erschien 2011 bei Rütten & Loening,
einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Copyright © Deon Meyer 2010
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Mediabureau Di Stefano, Berlin
unter Verwendung eines Motivs von
iStockphoto / Alex Bramwell
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital - die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Impressum
Inhaltsübersicht
1. BUCH: MILLA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2. BUCH: LEMMER
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
3. BUCH: MILLA
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
4. BUCH: MAT JOUBERT
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
EPILOG
109
Danksagungen
Glossar mit Erklärungen der afrikaanssprachigen Wörter und anderer Begriffe
Antje Deistler: Deon Meyer – Bure mit Mission
Fußnote
Zum Gedenken an Madeleine van Biljon (1928 – 2010)
1. BUCH: MILLA
(Komplott)
Juli bis September 2009
… manche Tage hinterlassen keine Spuren.
Sie gehen vorbei, als hätten sie nie existiert, sogleich vergessen im Stumpfsinn des täglichen Einerleis. Die Abdrücke anderer bleiben manchmal für eine Woche oder länger erhalten, bis die Winde des Gedächtnisses sie mit dem Sand neuer Erfahrungen überdecken.
Tagebuch Milla Strachan, 27. September 2009
Das U.S.-Finanzministerium hat heute die südafrikanischen Staatsbürger Farhad Ahmed Dockrat und Junaid Ismail Dockrat sowie eine weitere Person der Finanzierung und Unterstützung der al-Qaida gemäß Durchführungsverordnung 13224 für schuldig befunden. Demzufolge werden sämtliche unter U.S.-Rechtssprechung fallende Vermögenswerte der genannten Personen eingefroren und Transaktionen zwischen Staatsbürgern der U.S.A. sowie den genannten Personen unter Strafe gestellt.
Presseerklärung des U.S.-Finanzministeriums,26. Januar 2007 (verbatim)
1
(31. Juli 2009. Freitag.)
Ismail Mohammed rannte die steil abfallende Heiligerlaan hinunter. Seine weiße Galabija mit dem modernen, offenen Mandarin-Kragen bauschte sich bei jedem seiner Schritte auf. Er ruderte hektisch mit den Armen, aus Angst und um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Die gehäkelte Kufi fiel ihm vom Kopf und blieb auf den Pflastersteinen neben der Kreuzung zurück. Seine Augen waren starr auf die Stadt dort unten gerichtet, wo er einigermaßen in Sicherheit sein würde.
Hinter ihm flog die Tür des weißen, eingeschossigen Hauses neben der Schotsekloof-Moschee oben im Bo-Kaap ein zweites Mal auf. Sechs Männer, ebenfalls in traditionellen muslimischen Gewändern, stürmten auf die Straße und blickten alle instinktiv bergab. Einer hielt eine Pistole in der Hand. Hastig zielte er auf den flüchtenden Ismail Mohammed, der bereits sechzig Meter weit entfernt war, und schoss zwei Mal auf gut Glück, bis der ältere Mann hinter ihm von unten gegen seinen Arm schlug und rief: »Nein! Los, ihm nach!«
Die drei Jüngeren nahmen die Verfolgung auf. Die Älteren blieben zurück, besorgt über Ismails Vorsprung.
»Du hättest auf ihn schießen lassen sollen, Scheich«, sagte einer.
»Nein, Shahid. Er hat uns belauscht.«
»Genau. Und dann ist er geflohen. Das sagt doch alles.«
»Aber nicht, für wen er arbeitet.«
»Er? Ismail? Du glaubst doch wohl nicht …«
»Man kann nie wissen.«
»Nein. Er ist zu … ungeschickt. Höchstens für einen der nationalen Geheimdienste. Die NIA vielleicht.«
»Ich hoffe, du hast recht.« Der Scheich sah den Verfolgernnach, die über die Kreuzung Chiappinistraat sprinteten, und versuchte, die Tragweite des Zwischenfalls zu ermessen. Plötzlich heulte knapp unter ihnen, in Buitengracht, eine Sirene auf.
»Kommt«, sagte er ruhig. »Alles hat sich geändert.«
Er eilte ihnen voraus zum Volvo.
Eine weitere Sirene setzte ein, unten im Herzen der Stadt.
Sie wusste, was die zielstrebigen, eiligen Schritte an einem Freitagnachmittagum fünf bedeuteten. Erfüllt von einer lähmenden, bedrückenden Vorahnung, versuchte sie schweren Herzens, sich zu wappnen.
Barend stürmte herein, umweht von einem Duft nach Shampoo und übermäßig viel Deodorant. Sie sah ihn nicht an. Sie wusste, dass er sich für den Abend gestylt und mit seiner neuen, ungewohnten Frisur herumexperimentiert hatte. Er setzte sich an die Küchentheke. »Na, wie geht’s dir, Mama? Was machst du so?« Richtig jovial.
»Abendessen«, erwiderte Milla gelassen.
»Ach so. Ich esse aber nicht mit.«
Sie hatte es geahnt. Christo würde sicher auch nicht kommen. »Du brauchst doch bestimmt heute Abend dein Auto nicht, oder, Mama?«, fragte er in einem Tonfall, den er bis zur Perfektion vervollkommnet hatte: eine raffinierte Mischung von vorausschauender Gekränktheit und implizitem Vorwurf.
»Wo wollt ihr denn hin?«
»In die Stadt. Jacques kommt mit. Er hat einen Führerschein.«
»Wohin in der Stadt?«
»Wissen wir noch nicht genau.«
»Ich will es aber wissen, Barend«, erwiderte sie so sanft wie möglich.
»Okay, Mama, ich sag dir dann Bescheid.« Die ersten verärgerten Untertöne.
»Wann seid ihr wieder da?«
»Mama, ich bin achtzehn. In meinem Alter war Papa schon in der Armee.«
»Ja, aber auch da gab es Regeln.«
Er seufzte gereizt. »Okay, okay. Sagen wir … wir machen uns um zwölf auf den Heimweg.«
»Das hast du letzte Woche auch versprochen und bist dann erst nach zwei nach Hause gekommen. Du musst dich auf dein Examen vorbereiten, die Klausuren sind …«
»Mein Gott, Mama, musst du mir das immer wieder aufs Butterbrot schmieren? Gönnst du mir denn gar nichts?«
»Doch, ich gönne dir alles. Aber innerhalb gewisser Grenzen.«
Er antwortete mit gedämpftem Hohngelächter, das ausdrückte, was sie doch für eine blöde Kuh sei und dass er sie kaum ertrage. Sie zwang sich, nicht darauf einzugehen.
»Wie gesagt: Wir fahren um zwölf Uhr los.«
»Und bitte trinkt keinen Alkohol.«
»Was machst du dir denn darüber Sorgen?«
Weil ich eine halbe Flasche Brandy in deinem Kleiderschrank gefunden habe, ungeschickt hinter den Unterhosen versteckt, und dazu eine Schachtel Marlboro, dachte sie bei sich. »Es ist meine Aufgabe, mir Sorgen zu machen. Du bist mein Sohn.«
Schweigen. Das schien er zu akzeptieren. Sie fühlte sich erleichtert. Er hatte also bekommen, was er wollte. Bis hierher hatten sie es ohne Auseinandersetzung geschafft. Dann hörte sie das rhythmische Klopfen seines wippenden Beins gegen die Theke und sah, wie er mit dem Deckel der Zuckerdose spielte. Da wusste sie, dass es noch nicht genug war. Er wollte auch noch Geld von ihr.
»Mama, ich möchte nicht, dass Jacques und die anderen für mich bezahlen.«
Er wählte seine Worte derart mit Bedacht, steigerte seine Forderungen so geschickt, pirschte sich mit einer Strategie aus Anschuldigungen und Vorwürfen an sie heran. Er spinnt sein Netz planvoll wie ein Erwachsener, dachte sie. Er stellte seine Fallen auf, und sie tappte jedes Mal hinein, nur weil sie um jeden Preis Konflikte vermeiden wollte. Ihre Stimme verriet, dass sie bereits in die Defensive ging. »Hast du nichts mehr von deinem Taschengeld übrig?«
»Willst du, dass ich wie ein Schmarotzer dastehe?«
Das »Du« und die Aggressivität waren die Auslöser – sie ahnte das vertraute Streitmuster voraus. Sie sollte ihm einfach das Geld geben, ihr Portemonnaie in die Hand drücken und sagen: Hier! Nimm alles! So viel du willst!
Sie atmete tief durch. »Ich möchte, dass du dir dein Taschengeld besser einteilst. Achthundert Rand im Monat sind doch wirklich …«
»Weißt du, wie viel Jacques bekommt?«
»Das spielt keine Rolle, Barend. Wenn du mehr haben möchtest, musst du …«
»Willst du, dass ich alle meine Freunde verliere? Du gönnst mir auch überhaupt nichts, verdammte Scheiße!« Der Fluch und der Knall des Zuckerdosendeckels, den er gegen den Schrank warf, ließen sie zusammenzucken.
»Barend«, sagte sie entsetzt. Schon oft war er explodiert, hatte die Hände in die Luft geworfen, vor sich hin geflucht und feige, knapp außer Hörweite, etwas unsagbar Ordinäres gemurmelt, doch diesmal nicht. Diesmal beugte er den Oberkörper über die Theke, das Gesicht vor Verachtung verzerrt, und sagte: »Du machst mich krank.«
Sie wich zurück, als hätte er sie körperlich angegriffen, und musste sich am Schrank festhalten. Sie wollte nicht weinen, aber die Tränen liefen ihr übers Gesicht, dort am Ofen, mit dem Kochlöffel in der Hand, den Duft von warmem Olivenöl in der Nase. Wieder stammelte sie den Namen ihres Sohnes, beruhigend und sanft.
Voller Bosheit und Verachtung und in der vollen Absicht, sie zu verletzen, mit der Stimme, dem Tonfall und der demütigenden Art seines Vaters sank Barend zurück auf den Hocker und stieß hervor: »Mein Gott, bist du armselig. Kein Wunder, dass dein Mann mit anderen bumst.«
Das Mitglied des Kontrollausschusses, ein Glas in der Hand, winkte Janina Mentz zu. Sie blieb stehen und wartete, bis der Mann sich zu ihr durchgedrängt hatte. »Frau Direktor«, begrüßte er sie, neigte sich zu ihr und näherte seinen Mund verschwörerisch dicht ihrem Ohr. »Haben Sie schon gehört?«
Sie standen in der Mitte des Bankettsaals, umgeben von vierhundert Gästen. Sie schüttelte den Kopf, in Erwartung des Skandälchens der Woche.
»Der Minister erwägt eine Fusion.«
»Welcher Minister?«
»Ihr Minister.«
»Eine Fusion?«
»Die Gründung einer Dachorganisation. Sie, der Nationale Nachrichtendienst NIA, der Geheimdienst, alle gemeinsam. Eine Vereinigung, eine Zusammenlegung. Allgemeine Integration.«
Sie sah ihn an und untersuchte sein vom Alkohol gerötetes Vollmondgesicht auf Zeichen von Humor. Vergeblich.
»Ach was«, sagte sie. Der war doch nicht mehr ganz nüchtern?
»So geht das Gerücht. Ein ziemlich hartnäckiges.«
»Wie viel haben Sie getrunken?«
»Janina, das ist mein voller Ernst.«
Sie wusste, dass er stets gut informiert war und man sich bisher immer auf ihn verlassen konnte. Wie gewohnt verbarg sie ihre Besorgnis. »Besagt das Gerücht auch, wann?«
»Der offizielle Beschluss wird in drei, vier Wochen erwartet. Aber das ist noch nicht alles.«
»Nein?«
»Der Präsident will Mo haben. Als Chef.«
Sie sah ihn nur stirnrunzelnd an.
»Mo Shaik«, präzisierte er.
Sie lachte, kurz und skeptisch.
»Man hört es immer wieder«, beharrte er voller Ernst.
Sie lächelte und wollte ihn gerade nach seiner Quelle fragen, als das Handy in ihrer schwarzen Abendhandtasche klingelte. »Entschuldigen Sie«, sagte sie, öffnete die Handtasche, holte das Telefon heraus und sah, dass es der Anwalt war.
»Tau?«, fragte sie.
»Ismail Mohammed hat kalte Füße bekommen.«
Milla lag in der Dunkelheit, auf der Seite, mit angezogenen Beinen. Nachdem sie sich ausgeweint hatte, musste sie widerwillig einigen schmerzlichen Wahrheiten ins Gesicht sehen. Es war, als sei das Rauchglas, die getönte Scheibe zwischen ihr und der Realität, plötzlich zerbrochen, so dass sie ihr jetziges Dasein im hellen Licht betrachten musste und nicht mehr wegsehen konnte.
Als sie ihren eigenen Anblick nicht mehr ertrug, begann sie, ihren Zustand zu analysieren. Rückblickend versuchte sie nachzuvollziehen, wie sie an diesen Punkt gekommen war. Wie hatte sie derart abstumpfen und so tief sinken können? Wann? Wie hatte diese Lüge, dieses Phantasiegebilde, sie derart täuschen können? Und jede Antwort brachte größere Angst vor dem Unabwendbaren, der Gewissheit, was sie tun musste. Doch sie besaß weder den Mut noch die Kraft dazu. Ja, nicht einmal die Worte. Sie, die nie um Worte verlegen war, im Kopf, in ihrem Tagebuch, immer und überall.
So lag sie da, bis Christo hereinkam, mitten in der Nacht.
Er versuchte gar nicht erst, leise zu sein. Seine unsicheren Schritte wurden vom Teppich gedämpft. Er schaltete das Badezimmerlicht ein, kehrte dann zurück und ließ sich schwer auf der Bettkante nieder.
Mucksmäuschenstill lag sie da, mit dem Rücken zu ihm, die Augen geschlossen. Sie hörte, wie er die Schuhe auszog, sie beiseite warf, aufstand, ins Bad ging, pinkelte, furzte.
Bitte geh duschen. Wasch deine Schweinereien ab.
Der Wasserhahn am Waschbecken lief. Dann ging das Licht aus, und er stieg ins Bett. Knurrte, müde und zufrieden. Kurz bevor er die Decke über sich zog, roch sie ihn. Den Alkohol. Zigarrenrauch, Schweiß. Und den anderen, primitiveren Geruch.
Und in diesem Moment fand sie den Mut.
2
(1. August 2009. Samstag.)
Mitschrift: Vernehmung von Ismail Mohammed, durchgeführt von A.J.M. Williams. Konspirative Wohnung, Tuine, Kapstadt.
Datum und Uhrzeit: 1. August 2009, 17:52
M: Ich will in das Schutzprogramm aufgenommen werden, Williams. Und zwar sofort.
W: Ich verstehe, Ismail, aber …
M: Kein aber. Diese Scheißkerle wollten mich erschießen. Und sie werden nicht lockerlassen, bis sie mich erwischen.
W: Keine Angst, Ismail. Sobald wir sämtliche Informationen von Ihnen haben …
M: Wie lange wird das dauern?
W: Je eher Sie sich beruhigen und mit mir reden, desto eher kann es losgehen.
M: Dann komme ich ins Zeugenschutzprogramm?
W: Sie wissen, dass wir uns um unsere Leute kümmern. Wir sollten jetzt anfangen, Ismail. Wie ist das passiert?
M: Ich habe sie reden hören …
W: Nein, wie haben sie herausgefunden, dass Sie für uns arbeiten?
M: Ich weiß nicht.
W: Aber Sie müssen doch eine Ahnung haben!
M: Nein, ich … wissen Sie … Nachdem ich meinen letzten Bericht hinterlassen hatte, dachte ich … Ich weiß nicht … Kann sein, dass mich jemand gesehen hat. Aber dann … W: Einer von ihnen?
M: Könnte sein. Vielleicht.
W: Warum haben sie Sie verdächtigt?
M: Wie meinen Sie das?
W: Gehen wir mal davon aus, dass sie Sie beschattet haben. Das muss doch einen Grund gehabt haben. Sie müssen irgendetwas getan haben. Vielleicht zu viele Fragen gestellt? Oder Sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort?
M: Das ist Ihre Schuld! Wenn ich über Handy hätte berichten können, wäre ich jetzt noch dort.
W: Handys sind gefährlich, Ismail, das wissen Sie doch.
M: Aber die können doch nicht alle verdammten Handys am ganzen Kap abhören!
W: Nein, Ismail, nur die wichtigen. Aber was hat das Handy damit zu tun?
M: Weil ich mich jedes Mal wegschleichen musste, wenn ich einen Bericht in dem toten Briefkasten hinterlassen wollte.
W: Was ist nach diesem letzten Bericht passiert?
M: Der Bericht war am Montag. Am Dienstag hat dann die Scheiße angefangen, die haben sich immer so komisch angeschaut, aber nichts gesagt. Erst dachte ich, die Spannungen hätten nichts mit mir zu tun, sondern vielleicht mit der Schiffsladung. Aber gestern ist mir aufgefallen, dass sie sich nur so benommen haben, wenn ich in der Nähe war. Sie haben versucht, sich nichts anmerken zu lassen, aber ich hab’s trotzdem bemerkt. Da habe ich mir allmählich Sorgen gemacht und gedacht: Halt lieber die Ohren offen, da stimmt was nicht. Und dann hat gestern Suleiman am Rat teilgenommen, und ich sollte mit Rayan zusammen in der Küche warten …
W: Suleiman Dolly. Der Scheich.
M: Genau.
W: Und wer ist Rayan?
M: Baboo Rayan. Ein Handlanger, ein Fahrer. Genau wie ich. Wir haben zusammen gearbeitet. Na, jedenfalls hat Rayan kein Wort mit mir geredet, was sehr merkwürdig war. Und dann haben sie Rayan auch reingerufen, zum allerersten Mal, ich meine, er ist ein Kerl für die Drecksarbeit, genau wie ich, wir werden nie dazugeholt. Da dachte ich, ich horche mal lieber an der Tür, denn mir schwante nichts Gutes. Ich bin also raus auf den Flur gegangen, und da habe ich gehört, wie der Scheich – also Suleiman – gesagt hat: »Wir können kein Risiko eingehen, es steht zu viel auf dem Spiel.«
W: »Es steht zu viel auf dem Spiel.«
M: Genau. Dann sagte der Scheich zu Rayan: »Erzähl dem Rat, wie Ismail sich regelmäßig wegschleicht.«
W: Weiter.
M: Weiter weiß ich nicht, denn danach haben sie mich geschnappt.
W: Wie?
M: Der Imam hat mich vor der Tür erwischt. Ich dachte, er wäre drinnen. Sie hätten alle drin sein müssen.
W: Und dann sind Sie weggerannt.
M: Ja, dann bin ich weggerannt, und die Scheißkerle haben auf mich geschossen. Ich sag Ihnen, diese Leute sind skrupellos. Extrem.
W: Okay, kommen wir also noch einmal auf den Montag zurück. In diesem Bericht haben Sie »viele plötzliche Aktivitäten« erwähnt …
M: Ja, in den letzten zwei Wochen. Da braut sich etwas zusammen.
W: Wie kommen Sie darauf?
M: Monatelang hat sich der Rat einmal pro Woche getroffen. Und jetzt plötzlich drei, vier Mal. Was würden Sie daraus schließen?
W: Sie wissen aber nicht, warum.
M: Muss mit der Schiffsfracht zusammenhängen.
W: Erzählen Sie noch einmal von dem Anruf. Suleiman und Macki.
M: Das war letzten Freitag. Macki hat den Scheich angerufen. Aber der Scheich ist aufgestanden und raus in den Flur gegangen, deshalb konnte ich nicht alles verstehen.
W: Woher wussten Sie, dass es Macki war?
M: Weil der Scheich sagte: »Hallo, Sayyid.«
W: Sayyid Khalid bin Alawi Macki.
M: Das ist er. Und im Rausgehen hat der Scheich Macki gefragt: »Irgendwelche Neuigkeiten über die Schiffsladung?« Und dann sagte er: »September.« Wie zur Bestätigung.
W: Ist das alles?
M: Das war alles, was ich von ihrer Unterhaltung gehört habe. Als der Scheich wieder hereinkam, sagte er zu den anderen: »Schlechte Nachrichten.«
W: »Schlechte Nachrichten.« Was hat das zu bedeuten?
M: Woher soll ich das wissen? Es könnte heißen, dass die Ladung unvollständig ist. Oder der Zeitplan ungünstig. Es konnte sonstwas sein.
W: Und dann?
M: Dann sind sie gegangen, der Scheich und die beiden Mitglieder des Höchsten Rats. Sie gingen runter in den Keller. Das bedeutet: top secret.
W: Die Schiffsladung trifft also im September ein? Diese Schlussfolgerung haben Sie gezogen?
M: Mehr kann man sich nicht zusammenreimen.
W: Heißt das ja?
M: Ich glaube es jedenfalls.
W: Und diese Fracht. Haben Sie eine Ahnung, was das sein könnte?
M: Wissen Sie, wenn Macki damit zu tun hat, sind es garantiert Diamanten.
W: Was will der Rat mit Diamanten, Ismail?
M: Das weiß nur der Höchste Rat.
W: Und niemand sonst hat etwas erwähnt?
M: Natürlich wurde darüber geredet, unter den gewöhnlichen Mitgliedern. Aber nur hinter vorgehaltener Hand.
W: Wo Rauch ist … Was haben diese gewöhnlichen Mitglieder gesagt?
M: Sie haben behauptet, es ginge um Waffen. Für Anschläge vor Ort.
W: Was soll das heißen?
M: So lautete das Gerücht. Dass sie Waffen einschmuggeln wollten. Für einen Anschlag, hier. Zum ersten Mal.
W: Ein islamistischer Anschlag? In Südafrika?
M: Ja. Hier. In Kapstadt. An unserem schönen Kap.
3
(2. August 2009. Sonntag.)
Im sechsten Stockwerk der Wale Street Chambers, im Direktionsbüro des Präsidentiellen Nachrichtendienstes, kurz 9,5 studierte Janina Mentz die Mitschrift äußerst aufmerksam. Nachdem sie fertig war, setzte sie die Brille ab, legte sie auf den Schreibtisch und rieb sich die Augen.
Sie hatte nicht gut geschlafen. Die Neuigkeit des gestrigen Abends nagte an ihr, dieses Gerücht über eine Fusion. Abstrus genug, um wahr zu sein.
Doch was sollte dann aus ihr werden?
Sie galt nämlich als Protegé Mbekis, des vorherigen Präsidenten und Gründers der PIA. Und obwohl Mentz im Streit um die Führung des Landes keine Position bezogen hatte und ihre Leute ausgezeichnete Arbeit leisteten, blieb dieses Stigma an ihr haften. Außerdem war sie neu, noch keine dreizehn Monate im Amt, und ihr fehlte der notwendige Erfolgsnachweis, um auf eine neue Stelle pochen zu können. Und nicht zuletzt war sie weiß.
Was stimmte an dem Gerücht? Mo Shaik als Chef der Dachorganisation? Mo, der Bruder Schabirs. Schabir, dieser wegen Korruption verhaftete Halunke und ehemalige Freund des neuen Präsidenten.
Nichts schien unmöglich.
So viele Jahre im Dienst. So viele Kämpfe und zäher Eifer, so viel harte Arbeit, um es so weit zu bringen. Nur, um alles wieder zu verlieren?
Nein.
Janina Mentz ließ die Hände sinken und setzte die Brille auf.
Erneut zog sie die Ismail-Mohammed-Vernehmung heran. Was sie, was die PIA zum Überleben brauchte, war eine extreme Erschütterung. Eine große Bedrohung. Eine heikle Angelegenheit. Und hier war sie, vom Himmel gesandt. Jetzt lag es an ihr, sie geschickt zu nutzen.
Sie drehte sich zu ihrem Computer um und suchte die einschlägigen Artikel aus der Datenbank heraus.
Bericht: Islamischer Extremismus in Südafrika, eine Neubewertung
Datum: 14. Februar 2007
Zusammengestellt von: Velma du Plessis und Donald MacFarland
Qibla in neuem Gewand
Die Qibla wurde 1980 von dem radikalen Imam Achmed Cassiem gegründet, um nach dem Vorbild der iranischen Revolution die Gründung eines islamischen Staates in Südafrika voranzutreiben. In den 1980er Jahren schickte die Qibla Mitglieder zur militärischen Ausbildung nach Libyen und in den Neunzigern kämpften in Pakistan geschulte Terroristen an der Seite der Hisbollah im Südlibanon. Nach den Anschlägen des 9. September wurden auch Kämpfer für den Einsatz in Afghanistan rekrutiert.
Aufgrund des scharfen Vorgehens gegen die verwandte Organisation People Against Gangsterism and Drugs (PAGAD) zwischen 1998 und 2000 sowie der Verhaftung von über hundert Qibla-Anhängern wegen schwerer Verbrechen, darunter Mord, verschwand die Qibla nahezu von der Bildfläche. An ihrer Stelle wurde eine wesentlich geheimere Organisation gegründet. Sie nennt sich »Der Höchste Rat«.
(3. August 2009. Montag.)
Milla Strachan zog den Schlüssel aus dem Schloss, stieß die Haustür auf, ging aber nicht sofort hinein. Zunächst blieb sie reglos stehen, einen ratlosen Blick in den dunklen Augen. Die Zimmer der Wohnung jenseits der offenen Tür waren leer. Keine Gardinen, keine Möbel, nur ein verschlissener Teppichboden in fast gänzlich verblasstem Beige.
Noch immer stand sie zögernd vor der Tür, als hielte ein großes Gewicht sie zurück, als warte sie auf irgendetwas.
Bis sie sich plötzlich energisch bückte, die beiden großen Reisetaschen rechts und links aufhob und durch die Tür trat.
Sie stellte ihr Gepäck im Schlafzimmer ab, sich deutlich der beklemmenden Leere bewusst. Bei der Wohnungsbesichtigung am Samstag hatten noch die Möbel der früheren Bewohnerin den Raum ausgefüllt, Umzugskartons stapelten sich, bereit für den übereilten Rücktransport nach Deutschland, nachdem die Frau kurzfristig in den Hauptsitz der Hilfsorganisation zurückbeordert worden war. »Ich bin so dankbar, dass jemand die Anzeige gelesen hat, es musste alles so schnell gehen. Sie werden es nicht bereuen, sehen Sie mal, diese Aussicht!« Die Frau hatte auf das Fenster gezeigt. Es lag zur Davenpoortstraat in Vredehoek hin und bot einen Blick auf einen schmalen Ausschnitt der Stadt und des Meeres, eingerahmt von den Häusern auf der anderen Straßenseite.
Milla sagte, sie wolle die Wohnung haben und werde den Mietvertrag übernehmen.
»Woher kommen Sie?«, hatte die Frau gefragt.
»Aus einer anderen Welt«, hatte Milla leise geantwortet.
Die drei, die sich um den runden Tisch in Mentz’ Büro versammelt hatten, hätten unterschiedlicher kaum sein können. Die Direktorin besaß ein strenges Gesicht, trotz ihres vollen, breiten, jedoch stets ungeschminkten Mundes. Dazu trug sie eine nüchterne Brille mit Metallgestell, die Haare stets straff nach hinten gekämmt und konservative Kleidung, locker sitzend, grau-weiß, als wolle sie ihre Weiblichkeit verhüllen. Die alten Aknenarben auf ihren Wangen überdeckte sie mit Fond de Teint, die schlanken Finger schmückten weder Ringe noch Nagellack. Ihr Gesichtsausdruck war meist undurchdringlich.
Dann war da Rechtsanwalt Tau Masilo, der stellvertretende Direktor, zuständig für Einsatz und Strategie. Dreiundvierzig, straffer Bauch, helle Hosenträger, passende Krawatte, ein klein wenig geckenhaft. Ausgeprägte, gravitätische Gesichtszüge, eindringliche Augen, die Haare kurz und gepflegt. Masilos Mitarbeiter nannten ihn »Nobody« – eine Anspielung auf »nobody is perfect«. Denn Tau Masilo, phlegmatisch und kompetent, war in ihren Augen perfekt. Er war ein SeSotho, sprach aber fließend fünf weitere südafrikanische Sprachen. Mentz hatte ihn sorgfältig ausgewählt.
Der dritte im Bunde war Rajkumar, ebenfalls stellvertretender Direktor, zuständig für Nachrichtentechnik. Seine langen schwarzen Haare reichten ihm bis zum Hintern. Ihn hatte Mentz geerbt.
Rajkumars Vorteile bestanden in seinem phänomenalen Intellekt und seinem breiten Wissen über elektronische und digitale Kommunikation. Er verkörperte in allem ein Extrem: feinfühlig, aber sozial unbeholfen. Er hatte die Unterarme auf den Tisch gelegt, die dicken Finger verschränkt und starrte intensiv seine Hände an, als sei er vollkommen davon gefesselt.
Mentz hob langsam den Blick. »Haben wir sonst noch irgendwelche Beweise?«
Rajkumar, stets eifrig zur Stelle, antwortete: »Der E-Mail-Verkehr des Höchsten Rats ist erheblich reger geworden. Ich glaube, Ismail hat recht, da braut sich etwas zusammen. Aber was die Gründe angeht, bin ich mir nicht so sicher …«
»Tau?«
»Mich stören die Nachrichten aus Zimbabwe. Macki besitzt keinen Einfluss mehr – er und Mugabe haben sich überworfen.«
»Also kommt die Ware vielleicht gar nicht aus Zimbabwe?«
»Möglicherweise nicht. Sie könnte auch direkt aus Oman kommen oder aus einer ganz anderen Richtung. Angola wäre eine Möglichkeit.«
»Und die Vermutung, dass sie Anschläge am Kap planen?«, fragte Mentz.
»Da bin ich mit Raj einer Meinung. Erstens würden Terroranschläge hierzulande ihre Verbündeten verärgern. Die Hamas und die Hisbollah sind äußerst dankbar für die Sympathie und Unterstützung seitens unserer Regierung. Zweitens: Welchen Nutzen zögen sie daraus? Welches Ziel sollten sie angreifen? Mir fällt nichts ein, was sie damit erreichen könnten. Und drittens: Welches Motiv könnten sie haben? – Afghanistan«, fuhr der Anwalt fort, »das ist ihr neuer Brennpunkt. Die Mudschaheddin brauchen Waffen und Vorräte, aber woher sollen sie sie beziehen? Pakistan hat sich mit den USA verbündet und schottet seine Grenzen ab, die Transporte aus dem Mittleren Osten stehen unter strenger Beobachtung der NATO. Somalia kommt wegen der Seeräuber nicht mehr in Frage.«
»Der Opiumpreis ist ebenfalls am Boden«, ergänzte Rajkumar. »Die Taliban sind nicht mehr so gut bei Kasse wie früher.«
»Von wo aus transportieren sie also ihre Ladung?«, fragte Masilo und gab auch gleich die Antwort: »Von hier aus.«
»Wie denn?«
»Keine Ahnung. Per Schiff?«
»Warum nicht?«, sagte Rajkumar. »Afghanistan hat keine Küste, aber der Iran.«
»Dann könnte man die Waffen auch von Indonesien aus verschiffen. Dort gibt es viele radikale Muslime.«
»Gute Idee. Aber so weit denken sicher auch die Amerikaner, die in diesem Gebiet zahlreiche Kriegsschiffe stationiert haben.«
Sie sahen Mentz an. Die Direktorin nickte und schob die Akten zu einem ordentlichen Stapel zusammen. »Trotz allem hat Ismail von einem Anschlag hier bei uns gesprochen.«
»Das war doch nur ein Gerücht unter den einfachen Mitgliedern.«
»Wie Sie wissen, verbreiten sich Informationen von oben nach unten, Raj.« Mentz sah Masilo an. »Wie schnell können wir Ismail Mohammed ersetzen?«
»Das wird nicht einfach. Die Sache mit Ismail hat sie misstrauisch gemacht. Sie versammeln sich nicht mehr in dem Haus an der Schotsekloof. Wir müssen erst ihren neuen Treffpunkt ermitteln. Wenn es einen gibt.«
»Das hat absolute Priorität, Tau. Spür sie auf. Und ich will einen Ersatz für Ismail.«
»Das wird aber eine Weile dauern.«
»Sie haben weniger als einen Monat.«
Tau schüttelte den Kopf. »Mevrou, wir haben uns in den letzten drei, vier Jahren kaum noch für diese Gruppe interessiert. Es ist eine geschlossene Gesellschaft. Ismail hatte es gerade so geschafft, sich einzuschleusen.«
»Wir brauchen aber einen zweiten Informanten.«
»Ich werde eine Liste zusammenstellen.«
»Raj, warum können Sie ihre E-Mails nicht lesen?«
»Weil sie eine Verschlüsselungstechnik benutzen, die wir noch nie gesehen haben. Es könnte eine Variante des 128-Bit-Codes sein, aber Tatsache ist, dass wir ihn bisher nicht knacken konnten. Wir bleiben am Ball und untersuchen jede einzelne Sendung. Früher oder später wird ihnen ein Fehler unterlaufen, indem sie vergessen, eine Nachricht zu kodieren. So etwas passiert immer irgendwann.«
Mentz dachte einen Augenblick nach und sagte dann: »Hier ist etwas im Busch, meine Herren. Alle Zeichen deuten darauf hin. Der E-Mail-Verkehr, das plötzliche Vorgehen gegen Ismail, die Gerüchte, die angebliche Schiffsladung, und das nach zwei Jahren Funkstille. Ich will wissen, was da los ist. Wenn Sie noch Leute oder Mittel benötigen, wenden Sie sich an mich. Tau, verdoppeln Sie die Observation. Ich will einen Ersatz für Ismail, ich will wöchentliche Berichte über unsere Fortschritte, ich will Konzentration und Einsatzbereitschaft. Danke, dass Sie heute früher gekommen sind.«
Sie holte zwei weitere Taschen und dann den Schlafsack und die Luftmatratze aus ihrem weißen Renault Clio, den sie draußen am Straßenrand geparkt hatte. Was wohl zufällige Beobachter denken mochten, wenn sie sie sahen: eine Frau um die vierzig, die allein hier einzog. Dazu brütete in ihr diese vage, undefinierbare Angst wie ein dösendes Krokodil unter der Wasseroberfläche.
Sie räumte ihre Kleider in die Einbauschränke aus billigem weißen Melamin. Im Spiegelschrank über dem Waschbecken im Badezimmer war nicht genug Platz für ihre Kosmetika. Als sie die Tür zuklappte, fiel ihr Blick auf ihr Spiegelbild, und sie erkannte sich kaum wieder. Schwarze, halblange Haare ohne vernünftigen Schnitt, graumelierter Ansatz, der dringend nachgefärbt werden musste. Olivfarbene, mediterrane Haut, Krähenfüße in den Augenwinkeln, tiefe Nasolabialfalten, ungeschminkt, leblos, müde. Es war ein Schock. Mein Gott, Milla, hast du dich gehen lassen, kein Wunder, welcher Mann würde schon bei dir bleiben wollen?
Sie drehte sich hastig weg, denn als Nächstes wollte sie die Matratze aufblasen.
Im Schlafzimmer setzte sie sich auf den Boden, rollte die Matratze aus und setzte das Ventil an die Lippen. Pustete. Worte gingen ihr durch den Kopf. Wie immer viel zu viele.
Einige würde sie heute Abend in ihr Tagebuch schreiben: Ich bin hier, weil die Frau im Spiegel versagt hat, Tag für Tag. Als hielte ich ein Seil in den Händen, an dessen anderem Ende ein Gewicht in einen Abgrund hinunterhängt, gerade schwer genug, um mir nach und nach durch die Finger zu rutschen, bis mir das Ende entschlüpft. Die Ursache, so weiß ich inzwischen, liegt ausschließlich bei mir. In der Beschaffenheit meines Körpers, in der Struktur meiner DNS. So erschaffen, nie verändert. Unfähig. Unfähig trotz meiner angestrengten Versuche und guten Vorsätze. Unfähig wegen meiner Versuche und Vorsätze. Eine inhärente, unentrinnbare, vollkommene, frustrierende, jämmerliche Unfähigkeit: Ich kann diesem Mann keine gute Frau sein. Ich kann diesem Kind keine gute Mutter sein. Höchstwahrscheinlich würde ich für niemanden eine gute Frau abgeben, ja, bin ich ganz allgemein unfähig, eine gute Ehefrau und Mutter zu sein.
Das Handy in ihrer Handtasche klingelte. Vorsichtig und ohne Eile drückte sie den Verschluss in das Ventil, denn sie vermutete, dass es Christo war. Ihr Exmann. In jeder Hinsicht.
Er hatte den Umschlag erhalten.
Sie holte das Handy aus ihrer Handtasche und warf einen Blick auf das Display. Christos Firmennummer.
Wahrscheinlich saß er in seinem Büro, ihren Brief auf dem Schreibtisch vor sich, dazu die Unterlagen ihres Anwalts, die sie am Samstag rasch aufgesetzt hatten. Vorher hatte er sicher die Tür geschlossen, mit einem wütenden Gesichtsausdruck in der Variante: Du-blödes-armseliges-dämliches-Weib! Demütigende Beschimpfungen mussten sich in ihm aufgestaut haben. Wenn sie jetzt dranginge, würde er mit einem »Mein Gott, Milla!« beginnen und dann alle Schleusen öffnen.
Mit klopfendem Herzen und zittrigen Händen starrte sie die Nummer an. Sie ließ die Hand mit dem Handy sinken und verstaute es wieder in der Handtasche. Unheilvoll leuchtete das Display in der dunklen Öffnung.
Endlich verstummte das Klingeln, und die Mailbox schaltete sich ein. Das Licht erlosch. Sie wusste, dass er ihr eine Nachricht hinterließe. Gespickt mit Flüchen.
Sie wandte sich von der Tasche ab und fasste einen Entschluss: Sie würde sich eine neue Nummer zulegen.
Noch ehe sie sich wieder neben die Matratze setzte, ertönte das Signal, dass sie eine neue Nachricht erhalten habe.
(5. August 2009. Mittwoch.)
Am späten Nachmittag wurde der Ardo-Kühlschrank geliefert. Nachdem die Männer gegangen waren, stellte sich Milla davor und lauschte dem beruhigenden Brummen, betrachtete das wuchtige Gerät und fand, es böte ihr irgendwie Halt. Die erste klobige Barrikade gegen die Rückkehr, gegen den Untergang, gegen die Angst vor einer ungewissen Zukunft. Dazu kam eine ganz neue Sorge, nämlich um Geld. Ein Bett, ein Sofa, ein Tisch, Stühle, ein Schreibtisch, Gardinen, alles war bestellt und würde ein kleines Vermögen kosten.
Ihr Notgroschen, ihr bescheidenes Erbe, war beträchtlich geschrumpft.
Sie würde eine Arbeit finden müssen. Dringend. Weil sie Geld brauchte. Aber auch, weil sie frei sein wollte.
4
(6. August 2009. Donnerstag.)
Morgens fuhr sie gegen zehn Uhr zurück nach Durbanville, weil sie wusste, dass um diese Zeit niemand zu Hause sein würde. Sie wollte den Schlafsack und die Luftmatratze in die Garage bringen, weil sie Christo gehörten, und ihre Schlüssel endgültig zurücklassen.
Herta Ernastraat.
Christo hatte sie ausgelacht, als sie gesagt hatte, sie wolle nicht in einer Straße dieses Namens wohnen.
Er arbeitete mit Zahlen und hatte ihre Beziehung zu Worten nie verstanden. Ihm war unbegreiflich, dass Worte Rhythmus, Gefühl und Dynamik besaßen. Dass die Art, wie Mund und Zunge sie formten, untrennbar mit ihrem Klang, ihrer Bedeutung und den Gefühlen, die sie auslösten, verbunden war.
Die Lombards aus der Herta Ernastraat. Beim Einzug war es ihr kalt den Rücken hinuntergelaufen.
Sie wartete ungeduldig, während das Eingangstor langsam aufschwang. Hinter den Garagen ragte das große, zweistöckige Haus empor. Ein Architekt hatte den Baustil in einer Zeitschrift als »Bauunternehmers Sahneschnittchen« bezeichnet. »Man könnte auch sagen: transvaal-toskanisch. Mit etwas Wohlwollen vielleicht: Vorstadtmoderne.«
Sie hatten es damals zusammen besichtigt. Zwei Monate lang hatten sie in dieser Gegend etwas gesucht, denn Christo wollte auf Biegen und Brechen hierherziehen. Aus dem einzigen Grund: »Weil wir es uns leisten können.« Was im Grunde bedeutete: Wir sind jetzt zu wohlhabend für Stellenberg.
Ein Durbanville-Haus nach dem anderen. Sie hatte sie gewogen und für zu leicht befunden. Luxuriöse, kalte, unpersönliche Behausungen. Und nicht eines enthielt Bücherregale. Daran erinnerte sie sich am deutlichsten, all diese reichen Weißen, aber nicht ein Buch im Haus. Bars, ja, wuchtige, teure Monstrositäten aus Holz, ob aus alten Eisenbahnschwellen oder poliertem hellem Weichholz im Schwedenstil, die indirekte Beleuchtung oft mit peinlicher Sorgfalt, fachmännisch und teuer installiert. Auf Knopfdruck erwachte, erschien, erstrahlte vor einem: ein heiliger Ort, eine Kathedrale des Alkohols.
Dann hatten sie dieses Haus gesehen, und Christo erklärte: »Das hier will ich haben.« Denn es sah nach Reichtum aus. Sie hatte sich dagegen gewehrt, gegen diesen ganzen Ort, auch gegen den Straßennamen. Er hatte alles lachend abgetan und den Vertrag unterzeichnet.
Milla fuhr die Auffahrt hinauf bis vor die drei Garagentore. Eine Garage war für Christos Audi Q7, eine für ihren Renault und eine für Christos Spielsachen bestimmt.
Sie betätigte die Fernbedienung, und das Garagentür öffnete sich. Sie nahm den Schlafsack und die Luftmatratze, beide ordentlich aufgerollt, stieg aus und betrat die Garage.
Der Platz des Q7 war leer.
Ein Glück.
Hastig ging sie nach hinten durch, wo Christo seine Sachen akribisch geordnet aufbewahrte, und legte das Bettzeug zurück an seinen Platz. Sie hielt inne. Die Tür links von ihr führte ins Haus. Sie wusste, dass sie nicht hindurchtreten durfte. Sie würde Barends vertrauten Geruch wahrnehmen. Sie würde sehen, wie sie jetzt lebten. Sie würde die Schwerkraft ihres hiesigen Lebens spüren.
Hunde kläfften in der Straße. Die schwere Hand der Depression legte sich auf ihre Schulter.
In diesem Viertel bellten tagsüber unaufhörlich die Hunde. Dogville. So hatte sie Durbanville bezeichnet, als sie es eines Tages wieder einmal gewagt hatte, sich Christo gegenüber zu beklagen.
»Mein Gott, Milla, musst du denn an allem herummeckern?«
Hastig verließ sie die Garage und kehrte zu ihrem Auto zurück.
Vor dem Palm Grove Centre im Zentrum von Durbanville bog sie in den nächstbesten freien Parkplatz ein, in der Absicht, sich bei Woolworth etwas zum Mittagessen zu kaufen. Als sie ausstieg, fiel ihr Blick auf das Aushängeschild von Arthur Murrays Tanzstudio, ganz kurz nur. Sie hatte ganz vergessen, dass es das hier gab – noch ein Beweis für die Blase, in der sie gelebt hatte. Beim Betreten des Supermarktes nahm sie den Duft der Blumen wahr und betrachtete die leuchtenden Farben, als sähe sie sie zum ersten Mal. Sie dachte an die Worte, die sie gestern Abend in ihr Tagebuch geschrieben hatte. Wie kann ich wieder die werden, die ich war, v. Chr.? (vor Christo)
Zurück bei ihrem Renault blickte sie wieder zu dem Aushängeschild auf.
Tanzen. Christo hatte sich immer geweigert zu tanzen. Schon auf der Universität. Warum hatte sie all das so gelassen hingenommen, seine Entscheidungen, seine Vorlieben? Es hatte ihr so viel Spaß gemacht, damals, bevor sich alles veränderte.
Sie schloss das Auto auf, stieg ein und legte die Blumen und die Plastiktüte mit den Zutaten für das Mittagessen auf den Beifahrersitz.
Sie war frei von Christo.
Sie stieg aus, schloss die Tür und machte sich auf den Weg zum Studio.
Auf der Tanzfläche sah sie in dem hellen Licht, das durch die Fenster fiel, einen Mann und eine Frau. Jung. Er trug eine schwarze Hose, ein weißes Hemd und eine schwarze Weste, sie ein kurzes, weinrotes Kleid. Ihre Beine waren lang und wohlgeformt. Ein Tango ertönte aus den Lautsprechern, und die beiden schwebten mühelos und graziös über das Parkett.
Milla starrte sie an, gefesselt von der Schönheit dieser Szene, den flüssigen, harmonischen Bewegungen, der sichtlichen Freude des Paares. Eine plötzliche Sehnsucht erfüllte sie – irgendetwas auch so virtuos zu beherrschen, etwas Schönes, in dem man ganz aufgehen konnte, ein Erlebnis für die Sinne, ein Geben und Nehmen zugleich.
Wenn sie nur so tanzen könnte! So frei.
Schließlich ging sie zum Empfang. Eine Frau blickte auf und lächelte.
»Ich möchte mich zu einem Kurs anmelden«, sagte Milla.
(7. August 2009. Freitag.)
Sie hatte sich die Haare schneiden und färben lassen. Ihre Kleidung sorgfältig ausgewählt. Ihr Ziel war lässiger Schick, beiläufige Eleganz, indem sie Stiefel und einen schwarzen Rollkragenpulli zu einer langen Hose trug und mit einem roten Schal kombinierte. Doch während sie im Café des Pressegebäudes Media24 auf eine Freundin wartete, fühlte sie sich unsicher – das Make-up erschien ihr zu hell, der Schal zu leuchtend. Insgesamt wirkte sie zu förmlich, zu übertrieben zurechtgemacht.
Doch als ihre Freundin erschien, sagte sie: »Milla! Du siehst ja toll aus!«
»Findest du?«
»Du weißt, dass du schön bist.«
Nein, das wusste sie nicht.
Die Freundin hatte vor fast zwanzig Jahren mit ihr zusammen studiert und Karriere als Journalistin gemacht. Die Freundin hatte eine Topfigur und war inzwischen zur stellvertretenden Chefredakteurin einer bekannten Frauenzeitschrift aufgestiegen. Sie sprach oft in Anführungs- und mit Ausrufezeichen.
»Wie geht es dir denn?«
»Gut.« Etwas unsicher fügte Milla hinzu: »Ich will anfangen zu arbeiten.«
»Dein Buch schreiben? Endlich!«
»Nein, ich suche eine Stelle als Journalistin …«
»Nein! Milla! Warum denn? Hast du Probleme?«
Sie konnte noch nicht über alles reden. Deswegen zuckte sie nur mit den Schultern und sagte: »Barend ist erwachsen, ich muss seinetwegen nicht mehr zu Hause bleiben.«
»Milla! Das wird aber schwierig werden. Du hast die falsche Hautfarbe. Du hast keine Berufserfahrung – was willst du denn in deinen Lebenslauf schreiben? Dein Abschluss nützt dir gar nichts, nicht in unserem Alter. Du musst mit Scharen junger, ehrgeiziger, hochqualifizierter Leute konkurrieren, die bereit sind, umsonst zu arbeiten. Sie kennen sich mit den digitalen Medien aus, Milla, sie leben damit! Und die Wirtschaftskrise! Weißt du, wie viele Zeitschriften in Konkurs gegangen sind? Überall gilt Einstellungsstopp, Abbau von Arbeitsplätzen. Einen ungünstigeren Zeitpunkt hättest du dir nicht aussuchen können. Sag Christo, du willst eine Boutique aufmachen. Oder ein Café. Als Journalistin arbeiten? Vergiss es!«
(9. August 2009. Sonntag.)
Sie saß auf ihrem neuen Sofa im Wohnzimmer. Vor ihr auf dem Wohnzimmertisch lag der Stellenteil der Sunday Times. Ängstlich wanderte ihr Blick über die Stellenanzeigen aus der Medienbranche – die Firmen suchten eCommerce Operations Manager, WordPress /PHP Developer, Webdesigner und Web-Editoren (Internet / Mobilerfahrung vorausges.)
Erneut wuchs ihre Beklemmung. Verzweiflung übermannte sie. Sie würde es nicht schaffen, sie würde nicht allein zurechtkommen. Die Freundin hatte recht. Und der Berater in der Arbeitsvermittlung hatte am Freitagnachmittag dasselbe gesagt, wenn auch politisch korrekter und mit Berufseuphemismen verbrämt: Sie hatte keine Chance.
Sie wollte das nicht akzeptieren. Erst hatte sie die Zeitschriften angerufen, persönlich, eine nach der anderen. Bei ihren Lieblingszeitschriften angefangen bis hin zu den Tageszeitungen, sowohl den afrikaans- als auch den englischsprachigen Publikationen. Danach hatte sie es bei den Lokalzeitungen, der Boulevardpresse und den Wochenblättchen versucht. Endlich hatte sie sogar versucht, die Herausgeber der Klatschpresse zu erreichen.
Ohne Erfolg. Immer dieselbe Antwort: Wir haben keine freien Stellen zu besetzen. Aber schicken Sie uns doch Ihre Bewerbung und Ihren Lebenslauf.
Ganz unten auf einer Innenseite entdeckte sie schließlich das Kästchen mit der Kleinanzeige: JournalistIn. Festanstellung in Kapstadt. Berufserfahrung wünschenswert. Überdurchschnittliche Fähigkeiten im Recherchieren und Verfassen von Texten erforderlich. Freude an Teamarbeit wird vorausgesetzt. Abgeschlossenes Studium erforderlich. Branchenübliches Gehalt. Bewerbungen bis 31.08.2009. Telefonische Auskünfte: Mrs. Nkosi.
Es war das »wünschenswert«, was ihr ein wenig Mut einflößte, so dass sie sich aufrichtete, die Zeitung so faltete, dass die Anzeige deutlich sichtbar war und nach ihrer Tasse Rooibostee griff.
5
(11. August 2009. Dienstag.)
Um 12:55 Uhr schob der Bergie mit der linken Hand einen Einkaufswagen die Coronationstraat hinunter, vorbei an der Reihe parkender Autos vor der Moschee. Er torkelte. In der rechten Hand hielt er eine in braunes Packpapier gewickelte Flasche.
Die Straße lag verlassen da. Die Besitzer der Autos saßen beim Dhuhr-Gebet in der Moschee.
Neben einem weißen Hyundai Elantra, Baujahr 1998, stolperte der Stadtstreicher und stürzte. Er hielt die Flasche hoch, um sie zu schützen. Einen Augenblick lang blieb er benommen liegen. Er versuchte aufzustehen, schaffte es aber nicht. Er rutschte mit dem Kopf unter das Auto, neben dem Hinterrad, als suche er Schatten. Dann zog er auch die Flasche unter den Wagen, um einen Schluck zu nehmen, aber seine Hände waren nicht mehr sichtbar. Einen Augenblick blieb er so liegen und hantierte herum, ehe er langsam wieder hervorrutschte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!