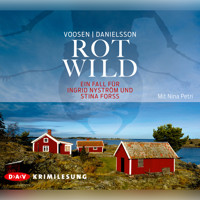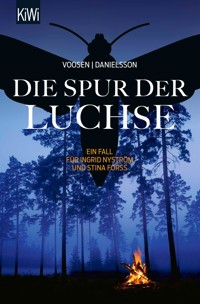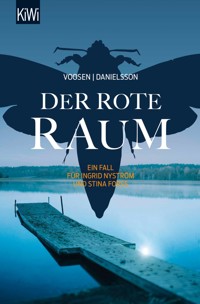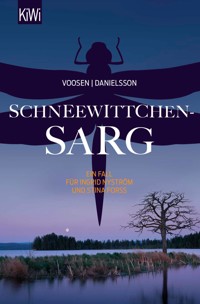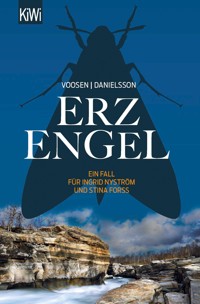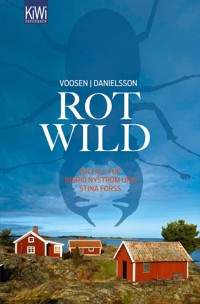
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kommissarinnen Nyström und Forss ermitteln
- Sprache: Deutsch
Der zweite Fall für Nyström und Forss – ein hochpolitischer, psychologisch komplexer Krimi, der den Leser bis zur letzten Seite fesselt Kurz vor Mittsommer im småländischen Växjö: In einem Wald am Seeufer wird der von Pfeilen durchbohrte Leichnam eines Lehrers gefunden. Die Todesumstände erinnern an die Darstellungen frühchristlicher Märtyrer. Kommissarin Ingrid Nyström und ihre junge, impulsive Kollegin Stina Forss übernehmen die Untersuchungen. Bald darauf tauchen an der Wand der Domkirche seltsame Zeichen auf. Haben die Polizistinnen es mit einem religiösen Ritualmord zu tun? Die Deutsch-Schwedin Stina Forss hat bald erste Zweifel. Spätestens nachdem ein weiterer Toter entdeckt wird, erhöht sich der Druck von Vorgesetzten, Presse und Öffentlichkeit auf die beiden ungleichen Frauen spürbar. Während Ingrid Nyström mit familiären Problemen zu kämpfen hat, führt die wendungsreiche Ermittlung Forss nach Nordschweden, nach Berlin und weit zurück in die Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Roman Voosen / Kerstin Signe Danielsson
Rotwild
Der zweite Fall für Ingrid Nyström und Stina Foss
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Roman Voosen / Kerstin Signe Danielsson
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Roman Voosen / Kerstin Signe Danielsson
Roman Voosen, Jahrgang 1973, aufgewachsen in Papenburg, studierte und arbeitete in Bremen, Hamburg und Växjö.
Kerstin Signe Danielsson, Jahrgang 1983, geboren und aufgewachsen in Växjö, studierte und arbeitete in Deutschland und Schweden.
Sie leben und arbeiten gemeinsam im småländischen Växjö. Ihre Romane stehen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und werden auch in Schweden von der Presse gefeiert.
www.voosen-danielsson.de
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Kurz vor Mittsommer im småländischen Växjö: In einem Wald am Seeufer wird der von Pfeilen durchbohrte Leichnam eines Lehrers gefunden. Die Todesumstände erinnern an die Darstellungen frühchristlicher Märtyrer. Kommissarin Ingrid Nyström und ihre junge, impulsive Kollegin Stina Forss übernehmen die Untersuchungen. Bald darauf tauchen an der Wand der Domkirche seltsame Zeichen auf. Haben es die Polizistinnen mit einem religiösen Ritualmord zu tun? Die Deutsch-Schwedin Stina Forss hat bald erste Zweifel. Spätestens nachdem ein weiterer Toter entdeckt wird, erhöht sich der Druck von Vorgesetzten, Presse und Öffentlichkeit auf die beiden ungleichen Frauen spürbar. Während Ingrid Nyström mit familiären Problemen zu kämpfen hat, führt die wendungsreiche Ermittlung Forss nach Nordschweden, nach Berlin und weit zurück in die Geschichte.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2013, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © plainpicture/Johner
ISBN978-3-462-30739-9
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Prolog
Schweden, heute
Ein Tag zuvor, Samstag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Sonntag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Montag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Dienstag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Mittwoch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Donnerstag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Freitag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Samstag
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Mai 1970, Berlin (West)
Literatur
Für Bent und Snah
»Etwas starrt mich an und harrt im Dumpfen, lang nicht tot.«
Markus Hettinger
»Tonight a comedian died in New York.
Somebody knows why.
Somebody knows.«
Rorschach, Watchmen
Wie ruhig es ist, dachte sie, wie unerwartet ruhig es hier drinnen doch ist. Als hätte der hohe, kühle Raum, in dem sie eingeschlossen war, den Atem angehalten. Weder die Geräusche der Autos auf der nahen Straße waren zu hören noch das Gezanke der anderen auf dem umzäunten Innenhof. Dabei war das Fenster geöffnet und die Frühjahrssonne blinzelte durch den Spalt, den die blinde Scheibe gelassen hatte. Sie lauschte der Stille. Dem Echo des Flüsterns und Seufzens der Heiminsassen, die vor ihr im Arrestzimmer gesessen hatten. Ihrem längst vergangenen Flehen, ihrer Wut, ihrer Verzweiflung. Sie lauschte den in den bröckeligen Putz geritzten Wünschen und Flüchen. Auch sie selbst hatte geritzt, in den langen Stunden, die vergangen waren, seit man sie am Morgen eingesperrt hatte; zuerst ihre Haut, wie sie es immer tat, wenn sie sich spüren wollte, dann mit einem Löffelstiel die Wand.
Es gab da ein Wort, das sie nicht mehr losließ. Ein Mantra, das ihr seit Wochen durch den Kopf ging. Es war ein fremdes, ein kraftvolles Wort und sie war beinahe damit fertig geworden, es in großen Buchstaben in den Putz zu schneiden, auf dass es die Schar ihrer Nachfolger lesen mochte: als Mahnung und Aufschrei zum Protest. Nur eine kurze Pause, dachte sie, die brennenden Finger entspannen und das schmerzende Handgelenk. Und wie sie da saß, eingesperrt und einsam, kamen die Gedanken wieder, die sie immer häufiger heimsuchten, seit sie mit der Journalistin gesprochen hatte, die für einen Bericht über die Situation in Jugendheimen recherchiert hatte. Gedanken über sich und ihr Leben. Über die strengen Regeln und die unnötigen Bestrafungen. Über die Ungerechtigkeiten, die hier tagtäglich geschahen. Es war, als hätte diese Journalistin mit den warmen Augen und der sanften Stimme sie verstanden, unglaublich, als hätte eine Erwachsene sie tatsächlich verstanden! Und nicht nur das. Sie hatten gemeinsam über andere Dinge diskutiert. Über große Dinge, große Zusammenhänge. Über das System. Selten hatte sie sich so ernst genommen gefühlt. Die Journalistin hatte ihr sogar ihre Privatadresse gegeben. Wenn mal was ist, hatte sie gesagt. Wenn du draußen bist und mal was ist.
Sie war nicht draußen. Sie saß hier drin fest. Weil sie auf dem Klo eine Zigarette geraucht hatte und von der Aufseherin erwischt worden war. Sie saß hier drin und lauschte in die Stille hinein. Und wenn sie die Augen zukniff, nur ganz leicht, nur ein kleines bisschen, dann sah das Rechteck, das die Sonne an die gegenüberliegende Wand warf, beinahe aus wie eine Tür.
Als die diensthabende Erzieherin am Abend das Arrestzimmer aufschloss, erschrak sie. Der Raum war leer. Das Mädchen war verschwunden. Zurückgelassen hatte es eine halsbrecherische Pyramide aus Tisch, Bank und Nachttopf und eine Art Lasso aus einem Pullover, das am Fensterkreuz baumelte. An der Wand stand ein neues Wort.
BAMBU
Die Erzieherin begriff nicht ansatzweise, was es bedeutete.
Schweden, heute
Janus Dahlin brauchte die ausgedehnten Spaziergänge in diesen frühen Stunden, besonders im Juni, wenn die Nächte kaum mehr waren als ein flüchtiges Dämmern, denn dann stiftete die Schönheit der klaren Morgen seiner chronischen Schlaflosigkeit einen Sinn. Es war kurz nach fünf und die Sonne stand bereits eine Handbreit über dem dunklen Saum aus Nadelbäumen auf der gegenüberliegenden Seite des Helgasees, über Ekesås und Rottnevägen. Der Dunst, der wie eine zweite Haut über der Wasseroberfläche lag, glühte rosa und orange. Dahlins Schritte verlangsamten sich, dann blieb er stehen. Er nahm seine Brille ab, schloss die Augen und fühlte die Sonnenstrahlen auf seinem Gesicht. Er atmete die Frühsommersonne und die Frische des Morgens ein.
Als er die Brille am Ärmel seines Fleecepullis geputzt und wieder aufgesetzt hatte, sah er, dass sein Hund auf ihn zugestürmt kam, im Maul einen Ast. Das Fell des Retrievers war nass, im Schein der tief stehenden Sonne wirkte es wie aus Gold. Um diese Uhrzeit konnte er das Tier ohne Leine laufen lassen, selbst in Evedalsvägen, die großen Audis, Volvos und BMW standen noch mit kalten Motorhauben in den Doppelgaragen und Carports auf den großzügig geschnittenen Seegrundstücken. Strax ließ sich mit wedelndem Schweif vor ihm nieder und sah zu ihm auf. Dahlin wusste, was von ihm erwartet wurde. Er nahm dem Hund den speichelnassen, morschen Strunk aus dem Maul und warf den Ast so weit er konnte die Straße hinauf. Strax schoss los. Das Holz zerbrach beim Aufprall auf dem Asphalt in drei Teile.
Mann und Hund folgten der sich windenden Straße am Hügel von Lilla Smäcken vorbei bis zum Ende der Landzunge, die Evedal dem Helgasee entgegenstreckte. Statt links in Richtung der Burgruine abzubiegen, wandte sich das Paar nach rechts, über die kleine Brücke in das unbebaute Naherholungsgebiet auf die Insel Hissö, verließ dort bald die geteerte Straße, schlug sich zwischen die Bäume und gelangte schließlich auf den schmalen Trampelpfad, der Hissö am Ufer entlang umrundete. Hier im Wald verwandelte sich Strax’ verspielte Aufgeregtheit in Euphorie. Der Hund sprengte vor und zurück, verschwand minutenlang im Unterholz, brach durch Schilf und Gesträuch, platzte ins Seewasser und scheuchte Tauben und Singvögel auf. Der morgendliche Wald roch, wie er es im Sommer immer tat: nach Kiefernrinde und Tannennadeln. Die derben Wanderstiefel trugen Dahlin sicher über den holprigen Weg, er war ein geübter Schnellgeher, außerdem kannte er hier jede Wurzel, jeden Stein, er hätte den Weg blind gehen können.
Nach einer guten halben Stunde hatten sie die Spitze von Hissö erreicht. Jetzt schwitzte Dahlin leicht. Es war angenehm, sein trainierter Körper brauchte die Bewegung. Der Pfad führte an einer Picknick- und Feuerstelle vorbei, die auch von der asphaltierten Straße aus gut zu erreichen war, was man leider nur allzu oft sah: Auch gestern war hier offensichtlich eine Art Party veranstaltet und der Müll liegen gelassen worden. McDonald’s-Verpackungen, wahrscheinlich vom Drive-in in Norremark, leere Bierdosen und ein benutztes Kondom. Fastfood und Fastfuck, dachte Dahlin, Teenagerfreuden, das war ja alles schön und gut, aber drei Meter weiter stand ein Mülleimer, da war es nicht zu viel verlangt, den Mist danach auch wegzuräumen, Hormonrausch hin oder her. Er schluckte das aufkommende Gefühl von Ärger hinunter, gab sich einen Ruck, hob den Müll auf und warf ihn in die Tonne. Der Morgen war zu perfekt, um sich aufzuregen. Um das Kondom nicht anfassen zu müssen, nahm er einen von den Plastikbeuteln aus seiner Tasche, die eigentlich für Strax’ Hinterlassenschaften bestimmt waren. Der Hund, der bereits vor ihm den Müll inspiziert hatte, sah ihm neugierig zu, auf seiner feuchten Nase klebte etwas, das nach Big-Mac-Sauce aussah.
Nachdem die Ordnung im Wald wiederhergestellt war, setzten Mann und Hund ihren Weg fort. Der Pfad mündete bald auf der Straße, die Hissö durchmaß. Sie folgten dem Verkehrsweg für einige Minuten, bis sie zu einem Schild gelangten, das ins Unterholz wies. Musön stand darauf, die Mäuseinsel. Ein Pfad, schmaler und verwachsener als der erste, führte einige Hundert Meter durch Büsche und Blaubeersträucher zur Uferkante. Zwischen Kiefern und Tannen sah Dahlin auf den Helgasee hinaus. Die Sonne stand jetzt schon ein ganzes Stück höher. Eine einzelne Wolke war am Himmel zu sehen. Ein Fisch sprang, es platschte kurz. Dann war die Wasseroberfläche wieder vollkommen schwarz und eben. Der Dunst hatte sich verzogen. Gut fünfzehn Meter vor ihm lag Musön im Wasser, eine von Hissös kleineren Schwesterinseln. Mit einer Treidelbrücke konnte man Musön auch ohne Boot erreichen. Wie an jedem Morgen lag der Schwimmponton an der Hissö-Seite. Niemand ging diesen Weg so früh am Tag wie Dahlin und war vor ihm auf Musön, auch heute nicht. Er stieg auf die wackelige Konstruktion und Strax folgte ihm mit einem Satz, der Hund kannte die Prozedur. Die Treidelbrücke war eine Art Floß, das im Wasser mit einer Führung an einem Stahlseil befestigt war, das ein Abtreiben verhinderte und den Kurs vorgab. Ein zweites Seil, in Hüfthöhe gespannt, diente dem Treidler als Antrieb. Indem man auf dem Floß stehend am Seil zog, gelangte man auf die andere Seite. Nach wenigen Griffen stieß die Treidelbrücke, eigentlich nicht mehr als eine Holzplattform auf einem Aluminiumrumpf, ans andere Ufer. Der Abrieb des Metalls hatte durch Hunderte von Anlegemanöver die Steine am Ufer unter Wasser silber gefärbt. Strax sprang an Land, Dahlin stieg hinterher. Für einen Mann um die fünfzig war er gut in Form. Zehn Minuten noch, dann würden sie die Spitze von Musön erreicht haben, das Ziel und den Wendepunkt ihres täglichen Spaziergangs. Von dort aus war die Sicht auf die Weite des Sees berauschend, gerade an klaren, sonnigen Morgen wie diesen. Mit fünf, sechs Sätzen war Strax im Unterholz verschwunden. Kurz hörte Dahlin noch das Hecheln des Hundes und das Knacken von trockenem Gehölz, dann war es still auf der Insel. Er folgte dem Trampelpfad Richtung Westen. Die Bäume und Büsche standen hier dichter als auf Hissö, selbst an schönen Tagen fand wenig Licht den Weg durch das Geäst. Die Mulde, in der seit vielen Jahren eine umgekippte Tanne lag, roch brackig; zwischen dem hellgrünen Sumpfgras schmatzte Wasser unter seinen Schuhen. Er nahm die lang gestreckte Anhöhe Richtung Norden, nach weiteren fünfhundert Metern auf knotigem Wurzelboden und Heidekraut hatte er die Inselspitze erreicht.
Tatsächlich war der Ausblick atemberaubend. Zwei Reiher landeten im gleißenden Gegenlicht, in der Ferne tuckerte ein Boot mit Außenborder. Ein starkes Gefühl von Verbundenheit durchfuhr ihn. Er war Teil von etwas. Von diesem hier. Von Schönheit. Er schloss die Augen und öffnete sie wieder. Ein machtvoller Impuls: hier und jetzt sterben. In Einheit. In Frieden. Ein beruhigender Gedanke. Wahr und klar.
Und doch grundfalsch. Menschen sind nicht so. Sie wollen leben, immer weiter. Er schüttelte die Sentimentalität so schnell ab, wie sie gekommen war. Es war Zeit zu gehen. Er war hungrig, außerdem musste er pinkeln. Wo blieb Strax? Der Hund war immer noch nicht wieder aufgetaucht. Diese verdammten Mäuse! Er pfiff laut auf den Fingern. Der Pfiff hallte zwischen den Bäumen und weit über den See. Er wartete. Eine Minute, zwei. Dann drehte er sich um und folgte dem Rundpfad zurück in Richtung der Treidelbrücke. Zwischendurch ließ er erneut seine Pfiffe durch den Wald gellen und rief nach dem Hund. An einer Birke blieb er stehen und entleerte seine Blase. Immer noch kein Strax in Sicht. Er ging weiter. Sorgen machte er sich keine. Wo sollte der Hund schon hin sein? So groß war die Insel ja nicht. Wahrscheinlich hockte er vor einem Mäuseloch oder jagte einem Eichhörnchen hinterher. Oder er folgte der Fährte seines Herrchens. Gleich kommt er den Pfad hinuntergerast und bringt mir stolz einen neuen Ast, dachte Dahlin. Der Weg machte eine letzte Kehre, dann hatte er wieder den Anleger erreicht. Auch hier war der Hund nicht. Er pfiff erneut, doch im Unterholz rührte sich noch immer nichts. Sein Blick suchte die Uferkante ab. War der Hund vielleicht im Wasser? Aber müsste er ihn dann nicht planschen hören? Dann entdeckte er es. Das Floß, die Treidelbrücke, sie war weg. Aber …
Nein, genau genommen war sie nicht weg, sondern trieb etwa dreißig Meter vom Anleger entfernt in der schwachen Strömung auf den See hinaus. Wie konnte denn …?
Jetzt war er so nah am Anleger, dass er es sah. Am Anleger waren die beiden Stahlseile durchtrennt worden. Stahlseile. Nordschwedische Qualitätsarbeit, zwei Zentimeter Durchmesser.
Was um alles in der Welt …?
Plötzlich hinter ihm ein Jaulen. Da war Strax! Er hatte einen Zweig im Maul. Aber warum lief er denn so seltsam? Warum hinkte das arme Tier? Dann erkannte er: Das war kein Zweig. Es war ein Pfeil. Und der war nicht in Strax’ Maul, sondern steckte in seiner Schnauze, nein, er ging durch die Hundeschnauze hindurch. Und ein zweiter steckte in seiner Flanke. Was …?
Die Wucht des Aufpralls riss seinen Arm, seine Schulter nach hinten. Der Schmerz presste ihm die Luft aus der Lunge. Als er hinsah, verstand er, dass der dünne Aluminiumpfeil seinen Oberarm durchbohrt hatte.
Den nächsten Pfeil hörte er, bevor er ihn sah. Konnte das sein? Brach das nicht mit allen Regeln der Physik? Er starrte auf den silbernen Stachel in seinem Oberschenkel. Merkwürdigerweise schärfte der Schmerz seine Wahrnehmung. Er schmeckte die Kiefern. Die Tannennadeln. Er dachte an die Geschwindigkeit des Schalls. An Licht und Wellen. Der dritte Pfeil durchschlug seine Bauchdecke. Strax brach zitternd vor ihm zusammen, ein graubraunes Bündel, alles Gold war dahin. Das helle Fleece seines Pullovers färbte sich schwarz. Er verstand überhaupt nichts mehr.
Dabei war das erst der Anfang.
Ein Tag zuvor, Samstag
1
Die weiß getünchte Waldkirche von Ormesberga strahlte in der Nachmittagssonne von ihrem Hügel auf die Prozession der feierlich gekleideten Gäste herunter. Der Klang der Glocken hallte weit über den Fichtenwald und die Hochzeitsgesellschaft zog in die kleine Kirche ein. Der Raum füllte sich. Es wurde eng in den Reihen wie sonst nur zu Weihnachten und die knarrenden, alten Holzbänke hatten Mühe, die Schar der Besucher zu fassen. Der Küster, normalerweise ein ruhiger, besonnener Mann, fuchtelte mit den Armen in der Luft herum und dirigierte die Gruppen und Besucher in die Reihen. Endlich schienen alle einen Platz gefunden zu haben. Nur das Brautpaar fehlte noch – und Kommissarin Ingrid Nyström. Gerade als sie zu Hause aus der Tür gegangen war, hatte sie auf dem Aufschlag ihres Jacketts einen Make-up-Fleck entdeckt, groß wie ein Daumenabdruck. Nun war der Fleck zwar beseitigt, dafür verströmte ihre Jacke den beißenden Geruch von Waschbenzin. Als sie verstohlen durch die Kirchentür schlüpfte, begann gerade die Orgel zu spielen, Mendelssohns Hochzeitsmarsch. In Erwartung des Brautpaares drehten sich die Leute zu ihr um. Mit verkniffener Miene huschte sie auf den Platz, der in der zweiten Reihe für sie reserviert war. Der Pastor warf ihr einen kurzen, genervten Blick zu. Zum Glück kannte sie ihn gut, es war ihr Mann, Anders, und was das Genervtsein anging, stand es jetzt unentschieden, denn sie hatte sich am Morgen bereits über eine Spur aus Schmutzwäsche geärgert, die Anders von ihrem gemeinsamen Schlafzimmer unter dem Dach bis hinunter in den Waschkeller hinterlassen hatte. Man würde reden müssen, so viel war klar, aber wohl nicht jetzt. Leicht verschwitzt sortierte sie sich und ihre Notenblätter, dann war es so weit. Alle erhoben sich, das Brautpaar betrat die Kirche und schritt feierlich im Takt des Hochzeitsmarsches zum Altar. Anders lächelte nun; gütig, was das anging, war er Profi. Auch Braut und Bräutigam lächelten. Sie trug einen Traum aus Seide und Spitze, die Haare zu einer Art kunstvollem Bienenkorb aufgetürmt und mit weißen Blüten verflochten; er einen farblich abgestimmten Frack mit Zylinder. Die Braut war Ingrid Nyströms Nichte Rosa-Marie, Jungunternehmerin in Maniküre und Bio-Kosmetik. Der Bräutigam war Björn-Erik, Verwaltungsangestellter der Kommune Växjö, Fachgebiet Liegenschaften.
Als Onkel fand Pastor Anders persönliche und originelle Worte, flachste ein wenig und gratulierte Björn-Erik zu seinem guten Fang. In der Predigt griff er das Thema Partnerschaft und Respekt auf. Ingrid Nyström musste dabei an seine schmutzigen Socken auf der Treppe denken. Nach dem Ringtausch und dem Kuss, der für ihren Geschmack ein wenig zu lang und innig ausfiel, sangen alle gemeinsam Nun kommt die Zeit der Blumen. Nach den Fürbitten war ihr Auftritt vorgesehen. Als sie nach vorne trat, wurde es still. Ingrid Nyström war dafür bekannt, eine der berührendsten Altstimmen Smålands zu haben. Sie sang, ihr Neffe Carl, Rosa-Maries Bruder, begleitete sie dazu auf der Violine. Es war einer dieser ganz besonderen Momente. Die Sonne warf Lichtquader durch die hohen, klaren Fenster in den alten Raum. Das Licht zersplitterte und spannte Netze über Kleid und Schleier der Braut. Der Mutter des Bräutigams liefen die Tränen über die gepuderten Wangen. Als der letzte Ton verklungen war, schniefte jemand vernehmlich in den hinteren Reihen. Sogar sie selbst spürte Rührung, vielleicht lag das aber auch ein wenig an den Dämpfen des Waschbenzins.
Nach dem Gottesdienst wurde vor der Kirche Reis geworfen und es gab ein großes Umarmen und Händeschütteln. Dann brauste das Brautpaar unter Applaus und anfeuernden Rufen in einem blumengeschmückten Sechzigerjahre-Sportwagen mit offenem Verdeck davon; nach Umziehen und Frischmachen würden sie im Laufe des Nachmittags wieder zu den Feiernden stoßen. Natürlich hatte irgendein Scherzkeks eine Schnur mit leeren Dosen hinten am Auto befestigt, die nun klappernd über den Schotterweg sprangen. Ingrid Nyström gratulierte den Eltern des Brautpaares, im Gegenzug dankte man ihr für den bewegenden Gesangsvortrag. Sie fühlte sich in ihren Pumps nicht wohl, schon in flachen Schuhen fand sie sich zu groß, außerdem versanken die Absätze im groben Kies des Kirchenvorplatzes und die Steine zerkratzten den Lack. Ingrid Nyström unterhielt sich kurz mit ihren Nachbarinnen Kajsa und Ingegerd, nickte ihren Töchtern Sophie und Marie zu, winkte den Enkeln Marcus, Noah, Thea, Jonna und Hampus. Später, auf der Feier, würden sie Zeit füreinander haben. Sie stöckelte zu ihrem Toyota. Im Auto zog sie sich die Pumps aus und begutachtete den Schaden, den der Schotter angerichtet hatte. Dann schlüpfte sie in braune Halbschuhe. Der Plan sah vor, dass die Hochzeitsgesellschaft auf einen Bauernhof in der Nähe von Åby fahren würde. Dort, auf dem Grundstück der Eltern des Bräutigams, fand das eigentliche Hochzeitsfest statt. Nyström steckte die zerkratzten Pumps in ihre Handtasche, für später. Ihr Mann war jetzt auch so weit. Er hatte sich bereits in der Kirche umgezogen, der braune Anzug stand ihm nach all den Jahren immer noch gut, fand sie, auch wenn er um den Bauch herum zugelegt hatte. Vögel zwitscherten. Ein Kuckuck rief. Was für ein Tag zum Heiraten! Langsam setzte sich die Hochzeitsgesellschaft in Bewegung.
Angesichts des sonnigen, windstillen Wetters waren die Tische im Garten des Seegrundstücks aufgebaut. Der Ausblick auf den Helgasee war etwas Besonderes: Silber und blau, majestätisch funkelte das weitläufige Gewässer in der Junisonne. Ingrid Nyström konnte sich nicht entsinnen, wann sie das letzte Mal in einem solch prächtigen Naturambiente gefeiert hatte: Die langen Tafeln waren weiß eingedeckt, Kellnerinnen mit weißen Schürzen hantierten mit Kaffee, Torten und Dessertwein. Es gab kaligrafisch ausgefeilte Platzkärtchen aus Büttenpapier, Blumengestecke und eine elegante Tischdekoration. Eine Band aus Värnamo in lachsfarbenen Anzügen spielte Klassiker. Die ersten tanzten, junge Leute mit Sonnenbrillen, wahrscheinlich Freunde des Brautpaares aus der Stadt. Es gab zwei Zeremonienmeister, die zwischen den vielen Musikstücken, Reden und Spielen moderierten; der eine war ein Jugendfreund des Bräutigams, ein dicklicher Nordschwede, den die eigens gedruckte Festbroschüre als Sitznummer 12, Arvid Appelgreen auswies; der andere war Ingrid Nyströms jüngste Tochter Anna. Obwohl ihr die pink gefärbten Haare missfielen, musste sie zugeben, dass ihre neunzehnjährige Tochter den Job als Moderatorin ausgezeichnet erledigte. Da, wo der leicht tumbe Appelgreen die Pointen zu vergeigen drohte oder ins Stocken geriet, sprang Anna mit ihrem småländischen Wortwitz und Charme in die Bresche. Ingrid Nyström konnte nicht umhin, einen gewissen Mutterstolz zu empfinden. Dann fiel ihr Blick zum wiederholten Mal auf Tischposition 81. Die 81 war eine gut aussehende, junge Frau in einem geschmackvollen, geblümten Kleid. Die Festbroschüre wies Nr. 81 als Madeleine Tedenlid aus, Friseurschülerin aus Växjö, Lebensgefährtin von Nr. 24. Genau darin lag eins von Ingrid Nyströms Problemen. Nr. 24 war ihre Tochter Anna.
2
Das zweite Problem, das Ingrid Nyström seit zwei Wochen mit sich herumtrug, war weitaus ernst zu nehmender. Im Gegensatz zum kürzlich erfolgten Outing ihrer Tochter war dieses Problem keines, von dem sie hoffen konnte, dass sie sich damit im Laufe der Zeit schon würde arrangieren können. Im Gegenteil. Es war eine gewisse Eile erforderlich und sie hatte die Dinge schon viel zu lange aufgeschoben. Nur konnte sie unmöglich damit beginnen, die entsprechenden Schritte einzuleiten, ohne vorher mit Anders darüber zu sprechen. Und darin lag Problem Nummer drei. Sie wusste nicht, wie. Sie fand keine Worte dafür. Sie fand keine Worte, weil sie es selbst nicht begriff. Es gab da etwas, das mit dem Verstand nicht zu greifen war. Etwas Metaphysisches, das Anders so nicht hinnehmen würde, etwas, das er sich weigern würde zu glauben, weil es mit seinem Weltbild, nein, mit seinem Glaubensbild kollidierte. Er würde es falsch finden, und das zu Recht. Das konnte sie nicht von ihm verlangen.
Und trotzdem war es wahr.
3
Dämmerung lag über dem See. Es war jetzt weit nach Mitternacht. Das Wasser schien zu leuchten. Ein dunkles Schimmern. Ingrid Nyström saß auf dem Steg, abseits der Feier, neben ihr die Pumps und ein letztes Glas Wein. Die Band spielte jetzt nur noch alte Hits, Queen und ABBA natürlich, niemand war mehr nüchtern, die Kinder waren längst im Bett, junge Leute jubelten in der Nacht. Dann war Anders neben ihr, er legte ihr das Jackett über die Schulter, eine zärtliche Geste, dachte sie, und weil sie noch immer einen Hauch von Waschbenzin roch, musste sie lächeln. Auf Anders Glatze spiegelte sich der Schein des hellen Nachthimmels, er schwitzte, vom Tanzen und vom Alkohol, sie mochte diesen Geruch. In ihrem Herzen regten sich Wärme und Vertrauen, die über mehr als drei Jahrzehnte gewachsen waren.
»Da ist doch etwas, das du mir sagen willst.«
Seine Stimme war einladend und beinahe hätte sie ihr nachgegeben.
»Vielleicht später«, sagte sie leise und legte ihren Kopf an seine Brust.
Sonntag
1
Ingrid Nyström fuhr ihren kleinen Toyota durch Sandsbro, von der Landstraße 23 auf die 897, nördlich in Richtung Rottne und Söraby. Nach einigen Kilometern zweigte links der Gamla Rottnevägen ab, sie folgte der schmalen Straße, die einen Tunnel in die hoch aufragenden Fichten schnitt, bis sie auf eine ebenso schmale Querstraße traf, die sie zu einem alten Gutshaus am Ostufer des Helgasees führte, Humlehöjden. Hier öffnete sich der dichte Wald und gab den Blick auf den großen See frei, der still in der Morgensonne lag. Auf dem geschotterten Parkplatz vor dem ehemaligen Herrenhaus, das seit zwei Jahrzehnten als Pension und Tagungszentrum genutzt wurde, standen mehr als dreißig Fahrzeuge, darunter vier Streifenwagen, an einem lehnten uniformierte Kollegen, das Blaulicht auf dem Dach blinkte sinnlos vor sich hin. Sie erkannte den VW-Transporter der Spurensicherung und Lars Knutssons riesigen, amerikanischen Wagen mit Ladefläche. Sie stellte ihr Auto ab und stieg aus. Es war erst kurz nach neun, trotzdem brannte die Sonne schon auf der Haut. Bis in den April hinein hatte es Eis auf dem See gegeben, den Mai hindurch hatte es geregnet und jetzt war plötzlich Sommer. Vor der breiten Treppe, die auf die Veranda und zum Eingang des hellblau gestrichenen Holzgebäudes führte, stand ein Mitsubishi-Kombi mit eingedrückter Beifahrertür und fehlendem Außenspiegel, an der Hauswand daneben lehnte ein rotes Mountainbike. Anette Hultin und Hugo Delgado waren also ebenfalls bereits eingetroffen. Sie ging die Stufen hinauf, schob die Sonnenbrille in ihr Haar, nickte dem Streifenbeamten auf der Veranda zu und trat durch die Eingangstür ins Foyer.
Die unbesetzte Rezeption öffnete sich nach wenigen Schritten zu einem großen Speisesaal. In dem sonnendurchfluteten Raum saßen mehr als fünfzig Personen zu Tisch, unterhielten sich angeregt, standen in kleinen Gruppen beieinander oder wuselten mit beladenen Tellern durch die Reihen.
Das Merkwürdige daran war, dass, abgesehen von zwei älteren Kellnerinnen am Frühstücksbuffet, keiner der Anwesenden normal aussah. Was sie sah, waren Wikinger, Ritter und barfüßige Mönche in braunen Kutten. Elben und Elfen. Ein Burgfräulein mit einem gewagten Dekolleté. Ein Zwerg. Männer in Lederwämsen. Jemand trank Kaffee aus einem Horn, Käse wurde mit einem Kurzschwert zerteilt. Sie war auf einem Kostümfest gelandet. Dann sah sie das Banner an der Wand:
Elftes Jahrestreffen für historisches Bogenschießen stand dort in runenartigen Buchstaben auf dunklem Tuch. Jetzt sah sie auch die Sportbögen, die überall herumlagen. Köcher voller Pfeile. Eine Armbrust neben einer Aufschnittplatte. Und irgendwo hier gab es auch einen Toten.
Plötzlich stand Delgado neben ihr und fasste sie am Arm. Er sah angespannt aus.
»Es ist draußen, ein Stück in den Wald hinein.«
Delgado führte sie durch eine Großküche ins Freie. Der Rasen hinter dem Herrenhaus war noch feucht vom Morgentau und fiel zur Uferkante hin leicht ab. Das Wasser schillerte. Ein leichter Wind kam vom Westufer her, perlte im Blattwerk der Obstbäume. In der Ferne zog das historische Dampfschiff Thor in Richtung der nördlichen Schleuse vorbei. Noch mal historisch. Es gibt seit Jahren diesen Nostalgietrend in Schweden, dachte sie flüchtig, vielleicht ja auch woanders. Ist das Jetzt denn so abscheulich, dass wir uns in eine andere Zeit zurückwünschen?
Ein Stück in den Wald hinein hatte Delgado gesagt. Sie folgten einem Pfad, der in die dicht stehenden Fichten führte. Hier roch es nach warmem Waldboden. Delgado schwieg noch immer. Das musste nichts heißen, vielleicht aber doch. Trotzdem fragte sie nicht nach, sie wollte zuerst sehen. Die unverrückbaren Fakten, keine Interpretationen. Beinahe musste sie lächeln. Unverrückbare Fakten. Als gäbe es so etwas überhaupt.
Sie waren dem verwachsenen Pfad ein Stück durch die Nadelbäume gefolgt, nicht weit, fünfzig oder siebzig Meter vielleicht. Die hohen Äste der Bäume bildeten ein dichtes Dach. Der Boden war feucht, in einigen Monaten würden hier haufenweise Pfifferlinge wachsen und große Karl-Johan-Pilze. Schließlich öffneten sich die Fichten zu einer ovalen Lichtung. Dort sah sie ihn.
Der Leichnam des Mannes war aufrecht an einen Baumstamm gelehnt. Die hellgraue Haut des nackten Körpers hob sich vom dunklen, feuchten Holz eines abgestorbenen Baumstamms ab. Sie ging näher heran und sah die Pfeile, die in dem Leichnam steckten dünne, armlange Metallpfeile, ein Dutzend, vielleicht auch mehr. Vier davon ragten aus dem Kopf des Toten, aus dem linken Auge, aus dem Mund, aus der rechten Wange. Ein Pfeil hatte das rechte Ohr durchdrungen, er hing dort wie bizarrer Modeschmuck.
Andere Pfeile steckten in seiner Schulter, in Oberarmen und Händen. Einer hatte sein linkes Knie durchschlagen. Sie stellte sich vor ihn und erkannte Wundmale, Prellungen und Blutergüsse auf dem Körper. Deformierte Linien, seltsam verdrehte Muskeln. Zertrümmerte Knochen. Opfer von schweren Verkehrsunfällen sahen so aus, verunglückte Motorradfahrer. Sie sah die dünnen Nylonschnüre, mit denen der Leichnam an den Baumstumpf gebunden war. Sie nahm den scharfen Geruch menschlicher Exkremente wahr. Obwohl der Mann nicht mehr lebt, dringen seine Moleküle in uns ein, dachte sie. Er reicht etwas an uns weiter. Vielleicht ist es ein Auftrag. Oder es ist nur der Geruch eines grausam zugerichteten Mordopfers. Sie schloss die Augen und öffnete sie wieder. In ihren Ohren dröhnte es. Das Pochen ihres eigenen Bluts. Mein Körper reagiert, dachte sie. Er reagiert, weil mein Verstand das hier kaum fassen kann. Sie zwang sich ruhig zu atmen, bis das Hämmern in ihren Ohren verschwand. Erst jetzt sah sie die anderen Menschen, die um sie herum standen. Lars Knutsson, den alle Lasse nannten, Anette Hultin, Hugo Delgado. Bo Örkenrud, der Chef der Spurensicherung. Ihre Freundin, die Pathologin Ann-Vivika Kimsel. Andere Männer und Frauen in violetten Overalls. Sie schluckte, räusperte sich. Trotzdem war ihre Stimme belegt, als sie sprach.
»Wissen wir schon, wer das ist? Wer das war?«
Unverrückbare Fakten.
Das rechte Auge des Toten, das, in dem kein Pfeil steckte, schien sie anzustarren. Zwischen den Bäumen glitzerte der See. Neben ihr keuchte Knutsson. Sein Übergewicht machte ihn kurzatmig.
»Nein. Wir haben noch wenig bis gar nichts. Der Anruf kam vor einer knappen Stunde, gegen acht. Ein Albtraum in jeder Hinsicht. Der Mann steckt voller Pfeile.«
»Und in Humlehöjden sitzen fünfzig Bogenschützen«, sagte Hultin.
»Fünfzig historische Bogenschützen«, hob Delgado hervor. Es war witzig gemeint, aber niemand reagierte darauf.
»Fünfzig Verdächtige. Ein absoluter Albtraum, in jeder Hinsicht«, wiederholte sich Knutsson. »Und das eine Woche vor Mittsommer.«
»Wer hat ihn gefunden?« Nyström hatte ihre Stimme wieder. Die Stimme, die gestern auf einer Vermählung gesungen hatte. Eine der schönsten Altstimmen Südschwedens. Jetzt hatte sie eine Ermittlung zu leiten. Sie wich dem starrenden Auge aus. Die Nylonschnüre schnitten sich tief in das graue, gelb und blau geschlagene Fleisch des Toten.
Hultin blätterte in ihrem Notizblock.
»Aaron Wicander. Der Chef des Ganzen hier. Der Parcoursleiter.«
»Was ist ein Parcoursleiter?«
2
»Der 3-D-Parcoursleiter ist für den Aufbau der Strecke verantwortlich. Er bestimmt die Distanzen, sucht die Wege durch den Wald, stellt die Tiere auf.«
»Die Tiere?«
»Ja, die lebensgroßen Tiermodelle. Deshalb heißt es ja auch 3-D-Parcours. Die sind aus Hartgummischaum. Wir haben hier Hirsche, Luchse, Ratten, Biber, Seeadler. Sogar einen Elch.«
»Und heute Morgen haben wir einen letzten Kontrollgang gemacht. Bevor alles losgeht. Und dann sind wir darauf gestoßen.«
»Kontrollgang?«
»Ja, vom Parcours.«
»Im Grunde funktioniert es ähnlich wie Golf. Man zählt die Schüsse, die man von der jeweiligen Abschussstelle bis zum Ziel braucht. Derjenige, der die wenigsten Gesamtschüsse hat, ist der Turniersieger.«
»Traditionelles Bogenschießen findet immer mehr Zulauf. Wir haben heute auch internationale Sportfreunde hier, aus Dänemark, Deutschland, sogar aus Italien!«
»So, so«, sagte Nyström. Sie musste sich Mühe geben, um die Irritation abzuschütteln, die von den Verkleidungen der drei Hobbysportler ausging, die vor ihr saßen. Aaron Wicander, der Vorsitzende des Vereins Traditionelles Bogenschießen Växjö, war ein rundlicher Mann um die fünfzig, der eine Lederweste und silbrig schimmernde Strumpfhosen trug. Eine ebenfalls silberne Langhaarperücke und spitz modellierte, falsche Ohren wiesen ihn als eine Figur aus einem Fantasy-Epos aus. Ein Legolas mit Bierbauch. Der weitere Vorstand des Vereins, der das jährliche historische Bogenschießen organisiert hatte, bestand aus Peter Quist, einem bärtigen Mittvierziger in der detailreichen Montur eines römischen Legionärs, und Mona Wedén, einem Burgfräulein mit opulentem Dekolleté, in der Nyström die Geschäftsführerin eines Seniorenpflegedienstes erkannte, mit der sie vor wenigen Monaten am Rande der Ermittlung im Fall eines ermordeten Schmetterlingzüchters zu tun gehabt hatte.
Dabei war die Situation überaus ernst. Unter anderen Umständen hätte sie die Zeugen darum gebeten, sich umzuziehen, aber jetzt zählte jede Minute. Sie saßen in einem Nebenraum des großen Speisesaals. Die Stimmen der Turnierteilnehmer drangen durch die Wand. Vereinzelt hörte man Auflachen.
»Hat einer von euch den Mann da draußen gekannt?«
Die drei schüttelten betreten den Kopf. Nyström hatte nicht den Eindruck, dass sie sich den Toten sehr genau angesehen hatten, aber wer wollte ihnen das verdenken?
»Ich nehme an, die anderen Bogenschützen wissen noch nicht Bescheid?«
»Gott bewahre! Das Letzte, was wir hier wollen, ist eine Massenpanik!«
Die schrille Stimme von Mona Wedén konterkarierte ihre Aussage. Ihr mächtiger Busen vibrierte vor Aufregung unter dem rosafarbenen Tüll.
»Wir haben sofort die Polizei gerufen«, ergänzte Wicander. »Natürlich hat jeder mitbekommen, dass hier etwas geschehen ist. Deshalb haben wir vorläufig nur bekannt gegeben, dass es einen Unfall gegeben hat.«
»Das habt ihr gut gemacht«, lobte Nyström.
Kurz lächelte der Elbenmann, dann sah er wieder betroffen aus.
»Wie soll es denn jetzt weitergehen?«, fragte er. »Schließlich soll in einer halben Stunde das Turnier losgehen.«
»Wo wir doch internationale Sportfreunde hier haben«, piepste Wedén.
Nyström seufzte.
»Ich fürchte, es sieht nicht gut aus für eure Veranstaltung. Zum einen ist da der Tatort, den wir natürlich weiträumig absperren müssen. Und zum anderen ist da das Opfer. Ihr habt es ja gesehen. Die Pfeile und alles. Und nebenan frühstücken fünfzig Bogenschützen. In unseren Augen sind das selbstverständlich erst einmal fünfzig potenziell Verdächtige, beziehungsweise Zeugen. Euch eingeschlossen. So leid es mir tut.«
Der Elb wurde noch blasser, dem Burgfräulein schoss dagegen das Blut in den Kopf.
»Aber …«, sagte es mit hochrotem Gesicht.
»… es kann gar keiner von uns Bogenschützen gewesen sein!«
Peter Quist, der Römer, hatte seinen geharnischten Oberkörper nach vorne geschoben. Imperialer Triumph schwang in seiner Stimme mit, die roten Borsten der Quaste auf seinem Helm wippten.
»Wie kannst du dir da sicher sein?«
Nyström und die beiden anderen sahen Quist an.
»Weil die Pfeile, die in dem Leichnam stecken, gar nicht von einem Bogen stammen. Diese Edelstahldinger ohne Befiederung und Nocke verschießt man mit einer Harpune.«
»Bitte?«
»Sieh doch, hier.«
Quist langte mit seinem rechten Arm über seine linke Schulter. Erst jetzt bemerkte Nyström, dass er einen Köcher auf dem Rücken trug. Er angelte einen der Pfeile hervor.
»Dies hier ist ein typischer Holzpfeil, wie er beim traditionellen oder historischen Bogenschießen verwendet wird. Früher waren solche Pfeile meistens aus Esche, heute verwendet man häufig Zeder oder auch Kiefern- oder Fichtenholz. Siehst du die Befiederung hier? Wir Traditionalisten verwenden eingefärbte Truthahnfedern. In Japan gibt es auch Großmeister, die echte Adlerfedern verwenden, aber dann kann ein einzelner Pfeil mehrere Tausend Kronen kosten. Und dies hier, der Schlitz am Ende des Schafts, den nennt man Nocke. Damit legt man den Pfeil auf die Sehne des Bogens. Ein Harpunenpfeil dagegen braucht weder Nocke noch Befiederung. Eine Harpune funktioniert meistens mit Druckluft. Die Pfeile, die in dem Mann da draußen stecken, sind Harpunenpfeile.«
»Ein Tauchmörder!«, rief Wedén. »Wie in diesem Film mit den Grachten, Verfluchtes Amsterdam!«
Nyström sah sie streng an. Die Frau sah aus, als wolle sie gleich vor Verzückung in die Hände klatschen. Aus dem Spalt zwischen ihren Brüsten war der Anhänger einer feingliedrigen Halskette gerutscht. Es war ein goldener Amor mit Pfeil und Bogen.
3
»Wo er recht hat, hat er recht«, murmelte Bo Örkenrud. Er schwitzte merklich in seinem Overall, der Kunststoff klebte auf seiner Haut und wurde an den Ellbogen bereits durchsichtig. Auch wenn die hohen Fichten vor der direkten Sonneneinstrahlung schützten, war es im Wald mittlerweile wärmer geworden. Zwischen den Bäumen funkelte das Wasser des Sees. Ein Motorboot knatterte vorbei.
»Es sind eindeutig Harpunenpfeile. Keine Federn, keine Nocke.«
»Heißt das, dass diese Pfeile unter Wasser abgeschossen worden sind?«
»Nein, nicht zwangsläufig. Eine Harpune funktioniert ebenso gut an Land. Auch wenn man mit solchen unbefiederten Pfeilen wohl nicht so genau zielen kann wie mit einem Sportbogen, jedenfalls nicht auf weite Distanz. Aber wer sagt schon, dass der Täter weit vom Opfer entfernt war? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man mit ein wenig Übung auch eine Harpune als tödliche Waffe benutzen kann. Trotzdem würde ich keinen dieser Bogenschützen als Täter ausschließen.«
»Nein, natürlich nicht. Aber es ist dennoch sehr merkwürdig. Auf einem Treffen von historischen Bogenschützen wird ein Mann mit Harpunenpfeilen getötet. Man bindet ihn nackt an einen Baum und dann schießt man auf ihn. Pfeil um Pfeil.«
»Es gibt einiges, das dagegen spricht, dass es so gelaufen ist. Auch wenn wir alle Hinweise erst sorgfältig auswerten müssen: Ich glaube nicht, dass er hier gestorben ist. Wir haben kaum Blut auf dem Boden gefunden, es gibt keinerlei Spuren, die auf einen Kampf hinweisen. Auf seinem Körper kleben Birkenblätter und Kiefernnadeln, dabei stehen hier überall nur Fichten. Ich denke, er ist hier hergebracht worden, nachdem er getötet worden ist.«
»Verdammt, Bo, was bedeutet das?«
Der große Mann zuckte mit den Schultern, wischte sich Schweiß vom Gesicht.
»Ich habe absolut keine Ahnung.«
Die Gerichtsmedizinerin Ann-Vivika Kimsel wandte sich ihnen zu. Ihr Gesicht war blutleer und in ihrer Stimme fand Nyström nichts von der kecken Fröhlichkeit wieder, die sie sonst an ihrer Freundin schätzte.
»Ich stimme mit Bo überein. Der Mann hat vor seinem Tod eine große Menge Blut verloren, aber davon ist hier nichts zu sehen. Dazu kommt, dass in seinem Körper mindestens ein Dutzend Knochen gebrochen worden sind. In der Haltung, in der er dort steht, können diese schweren Misshandlungen nicht begangen worden sein. Von daher gehe ich auch davon aus, dass das hier nicht der Tatort ist. Er ist hier abgeladen worden. Oder vielmehr zur Schau gestellt.«
»Wie lange ist er bereits tot?«
»Einige Stunden. Seit dem frühen Morgen. Später kann ich Genaueres sagen.«
»Gibt es immer noch nichts zur Identität des Mannes?«
Delgado schüttelte den Kopf.
»Nein, nicht mal im Ansatz. Wir haben nichts in der Nähe gefunden, was zu dem Leichnam zu gehören scheint. Keine Kleidung. Auch keine Schleifspuren. Dabei war er ein kräftiger, großer Mann.«
Nyström biss sich auf die Unterlippe.
»Wir müssen wissen, wer er ist. So bald wie möglich. Danach kommt alles andere.«
4
Es dauerte mehrere Stunden, bis die Untersuchungen am Tatort abgeschlossen waren. Unterdessen war die Stimmung bei den Turnierteilnehmern vollständig gekippt. Man hatte sie über das Geschehene und den Ausfall der Veranstaltung informiert. Von sämtlichen Anwesenden wurden die Personalien aufgenommen und mit den Daten der Anmeldelisten abgeglichen. Polizisten befragten die Teilnehmer in Zweier- oder Dreiergruppen. Gut ein Drittel der Sportschützen, überwiegend Gäste von außerhalb, war bereits am Vorabend in Humlehöjden eingetroffen und hatte im Gutshaus übernachtet. Niemand hatte in der Nacht oder am frühen Morgen etwas Ungewöhnliches bemerkt. Die meisten waren jedoch erst zum gemeinsamen Frühstück eingetrudelt. Bis auf eine Frau aus Karlskrona, die wegen einer akuten Thrombose hatte absagen müssen, fehlte keiner der angemeldeten Teilnehmer. Nyström spürte die Unruhe und Verwirrung der Menschen, nur wenige zeigten unverhohlene Neugier. Eine Elfenfrau begann zu weinen, ein Robin Hood lachte hysterisch. Auch wenn sich Nyström dagegen sträubte, sah sie keine andere Möglichkeit, als den Schützen ein Foto des getöteten Mannes zu zeigen. Ihrer Meinung nach konnte es kein Zufall sein, dass der grotesk zugerichtete Leichnam in unmittelbarer Nähe des Bogenturniers drapiert worden war. Daraus ergab sich für sie nur die eine Schlussfolgerung, dass der unbekannte Tote in einer Beziehung zu einem der Teilnehmer stehen musste; irgendjemand musste den ermordeten Mann kennen, was ergäbe das Ganze sonst für einen Sinn? Natürlich war ihr bewusst, dass sie den Sportschützen damit eine Menge zumutete. Das Foto, das Delgado mit seinem Smartphone aufgenommen hatte, war grauenhaft: ein geschundener Körper, ein verschwollenes, zertrümmertes Gesicht.
Leider gab es keine Alternative. Einen Zeichner aufzutreiben und hierherkommen zu lassen, das hätte Zeit gekostet, die ihnen nicht zur Verfügung stand. Auch wenn sie noch nicht im Ansatz ahnte, welche Richtung diese Ermittlung nehmen sollte, so sagte ihr Gefühl, dass sie zügig handeln müsse. Nicht überstürzt, aber schnell und bestimmt. Etwas tun.
Die Menschen, denen sie das Foto zeigten, reagierten vollkommen unterschiedlich, aber dennoch war ihren Reaktionen etwas gemein, eine intuitive Abwehr gegen das, was dort zu sehen war, gegen die Kraft des Unmenschlichen, das den kleinen Bildschirm von Delgados Handy zu sprengen drohte.
Nyström sah das Entsetzen in den Gesichtern der Leute, die Angst, die Verwirrung, den Schock. Ein Mann fluchte, ein anderer begann zu wimmern. Eine Frau biss sich in die Hand. Die meisten wandten sich ab, so schnell es ging. Einer war wie ein Mönch gekleidet. Als er das Foto sah, bekreuzigte er sich. Er betete, schnell und laut, aber Nyström verstand kein Wort. Der Mann redete italienisch. Seine Stimme überschlug sich. Er bekreuzigte sich erneut, zweimal, dreimal, küsste das Kreuz, das um seinen Hals hing, dann zeigte er mit ausgestrecktem Arm auf das Foto. Er rief in gebrochenem Englisch:
»It’s him!«
»Wer?«
Sie stieß Delgado an.
»Who? Who is he?« Delgados Stimme warf ein Echo in der Großküche, die sie zu einem Vernehmungsraum umfunktioniert hatten.
Die Augen des Mönches waren aufgerissen.
»It’s Saint Sebastian! The holy martyr!«
»Was meint er?«
Nyström riss an Delgados Ärmel herum.
»Der heilige Sebastian, ein Märtyrer. Sagt er.«
Delgado zuckte die Schultern.
Alle sahen sich an.
»Was bedeutet das?«, fragte Hultin.
»Ich weiß es nicht«, sagte Delgado.
»Wir brechen das hier ab«, sagte Nyström. »Besorgt einen Dolmetscher. Und noch was, Anette: Ich will Stina Forss hier haben. So schnell es geht.«
»Aber … sie ist doch …«
»Verdammt, Anette! Hol sie gefälligst her! So schnell es geht!«
Hultin und Delgado starrten sie an. Nyström atmete schnell. Sie hatte geflucht. Soweit sie wusste, war ihr das noch nie im Dienst passiert. Was für eine lächerliche Chefin du bist, dachte sie. Dann biss sie sich auf die Lippe und ließ sich im Spülbecken ein Glas kaltes Wasser ein.
5
Stina Forss glitt aus einem beinahe traumlosen Schlaf. Sie erinnerte sich lediglich an Schemen von geometrischen Mustern, Dreiecke waren es gewesen, der Schatten eines Rechtecks, möglicherweise auch ein Halbkreis. Dann öffnete sie die Augen. Was sie sah, war ein stark behaarter Männerrücken. Der Rücken roch nach Alkohol. Und nach Fisch. Dann begriff sie: Ein Rücken riecht nicht nach Alkohol und auch nicht nach Fisch, das, was sie da roch, musste ihr eigener Atem sein, Wodka und Hering in rauen Mengen. Sofort wurde ihr schlecht. Sie drehte sich um. Da war noch ein Männerrücken. Schmaler als der auf der anderen Seite, heller in der Hautfarbe und auch nicht behaart, aber definitiv ein Männerrücken, keine Frage. Auch ihr Atem sah das so. Mehr Fisch, noch mehr Wodka. Ihr Magen rührte sich gefährlich. Jetzt aber schnell. Irgendwie kam sie an den Körpern vorbei aus dem Bett, strampelte dabei das Laken von sich, stolperte, fing sich, drei lange Schritte, ein anderer Raum, aus den Augenwinkeln: ein Sofa mit noch einem schlafenden Nackten darauf, diesmal auch ein Gesicht dazu, kein Mann, ein Jüngling eher, vielleicht sechzehn oder siebzehn, was hatte das alles zu bedeuten?
Hatte sie etwa …?
Mit beiden? Oder sogar …?
Egal, später.
Sie lief aus dem Zimmer, aus der Hütte, links das Klohäuschen, rechts der Steg, sie entschied sich für den Steg und endlich übergab sie sich. Als sie schließlich fertig war und sich ihr Magen und auch das Wasser unter ihr wieder beruhigt hatten, sah sie ihr eigenes Spiegelbild auf der glänzenden Oberfläche des Sees. Ihr Mascara war verschmiert und auf ihrer rechten Brust war etwas, ein Knutschfleck. Ansonsten sah sie ganz lebendig aus. Dann schwamm eine interessierte Barschschule durch sie hindurch. Am Ufer schnatterte eine Ente, vielleicht war es aber auch ein Haubentaucher. Was wusste sie schon von Vögeln? In der Ferne zog das altmodische Dampfschiff Thor über den See. Es tutete. Dann lösten sich seine Konturen im Gegenlicht auf. Geometrie, die verschwand. Beinahe wie in ihrem Traum.
Zurück im Haus setzte sie Kaffeewasser auf. Auf dem Küchentisch lagen Bierdosen und leere Flaschen aus ungefärbtem Glas, offene Fischdosen und ölige Teller, ein Taschenspiegel und ein halbierter Strohhalm. Als der Kessel zu pfeifen begann, regte sich der Körper auf dem Sofa und richtete sich auf. Blonde lange Haare fielen über ein hübsches Gesicht. Erik, wenn sie sich richtig erinnerte. Dann musste der im Bett Claas sein. Aber vielleicht war es auch umgekehrt. Oleg hatte die beiden Tramper auf einer Autobahnraststätte aufgegabelt. Die jungen Dänen waren auf dem Weg zu einem Rockfestival. Oleg, das war der behaarte Rücken. Gestern war er aus Berlin gekommen, um mit ihr ihren vierunddreißigsten Geburtstag zu feiern. Oleg war ein guter Freund, ein gebürtiger Russe. Und beruflich Saunameister. Deshalb hatte sie die Hütte am Helgasee gemietet. Schwitzen und saufen, skandinavischer kann man seinen Geburtstag nicht begehen, hatte sie gedacht. Wo sie nun schon mal hier war, in diesem seltsamen Land ihrer Kindheit, das so weitläufig war und doch so eng sein konnte, dass ihr viel zu oft die Luft wegblieb. Vier Monate war das her, dass sie ihr Leben in Berlin aufgegeben hatte, um nach Schweden, in das Land ihres Vaters, zurückzukehren. Ins ländliche Småland, in die Provinz. Zurückgelassen hatte sie eine Karriere bei der Berliner Mordkommission und eine Beziehung, die zu schwer war, um zu funktionieren. Eingetauscht gegen die Nähe und nicht minder schwierige Beziehung zu ihrem kranken Vater. Und ein Anerkennungsjahr im schwedischen Polizeidienst, in dem sie zweimal die Woche die Schulbank drücken musste, in dem man sie nach wenigen Wochen wegen disziplinarischen Schwierigkeiten gemaßregelt hatte, strafversetzt in den regulären Verkehrs- und Streifendienst. Anfängerarbeit: monatelang Autos blitzen, Unfälle aufnehmen, Lkw-Fahrer ins Röhrchen pusten lassen. Die Situation war vollkommen lächerlich.
Nach einem langen Winter und einem verregneten Frühling war es nun wenigstens endlich Sommer geworden. Ihre Cousine Maj hatte recht gehabt, Schweden war ein anderes Land im Sommer. Innerhalb von wenigen Wochen war das ganze Grau da draußen explodiert. Der See spiegelte das Blau des Himmels, der Horizont war ein Gürtel aus üppigem Grün. Warmes Licht strömte durch die offene Tür in die Hütte, bedeckte den Boden, ihre nackten Beine. Sie hatte sich noch immer nichts übergezogen. Irgendwie schien es nicht notwendig. Dass sie das so empfand, lag vielleicht auch an den Substanzen, die sich noch in ihrem Blutkreislauf befanden, weil ihre Leber sie noch nicht abgebaut hatte. Jedenfalls schien der junge Erik oder Claas die Sache genauso zu sehen. Unbekleidet und schweigend tranken sie ihren Kaffee. Schließlich räusperte er sich. Sein Dänisch klang kehlig.
»Haben wir gestern eigentlich …?«
In dem Moment brummte ihr Handy. Es kroch vibrierend zwischen den leeren Fischdosen hindurch.
Sie nahm das Gespräch an. Die Frage des jungen Mannes blieb offen im Raum stehen. Sie hätte auch keine Antwort darauf gewusst.
6
Es stellte sich heraus, dass der Mönch wirklich ein Mönch war. Bruder Ignatio kam aus einem Benediktinerkloster in der Lombardei und war damit der Sportfreund mit der weitesten Anreise und gleichzeitig der Einzige der historischen Bogenschützen, der nicht verkleidet war, sondern seinem ungewöhnlichen Hobby in seiner Alltagskleidung nachgehen konnte, abgesehen vielleicht von seinen neongelben Reebok-Turnschuhen, von denen sich Ingrid Nyström nicht vorstellen konnte, dass er sie in San Benedetto di Polirone zu seiner täglichen Morgenandacht trug. Im Grunde war sie jedoch bereits in einer Gemütsverfassung, in der sie überhaupt nichts mehr wunderlich fand. Sie saß gemeinsam mit Hugo Delgado und dem jungen Italiener in einem Nebenraum des Speisesaals, den man zu einer provisorischen Einsatzzentrale umfunktioniert hatte. Nach dem ergebnislosen Versuch, den Toten mithilfe eines Fotos zu identifizieren, hatte man die Turnierteilnehmer, die sich mittlerweile zum Großteil umgezogen hatten, wieder in den Speisesaal geordert, wo es Mittagessen gab und sich ein Arzt und eine Psychologin um die aufgebrachten und mitgenommenen Menschen kümmerten. Keiner der Anwesenden hatte den Toten erkannt. Da war nur Bruder Ignatio und seine, nun ja, Reaktion, oder wie man das, was vorhin geschehen war, auch immer nennen wollte. Wenigstens wurde bald deutlich, dass sie im Gespräch mit dem Mönch keinen Dolmetscher brauchten, da er trotz seines Akzents ein solides Englisch sprach, das Delgado und ihr keine Probleme bereitete. Der Mann machte keinesfalls einen wirren oder verklärten Eindruck, aber bei diesen religiösen Eiferern wusste man ja nie, dachte Nyström. Als Schwedin war sie natürlich protestantisch, noch dazu mit einem lutherischen Pastor verheiratet, und alles Katholische war ihr erst einmal fremd, ja sogar ein wenig suspekt.
Ignatio machte den Eindruck eines ernsthaften jungen Mannes, dessen braune Augen noch viel von dem Schreck, nein, vielmehr von der Erregung verrieten, die angesichts des Fotos von dem so grausam getöteten Mann in ihn gefahren war. Was er Delgado zu erklären versuchte, war Folgendes: Der Tote war in seinen Augen Sankt Sebastian. Der Heilige. Der Märtyrer. Der Schutzpatron der Eisenhändler, Waldarbeiter, Steinmetze und Leichenträger. Und wenn er es nicht tatsächlich war, so sah derjenige genauso aus wie Sankt Sebastian. Und wieso sollte jemand aussehen wie ein Heiliger, wenn nicht zu dem Zweck, dass Gott den Menschen damit ein Zeichen geben wolle.
»Ein Zeichen?«, fragte Nyström.
Ignatio nickte.
»Wofür denn ein Zeichen?«, fragte sie.
Die gütigen braunen Augen sahen sie an.
»I don’t know. You’re the police, aren’t you?«
Worauf du wetten kannst, dachte sie. Sie antwortete auf Englisch:
»Danke, dass du uns geholfen hast, du kannst jetzt gehen. Es sei denn, mein Kollege hat noch eine Frage.«
Sie sah zu Delgado, doch der reagierte nicht. Er wischte stattdessen auf seinem Mobiltelefon herum, es war eins dieser Dinger ohne Tasten, wie Anders auch eins hatte.
»Hier hab ich’s«, sagte er.
Er hielt ihr das Display entgegen. Ein Bild aus dem Internet. Ein Ölgemälde. Und tatsächlich: Sankt Sebastian, der Märtyrer. Dargestellt von Andrea Mantegna, 1456–1459, wie die Bildunterschrift verriet. Ein Mann an eine Säule gefesselt, von Pfeilen durchbohrt.
Himmelschreiendes Leid.
Marter.
Sie sah zu Ignatio. Auch er hatte das Bild gesehen, er nickte heftig. Sie sah zu Delgado. Der tippte schon wieder auf seinem Smartphone herum.
»Oh«, sagte er dann.
»Was?«
»Das ist merkwürdig, was hier steht, Ingrid.«
»Was?«
Ihre Haut spannte. Delgado räusperte sich, als habe er etwas im Hals.
»Also dieser Sankt Sebastian, das war ein christlicher Märtyrer aus dem dritten Jahrhundert. Ein römischer Prätorianerhauptmann, der sich öffentlich zum Christentum bekannte. Daraufhin verurteilte ihn Kaiser Diokletian zum Tode und ließ ihn von numidischen Bogenschützen erschießen. Aber Sebastian überlebte, woraufhin man ihn mit Keulen erschlug und anschließend in eine Kloake warf. So weit erzählt es die Legende, Wikipedia zufolge.«
Die Pfeile.
Der geschundene, von Blutergüssen gezeichnete Körper.
Der starke Geruch nach Exkrementen.
»Oh, mein Gott!«, flüsterte sie.
7
Lars Knutsson nippte an der Tasse, die vor ihm stand. Der Kaffee war lauwarm und bitter, auch wenn er das nur am Rande wahrnahm. Seine Seele war in Aufruhr und das war für ihn ein emotionaler Ausnahmezustand, ruhte das Gemüt des besonnenen, bärtigen Manns doch sonst fest in seinem großen, beleibten Körper. Knutsson fühlte sich wie in einem schlimmen Traum, aus dem es kein Erwachen gab. Draußen im Wald hing ein zertrümmerter und gemarterter Körper an einem Baum und hier, in Humlehöjden, huschten seltsame Gestalten mit ihren Pfeilen und Bögen durch die Räume. Die bedrückende, unwirkliche Atmosphäre erinnerte ihn an die traumatischen Szenerien des Malers Hieronymus Bosch, die er einmal vor vielen Jahren in einer Ausstellung im Urlaub in Rotterdam hatte sehen müssen, weil seine kulturbeflissene Frau Lisa ihn hineingezerrt hatte, und es verlangte ihm nun nicht allzu viel Fantasie ab, sich vorzustellen, wie missgebildete Tierwesen, die aus überdimensionierten Eierschalen krochen und mit abenteuerlichsten Folterwerkzeugen bewaffnet waren, das Albtraumszenario vervollständigten. Natürlich war das Quatsch. Das hier war die Realität. Aber es war verführerisch, seinen sich verselbstständigenden Gedanken nachzuhängen, bargen sie doch die vage Möglichkeit, dass er vielleicht tatsächlich noch träumte und gleich aufwachen könnte, um den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück und einem guten Kaffee zu beginnen und anschließend zu Hause die Ausbesserungsarbeiten am Steg vorzunehmen, die er sich eigentlich für dieses Wochenende, dem womöglich schönsten und sonnigsten des Jahres, vorgenommen hatte. Das Klingeln seines Handys riss ihn abrupt aus seinen Gedanken, Kaffee schwappte auf seine Hose. Fluchend nahm er das Gespräch an. Es war Olsson von der Zentrale.
»Kajakfahrer haben einen toten Hund gefunden. Auf Musön.«
»Verdammt, Stig, dafür rufst du mich an? Falls es sich bei euch noch nicht rumgesprochen hat: Wir haben hier einen Mord wie aus einem Horrorfilm, dazu fünfzig bekloppte Bogenschützen und einen Mönch mit Erscheinungen! Und du nervst mich mit einem toten Köter?«
»In dem Kadaver stecken Pfeile, sagen die Kollegen von der Wasserschutzpolizei. Und massenhaft Klamotten lägen da auch rum. Außerdem sei alles voller Blut.«