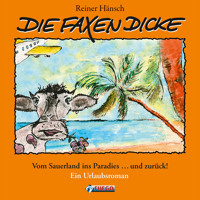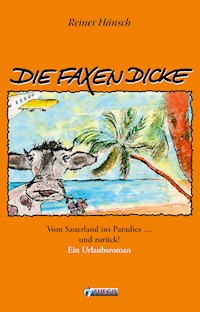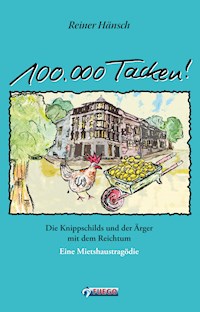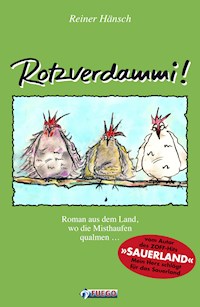
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fuego
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Herrlich stinkendes Sauerland oder schnöde glitzerndes Düsseldorf? Heinz-Norbert Flottmann muss sich entscheiden. Auf der Beerdigung seiner Mutter, mitten im Sauerland, taucht plötzlich seine chaotische, fast begrabene Vergangenheit wieder auf. Das schöne, schreckliche Leben zwischen Misthaufen, Mädchen, Gitarrenverstärkern und Bierflaschen ist plötzlich wieder da. Und wie! Die Jungs seiner alten Band und auch seine Jugendliebe Henni machen ihn nochmal sehr nervös. Heinz-Norbert, inzwischen als Hardy Fetzer eine große Nummer in der Düsseldorfer Werbeszene, spürt den verlockenden, kribbelnden Sog der tollen, alten Zeiten, als alle noch jung und so 'töfte' bekloppt waren. Als es noch eine Band gab, die die Welt, oder wenigstens das Sauerland, aus den quietschenden Angeln hebeln wollte. Der unmögliche Gedanke, diese Band wiederzubeleben, lässt Hardy trotz verzweifelten Sträubens und Windens irgendwie nicht los und bringt damit alles wunderbar durcheinander. Sein ganzes Leben "'is' auf eima' irgendwie inne Wicken". In unmöglichen, schrägen Episoden voller Sauerländischer Sprachakrobatik läuft dann alles dramatisch auf ein herrliches Ende zu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Rotzverdammi!
aus dem Sauerländischen
von
Reiner Hänsch
FUEGO
- Über dieses Buch -
Herrlich stinkendes Sauerland oder schnöde glitzerndes Düsseldorf? Heinz-Norbert Flottmann muss sich entscheiden. Auf der Beerdigung seiner Mutter, mitten im Sauerland, taucht plötzlich seine chaotische, fast begrabene Vergangenheit wieder auf. Das schöne, schreckliche Leben zwischen Misthaufen, Mädchen, Gitarrenverstärkern und Bierflaschen ist plötzlich wieder da. Und wie! Die Jungs seiner alten Band und auch seine Jugendliebe Henni machen ihn nochmal sehr nervös. Heinz-Norbert, inzwischen als Hardy Fetzer eine große Nummer in der Düsseldorfer Werbeszene, spürt den verlockenden, kribbelnden Sog der tollen, alten Zeiten, als alle noch jung und so 'töfte' bekloppt waren. Als es noch eine Band gab, die die Welt, oder wenigstens das Sauerland, aus den quietschenden Angeln hebeln wollte.
Der unmögliche Gedanke, diese Band wiederzubeleben, lässt Hardy trotz verzweifelten Sträubens und Windens irgendwie nicht los und bringt damit alles wunderbar durcheinander. Sein ganzes Leben “is' auf eima’ irgendwie inne Wicken”. In unmöglichen, schrägen Episoden voller Sauerländischer Sprachakrobatik läuft dann alles dramatisch auf ein herrliches Ende zu.
Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland! Die ideale Lektüre für einen lustigen Abend bei Bier und Bütterkes mit Sskhinken!
Bettina Tietjen
“Rotzverdammi!” - Spätestens, wenn man den ersten Satz gelesen hat, muss man durch die 350 Seiten durch: “Herrlich stinkendes Sauerland oder schnöde glitzerndes Düsseldorf” - Günter Grass lässt grüßen: “Weihnachten feiern im Sauerland, aber nicht bei den Radschlägern…”, haute er DDorf schon in den “Hundejahren” um die Ohren - und erhielt den Literatur-Nobelpreis. Das macht doch Hoffnung, Herr Hänsch!
Gisbert Baltes
Für alle, woll!
Hier kannze die Schauplätze der dramatischen Ereignisse bekucken - un alle Orte aus'm Song “Sauerland”, woll.
Herrlich stinkendes Sauerland oder schnöde glitzerndes Düsseldorf? Heinz-Norbert Flottmann muss sich entscheiden.
Auf der Beerdigung seiner Mutter, mitten im Sauerland, taucht plötzlich seine chaotische, fast begrabene Vergangenheit wieder auf. Das schöne, schreckliche Leben zwischen Misthaufen, Mädchen, Gitarrenverstärkern und Bierflaschen ist plötzlich wieder da. Und wie! Die Jungs seiner alten Band und auch seine Jugendliebe Henni machen ihn nochmal sehr nervös.
Heinz-Norbert, inzwischen als Hardy Fetzer eine große Nummer in der Düsseldorfer Werbeszene, spürt den verlockenden, kribbelnden Sog der tollen alten Zeiten, als alle noch jung und so 'töfte' bekloppt waren, als es noch eine Band gab, die die Welt – oder wenigstens das Sauerland aus den quietschenden Angeln hebeln wollte.
Der unmögliche Gedanke, diese Band wiederzubeleben, lässt Hardy trotz verzweifelten Sträubens und Windens irgendwie nicht los und bringt damit alles wunderbar durcheinander: Sein ganzes Leben „is’ auf eima’ irgendwie inne Wicken“.
In unmöglichen, schrägen Episoden voller sauerländischer Sprachakrobatik läuft alles dramatisch auf ein herrliches Ende zu.
Diese Geschichte ist gelogen.
Natürlich gibt es gewisse Parallelen zur Geschichte der
Band ZOFF, aber die Story ist viel zu frei erfunden, um als
Bandgeschichte durchgehen zu können.
Reiner Hänsch
Sauerland
Ein Bauer stand im Sauerland
und dachte drüber nach,
dass Hühner auffe Stange sitzen,
Tauben auf’m Dach.
Inzwischen in sein’ Hühnerstall,
da tobt der Fuchs ganz munter
und holt de Hühner nach und nach
von ihrer Stange runter.
In Finnentrop is’ dunkel,
in Küntrop noch viel mehr,
in Hundesossen wird auf Touristen geschossen
und trotzdem kommen jedes Jahr mehr.
In Winterberg lebt ein Gartenzwerg,
der ging sich in Züschen ein’ zischen,
er hat sich verlaufen nach Schmallenberg,
das is’ ganz schön weit für’n vollen Zwerg.
Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland,
begrabt mich mal am Lennestrand,
wo die Misthaufen qualmen, da gibt’s keine Palmen.
Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland,
vergrabt mein Herz im Lennesand,
wo die Mädchen noch wilder als die Kühe sind.
In Stachelau tobt die wilde Sau,
da komm’ alle Bauern aus Krombach
und nach der Feier verprügeln sich alle,
da freut man sich schon ’s ganze Jahr drauf.
In einer Baracke in Kalberschnacke,
da übt die Kapelle der Feuerwehr,
sie machen vier Stunden Radetzkymarsch
und fünf Kisten Warsteiner leer.
Der im Sauerland weltberühmte Song der Band ZOFF
Bitte zuerst lesen!
Sehen Sie mal, Sauerländisch gibt’s ja eigentlich gar nicht. Nicht als offizielle Sprache jedenfalls. Man muss es gar nicht sprechen können und man muss es auch nicht verstehen. Man sollte nur Verständnis dafür aufbringen.
Ach ja … Sauerländisch ist schon was ganz Eigenes. Es hat einen ganz eigenen Klang, eine eigene Melodie und es gibt ein sehr eigenes Völkchen, das sich dieser „Sprache“ bedient und sich sogar problemlos auf Sauerländisch verständigt. Untereinander, versteht sich. Der Außersauerländische steht da oft ratlos in der schönen bergigen, aber meist verregneten Gegend herum und „kricht nix mit“. Deshalb sollte man einige Absonderlichkeiten dieser „Sprache“ kennen, um den gemeinen Sauerländer auch zu verstehen, wenn er mal mit uns spricht. Manchmal tut er das. Nicht oft, aber hin und wieder. Und gemein ist er eigentlich gar nicht.
Fangen wir also mit dem R an. Es rollt natürlich, klar. Wohin, weiß keiner, aber es rollt. Nicht so wie beim Siegerländer, da rollt es ja schon so wie beim Engländer, nein, nein, so nicht, aber es rollt, dass die Zunge schon mal kurz hinter den Zähnen des Sauerländers so rrrichtig ins Rrrotieren cherrrät.
Das letzte Wort haben Sie nicht verstanden?
Ja, das kann ich verstehen. Kommen wir also zur nächsten Absonderlichkeit: dem G.
Ist ein Sauerländer zum Beispiel in Finnentrop, einem hübschen, kleinen sauerländischen Städtchen, geboren, so verkündet er dies nach hartnäckigen Nachfragen mit: „aus Finn’ntrop chebürtich“. Rrrichtig. Kein G, wie man es in „gebürtig“ zweimal erwarten sollte, sondern ein CH ertönt an der Stelle, wo eigentlich das G sein sollte. Am Ende sowieso, das machen alle (Könich – Honich – färtich). Aber am Anfang, da ist es etwas ganz Besonderes. G gibt es gar nicht im Sauerländischen, „chibt et char nich’“. Das G ist im Laufe der letzten zehntausend Jahre der sauerländischen Sprachentwicklung wahrscheinlich einfach nicht mehr weiterbearbeitet worden, weil es sich nicht lohnte, und es ist so auf der Stufe eines rauen CH hängengeblieben. Einem CH wie in „doch“ ungefähr. Kratzig. Aber nicht so ganz wie in „doch“, etwas weiter vorne in den Rachen wird es gelegt. Ist eben einfacher so. Aber ein Fluchzeuch fliecht. Vorne kratzt es, hinten nicht - wie in „frrrech“.
Jaaa. Jaaa. So is dat!
Aber so ganz wegfallen soll es dann doch nicht. Wäre ja schade drum, wo es doch nun schon mal da ist. Nein, es wird da eingesetzt, wo wir eigentlich ein fröhliches J haben sollten. Zu schwer? Also, getz hömma chut zu… Wenn der Sauerländer verkünden will, dass zum Beispiel der große Johannes mit der gelben Jacke jetzt gleich zum Jugendgottesdienst geht, heißt das auf Sauerländisch: „Der chroße Gohannes mit der chelben Gacke cheht getz chleich zum Gugendchottesdienst.“ Nicht schlecht, was?
Getz abba!
Das ist nämlich noch lange nicht alles. Sicherlich kennen auch einige von Ihnen den netten kleinen Ort Meschede im Sauerland. Seltsamerweise besinnt sich der Sauerländer bei Worten mit SCH auf jeden einzelnen Buchstaben ganz genau. Er macht sich unverständlicherweise die nicht unerhebliche Mühe und nimmt quasi das S-C-H von Meschede sämtlich in alle seine Einzelteile akribisch auseinander. Er spricht also erstmal das S. Aber nicht ganz so, wie wir es tun, mit der Zunge recht gerade, kurz hinter den leicht geöffneten Zähnen, sondern er biegt die Zungenmitte ein wenig nach oben und bildet einen kleinen Kanal, durch den die Luft strömt, bis es bald schon ein leises Pfeifen wird… Muss man lange für üben.
Lassen Sie’s lieber.
Dann kommt logischerweise das C, und das wird separat und sauerländisch stur ausgesprochen wie ein K! Und das H, naja, das hört man ja nicht.
Also heißt die Stadt Meschede, vom Sauerländer ausgesprochen, „Messkhede“. Auch nicht schlecht, oder? Man muss das aber wissen, sonst kommt die Botschaft des Sauerländers nicht bei uns an. Oder eben nicht richtig an, woll.
Dat sacht er auch cherne, der Sauerländer.
„Woll.“
An allen Ecken und Enden. Meistens an den Enden. Das kann man praktisch an jeden Satz anhängen, wenn man meint, er sei noch nicht lang genug, oder wenn man das Gesagte unterstreichen oder auch in Frage stellen will. Mit einem „woll“ kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. „Woll“, manchmal auch in den Sonderformen „wonnich“ oder nur „wo!“, passt immer und sollte man zur Sicherheit auch immer parat haben und auf jeden Fall mal hinten dran hängen, woll?!
Weitere sprachliche Besonderheiten wie der sauerländische Genitiv („meine Frau ihr Auto“) und das an das Englische angelehnte “am Machen sein”, also die berühmte “-ing-Form” („er is chrade am Auto wasskhen, sie is am Essen machen”) seien hier nur am Rande erwähnt.
Und bevor man es am Ende noch vergisst: Es gibt da auch noch den Akkusativus Sauerlandus, der bei direkten Personenbenennungen oder auch meistens bei direkten Beleidigungen angewandt wird, nicht selten in Verbindung mit dem personenbezogenen Dativ: „Jemandem einen … sein“.
Zu schwer? Nein. Passen Sie auf.
Also, zum Beispiel sacht man: „Dä Häbätt, nä, dat is mir ’n dummen Sack, woll!“ Also, bitte merken, ganz wichtig: Er ist mir einen dummen Sack, einen blöden Hund, einen fiesen Doofmann und so weiter. Aber manchmal nich’ nur dä Häbätt.
Ach ja, die Sauerländer, dat sin’ mir so welche…
Abba getz cheht et los!
1
Onkel Willi
„Rotzverdammi!
Dat hat ja chrad nomma chut chechangen.
Wat biss du mir doch ’n dösigen Tuppes, du!
So ’n Heiopei wie du hat mir chrade noch chefehlt.
Dat chibb’s doch char nich’.
Ochottochottochott!“
Das haben Sie nicht verstanden?
Das kann eigentlich kein Mensch verstehen.
Ich aber kenne diese Sprache noch aus einem anderen Leben,
ganz weit weg und ganz, ganz lange her,
als ich selbst noch ein ganz anderer Mensch war.
Tja, so was hört man nur, wenn man sich ganz weit rauswagt. Wie weit bin ich eigentlich schon? Ich stehe mit meinem Wagen mitten auf einer kleinen Dorfstraße. Ganz idyllisch so weit. Rechts und links jeweils ein malerisches, bäuerliches Gehöft mit wuchtigen Sockeln aus grauem Felsgestein, darüber Fachwerk, schwarz-weiß, und dahinter kitschig schöne, hügelige Weiden, Wälder und Äcker. Und direkt vor mir, mitten auf der Straße, zappelt, zetert und flucht ein kleines, runzeliges, grünes Männchen, das dieses vollkommene Bild sehr eigenwillig belebt und dem dieses abenteuerliche Wörtergewusel soeben aus seinem knallroten, furchigen Gesicht gepoltert ist. Nach oben hin wird dieses Gesicht abgerundet durch eine rustikale, grüne, sagen wir mal, agrarwirtschaftliche Kappe mit Schirm. Sozusagen eine Agro-Kappe, denn der kleine, alte Mann ist wütend. Mit seinen dazu farblich fein abgestimmten grünen Gummistiefeln stampft er in seiner Wut mehrfach heftig auf den welligen Asphalt der geflickten Straße und ich sehe ihm an, dass er gleich platzt.
Er ist wütend auf mich.
Jetzt stiefelt er direkt auf mich und mein Auto zu, eine Art Dreizack bedrohlich in der Hand schwingend. Ein riesiger brauner Höllenhund begleitet ihn laut bellend. Ich schließe schnell das Wagenfenster, drücke die Türknöpfe herunter und der alte Mann funkelt mich jetzt durch das hoffentlich sichere Fensterglas sehr, sehr böse an. Weder er noch der Bluthund haben eigentlich einen Grund, so böse zu sein, denn ich habe schließlich meinen Wagen gerade noch rechtzeitig vor den blöden … was sind das da? … Hühnern mit quietschenden Reifen zum Stehen gebracht. So viel Aufregung kann weder ich noch mein Auto vertragen. Wir sind beide Oldtimer.
Ich verrate es Ihnen gerne, ich bin neunundvierzig. Sie erfahren es ja doch. Dieses Jahr ist es aber dann so weit und der unangenehme Fünfzigste droht. Allerdings noch von Weitem, denn jetzt ist erst März und ich habe im Dezember Geburtstag. Kleine Galgenfrist also noch.
Und ich sehe auch, wie ich selbst meine – und deshalb müssen Sie mir auch nicht glauben –, noch ganz ordentlich aus. Immer ein wenig im Kampf mit ein paar überflüssigerweise an der Hüfte angesiedelten Pfunden. Na, und die Haare – immer noch recht lang, aber schon ganz schön grau – weichen unaufhaltsam und unbeirrbar zurück. Der Hinterkopf hat sogar schon eine unverschämte, kreisrunde, kahle Stelle und über der Stirn hat auch nur ein trauriges Büschel überlebt mit ein paar dünnen Haaren, die sich ängstlich aneinander klammern. Aber sonst bin ich ganz zufrieden. Für einen Fast-Fuffziger geht’s noch. So, dann wissen Sie das.
Der grüne Kerl scheint sich jetzt angemessene Beachtung meinerseits zu wünschen. Und der Hund, wirklich ein Gigantoköter, wohl so eine Art Dogge, muss sich sogar etwas bücken, um blöd zu mir ins Auto glotzen zu können. Dabei hechelt er an die Scheibe und sabbert unappetitlich auf die Gummidichtung. Nein, nein. Ich werde auf keinen Fall diese Scheibe wieder öffnen, grüner Mann, brauner Hund. Ich sehe euch gar nicht. Ich werde einfach nur abwarten, bis diese … Hühner endlich ihre gackernde Prozession beendet haben und dann werde ich Vollgas geben. Und weg bin ich. Ha!
Aber das Männlein mit seinem Hund ist natürlich nur sehr schwer zu ignorieren. Das können Sie sich denken. Sie rücken beide jetzt noch näher an die Scheibe heran, so dass sie schon ein wenig beschlägt, besonders durch das hechelnde Ungetüm, und es nützt überhaupt nichts, dass ich stur nach vorne zu diesen Hühnern blicke und sehnsüchtig auf den Ausgang ihrer chaotischen Pilgerreise warte. Das rote Gesicht mit der grünen Kappe und der sabbernde Höllenhund verschwinden einfach nicht. Dann klopft der wütende Mann auch noch mit seinem Dreizack mehrmals an die Scheibe. Gleich wird er mir auch noch den Lack zerkratzen!
Und das geht nun wirklich nicht. Jetzt reicht’s mir aber! Jetzt gibt’s Krieg. Das ist ein wertvoller Oldtimer, grüner Mann! 356er Porsche, Baujahr ’62. Eine Kostbarkeit! Ein Vermögen wert. Nimm bloß die Zinken weg!
Ich kurble also, jetzt natürlich ebenfalls sehr wütend und daher alle nötigen Vorsichtsregeln außer Acht lassend, die Scheibe wieder herunter und tatsächlich stellt der Grüne mangels Möglichkeiten sogleich das unverschämte Klopfen ein. Der Hund hat sich dabei ein wenig erschreckt und zuckt fast ängstlich zurück. Wie niedlich.
Umgehend versucht der grüne Mann jetzt natürlich wieder, seine sprachlichen Möglichkeiten ins Spiel zu bringen, um auf diese Weise eine Art Kontakt zu mir herzustellen. Vielleicht ist diese „Sprache“ ja auch ein noch ganz neuartiges Kommunikationsmodell in der ersten Testphase, denken Sie vielleicht. Und ich bin rein zufällig in diesen Test hineingeraten.
„Da hätt’ste mir bald die Hühna plattchefahren, du dusseligen Stadtfuzzi.“
Der Hund bellt jetzt wieder in sicherem Abstand.
„Halt die Skhnauze, Sskhutzmann!“, knurrt ihn der Alte an und der braune Hund stellt augenblicklich sein Gebell ein, legt sich schwer beleidigt mitten auf die Straße, mit dem Kopf zwischen seinen riesigen Vorderpranken, und schielt hinter schweren Augenlidern zum Agro-Mann hoch. Vielleicht hat der Grüne heute einen besonders schlechten Tag. Ich weiß es nicht. Der Hund weiß das sicher besser.
Der Grüne drängt jetzt seinen schwartigen, kleinen Schädel ins Innere meines Autos und lehnt sich breit in die Fensteröffnung. Das runzelige Männchen hat so was Dunkles, Braunes, noch nicht ganz Festes am grünen Jackenarm, das mich und meinen schönen Wagen ernsthaft bedroht. Ich weiche reflexartig zurück, weil die Masse auch nicht ganz geruchsfrei scheint, um es vorsichtig auszudrücken. Ach, warum eigentlich so vorsichtig? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es stinkende Landtierscheiße ist. Kuh. Schwein. Huhn. Hund. Außerdem verbreitet sie sich unaufhaltsam über die gesamte Fensteröffnung.
Langsam, vorsichtig und unter Abwägung aller Möglichkeiten zur friedlichen Deeskalierung des Konflikts drehe ich meinen Kopf jetzt mutig und entschlossen so in etwa in die Richtung des faltigen Gesichts und versuche, mich auf seine Kommunikationsebene einzustellen.
„Wat willze, Oppa?“
„De Hühna!“, durchzuckt es ihn da noch mal und er zeigt mit dem Dreizack aufgeregt in Richtung Straße, wo die gefiederte Prozession jetzt in totaler Auflösung zu sein scheint, ohne allerdings die Straße endlich frei zu geben.
Das braune Ungetüm bellt wieder und will aufstehen.
„Halt de Sskhnauze, Sskhutzmann! Platz!“
Wie heißt der Hund? Schutzmann?
Meine Güte! Und die ganze Aufregung wegen ein paar Hühnern! Phh. Wusste gar nicht, dass es so was überhaupt noch gibt. Solche Tiere hab ich doch bestimmt schon seit zwanzig Jahren nicht mehr in echt gesehen.
Hühner. Eier. Huhn süß-sauer mit Reis, Nummer 37. Na klar, der ganze große Zusammenhang ist auch mir plötzlich wieder präsent. Ich hatte es wohl bloß vergessen. Aber da laufen sie einfach so auf der Straße rum. Wilde Hühner! Ja, wo bin ich denn hier?
„Du biss donnich’ au’m Nürburchring, du Heiopei.“ Die kleine Pause hat dem Mann neue Kraft gegeben. „Du kanns' doch hier nich mit deine alte Karre mit Bleifuß durchbrettern und mir de Hennen umsensen. Bisse eingeknackt oder bisse einfach nur bekloppt?“
Mit „alte Karre“ meint er meinen wunderbaren, silbergrau lackierten und frisch polierten, historischen Porsche, dessen Schönheit momentan leider durch etwas Hühnerkacke am Fenster leidet. Ich hole tief Luft und versuche, mich zu sammeln, verliere dabei aber die dunkle, braune Gefahr an seinem Ärmel niemals aus den Augen. Aber ich komme nicht zu Wort.
„Solche Blindchänger wie dich habbich ja chefressen, woll ... und dann kommsse au noch aus’m feinen Düsseldorf wech, Gunge? Dat die alte Kiste sonne Tour überhaup’ noch mitmacht!“, knurrt er jetzt noch ärgerlicher und er wird immer lauter, weil er vielleicht meint, ich verstehe ihn nicht, weil ich ja auch noch nicht viel gesagt habe. Vielleicht denkt er aber auch, dass man in Düsseldorf eine ganz andere Sprache spricht. Und so ganz unrecht hat er damit ja nicht. Ja, ich komme aus Düsseldorf. Steht ja auf dem Nummernschild.
Schutzmann bellt wieder tief und donnernd, dass einem angst und bange werden kann.
Also gut, dann vielleicht etwas höflicher. Ich versuche es.
„Jetzt halten Sie aber mal die Luft an, Herr Landwirt! Ich muss jetzt weiter!“
„Getz werd ma nich frech hier, du Güngelsken! Sach mir ersma, woosse hinwillz mit deine rasende Blechkiste, Düsseldorfer!“, sagt er jetzt ganz listig.
Da will der mich einfach hier festhalten!
„Na?“ Jetzt wird der kleine Zappelphilipp langsam ungeduldig. „Wat is? Kommt wat?“
Ich räuspere mich kurz, überwinde mich noch ein wenig und entschließe mich zu einer Antwort. Ein Wort soll alles klären.
„Schwattmecke“, sage ich also zu ihm.
Und das ist wahrscheinlich das Letzte, was er von mir erwartet hat. Er reißt die Äugelchen auf und sieht mich an, als hätte ich ihn zutiefst beleidigt. Dabei ist Schwattmecke ja überhaupt keine Beleidigung, wie man vielleicht annehmen könnte, weil es sich wie eine anhört. Du blöden Schwattmecke, du, hau bloß ab! Verpiss dich! Du stinkst nach Hühnerkacke! Nein, nein. Schwattmecke ist ein winziger, vergessener Ort in dieser unheimlichen Zwischenwelt, in der ich offensichtlich gelandet bin. Und genau da muss ich hin, nach Schwattmecke, meine Mutter begraben, die 75 Jahre hier gelebt hat. Hier, mitten im Sauerland.
Ich bin also angekommen.
Und es wird höchste Zeit! Ich muss jetzt wirklich weiter. Wenigstens zur Beerdigung der eigenen Mutter will ich mal pünktlich da sein. Besser gesagt, überhaupt mal da sein.
„Wat willze da?“, schnauzt der Kerl mich an.
Schutzmann hält den Kopf schief. Ein paar lange Sabberfäden hängen ihm vom Maul und tropfen zäh auf den brüchigen Asphalt.
Ja, das geht ihn ja nun eigentlich gar nichts an.
„Geht Sie doch gar nichts an!“, versuche ich wieder etwas unhöflicher zurückzuschnauzen, was mir aber nicht so recht gelingt. Ich bin eigentlich nur sehr ungern unhöflich und irgendwie finde ich den Typen ja schon wieder lustig, wenn er mir nur nicht so viel Zeit stehlen würde.
Ich drehe also schon mal leicht an der Kurbel für das Fenster, damit ihm die Scheibe von unten in den Arm schneidet, aber es nützt nichts. Das Braune verteilt sich dadurch jetzt auch auf der oberen Kante der Scheibe und rutscht schmierig und böse zwischen die Dichtungsgummis. Ich hoffe, es ätzt sich nicht wie der schlimme Alienausfluss durch die gesamte Tür bis auf die Straße.
„Schwattmecke. Da is’ heute ’ne Beäärdigung, woll!“, sagt er dann mit einer plötzlichen Traurigkeit in der Stimme, die ich gar nicht erwartet hätte. „Hilde Flottmann is’ nämmich tot.“
Ja. Das ist sie. Meine Mutter. Hildegard Flottmann.
„Hilde Flottmann ist meine Mutter!“
So. Und hoffentlich hält er jetzt endlich seine Klappe und lässt mich ziehen.
Aber er starrt mich nur an und ich sehe, wie es in ihm rattert. Da kommt ganz langsam eine Präzisionsmaschine auf Touren, die schon lange nicht mehr so plötzlich beansprucht wurde und wahrscheinlich auch dringend mal geölt werden müsste.
„Abba der Bernd bisse ja nich’…“, hat die Maschine nach einer Weile errechnet.
„??“
„NICH – DER – BERND!“
„Nä, binnich nich’.“
Bernd ist mein Bruder.
„Heinz-Nobbät???“
Dieses sperrige Wort hat er anscheinend ganz tief unten aus seiner staubigen Erinnerungskiste gekramt. Der Kistendeckel hat ganz laut gequietscht.
Es fällt mir zwar schwer, das zuzugeben, aber er hat leider recht. Ja, ja, ich bin „Heinz-Nobbät“ und nicke nur bedeutungsschwer mit geschlossenen Augen, in mein Schicksal ergeben. Ich bin erkannt.
Heinz-Norbert. So was haben mir meine Eltern doch tatsächlich mal verpasst – ungefragt natürlich. Heinz und Norbert. Das waren meine beiden Großväter, die ich leider nie kennengelernt habe. Vereint in einem grausamen Namen, vergeben an einen armen, kleinen, unschuldigen Kindermenschen, der nun wirklich nichts dafür kann. Mit so was und einem Klapps auf den Hintern wird man dann ins böse Leben rausgeschickt. Sieh ma zu, wiesse klar komms, Heinz-Nobbät! Hähähä … Und da reiben sie sich heute noch gehässig die Hände.
Ach, jetzt sind ja beide tot.
Aber mal im Ernst. Schrecklichere Namen gibt’s doch gar nicht mehr, oder, was meinen Sie? Naja, vielleicht doch. In meiner Generation gibt es auch noch viele Heinz-Jürgens, Heinz-Herberte, Heinz-Geörge, Heinz-Wilhelms, Heinz-Herrmänner ... oder eben alles mit Hans. Das geht auch ganz gut und wurde im-mer wieder gerne genommen: Hans-Walter, Hans-Martin, Hans-Peter ... oder Horst. Ja. Horst-Peter zum Beispiel. So heißt der Fotograf aus Krefeld, mit dem ich letzte Woche noch das Wahnsinns-Fotoshooting in New York gemacht habe. Die Amerikaner haben sich scheckig gelacht über seinen Namen. „Horse-Peter“, haben sie gesagt, „the talking horse, hahaha.“ Ich muss wieder grinsen, wenn ich daran denke. War toll mit Horse-Peter in New York. Jetziges Ziel: Schwattmecke.
„Heinz-Nöbbät?“, fragt der grüne Oppa jetzt noch mal und schaut mich lange und prüfend an. Dabei kneift er seine listigen Äugelchen zusammen. Immer wieder scheint er mich abzuscannen und mit Bildern auf seiner internen Festplatte zu vergleichen. Nä, der Vergleich ist nicht gut. So was hat der Oppa noch nicht.
„Ja“, sage ich ergeben. „Ich bin Heinz-Norbert.“
Und dann geht ein Leuchten über sein zerfurchtes Gesicht und er bewundert mich wie eine Sonnenfinsternis, die nur alle sechsundzwanzig Jahre zu sehen ist.
„Wars abba lange nich mehr hier, mein Gunge!“
Mein Junge? Aber es stimmt. Ziemlich lange. Aber woher will er das denn wissen und was geht ihn das überhaupt an?
„Ja, kennze mich denn char nich mehr?“, fragt er jetzt mit Grinsebacke, aufgerissenen Äugelchen und hochgeschobener grüner Agro-Kappe. Er taut so langsam auf, scheint mir. Ist gar nicht mehr so auf Randale aus.
Jetzt fängt es dafür aber nun bei mir an zu rattern. Wer ist dieser alte Mann? Habe ich so jemanden überhaupt schon mal gekannt? Grün, Hühnerscheiße, Dreizack … ich versuche alle Details irgendwie zusammenzubringen, aber ich komme zu keinem verwertbaren Ergebnis.
„Nee“, sage ich daher nur.
„ONKEL WILLI BINNICH!“, brüllt er mich da plötzlich ganz freundlich an. „Brockmanns Willi, Mensch, das gibbs donnich, du dösigen Tuppes!“
Schutzmann bellt und steht wieder auf. Das Haltbarkeitsdatum seines Herrchenbefehls ist wohl endgültig abgelaufen.
Willi Brockmann. Onkel Willi. Ja, die Synapsenmaschine läuft zwar noch aber es macht plötzlich schon ganz eindeutig Klick. Und „dösigen Tuppes“, nett gemeint, natürlich!, hat ja eigentlich nur immer einer zu mir gesagt. Ich muss einfach nur mal so etwa vierzig, fünfzig Jahre zurückdenken. Kein Problem. Der Mann, der hier gerade meinen Zeitplan gehörig durcheinanderbringt, ist sicher siebzig oder achtzig … oder älter? Wie alt wird man denn in so einer Urgegend? Manche Leute in der sibirischen Einöde oder in mongolischen Steppendörfern werden ja schon mal weit über hundert.
Aber das ist er.
„Onkel Willi!“, brülle ich zurück und grinse dabei jetzt ebenfalls übers ganze Gesicht. Ja, sicher. Das ist ja Onkel Willi! Und dann steige ich endlich aus.
„Ja, sachich doch“, meint er achselzuckend. „Hab' euch Kindern doch früher immer ma ’n paar Klümpkes mitchebracht oder ma paar Chroschen für’n Eis checheben, dir un deim Bruder, dem Bernd.“
Ja, Bonbons und Kleingeld. Und das ist also Onkel Willi, der drahtige und eigentlich erstaunlich gut aussehende Mann aus meiner Kindheit. Wenn Vater nicht zuhause war – und er war häufiger unterwegs auf Montage für eine Baufirma –, war Onkel Willi oft bei uns. Meine Mutter mochte ihn wohl ganz gerne. Und er sie wohl auch.
Ich sehe mir den hutzeligen Mann, diesen Gegenwarts-Onkel-Willi, jetzt so aus der Nähe an und stelle fest, dass er sehr viel kleiner geworden ist als ich.
„Dein Vatter hat mich ja dann vom Hoff chegaacht (,gejagt‘ soll das heißen), weil ich ja ma ’n Krösken mit der Hilde hatte, woll ... VOR seiner Zeit, natürlich. Knapp davor. Abba dat hat ihm nich chepasst.“
Noch mal Achselzucken, verschwörerisches Grinsen und Augenkneifen. Er hatte was mit meiner Mutter? Na, guck mal einer an. Das habe ich allerdings nicht gewusst. Und dann sieht er mich wieder an, so ganz verträumt irgendwie, und grinst über beide pausigen Backen, die jetzt sogar eine gewisse Röte zeigen.
„Dattich dich nomma seh’, woll“, sagt er dann und holt ganz tief Luft, um sie dann lange und schnaufend durch die Nase wieder rauszulassen. Aber dann reißt er sich zusammen und sagt: „Weiße, dat mit der Hilde … ach … ich kann da nich zur Beäärdigung heute. Dat is zu traurich für mich. Ich chlaub, da krichich ’n Herzkasper un fall mit ins Chrab, woll.“
Ich nicke nachdenklich, ja, das ist zu riskant, das leuchtet mir ein.
„Getz wird et abba höchste Zeit für dich, mein Gunge, sons kommsse noch zu spät.“
Oh, er hat recht. Ich muss los.
„Mensch, Onkel Willi, ich komm’ auf jeden Fall noch mal bei dir vorbei.“
„Ja, dat wär’ sskhön … abba getz ersma ’ne sskhöne Beärdigung, woll!“
Und dann bellt Schutzmann noch einmal und Onkel Willi gibt mir die Hand. Scheißegal. Ich sehe die Hühner- oder Hundekacke an seinen Fingern, aber ich greife trotzdem beherzt zu. Ist ja schließlich Onkel Willi. Und dann umarme ich ihn auch noch mal. Wenn schon, denn schon. Er bleibt etwas steif dabei und grinst verlegen. Schutzmann kommt vorsichtig näher, beschnüffelt mich und wedelt mit dem Schwanz.
„Heißt der wirklich Schutzmann?“, frage ich Onkel Willi.
„Jou. Sskhutzmann.“
Der Hund spitzt die Ohren.
Dann traue ich mich noch, den braunen Riesen anzufassen, allerdings möglichst ohne seinen Sabber an die Hose zu bekommen, und er erhöht sofort seine Schwanzwedelfrequenz. Guter Hund.
So. Jetzt aber. Scheibe hoch, Gang rein, wohin mit der Kacke …? Fußmatte! Und los. Der Porsche faucht geschmeidig und legt sich schwer ins Zeug. Die Hühner sitzen inzwischen alle auf einer Stange in so einer Art Hühnertreff-Gemeinschaftsbaracke auf dem Hof, die wahrscheinlich Onkel Willi höchstpersönlich gezimmert hat.
Kopfschüttelnd und breit grinsend versuche ich, mich auf die Straße zu konzentrieren, um endlich, endlich anzukommen. Weit kann es jetzt nicht mehr sein.
Onkel Willi. Phh. Das gibt’s doch nicht. Na, der hat sich aber gefreut über mich. Mmh. Und schon fällt mir ein alter, netter Reim ein.
Ein Bauer stand im Sauerland
und dachte drüber nach,
dass Hühner auffe Stange sitzen,
Tauben auf’m Dach.
Inzwischen in sein’ Hühnerstall,
da tobt der Fuchs ganz munter
und holt de Hühner nach und nach
von ihrer Stange runter.
2
Bütterkes mit Sskhinken
„In mümpfundert Mepern mechts abmiegen“, verkündet die freundliche Frauenstimme meines Navigationsgerätes, die ich aber leider kaum verstehen kann. Denn weil so ein Gerät ja eigentlich nicht in so ein altes Auto gehört, habe ich es tief ins Handschuhfach verbannt, damit es auch ja keiner sieht. Bloß nichts Modernes in meinem Klassiker! Alles stilecht. Das muss schon sein. Leider hört man das nützliche Gerät dann aber auch nicht so gut und die schöne Stimme ist viel zu dumpf, so, als würde man der guten Frau beim Sprechen den Mund zuhalten oder vielleicht hat man sie auch enführt und geknebelt.
Da bin ich also wahrscheinlich die ganzen letzten zwei Stunden irgendwie in einer Art Autofahrertrance gewesen, immer den Blick an den sich ständig windenden, hypnotisierenden Mittel-streifen geklebt, bis diese Hühnerscheiße hier mich wieder ins Leben zurückgeholt hat. Aber trotzdem bin ich in diesem Zustand über endlose Sträßchen und Kurven, Hügel, Berge und Täler wohl doch ganz in die Nähe meines gewünschten Zieles gekommen. Jedenfalls sieht es ganz danach aus. Und ich hab sogar jemanden aus meinem früheren Leben getroffen.
Der Himmel sieht nicht so ganz echt aus. Die Sonne scheint zwar noch, aber am Horizont nähern sich bedrohlich dicke, schwarze Wolken und ein kühler, leichter Wind kommt auf. Ich glaube, dass es bald ganz furchtbar zu regnen, zu gewittern, zu unwettern, nein, zu plästern oder schütten, wie man hier sagt, anfangen wird.
„Schütten“ übrigens immer ohne die Ts aussprechen. Sauerländisch. Da müssen Sie unbedingt drauf achten. „Schü’en“, sagt man hier. Und statt „Kotelett“ sagt man zum Beispiel „Ko’le’“. „Scho’land“, „Ko’en“ (Kotten) und so weiter.
So ist das eben im Sauerland. Normal. Machen Sie sich nix draus.
Meine Güte, wie lange war ich eigentlich wirklich nicht mehr hier?, denke ich, als der Porsche wieder alleiniger, zufriedener Chef einer Straße ohne Hühner ist und jetzt ordentlich Tempo macht – ich hab’s ja echt eilig. In zwanzig Minuten soll es schon losgehen mit der Trauerfeier.
Zehn, zwölf Jahre ist es bestimmt her. Ja, zu Vaters Beerdigung, wahrscheinlich. Und Onkel Willi habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen. Ich hatte ihn, ehrlich gesagt, eigentlich total vergessen. Den lustigen Onkel Willi, immer die Taschen voller Klümpkes für uns Kinder.
Und war ich sonst mal wieder hier, seitdem ich nicht mehr hier bin? Also, seitdem ich damals quasi Hals über Kopf hier abgehauen bin? Naja, ist lange her. Und es gibt da ein paar Leute, die sicher immer noch hier wohnen und möglicherweise nicht besonders scharf drauf sind, mich noch mal zu treffen. Es sei denn, um mir vielleicht eine reinzuhauen. Hoffentlich ist es lange genug her … und vielleicht hauen sie ja nicht so feste. Aber dann hätte ich es wenigstens endlich hinter mir. Ich erzähle Ihnen gleich noch mehr davon.
Eigentlich hat mich auch nichts wieder hierhingezogen. Ich war immer ziemlich froh, aus dem ganzen Misthaufen-Milieu endlich rausgekommen zu sein. Düsseldorf. Ja. Das war schon was ganz Anderes. Die feine, große Welt ohne Misthaufen, Gülle und ewige Kirchenglocken. Doch Mutter wollte ich natürlich schon mal ab und zu besuchen und hatte es ihr auch immer wieder versprochen. Und ich hatte es auch wirklich vor. Ja. Bestimmt. Und so weit war es ja nun auch nicht vom feinen Dorf an der Düssel bis hierhin in dieses sauerländische Outback. Aber irgendwie hat es doch nie geklappt. Hat nich’ sollen sein!
„Dat is mir doch ’n chanz dummen Spruch, Heinz-Nobbät“, sagt das Sauerland da zu mir und ich glaube, es hat recht. „Du hast doch in dein’ Düsseldorfer Luxusleben char nich an mich chedacht.“
Ja, kann sein, liebes Sauerland. Wahrscheinlich hast du sogar recht.
Zwei- oder dreimal hatte mein Bruder Bernd und sein wuchtiges und überaus patentes, liebenswürdiges Vollweib Sabine, die beide zusammen mit Mutter in ihrem, also, unserem alten Haus in Schwattmecke leben, sie zu mir nach Düsseldorf geschleift, „damit we uns nich so chanz ausse Augen verlier’n”.
Aber gerne hat Mutter das nicht mitgemacht.
„Da kannze ein’ drauf lassen! Düsseldorf, dat is nix für mich“, hatte Mutter sich immer beklagt und war immer heilfroh, schnell wieder wegzukommen. Und wenn ich ehrlich bin, dann war ich das eigentlich auch. Denn Mutter brachte immer eine gewisse Instabilität in mein schönes, feines Düsseldorfer Überholspur-Leben.
Wie Mutter einmal im „Bugatti’s“, dem angesagtesten Ess- und Trefftempel der Düsseldorfer Werbeszene, der meinem guten Freund Hugo gehört, die Scampis in hohem Bogen wieder ausgespuckt und dem Ober hinterhergerufen hat, solche „eckeligen Würmer würd’ man in Schwattmecke noch nich ma an de Schweine verfüttern“, das war in dieser Umgebung unterhaltsam, befremdlich und schockierend zugleich. Und als sie dann noch lauthals „Bütterkes mit Ssckinken“ bestellt hatte, „aber zack, zack, Herr Oberst!“, sind wir dann auch nicht mehr so lange geblieben. Naja, ich hatte den Laden ja selbst vorgeschlagen. Und die Scampis auch. Blöd von mir. Das musste ja schiefgehen.
Mutter Hilde war eben durch und durch Sauerländerin und da gehörte sie auch hin – nach Schwattmecke.
Schwattmecke, Schwattmecke,
dat is’ nich umme Ecke,
dat is’ im schönen Sauerland,
den meisten Leuten unbekannt.
Sylvia wollte sowieso nie hierhin. Ist ja noch nicht mal heute dabei. Sylvia ist meine Frau … also, eigentlich nur Freundin oder, wie sagt man, Verlobte, nein, das ist zu altmodisch, vielleicht Partnerin, obwohl manchmal … na, dann eben Lebens-abschnittsbegleiterin … ach, irgendwie haben wir uns da noch nicht so richtig festgelegt, was wir eigentlich so für- oder eben manchmal auch gegeneinander sind … sagen wir also, die sehr attraktive, zwölf Jahre jüngere Frau, mit der ich seit vier Jahren zusammenlebe – immer im hart umkämpften Niemandsland zwischen endgültiger Trennung und überzeugter Liebesheirat. Ja. So kann man mit der Formulierung eigentlich zufrieden sein.
Sylvia ist ganz toll und ganz furchtbar. Je nachdem. Wir passen überhaupt nicht zusammen, aber irgendwas an ihr lässt mich immer wieder ihre schlechten Eigenschaften vergessen. Ich denke mal, ihr geht es genauso mit mir.
Gestern Abend war sie wieder mal ganz furchtbar. Ich wahrscheinlich aber auch. Es ging eigentlich ja nur darum, dass sie trotz vollgequetschter Kleiderschränke aber auch rein gar nichts anzuziehen hatte für eine Beerdigung und dass mir das natürlich fuuurchtbar leidtat. Oooch, gar nichts anzuzieh’n, du Arme! Dann malen wir dich eben schwarz an, mit einer weißen Blume auf dem Hintern. So was und noch ein paar ähnliche Vorschläge habe ich ihr gemacht, weil es immer dasselbe Theater ist mit ihren scheiß Klamotten. Entschuldigen Sie! Ist mir so rausgerutscht. Naja, und am Schluss hat sie die Tür geknallt, aber vorher noch gesagt, dass sie dann eben überhaupt nicht mitkäme. Und dabei ist es dann geblieben. Von mir aus. Ich habe auch keine Lust mehr, mich darüber zu ärgern. Heute nicht.
„Du und deine Sauerländer!“, sagt sie immer schon so abwertend, aber ich habe es ihr noch nicht einmal so richtig übel genommen, weil ich diese Käffer im Hühnerscheiße-Niemandsland ja auch irgendwie ziemlich satthatte. Aber wenn ich mir dann doch mal fest vorgenommen hatte, wenigstens Mutter zu besuchen, kam doch glatt immer in letzter Minute irgendetwas dazwischen, weil mal wieder was Wichtiges in der Agentur zu tun war.
Ach ja, die Agentur!
Ich mache Werbung, Reklame, Kommunikation, müssen Sie wissen … wie immer man diese zwielichtige Branche vornehm benennen will. Man könnte auch etwas bösartig sagen, wir bescheißen einfach nur sehr professionell die Leute und verdienen ’ne Menge Geld dabei. Das ist eigentlich schon alles. Man könnte auch sagen, wir geben den ansonsten ja völlig hilflosen Personen, die da draußen in den Supermärkten, den Einkaufsmalls und überhaupt so im Leben zwischen den marktschreierischen und überall lockenden Angeboten und Versprechungen umherirren, „Kaufempfehlungen“ für gewisse Produkte. Wir helfen da nur. Phh. Aber: Wir müssen die Hersteller und Vertreiber dieser Produkte überzeugen, dass wir am effektivsten und lautesten für ihre Produkte schreien können und ihnen dann ihr Geld dafür aus den Taschen ziehen. Das ist eigentlich das Schwerste und der leider etwas demütigende Teil dieser Arbeit.
Und ich bin sozusagen der wichtigste Mann in der Agentur. Kreativ-Chef. ECD – Executive Creative Director – Head of Creation. Toller Titel, oder? Unentbehrlich. Hochbezahlt. Mr. Wichtig. Aber dafür auch Niggersklave in goldenen Ketten – rund um die Uhr.
Bölkemeyer & Friends heißt die aufstrebende Düsseldorfer Reklamefabrik mit immerhin fast einhundert hektischen Angestellten. Und Sylvias Vater, Arno Bölkemeyer, ist der Chef. Massa Arno. Also gut, eigentlich ist ER der wichtigste Mann, natürlich. Und er ist mein Vielleicht-Schwiegervater. Mal sehen. In ein, zwei oder drei Jahren setzt der Alte sich wahrscheinlich zur Ruhe, ich könnte praktischerweise seine Tochter heiraten, den Laden übernehmen und viel, viel weiteres schönes Geld einsammeln bis ans Ende eines wohlhabenden, unbeschwerten Daseins.
Schöne Vorstellung eigentlich. Und wahrscheinlich mache ich das auch. Na klar, mach ich’s. Ich meine, ich bin ja nicht blöd. Das ist die Chance meines Lebens. Und was soll ich sonst tun?
Aber erst in ein, zwei oder drei Jahren. Vielleicht auch später. Im Moment muss ich jedenfalls noch Ideen liefern, Konzepte erfinden, die Nächte durcharbeiten und eben Kunden überzeugen.
Aber vor allem muss ich Arno überzeugen. Ich muss ihm zeigen, dass ich der Richtige bin, um seine Agentur weiterführen zu können. Er muss wissen, dass man sich auf mich verlassen kann, dass ich die richtigen Entscheidungen fälle, dass ich immer und voll für die Agentur da bin. Die Betonung liegt auf „immer“. Also los, Flottmann, dann hau rein! Ackern und ackern und ackern – und da ist es natürlich klar, dass ich überhaupt keine Zeit habe. Für nichts.
„Vorwicht! Gepfwindikeitsbeschwänkung!“
Ich drehe TV-Spots, kreiere Anzeigenkampagnen, entwerfe Visionen für unsere Kunden, treffe Entscheidungen, bin ständig unterwegs, Vielflieger natürlich, ich bin einfach mittendrin in dieser gnadenlosen Reklamemühle, die sich immer dreht. Tag und Nacht. Manchmal hab’ ich echt große Lust, in den berühmten Sack zu hauen. Aber feste. Doch das geht natürlich nicht. Und es darf auch keiner wissen, dass ich das möchte, weil es ja auch keiner verstehen würde.
Zum Beispiel gestern: Was gab es da für ein Riesentheater, als ich sagte, ich sei heute mal nicht da?
„Wie, Sauerland?“, haben sie regelrecht angewidert gefragt. „Wo ist das denn? … Beerdigung? Deine Mutter? Oh, ja ... tut uns leid … jaja ... schon vergessen … natürlich“, und zähneknirschend hat mir Arno Bölkemeyer dann freigegeben.
„Ja, ja“, hat er gesagt, „selbstverständlich“. Aber ich wurde den Gedanken nicht los, dass er es eigentlich nicht so richtig eingesehen hat, wo doch soooo wichtige Arbeit auf dem Tisch lag. „Aber sieh bloß zu, dass du übermorgen pünktlich wieder hier bist, Hardy!“
Hardy.
Ja, so heiße ich in der großen Werbewelt. Hardy Fetzer. Nicht Heinz-Nobätt Flottmann. Nä, das geht ja nicht. Eigentlich war der tolle, schnittige Name Hardy Fetzer für eine ganz andere zweifelhafte Karriere gedacht: Sänger. Das erzähle ich Ihnen auch später. Aber für die Werbung passt er doch auch ganz wunderbar. Man hat mir nämlich vor langer Zeit ziemlich schnell klargemacht, dass eine Karriere im Reklamegeschäft als Heinz-Norbert Flottmann quasi ausgeschlossen wäre. Das hat mir auch eingeleuchtet. Kein Mensch hat hier solche Namen. Nicht hier im Zentrum der Großkotz-Werbewelt. Und da habe ich diesen Namen einfach wieder hervorgekramt. Hardy Fetzer. Hört sich doch gar nicht übel an für so’n Reklameheinz auf der Überholspur, was meinen Sie?
Ich heiße und bin jetzt H. F., der Senkrechtstarter der Düsseldorfer Werbeszene, strahlender Stern am Firmament der Kreativen, der Mann, dem die Unternehmen ihre Millionen anvertrauen, um damit Werbekampagnen zu erschaffen, die die Welt erschüttern.
„Naja, nu chib ma nich so furchtbar an, Düsseldorfer!“, sacht dat Sauerland. Und es hat schon wieder recht.
3
Sskhöne Sskheiße!
„Mie mächste Mpfraße minks abmiegen“, mumpft die geknebelte Frau aus dem Handschuhfach.
Nee, Moment, das weiß ich jetzt aber besser, gute Frau. Entschuldigung, aber hier fahre ich mal geradeaus weiter, denn da war doch immer diese kleine Straße hinter den Feldern lang, die dann direkt bei Schwattmecke wieder auf die Hauptstraße führt.
Ich kenne mich doch tatsächlich immer noch ganz gut aus hier und brauche das Navi eigentlich gar nicht mehr. Ich erkenne doch glatt einiges wieder. Hier steht also immer noch die alte, schon immer recht baufällig wirkende Kirche von Schmelbecke und gleich müsste der Abzweig nach Langenei und dann nach Marbecke kommen. Diese Namen! Haben Sie schon jemals von Hundesossen oder Faulebutter gehört? Nein, sicher nicht. Das gibt’s nur hier. Das ist eben das Sauerland.
Das Sträßchen ist leider schlechter, als ich es in Erinnerung habe, aber es geht. Und wenn ich alle Löcher geschickt umfahre, dann setzt der Porsche noch nicht einmal auf.
„Bippe, wendem Sie bei ber mächsten Melegenheit!“
Jaja. Frau, Geknebelte, du meinst es ja gut, aber vertraue mir trotzdem. Ich bin hier zuhause!
Schwattmecke. Gleich bin ich da.
Ich blicke staunend wie ein kleiner Junge auf großer Fahrt, jetzt ganz wach, über geschwungene Hügelketten und Wäldchen, die sich zwischen Weiden, gewundenen Landsträßchen und kleinen, schnuckeligen Örtchen mit Kirchen in der Mitte, so wie es sich für’s Sauerland-Bilderbuch gehört, an die grünen Berge klammern. Jetzt ist die Sonne auch wieder kräftiger, der Frühling probt schon mal ein wenig, aber er ist sich noch nicht sicher. Ich überlege einen Moment, ob ich nicht das Cabriodach öffnen soll, lasse es dann aber doch. Das dauert ewig bei dem alten Modell. Keine Zeit. Und außerdem bin ich ja gleich da. Doch in diesem magischen Moment taucht der Probefrühling alles in ein sagenhaft intensives, tiefleuchtendes, sattes Grün. Und mit den drohenden schwarzen Wolken im Hintergrund sieht alles sogar noch dramatischer aus.
„Bippe wendem Sie metzt!“, sagt die geknebelte Frau und es klingt fast schon verzweifelt, als wolle sich mich unbedingt davon abhalten, in mein Verderben zu fahren. Ich höre gar nicht hin.
Meine Güte, ist das schön hier. Wahnsinn! Total kitschig eigentlich. Das habe ich auch vergessen. Es sieht aus wie in einem alten Heinz-Rühmann-Film. Dieser Heinz fuhr doch auch immer fröhlich singend in polierten Oldtimern auf kleinen, kurvigen Sträßchen durch Deutschland bergauf, bergab. Manchmal mit sei-nem Filmsohn dabei, dem er dann später „Lalelu“ vorgesungen hat. Das hab ich immer gerne gesehen. Sonntagsnachmittags, wenn mal einfach gar nichts los war. Früher. Da war öfter mal gar nichts los. Und heute?
Ich suche einen Sender auf dem natürlich auch stilechten alten Radio aus den Sechzigern, aber das ist nicht ganz einfach. Viele Störungen, schlechter Empfang, viel Gerausche. Was zum einem an dem alten Röhrenradio liegt, zum anderen aber auch an den vielen Hügeln und Bergen, die immer wieder den Empfang stören. Nach einigem Kurbeln bekomme ich den Sender „Sauer-land Radio“ einigermaßen störungsfrei rein. Na gut. Sie spielen nette alte Sachen. Bisschen rockig, ziemlich altmodisch. Aber mir gefällt’s. Gerade läuft Bachmann-Turner Overdrive mit „Roll on down the Highway“ aus dem Jahre 1975, wie der oberschlaue Moderator des Senders stolz verkündet. Na, warum denn nicht? Passt doch.
Kraatz. Jetzt hat der Porsche doch noch leicht aufgesetzt.
„Bippe wendem Sie metzt!“
Wenn ich jetzt nicht auf dem Weg zur Beerdigung meiner Mutter wäre, würde ich diese Fahrt glatt genießen. Eine tolle Tour durch die alte Heimat. Ach, Mutter, ich war, glaube ich, ein schlechter Sohn. Ich hätte mal öfter kommen müssen.
„Ja, ja, da muss ers’ deine Mutter stärben, dat du dich ma’ wieder seh’n lässt, Heinz-Nobbät Flottmann“, sacht dat Sauerland zu mir. Und es hat noch mal recht.
„Mach mpfünmpfig Mepern … mpfmpf … mpfmpf …“
Was hat die Geknebelte gesagt? Kein Wort verstanden. Und jetzt könnte ich sie gerade mal gebrauchen. Rechts oder links? Das weiß ich jetzt doch nicht mehr so genau. War hier nicht immer die alte Schule, oder bin ich jetzt auf den letzten Metern doch noch falsch gefahren? Ich öffne das Handschuhfach, um die arme Frau besser verstehen zu können. Aber sie sagt einfach nichts mehr.
Sprich, Frau! Du hast deine Freiheit wieder. Rechts oder links? Nichts. Sie schweigt eisern.
Ich versuche auf dem Display mit der Karte zu erkennen, wo ich bin und wo ich hin muss, aber das ist nicht so einfach. Mit einer Hand am Lenkrad versuche ich mit der anderen das Navigationsgerät etwas zu drehen, um besser sehen zu können.
Und dann erschrecke ich mich ganz furchtbar und es durchbrizzelt mich wie ein ernstzunehmender Elektroschock am Weidezaun für Ochsen.
Ich höre meine eigene Stimme aus dem Radio. Ja. Ich singe zu krachenden Gitarren und polterndem Schlagzeug: „Wo die Misthaufen qualmen, da gibt’s keine Palmen!“ Das bin ich, das ist unser alter Hit. Der Hit meiner Band von vor … vor … über zwanzig Jahren. Nein, noch viel mehr.
Rotzverdammi! Das hätte ich nicht gedacht, dass der noch gespielt wird. Ich versuche ganz aufgeregt, den Sender etwas schärfer zu stellen, denn ich selbst habe den Song doch auch schon ewig nicht mehr gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wie er so klingt. Das ist ja wie früher, denke ich, als wir diesen Song zum allerersten Mal überhaupt im Radio gehört haben. Da sind wir fast ausgeflippt, haben alle Fenster aufgerissen, das Radio bis zum Anschlag aufgedreht und haben mitgegrölt, damit auch bloß jeder mitbekommt, dass es jetzt endlich so weit ist und das Sauerland seine ersten großen Popstars hat.
Und dann passiert es. Irgendwie verliere ich zwischen Navi und Radio die Übersicht, das heißt, eigentlich habe ich sie zu diesem Zeitpunkt schon längst nicht mehr und schaue auch vor Aufregung schon längere Zeit gar nicht mehr auf das Sträßchen. Und da fühlt das Sträßchen sich wohl ziemlich vernachlässigt und schickt mir aus lauter Bosheit eine ganz gemeine Linkskurve, in der ich dann auch die Fahrbahn auf direktem Wege Richtung Straßengraben verlasse.
Panisch versuche ich noch, ein paar Korrekturen am drohenden Untergang vorzunehmen, reiße das Lenkrad noch hastig herum und trete mit voller Kraft auf die Bremse. Was man eben so macht, um vielleicht doch noch einige wichtige Körperteile retten zu können. Der erschrockene Porsche gehorcht mir zwar und macht einen mutigen Satz, rutscht dann aber doch sehr unsanft, unaufhaltsam und leise stöhnend über den Randstreifen in den Graben. Mit einem ziemlich schmerzhaften Krachen kommt er halb schräg rechts auf der Seite liegend zum Stehen. Mein Kopf prallt unerfreulich hart von innen gegen die Windschutzscheibe, weil dieser alte Wagen natürlich keine Gurte hat.
Aua. Aua. Aua.
Meine Güte. Was war das denn? Lass die Döppen (sauerländisch: Augen) ersma zu, Gunge! Wat du nich siehs’, dat gibbs auch nich.
Es dauert eine Weile, bis ich dann doch den nötigen Mut aufbringe, die Döppen wieder zu öffnen, und sich mir das Sträßchen aus der tiefergelegten Grabenperspektive erschließt. Tja, was soll man sagen? Das war jetzt wohl, egal wie lange man noch darüber nachdenkt oder versucht, es sich irgendwie schön zu denken, auf jeden Fall ein richtiger, echter Unfall. Ist ja wohl klar. So ein Mist. Für so was hab’ ich doch überhaupt keine Zeit jetzt! Oh, unerreichbares Schwattmecke!
Das Radio läuft immer noch. Der Song geht soeben zuende und ich habe wieder nicht richtig zugehört. Der Refrain „Wo die Misthaufen qualmen…“ verliert sich in der Ausblende und der Sprecher bekennt tief seufzend: „Ach, was für ein schönes Lied. Wenn man diese Band doch noch mal live erleben dürfte! Naja, ist ja schon so lange her. War aber ’ne schöne, wilde Zeit. Na, wer weiß, vielleicht kommen die Jungs ja noch mal zusammen.“
Der Typ ist ja völlig durchgedreht. Die Band noch mal live? Meine Band? Ach, halt die Schnauze, du Quatschkopp! Ärgerlich drehe ich den Kasten ab.
„In mümpfhundert Mepern haben Wie ihr Pfiel erweicht!“
Klappe halten! Alle!
Okay. Eins nach dem anderen. Quietsch. Unfall. Bumms. Graben. Kopf. Geht’s mir gut? Hat’s mich erwischt?
Ich blicke an mir herunter und kann erst mal keine Veränderung zu vorher entdecken. Alles scheint an den bisherigen Stellen geblieben zu sein. Ich kann meine Arme bewegen, was ich dadurch feststelle, dass ich sie beide in die Höhe hebe und mit den Händen wackele. Ententanz im Sitzen ginge also noch. Haha. Blödsinn. Meine Beine sind ebenfalls ohne erkennbare Funktionsstörungen, soweit ich das durch einfache Tests feststellen kann. Ich drehe den Kopf. Aah ja, der tut also weh. Mmh. Aber trotzdem, einmal rechts, einmal links gedreht. Er tut’s noch irgendwie in den Grundfunktionen. Ich kann sehen und hören. Jo. Och, dann geht’s mir doch gut. Man kann zufrieden sein.
Is’ der Kopp noch dran am Mann,
kannze mal von Glück erzählen.
Aber nächstes Mal schon, dann
könnten wicht’ge Teile fehlen.
Jetzt versuche ich also mal auszusteigen, um mir den Schaden an meinem schönen Auto anzusehen. Aber das scheint nicht mehr so einfach zu sein, wie vor diesem kleinen Zwischenfall. Die Tür klemmt und ich muss mich mehrmals von innen mit der Schulter dagegenwerfen, um sie endlich aufzubekommen. Dann rolle ich mich ächzend und schnaufend, aber doch dankbar heraus, bleibe dafür aber mit dem Ärmel meines Sakkos am Türgriff hängen. Bisken Schwund is’ ja immer. Dass ich dann mit den Füßen im braunbrackigen, nach Gülle stinkenden Wasser dieses bösartigen Grabens stehe, mir plötzlich, so im Stehen, dann doch leicht schwindelig wird, sogar ziemlich schummerig vor den Augen, und ich dann wie ein Sack auf die weiche, braune, schlammige Erde plumpse, ist mir dann auch egal. Das ist der Schock, sagt man ja. Ich hab’s jedenfalls überlebt … und ich will weiterleben, denn ich habe noch Ziele.
„Schwattmecke“, deliere ich vor mich hin und versuche mich nach einer kurzen Dunkelpause wieder aufzustellen.
Der Porsche sieht schrecklich aus. Halb im Graben versunken, mit Schlamm bis ans Dach versaut. Und die wirklichen Schäden kann ich noch gar nicht erkennen, weil er ja halb im Stinkewasser liegt. Ob man den jemals wieder hinbekommt? Ich kann gar nicht hinsehen.
„Schwattmecke.“ So langsam wird doch noch ein Schimpfwort daraus.
Ich halte mich an der Stange fest, die freundlicherweise zufällig direkt neben mir in den schlammigen Boden gerammt ist. Sie trägt das Ortsschild von Schwattmecke, wie ich erstaunt feststelle.
Ich bin also schon da. Schön.
Schweren Herzens lasse ich also mein Autowrack im Stich und schleppe mich die Straße entlang, in der Hoffnung, irgendwo den Friedhof zu finden.
Mannomann, dat is abba ’ne sskhöne Sskheiße, woll!
4
Hirn ohne Blut
Bei jedem Schritt quietschen meine nassen italienischen Edeltreter und das Schlammwasser quillt zwischen den feinen, ledernen Schnürsenkeln hervor. In meinem Kopf höre ich das Brummen eines ganz alten, leicht defekten Diesel-Generators, der allerdings auf meinem Kopf zu stehen scheint oder wenigstens direkt daneben. Ich möchte gar nicht wissen, wie der Schädel des Heinz-Norbert Flottmann jetzt aussieht. Es fühlt sich jedenfalls ganz oben an wie eine schnell wachsende Beule. Links oben kann ich sie fühlen, wenn ich ganz, ganz vorsichtig mit der Hand darüberfahre. Aahua. Kein Blut allerdings. Das ist doch schon mal gut. Immer schön optimistisch bleiben, Flottmann. Vielleicht ist es ja dann optisch doch nicht ganz so katastrophal, wie du denkst.