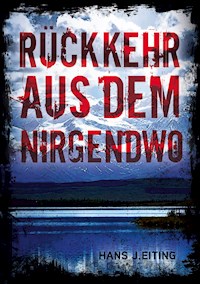
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Förster Robert Buchholz reist nach Alaska, um hier seinen Urlaub zu verbringen. Auf dem Inlandsflug von Anchorage nach Bettles, nördlich des 68. Breitengrades, gerät das Flugzeug in einen schweren Gewittersturm und muss weitab von der eigentlichen Flugroute notlanden. Es gibt zahlreiche Tote und Verletzte. Zu den Überlebenden zählen neben Buchholz unter anderem auch die Stewardess Jacqueline Garden, der Arzt Dr. Franz Keller, Hauptkommissar Jakob Schmitz und der zwielichtige Kneipenwirt Heinrich Biermann. Die unfreiwillige Schicksalsgemeinschaft merkt sehr bald, dass mit einer zeitnahen Rettung nicht zu rechnen ist und bereitet sich jenseits vom Nirgendwo auf einen Überlebenskampf im Wettlauf mit dem herannahenden Winter vor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Jungs Alexander und Marc
Dank an Regina und Vanessa
Inhalt
Prolog
Showdown
Schwierige Lage
Erster Konflikt
Aufbruch ins Ungewisse
Tal der Hoffnung
Zarte Bande
Zweikampf
Jagdglück
Die Höhle
Flucht und Verfolgung
Entführung
Befreiung
Bitterer Verlust
Alltag
Blizzard
Verschüttet
Wölfe
Fairbanks Fire Department
Die Rettung
Heimkehr und Abschied
Die Zeit danach
Zurück in die Vergangenheit
Epilog
Prolog
Man schrieb den 15. September, ein Tag im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, als die Räder des Flugzeuges die Landebahn der US-Airbase im Nordwesten der Vereinigten Staaten von Amerika berührten.
Die Landung verlief problemlos. Ein Ruck ging durch unsere Körper, als die Piloten die schwere Transportmaschine abbremsten, um danach zügig zu ihrer Parkposition zu rollen.
Die Turbinen wurden abgestellt. Sekunden später öffnete sich langsam die Heckklappe.
Wir nahmen unser Gepäck auf und betraten kurz darauf amerikanischen Boden.
Wir, das waren 18 Soldaten aus verschiedenen NATO-Mitgliedsländern, die in den nächsten acht Wochen an einem Winterüberlebenstraining in den unendlichen Weiten Alaskas teilnehmen durften. Zwei US-Soldaten sollten noch zu uns stoßen, so dass wir insgesamt zwanzig Lehrgangsteilnehmer zählen würden.
Zwei Mann aus jedem Land. Jeweils ein Offizier und ein Unteroffizier. Aus Deutschland waren das in diesem Fall der Hauptfeldwebel Fred Limbach und meine Wenigkeit, der Oberleutnant Robert Buchholz. Beide dienten wir in derselben Fallschirmjägerbrigade und hatten bereits gemeinsam ein sechswöchiges Sommertraining in den Everglades in Florida absolviert.
Wir wussten deshalb ungefähr, was uns erwartete, und das war kein Zuckerschlecken. Die Ausbilder würden keinerlei Rücksicht nehmen. Wer Schwäche zeigte, konnte seine Sachen packen und frühzeitig nach Hause fliegen. Dieser Blamage wollte sich natürlich niemand aussetzen. Das drohende Damoklesschwert über unseren Köpfen spornte jeden Einzelnen zu Höchstleistungen an.
Auf der Airbase wurden wir zunächst jedoch freundlich empfangen und zuvorkommend behandelt.
»Das ist wie bei Hänsel und Gretel. Erst machen sie dich fett und dann fressen sie dich auf«, knurrte Fred bei passender Gelegenheit.
Womit er nicht ganz unrecht hatte.
Drei Tage sollten wir auf dem Flughafen zubringen, bevor es dann ins erste Trainingscamp ging.
Ausrüstung und Waffen wurden ausgegeben. In einem großen Schulungsraum erhielten wir alle möglichen Instruktionen und Sicherheitshinweise. Abschließend noch eine gründliche Untersuchung beim Truppenarzt –mit dessen Okay marschierten wir geschlossen zum Friseur und sahen danach auf dem Kopf alle gleich aus.
Als letzte Maßnahme entfernten wir unsere Dienstgradabzeichen von den Uniformen, denn ab sofort spielte das keine Rolle mehr. Wir waren alle gleich und lediglich Lehrgangsteilnehmer – mehr nicht.
Chef–Ausbilder war Mastersergeant Bill Hancock, ein Vietnamveteran der Green Berets – hochdekoriert, knallhart, aber durch und durch ein fairer Soldat. Ihm zur Seite hatte man einen jungen Captain der US Army gestellt, der allerdings nur als Anstandswauwau diente, da immerhin zehn Offiziere an diesem Ausbildungsprogramm teilnahmen. Er trat während der gesamten Aktion selten in Erscheinung. Seinen Namen habe ich vergessen.
Am Morgen des vierten Tages war es dann soweit. Mit Sack und Pack bestiegen wir die gute alte Hercules C-130, eine viermotorige Transportmaschine und der Lastenesel der Air Force schlechthin.
Stunden später lag das Einsatzgebiet vor uns.
Ein Mitglied der Besatzung gab das Signal.
Aufstehen, Reißleinen einhaken, überprüfen, vorrücken.
Quietschend öffnete sich die Heckklappe. Als die Signallampe von Rot auf Grün wechselte und eine laute Hupe ertönte, liefen wir nacheinander hinten hinaus und fielen aus 1000 Metern Höhe in ein bodenloses Nichts. Ein Ruck, der Fallschirm öffnete sich und unter uns lag die unendliche Weite der Wildnis Alaskas.
Grandios und gleichzeitig auch Respekt einflößend.
Was erwartete uns da unten?
Die Landung verlief glatt. Von diesem Augenblick an waren wir auf uns allein gestellt. Hilfe von außen würde es ausschließlich in extremen Notsituationen geben. Vom ersten Tag an ging es richtig zur Sache, um es salopp zu formulieren. Die Ausbilder schenkten uns nichts. Tagesmärsche von bis zu dreißig Kilometern mit vierzig Kilogramm Gepäck auf dem Rücken waren normal, sofern es das Gelände erlaubte. Dessen Strukturen forderten die letzten Reserven eines jeden.
Einziger Lichtblick in diesen strapaziösen Zeiten war der Indiansummer. Die Farbenpracht und die Lichtspiele der herbstlichen Natur, in Verbindung mit der atemberaubenden Landschaft, hinterließen einen bleibenden Eindruck und entschädigten dadurch den geschundenen Körper und Geist.
In diesen Momenten entstand bei mir erstmalig der Wunsch, eines Tages hierher zurückzukehren.
Die Zeit verging. Als wir am Ende in die Hubschrauber stiegen, die uns in die Zivilisation zurückbringen sollten, herrschte bereits fünf lange Wochen tiefster Winter. Eisige Kälte und Schneemassen bereiteten dem Team erhebliche Schwierigkeiten.
Wir hatten gelernt, in einer extrem feindlichen Umwelt und unter noch extremeren Bedingungen zu leben und zu überleben.
Physisch und psychisch führte uns das an die Grenzen der Belastbarkeit.
Das später verliehene Ranger-Abzeichen trugen wir daher mit entsprechendem Stolz.
Jahre danach quittierte ich den Militärdienst, begann ein Studium der Forstwissenschaften und trat schließlich meine neue Stellung in der Lüneburger Heide an.
Eines Tages war es dann soweit. Angeregt durch Erzählungen eines befreundeten Jägers, der unlängst erst in Alaska gejagt hatte, fiel mir mein seinerzeit lose ins Auge gefasstes Vorhaben, dorthin zurückzukehren, erneut ein. Ich beschloss, meinen nächsten Urlaub da zu verbringen.
So geschah es dann auch. Das Schicksal nahm seinen Lauf.
Showdown
Alaska!
Land, in dessen Richtung der Ozean strömt, Great Land oder The Last Frontier, gleichzeitig die größte Exklave der Erde.
Das war mein Ziel.
Der International Airport liegt sechs Kilometer südwestlich von Anchorage.
Als Verkehrsflughafen ist er einer der größten Frachtflughäfen der Welt.
In seiner riesigen Abflughalle kam ich mir recht verloren vor. Dabei sah es hier nicht viel anders aus als auf den meisten Flughäfen, die ich in meinem bisherigen Leben kennengelernt hatte.
Hektische Betriebsamkeit sowie ein ständiges Kommen und Gehen beherrschen den Alltag eines solchen Verkehrsknotenpunktes. Lange Schlangen Reisender standen an den Abfertigungsschaltern der verschiedenen Luftfahrtgesellschaften. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derselben gaben sich alle Mühe, Fragen zu beantworten und den zahlreichen Wünschen der Fluggäste gerecht zu werden.
Fast pausenlos erfolgten Aufrufe über die Lautsprecheranlagen: »Mister X, bitte zum Informationsschalter!«
»Miss Y, letzter Aufruf zum Direktflug Nummer …!«
Auf Monitoren und überdimensionalen elektronischen Schautafeln wurden Informationen über Abflug- und Ankunftszeiten, Gates, startbereite und gelandete Maschinen angezeigt.
Lange Transportbänder schoben Mengen an Koffern und sonstigem Gepäck auf undefinierbaren Wegen in diverse Bereiche des Flughafens, von wo aus die Verteilung auf die jeweiligen Maschinen vorgenommen wurde – ein geordnetes Chaos. Die komplizierten Abläufe funktionierten allerdings scheinbar problemlos.
Passagiere stopften an Snackbars hastig noch einen Hamburger oder ein Sandwich in sich hinein. Andere tätigten letzte Einkäufe im Duty-Free-Shop.
Ausgerechnet dieser geschäftige Ort sollte nach meinen eigenen Wünschen und Vorstellungen für die nächsten vier Wochen das letzte Zusammentreffen mit der Zivilisation sein.
Hätte ich zu diesem Zeitpunkt auch nur ahnen können, wie sehr ich mich in dieser Hinsicht irrte und dass Monate vergehen würden, in denen ich weitab von eben dieser Zivilisation um mein bisschen Leben würde kämpfen müssen, ich wäre auf dem schnellsten Wege mit der nächsten Maschine nach Deutschland zurückgeflogen und hätte mir den kommenden Showdown erspart.
Doch das Schicksal meinte es anders mit mir.
Noch saß ich voller Erwartung und Vorfreude hier in Anchorage und wartete auf meinen Anschlussflug nach Bettles.
Bettles war ein kleines Buschdorf mit zirka einhundert Einwohnern und einer Handvoll Gebäuden im Yukon-Koyukuk Gebiet, am gleichnamigen Koyukuk River gelegen. Benannt wurde es nach Gordon Bettles, der während des Goldrausches in Alaska 1899 dort einen Handelsposten errichtete. Der Koyukuk River mündet nahe Bettles in den John River und dieser wiederum weiter südlich in den Yukon – der mächtige Yukon, der nach 3120 km im Yukon National Wildlife Refuge in das Beringmeer fließt.
Bettles war das vorläufige Endziel meiner Reise. Etliche Meilen nördlich des Polarkreises, nicht weit entfernt von den südlichen Ausläufern der Brooks Range, wollte ich den Anstrengungen der Zivilisation entfliehen und für einige Zeit in der Weite der Landschaft untertauchen.
Vorgestern hatte meine Reise in der Lüneburger Heide, etwa 100 Kilometer südlich von Hamburg, ihren Anfang genommen. Mit der Bahn ging es zunächst nach Frankfurt am Main. Am Abend desselben Tages startete ich an Bord einer Boeing 747 zum Nonstopflug nach Anchorage.
Der Flug verlief ausgesprochen ruhig. Frisch und ausgeruht – ich hatte unterwegs einige Stunden geschlafen – waren wir im nördlichsten und größten Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika gelandet.
Alaska! Seit vielen Jahren ein Traum. Ein Traum aus Sehnsucht, Romantik und Abenteuerlust.
Ich dachte dabei an meinen ersten Aufenthalt vor langer Zeit. Seither hatte mich dieses atemberaubende Land in meinen Gedanken nicht losgelassen.
Allein die Faszination, die von der Natur ausging, war überwältigend.
Unendliche Dimensionen, monumentale Berge und Schluchten, reißende Flüsse und Bäche, verträumte glasklare Seen, die riesige Weite der Tundra und die ewigen Wälder. Waldgebiete von unglaublichen Ausmaßen, ursprünglich und teilweise unberührt. Urwaldähnlich und nahezu undurchdringlich.
Viele Teile dieser Region hatte noch nie ein Mensch betreten.
Der Gedanke daran ließ mein Herz schneller schlagen.
Seinerzeit hatte ich mir vorgenommen, eines Tages zurückzukehren. Frei von jeder militärischen Disziplin, unabhängig und ganz auf mich allein gestellt, wollte ich abseits allen menschlichen Daseins Urlaub machen: jagen, fischen, die Natur genießen, faulenzen und die Seele baumeln lassen.
Eine Reihe von Jahren war seitdem vergangen. Meine Militärzeit lag längst hinter mir und, wie gesagt, nach einem Studium der Forstwissenschaften an der Universität Freiburg im Breisgau arbeitete ich jetzt seit einigen Jahren als Berufsförster in der Lüneburger Heide. Endlich erlaubte es mir die Zeit, meinen lang gehegten Traum in die Tat umzusetzen. Es trennten mich noch wenige Stunden von der Erfüllung meiner Wünsche.
In Bettles würde ich meine Ausrüstung vervollständigen. Im Reisegepäck befand sich die Adresse eines auf Abenteurer spezialisierten Ausrüsters.
Ein Freund aus Deutschland, der bereits mehrere Reisen nach Alaska unternommen hatte, gab sie mir kurz vor der Abfahrt. Er meinte, dass man bei Charles McIntire – so war der Name des Ausstatters – gut aufgehoben und beraten sei. Dort könne ich alles bekommen, was für einen Aufenthalt in der Wildnis notwendig sei. Zudem sei sichergestellt, dass Charlie mir kein unnützes Zeug aufschwatzen würde, um einen schnellen Dollar zu machen. Das war beruhigend, zu wissen.
In Gedanken versunken schlenderte ich durch die Hallen des Flughafens.
Die Uhr an der Wand zeigte an, dass es langsam Zeit wurde, ans Einchecken zu denken.
Suchend glitt mein Blick über die Abfertigungsschalter. Dann hatte ich die Fluglinie entdeckt, die mich in die nördlichen Gefilde transportieren sollte.
Es handelte sich um eine kleine Gesellschaft, die ausschließlich die Flughäfen in Alaska bediente.
Oftmals befanden sich diese Unternehmen in Privathand. Bei den Piloten handelte es sich in der Regel um ehemalige Air Force-Angehörige – robuste, raubeinige Zeitgenossen, für die Fliegen ein großes Abenteuer bedeutete.
Na, dann los. Wozu noch länger warten oder planlos in der Gegend herumlaufen?
Gut gelaunt präsentierte ich der jungen Dame am Check-in-Schalter das Ticket.
Lächelnd nahm sie dieses entgegen. Danach erfolgte eine kurze Überprüfung der Reservierung am Computer.
»Wo möchten Sie gerne sitzen?« fragte sie.
»Ganz hinten, bitte. Hinten sitzen immer die Überlebenden«, bemühte ich den alten Scherz.
Augenblicke später hielt ich die Bordkarte in den Händen. Die hübsche Stewardess sagte freundlich zu mir: »Bitte Gate Nummer 6, Flug 0731, Mister Buchholz. Wir lassen die Passagiere in einer Stunde einsteigen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise … und eine gute Zeit in der Wildnis.«
Ich stutzte leicht und antwortete: »Herzlichen Dank für die Wünsche, Miss. Aber woher wissen Sie, dass ich in die Wildnis möchte?«
»Wissen Sie, Sir, kaum ein Fluggast reist aus einem anderen Grund ausgerechnet nach Bettles. Viel mehr Wildnis geht nicht. Jagen, Fischen, Wandern und ein bisschen Pfadfinder spielen. Dazu passt auch Ihre rustikale Kleidung. Das kommt hier öfter vor. Passen Sie gut auf sich auf und kommen Sie heil zurück.« Sie strahlte mich erneut mit einem bezaubernden Lächeln an.
»Okay, Sie haben recht. Danke für die guten Wünsche.« Ich hatte total verdrängt, dass die Menschen in diesem Lande eine besonders ausgeprägte Beobachtungsgabe für ihre Umgebung, deren Bewohner und insbesondere für Fremde besaßen. Das konnte ich bereits während meines ersten Aufenthaltes in Alaska registrieren. Nun wurde das durch eine kleine, nette Geste der Stewardess in mein Gedächtnis zurückgeholt.
Mit einem freundlichen Kopfnicken verabschiedete ich mich und ging zur Abflughalle.
Gate Nummer 6, hatte das hübsche Girl gesagt.
Ach ja, da vorne war es schon.
Die automatischen Schiebetüren öffneten sich wie von Geisterhand und ich betrat die Wartezone. Außer mir hielt sich kein Mensch in dem kleinen Saal auf. Allein auf weiter Flur – mir sollte es recht sein. Da, wo ich hin wollte, hätte sowieso jeder andere gestört. Schließlich war es mein freier Entschluss, in die Einöde reisen zu wollen. Je eher man sich daran gewöhnte, umso besser.
Direkt neben dem Ausgang zum Flugfeld ließ ich mich auf einem der Stühle nieder und streckte genüsslich die Beine weit von mir.
Alaska, ich komme!
Noch einige Stunden Flugzeit, ein kurzer Zwischenstopp in Bettles und die Wildnis konnte mich mit Haut und Haaren verschlingen. Herz, was willst du mehr?
Mein Blick wanderte suchend umher und landete draußen auf dem Flugfeld.
Ich traute meinen Augen nicht. Dort stand eine zweimotorige Turboprop-Maschine – zweifellos eine Douglas DC 3, jenes sagenumwobene Transportflugzeug der amerikanischen Air Force aus dem Zweiten Weltkrieg. Dabei handelt es sich um das sogenannte Pendant zu unserer JU 52 – der alten »Tante JU«.
Besser bekannt ist die DC 3 vielen älteren Menschen als »Rosinenbomber« aus der Zeit der Blockade von Berlin durch die Russen.
Alleine vom Flugplatz Faßberg aus, bei uns in der Heide, haben diese Maschinen nahezu fünfhundertvierzigtausend Tonnen Kohle nach Berlin geflogen.
Unkaputtbar waren diese Vögel. Ich möchte nicht wissen, wie viele Flugstunden diese Mühle auf ihrem Buckel hatte – und sie flog noch immer.
Ziemlich bunt sah der Vogel aus. Auch wenn die Farbe nicht mehr ganz neu zu sein schien, das Fluggerät hinterließ auf den ersten Blick einen tadellosen Eindruck.
Das fing bereits gut an. Wo und wann ergab sich im Zeitalter der Düsenjets und Großraumflugzeuge die Gelegenheit, mit einer Propellermaschine zu fliegen, und dann auch noch ausgerechnet mit einem Oldtimer?
Unter Umständen war die Start- und Landebahn in Bettles sowieso nicht für große Maschinen ausgelegt. Die Flugzeit würde länger dauern, aber mir sollte es egal sein. Zeit stand ausreichend zur Verfügung und ich hatte es überhaupt nicht eilig. Dafür würde man mit Sicherheit die Reise genießen können, denn für im Normalfall flogen diese Flugzeugtypen nicht so hoch wie Jets.
Erinnerungen an jene Tage damals kamen auf und ließen mich schmunzeln.
Vor einigen Jahren waren wir auch mit einer Propellermaschine in den Norden geflogen. Allerdings hatten wir dort keinen Flughafen zum Ziel, sondern wurden in ungefähr eintausend Metern Höhe über Grund mit einem Fallschirm auf dem Rücken vor die Tür gesetzt. Hoch oben am Himmel schwebend begriff ich damals schnell, dass Weglaufen hier nicht möglich wäre. Unter uns gab es nichts als unendliche Weite. Nicht der Hauch einer Infrastruktur oder von Zivilisation war bis an das Ende des Horizonts zu erkennen.
Da hatte ich es dieses Mal doch erheblich besser. Der Service an Bord war garantiert auch angenehmer und die freundlichen Stewardessen nicht zu vergleichen mit dem bärbeißigen Master Sergeant der Green Berets, von dem uns seinerzeit die Hammelbeine langgezogen worden waren.
Meine Gedanken wurden jäh unterbrochen.
Im Gang, draußen vor dem Wartesaal, wurde es schlagartig laut. Stimmengewirr und fröhlicher Gesang waren zu vernehmen.
Da schien eine lustige Gesellschaft im Anmarsch zu sein.
Ob das meine Reisegefährten werden sollten? Das konnte dann aber noch heiter werden. Dem Grad der Fröhlichkeit nach zu urteilen, durfte da der ein oder andere Sangesbruder bereits tiefer ins Glas geschaut haben.
Verdammt, das konnte, nein, das durfte doch nicht wahr sein. Ich musste mich kneifen, um sicher zu sein, nicht zu träumen.
Im selben Moment öffnete sich die automatische Schiebetür und herein stürmte eine Schar Männer, die aus voller Brust und im schönsten Dialekt sangen: »Ich möch ze Foß noh Kölle jonn!«
Ich war sprachlos. Das haute glatt den dicksten Eskimo vom Schlitten. Da flog man beinahe an das andere Ende der Welt und auf wen traf man? Deutsche, Rheinländer – laut, heiter und gut gefüllt mit Alkohol. Da sollte doch …
Die Welt ist ein Dorf, pflegte mein Großvater bei derartigen Anlässen zu sagen. Hier fand sich die Bestätigung für seine Worte.
Lärmend verteilten sich die ›Sängerknaben‹ auf die freien Stühle und öffneten knallend die nächsten Bierdosen.
Einige der Neuankömmlinge verhielten sich zurückhaltender, aber die Mehrzahl war gut drauf, wie man das so landläufig formuliert.
»He, Jung«, ließ sich ein mittelgroßer, rundlicher Zeitgenosse mit lustigen Augen vernehmen.
»Willste auch ein Kölsch?«
Dabei hielt er mir auffordernd eine Dose Bier entgegen. Ich schaute ihn nur stumm an, dachte mir meinen Teil und schüttelte den Kopf.
»Wer nicht will, der hat schon.« Er sprach es aus und ließ sich schwer auf den Stuhl zurückfallen. Schnaufend, wie ein halb verdursteter Wüstenkrieger, kippte er das kühle Nass hinter die Binde. Ein Rülpser, begleitet vom Lachen und deftigen Kommentaren seiner Begleiter, zeugte von dem Genuss, den die ›Kugel‹ bei dem Zechgelage empfand.
Junge, Junge, wo hatte man diese Bande bloß losgelassen? Weitab von Frau und Kind – sofern vorhanden – und abseits jeglicher Arbeit und dem damit verbundenen Stress, fühlten sie sich so richtig wohl. Jedenfalls versuchten sie, in aller Klarheit deutlich zu machen, dass ihnen momentan die Welt gehörte. Ein Fass aufmachen, kräftig auf den Putz hauen, Alaska mit Licht kaufen, dieses Vorhaben stand ihnen förmlich ins Gesicht geschrieben. Die wollten Spaß haben, koste es, was es wolle. Ob sie sich dafür allerdings den richtigen Ort auf unserem Planeten ausgesucht hatten, wagte ich zu bezweifeln. Doch das sollte nicht mein Problem sein, jedenfalls jetzt und hier nicht.
Zwischenzeitlich hatten sich noch einige weitere Reisende zu uns gesellt. Diese betrachteten mehr oder weniger belustigt die ausgelassene Gesellschaft.
Mitten im schönsten Trubel betrat ein Angestellter der Fluglinie den Raum und versuchte, sich Gehör zu verschaffen. Mit Mühe gelang es ihm, sich gegen die gut geölten Stimmen durchzusetzen.
»Gentlemen!«
Diese Bezeichnung empfand ich momentan als leicht übertrieben.
»Gentlemen, bitte!«
Allmählich nahmen auch die Letzten der Anwesenden Notiz von ihm. Nach und nach ebbte der Lärm ab.
»Gentlemen, würden Sie bitte Ihr Handgepäck aufnehmen und mir zum Ausgang folgen? Die kurze Strecke zur Maschine können wir zu Fuß zurücklegen. Bitte!«
Mit einer Handbewegung deutete der Mann zum Ausgang.
»Zu Fuß? Oberaffengeil!«, rief einer aus der Gruppe. »Ade, ihr angenehmen Seiten der Zivilisation, von jetzt an sind wir Trapper!«
Die anderen lachten, nahmen dann aber brav ihre paar Habseligkeiten auf und folgten herumalbernd dem Mann in Uniform.
Als Letzter trat ich hinaus auf das Vorfeld des Flugplatzes und sog tief die frische Morgenluft in meine Lungen. Dem Himmel nach zu urteilen sah es so aus, als ob wir einen herrlichen Tag zu erwarten hätten.
Sollten die anderen nur die Maschine stürmen. Ich hatte es nicht eilig. So konnte ich in Ruhe meinen Sitzplatz abseits dieser lautstarken Komiker einnehmen.
Die Ersten kletterten bereits über eine kleine Metalltreppe am Heck in das Flugzeug und verschwanden im Rumpf.
Ich zog es jedoch vor, erst nach ihnen ins Innere des Vogels zu gelangen. Die Sitzplätze waren fest vergeben, Drängeln somit überflüssig. Trotzdem war es stets erstaunlich, zu beobachten, wie die Leute sich beeilten, um schnellstmöglich an Bord zu gelangen. In der Regel nützte ihnen das nichts, aber das hatte scheinbar mit dem Herdentrieb zu tun.
Nicht, dass ich keinen Sinn für Humor besaß, aber ich war nicht nach Alaska gekommen, um an Jubel, Trubel und Heiterkeit teilzunehmen, sondern um in aller Gemütsruhe zu entspannen. Dafür waren diese mitreisenden Spritköpfe wahrlich nicht die geeigneten Partner. Mochten sie nach ihrer Methode glücklich werden. Ich zog eine andere vor. Deshalb würde ein wenig Abstand nicht schaden.
Gemächlich stieg ich die Stufen der Minigangway empor und betrat die Kabine. Man musste den Kopf einziehen, um nicht am Türrahmen anzustoßen. Für Riesen waren diese Vögel nicht gebaut worden.
»Donnerwetter«, rutschte es mir ungewollt heraus.
Vor mir stand eine blendend gutaussehende Stewardess. Das maßgeschneiderte rote Kostüm betonte ihr formvollendetes Äußeres. Keck saß ein Käppi auf dem blonden, kurzgeschnittenen Haar. Das Gesicht, dezent geschminkt, war makellos. Doch am meisten faszinierten mich ihre Augen. Diese waren von einem solch tiefen Blau, dass sich die herrlichen Seen der Brooks Range vor Neid verfärbt hätten, wäre es ihnen möglich gewesen, das zu sehen, was ich sah.
Teufel auch, was gab es doch für schöne Frauen auf der Welt. Hier an Bord dieser alten Maschine hatte ich eine solche Luxusausführung allerdings nicht erwartet.
»Herzlich willkommen an Bord, Sir«, strahlte mich die Lady an und gewährte mir dabei den Blick auf eine Reihe perlweißer Zähne.
Diese Stimme. Mir wurde ganz merkwürdig zumute. Ich hatte das Gefühl, zu erröten, und schob mich, einen leisen Dank murmelnd, leicht verwirrt und verlegen an ihr vorbei. Im letzten Augenblick glaubte ich noch, ein belustigtes Flackern in den Augenwinkeln der Schönen entdecken zu können, aber das konnte täuschen.
Ich schalt mich selbst einen Narren.
Draußen in der freien Wildbahn war kein Platz für derartige Frauen. Damen dieser Art hielten sich überwiegend in vornehmen Kreisen auf, wo sich wohlhabende und interessante Männer um ihre Gunst bemühten.
Das hatte ich leider nicht zu bieten. Also, was sollte das Theater?
Ein wenig verärgert über mich selbst, nahm ich in der hintersten Reihe am Fenster auf der Backbordseite Platz.
Die Sangesbrüder vom Rhein und die wenigen anderen Passagiere verteilten sich auf den Sitzen vor mir. Es blieb eine Sitzreihe frei und somit genügend Freiraum zwischen ihnen und mir. Solange man mich in Ruhe ließ, sollte mir die ganze Sache auch egal sein.
Die geöffnete Tür der Pilotenkanzel erlaubte es, einen Blick in das rustikale Cockpit zu werfen.
Die beiden Flugzeugführer saßen bereits in ihren Sitzen und gingen die Checklisten Punkt für Punkt durch.
Eine zweite Stewardess bemühte sich zwischenzeitlich mit wechselndem Erfolg, die fidelen Rheinländer auf ihre Plätze zu verfrachten.
Die ersten leicht anzüglichen Bemerkungen waren zu hören. Im Interesse der Flugbegleiterin konnte ich nur hoffen, dass sie der deutschen Sprache nicht mächtig war.
Augenblicke später wurden die Türen geschlossen und verriegelt. Ein schrilles Pfeifen an der Backbordseite deutete darauf hin, dass der linke Motor gestartet wurde. Ein Knall, eine schwarze Abgaswolke aus dem Auspuffrohr und die Luftschraube begann, sich langsam zu drehen.
Immer schneller rotierte der Propeller, bis die einzelnen Blätter nicht mehr zu erkennen waren und zu einer schimmernden Scheibe verschmolzen. Nur Sekunden später wiederholte sich der gleiche Vorgang an der Steuerbordseite. Die beiden Pratt & Whitney Doppelsternmotoren mit jeweils 14 Zylindern liefen einige Zeit mit Vollgas, bis der Pilot sie abbremste. Das ganze Flugzeug dröhnte und vibrierte. In den Aufbauten und Spanten knackte es verdächtig unter der Belastung der frei werdenden Kräfte.
Aus dem Lautsprecher ertönte die Stimme meiner Stewardess.
Meine Stewardess – Blödsinn.
Na, eben jener jungen, gutaussehenden Dame, die mich so freundlich an Bord begrüßt und dabei auch kurzfristig aus dem Konzept gebracht hatte. Mir gegenüber konnte ich das schließlich eingestehen.
Aber das Thema war erledigt. So war es beschlossen. Daran gab es auch nichts mehr zu rütteln. Punkt und Ende.
»Sehr geehrte Fluggäste. Im Namen von Captain Mike Bronson und seiner Besatzung darf ich Sie herzlich an Bord zu unserem Flug nach Bettles begrüßen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord und eine gute Reise.«
Es folgten noch einige Angaben bezüglich der Flugzeit und Reiseroute sowie die üblichen Sicherheitsanweisungen und sonstigen Verhaltensmaßnahmen, doch da hörte ich bereits nicht mehr zu. Beim Blick aus dem Fenster erregte eine andere Sache meine Aufmerksamkeit. Die Türe zu dem Warteraum, in dem wir noch vor kurzem gesessen hatten, wurde erneut geöffnet. Ein Mann in Uniform lief von hinten auf das startbereite Flugzeug zu. Ihm dicht auf den Fersen folgte ein elf- bis zwölfjähriger Junge halbwegs im Laufschritt. Das Dominierende an dem jungen Mann war eine riesige rote Schirmmütze, die bedenklich auf seinem Kopf herumwackelte.
Im selben Moment klappte die Hecktür auf. Da die Einstiegtreppe bereits abgezogen worden war, packte der Uniformierte den Knirps und hob ihn in das startbereite Flugzeug.
»Na, das hat soeben noch geklappt. Beinahe wären wir ohne dich abgeflogen«, vernahm ich die Stimme der Flugbegleiterin. »Suche dir schnell einen Platz und schnalle dich bitte an. Es geht sofort los.«
»Danke, Miss, dass Sie auf mich gewartet haben. Mein Großvater wäre bestimmt traurig gewesen, wenn ich es nicht geschafft hätte, aber die Maschine aus Los Angeles hatte Verspätung«, krähte der Bursche selbstbewusst mit seiner jugendlichen Stimme.
Kurz darauf stand er neben mir und grinste mich an.
»Hey, Mister, ist der Platz neben Ihnen noch frei?«
Ohne erst lange eine Antwort abzuwarten, warf er seinen Rucksack auf den Boden zwischen die Vordersitze und ließ sich mit Schwung in den Sessel plumpsen.
»Na, Glück gehabt, wie?« Ich grinste zurück.
Noch bevor wir unseren Dialog fortsetzen konnten, ging ein leichter Ruck durch die Maschine und wir rollten an.
Vorbei an den Flughafengebäuden und -hallen, geparkten Flugzeugen und Hubschraubern führte der Taxiway zur Rollbahn. Dort schwenkte die Maschine ein. Ich war meinem kleinen Nachbarn noch behilflich, den Gurt zu schließen, da ging es auch bereits los.
Die Triebwerke heulten auf. Als der Pilot die Bremsen löste, wurden wir wie von einer unsichtbaren Faust in die Polster gedrückt.
Die Startbahn huschte immer schneller unter den Tragflächen vorbei. Das kleine Rad unter dem Heck hob als erstes vom Boden ab. Ehe wir uns versahen, schwebte die Maschine in der Luft.
Mit einem polternden Geräusch fuhr das Fahrwerk ein. Als der Flugzeugführer das Gas zurücknahm, sackte das Flugzeug unmerklich durch.
Die Entfernung zur Erde wurde rasch größer. Wenn man aus dem Fenster blickte, entstand der Eindruck, als läge unter uns eine Spielzeuglandschaft.
Anchorage, gegründet 1915 als Hauptquartier der Alaska Railroad, ist eine noch recht junge Großstadt. Umgeben von den Bergketten der Chugach Mountains, der Talkeetna Mountains und der Alaska Range sowie an den gezeitenabhängigen Gewässern des Cook Inlet gelegen, kann sich die Stadt von ihrer Lage her ohne Weiteres mit den schönsten Metropolen der Welt vergleichen. Beinahe dreihunderttausend Menschen leben in der größten Ansiedlung des nördlichsten und gleichzeitig westlichsten Bundesstaats der USA.
Rasch erreichten wir im Steigflug die Außenbezirke. Die Bebauung ließ langsam nach und hörte bald darauf ganz auf. Tief unten erstreckte sich die Wildnis in ihrer unendlichen Weite.
Über 1,5 Millionen Quadratkilometer groß war dieser Staat der USA. Das ergab zum damaligen Zeitpunkt mehr als viermal die Fläche meiner deutschen Heimat beziehungsweise circa die Ausdehnung von Zentraleuropa. Allerdings leben hier insgesamt noch immer weit weniger Menschen als in der Großstadt Hamburg – beinahe unvorstellbar. Da fiel es mit Gewissheit nicht weiter auf, wenn ich in den nächsten Wochen ein kleines Stückchen dieses gewaltigen Areals vorübergehend für mich in Anspruch nehmen würde.
Eine farbenprächtige Landschaft zog unten vorüber. Hügel und Täler wechselten sich mit Hochebenen und weitläufigen Waldgebieten ab. Mitten darin lagen herrliche, verträumt aussehende Seen. Größere und kleinere Flüsse schlängelten sich durch die Region, deren Wildheit man selbst aus dieser Höhe vereinzelt noch erkennen konnte.
Dann tauchte in einiger Entfernung schräg voraus ein monumentales Bergmassiv auf.
Da war er, der höchste Berg Nordamerikas, der Mount McKinley. Mit 6194 Metern ragte sein Gipfel höher hinauf als alles, was wir in Europa zu bieten hatten. Der Anblick des schneebedeckten Riesen war imposant und majestätisch zugleich.
Es ranken sich viele geheimnisvolle und auch dramatische Geschichten um den kältesten Berg der Erde, der tatsächlich ein ganzes Gebirge bildet. Zahlreiche, zum Teil erfahrene Bergsteiger aus aller Welt mussten dort in der Vergangenheit ihr Leben lassen. Sie hatten die Gefährlichkeit ihres Tuns und die Urgewalten der Natur falsch eingeschätzt oder auch unterschätzt. Eisige Temperaturen und fürchterliche Stürme konnten zu jeder Jahreszeit zu einer tödlichen Falle werden.
Langsam schob sich unser Flugzeug an dem gewaltigen Monument vorbei. Schätzungsweise betrug die derzeitige Flughöhe dreitausend Meter über Grund. Weiter ging es in Richtung Norden, unserem Reiseziel entgegen.
Ein leises Schnarchen unterbrach meine Betrachtungen und ließ mich aufhorchen. Der kleine Reisegefährte neben mir war sang- und klanglos eingeschlafen und schnaufte dabei wie ein Großer. Auch im vorderen Teil der Kabine herrschte Ruhe. Die lange Anreise und der Alkohol hatten ihre Wirkung getan. Jedenfalls rührte sich dort auch nichts mehr.
So sehr mich auch die unter uns vorbeiziehende Landschaft mit all ihren Sehenswürdigkeiten interessierte, das gleichmäßige Brummen der Motoren wirkte einschläfernd. Die Augenlider wurden schwerer und schwerer. Ich hatte Mühe, wach zu bleiben.
Da erschien die Stewardess, fragte freundlich lächelnd nach meinen Wünschen und betrachtete mich dabei länger als nötig.
Oder bildete ich mir das nur ein?
Einbildung ist auch eine Bildung, dachte ich im Stillen und lehnte dankend ab.
Bei ihrem Anblick begann mein Herz, schneller zu schlagen.
Junge, reiß dich zusammen, sagte meine innere Stimme.
Wie wahr. Erstens wartete garantiert irgendwo ein Mann auf diesen ›Engel der Lüfte‹, denn eine solche Lady lief mit Sicherheit nicht als Single durch das Leben. Zweitens war ich zur Erholung nach Alaska gereist und nicht, um irgendwelche aussichtslosen Frauengeschichten anzufangen. Wo und wie auch? In Bettles angekommen, würde ich kurze Zeit später in der Wildnis sein. Also abhaken. Vergiss es.
Mit einem leisen Seufzer lehnte ich mich in die Polster zurück und schloss die Augen.
Kurz darauf schlief ich wohl sein.
Das Knarren des Lautsprechers in der Kabinendecke weckte mich auf. Ein Blick zur Uhr zeigte, dass ich über zwei Stunden lang fest eingenickt war.
Blechern ertönte eine männliche Stimme: »Sehr verehrte Fluggäste, hier spricht Ihr Pilot. Im Augenblick nähern wir uns bedauerlicherweise einer ausgedehnten Schlechtwetterfront. Da ein Überfliegen leider nicht möglich ist, müssen wir nach Osten ausweichen, um so dem Unwetter zu entgehen. Danach werden wir versuchen, den Flughafen in Bettles in einem großen Bogen von Norden her zu erreichen. Die Flugzeit wird sich dadurch voraussichtlich um circa fünfzig bis sechzig Minuten verlängern. Wir bitten Sie, diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Schließen Sie jetzt vorsichtshalber Ihre Sicherheitsgurte. Es besteht kein Anlass zur Sorge. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.«
Kein Grund zur Sorge? Der Captain hatte gut reden. Schließlich war er ein Profi in solchen Dingen. Mir wurde bei einer derartig elenden Schaukelei, die wir gleich mit Sicherheit zu erwarten hatten, ganz anders zumute. Trotz meiner über vierhundert Fallschirmabsprünge fühlte ich mich auf der Erde am wohlsten.
Abwarten. Wir würden sehen.
Neben mir regte sich mein kleiner Nachbar. Der junge Mann kehrte aus dem Reich der Träume in die Wirklichkeit zurück. »Hallo, sind wir bald da?« Gähnend rieb er sich die Augen.
»Eine Weile wird es noch dauern. Wir müssen einen Umweg fliegen. Vor uns liegt ein Schlechtwettergebiet. Du brauchst aber keine Angst zu haben.«
»Habe ich auch nicht. Nur Großvater wird sich Sorgen machen, wenn wir nicht pünktlich ankommen. Er freut sich nämlich wahnsinnig auf mich. Zwei Jahre haben wir uns nicht mehr gesehen. Damals sind meine Eltern mit meiner kleinen Schwester und mir nach Los Angeles gezogen. Daddy hat dort einen neuen Job bekommen, wissen Sie. Hoffentlich erkennt Großvater mich überhaupt noch. Seitdem wir das letzte Mal zusammen waren, bin ich ganz schön gewachsen und sehe viel älter aus.«
Innerlich musste ich über diesen munteren Dreikäsehoch schmunzeln. Ach, konnten Kinder herrliche Sorgen haben.
Ohne lange Pause plapperte er weiter: »Großvater ist nicht nur mein bester Freund, nein, er ist auch ein berühmter Trapper und der bekannteste Outfitter in der ganzen Region. Fast alle Jäger, Angler und Abenteurer kaufen oder mieten sich ihre Ausrüstung und Verpflegung bei Charles McIntire. So heißt mein Großvater: Charles McIntire.«
Potzblitz, war das denn die Möglichkeit? Der Enkelsohn vom alten Charlie, den ich nach der Ankunft aufsuchen wollte, saß neben mir. Wie war das noch gleich mit der Welt und dem Dorf?
»Wenn das kein Zufall ist«, unterbrach ich den Redeschwall des Jungen, »da kannst du mich direkt mitnehmen, wenn wir gelandet sind. Dann brauche ich nicht erst lange herumsuchen, denn bei deinem Großvater wollte ich sowieso vorbeischauen. Dein Name ist dann auch McIntire, oder?«
»Klar doch. Benjamin McIntire, aber meine Freunde nennen mich Benny. Sie dürfen auch Benny zu mir sagen, Sir.«
»Vielen Dank, Benny. Ich heiße Robert Buchholz, komme aus Deutschland, will hier einige Wochen lang meinen Urlaub verbringen. Du kannst ruhig Robert zu mir sagen.«
»Au fein, du bist okay, Sir!«
Wir gaben uns die Hand und besiegelten damit die neu gewonnene Freundschaft.
»Warst du schon einmal in Alaska?« fragte mein junger Nachbar neugierig.
In knappen Worten erzählte ich ihm von meiner Vergangenheit hier draußen in der Wildnis.
»Okay, dann bist du wenigstens kein Greenhorn«, kommentierte er meine Ausführungen und grinste mich dabei an.
Ich nickte nur.
An den Tragflächenspitzen sausten die ersten Wolkenfetzen vorbei. Der Himmel ringsherum hatte sich bedrohlich verfinstert. Riesige schwarze Wolkentürme waren durch das Fenster zu erkennen. In der Ferne zuckten bereits erste grelle Blitze – ein fantastisches Schauspiel, das ich mir aber weitaus lieber vom Boden aus angeschaut hätte. Wehe, wenn wir da hineingerieten. Trotz des angekündigten Kurswechsels war es den Piloten nicht gelungen, das Unwetter zu umfliegen. Prost Mahlzeit.
Verstohlen schob mein kleiner neuer Freund seine Hand in die meine.
Aufmunternd lächelte ich ihm zu.
Da wurde die Maschine von einer heftigen Windböe gepackt und kräftig durchgeschüttelt. Vorne in der Kabine entstand Unruhe. Die vom Alkohol noch benebelten Schläfer erwachten nach und nach und schauten sich mit mehr oder weniger glasigen Augen in der Kabine um.
Das Flugzeug hüpfte und schlingerte zwischenzeitlich wie wild.
»Hurra! Jetzt ist Achterbahnfahren angesagt! Macht euch bloß nicht in die Hosen!«
Irgendwer hatte das gerufen und ernte dafür aber lediglich ein vereinzeltes gequältes Lachen. Die vorherige allgemeine Fröhlichkeit war doch eher einer großen Besorgnis gewichen.
Heftig einsetzender Regen klatschte an die Kabinenfenster und trommelte mit Vehemenz auf den Rumpf.
Wenn das bloß gut ging.
Kaum hatte ich dies zu Ende gedacht, da wurde es auf der Steuerbordseite schlagartig hell. Zugleich gab es einen ohrenbetäubenden Knall. Die Maschine wurde mit einem ungeheuren Ruck zur Seite geschleudert. Der Backbordmotor heulte in den schrillsten und grässlichsten Tonarten. Einige Passagiere im Bug taten es ihm gleich.
Mein Gott. Waren wir von einem Blitz getroffen worden? Das Licht begann zu flackern und erlosch dann ganz. Sekunden später ging die Notbeleuchtung an.
Angestrengt versuchte ich, aus dem Fenster zu schauen, was jedoch bei dem Geschaukel nicht auf Anhieb gelang. Auf unserer Seite konnte ich nichts Auffälliges erkennen. Mit einiger Mühe schaffte ich es dann doch – halb über Benny gebeugt – einen Blick auf die rechte Tragfläche zu werfen.
Mein Atem stockte. Ich merkte, wie mir das Entsetzen langsam den Rücken hinaufkroch. Der kalte Schweiß trat auf meine Stirn.
Dort, wo zuvor der Motor befestigt gewesen war, klaffte ein großes Loch. Losgerissene Metallteile flatterten im Wind.
Das konnte normalerweise nicht durch einen Blitzschlag passieren.
Der Rumpf eines Flugzeuges bildet einen faradayschen Käfig, der als elektrische Abschirmung wirkt. Da musste etwas vollkommen aus dem Ruder gelaufen sein. Ob Motorexplosion oder Blitz, in der Endkonsequenz blieb es egal.
Panik stieg in mir auf. Das war das Ende. Das musste das Ende sein. So schnell ging das also. Meine Gedanken überschlugen sich. Bloß jetzt nicht durchdrehen. Leichter gesagt als getan. Ich hatte mich öfter in beinahe ausweglosen Lebenslagen befunden, aber nie war ich mir dabei so hilflos vorgekommen wie in diesem Augenblick. Hier und jetzt waren wir einer äußerst gefährlichen Situation ausgesetzt und hatten keinerlei Möglichkeit, aktiv in das Geschehen einzugreifen. Das war das Schlimmste daran.
Der Lärm in der Maschine steigerte sich. Auch der Letzte hatte begriffen, in welchem Zustand sich unser Flugzeug befand und was das für uns alle eventuell bedeuten konnte.
Die Männer, die vor wenigen Stunden noch so fröhlich gewesen waren, riefen im Angesicht der sich anbahnenden Katastrophe ihre Angst in den Raum.
Erneut wurde das Flugzeug von schweren Sturmböen hin- und hergeworfen.
Die Türe zum Cockpit öffnete sich. Krampfhaft hielt sich der Copilot am Rahmen fest, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Er schrie gegen den Krach, der uns umgab, an: »Wir müssen runter! Fertig machen zur Notlandung! Festschnallen und Köpfe einziehen!«
Ein erneuter Ruck ließ ihn taumeln. Die Türe flog zu. Weg war er.
Da schien dann auch die Lautsprecheranlage ausgefallen zu sein und wer wusste, was sonst noch.
Der Bug der Maschine senkte sich.
Um uns herum war finstere Nacht, die lediglich von grell zuckenden Blitzen gespenstisch erhellt wurde. Ein einziges Inferno.
Benny saß mit vor Schreck geweiteten Augen neben mir und krallte seine kleinen Finger schweißnass in meine Hand. Alles Blut war aus seinen Wangen gewichen, so dass sein schmales Gesicht wie eine milchige Scheibe in dem fahlen Zwielicht schimmerte.
Ich schätzte, dass ich nicht viel besser aussah.
»Stürzen wir jetzt ab?«, rief er ängstlich.
Ich zuckte hilflos mit den Schultern: »Ich weiß es nicht. Die Jungs da vorne werden das hinbekommen, hoffe ich. Lege nun deinen Kopf auf die Beine und halte dir die Kissen vor das Gesicht. Nur Mut, es wird bestimmt gutgehen.«
Von unseren Sitzen riss ich die zwei Nackenkissen ab und reichte ihm diese. Artig befolgte er meine Anweisungen. Dann bereitete auch ich mich auf die Notlandung vor.
Notlandung!
Solch ein Blödsinn. Bei diesem Wetter. Bei dieser Sicht. Mit einer schwer beschädigten, beinahe manövrierunfähigen Maschine. Wie konnte man da noch von Notlandung sprechen? Was erwartete uns da unten? Volle Pulle hinein in den Wald oder gegen den nächsten Hügel. Aufschlag – Feuerball – Ende. Die Katastrophe war abzusehen; die Chancen weniger als gering. Da biss die Maus keinen Faden ab. Meinen Tod hatte ich mir anders vorgestellt. Seltsam, dass man dabei noch halbwegs gelassen bleiben konnte, wenn es erst soweit war. Der Anblick der Stewardess hatte mich heute Morgen mehr aufgeregt.
Welch ein Unsinn einem in einer derartigen Situation durch den Kopf ging. Normal war das nicht. Beinahe hätte ich gelacht. Galgenhumor, oder was auch immer – keine Ahnung.
Da! Wie aus dem Nichts tauchten die Spitzen der Baumwipfel unter uns auf. Wusste ich es doch, das gab eine Bruchlandung allererster Klasse. Heiliges Kanonenrohr.
Stotternd blieb jetzt auch die linke Turbine stehen. Die Luftschraube drehte kraftlos im Wind. Vermutlich hatten die Piloten das Triebwerk abgeschaltet, um das Explosionsrisiko bei der Landung zu verringern. Jeden Augenblick musste der Aufschlag erfolgen. Meine Hände umklammerten die Knie. Vor Anspannung biss ich mir die Unterlippe blutig.
Steil kippte das Flugzeug nach vorne ab und krachte Sekunden später mit unvorstellbarer Wucht auf dem Boden auf.
Instinktiv zog ich den Kopf zwischen die Schultern. Der Sicherheitsgurt schnitt tief ins Fleisch. Der Schmerz durchlief meinen Körper. Kreischendes und berstendes Metall verursachte einen Höllenlärm. Dazwischen ertönten die Schreie von in Todesangst versetzten Menschen.
Die Maschine bäumte sich auf, knallte erneut auf den Boden und rutschte pfeilschnell auf dem Untergrund dahin.
Ein heftiger Schlag war das Letzte, was ich wahrnahm. Mein Kopf wurde mit Wucht gegen den Vordersitz gerammt. Vor den Augen bildeten sich feurige Kreise; dann fiel ich in ein abgrundtiefes schwarzes Loch.
Schwierige Lage
Ein gleichmäßiges Rauschen und Trommeln war der erste Eindruck, den mein Gehirn registrierte.
Jemand sprach mit mir, jedoch konnte ich den Sinn der Worte nicht richtig erfassen.
Mein Schädel dröhnte und schmerzte, als ob eine Dampframme stets auf dieselbe Stelle schlagen würde.
Auf dem Weg zurück in die Wirklichkeit begann der Verstand, allmählich zu arbeiten.
Mühsam versuchte ich, die Augen zu öffnen. Wie durch Milchglas schimmerte die nähere Umgebung zunächst undeutlich und verschwommen.
Was war geschehen? Wo war ich?
Das Flugzeug, das Unwetter, der fürchterliche Aufschlag.
Ganz langsam kehrten die Erinnerungen an die letzten Sekunden der unfreiwilligen Landung zurück. Ich musste unbedingt wissen, was sich ereignet hatte. So ganz wollte das aber noch nicht gelingen.
»Er kommt zu sich, Miss. Er wacht auf. Schnell kommen Sie her. Jetzt schlägt er die Augen auf!« Das war Bennys Stimme, die da rief.
Also befand ich mich noch unter den Lebenden.
Mit einem Ruck richtete ich mich auf. Diese heftige Bewegung hatte auf meinen Kopf beinahe dieselbe Wirkung, als wäre direkt neben mir eine Handgranate explodiert. Aufstöhnend presste ich beide Hände gegen die Schläfen und blickte im selben Moment in das Gesicht meines kleinen Freundes.
Obwohl noch Tränenspuren auf seinen Wangen zu erkennen waren, versuchte er bereits ein zaghaftes Lächeln.
»Junge, komm her.«
Ich breitete die Arme aus, zog ihn an mich und hielt den kleinen Kerl, der immerhin soeben eine Bruchlandung überlebt hatte, fest an mich gedrückt. »Haben wir ein Glück gehabt, Sportsfreund. Wenigstens leben wir noch. Wie geht es dir? Bist du verletzt?«
»Nein, ich bin okay. Nur der Bauch tut mir vom Sicherheitsgurt ein bisschen weh. Du hast eine schöne Beule am Kopf. Sie schillert in allen Farben.«
Währen Benny so erzählte, blickte ich über seine Schulter und sah ein Paar wohlgeformte Damenbeine unmittelbar vor mir stehen.
Meine Augen wanderten weiter nach oben. Trotz der rasenden Schmerzen in meinem Kopf konnte ich mir ein Grinsen nicht verkneifen.
Vor uns stand ›meine‹ gutaussehende, elegante Stewardess – der ›Engel der Lüfte‹.
Wenn ich mir die Lady jetzt allerdings anschaute, konnte von Eleganz kaum noch die Rede sein. Sie erinnerte mich eher an einen Uhu nach dem Waldbrand.
Der Rock war eingerissen, ein Ärmel der Jacke fehlte. Ihre Haare waren zerzaust und trieften vor Nässe, ebenso wie der Rest der Schönheit.
Meine scheinbar etwas unverschämt wirkende Mimik und die taxierenden Blicke, mit denen ich sie betrachtete, machten sie sichtlich wütend.
Ihre tiefblauen Augen funkelten zornig, als sie mich mit rüdem Ton anfuhr: »Mister, sollten Sie es noch nicht bemerkt haben, wir sind mitten in der Wildnis von Alaska mit einem Flugzeug notgelandet. Die beiden Piloten und ein großer Teil der Passagiere sind tot oder verletzt. Wir haben pausenlos versucht zu retten, was noch zu retten ist. Das nur für den Fall, dass Sie als Gast unserer Gesellschaft Anstoß an meinem Äußeren nehmen sollten.« Sie holte tief Luft, um weiter zu reden. Doch da war es dann mit ihrer Selbstbeherrschung zu Ende. Die Mundwinkel begannen verdächtig zu zucken. In den Augen schimmerten Tränen. Sie kniete sich neben uns auf den Boden, schlug die Hände vors Gesicht und weinte.
Benny schaute mich fragend an. Mit weinenden Frauen konnte er noch weniger anfangen als ich. Vorsichtig, als könne er ihr wehtun, legte er seine kleine Kinderhand auf ihren Kopf und streichelte sanft ihr Haar.
Ich war leicht verwirrt. Was sollte ich tun? Am besten hielt ich den Mund und ließ sie sich ausweinen. Behutsam legte ich einen Arm um ihre Schultern. Da saßen wir nun: ein Häufchen Elend, im Wrack eines Flugzeuges, zwischen Trümmern und Toten, wie ich mich mit einem schnellen Rundumblick überzeugen konnte. Wie sollte es jetzt weitergehen?
In mir erwachte der Selbsterhaltungstrieb. Zunächst erschien es geboten, sich einen Überblick von dem gesamten Ausmaß der Katastrophe zu machen. Vermutlich lief bereits eine Suchaktion auf Hochtouren und wir konnten auf Hilfe von außen hoffen. Es gab viele Fragen, auf die ich so schnell keine Antwort parat hatte, aber es war an der Zeit, tätig zu werden.
Das Trommeln und Rauschen, das ich beim Erwachen aus der Bewusstlosigkeit zuerst vernommen hatte, war der Regen, der mit heftiger Gleichmäßigkeit hernieder prasselte. Just im Moment ließ er hörbar nach. Vereinzelt konnte man noch ein entferntes Donnergrollen vernehmen.
»Miss, hallo Miss Stewardess. Wir können hier nicht sitzen bleiben, sondern müssen Maßnahmen in die Wege leiten, damit uns die Rettungsmannschaften leichter finden können.«
Der Überlebenswille im Innersten eines jeden Menschen beflügelte mich. Es galt jetzt, zu versuchen, in der Praxis das umzusetzen, was ich vor Jahren in diesem Land geübt und gelernt hatte. Welche Ironie des Schicksals.
Meine Worte bewirkten, dass das Schluchzen leiser wurde und schließlich ganz aufhörte. Dann hob sie den Kopf und sah mich aus rotgeweinten Augen an.
»Hat jemand ein Taschentuch für mich?«
Benny kramte in seiner Hose und reichte ihr ein Papiertuch.
Sie wischte sich die Augen ab, putze die Nase und sah den Jungen mit einem dankbaren Lächeln an. »Sie haben recht, Mr. Buchholz, wir sollten nicht untätig herumsitzen. Vor allen Dingen müssen wir uns um die Verletzten kümmern. Übrigens heißt die Miss Stewardess Jacqueline Garden, ist siebenundzwanzig Jahre alt, kommt aus Anchorage, ist nicht verheiratet und kinderlos. Damit wären dann hoffentlich alle Fragen zu meiner Person beantwortet. Bevor Sie mich jetzt fragen, woher ich Ihren Namen kenne, Mr. Buchholz, wir haben eine Passagierliste an Bord – und nun los! Es gibt viel zu bedenken und zu tun.«
Über genügend Tatkraft verfügte diese junge Frau, das musste man ihr lassen.
»Ich heiße Benjamin McIntire«, krähte mein kleiner Freund. »Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Miss Garden!« Benny war ein wohlerzogener, richtiger Kavalier.
»Freut mich ebenfalls«, brummte ich.
Miss Garden und Benny erhoben sich. Bei dem Versuch meinerseits, aufzustehen, schlug jemand auf dieser verdammten Kesselpauke in meinem Kopf herum. Ich zog eine Grimasse und knurrte.
»Haben Sie starke Schmerzen?«, fragte Miss Garden.
»Es geht – nur, wenn ich lache.«
»Warten Sie, ich hole Ihnen eine Tablette und ein Glas Wasser aus der Pantry, danach lassen die Schmerzen hoffentlich nach. Sie haben sich beim Aufprall eventuell eine leichte bis mittelprächtige Gehirnerschütterung zugezogen. Damit ist nicht zu spaßen. Ich bin gleich wieder da.«
Mit Bennys Hilfe zog ich mich vollends in die Höhe und hielt mich leicht schwankend an der Rückenlehne eines Sitzes fest.
Da kehrte auch bereits meine selbsternannte Krankenschwester zurück und reichte mir die Medizin.
»Es geht auch ohne, danke«, wehrte ich ab.
»Keine Widerrede, runterschlucken!«
Eine Diskussion erschien nicht vielversprechend. So tat ich, wie mir geheißen wurde.
Das Flugzeug war ein einziger Trümmerhaufen. Das Cockpit fehlte und musste draußen liegen. Der vordere Teil der Kabine war zu einem Drittel eingedrückt worden. Mitten im Raum stand der Stamm einer gewaltigen Hemlocktanne.
Dieses Ungetüm hatte uns also so abrupt zum Stillstand gebracht und damit auch das so tragische Ende der Notlandung verursacht.
Der Anblick, der sich mir bot, war grässlich. Ich hatte in der Vergangenheit einiges erlebt, aber das hier überstieg jegliche Fantasie.
Die Körper furchtbar zugerichteter Menschen lagen auf dem Boden herum oder hingen teilweise noch in den Gurten ihrer Sitze. Alles ringsum war voll Blut. Es roch abscheulich.
»Miss Garden, bringen Sie bitte Benny nach draußen. Dieser Anblick ist nicht gut für ein Kind in diesem Alter.«
Für Erwachsene in meinem Alter auch nicht, aber das dachte ich lediglich.
Die Stewardess und der Junge kletterten über herumliegende Trümmer zu einem der geöffneten Notausgänge und von dort aus über die Tragfläche hinunter auf den Erdboden.
»Wir sind unten!«, hörte ich Benny rufen.
»Es ist gut, ich komme gleich nach!«
Suchend bahnte ich mir einen Weg in die Überreste des Bugs.
Da war beim besten Willen nichts mehr zu machen. Jede Hilfe kam für diese bedauernswerten Menschen zu spät. Unter den Toten befanden sich neben den so fröhlichen Rheinländen auch alle anderen in Anchorage zugestiegenen Passagiere, wie ich mit einiger Mühe glaubte, erkennen zu können.
Wer sie auch gewesen sein mochten, an diesem Ort hier hatte sie ihr Schicksal ereilt.
Ich verspürte ein Würgen in der Kehle. Dieses grausame Ereignis und die furchtbaren Bilder würden mir noch lange zu schaffen machen. Das war so sicher wie das Amen in der Kirche.
Frische Luft war dringend erforderlich, ansonsten würde ich mich gleich übergeben müssen. Den Weg zurück durch das Chaos ersparte ich mir und stieg vorne ins Freie – da, wo einst die Pilotenkanzel gewesen war.
»Miss Garden, Benny, ich bin hier!«
»Wir kommen!«, riefen beide wie aus einem Mund.
Wenige Augenblicke später standen sie neben mir.
Der Platz, an dem wir uns befanden, verschaffte mir einen brauchbaren Überblick von dem, was sich vermutlich abgespielt hatte.
Die stark beschädigte Maschine lag auf dem Grund eines schmalen Canyons. Ein ausgetrocknetes Flussbett oder nur eine Erdspalte aus grauer Vorzeit? An den Hängen zu beiden Seiten wucherten Gras und Buschwerk. Oberhalb der Schlucht, schätzungsweise in zehn bis zwölf Metern Höhe, begann sofort der Hochwald. Unser Notlandeplatz, eine Felsenrinne, war ungefähr einhundert Meter breit, achthundert Meter lang und verlief an den Enden hinter einer Biegung in beide Richtungen weiter. Die Wahrscheinlichkeit, diese schmale Spalte zu finden, lag bei eins zu einer Million. Der Zufall beziehungsweise das ganz große Glück dürften dabei ihre Hand im Spiel gehabt haben. Dann aber auch noch darin zu landen, war wahrlich eine Meisterleistung von Captain Bronson und seinem Copiloten. Die realen Chancen hielt ich für beinahe ebenso so groß, wie aus zehn Metern Entfernung ein Geldstück in den Einwurf-Schlitz eines Sparschweins zu werfen.
Glück im Unglück für die Überlebenden. Wer konnte das exakt beantworten? Länger darüber nachzudenken, wäre müßig gewesen.
Mein Blick wanderte weiter suchend umher.
Das zerstörte Cockpit lag am Anfang und seitlich von der tiefen Schleifspur, die der dahinrasende Rumpf in den Geröllboden gepflügt hatte. Allem Anschein nach war es sofort bei der ersten Bodenberührung zerborsten und weggebrochen. Die beiden Flugzeugführer hatten nicht die geringste Chance und waren wohl auf der Stelle tot.
Die gute alte DC 3 hatte unter Umständen während des Zweiten Weltkrieges zahlreiche schwierige und gefährliche Situationen überstanden, aber stets mehr oder weniger unbeschadet den Heimatflughafen erreicht. Ausgerechnet ein Blitzschlag oder eine Triebwerksexplosion besiegelte heute ihr Ende.
Trotzdem hatten wir es diesem Flugzeugtyp zu verdanken, dass wir noch am Leben waren. Mit einem Düsenjet hätte das der beste Pilot der Welt nicht geschafft.
»Miss Garden?«
»Ja, Sir.«
»Sie sprachen vorhin von Verletzten. Wie viele Passagiere sind verletzt und tot. Wie viele haben überlebt?«
»Einschließlich der Besatzung befanden sich zweiunddreißig Menschen an Bord. Außer Ihnen, Benny und mir haben weitere vierzehn Personen überlebt, also insgesamt siebzehn. Drei von ihnen haben schwerste Verletzungen davongetragen. Die anderen haben das Unglück mehr oder weniger heil überstanden, jedenfalls auf den ersten Blick: Hautabschürfungen, Prellungen, Platzwunden und natürlich der Schock. Solch ein Ereignis geht nicht spurlos an einem vorüber. Ich habe jetzt noch weiche Knie. Glücklicherweise befindet sich unter den Überlebenden ein Arzt, der sich sofort um Sie, seine Freunde und meine Kollegin gekümmert hat. Ebenso hat er zweifelsfrei den Tod der dreizehn Menschen im Rumpf der Maschine sowie der beiden Piloten in der Kanzel festgestellt.«
»Hm, dann hat die Stewardess also auch überlebt?«
»Ja, aber sie zählt zu den Schwerverletzten. Es ist noch nicht abzusehen, ob sie durchkommen wird.«
Das war in Kürze ein sachlicher Bericht, den meine Gesprächspartnerin da abgegeben hatte. Demnach gab es bislang fünfzehn Opfer zu beklagen. Die Zahl derer konnte sich durchaus noch erhöhen. Diese Tatsache war so schrecklich, dass man nicht darüber nachdenken durfte.
»Danke, lieber Gott, dass du deinen Daumen dazwischen gehalten hast«, murmelte ich leise.
»Was hast du gesagt?« Das war Benny.
»Ach, nichts. Ich habe nur laut gedacht.«
»Wir sollten zu den anderen gehen«, mahnte Miss Garden.
»Richtig. Wir müssen uns Gedanken machen, was weiter geschehen soll.«
Einen vorläufig letzten Blick auf den Ort der Verwüstung werfend, setzten wir uns in Bewegung. Mir taten alle Knochen weh, aber das war auch kein Wunder.
Der klägliche Rest der Reisegruppe lag oder saß im Schutz einer kleinen Felsnase am aufsteigenden Hang des Canyons, wo sie dem Regen nicht so stark ausgesetzt gewesen waren. Trotzdem sahen alle arg durchgeweicht aus.
Auf den ersten Blick war zu erkennen, dass sie schwer mitgenommen und auch deprimiert wirkten. Das war nicht weiter verwunderlich, denn was diese Menschen vor kurzer Zeit erlebt hatten, gab nicht den geringsten Anlass zu Heiterkeitsausbrüchen.
Ein mittelgroßer, dunkelhaariger Mann mit leicht ergrauten Schläfen kniete neben einer Gestalt, die lang ausgestreckt auf einer Decke lag. Offensichtlich handelte es sich bei ihm um den Arzt, von dem Jacqueline Garden gesprochen hatte.
»Da kommt der letzte der Mohikaner!«, rief jemand und versuchte dabei, seiner Stimme einen optimistischen Klang zu verleihen. Ganz überzeugend hörte sich das allerdings nicht an. Bei näherem Hinschauen erkannte ich in dem Sprecher die ›Kugel‹. Das war jener Mann, der mir heute Morgen am Flughafen von Anchorage eine Dose Bier angeboten hatte.
Seine Freunde hoben interessiert ihren Kopf und schauten in unsere Richtung.
Niemand sprach zunächst ein weiteres Wort. Ich winkte kurz zum Gruß und nickte ihnen zu.
Lediglich der Doktor drehte sich zu uns um, erhob sich und kam uns ein paar Schritte entgegen.
»Guten Tag, Sir. Mein Name ist Keller. Franz Keller. Ich bin Arzt. Haben Sie Schmerzen? Kann ich Ihnen helfen? Bei der ersten vorläufigen Untersuchung vorhin in der Maschine sah es so aus, als seien Sie glimpflich davongekommen. Daher habe ich mich zuerst um die schwerer Verletzten gekümmert.« Er sah mich prüfend an.
»Hallo.« Ich nickte ihm zu und nannte meinen Namen.
»Das ist schon in Ordnung so, Doktor. Mir geht es soweit recht gut. Bis auf die Beule an der Stirn und entsprechende Kopfschmerzen kann ich nicht klagen. Miss Garden hat mir bereits eine Schmerztablette verabreicht. Vielen Dank also.«
Der Arzt hatte Englisch mit mir gesprochen und ich hatte ihm ebenso geantwortet. Deshalb fuhr ich jetzt in unserer gemeinsamen Muttersprache fort: »Wir können gerne Deutsch miteinander reden. Ich bin auch Deutscher, wie Sie und Ihre Freunde, und ebenfalls auf dem Weg in den Urlaub … gewesen.« Das letzte Wort fügte ich leise hinzu.
Dr. Keller runzelte die Stirn. Man merkte ihm die Enttäuschung an, als er antwortete: »Was die Sprachschwierigkeiten angeht, erleichtert das die Sache zwar, doch wenn ich ehrlich sein soll, hatte ich gehofft, Sie seien hier in der Gegend zu Hause. In der augenblicklich verfahrenen Situation fehlt uns ein Experte mit entsprechenden Fachkenntnissen am dringlichsten. Schade, das verbessert unsere Lage nicht. Da kann man nichts machen.«
Resignierend zuckte er mit den Schultern.
»Doktor, lassen Sie den Kopf nicht hängen. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Zum Glück ist mir dieses Land nicht gänzlich fremd. Ich habe hier einst in einem Crashkurs gelernt, zu leben und zu überleben. Zugegeben, es ist lange her und die Voraussetzungen damals waren andere als heute, aber es gibt derzeit noch keinen Grund, um in Pessimismus zu verfallen. Wir leben und das ist die Hauptsache. Bis zum Eintreffen der Rettungsmannschaften müssen wir versuchen, das Beste aus diesem Dilemma zu machen. Man wird uns längst auf die Verlustliste gesetzt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet haben. Ich gehe davon aus, dass wir spätestens morgen um diese Zeit in Sicherheit sind. Mit Glück wird das heute noch passieren.«
»Ihr Wort in Gottes Ohr«, antwortete der Arzt. »Eine Stewardess und zwei meiner Freunde sind schwer verletzt. Ich kann nicht dafür garantieren, dass sie ohne ausreichende medizinische Versorgung überleben werden. Sollten sie innere Verletzungen davongetragen haben – und davon muss man im schlimmsten Fall ausgehen – gebe ich ihnen keine große Chance. Meine bescheidenen Mittel sind da unzureichend. Außerdem bin ich lediglich Allgemeinmediziner und kein Internist oder Chirurg. Dazu kommt erschwerend hinzu, dass mein Vorrat an Medikamenten begrenzt ist. Trotzdem werde ich natürlich alles tun, was in meiner Macht steht.«
Jacqueline Garden war dem Gespräch aufmerksam gefolgt.
Als Keller geendet hatte, bat sie uns um eine kurze Unterredung unter sechs Augen, etwas abseits der übrigen Geretteten. Wir folgten ihr bereitwillig und waren gespannt auf das, was sie uns zu sagen hatte.
»Gentlemen, die Folgen unserer Bruchlandung dürften unter Umständen komplizierter sein, als Sie momentan annehmen«, erklärte sie uns zu unserer Verwunderung in nur leicht akzentuierter deutscher Sprache. »Captain Bronson hat uns zwei Flugbegleiterinnen noch unmittelbar vor der Katastrophe per Bordtelefon über den Stand der Dinge informiert. Aufgrund atmosphärischer Störungen, bedingt durch das Unwetter, war der Funkverkehr bereits vor dem beabsichtigten Kurswechsel gestört beziehungsweise ganz unterbrochen worden. Ein Notruf wurde bestimmt abgesetzt, aber ob man ihn empfangen hat, ist fraglich. Ich denke, man hat das Verschwinden des Flugzeuges unter diesen Umständen nicht sofort bemerkt, zumal wir nach dem Ausweichmanöver auf dem letzten Teil der Strecke das Radar phasenweise unterflogen haben dürften. Erst nach einer längeren Zeitüberschreitung wird man sich Sorgen über unser Ausbleiben gemacht und einen ernsten Zwischenfall in Erwägung gezogen haben. Frühestens, wenn die Flugsicherung zu dieser Erkenntnis gelangt ist, werden entsprechende Such- und Rettungsaktionen anlaufen. Mit schneller Hilfe ist also nicht zu rechnen, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
Oh, ich verstand, was sie da gesagt hatte. Wie Schuppen fiel es mir von den Augen. Mir wurde abwechselnd warm und kalt. Die ganze unbarmherzige Wahrheit war überdeutlich ihren Worten zu entnehmen gewesen. Man musste nur den Sinn erst begreifen und den Inhalt ihrer Aussage richtig interpretieren. Meine Gedanken überschlugen sich. Da saßen wir aber wunderbar bis zum Stehkragen im Schlamassel. Nachtigall, ich hör dir trapsen.
»Dann sind Sie also der Meinung, dass wir heute nicht mehr mit Hilfe rechnen können und eventuell zwei oder drei Tage länger warten müssen, bis die Retter hier eintreffen?«
In Doktor Kellers Stimme schwang ein leiser Anflug von Besorgnis mit.
Ihre Augen bettelten mich an: »Sag du es ihm. Sage ihm, wie es um uns bestellt ist. Ich habe nicht den Mut dazu.«
Der Kloß in meinem Hals wurde dicker. Obwohl Kahlköpfigkeit kein Mittel gegen Ratlosigkeit ist, kratzte ich hilflos auf dem Kopf herum und suchte fieberhaft nach passenden Worten.
»Doktor, was Miss Garden soeben versucht hat, uns zu erklären, ist noch weitaus übler, als Sie momentan annehmen. Wenn ich alles richtig verstanden haben sollte, ist Folgendes der Fall: Da der Funkverkehr bereits vor der Kursabweichung der Maschine abgerissen ist und eine lückenlose Radarüberwachung nicht sichergestellt war, wird man unseren Notlandeplatz ganz woanders vermuten. Die Befürchtung liegt also nahe, dass hier vorerst kein Mensch nach dem Wrack suchen wird und wir somit auf Hilfe von außen nicht unbedingt hoffen können, um es vorsichtig zu formulieren – jedenfalls nicht in den nächsten Tagen. Da müsste dann ein Wunder geschehen. Es ist schwer, zu beurteilen, in welchem Radius um den angenommenen Unfallort herum die Suchaktion ausgedehnt wird, aber wir sollten vorsichts





























