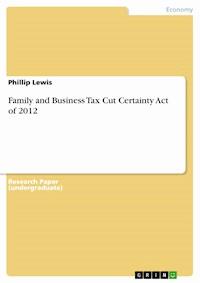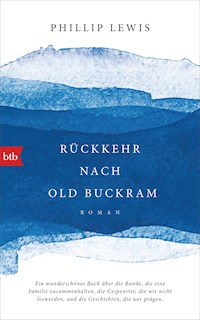
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein großartiger Roman über die Bande, die eine Familie zusammenhalten, die Gespenster, die wir nicht loswerden, und die Geschichten, die uns prägen.
Henry Astor wird in Old Buckram geboren, einer Kleinstadt in den Blauen Bergen von North Carolina. Eine Bahnlinie führt hierher, aber Züge kommen lange schon nicht mehr durch. Es ist ein Ort, in dem die Zeit stillsteht, an dem abends weiße Nebelschwaden in den Tälern aufsteigen und die grünen Berge in der Ferne zu Blautönen verblassen. Kaum dass Henry die Schule abgeschlossen hat, verlässt er Old Buckram. Erst Jahre später kehrt er zurück. Er will verstehen, was einst mit seinem Vater geschah, der eines Tages ohne ein Wort aus dem Leben der Familie verschwand und nie mehr wiederkehrte. Der Bücher über alles liebte, aber mit niemandem wirklich reden konnte. Ein großartiger Roman über die Zerbrechlichkeit unserer Existenz, die Liebe eines Sohnes und die Leidenschaft für die Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Lässt sich ändern, was geschehen ist?
Old Buckram ist ein verschlafenes Nest in den Blauen Bergen von North Carolina. Nach vielen Jahren kehrt Henry Astor an den Ort seiner Kindheit zurück. Er will verstehen, was mit seinem Vater geschah. Ohne ein Wort war der eines Tages aus dem Leben der Familie verschwunden und nie mehr wiedergekehrt. Ein Mann, der es aus einfachen Verhältnissen zum Anwalt gebracht hatte. Der Bücher über alles liebte, im wirklichen Leben aber geradezu verzweifelt nach Worten und Anerkennung suchte.
Ein unvergesslicher Roman über die Zerbrechlichkeit unserer Existenz, die Bande, die eine Familie zusammenhalten, und die Liebe eines Sohnes zu seinem Vater.
»Das Werk eines überragenden Talents.«The New York Times
Zum Autor
PHILLIP LEWIS ist in den Bergen von North Carolina geboren und aufgewachsen. Er studierte Jura und arbeitet als Anwalt in Charlotte, North Carolina. »Rückkehr nach Old Buckram« ist sein Erzähldebüt. Es wird in mehrere Sprachen übersetzt und von der New York Times als »Werk eines überragenden Talents« gefeiert.
Phillip Lewis
Rückkehr nach Old Buckram
Roman
Deutsch von Sigrid Ruschmeier
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »The Barrowfields« bei Hogarth Press, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 Phillip Lewis
Copyright © der deutschen Ausgabe 2019 btb Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: semper smile, München
unter Verwendung eines Motivs von © Shutterstock/Alexander Evgenyevich
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-19423-9V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Ashley
O Brüder, wie unsere Väter zu ihrer Zeit, brennen wir, wir brennen, brennen in der Nacht.
Thomas Wolfe, Es führt kein Weg zurück
Prolog
Der Schreibtisch ist noch immer so, wie er ihn verlassen hat. An der Wand der Rabe – oder welcher Vogel das auch immer sein soll. Wolfe. Poe. Chopin. Eine Erstausgabe von Camus’ DerFremde, völlig zerfleddert und zerlesen. Eine von Thomas Wolfe signierte Erstausgabe von Schau heimwärts, Engel, die ihm teurer war als jedes andere Buch. Poes Tales of Mystery and Imagination, mit blutroter Tinte signiert von Harry Clarke. Eine in schwarzes Leder gebundene Bibel. Drei Kerzen; reichlich geflossenes Wachs. Eine Flasche Hill’s Absinth, leer. Zwei Flaschen Wodka, leer. Eine Flasche spanischer Wein, auch leer. Ein Streichholzbriefchen. Eine Lampe, ohne Glühbirne. Einundfünfzig Tagebücher, handgeschrieben. Die Titelseite eines unveröffentlichten Romans mit einer Anmerkung auf Latein. Der gesammelte Staub von neun Jahren und eine Handvoll Fotos, die ihm etwas bedeutet haben müssen. Ich schlage den Fremden auf und sehe die Widmung in meiner eigenen Handschrift. Ich blättere um, lese die erste Zeile des Buches: »Heute ist Maman gestorben.« Und allmählich verstehe ich.
TEIL I
1
Mein Vater war eins von nur zwei Kindern, die in dem kalten, harten Herbst 1939 in der schmucklosen Klinik von Old Buckram geboren wurden. Das andere, ebenfalls ein kleiner Junge, lebte nicht lange genug, um einen Namen zu bekommen oder um seine Seele zu retten. Es wurde von seiner Mutter auf einem Berghang in der Nähe beerdigt, als der Boden noch warm genug war, dass sie ihm ein Grab schaufeln konnte. Ohne einen Pfarrer, ohne dass die Kirchengemeinde ein Lied sang. Als Grabstein, wenn man ihn denn als solchen bezeichnen wollte, diente lediglich ein großer glatter Flusskiesel. Dort wurde es zur letzten Ruhe gebettet, nur mit dem stummen Gebet der Mutter an einen abwesenden Gott, die darum bat, Er möge dem Kind die Sünde vergeben und es gütigst im Himmel aufnehmen.
Old Buckram, wo diese Geschichte beginnt, ist ein graues abgeschiedenes Städtchen in den Appalachen, in der nordwestlichsten Ecke von North Carolina gelegen. 1799 betrug die Bevölkerungszahl 125; 1939 war sie auf 400 gestiegen. Die Straßen und Bürgersteige sind meist leer und verwaist. Die wenigen Läden – eine altmodische Eisenwarenhandlung, ein Futtermittelladen, eine Schuhmacherei, ein Café, ein billiges Textilgeschäft und die Werkstatt eines Grabsteinmetzes – können nur mit Müh und Not überleben. In den dunklen Wintertagen, bevor der erste Schnee fällt, schließen sie früh. Eine Bahnstrecke führt durch die Stadt, aber Züge kommen schon seit Jahren nicht mehr hindurch. Es ist ein Ort mit kleinen roten Backsteinkirchen, einfachen Gebäuden mit einem einzigen Versammlungsraum, die über die Hänge und kleinen Täler verstreut sind. Ein Ort, an dem man an einen Gott glaubt, der lebendig, aber zugleich weit weg ist. Ein Bestattungsunternehmen bringt fast alle Toten unter die Erde. Old Buckram ist aber auch eine Stadt der Gespenster und des Aberglaubens. Hier gibt es die Teufelstreppe, den Schlangenzungenfels und den Abaddon Creek, der bei der Überschwemmung von 1916 tatsächlich ein Ort des Verderbens wurde und eine ganze Familie in den Tod riss. Oberhalb des Flusses, am Stadtrand, liegen die Barrowfields, auf denen aus irgendeinem mysteriösen Grund nichts wächst außer grauem Moos, das über Felshügel und versteinerte Baumstümpfe kriecht, die die gläubigeren Stadtbewohner für Grabsteine aus einer Zeit vor unserer Zeit halten. Andere behaupten, vor tausend Jahren sei ein mächtiger Windstoß über die Berge gefegt, habe alle Bäume ausgerissen und alles Gute aus dem Erdreich fortgetragen, sodass nie wieder etwas darauf gewachsen sei. Fast alle glauben, der Boden sei verhext. Niemand würde auf den Gedanken kommen, sich dort zum Picknick hinzusetzen.
Wenn überhaupt einmal bekannt war, wie die Familie meines Vaters nach Old Buckram kam, dann sind die Geschichten längst von den gnadenlos verrinnenden Jahren und Jahrzehnten zum Verstummen gebracht worden. Mein Großvater, dessen Taufname Helton war, erzählte mir einmal, dass die Asters irgendwann im 18. Jahrhundert aus dem Norden zugewandert seien, über die Great Wagon Road, die von Pennsylvania zum Piedmont in North Carolina verlief. Unsere Vorfahren hätten vermutlich zu den ersten Siedlern auf diesem rauen, unwirtlichen Land gehört. »Was beweist, dass sie nicht die Hellsten waren«, sagte er.
Sie waren arm, bettelarm, wie fast alle in den Bergen, doch mit harter Arbeit und Entschlossenheit schafften sie es, sich eine einigermaßen würdige Existenz aufzubauen. Mein Großvater nahm jede Arbeit an, erledigte sie ehrlich und sorgfältig und murrte nicht – außer wenn er sonntagmorgens in der Kirche mit Gott Zwiesprache hielt. In den Dreißigern arbeitete er mehrere Jahre lang als Sprengmeister für die Works Progress Administration am Blue Ridge Parkway. Seitdem war er auf einem Ohr taub und kriegte von Gesprächen kaum noch etwas mit. Er war wie ein alter Hund, der still in seiner Zimmerecke sitzt und das, was um ihn herum passiert, an sich vorbeiziehen lässt.
Ich wüsste nicht, dass er je in seinem Leben etwas Außergewöhnliches getan hätte. Er arbeitete fünf Tage die Woche, blieb trotz unzähliger bitterer Winter und unbarmherziger Armut bis zum Schluss mit meiner Großmutter Madeline verheiratet und erwarb weder nennenswertes Geld noch Gut. Am Tage seines Todes besaß er kaum mehr als ein leidlich großes Farmhaus, das sich neigte, wenn der Wind blies, und ein unbrauchbares Stück Land, das er für fünf Dollar den Morgen auf einer Auktion erstanden hatte. Das einzige Buch in seinem Besitz war die Heilige Schrift, die nach seinem Tod an mich überging. Auf der ersten, leeren, pergamentenen Seite steht in kaum lesbarer Schrift ein Satz seines Vaters William, meines Urgroßvaters: »Lies diese Bibel und verhalte dich danach.« Auf der nächsten Seite befindet sich eine verblasste Reproduktion des Bildes »Christus in Gethsemane« von Heinrich Hofmann. Mein Großvater hatte seinen Namen in die Bibel geschrieben und im Laufe der Zeit etliche Kommentare. Der erste steht am Anfang des ersten Buches Mose und lautet schlicht und ergreifend »4004 v. Chr.«. Für ihn das Jahr, in dem die Zeit begann.
Obwohl mein Großvater sein gesamtes Leben in Old Buckram verbrachte, tauchte er nur einmal in der Lokalzeitung auf. Wider besseres Wissen ließ er sich nämlich zur Kandidatur für ein politisches Amt im County aufstellen. Der Pfarrer seiner Gemeinde hatte ihn dazu überredet, weil er ihn als besonnenen, anständigen Mann mit gesundem Menschenverstand schätzte, aber er bekam nach einem kurzen Wahlkampf in einem eisigen Herbst nur zwei von fünfundzwanzig Stimmen. In der Zeitung stand ein einziger Satz dazu:
T. VANHOY AUS VELLUM’S CASKE GEWINNT WAHL ZUM LANDRAT MIT GROSSEM VORSPRUNG VOR H. L. ASTER
Weil mein Großvater wusste, dass er sich selbst gewählt hatte, sagte er, dass er von da an weder seiner Frau noch seinem Pfarrer so recht über den Weg traute. Und bevor er am nächsten Tag in die Stadt ging, verwendete er viel Mühe und Sorgfalt darauf, seine Pistole zu säubern und zu laden. Die Familie beobachtete es mit stummer Besorgnis. Maddy erzählte später, er sei vom Tisch aufgestanden, habe sich die Waffe betont feierlich in den Gürtel gesteckt und auf ihre Frage: »Meine Güte noch mal, Helton, was willst du mit der Knarre?« erwidert: »Ich schätze mal, dass ein Mann, der nicht mehr Freunde hat als ich, zumindest so klug sein sollte, Vorkehrungen zu seinem Schutz zu treffen.« Dann schloss er die Tür hinter sich und ging den langen Weg zur Stadt zu Fuß. Für ein Amt bewarb er sich nie wieder. Es schlug ihn auch keiner mehr vor.
Als Junge fuhr ich mit meinem Großvater in seinem verrosteten Ford Pritschenwagen manchmal nach der Schule oder am Wochenende zum Schlachthof, der nördlich von Old Buckram lag. Im Erdgeschoss befand sich ein Laden, in dem Speck, Wurst, Gemüse und andere Lebensmittel verkauft wurden. Hinter dem Gebäude hatte man vier Rinnen in den Betonboden gehauen, die in einem schwarzen Gully endeten. Auf dem Schild an der Straße prangte ein wohlgenährtes schwarz-weißes Schwein.
Jeder kannte hier draußen jeden. Als mein Großvater und ich einmal freitagnachmittags Milch kaufen wollten, begrüßte ihn ein riesiger Mann in Latzhose mit einem jovialen Schlag auf den Rücken.
»Helton, was gibt’s Neues?«, fragte er.
Worauf mein Großvater erwiderte: »Woher soll ich das wissen? Seit wann passiert hier überhaupt was?«
Der Kerl in der blauen Latzhose lachte und zwinkerte mir freundlich zu. Vor dem Laden saßen Männer, allesamt arbeitslos, stundenlang auf Bänken, erzählten sich Witze, prokelten sich mit Zahnstochern in den Zähnen und beobachteten das Kommen und Gehen ihrer Mitmenschen. Wieder andere saßen drinnen auf den Holzstühlen mit geflochtener Sitzfläche und beugten sich mit offenen Mündern über ihre Schachbretter. Nur hin und wieder hoben sie den Kopf, um sich umzuschauen oder auszuspucken. Die Männer tranken Cola aus Flaschen und redeten über das Wetter und darüber, wie schnell sich die Dinge änderten. Sie änderten sich nicht. Rote und gelbe Tomaten in den verschiedensten Formen lagen hübsch aufgereiht neben Weidenkörben voll frisch gepflückter grüner Bohnen; Kartoffeln, noch mit trockener brauner Erde verkrustet, hatte man in Papiertüten verpackt. In einer Ecke summte ein antiquierter Getränkeautomat. Und der unebene Holzboden knarzte jedes Mal, wenn die Leute an den Regalen entlangliefen.
Einmal kam ein Schwarzer, den niemand kannte, herein und bezahlte eine Gallone Benzin. Mit ihm kam Stille und ging mit ihm wieder hinaus. Als er die Straße hochlief, schüttelten ein, zwei faltige alte Männer ungläubig den Kopf. In Old Buckram wohnten wenige schwarze Familien, und wenn, dann fast ausnahmslos in dem klar abgegrenzten Viertel hinter dem städtischen Parkplatz. Laut einem arg strapazierten alten Witz lebten im ganzen County genau einhundert Schwarze – keiner mehr, keiner weniger. Die Pointe, unweigerlich mit schiefem Grinsen und einem Seitenblick erzählt: Wenn einer mehr in die Stadt komme, bitte man einen anderen höflich darum, zu gehen. Schenkelklatschen, brüllendes Gelächter, verschleimtes Raucherhusten.
Während meiner Zeit in Old Buckram lebten in der Stadt nicht einmal tausend Leute, Weiße und Schwarze. Die anderen wohnten außerhalb, an unbefestigten Straßen und Schotterwegen, die sich endlos bergauf wanden und schließlich im Nichts endeten. In Trailern, deren Dächer zum Schutz gegen den starken Wind mit abgefahrenen Autoreifen beschwert waren, oder in kleinen Holzhütten mit dünnen, kaum regenfesten Asbestdachplatten.
Auf dem Heimweg vom Schlachthof fuhren mein Großvater und ich quer durch die Stadt und bogen am Ende auf die Larvatis Road ab, die zu seinem und Maddys Haus führte. Maddy hängte draußen Wäsche auf, als wir ankamen. Der Wind hatte aufgefrischt.
»Na, gerade noch rechtzeitig zum Abendessen«, sagte sie. »Ich wollte schon ohne euch anfangen.«
»Das hättest du nie«, erwiderte mein Großvater. Die verrosteten Angeln der Wagentür protestierten laut beim Öffnen und Zuschlagen.
»O doch«, sagte Maddy. Sie drückte mich liebevoll in die erstickenden Stoffmassen ihrer Schürze. »Wartet, ich habe eine Überraschung für euch.«
»Wirklich?«
»Und ob. Lass uns mal lieber reingehen. Hier draußen wird’s langsam kalt, und ihr habt keine Jacken an.«
»Vorhin war es noch warm«, sagte ich. Ein ungewöhnlich milder Oktober ging schnell auf den Winter zu. Bunte Herbstblätter lagen im hohen, gelb werdenden Gras auf dem Hof.
»In den Bergen wird es immer kalt, sobald die Sonne untergeht, mein Junge«, erwiderte Maddy. »Ganz egal, ob Frühling, Sommer oder Herbst.« Sie hatte stets eine Weisheit zum Wetter und zu den Jahreszeiten auf Lager. Besser als jeder Meteorologe konnte sie einem sagen, ob es regnen oder schneien würde, und früher als alle anderen wusste sie, ob der Winter besonders hart wurde. Ich hatte keine Ahnung, woher, aber sie wusste es immer.
Helton und Maddy wohnten am Ende einer Schotterpiste, zirka sechs bis sieben Kilometer außerhalb der Stadt in einem engen Tal, in das sich selten die Sonne verirrte. Hinter dem Haus floss ein Bach den Berghang hinunter und weiter durch eine tiefe pflanzenüberwucherte Schlucht bis zum Highway, der über eine einspurige Brücke aus Baumstämmen führte. Unter einer Trauerweide in der Nähe des Hauses, die aussah, als trinke sie aus dem Bach, hatte Maddy eine Holzbank aufgestellt, auf der nie jemand saß. Im Garten auf der anderen Seite des Hauses stand ein Holzapfelbaum, unter dem immer haufenweise halb verfaulte, verschrumpelte Äpfel lagen. Wenn beide Öfen im Haus bollerten, der in der Küche und der im Wohnzimmer, hielt man es vor Hitze kaum aus. An kalten Wintertagen stand Maddy früh morgens auf, um einzuheizen, und trieb damit meinen Großvater aus dem Bett. Der riss dann immer sämtliche Fenster auf und entgegnete auf ihre Proteste, er lasse ihre ganze Wärme raus, nur: »Sonst schmilzt hier gleich alles.«
Aus den Holzäpfeln, die Maddy aufsammelte, machte sie Cider. Das Gebräu köchelte und dampfte den ganzen Tag auf dem Küchenofen vor sich hin, und ich roch es immer schon von draußen. Im Haus goss Maddy mir gleich einen Becher zum Aufwärmen voll.
In der Highschool war Maddy eine ordentliche Schülerin und Mitglied in den wenigen Clubs gewesen, die es gab. Ansonsten verlief ihre schulische Karriere unauffällig. Sie ging nicht aufs College, sondern nahm nach der Highschool eine Stelle als Pfarrhelferin an einer der wenigen Baptistenkirchen in Old Buckram an. Sie behielt sie fast ihr ganzes Leben und sah mehr Pfarrer kommen und gehen, als man an einer Hand abzählen kann.
Wenn sie nicht arbeitete, zog sie sich gern zurück und bemalte Geschirr. Die Veranda hinter dem Haus stand voller Tassen, Teller und Krüge aus Keramik, die sie stolz mit ihren Initialen versehen hatte. Sie bewahrte auch allen möglichen wertlosen Krimskrams auf, Raritäten wie ein Blumenfossil in einem braunen Kalksteinstück, das die Fensterbank zierte, seit sie es für fünfzig Cent auf einem Straßenmarkt in Ohio erstanden hatte. Die Blütenblätter sah man schon gar nicht mehr, aber sie war mächtig stolz darauf. So manches Mal nahm sie es auf, betrachtete es und legte es wieder hin.
Maddy kochte gern, doch zuverlässigen Quellen zufolge war das Ergebnis recht mittelmäßig. Sie sei eben kein Naturtalent, sagte mein Großvater immer. Ihre Spezialität waren der Cider und ein nahezu ungenießbares Maisbrot, das hart wie Stein war und vor dem Verzehr in Milch eingeweicht werden musste. Als meine Großmutter erkrankte, nicht mehr arbeiten konnte und das Geld knapper wurde, gingen sie nur noch selten zum Essen aus. Aber sie hatten sich ohnehin keinen Luxus im Leben erlaubt und erwarteten auch keinen. Sie hatten gelernt, ihre begrenzten Mittel nur für das unbedingt Nötige auszugeben und sich mit sehr wenig zu bescheiden.
Während ich nun dasaß und mir die Hände am Cider wärmte, stand Maddy in der einen Spaltbreit offenen Küchentür und rauchte eine Zigarette. Sie blies den Rauch nach draußen, doch der Wind wehte ihn gleich wieder herein. Sie hustete, bis mein Großvater ihr die Zigarette wegnahm und ihr auf einen Stuhl half.
»Entschuldige, Schatz«, sagte sie zu mir. »Wie schmeckt dir der Cider? Gut?«
»Ja«, sagte ich, aber das stimmte nicht. Er war grauenhaft herb. Bei jedem Schluck kniff ich die Augen zusammen.
»Merkst du, dass irgendwas anders daran ist?«
Nein, aber das sagte ich nicht.
»Als kleines Extra habe ich Zimt reingetan.« (Das also war die Überraschung.)
»Schmeckt total lecker«, sagte ich.
»Na, dann trink ihn, bevor du nach Hause musst.«
»Mach ich. Fährst du mich?«
Mein Großvater brachte mich hin und wieder zurück, Maddy nie.
»Nein, mein Junge«, sagte sie wie so oft. »Ich bin einmal da gewesen, und das hat mir gereicht. Das Haus erinnert mich an einen fiesen alten Geier, der dort am Berghang hockt.«
»Wie kannst du das sagen? Ich wohne da«, protestierte ich.
»Ich weiß, ich weiß, und besser du als ich«, sagte Maddy.
Mein Großvater hielt mir mit seinen großen Händen die Ohren zu. Als ich zu ihm hochschaute, sah es aus, als berühre sein Kopf die Decke. Maddy stand auf, warf ein Holzscheit in den Ofen, und ich saß weiter vor meinem ekelhaften Cider, der jetzt noch schlechter schmeckte, weil mich ihre Worte getroffen hatten.
»Das Holz würde nicht so schnell verbrennen, wenn du den Ofen nicht so heiß werden ließest«, sagte mein Großvater.
»Hier drin ist es eiskalt.«
»Brauchst du deine dicke Jacke? Ich hole sie.«
»Ich soll in meinem eigenen Haus eine Jacke tragen? So weit kommt’s noch.« Maddy lächelte mich an. Ihr grauschwarzes Haar hatte sie an den Seiten mit unzähligen Haarklemmen zurückgesteckt. Nach der Zigarette malte sie sich die Lippen neu an. Orangefarben. »Wenn du so weitermachst«, sagte Helton und zeigte auf den Ofen, »dann ist bald in ganz Amerika kein Baum und kein Strauch mehr übrig.«
Maddy holte ihr Scheckheft heraus und rechnete ein wenig herum. Sie saß an dem kleinen viereckigen Tisch in der Küche, wo sie alle Mahlzeiten einnahmen. Die Vinyltischdecke klebte ihr an den Ellenbogen und knatschte, wenn sie die Arme hob. Ungefähr neunzig Prozent der Arbeitsfläche in der Küche waren von unterschiedlichsten Behältern und Gefäßen belegt. Eine Wanduhr zeigte dieselbe Zeit wie bei meinen letzten vier Besuchen. Ich schaute hin, um zu sehen, ob sich die Zeiger bewegten. Nein.
»Helton, hast du gehört, dass die kleine Ola Hamilton krank ist?«
Viola Hamilton war eine zweiundfünfzigjährige Witwe, deren Mann vor etlichen Jahren von einem Trecker überrollt worden war. Sie hatte nicht wieder geheiratet, und man sah sie kaum noch in der Stadt.
»Nein, woher sollte ich? Was ist passiert?«
»Sie schafft es nicht mehr aus dem Bett. Es heißt, sie hat schlimme Arthritis, und ihre Gelenke sind böse entzündet. Vielleicht ist es an der Zeit, den Trost-Trupp hinzuschicken.«
Trost-Trupp nannte man die Gruppe älterer Damen aus der Gemeinde, die wie eine Schar eitler Pfauen in das Haus von Kranken einfiel und mehr Essen, Brot und Pasteten brachte, als ein Mensch in seinem ganzen Leben verspeisen konnte. Eine Splittergruppe, der Bet-Trupp, rauschte später an, wenn der Patient langsam die Zuversicht verlor und wieder auf den rechten Glaubensweg gebracht werden musste.
»Könntest du ihr was vorbeibringen?«
»Aber sicher.«
Meine Großeltern waren gute, freundliche Menschen. Sie nörgelten aneinander herum, wie üblich bei Eheleuten, aber sie liebten sich sehr. Es hingen zwar keine Diplome an den Wänden, doch sie waren auf eine andere Art klug, so wie es die Leute in den Bergen sind, die gelernt haben, endlose Winter mit Eis und Schnee und einem Wind zu überleben, der einem das Dach über dem Kopf wegreißt. Die ersten Kinder kamen, kaum dass sie geheiratet hatten, und es hatte erst ein Ende, als sie fünf hatten und genau wussten, dass ein sechstes Hunger leiden würde. Dank großer Selbstaufopferung und schieren Glücks schafften sie es, alle Kinder irgendwie großzukriegen. Das Jüngste war mein Vater.
2
Für die Kinder in Old Buckram war es normal, mit der Schule zu beginnen, aber nicht, sie zu beenden, und so legte – wenig überraschend – von den Vorfahren meines Vaters keiner über die Highschool hinaus Wert auf weitere Bildung. Einmal fragte ich meinen Großvater in aller Unschuld, ob er am College gewesen sei. »Nein, mein Sohn, ich bin zwar an ein paar vorbeigefahren, habe aber nie angehalten«, erwiderte er trocken. Auch die Geschwister meines Vaters besaßen offenbar keinerlei intellektuelle Neugierde oder den Ehrgeiz zu studieren, ja überhaupt nennenswerten Wissensdurst. Mein Vater war anders. Vollkommen und verblüffend anders, was sich schon früh zeigte. So brachte er sich selbst das Lesen bei, eine Fähigkeit, die in seiner Familie eher für pure Notwendigkeit und keineswegs für eine Stärke gehalten wurde. Man sah ihn nie ohne Buch.
»Wo hat der Junge das denn her?«, sagten die Leute.
Ferner sprach er aus unerfindlichen Gründen in vollständigen, grammatisch komplexen Sätzen, obwohl rings um ihn her der eher hemdsärmelige Dialekt der Appalachen zu hören war. Besucher der Familie vermaßen seinen Kopf, um zu sehen, ob der normal groß war, und bestaunten den Jungen, als sei er ein singender Frosch. Seine Tante George (lange Geschichte) erklärte das Rätsel gern mit ihrer felsenfesten Überzeugung, er sei der wiedergeborene Mark Twain. Dabei sahen sie sich nicht im Geringsten ähnlich.
Bei seinen Altersgenossen in der Grundschule war er wenig beliebt, und so kam er an manchem Tag in der kühlen Hitze eines Bergsommers über die Schotterstraße gelaufen und barg zu Hause schluchzend seinen Kopf in Maddys Schoß. Oft wartete sie schon auf ihn und ging mit ihm ins Wohnzimmer, wo sie beide im farblosen Mittagslicht auf der Couch saßen wie zwei Steingolems, er mit einem Buch, sie mit einer Zigarette in der Hand, während das Rauschen des Bachs und das Singen der Vögel durchs offene Fenster drangen. »An dir ist absolut nichts verkehrt«, beschwichtigte Maddy ihn. Er schaute sie mit seinen großen Augen an. »Und wenn du lieber lesen willst, Henry, dann machst du das auch. Lass dir das von niemandem ausreden.«
In Wirklichkeit bereitete seine unbändige Lesewut ihr große Sorgen. Wenn sie ehrlich zu sich gewesen wäre, hätte sie gesagt, dass er seine Zeit verschwende, lieber mit den anderen Jungs draußen spielen solle und später einmal schielen werde. Jedes Mal, wenn sie ihm widerstrebend versicherte, seine Leserei sei vollkommen in Ordnung, tat sie das gänzlich wider ihre eigene Überzeugung. Aber wenn sie ihn dann getröstet hatte, konnte sie zum Schluss doch nicht anders, als zumindest diese wenig zartfühlende Warnung (oder eine ähnliche) noch anzuhängen: »Wenn du so weitermachst, gibt es irgendwann nichts mehr zu lesen für dich.«
Er wiederum begann schon früh zu ahnen, dass er in eine Welt geboren worden war, die ihm nicht genügte. Wenn er auch nie arrogant oder herablassend wurde, wusste er doch immer tief in seinem unruhigen Inneren, dass er sich über das ihm bestimmte Los hinwegsetzen und über die Menschen um ihn herum hinauswachsen werde. Und so wurde er mit der Zeit zum Außenseiter und blieb es, wie alle großen Männer und Frauen in ihrer Zeit.
Er verschlang jedes Buch, das er finden konnte. Da die Familie kein Geld zum Bücherkaufen hatte, verbrachte er Stunden in der County-Bibliothek und blieb einmal sogar so lange, dass er über Nacht dort eingeschlossen wurde. Um Mitternacht suchte ihn die ganze Stadt. Manche mutmaßten, er sei, obwohl erst zwölf, Old Buckram wahrscheinlich schon »entwachsen« und in die große Stadt abgehauen – nach Charlotte oder sogar Raleigh. Doch früh am nächsten Morgen tauchte er übernächtigt und seltsam euphorisch wieder zu Hause auf, ein gebundenes Buch, von dem dort noch nie jemand gehört hatte, in der Hand. Dann schilderte er der staunenden Familie sein nächtliches Abenteuer. Aus irgendeinem komischen Zufall hatte ein Roman von Thomas Wolfe auf dem »Aussortiert«-Stapel seine Aufmerksamkeit erregt, und er war die ganze Nacht wach geblieben und hatte ihn im Licht einer Straßenlampe gelesen. Alle waren sprachlos, er ging schlafen und stand erst zum Abendessen wieder auf. Kurz darauf bekam er seine erste Brille.
Ein Jahr später wurde ihm der Bibliotheksausweis entzogen, nachdem herausgekommen war, dass er im Verlauf mehrerer Monate über hundert Bücher mitgenommen hatte. Die Untat wurde entdeckt, als Maddy eines Tages das Bett in seinem Zimmer frisch beziehen wollte und mit dem linken Fuß so heftig gegen eine gebundene Ausgabe von Wiedersehen mit Brideshead stieß, dass sie ihn sich beinahe gebrochen hätte. Bei näherem Hinsehen entdeckte sie seine literarische Beute. In alphabetischer Reihenfolge standen die Bücher ordentlich nebeneinander unter dem Bett, das er mit seinem Bruder teilte. Bewerkstelligt hatte er das Ganze, ohne auch nur den geringsten Verdacht zu erregen. Nicht einmal die hexige Bibliothekarin Mrs. Tichborne hatte etwas mitbekommen, der es sowieso lieber war, wenn niemand Bücher auslieh. In dem winzigen Karzer der Schule, wo unheilschwanger ein großes Holzpaddel an der Wand hing, fand das Verhör statt.
»Was wolltest du mit all diesen Büchern?«, fragte Bent Smeth, der Rektor, der Henry schon mit Schulverweis gedroht hatte. Mr. Smeth war lang und dünn wie eine junge Birke, hatte aber einen schrecklich krummen Rücken und war dadurch nur halb so groß, wie er es ohne den Buckel gewesen wäre. Da er sich obendrein als Kind mit kochendem Wasser aus einem verrotteten Holzbottich verbrüht hatte, war er nicht nur gefleckt wie eine Kuh, sondern hatte auch noch einen schiefen Mund. Er leitete die Vernehmung, und Mrs. Tichborne, die nach allem, was man wusste, vom jahrelangen Starren auf Deweys tückisches Klassifikationsschema für Bibliotheken blind wie ein Maulwurf war, stand erwartungsvoll hinter ihm. Sie war seit jeher dafür bekannt, dass sie Schüler vom Lesen abhalten wollte, besonders vom Lesen angeblich unzüchtiger Romane, und wenn sie nun allein das Sagen gehabt hätte, hätte sie bei einem Untersuchungsrichter mit Sicherheit einen Haftbefehl erwirkt. »Ja, genau, was wolltest du mit meinen Büchern unter deinem Bett?«, mischte sie sich sofort ein. Schon die Frage suggerierte etwas Unanständiges.
»Ich wollte sie lesen«, entgegnete mein Vater, den man auf einen wackligen Stuhl in die Mitte des Raumes gesetzt hatte. Seine Inquisitoren umkreisten ihn wie ein Bussardpaar. »Das heißt, die meisten habe ich schon gelesen.« Er begann detailfreudig eine bis dato noch nie gehörte Hypothese zu erläutern, der zufolge der Mensch so gepolt sei, dass man ein bestimmtes Buch in einem bestimmten Moment lesen wolle, weshalb es wichtig sei, ja, lebensnotwendig, dieses Buch jederzeit zur Hand zu haben. Die Argumentation des Knaben überzeugte nicht.
»Er wollte sie bloß lesen und nicht etwa verkaufen.« Helton kam ihm gerade noch rechtzeitig zu Hilfe. »Außerdem müssen Sie zugeben, dass Bücher hier in Old Buckram vermutlich keinen reißenden Absatz finden. Sie können den Jungen nicht dafür bestrafen, dass er lesen will.«
»Das ist richtig«, sagte Mr. Smeth, »aber er hätte sie genauso gut eins nach dem anderen ausleihen können.«
»Stimmt«, erwiderte mein Großvater, »dagegen kann ich nichts sagen.«
»Ich habe sie nicht gestohlen«, sagte mein Vater. »Ich wollte jedes Einzelne zurückbringen.«
Nachdem sich Mr. Smeth endlich dazu durchgerungen hatte, Gnade vor Recht ergehen zu lassen, entließ er meinen Großvater mit den Worten: »Sie wissen schon, dass Ihr Junge recht eigenartig ist?«
»Und ob!«
Als mein Vater vierzehn war, schrieb er dann ein paar kurze Theaterstücke, zeigte sie jedoch niemandem. Im Unterricht sahen allerdings alle, wie er ständig etwas auf sein Blatt kritzelte. Mit sechzehn bekam er einen Job bei der Stadtzeitung, dem Old Buckram Echo. Zuerst trug er die Zeitungen mit dem Fahrrad aus, bald danach begann er Artikel zu schreiben, und binnen weniger Monate war er de facto zum Chefredakteur aufgestiegen. Neun von zehn Texten verfasste er, kaufte regelmäßig Kreuzworträtsel ein, gestaltete die Titelseite und änderte den Namen der Zeitung in Old Buckram Meteor, was bei manchen Ortsansässigen auf einigen Widerstand stieß. Es war das Jahr 1955. Tennessee Williams hatte gerade den Pulitzerpreis für Die Katze auf dem heißen Blechdach bekommen und Nabokov in Paris Lolita veröffentlicht. Es war das Jahr von Claudette Colvin und Rosa Parks. Überall auf der Welt fanden große Veränderungen statt, nur nicht in Old Buckram, das mit seinen einspurigen Straßen und verwaisten Veranden vor den Häusern dumpf vor sich hinbrütete. Niemand nahm von den Ereignissen der großen weiten Welt da draußen Notiz – nur mein Vater, der brannte auf Entkommen.
Als der Besitzer des Old Buckram Meteor ihn zu einer Journalistenkonferenz in Charlottesville, Virginia, schickte, verließ mein Vater zum ersten Mal den Staat North Carolina. Er verliebte sich in die Universität dort, deren Büchersammlung seine kühnsten Vorstellungen übertraf, und lernte zum ersten Mal Seelenverwandte kennen, die ihm ohne die genervten, schrägen Blicke begegneten, an die er sich in Old Buckram gewöhnt hatte. Ein Wunder, dass er überhaupt wieder nach Hause kam.
Mittlerweile war er zu einem blendend aussehenden jungen Mann herangewachsen. Er hatte das schwarze Haar über der hohen Stirn nach hinten gekämmt und die hagere, aber zähe Statur eines Langstreckenläufers. Auch sein selbstsicherer Gang verriet Zielstrebigkeit und Selbstvertrauen. Sein Lächeln war offen, obgleich eher schüchtern. Den wenigen Fotos aus dem Jahr nach zu urteilen, besaß mein Vater die Aura eines wahrhaften Zeitreisenden, den es aus einer fernen, goldenen Zukunft in diese Berge verschlagen hatte.
Seit er alt genug war, hatte ihm Maddy erzählt, dass er, wenn er denn wollte, dank seiner Klugheit gewiss einen Posten bei der örtlichen Spar- und Darlehenskasse bekommen könnte – mit oder ohne College. »Die Arbeit dort ist gut«, sagte sie. »Du bist nicht auf den Kopf gefallen, und es wäre eine Schande, wenn du das nicht nutzen würdest.« Besonders auf ein wichtiges Argument griff sie oft zurück: »Der Großcousin deines Vaters, Bishop Stonecipher, ist diesen Oktober seit zwanzig Jahren bei der Bank und kurz vor der Pensionierung. Wir hätten nie gedacht, dass er es so weit bringt, aber er hat dort gutes Geld verdient. Wenn du willst, gehe ich gern vorbei und rede mit ihm. Ich wette, ich kriege dich dort rein.« Man kann sich vorstellen, wie das bei Henry ankam.
Da Maddy jedoch ganz genau wusste, dass mein Vater die vergrämte Stadt in den Bergen um jeden Preis verlassen und studieren wollte, bat sie ihn, kurz bevor er mit der Highschool fertig wurde, zu sich auf die Wohnzimmercouch. »Mein Sohn«, sagte sie, »du bist so ein kluger Junge. Und wenn es dein Wille ist, kannst du natürlich aufs College gehen. Wir können dir nur nicht finanziell unter die Arme greifen. Wir haben einfach nicht …«
Das wusste Henry.
»Okay, dann hör mir einen Moment lang zu«, sagte Maddy ihm dann dort auf der Couch. »Du musst mit dem, was du lernst, später deinen Lebensunterhalt verdienen, und glaub mir, ich würde mich wirklich wundern, wenn … Hm, wie soll ich das sagen …?« Sie schlug die Asche ihrer billigen Zigarette in einen Pappbecher ab, indem sie zweimal rasch mit der Fingerspitze darauf klopfte. Er spürte, wie ärgerlich sie wurde, weil sie ihre Gedanken nicht in Worte fassen konnte. »Also, ich möchte nur sagen, dass ich deine Begeisterung für Bücher im Grunde nie verstanden habe. Wir haben es, Gott weiß, versucht. Aber Bücher sind nicht alles, Schatz. Schreiben ist nicht alles. Die Wahrheit ist – aber das willst du nicht hören –, dass du damit kein Geld verdienst. Wie soll das gehen? Glaub mir. Neulich abends habe ich mit deinem Vater gesprochen, und er hat gesagt – und was er gesagt hat, stimmt: ›Außer Jesus Christus kenne ich keinen Einzigen in der Geschichte, dessen Worte auch nur das Schwarze unterm Fingernagel wert waren.‹ Und da ist was dran. Schau, was aus Jesus geworden ist.« Durch den Qualm ihrer Zigarette sah sie ihn schief an und schüttelte den Kopf. »Mit den reichen Gaben, die dir der Herr gegeben hat, könntest du einfach so viel mehr tun.«
Dieser wenig hilfreiche Rat war nun in fast jeder Hinsicht falsch und stieß auf taube Ohren. Henry hatte seine Entscheidung ohnehin getroffen. Er bewarb sich an der University of Virginia und wurde angenommen. Da er weder ein Auto besaß noch jemanden kannte, der auch dorthin ging, fuhr er per Anhalter nach Charlottesville, wo er amerikanische Literatur studierte und in Liebe zu Wolfe, Poe und Faulkner entbrannte. Hier beschloss er auch ernsthaft und wider Maddys gut gemeinten, aber törichten Rat, sich seinen Lebensunterhalt mit Schreiben zu verdienen. Worüber, das wusste er noch nicht so recht.
Als er dreieinhalb Jahre später seinen Abschluss gemacht hatte, schickte er in der Hoffnung auf eine Dozentenstelle Bewerbungsschreiben an mehrere bedeutende Universitäten. Tagsüber zu unterrichten und frühmorgens und abends zu schreiben, das war sein Traum.
Er bekam einige Angebote von Colleges im nördlichen Mittleren Westen, doch er lehnte sie ab. Auch an der Appalachian State University in North Carolina wollte er nicht unterrichten, weil es ihm zu nah an Old Buckram und den Bergen, an Helton und Maddy war. Die allerletzte Offerte, von der University of Baltimore, war die beste, und er nahm sie an.
Im ersten Jahr musste er feststellen, dass er neben dem Unterrichten nicht, wie erhofft, genug zum Schreiben kam. Trotzdem schaffte er es, eine Erzählung fertigzustellen, die am Ende jedoch in der Schublade landete. Er versuchte es erneut. In einem Ausbruch von Kreativität verfasste er fünf avantgardistische Short Stories, die nacheinander in einer damals berühmten Literaturzeitschrift veröffentlicht wurden und ihm kurze, aber exklusive Aufmerksamkeit in der postmodernen Literaturszene eintrugen. Er experimentierte mit Formen und kombinierte sie zu weiteren kurzen Arbeiten, von denen ein paar in unbedeutenderen Zeitschriften erschienen und bei der Kritik weniger Interesse als vielmehr Verwirrung hervorriefen. In einer Rezension stand: »Asters Arbeiten sind zwar brillant, aber undurchdringlich.« Er lernte wichtige Lektionen und begann mit einem Roman.
Nach einem weiteren Jahr, in dem er tagsüber lehrte und bis spät in die Nacht schrieb, nahm er langsam Blässe und Züge einer Geistererscheinung an, hatte aber fünfzigtausend wohlgeordnete Worte zu Papier gebracht. Dieses Mal hatte er über sein Leben geschrieben. Über seine Mutter und seinen Vater, die Berge von North Carolina und einen klugen jungen Mann, der dort geboren wurde: fehl an diesem Ort, fehl in seiner Zeit.
Irgendwo in seinem Unterbewusstsein, absichtlich unter all den bitteren und vergessenen Erinnerungen an Zuhause gut vergraben, lauerte eine ihn vergiftende Idee: Wenn er dieses Buch geschrieben und veröffentlicht hätte, würde er nach Old Buckram zurückkehren und es Maddy als endgültigen Beweis seiner Tüchtigkeit präsentieren. In stillen Momenten gestattete er sich allerdings, seinem Dämon ins Gesicht zu blicken und sich seinen insgeheimen Wunsch nach Abrechnung einzugestehen, ehe er ihn wieder verdrängte und sich sagte, dass Maddys Meinung keine Rolle spiele und er nicht für sie schreibe. Ohnehin war er sich darüber im Klaren, dass sie nie auch nur ein Wort von dem lesen würde, was er geschrieben hatte. Das hätte ihn eigentlich retten müssen, doch ihre Zweifel an ihm sollten sein Leben lang wie eine erbarmungslose, nie leichter werdende Bürde auf seinen Schultern lasten, ihm Kraft rauben und ihn klein machen.
Trotzdem arbeitete er unermüdlich weiter. Tag für Tag, Nacht für Nacht. Er schrieb hunderte Seiten, war aber nie zufrieden damit. Er suchte nichts Geringeres als eine neue Art des Schreibens und des Geschichtenerzählens, und das erwies sich als vergeblich. Da kam er auf die Idee, vielleicht weniger zu schreiben als zu lesen, und zwar so lange, bis er seine Stimme gefunden hatte. Noch einmal nahm er sich alle Klassiker vor, studierte sie bis in die feinsten Verästelungen und schrieb seine Gedanken dazu auf. Er las jedes Buch von der Bestsellerliste der New York Times, hielt aber alles durch die Bank für uninteressant, weil immer das Gleiche. Irritiert durch seine wachsende Unlust, führte er sich den gesamten Index Librorum Prohibitorum zu Gemüte und genoss diese Lektüre weit mehr. Seinem eigenen Vorhaben kam er dadurch aber nicht näher. Etwas sagte ihm, er müsse mehr nachdenken, das Buch in seinem Kopf sei noch nicht ausgereift und müsse eine Weile länger köcheln. Er legte also die Teile des Romans, die er bereits geschrieben hatte, weg und ließ sich vom Strom seines Lebens weitertragen. Aus einer Laune heraus belegte er juristische Abendkurse an der Universität von Baltimore, um sich abzulenken. Doch eines Samstags ging er in die Bibliothek, um sich dort ein lateinisch-englisches Wörterbuch zu holen.
Seit seiner Ankunft in Baltimore war er fast täglich in dieser Bibliothek, und bereits mehr als einmal hatte ihn ein Student für einen der Angestellten gehalten. Schließlich schleppte er ständig Bücherstapel hin und her. Er selbst hatte jedes Mal das Gefühl, nach Hause zu kommen, wenn er durch die schweren Türen aus Holz und Glas trat und ihm der Duft all der Bücher entgegenschlug. Er kannte die Bibliothek wie seine Westentasche und wusste stets genau, wo er was fand. Leute mit Büchern im Arm kamen und gingen, und es gefiel ihm, wenn ihm eine Gruppe seiner Studenten respektvoll zunickte und ihn mit »Professor« grüßte. Dann kam einmal eine junge Dame, die er nicht kannte, vor ihm aus einem Verwaltungstrakt der Bibliothek. Er sah ihr zu, wie sie ein Paar weiße Handschuhe anzog, die Treppe zum Raritätenraum hinaufging, dort einen dicken antiquarischen Folianten holte und damit zum Aufsichtstisch zurückkehrte. Er hatte noch nie jemand so Schönes gesehen und vergaß auf der Stelle, wo er hinwollte und warum er hier war. Als sie an ihm vorbeiging und Hallo sagte, war er völlig außer Gefecht gesetzt. Alle Neuronen in seinem großen Hirn hatten Fehlzündungen und feuerten in neue, unbekannte Richtungen.
Obwohl sie diese Begegnung später ganz anders schilderte als er (zurückhaltend und dezent versus haushoch übertrieben), gab es in beiden Versionen ein paar auffallende Details. Übereinstimmung herrschte (mehr oder weniger) bei ihrer Kleidung und ihrem allgemeinen Äußeren: blondes Haar, grüne Dreiviertelhose. Er sagte »grünliche Caprihosen«, sie »hellgrüne knöchellange Hosen, die mir meine Zimmergenossin geborgt hatte«. Und er hätte darauf schwören können, dass sie eine schlichte weiße Bluse trug, die seiner Erinnerung nach »tief ausgeschnitten« und »ihrer Zeit um Jahre voraus« war. Sie hielt dagegen, dass es sich um ihre üblichen Arbeitsklamotten gehandelt habe, was glaubhafter und der Wahrheit sicher näher war.
Unstrittig war, dass er minutenlang kein Wort herausbrachte. Erst nachdem er schließlich an die frische Luft gegangen und wieder hereingekommen war, hatte er die Fassung wiedergewonnen. Und beide erinnerten sich daran, dass er vergessen hatte, welches Buch er suchte. Als es ihm wieder einfiel, es aber ausgeliehen war, bot sie ihm an, ihn anzurufen, sobald es zurückgebracht worden sei. Doch er gab ihr aus Versehen eine Telefonnummer mit mehreren falschen Ziffern. Es sei so ähnlich gewesen, erzählte er später, als wolle man einen Schwung Worte in die Schreibmaschine tippen und die Finger erwischten ständig die falschen Tasten.
Sie fragte ihn nach seinem Namen. »Ich heiße Henry Aster«, erwiderte er. »Ich bin Schriftsteller. Darf ich erfahren, wie Sie heißen?« Sie errötete und sagte, Eleonore.
3
Er vergaß alles um sich herum und träumte die nächsten Tage nur von ihr. Er schrieb ihr Liebesbriefe mit selbstverfassten Gedichten, doch sie war für seine Dichtkünste nicht sonderlich empfänglich. Er hatte von Männern gelesen, die Byron und Keats rezitierten, woraufhin den Frauen die Sinne schwanden. Eleonore freilich war für diesen Typus gehobenen Annäherungsversuchs viel zu pragmatisch. Bei ihrer ersten Verabredung ging er mit ihr in Warten auf Godot, und nach dem Theaterbesuch bat sie ihn nicht mit in ihre Wohnung. Beim zweiten Mal hatte er dazugelernt und ging mir ihr eislaufen.
Sie hatte keine wissenschaftlichen oder intellektuellen Interessen im herkömmlichen Sinn, aber sie war alles andere als dumm. Bereitwillig gab er zu, dass sie ihm in puncto natürlicher Intelligenz überlegen sei, sie aber auf deutlich andere Dinge verwende. Sie war gern in der freien Natur, liebte Blumen, Vögel, kühle Frühlingsmorgen und warme Sommernächte. Sie konnte reiten und kannte jedes Gewächs, jede Blume, jeden Baum und jedes Kraut an der Ostküste ebenso wie jede bekannte Vogelart dort, ob Zugvogel oder nicht.
Ihre Kindheit und Jugend hatte sie in Canonsburg, Pennsylvania, verbracht, südlich von Pittsburgh, und dort oft auf dem Chartiers Hills Friedhof gespielt, wo sie gelernt hatte, sich nicht vor Gespenstern zu fürchten. Ihr erstes Pferd, einen unbezähmbaren Araber namens Kashmir, bekam sie mit zwölf, und von da an gab es für sie nur noch das Reiten. Kashmir trainierte sie selbst. Sie las Bücher zum Thema, und er benahm sich würdevoll wie ein römisches Streitross. Ein Mädchen, das in diesem Alter ganz allein und ohne irgendwelche Anleitung, nur mit ihrem Instinkt und ihrer Willenskraft lernt, ein majestätisches Tier von solcher Statur zu trainieren, besitzt eine andere Art von Intelligenz als die, die gemeinhin in der Schule gefragt ist.
Sie hatte drei smarte ältere Brüder, die alle an Ivy-League-Universitäten studierten – zwei in Harvard, einer in Yale. Niemand in ihrer Familie wäre auf den Gedanken gekommen, dass auch sie hätte aufs College gehen können. So etwas war für eine Frau nicht vorgesehen. Während ihre Herren Brüder an den Hochschulen im Nordosten reüssierten, wurde sie mit der Highschool fertig und musste sich entscheiden, auf welcher Höhe ihre Lebensbahn verlaufen sollte. Sobald sie das Thema Studium anschnitt, stellte ihr Vater sich taub, und ihre Mutter verzog sich in die Küche. Eines Abends setzte sie sich zu ihnen an den Abendbrottisch und verkündete ihnen, dass sie studieren wolle und ein paar gute, bezahlbare Colleges herausgesucht habe. Ihr Vater reagierte mit hemmungslosem, hämischem Lachen und beißendem Sarkasmus. Was sie mit einem Hochschulstudium wolle? Ob sie Reitseminare besuchen wolle? Habe sie schon bei der örtlichen Volkshochschule angerufen? Dort gebe es Pferde, soweit er wisse. Aber für solcherlei Flausen sei ohnehin kein Geld da. Noch auf Jahre hinaus habe er sich verpflichtet, jeden Dollar in die Ausbildung seiner Söhne zu stecken. Glaube sie, das Geld liege auf der Straße? Mitnichten!
»Dann unterstützt ihr mich also nicht?«, sagte sie ganz ruhig.
Ihr Vater streckte ihr seine leeren Hände entgegen. Ein deutliches Zeichen. »Siehst du? Wir haben nichts.«
Ein Jahr zuvor waren in der Nachbarschaft Eltern von ihrem eigenen Sohn ermordet worden. Er war in Eleonores Alter – und bis zu dem strahlenden Augustmorgen, als er nach dem Frühstück in die Scheune ging und die Axt holte, ein mustergültiges Kind gewesen. Nach der Tat saß er eine Weile lang in dem endlich gefundenen Frieden, rief dann die Polizei an und meldete das Verbrechen. Auf die Frage, warum er es getan habe, erwiderte er: »Mehr Hohn und Spott konnte ich nicht ertragen.«
Eleonore stand auf.
»Wo willst du hin?«, fragte ihr Vater.
»In die Scheune.«
»Um die Axt zu holen?«
»Nein, um den Pferden Auf Wiedersehen zu sagen.«
Sie nahm ihr Geld und ihr gebrochenes Herz und schrieb sich im Herbst an der California University of Pennsylvania ein. Zwei Jahre später hatte sie ihr Lehrerdiplom und war für alles bereit, was das Leben zu bieten hatte. Weil sie es an der Zeit fand, in die Welt hinauszugehen, und sich selbst beweisen wollte, dass sie den Mumm dazu hatte, zog sie weiter in den Süden, nach Baltimore. Sie arbeitete seit drei Wochen in der Bibliothek, als Henry dort hineinging und alles anders wurde.
Ich kann wahrscheinlich von Glück reden, dass sich meine Eltern getroffen haben und einander so attraktiv fanden, dass sie Kinder in die Welt setzten. Jetzt allerdings begreife ich, dass es für beide besser gewesen wäre, wenn das nie passiert wäre.
Mein Vater hatte Old Buckram mit großen Plänen verlassen. Er fand, er habe die nötigen Voraussetzungen – den Verstand, das Talent, das Ohr –, um im Laufe der Zeit ein erfolgreicher Schriftsteller zu werden. Er träumte davon, eines Tages auf einer Stufe mit Wolfe, Faulkner, Fitzgerald zu stehen. Doch letztlich war er nur ein Mann, dessen Träume, wie bei so vielen von uns, größer waren als er selbst.
Und dieser Mann traf auf die strahlende Seele einer Frau, die meine Mutter werden sollte. Im Verlauf der Jahre sollte das Leben ihnen vieles abverlangen und sie schwer prüfen. Sein unstillbarer Durst nach allem und jedem würde sich verflüchtigen wie ein Trugbild, während ihre unbeugsame Daseinsfreude nur dann wieder auflebte, wenn sie im wilden Galopp über die Wiesen preschte, nur sie selbst Zeugin ihrer Kühnheit. Ja, sie waren zum Scheitern verurteilt. Doch das war damals nicht vorauszusehen.
Als mein Vater 1967 mit dem Jurastudium fertig war, heirateten sie vor dem Friedensrichter und zogen in eine Wohnung im zweiten Stock der West Fairmont Avenue in Baltimore. Meine Mutter liebte ihren Mann sehr und war überglücklich. Das sehe ich auf den Fotos. Eine langmütige, wunderschöne Zufriedenheit liegt in ihrem Lächeln.
Er fing ernsthaft an zu schreiben. Schrieb über Maddy. Schrieb über Old Buckram. Davon, wie die wirbelnden weißen Nebelschwaden in den Tälern aufstiegen und die grünen Berge in der Ferne zu herrlichen Blautönen verblassten. Wie an frühen Herbstabenden allenthalben der Holzrauch aus den Feuern stieg und die Milchstraße langsam sichtbar wurde. Er erinnerte sich an jede Einzelheit. Die Zeit vergehe dort langsamer, erzählte er Eleonore, aber nicht für ihn. Für ihn sei es anders. Für ihn habe Old Buckram eine Traurigkeit, die er nie verwinden werde. Warum, wisse er nicht. Wenn er nachts bedrückt war und nicht schlafen konnte, las er ihr vor, was er geschrieben hatte. Mit staunenden Augen lag sie dann am Fußende des Bettes.
Ein Dutzend Mal stellte er die Schreibmaschine um und versuchte, den perfekten Platz zum Schreiben zu finden. Ihre Wohnung hatte im Schlafzimmer einen winzig kleinen Balkon zur Straße hin, und abends schob er seinen Schreibtisch an die offene Tür, um dort im letzten Tageslicht zu arbeiten. Von Zeit zu Zeit schaute er auf und beobachtete die wenigen Menschen, die unter ihm hergingen. Er ließ sich leicht ablenken, regte sich aber entsetzlich über alles auf, was seine Aufmerksamkeit vom Schreiben abzog. »Schostakowitsch hat draußen auf dem Flur komponiert«, sagte er einmal, »nicht, um seine Familie vor dem Terror des KGB zu bewahren – er musste ja immer damit rechnen, dass man kam und ihn abholte –, sondern weil er meinte, er könne sich dort besser konzentrieren.«
Er musste nur rufen, dann brachte meine Mutter noch ein Glas Bier, einen Wodka-Tonic oder sonst was, je nachdem, welche Flasche gerade angebrochen war. Sagte ihm, wenn es dunkel wurde oder die Kälte durch die Balkontür kam. Sie bereitete einfache Abendessen für sie beide, und falls ihm mal nicht nach Essen war, stellte sie den Teller auf den Schreibtisch neben ihm. Irgendwann sah er ihn dann und nahm etwas zu sich.
An einem Freitag im Mai 1968 fing Henry früh zu schreiben und noch früher zu trinken an, und als er sich am Spätnachmittag nicht mehr rühren konnte, kamen auch die Worte nicht mehr. Schlecht gelaunt und frustriert, wie er war, vertrieb er Eleonore aus der Wohnung. Sie trat gerade aus der Haustür, da sah sie seine Schreibmaschine wie ein Flugzeug durch die Luft sausen und mitten auf die Straße krachen. Je nun. Eine Weile lang schrieb er eben mit der Hand.
Kurz danach bekam er von Helton eine lapidare Mitteilung auf einem ausgerissenen, unlinierten Blatt Papier. Da sein Vater nicht gerade als großartiger Briefeschreiber bekannt war, deutete allein schon der Umstand, überhaupt einen Brief mit der selten gesehenen Handschrift zu bekommen, auf schlechte Nachrichten aus Old Buckram hin. »Deine Mutter fühlt sich nicht gut«, schrieb Helton, »aber es geht bestimmt vorbei. Ich wollte es Dir nur sagen.« Auf der Rückseite des Blattes ein Nachsatz: »Du musst nicht nach Hause kommen. Es sei denn, Du wolltest es ohnehin. Ich schaffe das auch so.« Helton wollte ihn nicht unter Druck setzen, aber sein Ansinnen war klar.
Der Gedanke an Maddys sich verschlechternden Gesundheitszustand begann an meinem Vater zu zerren wie ein Schiffsanker. Er wollte nicht alles Helton überlassen, der sich kaum selbst versorgen konnte. Ein paar Wochen später bekam er wieder einen Brief. Jetzt hieß es: »Langsam mache ich mir Sorgen.«
In der Nacht nach dem zweiten Brief saß das junge Paar, ans Kopfende gelehnt, auf dem Bett. Durch die offene Balkontür kam die sommerliche Wärme herein. Henry trank Wein, las im trüben Licht der einzigen Lampe Updike und versuchte sich einzureden, dass er wegen Maddy sowieso nichts tun könne. Völlig unvermittelt sagte er zu Eleonore: »Ich will nicht zurück.«
Sie hatte die Briefe gelesen. »Ich weiß, dass du das nicht willst«, erwiderte sie, »aber vielleicht sollten wir.«
Er stand auf, holte eine neue Weinflasche aus der kleinen Küche und kam ins Bett zurück. »Es fühlt sich nicht wie zu Hause an. Hat es nie.«
»Es muss ja nicht zu Hause sein«, sagte sie und nahm seine Hand. »Falls es uns nicht gefällt, können wir wieder gehen, wenn …«
»Wenn? Wenn wir dort nicht mehr sein müssen?« Wenn Maddy gestorben ist, hatte sie gemeint, aber nicht sagen wollen, und er wusste es. »Wenn ich gehe«, sagte er, »gehst du dann mit?«
»Natürlich. Das weißt du doch.«
Die Worte auszusprechen, es sich real vorzustellen, machte es plötzlich möglich. Sie fand einen Umzug in die Berge von North Carolina im Hochsommer sogar eine erfreuliche, abenteuerliche Aussicht. Ganz kurz hatte sie die grünen Berge und hochgelegenen Wiesen und Felder von Old Buckram in immerwährender blühender Üppigkeit vor Augen. Ein verführerischer Optimismus führt nur allzu oft zu einer törichten Entscheidung.
»Wenn wir hinziehen«, sagte sie aufgeregt und schon ganz verzaubert, »meinst du, dann könnten wir …«
»Ein Pferd kaufen? Es gibt jede Menge Pferde in Old Buckram.«
»Auch Araber? Es würde mich überraschen, wenn es welche gäbe. Aber dann brauchen wir ein Haus mit einer eingezäunten Weide daneben oder nicht weit entfernt und einen Stall. Um den Rest kümmere ich mich.«
»Wenn wir uns ein Pferd zulegen«, sagte er, »möchte ich ihm den Namen geben.«
»Henry«, sagte Eleonore und legte die Hände auf ihren Bauch, »ich habe auch noch über was anderes nachgedacht. Ich will ein Kind nicht in der Stadt großziehen.«
Bevor sie nach Old Buckram gingen, besuchte mein Vater ein letztes Mal das Poe-Haus im Herzen von Baltimore, um sich gebührend von dort zu verabschieden. Eleonore fand ihn, als er betrunken auf der Vordertreppe saß und laut Gedichte rezitierte, die sie noch nie gehört hatte. »Nun mir flüstern Ulmenblätter / misstön’ge irre Melodien / Und Klagemelodien wie Schatten / spuken in den Trauerweiden …« Eine halbe Flasche Wodka hatte er schon intus. Kein verheißungsvoller Beginn, aber ein passendes Ende. Nachdem Eleonore am nächsten Morgen die Karten von drei Bundesstaaten studiert hatte, während er noch schlief, lud sie ihn ins Auto, und zusammen fuhren sie in die nebligen Berge North Carolinas. Er kehrte nach Hause zurück.
4
Als mein Vater klein war, machte die ganze Familie zu Beginn des Frühlings, wenn die Hartriegelsträucher in der blauen Gebirgskette weiß und golden blühten, einen Ausflug zum Farmers’ Market. Über eine schmale Schotterstraße die bewaldeten Hänge hinauf und hinab. Von einer Bergkuppe aus sah man, wie die Wälder gen Westen zurückwichen. Von dort ging es tief in ein großes Tal, stieg steil wieder an, und dann zeigte sich das steingraue Antlitz des Ben Hennom, eines uralten, von Zeit und Witterung glatt und dunkel geschliffenen Berges. Halb verborgen von einer Reihe gespenstischer Bäume, so alt wie die Zeit selbst, stand ein riesiges Haus aus schwarzem Eisen und Glas. Bei Tag war es ein architektonisches Kuriosum. Wegen der eigenartigen Faltungen des Berges schien es, selbst wenn die Sonne vom wolkenlosen Himmel knallte, immer im Schatten zu liegen und war von morgens bis abends von einem langsam wabernden Nebel, dicht wie Feuerqualm, umhüllt. Im Dunkel der Nacht brütete es hingegen wie ein Raubvogel mit glühenden Augen am Berghang. Niemals vorher oder nachher war ein solches Haus erbaut worden. Die Kinder drängten sich immer an die Autofenster, um ehrfurchtsvoll schweigend dieses großartige, mysteriöse Gebäude zu betrachten.
Ein stellvertretender Direktor der R. J. Reynolds Tobacco Company in Winston-Salem ließ es 1918 planen und errichten, gewiss, um in den höheren Lagen von Old Buckram Erholung von der drückenden Sommerhitze des Piedmont zu finden. Er kaufte für billiges Geld die hundert Morgen um das Haus – zu der Zeit war Land preiswert und reichlich vorhanden –, doch bei seinem Bau scheute er weder Kosten, noch hielt er sich an den herrschenden Architekturgeschmack. Entworfen wurde es von einem Schwager des Mannes, der ausgebildeter Architekt und Hobby-Okkultist war und, gelinde gesagt, eine Vorliebe fürs Unkonventionelle und Makabre hatte. Ein Jahr nach seinem Abschluss in Princeton war er nach Palenque gereist, um sich Inspirationen für seine beginnende Architektenkarriere zu holen und dem fantasielosen Design im amerikanischen Süden etwas entgegenzusetzen. Nach der üblen Attacke eines großen schwarzen Vogels, der ihm beinahe ein Auge auspickte, wurde er wochenlang von hohem Fieber geschüttelt. Knapp dem Tode entronnen, konnte er Mexiko zwar wieder verlassen, war aber hinfort ein Gezeichneter. Ein dunkler Zauber hatte sich seiner Seele bemächtigt. Zurück in North Carolina begann er mit seinem Opus Magnum, das gleichzeitig seine erste und letzte Schöpfung werden sollte: das große Haus am Berg. Bevor er erleben konnte, wie aus seinen Zeichnungen Wirklichkeit wurde, kehrte das Fieber zurück, und er tat seinen letzten Atemzug in der kalten Bergluft am Ben Hennom. Gebaut wurde trotzdem.
Jahrzehntelang wurde das fertige Haus kaum benutzt oder bewohnt und, völlig heruntergekommen, 1963 an einen exzentrischen Hotelier verkauft, dessen Gattin dort ein exklusives Bed and Breakfast betreiben sollte, damit sie nicht mehr ausschließlich zu Hause auf ihn wartete. Als das endete wie alle schlechten Ideen, zog er mit Frau und drei Töchtern dort ein. Er ließ ein großes Einfahrtstor am Fuß des Berges errichten, und die Familie verschwand langsam aus dem öffentlichen Leben. Dann jedoch verwahrlosten Haus und Grundstück wieder, und in der Stadt munkelte man, der Hotelier habe eine unheilbare exotische Krankheit. Eines Tages fiel jemandem auf, dass Tag und Nacht die Lichter in dem Haus brannten. Die Wochen vergingen, ehe eines nach dem anderen dann doch erlosch. Schließlich rief jemand die Polizei, die stieg über das Tor und durchsuchte das Anwesen. Offenbar war niemand da. Als zum fünften Mal die Hypothek nicht getilgt wurde, wollte die Bank wissen, was los war, und schickte einen Angestellten hin. Nachdem dieser Unglücksvogel lange geklopft und in alle Fenster geschaut hatte, trat er eine Glasscheibe ein und ging ins Haus. Es war vollkommen eingerichtet und aufgeräumt, als erwarte man Gäste. Der Mann rief, aber niemand antwortete. Dann entdeckte er in der kalten, düsteren Festung Entsetzliches. Er rannte hinaus und rief die Polizei.
Der mit dem Fall betraute Beamte schrieb in seinen ersten Bericht: »Etwas Schreckliches ist dort vorgefallen. Was genau, kann ich nicht sagen. Es ist seltsam. Zwei Erwachsene sind tot. Die drei Kinder nicht aufzufinden. Keine Hinweise auf ihren Verbleib. Die Todesursache der Eltern ungeklärt (die genauen Untersuchungen stehen noch aus), könnte aber selbstverschuldet sein, entweder freiwillig oder unfreiwillig (unter Zwang). Grabungsarbeiten im Gelände beginnen diese Woche.« Drei Wochen später hieß es: »Heute sind die Kinder gefunden worden. Mit dem Gesicht nach oben verscharrt in einer Grube im Wald hinter dem Haus. Nebeneinander, nicht übereinander. Offenbar mehrfache Knochenbrüche.« Ein ergänzender Bericht nannte als Todesursache für die Kinder Ertrinken. Wie oder warum die Morde verübt worden waren, konnte die Polizei niemals schlüssig erklären.
Fünf Jahre später gehörte das Haus immer noch der Bank, ein Verkauf war nicht absehbar. Das war der Stand der Dinge, als meine Eltern, Eleonore schwanger, nach Old Buckram kamen und zu Helton und Maddy in das beengte kleine Haus am Ende der Schotterstraße zogen. Ihr Zimmer war gerade so groß, dass ein durchgelegenes Doppelbett und ein kleiner Arbeitstisch für die Schreibmaschine meines Vaters hineinpassten. Noch bevor sechs Monate um waren, hatte der Tisch einer Wiege Platz gemacht, die angeschimmelt vom Boden des Hauses geholt, gründlich gesäubert, angestrichen und baulich verstärkt worden war. Meine Eltern nannten mich Henry, nach meinem Vater.
Aus Mangel an anderweitigen Möglichkeiten wurden Arbeitstisch und Schreibmaschine meines Vaters kurzerhand auf die hintere Veranda verbannt, wo sich auf verstaubten Regalen die von Maddy bemalten Keramiksachen stapelten. Dort draußen, zwischen lauter Sperrmüll, saß dann mein Vater, während das Haus schlief, stundenlang in der hereinbrechenden Nacht und versuchte, im Lampenlicht zu schreiben, belagert von flatternden weißen Faltern.
Da er in einem Umkreis von hundertfünfzig Kilometern keinen interessanten Lehrerjob fand, begann er in einer der beiden Anwaltskanzleien der Stadt zu arbeiten. Die Einkünfte eines Anwalts sind selten so exorbitant, wie die Leute meinen, vor allem nicht für jene, die in den ländlicheren Gegenden eines Bundesstaats viel mit Bau-, Grundstücks- und Bergrecht, Wasserrechten und einfachen Strafsachen sowie wenig lukrativen Grundstücksverkäufen zu tun haben. In manchen Monaten schrieb mein Vater mit Müh und Not schwarze Zahlen. Meistens arbeitete er für Leute, die ihn überhaupt nicht bezahlen konnten. Um sein Einkommen aufzustocken, benutzte er seinen messerscharfen Verstand und übernahm ein paar komplizierte Fälle von ärztlichen Kunstfehlern gegen Erfolgshonorar, vertragsgemäß ein Drittel jeder Schadensersatzzahlung. Die ersten drei Fälle kosteten ihn Geld und fast den Job. Der vierte wurde für etwas mehr als drei Millionen außergerichtlich beigelegt. Jetzt können wir ein Pferd für Eleonore kaufen, war sein erster Gedanke.
Kurz darauf kam ihm zu Ohren, dass das große Haus am Berg zum Verkauf stand, und zwar deutlich unter dem Marktpreis. Exakt viereinhalb Stunden nach dieser verheißungsvollen Entdeckung stieg er die steile Kiesauffahrt hinauf und betrachtete aus der Nähe, was er bis dahin nur von Weitem kannte. Was für ein Anblick! Düster und unheilvoll erhob sich das Haus, ein monströses Skelett, in den aschgrauen Himmel. Wenn er vom Vorplatz aus nach Osten schaute, konnte er die wenigen Lichter von Old Buckram und gen Südwesten in der blauen Ferne die uralte Bergkette der Blue Ridge Mountains sehen. Er schob die bleischwere Haustür auf und betrat staunend ein Mausoleum von Vorhalle, das ihn mit Spinnwebvorhängen und einer Schar davonflitzender Mäuse begrüßte. Langsam zog es ihn ins Innere, wo er im ersten Stock eine große holzvertäfelte Bibliothek mit endlosen, bis zur Decke reichenden Regalen vorfand. Bücher bedeckten die Wände, stapelten sich in Ecken und Nischen. Auf der Stelle entschloss sich mein Vater zum Kauf des Hauses, ganz egal, was es kostete. Hier kann ich schreiben, dachte er.
Weit unter den Felswänden und einem schwindelerregenden Abhang verlief das zum Haus gehörende Gelände wieder eben bis zur Straße. Dort verbarg sich in einem Hain von Buchen und Schwarzeichen ein dunkler Stall, alt wie der Berg selbst. Mindestens dreißig Morgen dieses ebenen Bereichs waren gerodet und von einem an vielen Stellen eingebrochenen Zaun umgeben. Abends, zurück im Haus von Helton und Maddy, sagte mein Vater zu Eleonore: »Wir ziehen um, und wir kaufen ein Pferd. Ich möchte, dass es Annabel Lee heißt.« Sie brauchten weniger als einen Tag zum Einzug und den Rest ihres Lebens zum Auszug.
5
Das viele Holz in dem Haus wäre, gebeizt und auf Hochglanz poliert, innen über alle Maßen elegant und hochherrschaftlich gewesen. Mit zusammengekniffenen Augen konnte man erkennen, was der wahnsinnige Architekt vorgehabt hatte, mit offenen nicht mehr.
Sein finsteres Antlitz wandte es nach Osten, der aufgehenden Sonne zu. Der erste Raum, den man durch die Haupteingangstür aus massivem Eichenholz betrat, war die schon erwähnte Vorhalle, mit düsterem Schiefer ausgelegt und doppelt so groß wie die Wohnung meiner Eltern in Baltimore. Rundbogengänge führten in alle Richtungen davon ab, eine weit geschwungene Treppe mit blutroten Stufen wand sich asymmetrisch nach oben, außer Sichtweite. Zur Rechten kam man durch eine Reihe von Türen zuerst in ein ungemütliches Wohnzimmer (das wir nie benutzen sollten), dann in ein Esszimmer mit Platz für fünfzig Leute sowie ein tristes, trostloses Raucherzimmer. Wir gebrauchten es nicht als solches, aber in seinem früheren Leben war das eindeutig sein Sinn und Zweck gewesen. Zwei taillenhohe Granitobelisken, unter deren pyramidenförmiger abnehmbarer Spitze man Zigarrenstummel und Zigarettenkippen in den Behältern darunter ablegen konnte, bezeugten es.
Die Außenwände bestanden aus Glasfenstern vom Boden bis zur Decke, ein ähnlicher Raum in der gegenüberliegenden Ecke des Hauses bildete das Pendant. Schaute man vom Raucherzimmer zur Stadt hin, sah man immer wieder Teile der Avernus Road, der alten, sich am gegenüberliegenden Hang entlangwindenden Schotterstraße, über die Helton mit Maddy und den Kindern vor so vielen Jahren zum Farmers’ Market gefahren war.
Hinter dem Raucherzimmer lag ein offener Raum, den wir den Bunten Salon nannten. In dem gut gemeinten, aber vergeblichen Versuch, ein wenig dringend notwendigen Frohsinn in die ansonsten leichenblasse Umgebung zu bringen, war eine Wand olivgrün gestrichen, die zweite paprikaorange, die dritte kanariengelb und die vierte lavendelblau. Eine faszinierende Farbzusammenstellung. Hoch oben an den Wänden verlief eine eierschalenfarbene Leiste für Bilderrahmen und versuchte erfolglos, dem Raum etwas Zusammenhängendes zu verleihen. In bizarrem Kontrast zu den Farbtsunamis hingen graue Bilder mit trostlosen Winterszenen aus den Bergen an den Wänden. In allen vier Ecken stand ein grellbunt längs gestreifter Sessel mit hoher Rückenlehne, der wiederum gar nicht zu den dahinter zusammenstoßenden, verschiedenfarbigen Wänden passte. Mein Vater drohte ständig damit, das Ganze weiß zu übertünchen, doch meine Mutter fand es reizend, und so blieb es, wie es war.