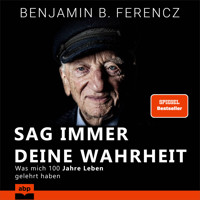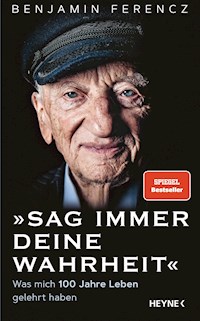
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Benjamin Ferencz blickt auf 100 Jahre eines bemerkenswerten Lebens zurück. Unermüdlich hat er sich für eine gerechte und friedliche Welt eingesetzt. Dieses Ziel, das er als Chefankläger bei den Nürnberger Prozessen bis zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs mit nie nachlassendem Engagement verfolgte, lässt ihn bis heute nicht ruhen. Der Sohn armer Migranten in den USA wurde als US-Soldat im Zweiten Weltkrieg und Ermittler im besiegten Nazideutschland Zeuge des Unsagbaren, das Menschen einander anzutun in der Lage sind. Dennoch verlor er nie den Glauben an die Befähigung des Menschen zum Guten. Sein Optimismus und sein Scharfsinn, seine Dankbarkeit und Demut beim Blick auf ein erfülltes Leben, seine tiefe Überzeugung, im Kampf für eine menschenwürdige Welt das Richtige zu tun, seine Energie und sein Humor: Ben Ferencz hat viel weiterzugeben in dieser zutiefst persönlich erzählten Autobiographie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
BENJAMINFERENCZ
»Sag immer Deine Wahrheit«
Was mich 100 Jahre Leben gelehrt habenVerfasst von Nadia Khomami
Aus dem Englischen von Elisabeth Schmalen
Die Originalausgabe erschien 2020 in Großbritannien unter dem Titel »Parting Words; 9 Lessons for a Remarkable Life« bei Sphere, einem Imprint von Little, Brown Book GroupDer Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. © 2020 Benjamin FerenczVerfasst von Nadia Khomami© der deutschsprachigen Ausgabe 2020 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenRedaktion: Ulrike Strerath-BolzCovergestaltung: Martina Eisele Grafik DesignCoverfoto: Robin Utrecht FotografieHerstellung: Helga SchörnigBildredaktion: Tanja ZielezniakSatz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, MünchenISBN978-3-641-27011-7V003www.heyne.de
Für meine geliebte verstorbene Frau Gertrude, die am 14.September 2019 von uns ging, nach vierundsiebzig Jahren glücklicher Ehe und liebevoller Partnerschaft ohne jeden Streit.
Inhalt
Einleitung
KAPITEL 1ÜBER TRÄUME
Man muss nicht mit dem Strom schwimmen
KAPITEL 2ÜBER BILDUNG
Lernen an jedem Ort
KAPITEL 3ÜBER UMSTÄNDE
Wie man sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht
KAPITEL 4ÜBER DAS LEBEN
Der Weg ist immer steinig und führt niemals geradeaus
KAPITEL 5ÜBER PRINZIPIEN
Entscheide dich für das Gute
KAPITEL 6ÜBER DIE WAHRHEIT
Sprich sie aus, auch wenn niemand zuhört
KAPITEL 7ÜBER DIE LIEBE
Es gibt Wichtigeres, als die Welt zu retten
KAPITEL 8ÜBER DURCHHALTEVERMÖGEN
Den Stein ein kleines bisschen weiter den Hügel hinaufrollen
KAPITEL 9ÜBER DIE ZUKUNFT
Die Augen offen, die Hände am Steuer
Dank
Bildnachweis
Einleitung
Ich frage Ben Ferencz oft, warum er so gut gelaunt ist.
»Wer innerlich weint, sollte nach außen besser lachen, Mädel. Es bringt ja nichts, in einem See aus Tränen zu ertrinken«, lautet seine Antwort.
Geschichte war für mich etwas gewesen, auf das man nur in Büchern und den schwarz-weißen Filmausschnitten trifft, die in der Schule gezeigt werden. Die alten Bilder von Krieg, Zerstörung und Wiederaufbau scheinen weit von unserem heutigen Alltag entfernt zu sein. Aber die Menschen, die aktiv dafür gesorgt haben, dass die Welt in ihrer heutigen Form existiert, sind nicht immer illustre Gestalten aus einer längst vergangenen Zeit, bevor das Gute über das Böse triumphierte.
Ich entdeckte Ben durch puren Zufall. Als ich eines Abends durch die amerikanischen Nachrichtenkanäle zappte, blieb ich an einem Bericht über ihn hängen. Ich schrieb damals für den Guardian in London, und Bens Worte weckten mein Interesse. Als ich seinen Namen recherchierte, stellte ich überrascht fest, was für ein bedeutender Mann er war und über welchen großen Erfahrungsschatz er verfügte.
In einem Video, aufgenommen im Hauptverhandlungssaal des teilweise wiederaufgebauten Justizpalasts in Nürnberg– der Stadt, in der die Nazis einst ihre Reichsparteitage abhielten– , sah ich, wie Ben, ein wortgewandter und entschlossener Siebenundzwanzigjähriger, dessen geringe Körpergröße durch ein großes Holzpult verdeckt wurde, als Chefankläger den größten Mordprozess der Geschichte eröffnete. Die zweiundzwanzig Mitglieder der Einsatzgruppen, der Nazi-Vernichtungstruppen, die für den Tod von mehr als einer Million Juden und Angehörigen anderer Minderheiten verantwortlich waren, starrten ihn von der Anklagebank aus an.
Ich bin mir nicht sicher, warum mich dieser Anblick so berührte, aber ich verspürte ein plötzliches Bedürfnis, zum Telefon zu greifen und diesen Mann anzurufen. Vielleicht lag es daran, dass ich genauso alt war wie er während des Prozesses vor mehr als siebzig Jahren. Vielleicht lag es an der aktuellen Nachrichtenlage. Das Votum der Briten, aus der EU auszutreten, die Wahl eines Reality-TV-Stars zum fünfundvierzigsten Präsidenten der Vereinigten Staaten, die Bürgerkriege im Nahen Osten– überall schien die weltweite Nachkriegsordnung rasant in sich zusammenzufallen. Vielleicht lag es aber auch einfach nur daran, dass ich gerade eine schlimme Trennung hinter mir hatte und jemanden brauchte, der mir in Erinnerung rief, wie unbedeutend mein privates Drama angesichts tief greifender Probleme wie Krieg und Terror war.
Also nahm ich Kontakt zu Ben auf und erhielt einen Termin für ein Telefongespräch mit ihm. Ich muss zugeben, dass ich einen ernsten, schwermütigen Menschen erwartete. Doch das Erste, was mir auffiel, war seine mitfühlende und charmante Art. Auch im hundertersten Lebensjahr hat er nichts von seinem geistreichen Scharfsinn eingebüßt, und trotz der Schrecken, die er erlebt hat, ist er immer zu Scherzen aufgelegt.
Innerhalb von Minuten war klar, dass er über die Gabe verfügt, Menschen zu inspirieren. Aus unserem Gespräch wurde ein Interview, das im Feuilleton des Guardian erschien. Der Artikel zog mehr Aufmerksamkeit auf sich als alles andere, was wir an jenem Tag herausbrachten, und die Leute lasen ihn am Stück bis zum Ende durch, was in heutigen Zeiten sehr ungewöhnlich ist. Ich habe in fünf Jahren als Journalistin nie positivere Rückmeldungen auf eine Geschichte erhalten. Leser aller Altersgruppen aus der ganzen Welt meldeten sich bei mir, um mir mitzuteilen, wie sehr Bens Worte sie berührt hatten.
Die folgenden Kapitel sind das Ergebnis einer Reihe von Gesprächen, die ich über mehrere Monate hinweg mit Ben geführt habe. Ich könnte behaupten, dass ich mich weiterhin mit ihm unterhalten habe, damit mehr Menschen in den Genuss dessen kommen, was er zu sagen hat. Das trifft auch zu, doch auf einer tieferen Ebene blieb ich aus rein egoistischen Gründen mit Ben in Kontakt: Er ist ein überaus einnehmender und unterhaltsamer Mensch und gibt wirklich gute Ratschläge.
»Ich bin heute traurig, Benny«, sage ich manchmal.
»Meine Liebe«, antwortet er dann, »was auch immer der Grund ist, ich bin mir sicher, dass du schon Schlimmeres überstanden hast.«
Ben ist unheimlich gut darin, sich an genaue Details und Anekdoten aus früheren Zeiten zu erinnern, sei es der volle Name von Menschen, die er getroffen hat, oder das Wetter an einem bestimmten Tag. Als ich ihm vorschlug, die Gespräche zu führen, aus denen letztendlich dieses Buch entstehen sollte, reagierte er zunächst zurückhaltend. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel ich zu tun habe«, sagte er. »Ich bin so beschäftigt, dass ich keine Zeit habe, um herauszufinden, warum ich so bin, wie ich bin; ich habe ja nicht einmal Zeit, um zu sterben.« So ging es eine Zeit lang hin und her– er beharrte darauf, dass sein Terminplan voll sei, ich darauf, dass das Ganze nicht viel Zeit in Anspruch nehmen würde. »Meine Liebe«, meinte er nach einer Dreiviertelstunde trocken zu mir, »so bringst du deinen Protagonisten noch ins Grab.«
Am allermeisten hat mich im Verlauf unserer gemeinsamen Zeit fasziniert, wie viel Ben und ich gemeinsam haben, obwohl ein Ozean und sieben Jahrzehnte zwischen uns liegen. Wir sind beide in sehr jungen Jahren in ein neues Land gekommen und in einer rauen Umgebung aufgewachsen, gefangen zwischen den Kulturen und den Kontinenten. Wir haben uns Sprachen durch Freundschaften und untertitelte Filme beigebracht. Wir waren lernbegierig, aber unfähig, uns an Regeln und Vorschriften zu halten. Wir waren die Ersten in unserem engeren Familienkreis, die auf die Universität gingen, wo wir schnell feststellten, dass wir mehr Zeit und Mühe aufbringen mussten als andere, um nicht den Anschluss zu verlieren. Wir studierten beide Jura, schwammen gern und verloren niemals den Humor. Wir haben sogar am gleichen Tag Geburtstag, auch wenn Ben mich jedes Mal, wenn ich ihn daran erinnere, warnt: »Komm nicht auf die Idee, etwas Blödes zu veranstalten und mir damit den Tag zu ruinieren, Kind.«
Auf den Bildern zum Artikel im Guardian trägt Ben blaue Shorts und Hosenträger, ein fröhlicher Mann in einer Wohnanlage in Delray Beach, Florida. Er hat die Hände in die Hüfte gestützt und schaut durch seine Brille in die Kamera, ein Lächeln auf den Lippen und die Sonne hinter dem Kopf. Auf einen unbeteiligten Betrachter wirkt er wie der nette alte Mann von nebenan, der Großvater, den man gerne am Wochenende und in den Ferien besucht. In seinem Garten hört man oft Enten quaken.
Doch Ben ist in keiner Hinsicht gewöhnlich. Fatou Bensouda, die Chefanklägerin am Internationalen Strafgerichtshof, hat ihn als »Ikone der internationalen Strafgerichtsbarkeit« bezeichnet; Alan Dershowitz, ein angesehener Anwalt und Verfechter der bürgerlichen Freiheit, der O. J. Simpson und Donald Trump verteidigt hat, nannte ihn die »Verkörperung des internationalen Weltverbesserers«, und Barry Avrich, der Regisseur der Netflix-Dokumentation Prosecuting Evil über Bens juristische Erfolge, in der alle Genannten auftreten, betrachtet ihn als eine der symbolträchtigsten Personen unserer Zeit.
Die folgenden Kapitel decken nur einen Teil dessen ab, was Ben im Verlauf seines bemerkenswerten Lebens alles gelernt hat, aber ich will versuchen, seine Geschichte hier zusammenzufassen. Er ist Träger von fünf Battle Stars– Verdienstauszeichnungen des US-Verteidigungsministeriums– , da er im Zweiten Weltkrieg sämtliche großen Schlachten in Europa miterlebt und überlebt hat. Er war bei der Landung in der Normandie dabei, beim Durchbruch durch die Maginot-Linie und den Westwall der deutschen Verteidigung, er hat den Rhein über die Brücke von Remagen überquert und war an der Abwehr der Ardennenoffensive in Bastogne beteiligt.
Nach seiner Versetzung in das Hauptquartier von General Pattons dritter Armee im Jahr 1944 erhielt Ben die Aufgabe, eine neue Abteilung zur Verfolgung von Kriegsverbrechen aufzubauen. Er war bei der oder kurz nach der Befreiung mehrerer Konzentrationslager vor Ort, darunter Buchenwald, Mauthausen, Flossenbürg und Ebensee, um Beweise für die Verbrechen der Nazis zu sichern– Beweise, die sich vor Gericht verwenden lassen würden. Ben grub oberflächlich verscharrte Leichen aus, manchmal mit bloßen Händen. Und er sah Szenen des absoluten Grauens, die ihn bis heute verfolgen.
Als sich die USA in die Wirren des Vietnamkriegs verstrickten, beschloss Ben, aus seiner Kanzlei auszusteigen und sich für den Frieden einzusetzen. Er schrieb in den folgenden Jahren mehrere Bücher, in denen er seine Ideen für eine internationale juristische Instanz darlegte und die entscheidend zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag beitrugen. Außerdem setzte er sich dafür ein, Holocaust-Überlebenden ihren Besitz zurückzuerstatten, und war an den Verhandlungen über das Wiedergutmachungsabkommen zwischen Israel und der Bundesrepublik Deutschland beteiligt.
Bens Karriere umspannt mehr als siebzig Jahre; er hat mehr erlebt als die meisten Menschen. Seine Geschichte ist eine klassische Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Erzählung. Er wurde in eine jüdische Familie in Transsilvanien hineingeboren und zog schon im Alter von neun Monaten mit seinen Eltern und Geschwistern nach Hell’s Kitchen in New York. Dort arbeitete er später hart daran, der Armut zu entkommen, bis er dank eines Stipendiums ein Jurastudium an der Harvard Law School absolvieren konnte.
Für seine Arbeit hat er viele Auszeichnungen erhalten, unter anderem 2014 die Medal of Freedom der Harvard University, die auch schon Nelson Mandela bekam. Ben nutzt seine Position bis heute, um sich für das Gute einzusetzen, und hat Millionen Dollar an das Genozid-Präventionszentrum des Holocaust Memorial Museum in Washington gespendet. Seine fortdauernden Bemühungen, eine globale Instanz zur Verfolgung von Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu etablieren, sind wirklich bemerkenswert. »Ich interessiere mich nicht für Ruhm, ich interessiere mich nicht für mein Erbe, ich interessiere mich nicht für Geld– ich würde alles weggeben«, sagt er. »Ich bin mittellos auf die Welt gekommen, habe den Großteil meiner Kindheit in Armut verbracht und gebe jetzt alles zurück.«
Der Mann gönnt sich einfach keine Ruhepause. An einem Wochenende, kurz bevor er wegen der Werbekampagne für die Netflix-Dokumentation nach Los Angeles flog, fragte ich ihn, ob er mit mir tauschen würde. »Du bist auf dem Weg ins sonnige Hollywood und ich sitze hier im verregneten London«, klagte ich. Er brach in sein übliches herzliches Gelächter aus und sagte, dass er natürlich sofort mit mir tauschen würde. »Ich habe einmal für das Holocaust Memorial Museum an einer Werbetour für einen Film teilgenommen«, erklärte er dann. »Es ging in New York los, und dann kamen Washington, Los Angeles, San Diego und Chicago. Aber da klappte ich zusammen. Meine nächste Erinnerung ist, wie ich im Krankenhaus aufwachte. Doch ich machte mir damals keine Sorgen, weil dort in dem kleinen Zimmer ein großes Kreuz an der Wand hing, unter dem stand: ›Auferstehungsgesellschaft Chicago‹.« Tod und Sterben sind bei ihm allgegenwärtige Themen. »Es könnte mir gar nicht besser gehen«, sagt er immer, wenn ich ihn frage. »Und weißt du auch, warum? Ich kenne die Alternativen.«
Es gibt niemanden mehr auf der Welt, der Bens Erfahrungen teilt. Als letzter noch lebender Ankläger der Nürnberger Prozesse hat er das passende Motto für alle, die wie er dafür sorgen wollen, dass der gesunde Menschenverstand über das Morden siegt: »Law, not war«– Recht statt Krieg. Dieser Satz taucht in jedem Gespräch mit ihm und in jeder seiner Anekdoten auf. Es wurde auch schon behauptet, Ben sei de facto eine Art Weltgewissen, weil er jeden Tag für mehr Gerechtigkeit kämpft. Seinem Sohn Donald zufolge beginnen sogar Mahlzeiten im Familienkreis mit der Frage: »Was hast du heute für die Menschheit getan?«
»Mir ist immer bewusst, wie viel Glück ich gehabt habe«, sagt Ben. »Ich bin als armer Sohn armer Eltern zur Welt gekommen. Ich habe die Schrecken des Krieges in jeder großen Schlacht überlebt. Ich habe eine wunderbare Frau kennengelernt. Ich habe vier Kinder großgezogen, die es zu etwas gebracht haben. Und ich erfreue mich einer hervorragenden Gesundheit. Mehr könnte niemand verlangen. Jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse oder zurückkomme, schätze ich mich glücklich.«
Als Nachrichtenredakteurin habe ich jeden Tag mit negativen Schlagzeilen zu tun. Die Welt scheint dem Untergang immer näher zu kommen. Die Welle des nationalistischen Denkens ist ungebrochen; Anführer der sogenannten freien Welt treten für Unilateralismus ein, während sie sich mit Beratern umgeben, die die Kriegstrommeln schlagen; die blutigen Aufstände reichen von Beirut bis nach Hongkong und Paris. Unsere Gesellschaften haben sich in ein Schlachtfeld für immer schlimmer werdende Kulturkämpfe verwandelt, die »Wir gegen sie«-Rhetorik erstickt jedes Mitgefühl und verteufelt Kompromisse. All das passiert, während etablierte Wirtschaftssysteme Ungleichheit und Korruption hervorbringen und Autokraten eine Minderheit gegen die andere aufhetzen und gleichzeitig an den in der Verfassung festgeschriebenen Regelungen und Institutionen sägen. Werte und Ideale, die einmal als selbstverständlich galten, etwa Gerechtigkeit und Großzügigkeit, sind immer stärker bedroht. Nie zuvor wurde eine Stimme wie die von Ben so dringend benötigt.
Doch manchmal stehen mir all diese Geschehnisse auch im Weg, und ich habe entweder zu viel zu tun oder ich vergesse, meinen Freund in der anderen Zeitzone anzurufen. »Die verschollene Nadia!«, neckt er mich dann, wenn ich mich schließlich bei ihm melde. »Rufst du nur an, um dich davon zu überzeugen, dass ich dich noch kenne?«
Aber Ben versteht mich, weil auch er die Nachrichten verfolgt. Er weiß, dass viel auf dem Spiel steht, weil er überzeugt ist, dass der nächste Krieg der letzte sein wird. Er mischt sich weiterhin überall dort ein, wo er es für sinnvoll hält– vor Kurzem hat er einen Brief an die New York Times geschrieben, als die USA und der Iran kurz vor einem offenen Konflikt standen. »Der Zirkus nimmt kein Ende«, sagt er. »Sie führen sich immer noch auf wie Dummköpfe.« Ben hält engagierte Vorträge an Schulen und Universitäten und geht die Stapel von Fanpost durch– oder Liebesbriefe, wie ich ihn gern aufziehe– , die er täglich erhält und die er hin und wieder auch beantwortet.
Es gibt Zyniker, die uns glauben machen wollen, dass sich die Menschen durch Geburt, ethnische Zugehörigkeit, Religion oder Grundüberzeugungen voneinander unterscheiden oder dass Flüchtlinge den Wohlstand und die Kultur eines Landes gefährden. All die Geschichten über Migrantenlager, Überquerungen des Ärmelkanals und Abschiebezentren dienen dazu, die Unbekannten zu entmenschlichen. Wir verinnerlichen diese Geschichten– bewusst oder unbewusst– und zweifeln an unseren oder anderer Leute Fähigkeiten, zu leuchten und Gutes zu tun. Aber in Ben sah ich etwas, das ich in mir so noch nicht entdeckt hatte: Vorstellungsvermögen, Fleiß und Stolz. Er lehrt uns, wie widerstandsfähig der Geist selbst unter schlimmsten Bedingungen ist. Wir können lernen, dass wir mehr gemeinsam haben, als uns bewusst ist, egal, woher wir kommen oder was wir tun, und dass wir vereint einfach stärker sind.
Fortschritt geht nicht schnell vonstatten, es handelt sich um eine langsame und komplexe Entwicklung. Doch Wunder sind möglich, das ruft Ben mir gern in Erinnerung, wenn ich frustriert bin. Galten nicht selbst grundlegende Dinge wie die Abschaffung des Kolonialismus und der Sklaverei, die Frauenrechte, die sexuelle Befreiung und sogar die Mondlandung noch vor wenigen Jahrzehnten als unvorstellbar?