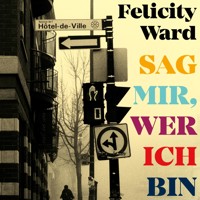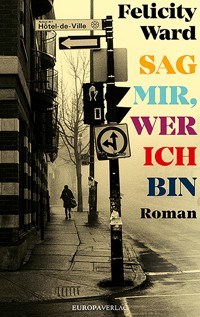
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ich habe immer gewusst, dass ich in Paris sterben werde", flüstert Sally, als sie in einem Pariser Krankenhaus aus dem Koma erwacht. "Aber du bist nicht tot", antwortet der Arzt. "Du lebst und du wirst wieder in Ordnung kommen." Doch schon bald wird dem Mädchen klar, dass sie nie wieder in Ordnung kommen wird. Nach einem Überfall, bei dem sie beinahe vergewaltigt und ermordet worden wäre, erholt sie sich zwar körperlich und kehrt in ihre Heimat Montreal zurück. Doch ihr Zuhause ist nicht mehr der sichere Ort, der es einmal war. Denn Sally ist überzeugt: Der Angreifer sucht überall nach ihr – um sein Werk zu vollenden und sie zu töten … es sei denn, sie käme ihm damit zuvor. Jahre nach dem grauenvollen Ereignis geschieht es: Auf einer Party erkennt sie über die Köpfe der anderen Gäste hinweg ihren ehemaligen Angreifer. Im gleichen Moment sieht er sie. Was folgt, ist ein spannungsgeladenes Katz-und-Maus-Spiel mit einem vollkommen unerwarteten, schockierenden Ende. Eine Geschichte über Furcht, Hass und Vergeltung, wie sie sich nicht nur zwischen zwei Menschen, sondern auch verschiedenen Kulturen und Nationen überall auf der Welt tagtäglich abspielt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Felicity Ward
SAG MIR, WER ICH BIN
Roman
Aus dem Englischen vonSabine Leopold
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
1. eBook-Ausgabe 2021© 2021 Felicity Ward© der deutschsprachigen Ausgabe:2021 Europa Verlag in Europa Verlage GmbH, MünchenUmschlaggestaltung und -motiv:Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, ZürichÜbersetzung des Vorworts aus dem Englischen:Dr. Sylvia Zirden, BerlinLayout & Satz: Robert Gigler, MünchenKonvertierung: BookwireeISBN: 978-3-95890-406-4
Alle Rechte vorbehalten.www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
»… Ein Schrei, der die Hölle zerriss,und darüber hinaus die Herrscherin über das Chaosund die Finsternis erschreckte.«
John Milton, Verlorenes Paradies
Inhalt
VORWORT DER AUTORIN
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
VORWORT DER AUTORIN
Um es mit Hugh MacLennans1 Worten aus dem Vorwort zu seinem Roman Two Solitudes zu sagen: »Weil dies eine Geschichte ist, möchte ich sie nicht mit einem Vorwort belasten, doch irgendetwas in der Art scheint mir nötig zu sein, denn es handelt sich um einen Roman über Kanada.« Und da viele meiner Leserinnen und Leser kaum etwas über Kanada oder Montreal, wo mein Roman spielt, wissen werden, halte ich ein Mindestmaß an Hintergrundinformationen für unentbehrlich. Außerdem verdankt sich diese Geschichte – die auch unabhängig von ihrem Schauplatz und ihrem allegorischen Charakter gelesen werden kann – der großen Trauer um eine Stadt, die ich erst liebte, dann hoffnungslos deprimierend fand und nie wiedersehen wollte und inzwischen wieder lieben kann. Dass das längst untergegangene Montreal meiner Kindheit nach einer schrecklichen Zeit der Verwüstung nun in vollkommen neuem Gewand wiedergeboren wird und aufblüht, ändert nichts an meinem Schmerz über das, was damals geschah: den ganzen Hass und die Feindseligkeit zwischen den beiden Kulturen und Sprachen, die ich liebe und die beide zusammen Montreal zu der wunderbaren, faszinierenden und unglaublich charmanten Inselstadt gemacht haben, die es ist.
Kanada ist ein Land mit zwei offiziellen Sprachen: Französisch und Englisch oder Englisch und Französisch, je nachdem, welche Sprachgruppe man meint zuerst nennen zu müssen (was schon auf die darunterliegenden Spannungen hindeutet). Als ich noch ein Kind war, konnte kaum ein englischstämmiger Kanadier außer Diplomaten und weit gereisten oder gerade erst eingewanderten Menschen ein Wort Französisch – weder in der Provinz Quebec noch irgendwo sonst in Kanada. Soweit ich weiß, sprachen auch nur wenige der Franzosen in der Provinz Englisch, obwohl manche natürlich dazu gezwungen waren, besonders in Montreal, wo sie das Englische beherrschen mussten, um eine Anstellung zu finden. Es war unmöglich, Bus- oder Taxifahrer, Hausmeister oder gar Anwalt zu werden, wenn man nicht die Sprache der damaligen Elite – der Briten – sprach, die zwar eine winzige Minderheit waren, aber eine enorme Macht hatten. Heute ist Montreal in jeder Hinsicht eine französischsprachige Stadt.2 Die meisten englischen Muttersprachler haben die Flucht ergriffen, als es verboten wurde, am Arbeitsplatz Englisch zu sprechen oder zu schreiben3, und vermutlich aus diesem Grund scheinen sich die heutigen Montrealer nicht mehr von den »Anglais« bedroht zu fühlen. Dennoch sprachen bei einem kürzlichen Besuch dort alle Franzosen, mit denen ich mich traf oder die in Geschäften und Restaurants arbeiteten, ganz selbstverständlich auch fließend Englisch (im Gegensatz zu den späten 70er- und frühen 80er-Jahren, als selbst diejenigen, die Englisch konnten, bewusst auf Französisch antworteten, wenn man sie auf Englisch ansprach). Ich würde die französischstämmigen Einwohner von Montreal heutzutage als zweisprachig bezeichnen: Zumindest sprechen sie besser Englisch als viele der verbliebenen »Anglos« Französisch, obwohl es auch bei diesen große Fortschritte gibt. In jedem Fall hat sich die einst giftige Atmosphäre zwischen den beiden Sprachgruppen weitgehend aufgelöst und einem überwiegend entspannten und freundlichen Miteinander Platz gemacht.
Und doch: Es gibt bis heute keine Bezeichnung für einen Bewohner des Landes, mit der beide Bevölkerungsgruppen zufrieden wären. Um noch einmal Hugh MacLennan zu zitieren (mit Sätzen, die 1945 geschrieben wurden, aber immer noch Gültigkeit haben): »Wenn die französischsprachigen Kanadier das Wort ›canadien‹4 verwenden, meinen sie damit in der Regel nur sich selbst. Ihre englischsprachigen Landsleute nennen sie ›les anglais‹. Englischsprachige Bürger handeln nach dem gleichen Prinzip. Sie bezeichnen sich selbst als ›Kanadier‹ und ihre französischsprachigen Landsleute als ›Frankokanadier‹ (heute wohl eher ›Québécois‹, wobei die beiden Ausdrücke nicht synonym sind).«
In Montreal schwankte die Vorherrschaft der einen Sprache über die andere im Laufe der Zeit. Im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert war die englischsprachige Bevölkerung in der Minderheit und bestrebt, Französisch zu lernen. 1831 bildeten die Briten sowohl in Quebec City als auch in Montreal, wo sie sich als Kaufmanns- und Unternehmerklasse etabliert hatten, die Mehrheit. Während dieser Zeit des rasanten wirtschaftlichen Wachstums kehrten sich die Verhältnisse um, und die Franzosen begannen Englisch zu lernen. Der wirtschaftliche Aufschwung führte zu einem Zustrom der frankokanadischen Landbevölkerung in die Metropole, und weil gleichzeitig viele anglofone Montrealer in andere aufstrebende Städte und Provinzen im Westen abwanderten, kehrte sich das Verhältnis wieder um, und im Jahr 1871 bildete die französischsprachige Bevölkerung aufgrund ihrer schwindelerregend hohen Geburtenrate5 wiederum die Mehrheit.
Zu dieser Zeit waren die Engländer bereits gut als herrschende Klasse etabliert, sowohl aufgrund ihrer kommerziellen und finanziellen Stärke als auch aufgrund ihrer Erziehung und Ausbildung, die der französischen weit überlegen waren. Das Ergebnis war, dass sich die englischsprachige Bevölkerung nicht bemühte, die Sprache der Mehrheit zu erlernen, und stattdessen behauptete, die katholische Kirche sei schuld, wenn die Franzosen von den Engländern als Bürger zweiter Klasse behandelt würden, denn sie habe die Gläubigen dazu ermutigt, riesige Familien zu gründen, für die sie kaum aufkommen konnten und die daher so unzureichend ausgebildet waren, dass sie mit ihren englischsprachigen Landsleuten nicht mithalten konnten. Obwohl nicht geleugnet werden kann, dass die katholische Kirche entscheidend dazu beitrug, ihre Gläubigen in Armut und von Bildung fernzuhalten, und dass sie in der Provinz Quebec lange Zeit überaus korrupt war, sind die Engländer damit meiner Meinung nach nicht von aller Verantwortung freizusprechen. An einem Ort wie Montreal oder in der Provinz Quebec, wo immer alles in beiden Sprachen gesagt und geschrieben wurde, erscheint es unbegreiflich und unentschuldbar, dass es jemals möglich war, dass Menschen nicht die Mehrheitssprache der Provinz, in der sie lebten, beherrschten. Die Tatsache, dass die Anglofonen in Quebec mit Ausnahme einer kleinen Handvoll aufgeklärter Geister bis vor Kurzem keinerlei Versuch unternahmen, auch nur ein einziges Wort Französisch zu verstehen, geschweige denn zu sprechen, musste bei den Frankokanadiern unweigerlich zu dem Eindruck führen, dass sie nicht nur gegen soziale und wirtschaftliche Ungerechtigkeit kämpften, sondern auch für den Erhalt ihrer Kultur und Sprache.
Glücklicherweise haben sich die Dinge in den letzten vierzig Jahren geändert. Die meisten englischstämmigen Kanadier in der Provinz Quebec haben sich bemüht, einigermaßen Französisch zu lernen, und einige sprechen es ziemlich fließend. Viele ihrer Kinder gehen inzwischen auf französische Schulen (in meiner Kindheit eine unerhörte Vorstellung, und ich vermute, es wäre auch rechtlich gar nicht möglich gewesen), und man kann hoffen, dass die beiden Kulturen dauerhaft friedlich und freundschaftlich zusammenleben.
Als ich länger über das nachdachte, was in Quebec im Laufe der Jahrzehnte geschehen ist, war ich erstaunt, wie viele Parallelen es zu anderen Orten in der Welt gibt (Irland, der Nahe Osten, der Balkan, Südafrika, Pakistan, Indien, Kaschmir, um nur einige zu nennen) und wie sehr diese uralten und offenbar unüberwindlichen Feindschaften aus der Angst vor dem »anderen« geboren zu sein scheinen. Sogar an ansonsten friedlichen Orte, an denen es zufällig zwei oder mehr Kulturen und Sprachgruppen gibt, wie Belgien und sogar die Schweiz, oder wo zwei verschiedene Richtungen ein und derselben Region verbreitet sind (Katholiken gegen Protestanten, Sunniten gegen Schiiten), sind viele Menschen nicht in der Lage, ihre – meist von mangelndem Verständnis und der daraus entstehenden Angst verursachte – Abneigung gegen andere zu überwinden. Wie ein verängstigter Hund eher dazu neigt zu beißen, provoziert Angst auch beim Menschen Aggression, die bis zum Krieg führen kann. Diese Reaktionsweise kennen wir nicht nur von Einzelpersonen, sondern auch von ganzen Nationen. Wer missbraucht wurde, neigt dazu, andere zu missbrauchen; wer unterdrückt wurde, tendiert dazu, selbst ein Tyrann zu werden, wenn es ihm irgendwann gelingt, an die Macht zu kommen; wer verfolgt wurde, entwickelt eine Paranoia und verfolgt seinerseits diejenigen, die er fürchtet. Wer als Kind geschlagen wurde, neigt dazu, seine eigenen Kinder zu verprügeln; und wer als Schüler drangsaliert wurde (besonders im Internat), hat unbegreiflicherweise die Tendenz, seine Kinder auf genau dieselbe Schule zu schicken.
Es ist nur zu verständlich und nachvollziehbar, dass, wer vergewaltigt wurde, in ständiger Angst lebt, das Gleiche erneut zu erleben, so wie Überlebende eines Völkermordes niemals die Furcht verlieren, wieder bis fast zur vollständigen Auslöschung verfolgt zu werden. Daher halte ich die #MeToo-Bewegung für so wichtig, weil sie so vielen von uns Hoffnung für unsere Töchter und Enkelinnen und alle zukünftigen Frauen gegeben hat. Und zugleich bin ich besorgt, dass sie auf den Irrweg vieler Bewegungen zusteuert, die ins Leben gerufen wurden, um ein Unrecht zu korrigieren, und am Ende selbst zu Unrecht wurden. Ich beschloss daher, die Geschichte des Opfers einer versuchten Vergewaltigung in den Mittelpunkt dieses Romans zu stellen, und begab mich auf eine sehr umfangreiche Recherche zu diesem Thema. Zunächst sprach ich mit allen mir persönlich bekannten Personen, die vergewaltigt wurden (damit meine ich keine sogenannten Date-Rapes oder Vergewaltigungen in der Ehe, sondern eine Vergewaltigung durch einen Fremden). Es waren ziemlich viele, und ich bin mir sicher, dass jede/-r von uns zahlreiche Betroffene kennt, ob er/sie sich dessen bewusst ist oder nicht. Außerdem habe ich ausführlich über das Thema gelesen und mich mit Ärzten, Psychiatern, Psychoanalytikern und Therapeuten in verschiedenen Ländern ausgetauscht, mit Polizeibeamten, die die Anzeigen von Vergewaltigungsopfern aufnahmen, mit Menschen in Frauenhäusern, mit Journalisten, Anwälten und Gefängnisinsassen. Immer wieder traf ich auf dasselbe Muster: Frauen, die vergewaltigt wurden, werden oft mehr als einmal vergewaltigt, und zwar nicht unbedingt von derselben Person; häufig werden auch ihre Töchter vergewaltigt. Von denjenigen, die ich persönlich kenne, ist eine dreimal von ganz verschiedenen Personen bei völlig unterschiedlichen Gelegenheiten vergewaltigt worden, und sie hat eine Tochter, der dasselbe als Jugendliche im Internat passiert ist. Das von mir gesammelte Wissen bildet die Grundlage für dieses Buch, das eine Allegorie ist über die Gefahren, die Opfermentalität und Wiederholungsangst bergen. Gleichzeitig möchte ich Frauen ermutigen, ihre Angst und ihren Wunsch nach Rache nicht alle Hoffnung darauf, dass nicht alle Männer Vergewaltiger sind und dass sich der Umgang mit Frauen zum Guten ändern kann, zerstören zu lassen. Ich hoffe, dass das Ergebnis ein Roman ist, der einfach wegen seiner fesselnden Handlung gelesen werden kann, aber auch mehr Verständnis für den enormen Schaden, den Missbauch und Vergewaltigung anrichten, und die Denkweise Betroffener weckt. Gesellschaftliche Umschwünge haben die Tendenz, von einem Extrem ins andere zu führen. Offenbar fällt es uns Menschen sehr schwer, die goldene Mitte zu finden. So galten Frauen über viele Jahrhunderte hinweg bis vor Kurzem per se als schuldig (die biblische Eva als Verführerin und Verantwortliche für Adams Sündenfall), sie galten als weniger intelligent und kreativ als Männer (keine Rede davon, dass es Frauen sind, die Menschen erschaffen, und keine Rede von den zahlreichen Künstlerinnen im Laufe der Geschichte, deren Leistungen einfach von ihren Vätern, Brüdern und Ehemännern unterschlagen wurden). Diese extreme Sichtweise hat sich in den letzten Jahren relativiert, läuft nun aber Gefahr, ins andere ebenso realitätsferne Extrem zu kippen: Plötzlich sind alle Männer böse, ausbeuterische Frauenhasser und alle Frauen brillante Überfliegerinnen, große Kriegerinnen und in jeder Hinsicht fabelhaft. Dadurch würde aber nur eine Ungerechtigkeit durch eine andere ersetzt. Die #MeToo-Bewegung ist lebenswichtig, aber sie muss ehrlich sein, sie darf aus banalen Vorfällen keine monströsen Verbrechen machen, sie muss sich ihrer Sache sehr sicher sein, bevor sie jemanden beschuldigt, sie darf nicht vergessen, dass jeder so lange unschuldig ist, bis seine Schuld bewiesen ist. Sie darf nicht von der Anklägerin zur Täterin zu werden, denn das wäre eine unfassbare Tragödie für alle Menschen.
Zum Schluss noch zwei Anmerkungen: Die Anfangsszenen dieses Romans spielen im Jahre 1962, deshalb habe ich mich bemüht, den Sprachgebrauch der damaligen Zeit zu berücksichtigen.
Außerdem möchte ich darauf hinwisen, dass dieser Roman reine Fiktion ist und alle Charaktere frei erfunden sind. Ich habe kanadisch klingende Namen für die Kanadier und schottische für die Menschen mit englischer Abstammung ausgewählt und möchte betonen, dass eine Namensgleichheit mit lebenden oder verstorbenen Personen reiner Zufall wäre.
1Hugh MacLennan (1907–1990), preisgekrönter kanadischer Schriftsteller, gilt als Begründer der kanadischen Literaturtradition; er war Professor für Englisch an der McGill University, zu seinen Studenten zählten Marian Engel und Leonard Cohen.
2Im Jahr 2016 waren 48,7% der Einwohner der Insel Montreal (also der Innenstadt ohne die Vororte) französische Muttersprachler, 16,8% englische Muttersprachler und die restlichen 34,4% stammten aus Ländern mit anderen Muttersprachen.
3Nachdem die »Front für die Befreiung Québecs FLQ« 1963 anfing, Bombenanschläge zu verüben, und in den 1970er-Jahren das – übrigens bis heute gültige – Gesetz 101 verabschiedet worden war, das den Gebrauch der englischen Sprache verbot (besonders auch im Geschäftsleben), begann ein Exodus der »Anglos«: Bis in die 1990er-Jahre verließen etwa 250 000 englischsprachige Montrealer (von zwei Millionen Einwohnern ingesamt) die Provinz. Sie nahmen ihr Geld und ihre Firmen, darunter teils große Konzerne, mit nach Toronto, Vancouver, Calgary – überall dorthin, wo sie ihre Geschäftsbeziehungen mit dem Rest Kanadas und Nordamerikas in englischer Sprache weiterführen konnten.
4Heute würden sie wahrscheinlich eher »Québécois«, »Québécois pure laine« oder »Québécois de souche« (»waschechte Quebecer«) sagen.
5Jean Chrétien, 1993–2003 kanadischer Premierminister, war das achtzehnte von neunzehn Kindern (von denen nur neun das Säuglingsalter überlebten). Dies war in seiner Generation und noch viele Jahrzehnte später in einer frankokanadischen Familie die Regel. Erst als die katholische Kirche ihre absolute Macht über die Franzosen in Quebec verlor, sank die Geburtenrate von der höchsten auf die fast niedrigste in der westlichen Welt.
1
Ihre ersten Worte waren: »Ich wusste, dass ich in Paris sterben würde. Ich wusste es schon, als ich herkam.«
»Aber Sie sind nicht gestorben«, erwiderte der Arzt. »Sie sind am Leben und werden wieder ganz gesund.«
Ein paar Minuten vorher noch war sie durch Zeit und Raum geschwebt. Alles war ganz klar und rein – eine blaue Leere. Da war nichts, nur der Raum: leer und klar wie ein Sommertag.
Ihr war heiß, und sie hatte entsetzlichen Durst. Sie wollte kalt sein, so kalt wie das blaue Nichts um sie herum. Sie wusste, dass sie sich nur noch ein bisschen treiben lassen musste, weiter hinaus, dann konnte sie sich abkühlen. Sie musste weiter weg schweben. Weg wovon? So weit ihre Blicke reichten, war nichts – nur ein endloses, ewiges, blaues Nichts.
Plötzlich entdeckte sie es, weit, weit weg, Tausende – vielleicht Millionen – von Meilen entfernt: ein winziger Ball, eine Sphäre, auch blau, aber dunkler und dichter. Sie betrachtete die Kugel interessiert. Was war das? Irgendwann einmal war das Gebilde sehr wichtig gewesen, aber sie wusste nicht, wieso. Es wurde »Erde« genannt, daran erinnerte sie sich noch. Aber was war das? Und warum war es so wichtig gewesen? Sie hatte keine Ahnung. Es erschien ihr absurd, dass diese winzige, unendlich weit entfernte Sphäre überhaupt je eine Rolle gespielt haben sollte.
Dennoch wusste sie eines ganz genau: Sie musste noch weiter weg von diesem Ball, wenn sie Abkühlung haben wollte.
Dann fühlte sie, wie jemand mit der flachen Hand auf ihre Wangen klatschte, und sie hörte eine Männerstimme.
»Machen Sie die Augen auf!«, rief der Mann auf Französisch. »Kommen Sie, wachen Sie auf! Geben Sie sich Mühe, nom de Dieu!«
In diesem Augenblick fielen ihr die Mimosen wieder ein – der Duft von Mimosen und das Geräusch des Meeres. Sie wollte das Meer sehen und den Mimosenduft riechen. Aber sie wurde zurückgerissen.
Rufe. Leichte Schläge. Rufe. Schläge. Musste er so schreien? Seine Stimme klang zornig. Sie versuchte sich zu konzentrieren und die Worte zu verstehen. »Die Schwestern waren Tag und Nacht bei Ihnen!«, brüllte er. »Tag und Nacht! Sie haben bei Ihnen gewacht, seit Sie zu uns gekommen sind. Aber was für einen Sinn hat das, wenn Sie nicht mithelfen? Sie müssen sich anstrengen. Kein Mensch kann Sie retten, wenn Sie sich selbst keine Mühe geben. Sie müssen selbst etwas tun. Versuchen Sie es! Machen Sie die Augen auf!«
Der Geruch nach Mimosen war sehr stark. Sie wollte sie genauso sehen wie die glitzernde Sonne auf dem Meer, deshalb öffnete sie die Augen.
»Enfin!«, sagte eine Frauenstimme.
Der Mann tätschelte noch immer kräftig ihr Gesicht.
»Nehmen Sie sich zusammen«, schrie er. »Sie müssen sich anstrengen, das können wir nicht für Sie übernehmen.«
Sie sah ihn überrascht und verletzt an. Wer war dieser Mensch? Dann entdeckte sie die Mimosen in einer Vase neben ihrem Bett. Wo war sie? Wer war sie? Nicht einmal das wusste sie. Sie betrachtete den Mimosenstrauß und war enttäuscht. Das waren nicht die üppig blühenden, vom Wind gebeugten Pflanzen, die sie sich vorgestellt hatte. Und da war auch kein Meer. Nicht einmal die Sonne schien. Und es gab auch keinen Strand und keine plätschernden Wellen. Nichts mehr war blau, sondern weiß. Alles weiß – sogar die Leute trugen Weiß, auch der Mann, der sich über sie beugte, schrie und in ihr Gesicht klatschte.
Sie hatte schrecklichen Durst und wünschte sich sehnlichst, dass man ihr Wasser bringen würde. Sie heftete den Blick auf den Mann, der endlich aufhörte, sie zu schlagen. Sein Gesicht war dem ihren sehr nahe.
»Tut mir leid«, sagte er, »aber ich musste das tun. Sie müssen sich anstrengen … Nein, schließen Sie nicht wieder die Augen. Können Sie mich hören? Wenn Sie nicht am Leben bleiben wollen, können wir Sie auch nicht retten. Das müssen Sie verstehen. Wir alle sind seit Tagen und Nächten bei Ihnen, seit Sie angekommen sind. Denken Sie an die Schwestern – weshalb sollten sie bei Ihnen wachen, wenn Sie sich selbst kein bisschen bemühen? Denken Sie darüber nach.« Sie drehte den Kopf ein wenig zur Seite und sah die Schläuche an ihren Armen – an beiden Armen. Die Schläuche führten zu Flaschen, die an einem Gestell befestigt waren. Blut tropfte in einem Schlauch, in dem anderen befand sich eine durchsichtige Flüssigkeit. Blut und Wasser. Wasser und Wein.
»Das ist Glukose«, erklärte der Mann, als er ihrem Blick folgte. »Sie brauchen Nährstoffe.«
Allmählich nahmen die Dinge um sie herum Gestalt an, und sie erinnerte sich wieder, wie man alles nannte. Der Mann war ein Arzt – sie lag offenbar in einem Krankenhaus. Aber sie konnte sich an nichts und niemanden erinnern. Nicht an ihre Mutter und nicht an ihren Vater – an gar niemanden.
Sie war so müde. Müde und unendlich traurig. Fast wäre sie weit genug weg gewesen. Sie trauerte um den endlosen blauen Raum und die Kühle, die sie beinahe erreicht hatte.
»Ich werde Ihnen jetzt eine Injektion geben«, eröffnete ihr der Arzt.
Kaffeeduft weckte sie – einen Tag später, oder waren es zwei oder drei? Es roch köstlich. Zwei Schwestern halfen ihr, sich aufzusetzen, und hielten ihr eine große Schale mit café au lait an die Lippen. Es war das Wunderbarste, was sie je gekostet hatte. An dieses Aroma und den Geschmack des Milchkaffees würde sie sich erinnern, solange sie lebte. Und sie würde für den Rest ihres Lebens danach suchen, wo immer sie sich auch befand, aber nie wieder konnte der Duft so überwältigend und vollkommen sein wie an diesem Tag.
Am Nachmittag schoben sie den Wandschirm, der ihr Bett umgeben hatte, weg, und sie konnte die anderen Menschen in dem Krankenzimmer sehen. Nur alte Damen, und alle waren hinfällig oder sehr krank. Von Zeit zu Zeit starb eine, und dann rollten sie die mit einem Laken bedeckte Leiche an ihrem Bett vorbei – als könnte das Laken die Tatsache verbergen, dass die Frauen tot waren. Sie bekam eine Gänsehaut, wenn sie das beobachtete.
Ein leerer Sarg – oder war es eine Art Wagen? – stand in der Nähe ihres Bettes. Sie fand das makaber und angsteinflößend. Der Anblick machte sie trübsinnig. Bei nächster Gelegenheit erklärte sie der Schwester, dass sie das Sterben und die Nähe des Todes nicht mochte. Sie wollte keine Leichname sehen, die mit Laken über den Gesichtern an ihrem Bett vorbeigeschoben wurden.
»Sie waren dem Tode sehr nahe, als Sie eingeliefert wurden«, erwiderte die Schwester, »deshalb haben wir Sie in die Station gelegt, in der die todgeweihten Patienten liegen. Vielleicht sollten Sie lieber weg von hier, aber diese Station ist ruhiger als andere.«
»Ich finde dieses Ding grässlich«, sagte sie und deutete auf den Sarg. Sie kannte das französische Wort dafür nicht.
Die Schwester schien überrascht zu sein. »Stört es Sie?«, fragte sie und fügte hinzu, als sie ihren Blick sah: »Kein Problem, wir tun es weg.« Sie schob das scheußliche Gebilde hinter den Wandschirm.
Ein weiterer Tag verging. Sie bekam immer noch Bluttransfusionen. Wenn die Flasche installiert wurde und das Blut in ihre Adern tropfte, fühlte sie sich wunderbar: schläfrig und leicht, Leben druchflutete ihren Kreislauf. Der Tropf mit der Nährflüssigkeit war nicht mehr da. Sie bekam jetzt am Abend Suppe und café au lait am Morgen – das war der schönste Augenblick des Tages –, und zur Suppe brachten sie ihr immer ein Glas Rotwein. »Das ist gut für die Bildung von roten Blutkörperchen«, erklärte die Schwester und lachte über ihr erstauntes Gesicht. »Rotwein ist eisenhaltig, und außerdem hebt er die Stimmung. Der Doktor meint, Sie sollten jeden Abend ein Glas trinken.« Sie genoss das tägliche Glas Rotwein an den langen Sommerabenden genau wie den Milchkaffee. Er war im wahrsten Sinne des Wortes zu ihrem Lebenselixier geworden, ohne das sie verloren wäre.
Kurz nachdem sie das Bewusstsein wiedererlangt hatte, fragte der Arzt bei der Visite: »Macht es Ihnen was aus, wenn ich mich einen Moment zu Ihnen setze?« Die Schwestern verschoben den Wandschirm, und der Doktor nahm auf ihrer Bettkante Platz. »Wie fühlen Sie sich jetzt?«, erkundigte er sich.
»Ganz gut.«
»Na, ich bin jedenfalls froh, dass Sie Ihre Sprache wiedergefunden haben. Ich fürchte, ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen, tut mir leid. Sie sind jetzt schon ein paar Tage hier, und wir wissen immer noch nicht, wer Sie sind oder was mit Ihnen geschehen ist. Können Sie mir irgendetwas darüber sagen?«
»Ich glaube, ich hatte Nasenbluten«, entgegnete sie.
»Sie haben tatsächlich aus der Nase geblutet, aber das war längst nicht alles. Sie hatten auch innere Blutungen – sie gingen vom Magen aus.«
»Ich hatte Nasenbluten«, wiederholte sie.
»Sie hätten niemals so viel Blut verloren, wenn es nur das gewesen wäre.«
Dazu sagte sie nichts.
»Es tut mir wirklich leid, dass ich das alles ansprechen muss«, begann er nach einer Weile wieder. »Ich hatte gehofft, dass Sie sich gut genug fühlen für diese Unterhaltung.« Er machte eine Pause, aber sie schwieg immer noch. »Wir müssen mit Ihrer Familie Kontakt aufnehmen und Bescheid sagen, dass Sie hier bei uns sind. Können Sie mir sagen, wo wir sie erreichen?«
Sie dachte nach. »Ich weiß nicht. Ich glaube, sie könnten in Kanada sein. Oder in den USA. Ich bin nicht sicher.« Sie versuchte, ein Bild von ihrer Familie heraufzubeschwören, aber es blieb vage und flüchtig. Sie sah keine Gesichter vor ihrem geistigen Auge.
»Sie standen dem Tod schon auf der Schippe, als Sie hier eingeliefert wurden«, sagte der Arzt, ohne den Blick von ihr zu wenden. »Sie haben eine Menge Blut verloren. Erinnern Sie sich? Sie hatten große Schwierigkeiten zu atmen, weil Ihnen das Blut aus Mund und Nase lief.«
»Ja, daran erinnere ich mich. Sie haben mir nicht erlaubt, die Arme über den Kopf zu legen. Ich wollte meine Arme heben, aber sie haben es nicht zugelassen.«
»Sie wissen also noch, wie die Sanitäter sie behandelt haben?«
»Ja. Sie haben versucht, mich zu ersticken – dauernd drückten sie mir irgendwelche Sachen auf Mund und Nase. Und ich war sicher, dass ich ersticke.«
»Sie wollten nur die Blutungen stillen, und gleichzeitig haben sie Ihnen Transfusionen gegeben. Wissen Sie das nicht mehr?«
»Nein … nein, davon weiß ich nichts.«
»Sie waren sehr, sehr schwach, als Sie hier ankamen. Sie müssen sich körperlich sehr angestrengt haben, bevor diese Blutungen einsetzten. Warum waren Sie so erschöpft?«
»Ich kann mich nicht erinnern.«
»Trotzdem fällt Ihnen einiges wieder ein. Möglich, dass Sie an einer partiellen Amnesie leiden, aber ganz sicher bin ich mir in diesem Fall nicht. Wieso erinnern Sie sich an manche Dinge und an andere nicht, was glauben Sie? Wollen Sie sich an den Rest nicht erinnern?«
Sie schwieg.
»Ich versuche nur, Ihnen zu helfen«, versicherte er, und nach einer Weile fuhr er fort: »Sie haben oft von Mimosen gesprochen.«
»Neben meinem Bett stand ein Mimosenstrauß. Da drüben ist er noch, in der Vase. Mimosen duften sehr stark.«
»Aber Sie mögen den Geruch. Sie haben immer wieder nach Mimosen gefragt, deswegen hat eine der Schwestern einen Strauß gekauft.«
»Ich mag den Duft, ja. Er erinnert mich an Südfrankreich. Den Geruch – genau wie den nach Eukalyptus und Basilikum – verbinde ich mit dem Mittelmeer.«
»Haben Sie einmal in Südfrankreich gelebt, oder tun Sie es noch?«
Sie überlegte einige Zeit, ehe sie antwortete: »Ich muss wohl dort gewohnt haben, aber ich glaube, ich war als Kind dort. Es hat mir sehr gefallen, das weiß ich, und ich liebe es noch immer.« Sie drehte den Kopf zur Seite und schloss die Augen. »Aber ich denke, ich lebe nicht mehr dort«, sagte sie schließlich. »Ich weiß nicht, wo ich wohne.«
»Es scheint fast, als hätten Sie sich zumindest einige Zeit hier in Paris aufgehalten, meinen Sie nicht? Sie wurden hier gefunden, und in dem Zustand, in dem Sie waren, konnten Sie nicht weit gefahren sein. Es muss hier passiert sein, was immer es auch war.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier wohne. Ich kenne Paris nicht – wenigstens nehme ich das an. Wo hat man mich gefunden?«
»Vor der Gare St. Lazare. Jemand, der gesehen hat, wie Sie auf der Straße zusammengebrochen sind, hat uns telefonisch benachrichtigt. Die Polizei hat uns auch angerufen. Die Männer von der Ambulanz haben Sie sozusagen vom Bürgersteig vor dem Bahnhof aufgelesen.«
»Glauben Sie, dass ich von einem Auto angefahren wurde?«
»Nein. Sie kamen aus der Metrostation oder dem Bahnhof, zumindest sagen das die Leute, die Sie gesehen haben.«
»Jetzt erinnere ich mich. All die Menschen standen um mich herum und starrten mich an. Ich konnte nicht richtig Luft holen.«
»Woher sind Sie gekommen? Waren Sie schon in Paris, oder sind Sie an diesem Tag hergefahren? Waren Sie mit dem Zug oder der Metro unterwegs? Daran müssen Sie sich doch erinnern.«
»Je ne puis pas«, sagte sie mit einem Seufzen.
Er lachte. »Peux«, korrigierte er sie. »Je ne peux pas. Ihr Französisch ist süß, sehr charmant, aber nicht perfekt. Ich denke, Sie leben nicht in Frankreich, zumindest noch nicht sehr lange. Wie alt sind Sie? Sechzehn? Siebzehn?«
»Sechzehn«, erwiderte sie ohne Zögern. »Ich bin sechzehn Jahre alt.«
»Wann haben Sie Geburtstag?«
»Am neunundzwanzigsten Juni.«
»Das war erst kürzlich.«
»Ja?«
»Kommen Sie, Sie werden sich doch an Ihren Geburtstag erinnern, da bin ich ganz sicher. Wo haben Sie ihn gefeiert?«
»Keine Ahnung, in Kanada vielleicht.«
»Wieso in Kanada? Leben Sie dort?«
»Ich weiß es nicht.«
»Sie haben Kanada schon einmal erwähnt. Sie sagten, Ihre Eltern könnten sich dort möglicherweise aufhalten. Sind Sie Kanadierin?«
»Ich weiß es nicht.«
»Sie kennen Ihr Alter und das Geburtsdatum ganz genau, wissen aber nicht, wer Sie sind oder woher Sie kommen. Wie ist so etwas möglich?«
»Ich weiß es nicht.«
»Hören Sie auf damit – sagen Sie nicht ständig ›Ich weiß es nicht‹. Strengen Sie sich an, und helfen Sie mir. Denken Sie nach! Hat Sie etwas erschreckt. Hat Ihnen jemand Angst eingejagt?«
Sie starrte ihn an, sagte aber nichts.
»Sie hatten schlimme Verletzungen«, erklärte er. »Wunden, Prellungen und blaue Flecken, das wissen Sie sicher, nicht wahr? Sie sind ja immer noch zu sehen, und bestimmt spüren Sie sie auch. Es tut weh, stimmt’s? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sie große Schmerzen haben. Allons, mademoiselle. Denken Sie dran, ich bin Arzt. Nichts kann mich erschüttern. Wurden Sie in den Bauch oder Magen geschlagen oder getreten?« Er wartete geduldig. »Wenn es Ihnen leichter fällt, erzählen Sie mir alles auf Englisch. Ich verstehe genug, um den Kern der Geschichte zu erfassen, wenn Sie lieber englisch sprechen wollen.«
Er gab ihr lange Zeit, aber das Mädchen senkte nur die Lider. Er beobachtete, wie sich ihre Hände in die Bettdecke krallten und wieder lösten.
»Was ist mit Ihnen geschehen?«, fragte er noch einmal eindringlich.
Sie war aufgeregt, das konnte er nicht übersehen. »Ich hatte Nasenbluten«, sagte sie auf Englisch. »Das habe ich Ihnen doch schon gesagt, meine Nase hat geblutet.« Sie brach in Tränen aus.
Der Arzt beugte sich vor und legte leicht die Hand auf ihren Arm. Er ließ sie erst wieder los, als sie aufhörte zu weinen.
»Tut mir leid«, sagte er. »Ich wollte Sie nicht aufregen, ich will wirklich nur helfen. Wer war er? Wir könnten etwas gegen ihn unternehmen, wenn Sie uns sagen, was Ihnen widerfahren ist.«
Als er merkte, dass sie ihm darauf keine Antwort geben würde, stand er seufzend auf. »Wenn Ihnen einfällt, wer Ihre Eltern sind oder wo sie sich aufhalten, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir würden sie gern benachrichtigen.« Sie zupfte noch immer an der Bettdecke, ihr Kopf war abgewandt, sodass er ihre Augen nicht sehen konnte. Er legte seine Hand kurz auf ihren Kopf. »Sie hatten keine Papiere bei sich, verstehen Sie. Die Sanitäter fanden auch keine Handtasche – wir wissen gar nichts über Sie.«
Er ging ins Büro der Oberschwester und nahm das Telefonbuch zur Hand, um die Nummer der kanadischen Botschaft herauszusuchen und dort anzurufen. »Es könnte möglich sein, dass eine kanadische Staatsbürgerin in unserem Krankenhaus liegt. Sie war mehr tot als lebendig, als sie eingeliefert wurde. Offenbar ist sie angegriffen worden – sieht nach versuchter Vergewaltigung aus, aber so weit ist es nicht gekommen. Außerdem sind Male an ihrem Hals, die darauf hindeuten, dass sie jemand gewürgt hat. Es geht ihr sehr schlecht, und wir müssen ihre Familie ausfindig machen … Nein, wir haben keine Papiere gefunden – keine Handtasche, nichts in den Taschen der Kleidung, nicht einmal eine Busfahrkarte …
Sie sagt, dass sie sich an nichts erinnert, obwohl ich den Verdacht habe, dass ihr mehr im Kopf herumspukt, als sie zugeben will. Trotzdem leidet sie eindeutig an partieller Amnesie. Sie hat keine Ahnung, wer sie ist oder wo ihre Eltern sein könnten … Nein, das ist nicht gespielt, sie weiß es wirklich nicht mehr … Ja … Ja, vielleicht … Das müsste aber eine Frau sein … Sie ist eine englischsprachige Kanadierin, ihr Französisch ist nicht fließend …
Ungefähr eins sechzig, hellhäutig, blond, graue Augen … Nein … Ja … Langes Haar, schlank, etwa fünfzig Kilo, würde ich sagen … Ja … Sie sagt, dass sie sechzehn Jahre alt ist, dessen scheint sie ziemlich sicher zu sein. Ich hätte sie auch auf sechzehn oder siebzehn geschätzt, also denke ich, dass es stimmt. Außerdem behauptet sie, am neunundzwanzigsten Juni Geburtstag zu haben. Ich glaube nicht, dass sie sich schon lange in Frankreich aufhält, aber in diesem Punkt könnte ich mich auch irren. Möglich ist, dass sie von Südfrankreich nach Paris gekommen ist – offensichtlich kennt sie den Süden –, aber ich kann mit beinahe absoluter Sicherheit ausschließen, dass sie gerade erst aus dem Zug gestiegen ist. Dann wäre sie viel eher an der Gare de Lyon gewesen als an der Gare St. Lazare …«
Er hörte dem Beamten am anderen Ende der Leitung eine ganze Weile zu. Bis er ungeduldig wurde und dem Mann ins Wort fiel: »Offensichtlich! Wir brauchten sie gar nicht zu informieren. Die Polizei war schon dort, bevor der Notarztwagen eintraf. Sie haben rein gar nichts herausgefunden. Sie haben Suchmeldungen herausgegeben, Durchsagen in den Radiosendern laufen lassen, mit der Alliance Française Kontakt aufgenommen, in der Berlitz-School, der Sorbonne und vielen anderen Institutionen nachgefragt … Nichts, jedenfalls bis jetzt noch nicht. Niemand wird vermisst … Fein … Halten Sie mich auf dem Laufenden … Ich spreche sie besser ein paar Tage nicht darauf an, ihr Zustand ist bedenklich … sehr ernst … Nein, das kann ich nicht zulassen, dazu ist sie noch zu schwach. Ich werde Sie benachrichtigen, sobald sich ihr Zustand genügend gebessert hat …«
Während sie das Gesprächsthema zweier Männer war, starrte Sally an die Decke. Sie konnte sich an das Auto erinnern – nicht an die Marke oder an die Zulassungsnummer, aber daran, wie es ungefähr ausgesehen hatte. Und die Stimme – die Stimme hatte sie nicht vergessen, aber an sein Gesicht erinnerte sie sich nicht mehr.
2
Am nächsten Tag erfuhren sie, wer sie war. Die Leute, bei denen sie gewohnt hatte, kamen von einer Fahrt aus Burgund zurück und waren sehr besorgt, weil Sally nicht da war. Sie riefen die Polizei an. Es dauerte weitere sechsunddreißig Stunden, bis die Eltern ausfindig gemacht wurden, die eine Reise durch die Vereinigten Staaten machten. Sie hatten Montreal vor neun Tagen verlassen, eine Nacht in New England verbracht und waren dann langsam in Richtung Westküste durchs Land gefahren.
Die Nachricht vom bedrohlichen Zustand ihrer Tochter erreichte sie im Napa Valley. Zu diesem Zeitpunkt lag Sally schon eine Woche im Krankenhaus. Der Schock war so groß, dass sich ihre Mutter nie mehr richtig davon erholte.
Jetzt, wenn sie auf die damaligen Ereignisse zurückblickte, hätte Mrs. Hamilton nicht sagen können, was schlimmer gewesen war: gezwungen zu sein, wertvolle Zeit mit einer Zwischenlandung in New York zu vergeuden, während ihre Tochter auf der anderen Seite des Atlantiks um ihr Leben kämpfte, oder die Tatsache, dass Sally einige Zeit brauchte, bis sie ihre eigene Mutter erkannte, als sie schließlich vor ihrem Bett stand.
Mr. und Mrs. Hamilton starrten ihre Tochter fassungslos an. Sally lag matt und aschfahl in ihrem Bett und war von einer erschreckenden Anzahl medizinischer Geräte umgeben – und dann noch die Schläuche an beiden Armen!
»Warum bekommt sie noch Bluttransfusionen?«, wollte Mr. Hamilton von dem Botschaftsangestellten wissen, der sie vom Flughafen abgeholt hatte und ihnen als Dolmetscher zur Verfügung stand. »Fragen Sie den Arzt – ich will das wissen. Sie kann doch nicht so viel Blut verloren haben. Und was ist in dem Tropf, wozu soll dieses Zeug gut sein? Was ist da drin?«
»Brock«, jammerte seine Frau. »Wir müssen sie hier herausholen. Wir haben ja gar keine Ahnung, wessen Blut sie ihr da geben. Es könnte von einem Senegalesen oder so stammen. Sie sollen sofort aufhören, ihr Blut zu geben. Die Franzosen verstehen nichts von Medizin. Um Himmels willen, hol sie weg von hier!« Mrs. Hamilton klammerte sich an ihren Mann, aber dann verließen sie ihre Kräfte. Sie sank auf das Bett und brach in Tränen aus.
Beinahe eine ganze Stunde übersetzte der Botschaftsangestellte die Fragen der Hamiltons, die er etwas abmilderte, und übermittelte ihnen die Antworten des Arztes.
»Ich weiß, dass Sie beide sehr aufgeregt sind«, schaltete er sich an einem gewissen Punkt persönlich ein, »aber dies hier ist eine ausgezeichnete Klinik. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist – Ihre Tochter hätte sterben können. Sie war tagelang ohne Bewusstsein, und die Ärzte hatten schon beinahe ihre Hoffnungen auf Rettung aufgegeben. Und sehen Sie sie jetzt an! Der Arzt und die Schwestern haben alles nur Menschenmögliche für sie getan … Gut, sie bekommt noch Transfusionen … Das andere? Der Arzt sagt, es ist ein Gerinnungsmittel; ihr Blut hat offensichtlich nicht die richtige Konsistenz … Seien Sie doch vernünftig, Sir. Sie können die Transfusionen nicht einfach absetzen … Das hat Ihnen Dr. Lamotte schon erklärt. Es dauert lange, bis ihr Körper wieder selbst Blut bilden kann. So wie ich es verstanden habe, versuchen sie, ihre Hämoglobinwerte zu verbessern – ich vermute, sie hat eine schlimme Anämie … Ja, natürlich bin ich auch kein Arzt, aber genau das hat er gesagt … Also gut, rufen Sie das amerikanische Hospital an, wenn Sie wollen. Sie können gleich von hier aus telefonieren. Dr. Lamotte ist gern bereit, den Ärzten dort den Fall zu schildern, und er ist sogar froh, wenn Sie die Meinung anderer Spezialisten einholen.«
»Okay, okay!«, brüllte Mr. Hamilton eine halbe Stunde später. »Wenn die Ärzte der amerikanischen Klinik überzeugt sind, dass das die richtige Behandlung ist, muss ich mich wohl oder übel damit abfinden. Trotzdem bin ich keineswegs glücklich darüber. Ich möchte, dass sie so schnell wie möglich in die amerikanische Klinik verlegt wird.«
»Der Doktor sagt, dass sie nicht transportfähig ist, und dieser Zustand wird noch einige Zeit andauern – mindestens zwei Wochen, meint er. Er kann es nicht verantworten, dass sie verlegt wird, solange sie noch so schwach ist … Nein, da bleibt er unerbittlich, und ich bin ganz sicher, dass er recht hat, Sir. Er ist der Überzeugung, dass ein solches Unternehmen im Moment sehr riskant sei … Was? Nein. Er sagt, er hat nicht die leiseste Ahnung, ob die Blutspender schwarz oder weiß sind, und das sei auch vollkommen unwichtig. Einzig und allein die Blutgruppe zählt. In jedem Fall gibt es unzählige Spender. Sie mussten Ihrer Tochter sehr viel Blut übertragen, seit sie hier ist.«
Der Botschaftsangestellte hielt es für besser, die nächsten Bemerkungen des Arztes nicht zu übersetzen – er kam seiner Aufgabe erst wieder nach, als sich Dr. Lamottes Ärger ein wenig gelegt hatte.
»Er erklärt, dass Ihre Tochter eine äußerst seltene Blutgruppe hat – wahrscheinlich haben nur vier Prozent der Weltbevölkerung diese Blutgruppe –, und es ist offenbar sehr schwierig, genügend Konserven zu finden. Er möchte Sie wissen lassen, dass er ihr deshalb Blut der Gruppe 0 übertragen musste, als der Vorrat des passenden Typs aufgebraucht war … Ja, es kann jedem gegeben werden. Sie tun so was beileibe nicht gern, besonders nicht bei Frauen, aber es war unbedingt nötig, das möchte Ihnen der Doktor klarmachen.«
Mr. Hamilton unterbrach ihn, aber der Botschaftsangestellte hob einen Arm, um ihm Einhalt zu gebieten. »Der Arzt möchte, dass wir die Diskussion an einem anderen Ort fortsetzen. Er meint, das Ganze würde Ihre Tochter zu sehr aufregen.«
»Komm, Brock. Lass uns unten darüber sprechen«, bat Mrs. Hamilton, die die ganze Zeit die Hand ihrer Tochter gehalten und leise geweint hatte.
»Ich will wissen, wie das alles passieren konnte!«, bellte Mr. Hamilton. »Ich möchte mit meiner Tochter reden ohne diesen Menschenauflauf hier. Würden Sie uns bitte alle allein lassen? Louise, du auch. Ich will, dass alle von hier verschwinden.«
Mrs. Hamilton rührte sich nicht von der Stelle. Sie weinte noch immer und tupfte sich die Augen mit einem durchweichten Taschentuch ab.
Sally wünschte, sie würde endlich damit aufhören. »Bitte, wein nicht mehr, Mum«, flüsterte sie. »Mir geht’s gut. Die Leute hier sind großartig und sehr, sehr nett. Sie kümmern sich gut um mich.«
»Ich fühle mich schrecklich, Liebes«, schluchzte Mrs. Hamilton. »Wir hätten nicht zulassen dürfen, dass du herkommst. Ich habe immer gesagt, dass das ein Fehler ist, hab ich’s dir nicht gleich gesagt?« Sie wandte sich an ihren Mann. »Dein Vater war auch dagegen, stimmt’s, Brock? Wir hätten dich in die Schweiz schicken sollen. Ich habe geahnt, dass wir dir nicht erlauben sollten hierherzukommen.«
Sally machte ihre Eltern nicht dafür verantwortlich, sie selbst hatte darauf bestanden, nach Paris zu fahren, weil sie sich ihr Französisch nicht mit einem Schweizer Akzent verderben wollte. Und außerdem hatte sie es sich immer gewünscht, Paris zu sehen, während sie keinerlei Interesse an der Schweiz hatte. Ohne jeden Zweifel war sie selbst an allem schuld.
Wenigstens, dachte sie, hat meine Mutter so viel Takt, mich nicht nach den Geschehnissen zu fragen – ganz anders als Vater, er ist fest entschlossen, die Wahrheit zu erfahren.
»Komm schon, Sally«, insistierte er. »Ich möchte wissen, was, zum Teufel, passiert ist. Es war ein Kerl, oder? Wo bist du ihm begegnet? Ist er Franzose? Wie heißt er? Sag uns, wer es war … Um Himmels willen, Kleines, du weißt, dass es mehr war als nur Nasenbluten! Du warst mit blauen Flecken und Wunden übersät, an deinem Hals sind Würgemale zu sehen gewesen, und du hattest innere Blutungen … Lieber Gott, Sally, sei doch vernünftig! Ich werde den verdammten Bastard kriegen, und wenn es mich das Leben kostet. Hat er dich vergewaltigt? War es das? Verflucht, du musst dich doch an irgendetwas erinnern können!«
An diesem Punkt schritt der Arzt ein, er nahm Mr. Hamiltons Arm und zerrte ihn aus dem Zimmer.
»Sie regen sie zu sehr auf. Bitte lassen Sie sie jetzt in Ruhe, sie muss schlafen. Mit der Zeit wird sie sich schon erinnern, wahrscheinlich …« Er führte den wild protestierenden Vater aus der Station.
Aber so leicht gab sich Mr. Hamilton nicht geschlagen. »Sie wurde vergewaltigt, habe ich recht? Sie versuchen, mir etwas zu verheimlichen. Der Kerl hat sie vergewaltigt, das weiß ich.«
»Nein«, erwiderte der Doktor. »Nein. Man hat es zwar versucht, aber der oder die Männer hatten keinen Erfolg. Ich vermute, dass sie Ihre Tochter umgebracht hätten, wenn es ihnen gelungen wäre, aber es ist nicht passiert, das versichere ich Ihnen. Der medizinische Beweis ist eindeutig … Es ist unmöglich, Mr. Hamilton. Ihre Tochter ist noch Jungfrau.«
3
Das Montreal aus Sallys Kindheit war nicht so wie das Montreal von heute. Aufgrund der sprachlichen und religiösen Unterschiede herrschte eine nicht allzu auffällige – und vom Stadtpunkt der Engländer durchaus akzeptable – Apartheid. Unter der Oberfläche hatte die Fehde zwischen den beiden Nationalitäten immer gebrodelt, aber Sally nahm wie die meisten Mitglieder der englischen Gemeinschaft die Franzosen gar nicht richtig wahr. Sie sprachen eine andere Sprache, besuchten ihre eigenen Schulen und Universitäten, lebten nach einer anderen Religion – nach einer sehr suspekten und primitiven, wurde Sally immer wieder erzählt. Die Priester seien allesamt korrupte, ignorante Trunkenbolde, die ihren Schäfchen das Geld abschwatzten, nur um die Taschen ihrer Soutanen damit zu füllen. Die Franzosen wohnten außerdem in Stadtteilen, in die kein englischstämmiger Bürger je einen Fuß setzte. Die einzigen französisch sprechenden Leute, denen Sally begegnete, waren Hausmeister, Taxifahrer und Straßenkehrer. Mit den alteingesessenen vornehmen Familien französischer Abstammung, den Senatoren, Professoren und Richtern hatte sie nie etwas zu tun gehabt – die lebten in einer anderen Welt.
In Sallys Kindheit war Montreal eine blühende Stadt – romantisch und voller Leben, und der ganz besondere Charme resultierte aus ebenden sprachlichen und kulturellen Unterschieden, die sie auch auseinanderriss. Drei ganz verschiedene Kulturen hatten Montreal geprägt und die Mischung von altem Geld, Geschäftstüchtigkeit, Risikobereitschaft und dem Tatendrang der Neuen Welt, von schottischer Kompromisslosigkeit und presbyterianischer Rechtschaffenheit und der kolossalen Macht der katholischen Kirche machte die Einzigartigkeit dieser Stadt aus. England – genauer Schottland –, Frankreich und Nordamerika waren hier eine Dreiecksbeziehung eingegangen, und alle drei hatten ihre eigene Persönlichkeit und den eigenen Stil miteingebracht. Ein paar der Gebäude aus dem 17. und 18. Jahrhundert, welche denen, die aus derselben Periode stammten und in den nordwestlichen Provinzen Frankreichs standen, bemerkenswert ähnlich waren, wurden bis zu den Sechzigerjahren kaum beachtet, weil sie zwischen Läden, Häusern und Kirchen undefinierbaren Stils versteckt waren. Mansarden des zweiten Empire und verzierte Kupferdächer des wiedererstandenen Barock, toskanische Pilaster und dorische Säulen waren in Montreal nichts Ungewöhnliches. Die einheimische Architektur mit kunstvollen Simsen, art-nouveau-Glas, unzähligen Balkonen und verwirrend vielen von schmiedeeisernen Geländern gesäumten Außentreppen weicht im englischen Sektor Queen-Anne-Giebeln, neogeorgianischen Villen, Terrassen und Absurditäten aus dem 19. Jahrhundert wie Türmchen mit Zinnen und Erker.
Reihen grauer Steinhäuser wachten mit stiller Würde über diese prahlerische, kunstfertige Extravaganz aus der viktorianischen Zeit und standen im krassen Gegensatz zu den üppig verzierten Fassaden und dem unglaublichen Mischmasch verschiedener Stilrichtungen, die lediglich den Wohlstand der neuen Reichen des späten 19. Jahrhunderts zur Schau stellen sollten, aber nie die diskrete Eleganz der unauffälligeren Gebäude und Plätze der Nachbarschaft erreichten.
Es war eine Stadt der beaux-arts-Balkönchen, Steinbalustraden, der paarweisen Säulen mit Eckkapitellen, die ohne Mühe neben Renaissance-Fenstern, der Gotik nachempfundenen Stützpfeilern und der palladinischen Bauweise Bestand hatten – die Schotten, die im 19. Jahrhundert die Elite der Stadt bildeten, liebten diese Architektur. Erstaunlicherweise machte gerade die Vermengung der unterschiedlichsten Stilrichtungen den Reiz aus: romanische Torbogen und plumpe Säulen ließen sich mit spitzen Giebeln, Kolonnaden und Porticos der alten Griechen und Römer ein. Der Neoklassizismus hob sich vorteilhaft zwischen den frühen Wolkenkratzern hervor, und die Schnörkelverzierungen und Obelisken des Neubarock erschienen ganz natürlich neben den medaillonförmigen Ornamenten des zweiten Empire und den vorspringenden Simsen der Chicagoer Schule.
Riesige katholische Klöster und religiöse Bauten gehörten ebenso in die Umgebung wie das Sun-Life-Gebäude, ehedem das größte Bauwerk im gesamten britischen Empire – dort wurden die Goldreserven der britischen Regierung während des Zweiten Weltkriegs gebunkert. Die Wolkenkratzer waren Bestandteil der Stadt wie der Blick über den Saint-Lawrence-Strom oder auf die Berge, nach denen der Ort benannt worden war.
Es war eine Inselstadt, in der sich lustige Cafés und preiswerte Bistros zwischen noblen Restaurants, privaten Kunstgalerien und edlen Boutiquen behaupten konnten. Die Straßen waren steil, die Ausblicke spektakulär und die Temperaturen extrem.
Im Winter, wenn der Saint Lawrence für Schiffe unbefahrbar war, senkte sich Ruhe über die Stadt – der Fluss war still, die Luft trocken und eisig. An wolkenlosen Tagen glitzerte die Sonne von einem blassblauen Himmel.
Nach den Monaten des Schweigens rissen die Schiffshörner im Frühling den Ort aus seiner Erstarrung, und die Ozeanliner brachen tapfer durch das schmelzende Eis, um die tausend Meilen bis zum offenen Meer hinter sich zu bringen.
Im Sommer flohen fast alle Bürger, die es sich leisten konnten, aufs Land; aber einige harrten doch aus, selbst ein paar Begüterte entschlossen sich freiwillig oder waren durch ihre Tätigkeiten dazu gezwungen. Während der heißesten Monate jedoch blieben die Menschen so oft wie möglich in den Häusern. Nur im Frühsommer und dann wieder im Herbst, wenn die Temperaturen erträglich waren, saßen teuer gekleidete Damen in den Gärten und auf den Balkonen, plauderten und untermalten ihre Unterhaltungen mit dem Klirren der Eiswürfel in ihren Gläsern, während in anderen Teilen der Stadt alte Männer in Schaukelstühlen auf den Veranden dösten oder das Geschehen auf den Straßen im Auge behielten.
Im September wurde gold zu kupfer, pink zu orange und dann zu rot. Die Berge nahmen die Farbe von schwerem Wein an, und das Blau des Himmels vertiefte sich. Die Betriebsamkeit hielt wieder Einzug in der Stadt. Nonnen, die ihre Breviere an sich drückten, wanderten in Zweierreihen durch die Klostergärten; die Franziskanermönche mit den braunen Kutten, die von Hanfseilen zusammengehalten wurden, zogen ihre Sandalen an und taten es den Nonnen gleich. Priester mit schwarzen Talaren hasteten durch die Straßen, und die Kinder gingen wieder zur Schule. Auf die Bürgersteige vor den Cafés wurden Tische und Stühle gestellt, in den Geschäften ging es lebhaft zu, und die Restaurants waren meistens voll. Die Männer strömten aus ihren Büros und strebten in die nächste Bar. Mütter schoben Kinderwagen über die von Bäumen gesäumten Gehwege, während Kinder zu den Klängen der Angelusglocke Himmel und Hölle auf dem Trottoir spielten.
Die Stadt war voller Kontraste – an den Hängen der Berge wohnten die Reichen in monumentalen Villen, während sich unten in den Straßen riesige Banken, die wie römische Tempel aussahen, und katholische Kirchen in der Größe von Kathedralen über begrünte Plätze hinweg mit uralter Rivalität beäugten.
Sally kehrte im Hochsommer 1962 in diese ungewöhnliche und atemberaubende Stadt zurück. Von dem Schock hatte sie sich immer noch nicht erholt. Obwohl sie froh war, wieder daheim zu sein, betrachtete sie jetzt diesen Ort – wie eigentlich die ganze Welt – mit anderen, ängstlichen Augen.
Eine Zeit lang konnte sie die Hitze als Ausrede anführen, um nicht ausgehen zu müssen, aber ihre Eltern merkten ziemlich schnell, dass die hohen Temperaturen auf der Straße nicht der einzige Grund waren, der sie im Haus hielt. Auch wenn sie nicht in vollem Umfang begriffen, wie grauenvoll es für Sally gewesen war, den schützenden Kokon der Klinik verlassen zu müssen, erkannten sie doch klar, dass sie schon allein der Gedanke an die Welt da draußen unsicher machte.
Louise war sehr in Sorge, weil ihre Tochter für ihren Geschmack zu abhängig von diesem Arzt in Paris geworden war. Sie hatte Sallys Abschied von ihm beobachtet und war schockiert gewesen, als sie Tränen in ihren Augen gesehen hatte. Dem Doktor war das auch nicht entgangen, davon war Louise überzeugt, denn er hatte die Hand auf Sallys Schulter gelegt und sie zur Tür gebracht. Louise war unglücklich über die Zuneigung, die sich zwischen den beiden offenbar entwickelt hatte, und ihre bösen Ahnungen wurden noch schlimmer, als der Arzt etwas auf Französisch zu ihrer Tochter sagte, was wie ein leidenschaftliches Flehen klang.
In Wirklichkeit hatte Dr. Lamotte Sally lediglich geraten: »Sie müssen vergessen, was passiert ist. Zwingen Sie sich, nicht mehr daran zu denken – ich meine das ernst. Die Sache ist ausgestanden, und so was geschieht nie mehr.« Er drehte sie zu sich herum und sah ihr fest in die Augen. »Was auch immer vorgefallen ist, Sie müssen es aus Ihrem Gedächtnis streichen. Wenn Sie das nicht tun, glauben Sie mir, dann zerstören Sie Ihr ganzes Leben.«
Als sie im Taxi saßen, um zum Flughafen zu fahren, bat Louise ihre Tochter, ihr zu übersetzen, was der Arzt zu ihr gesagt hatte, aber Sally zuckte nur mit den Schultern und murmelte ungehalten: »Er hat gar nichts gesagt, nur das Übliche eben.«
»Du scheinst ihn sehr gern zu mögen«, bemerkte ihre Mutter unklug.
Sally funkelte sie an. »Du würdest ihn doch sicherlich auch mögen, wenn er dir das Leben gerettet hätte«, versetzte sie schroff.
Die Hamiltons fanden nie heraus, was ihrer Tochter in Paris widerfahren war. Sie löcherten sie endlos, als sie wieder in Montreal waren, aber Sally war nicht bereit, sich ihren Verhören zu unterziehen. Deshalb bemühten sie sich immer wieder, die Sprache ganz beiläufig auf die Ereignisse zu bringen, ein- oder zweimal forderten sie sie auf, ihnen ihre Träume zu erzählen, und sie brachten sie zu Ärzten und Psychoanalytikern, aber nichts führte zum gewünschten Erfolg.
Sally erinnerte sich von Zeit zu Zeit in albtraumhafter Weise an Dinge, über die sie nie ein Wort verlor. Sie betrachtete die schreckliche Episode als etwas ganz Privates, das keinen anderen Menschen etwas anging. Sie war ohnehin nicht überzeugt davon, dass ihre verschwommenen Erinnerungen an diesen grauenvollen Zwischenfall nicht auf einem schlechten Traum beruhte, den sie gehabt haben mochte, als sie bewusstlos war und auf der Schwelle des Todes stand. Immerhin hatte sie halluziniert und einen kühlen, blauen unendlichen Raum gesehen. Warum sollte sie sich dann nicht vorstellen, die seltsamen, unbegreiflichen Dinge nicht geträumt zu haben? Als wollte sie sich selbst für ihre viel zu blühende Fantasie tadeln, redete sie sich, so gut es ging, ein, dass sie sich die ganze Sache nur eingebildet hätte.