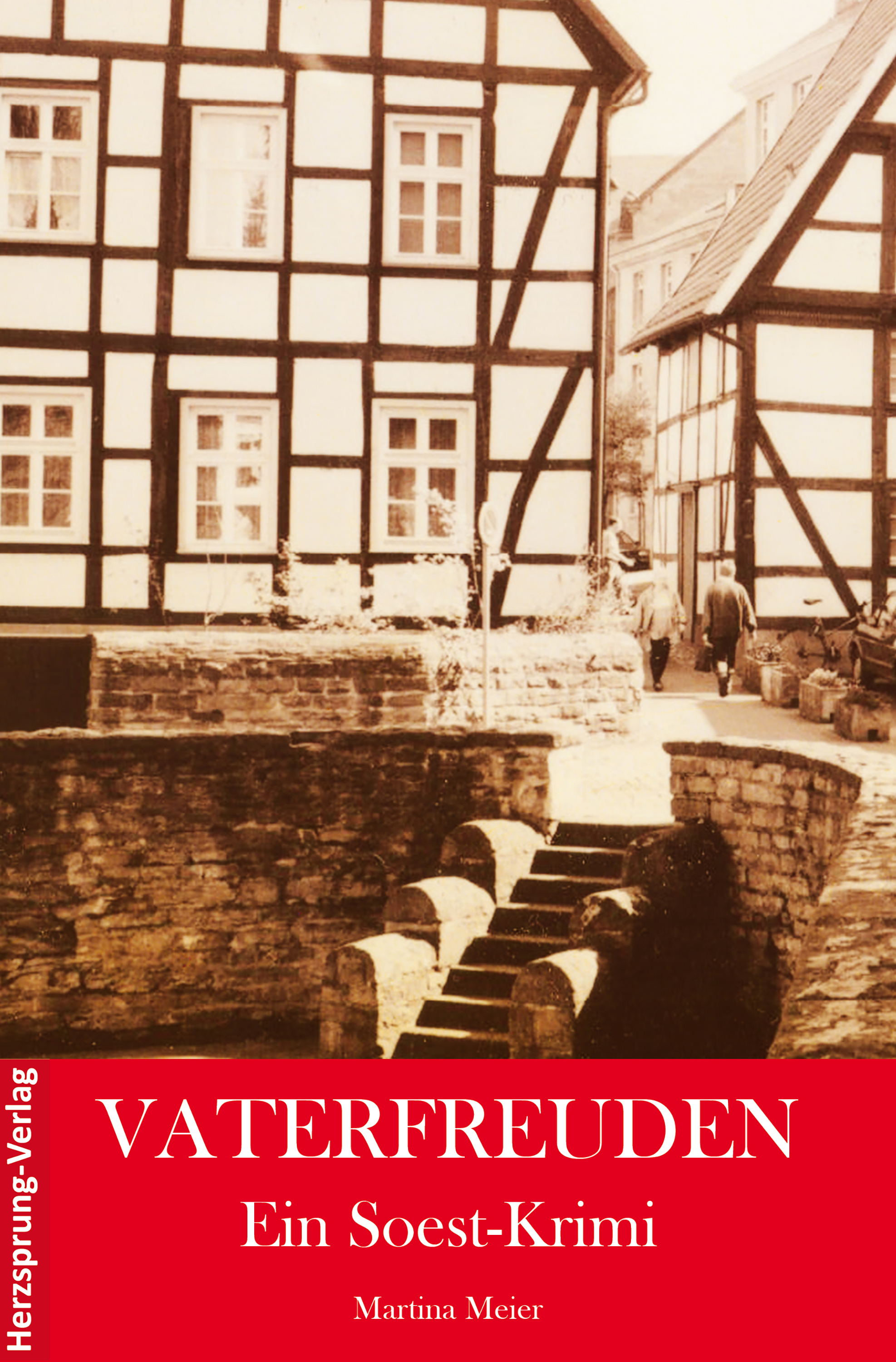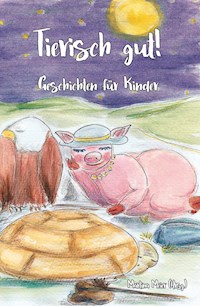9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Papierfresserchens MTM-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Geschichten von verwunschenen Orten, von Riesen, von zauberhaften Kräften oder Göttern auf dem Olymp – unsere neue Buchreihe „Sagenhaftes – Alte Sagen neu erzählt“ entführt ihre Leserinnen und Leser in magische Welten, bei denen man sich immer wieder fragt: „Ist das tatsächlich so geschehen?“ Wie viel Wahrheit in den von unseren Autorinnen und Autoren zusammengetragenen Sagen und Legenden tatsächlich steckt, wissen wir natürlich nicht. Wir hoffen aber, dass alle, die dieses Buch zur Hand nehmen, ebenso viel Freude an den poetischen, modernen, klassischen Erzählungen haben werden wie wir. Tauchen Sie also mit uns ein in die Welt der Nibelungen, besuchen Sie die Bürger Bambergs im Mittelalter, erklimmen Sie den Olymp oder leiden Sie mit den unglücklichen Paaren, die nicht zueinanderfinden können, weil es das Schicksal verhindert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
o
Sagenhaftes
Alte Sagen neu erzählt - Band 1
Martina Meier (Hrsg.)
o
Impressum
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet - www.papierfresserchen.de
© 2022 – Papierfresserchens MTM-Verlag GbR, Mühlstr. 10, 88085 Langenargen
in Zusammenarbeit mit CAT creativ www.cat-creativ.at
Alle Rechte vorbehalten. Taschenbuchauflage erschienen 2022.
Herstellung und Lektorat: CAT creativ - www.cat-creativ.at
Illustrationen Cover: © Tomasz Zajda - Adobe Stock lizenziert
ISBN: 978-3-99051-100-8 - Taschenbuch
ISBN: 978-3-99051-101-5 - E-Book
*
Inhalt
Vorwort
Die Pferde im Turm
Eine Braut in der Lache
Die Sage von der blauen Glockenblume
Das Geheimnis der Rheinbacher Waldkapelle
Das Teufelsschloss
Die weiße Frau vom Bodensee
Die Odenwälder Riesen
Wolfsbrunnen
Beatus und die Menschen am Thunersee
Die Hexeneiche bei Elkenroth
Mitterfelser Teufelsfelsen
Die Sage der Frau Holl
Der Holleabend
Die kalte Eiche
Elf Freundinnen müsst ihr sein
Die Blutfichten
Die Legende vom Weihnachtsstern
Der Träumende Aal
Rhönpaulus – Rebell der Rhön
Der kleine Schrazl vom Hauserl-Hof
Die Zwergerlhöhle von Pettenau
Die Sage vom Wirt am Berg
Die verwunschene Stadt Vineta
Bauernjunge Reineke
Ewiges Glück und Unsterblichkeit
Das Symbol von Almeria
Wie die Stadt Berlin zu ihrem Namen kam
Maui und die Sonne
Am weißen Stein
Der Nachtgeist von Kendenich
Rübezahl oder der Berggeist vom Riesengebirge
Baron Münchhausen
Der Kaiser und die Schlange
Das Lied aus Licht und Schatten
Von der Entstehung der Welt, Kopfgeburten und Sizilien
Die Blüemlisalp
Die Goldkammer
Das Hardermannli
Der Schusterjungengeneral
Der magische Kirschbaum
Prometheus lässt sich nicht unterkriegen
Das Beste aus Solingen
Psyche und Eros
Der Unvollendete
Die goldene Blüte und Luzifer
Die Ballingskellig-Melodie
Der Ingenieur Lenzen
Das Haus im Fluss
*
Vorwort
Manche Dinge brauchen einfach länger, um zu reifen, als andere. Schon seit Jahren spukte unserer Verlagsredaktion eine Idee im Kopf herum. Wir wollten ein Buch herausgeben, in dem wir alte Sagen neu erzählen lassen, um Dinge wieder ins Gedächtnis zu rufen, die nach und nach verloren gehen.
So ließen wir beispielsweise bereits 2016 von der Illustratorin Heike Georgi, mit der wir schon bei vielen Projekten zusammengearbeitet haben, den Schriftzug für die Buchreihe Sagenhaftes zeichnen. Doch wie es so oft ist, man hat eine Idee, beginnt ... und dann verläuft erst einmal alles im Sande. Von der ersten Idee bis zur konkreten Umsetzung des vorliegenden Buches vergingen tatsächlich mehr als sieben Jahren.
Doch das Warten hat sich gelohnt – wir freuen uns mächtig darüber, dass sich wirklich so viele Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an diesem Projekt beteiligt und tolle Sagen und Legenden in neuen Worten zusammengetragen haben. So steht es für uns inzwischen außer Frage, dass wir dieses Buchprojekt mit einem zweiten Band im kommenden Jahr fortsetzen werden.
Hatten wir zunächst noch überlegt, die einzelnen Bände regional zu halten, das heißt beispielsweise nur Sagen aus Bayern oder nur Sagen aus Österreich in einem Buch zu veröffentlichen, so sind wir bei der weiteren Planung der Buchreihe davon abgekommen. So wie es bereits in diesem Band ist, werden wir auch künftig in den Sagenhaft-Büchern ein breites Spektrum an Sagen aus aller Herren Länder präsentieren, denn wir als Verlagsredaktion fanden es tatsächlich spannend, in immer neue, uns manchmal auch unbekannte Erzählungen einzutauchen. Wir hoffen, dass es den Leserinnen und Lesern ebenso geht. Nun aber wünschen wir viel Freude beim Eintauchen in unsere ... sagenhafte Welt!
Martina Meier (Verlegerin und Herausgeberin)
*
Die Pferde im Turm
Eine Sage aus Köln
Mengis wich seiner Liebsten seit Tagen nicht mehr von der Seite. Ihre Stirn glühte. Immer wieder musste sie sich übergeben. Inzwischen fehlte Richmodis die Kraft, sich im Bett aufzurichten. Die geschwollenen Lymphknoten am Hals drohten zu platzen. Bei jeder Berührung schrie sie vor Schmerzen. Sie komme um vor Durst, klagte sie und die Magd schaffte unentwegt Wasserkrüge herbei. Mit blassgrünem Gesicht, spröden Lippen, die Lider nur halb geöffnet, wandte Richmodis sich an Mengis und flüsterte: „Wenn ich sterbe, nimm meine Base Konstanze zur Frau!“
Er traute seinen Ohren kaum. Wie konnte sie so etwas sagen? „Niemals!“, rief er. „Du wirst nicht sterben!“ Er klammerte sich an ihren Arm.
Am Mittag schickte man nach dem Medicus. Der schaute sich die Kranke an und zuckte die Schultern. Dann machte er sich auf den Weg zu anderen Patienten. Kurz darauf erschien der Kleriker. Auch er war in Eile, erteilte die Sterbesakramente und schon war er wieder fort.
Aus Richmodis’ Mund kamen nur noch Wortfetzen. Ihr Atem ging stoßweise. Plötzlich griff sie nach Mengis’ Hand. Ein letztes Mal atmete sie aus und dann rollte ihr Kopf zur Seite. Sie wirkte winzig und dünn, wie sie nun leblos auf der Matratze lag, das Gesicht friedlich und entspannt. Keine Spur mehr vom Todeskampf der letzten Stunden.
Mengis spürte, wie sein Herz in tausend Stücke zersplitterte. Warum Richmodis? Wie sollte er ohne sie weiterleben? Er beugte sich vor und lauschte. Aber sie atmete nicht mehr.
Ein Husten ertönte vom anderen Ende des Raumes. Erst jetzt wurde Mengis bewusst, dass er nicht alleine war. Das Gesinde, das sich ebenfalls von der Herrin hatte verabschieden wollen, hatte die letzten Minuten schweigend an der Wand verharrt. Er nickte der Dienerschaft zu und einer nach dem anderen verließ den Raum. Zuletzt entschwand die Kammerzofe, das Gesicht feucht von Tränen. Nur das Rascheln ihres Rockes war zu vernehmen. Als die Tür hinter ihr ins Schloss fiel, wurde ihm klar, dass er immer noch Richmodis’ rechte Hand hielt, obwohl der Medicus verboten hatte, die Tote zu berühren. Doch Mengis hatte nichts mehr zu verlieren. Er spürte, wie sich der Edelstein ihres Eheringes in seine Handfläche grub, und erinnerte sich an den Tag vor zwei Monaten, als er seiner Holden das Schmuckstück an den Finger gesteckt hatte. Was hatte sie gestrahlt! Mengis drückte noch fester zu und genoss den Schmerz. Er legte den Kopf auf Richmodis’ Brust und flüsterte: „Diesen Ring sollst du mit ins Grab nehmen als Zeichen unserer unendlichen Liebe.“
Gepolter auf der Treppe ließ ihn aufschrecken. Die Tür wurde aufgestoßen und ein kalter Luftzug erfüllte den Raum. Mengis wusste, es war verboten, Totenwache zu halten. Er war aber noch nicht bereit, sich von Richmodis zu lösen. Doch die Totengräber drängten ihn beiseite, wickelten den leblosen Körper wie einen Tierkadaver in schmutziges Sackleinen und schafften ihn hinunter. Mengis folgte ihnen, die Beine drohten ihm den Dienst zu versagen. Als er auf die Straße trat, sah er, wie Richmodis in eine Lade gelegt wurde. Das Gesinde stand bereit, um ihr das letzte Geleit zu geben. Die Kammerzofe schaute auf das schwarze Kreuz an der Hauswand und begann zu zittern und zu wehklagen. Hatte sie Angst, die Nächste in diesem Hause zu sein, die die Pest dahinraffen würde?
Dank seines Reichtums und des Ansehens, das er in der Stadt genoss, konnte Mengis verhindern, dass Richmodis in eine Grube auf dem Acker zu den anderen Toten geworfen wurde. Man bettete sie in einen Sarg, der auf dem Friedhof neben Sankt Aposteln in die Erde hinabgesenkt wurde.
Die Nacht brach bereits über Köln herein, als er in sein Haus zurückkehrte. Die Halle wirkte trostlos und leer. Am Fuß der Treppe erblickte er eine schlanke Gestalt. Einen Moment meinte er, Richmodis wäre zurückgekehrt, doch es war Konstanze. „Was macht Ihr in meinem Hause? Richmodis ist dahingeschieden!“, brüllte er.
Konstanze schaute ihn aus traurigen Augen an. „Ich weiß, mein Herr. Ich kam zu spät. Nun möchte ich Euch mein Beileid aussprechen.“
Mengis wusste, warum Konstanze wirklich gekommen war. Er gab dem alten Edgar, der soeben in der Halle erschien, ein Zeichen und dieser geleitete sie zur Tür hinaus.
Das Gesinde huschte rastlos durch die Räume und aus der Küche ertönte Geschirrklappern. Offenbar hatte das Personal die Arbeit wieder aufgenommen, ganz so, als wäre nichts geschehen.
Mengis’ Kehle fühlte sich an wie zugeschnürt. Er würde an diesem Abend keinen Bissen hinunterbekommen. Daher zog er sich in sein Schlafgemach zurück und sank, ohne eine Kerze anzuzünden, auf das Bett. Dann strömten die Tränen. Seine Brust bebte. Der Körper schien ihm nicht mehr zu gehorchen. Wie sollte er jemals wieder glücklich werden? Stundenlang wälzte er sich auf dem Lager hin und her. Irgendwann tief in der Nacht fiel er in einen Dämmerschlaf und träumte, Richmodis läge neben ihm. Eine helle Stimme drang in sein Unterbewusstsein. Er riss die Augen auf. Der Raum war leer. Das Weinen und Flehen kam von draußen. War Konstanze zurückgekehrt? Zu dieser späten Stunde? Aus der Halle ertönten verärgerte Rufe.
„Unsere Herrin ist tot. Wer immer Ihr seid: Schert Euch zum Teufel!“, rief Edgar.
Da! Erneut diese liebliche Stimme.
Mengis stürmte zum Fenster und schaute hinaus. Unten stand eine Person in einem Leichenhemd. Das Licht der Laterne fiel auf ihr Gesicht. Sie blickte ihn an und rief: „Mein lieber Gemahl! Sorge dafür, dass man mir Einlass gewährt!“
Es gab keinen Zweifel. Richmodis lebte! Aber wie konnte es sein? Er hatte die Tote selbst zum Friedhof geleitet.
„Erst wenn meine Schimmel auf den Turmboden laufen, glaube ich, dass du am Leben bist“, antwortete Mengis. Kaum hatte er den Satz beendet, ertönte Hufgetrappel auf den Stiegen. Er löste seinen Griff vom Fensterkreuz, durchquerte den Raum mit großen Schritten und rannte die Treppe hinab.
Das Gesinde drängte sich um ihn, als suche es Schutz vor dem Geist, der dort vor der Tür stand. Mengis schob den Riegel mit einem Ruck beiseite. Richmodis fiel ihm weinend um den Hals. Obwohl das Hemd bereits den Geruch von modernder Erde angenommen hatte, war ihr Haar weich und die Haut rosig. Er trug sie zum Kamin, in dem noch das Feuer loderte. Die Mägde brachten Kleidung und Decken. In der Küche herrschte wieder geschäftiges Treiben und man servierte kurz darauf dampfende Speisen.
Richmodis erzählte erst zögernd, dann immer lebhafter, was geschehen war: Ein Totengräber war offenbar auf den wertvollen Ring an ihrer Hand aufmerksam geworden. Er musste in der Dunkelheit zum Friedhof zurückgekehrt sein, das Erdreich wieder ausgehoben und den Sargdeckel aufgestemmt haben, denn in dem Moment, als er ihr das Schmuckstück vom Finger ziehen wollte, hatte sie die Augen aufgeschlagen.
Mengis nahm Richmodis’ Hand und strich über den Stein. Ein Segen, dass er ihr den Ring gelassen hatte.
Am nächsten Tag strömte das Volk herbei, um sich von dem Wunder zu überzeugen. Es gab Schreiberlinge, die die Geschichte auf Papier verewigen wollten. Doch Mengis schirmte seine Gattin wie einen kostbaren Juwel von der Außenwelt ab. Die Schimmel verharrten im Turm.
Wenn man heute durch die Richmodisstraße in Köln schlendert, sieht man noch immer aus einem Fenster zwei Pferdeköpfe hinausschauen.
Monika Arend, geboren 1964 in Köln, lebt mit ihrem Mann im Oberbergischen. Die Fremdsprachenkorrespondentin hat ein Studium in kreativem Schreiben absolviert. Sie verfasst kurze und lange Geschichten in diversen Genres. Monika Arend fährt gerne Mountainbike und ist sehr naturverbunden. Ihre Romane „Auszeit in die Liebe“ und „Einmal Steinzeit und zurück …“ sind im Herzsprung-Verlag erschienen. Im Frühjahr 2022 wurde ihr erster Krimi „Ruhe sanft am IJsselmeer“ ebenfalls von diesem Verlag veröffentlicht.
*
Eine Braut in der Lache
Eine Sage aus Reichertshausen
Geschehen ist das Unglück, vertraut man der Legende, nahe dem oberbayerischen Reichertshausen, einem Ort im Nirgendwo, eingekesselt von München, Ingolstadt, Augsburg und Landshut. Wir befinden uns jenseits des östlichen Bezirks der besagten Gemeinde, an der Grenzlinie zwischen Schlosswald und Staatswald.
Von der verwitterten Bank, sie thront über den umliegenden Wegen, ihr Holz ist an manchen Stellen brüchig, lässt sich ein Denkmal besehen. Dort, wo vier gekieste Forstpfade aufeinandertreffen, eine Kreuzung bilden, die die Höhenunterschiede der einzelnen Wege kurzzeitig ebnet, steht das sogenannte Marterl: Ein eingeschlagener Stempen, ein bisschen länger als ein handelsüblicher Zaunpfahl ist er schon, ihm obenauf, in einem Schaukasten, das Bild einer Braut. Von ihr wird gesagt, sie sei unter die Räder gekommen. Der unweite Friedhof, wallendes, durch Hasen, Wildschweine und Rehe aufgerührtes Gebüsch, das Raunen windgefächerter Äste, jene Symphonie erweckt die Atmosphäre eines naturgemachten Krimis. Beinahe schlafwandlerisch. Und in dieser trügerischen Ruhe mysteriös.
Zwei waagrechte Bretter über der Brücke, auf dem oberen von beiden steht Brautlache, bilden eine liederliche Front gegen den jähen Abgrund des Rinnsals direkt darunter. Es modern die schlierigen Latten dieser Brücke links neben dem denkwürdigen Schaukasten, Würmer bahnen ihre rätselhaften Gänge durch das Innenleben der Bretter. Alles ist angetan, der Braut im Vorbeigehen eine Gedenkminute zu spenden.
Es wird überliefert, die Kutsche, in der sie zusammen mit ihrem Bräutigam gesessen hat, sei seitlich gekippt. Die schmuckdekorierte Braut, Details ihres Aussehens sind in der Flüsterpost der Epochen verschüttgegangen, sei überrollt worden wegen des abschüssigen Geländes, fast ungebremst in die Tiefe des Rinnsals hinabgestürzt. Und ertrunken.
Die Brücke mit dem Denkmal und der Aussichtspunkt mit der Sitzbank sind ringsherum die einzigen Ebenen.
Gegenwärtig charakterisiert ein schlammiger Brei, ein wasserarmer Matsch, das Bett der Brautlache. Man hegt Zweifel, ob all das, was die Legende behauptet, in der Lache geschehen ist. Und doch, wenn Rotmilane den grau-tristen Himmel umkreisen, den Wald bei Reichertshausen wortlos zu ihrem Revier erklären, vermittelt ihr galanter Gleitflug, unter den Fittichen hielten sie, gehütet seit Generationen, Einzelheiten jener Historie verborgen.
Laub knistert unter den Sohlen, es knirschen dem Profil eingetretene Kieselsteine. Zwangsläufig erwägt man bei den Wanderungen im Radius der Brautlache, die Sinne trügen und der beträchtliche Pegel im gefluteten Rinnsal ferner Vergangenheit sei noch nicht gänzlich zurückgegangen, die Seele der Braut wird spürbar, ihr Herz scheint zu pulsieren. Scheuende, wiehernde, mit den Hufen scharrende Pferde, Schritt für Schritt webt das Gedächtnis fort, was wäre geworden, wenn … Hätte man die Kutsche anheben, die Braut vor dem Ertrinken in der Lache retten können?
Zwischen Schlosswald und Staatswald, dem Gebiet um Herrenrast, schwebt mit den gerade morgendlich ausgeprägten Nebelschwaden ein unterschwelliges Heldentum. Man schwelgt in der Illusion, ausgerechnet man selbst hätte die Braut aus der Untiefe des schlanken Wasserlaufs emporheben können. Der Bräutigam, er soll das Desaster ja überlebt haben, ist gewiss längst tot. Zu den Vorbeikommenden, die auf befremdliche Weise aufatmen, weil diese schrecklichen Szenen seit unzähligen Dekaden verjährt sind, gehöre auch ich. Der Humus allein weiß, wie groß der Gehalt an Wahrheit ist, den man der Brautlache andichtet. Überlassen wir den Bodenschichten, wohin sie diese Erzählung verorten ...
Oliver Fahn wurde 1980 in Pfaffenhofen an der Ilm im Herzen Oberbayerns geboren. Der Heilerziehungspfleger lebt bis heute zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in der Kreisstadt. Fahn veröffentlicht regelmäßig Beiträge in Kulturmagazinen und verfasst Texte für Anthologien. Zudem unterhält der Autor ein Profil bei story.one und bringt dort Kurzgeschichten heraus.
*
Die Sage von der blauen Glockenblume
Eine Sage aus dem Taunus
Sagenhaftes, das gibt es auch im Taunus. So wird unter anderem von einer blauen Glockenblume erzählt, die alle hundert Jahre auf dem Rossert wächst und voller Magie steckt. Diese Blume besitzt die Fähigkeit, den Berg zu öffnen, wodurch ein geheimnisvoller Ort offenbart wird.
Einst fand ein Mädchen aus dem kleinen Örtchen Eppenhain diese besondere Blume. Kaum dass sie diese gepflückt hatte, tat sich der Berg magisch auf und offenbarte eine Höhle. Mutig schritt das Mädchen hinein, wo sie neben Gold und Edelsteinen eine angekettete Frau vorfand.
„Mädchen“, sprach diese. „Nimm so viel Gold und Edelstein, wie in deine Schürze passt.“
Kurz zögerte die Kleine, dann jedoch ließ sie die Blume fallen und griff eifrig zu. Erst als die Schürze gänzlich gefüllt war, nahm das Mädchen allen Mut zusammen und fragte die Frau, weshalb sie denn angekettet sei. Doch als diese ihr nicht antwortete, beschlich das Mädchen ein ungutes Gefühl, weshalb es sich schnellen Schrittes zum Ausgang der Höhle begab. Doch bevor es diesen geheimnisvollen Ort verlassen konnte, trat ihm plötzlich ein Wichtelmann entgegen.
„Mädchen, du vergisst das Wichtigste!“, sprach das kleine Wesen, doch das Mädchen wich erschrocken zurück und eilte weiter.
„Hörst du nicht, Mädchen? Das Wichtigste hast du liegen lassen!“, rief der Wichtel erneut, doch da war das Mädchen bereits ins Freie getreten. Hinter der Kleinen schloss sich der Felsen.
„Wie konntest du nur die Blume vergessen?“, meinte der Wichtelmann vorwurfsvoll. „Sie war ein Schlüssel. Hättest du die magische Glockenblume behalten, so hätte diese sich in eine Springwurzel verwandelt, mit welcher du jederzeit Zugang zu der Höhle gehabt hättest. Dann wäre es dir sicherlich auch gelungen, die angekettete Frau zu befreien. Nun wird sie weitere hundert Jahre warten müssen und hoffen, dass die magische Glockenblume erneut von jemandem gefunden wird.“ Kaum dass der Wichtelmann verschwunden war, blickte das Mädchen auf ihren kleinen Schatz in der Schürze und stellte bestürzt fest, dass sich dort nichts weiter als Steine und Scherben befanden.
Pamela Murtas wurde 1975 in Frankfurt-Höchst geboren, lebte jedoch seit ihrem zehnten Lebensjahr in Italien, wo sie an der Deutschen Schule Mailand ihr Abitur absolvierte. Nach drei Jahren Moskauaufenthalt kehrte sie nach Italien zurück, um in Rom professionellen Reitsport zu betreiben. Seit 2007 wohnt sie erneut in Deutschland. Veröffentlicht hat sie bisher den vierteiligen Abenteuerroman „Destini“, außerdem weitere Kurzgeschichten und Gedichte in verschiedenen Anthologien.
*
Das Geheimnis der Rheinbacher Waldkapelle
Eine Sage aus Rheinbach
Die Rheinbacher Waldkapelle – oder auch Kapellchen, wie sie von den Einheimischen oft genannt wird, hat eine wunderbare Entstehungsgeschichte, die von Generation zu Generation weitererzählt wurde.
Hermann Kuchenheim, ein Bürger der Stadt Rheinbach, hatte ein schweres Los. Seine liebe Frau war sehr krank und er wusste nicht, wie er ihr helfen sollte. Doch mit einer Sache konnte er ihr helfen: Er war ein guter Holzfäller und sehr tüchtig mit der Säge. Also nahm er sich vor, genug Brennholz für den Winter zu beschaffen, sodass seine kranke Frau auf keinen Fall frieren musste.
Er kaufte fünf junge Buchen im Rheinbacher Stadtwald und machte sich eines Morgens mit seinem Neffen Johann Thynen auf den Weg, um die Bäume zu fällen. Es war sehr neblig und kalt, doch die beiden hatten die Bäume schnell gefunden. Sie machten sich an die Arbeit und fällten sie. Der Nebel verzog sich und die Sonne strahlte durch das Herbstlaub. Rotgelb wiegten sich die Blätter im Sonnenschein, irgendwo klopfte ein einsamer Specht. Die beiden Männer setzten sich auf einen Baumstamm und frühstückten ausgiebig. Sie waren sehr zufrieden mit ihrer Arbeit und wärmten sich an den Sonnenstrahlen.
„Wenn doch nur Helga bald wieder gesund wird!“, seufzte Hermann traurig. Plötzlich verdunkelte sich der Himmel unvermittelt und ein Donnergrollen war zu hören.
„Was ist das?“, fragte Johann. Er war vierzehn Jahre alt, doch sah durch die harte Arbeit, die er oft verrichten musste, viel älter aus.
Sein Onkel blickte verwundert nach oben. „Es ist seltsam. Zu dieser Jahreszeit haben wir doch nie Gewitter!“, murmelte er.
Es blitzte und donnerte erneut. Die Männer wussten nicht recht, was sie machen sollten und sahen sich ratlos an.
In diesem Moment schlug ein Blitz in den Baum ein, neben dem sie standen. Der Baum wurde gespalten und vier Holzscheite fielen zu Boden. Sie sahen aus wie ein Herz.
Eine Schrift wurde sichtbar: I H S – die Abkürzung für den Namen Jesus. Das Gewitter verzog sich so schnell, wie es gekommen war.
Hermann und sein Neffe staunten. Ihre Herzen schlugen schneller – was war passiert?
Hermann sagte: „Ich werde die Holzscheite mit nach Hause nehmen, sie sind etwas Besonderes, da bin ich mir sicher!“ Auch Johann glaubte, dass sie eben Zeugen eines ganz außergewöhnlichen Ereignisses gewesen waren. Schweigend und in Gedanken versunken machten sich die Männer auf den Heimweg.
Die kranke Frau hörte sich die Geschichte geduldig an. „Legt die Scheite neben mein Bett, wenn ich bete, werde ich Jesus ganz nah sein!“, flüsterte sie leise. Ihre Augen leuchteten in einem hellen Glanz und Hermann spürte so etwas wie Hoffnung.
Am nächsten Tag aß seine Frau das erste Mal seit langer Zeit wieder ihren Teller mit der Hühnersuppe ganz auf. Als Hermann zur Arbeit ging, hörte er ein Klopfen. Er drehte sich um und sah seine liebe Frau, die am Fenster stand und ihm hinterher winkte. Da musste er das erste Mal seit langer Zeit wieder lächeln. Fröhlich winkte er zurück.
Vier Monate später war die Frau wieder völlig gesund und konnte ihre Arbeit wieder aufnehmen.
Sechzehn Monate blieben die heiligen Scheite im Hause der Eheleute. Doch dann kam der Bonner Schneider Wilhelmi zu Besuch und hörte von der Geschichte. Der Schneider überredete das Ehepaar, die Scheite in der Kirche auszustellen, damit mehr Leute daran teilhaben konnten. Die Kuchenheims willigten sofort ein. Noch am selben Tag erfuhr der Sekretär des Kurfürsten von der Geschichte. Der Kurfürst freute sich so sehr über die Scheite, dass er einen Künstler beauftragte, die Scheite mit silbernen Verzierungen einzufassen. Außerdem ließ er die Geschichte aufschreiben, damit sie nicht verloren ging.
An der Stelle, an der die Buche stand, in die der Blitz eingeschlagen hatte, ließ er die Waldkapelle bauen. Dort sollte der Name Jesu immer verehrt werden.
Dörte Müller,geboren 1967, schreibt und illustriert Kinderbücher. Sie lebt mit ihrer Familie in Bonn und unterrichtet an einer Gesamtschule.
*
Das Teufelsschloss
Eine Sage aus dem Taunus
Auf dem Gipfel des Rossert erstreckt sich eine sonderbar gezackte Felsformation. Laut einer weiteren, etwas düsteren Legende handelt es sich hierbei um die versteinerten Nonnen, die einst in einem Kloster am oberen Hang des Rossert lebten. Diese nahmen ihren Glauben offenbar nicht allzu wichtig und lebten stattdessen fröhlich in den Tag hinein. Sie hielten sich nicht an die Regeln ihres Ordens und kamen auch nicht ihren religiösen Verpflichtungen nach. Dies entging natürlich nicht dem Teufel, und so beschloss er, eine dieser sündigen Nonnen zu entführen. Doch ein aufmerksamer Engel erkannte des Teufels Absicht und konnte ihm die Nonne noch rechtzeitig entreißen, sodass ihre Seele gerettet wurde. Dies erboste den Teufel so sehr, dass das gesamte Kloster erzitterte, als er schrie:
„Steinern und starr sei der Nonnen Gebein!
Sturm aus der Tiefe, zerschelle das Haus!“
Kaum dass der Teufel diesen Fluch ausgesprochen hatte, erhob sich ein eisiger Wind und noch bevor die lustigen Nonnen verstehen konnten, was mit ihnen geschah, erstarrten sie und verwandelten sie sich zu Stein. Auch das Kloster fiel dem Sturm zu Opfer und stürzte komplett ein. Lediglich wirres Felsgeröll am waldigen Abhang des Rossert blieb zurück und erhielt den Namen Teufelsschloss.
Pamela Murtas wurde 1975 in Frankfurt-Höchst geboren, lebte jedoch seit ihrem zehnten Lebensjahr in Italien, wo sie an der Deutschen Schule Mailand ihr Abitur absolvierte. Nach drei Jahren Moskauaufenthalt kehrte sie nach Italien zurück, um in Rom professionellen Reitsport zu betreiben. Seit 2007 wohnt sie erneut in Deutschland.
*
Die weiße Frau vom Bodensee
Eine Sage vom Bodensee
Aurelia ließ ihre Hand durch das Wasser fahren. Ihr Vater steuerte das kleine Fischerboot über den Bodensee, das Segel fing den Wind ein und sorgte für flotte Fahrt. Aurelias Finger glitten in das kühle Nass und mit der nächsten Welle wieder hinaus. Sie fühlte den See, für sie besaß er eine Seele, war ein lebendiges Wesen.
Den anderen Arm hatte sie auf den Rand des Bootes gelegt, das Kinn ruhte auf dem Unterarm und ein Lächeln umspielte ihre Lippen. Sie hatte an diesem Tag Johann gesehen auf dem See. Ach, sie liebte den einfachen, abenteuerlichen Fischer aus Meersburg. Er war halt vom anderen Ufer des Sees, von der anderen Seite. Aber durch ihre Hilfe auf dem Fischerboot ihres Vaters lernte Aurelia ihren Johann kennen und lieben. Natürlich nur im Geheimen. So eine Verbindung hätte ihr Vater nie gebilligt. Trotzdem hegte sie die Hoffnung, dass sie ihre Liebe irgendwann doch ausleben dürften. Eine Hoffnung, die noch am selben Abend zerschlagen werden würde.
„Ich werde diesen Trottel nie und nimmer heiraten“, schrie sie. Mit hochrotem Kopf starrte sie ihre Eltern an. „Ich kenne ihn nicht, ich will ihn nicht kennenlernen. Ich hasse ihn.“
Armin schaute seine Frau an und blickte dann zu Boden, den Blickkontakt mit seiner Tochter Aurelia hielt er nicht aus. Diese schnaubte schließlich und stürmte aus der kargen Küche, dem einzigen, geheizten Raum der Fischerhütte. Hätten sie 1000 Jahre später gelebt, hätte er wahrscheinlich geseufzt und resigniert Teenager gedacht. Aber sie lebten nun halt in tiefer Vergangenheit unter der knüppelharten Herrschaft der Habsburger und der arme Fischer kämpfte nicht nur mit den viel zu hohen Abgaben an die Herrscher, sondern auch noch mit der Halsstarrigkeit seiner Tochter. Früher, als er noch jung war, hatten die Kinder einfach gemacht, was die Eltern gesagt hatten. Aber heute war das ganz anders. Armin schüttelte verzweifelt den Kopf. Er musste seine Tochter in die Habsburgerfamilie einheiraten, jetzt, wo sich die Gelegenheit bot. Der junge Adalbert, die ach so hochwohlgeborene Rotzgöre des Vogts, hatte Avancen gemacht. Sehr zum Missfallen der jungen Burschen aus dem Dorf. Denn Aurelia war das hübscheste Mädchen am Nordwestufer des Bodensees. Miese Verräter wurden sie gescholten und Abtrünnige. Aber was sollte er tun? Die Fischbestände im See waren zurückgegangen und wenn er einen guten Fang einholte, formte der Herzog links schon eine hohle Hand und rechts eine Faust. Und die Familie war Armin näher als die tratschenden Dorfbewohner, also hatte er dem Pakt mit dem Teufel zugesagt und der Heirat seiner Aurelia mit diesem Adalbert zugestimmt. Das würde sie von den Steuern befreien und ihnen als Familie noch allerhand weitere Vorteile bringen.
Armin trat von einem Fuß auf den andern, blickte seine Frau an und entschloss sich dann doch, seiner Tochter zu folgen. Doch Anita hielt ihn am Arm fest und schüttelte den Kopf. Sie spürte, wie sich seine Muskeln entspannten und sein Schultern sanken.
„Gib ihr etwas Zeit“, hauchte sie mit gebrochener Stimme und schluckte ein Schluchzen hinunter. Wie hatten sie sich auch nur so entscheiden können. Ihre geliebte Tochter diesem Adalbert, diesem Habsburger anzuvertrauen. Diesem Fremdling, einem Eindringling in diesen friedlichen, heimischen Hügeln. Doch es ging nicht anders. Es war nicht mehr wie früher, als man noch gut leben konnte von Felchen, Brachsen und Saiblingen. Der Vogt verlangten immer mehr und genau einer dieser Blutsauger sollte nun die Rettung bringen. Die Ironie des Schicksals hätte nicht härter zuschlagen können. Natürlich war es Armin gewesen, der die Idee hatte. Und Anita hatte keine Ahnung, wie sie das Ganze hätte abwenden können, schließlich wusste sie um die missliche Lage und es gab einfach keine Alternative.
Bald waren alle Vorbereitungen getroffen, der Vogt hatte für die Hochzeit seinen Burghof oberhalb des Bodensees festlich geschmückt, Blumen, Tücher, wehende Fahnen. Aurelia stand an eine Säule gelehnt und starrte hinaus auf das spiegelglatte Wasser des Sees. Sehnsuchtsvoll Richtung Meersburg, Richtung Johann. Ihr weisses Kleid flatterte rein und unschuldig in der kühlen Brise, der Schleier lang und wild. Hinter ihr wuselten die Bediensteten herum, um noch an den letzten Details zu schleifen. Sie drehte sich um und sah, wie die edlen Gäste eintrafen, sich in unehrlichen Höflichkeiten ergaben und sich schier überschlugen, um sich beim Vogt einzuschleimen. Sie erkannte ihren Vater und ihre Mutter, abseits, am Rande des Parks. Sie passten in die Szene wie zwei gerupfte Hühner in ein Pfauengehege. Und über dem Geschehen zogen große, dunkle Wolken auf.
Auf der anderen Seite des Sees lehnte Johann an einer ähnlichen Säule und blickte über den See, ob er nicht ein Zeichen der Hoffnung, ein Zeichen Aurelias ausmachen könnte. Das Wissen um ihre Vermählung zerriss ihm das Herz. Er hieb mit seiner Faust auf die steinerne Säule ein und diese platzte an den Knöcheln auf. Der Blutfleck glich einem düsteren Zeichen und Johann starrte ihn an, nur kurz, ein paar Sekunden. Dann hob er seinen Blick zu den dunklen Wolken, die über der Burg des Vogtes thronten, verstand und hastete davon. Er musste zu seinem Boot, raus auf den See, ihr entgegen.
Dann kam der Moment, vor dem Aurelia sich so gefürchtet hatte. Sie musste sich in einer Kammer der Burg bereit machen für die Trauung, die Verbindung mit diesem Ekel. Sie hatte ihn erst einmal gesehen, aber das hatte gereicht. Dunkles, fettiges Haar, als Krone eines pickligen Gesichts, aufgepfropft auf einen hageren Körper, getragen von zwei dürren Stelzen. Adalbert. Sie blickte durch die Luke und da stand er, vor dem Altar. Er grübelte mit seinem Zeigefinger in der Nase und wartete wohl auf sie.
Dann erblickte Aurelia ihre Mutter, Tränen liefen ihr über die geröteten Wangen, ihr Vater hatte seinen Blick gesenkt. Aurelia schluchzte und fixierte die beiden. Eine Wärme erfüllte sie. Ihre Eltern sahen so klein und verloren aus, sie liebte sie dermaßen. Dann hob ihr Vater den Kopf, blickte ihr genau in die Augen und nickte ihr kaum merklich zu. Dabei lächelte er sanft. Aurelia lächelte zurück. Gleich darauf wandte sie sich plötzlich ab und floh. Floh aus der Burg, aus dem Park, aus diesem vorbestimmten, unglückseligen Leben. Sie stolperte hastig die Treppen hinunter zum See. Hinter sich hörte sie das wilde Gerangel der Gesellschaft, die ihr Verschwinden wohl unterdessen bemerkt hatte. Doch sie drehte sich nicht um.
Am See angekommen, suchte sie mit wachem Blick das Ufer ab, eine Strähne wild im Gesicht. Lachte los. Sie rannte dem Quai entlang, bis sie das kleine, altbekannte Fischerboot ihres Vaters entdeckte. Ohne zu zögern, schob sie es in den See und sprang geschickt an Bord. Sie hisste das kleine Segel und blickte nach oben. Wachsende Wolkentürme verdunkelten den Himmel und Aurelia richtete das Segel aus.
Hinter ihr am Ufer versammelten sich die Soldaten und bestiegen die bewaffneten Schiffe des Vogtes. Diese hatten größere Segel und schnittigere Rümpfe, sie würden Aurelia wohl bald eingeholt haben. Aber das kümmerte sie wenig. Sollten sie kommen. Sie reckte ihre Stirn stolz in den Wind und schaute dem anderen Ufer, Meersburg entgegen. Da erblickte sie, ein paar Hundert Ellen vor ihr, ein kleines, weißes Segel, das einsam dem unbarmherzigen Winde trotzte. Es hob sich winzig leuchtend vom dunklen Wasser ab, sie erkannte es sofort. Es war Johann. Sie strahlte, während die Schiffe des Vogts sie langsam überholten.
Nur noch ein paar Minuten, dann würde sie in Johanns Arme sinken und alles andere wäre egal. Dann rammte sie das erste Schiff des Vogts. Das schnellste Boot der Verfolger steuerte hart Backbord und schnitt ihr den Weg ab, während ein zweites Aurelia von Steuerbord gerammt hatte. Sie versuchte ihrerseits, nach Backbord auszuweichen und das Boot neigte sich bedrohlich auf die Steuerbordseite. Donner grollte und Blitze zuckten über die Hügel hinter Meersburg, Wasser schwappte schluckweise über den tief geneigten Bootsrand. Sie suchte nach einem Fluchtweg – und dann erblickte sie Johann. Er war unterdessen so nahe, dass sie seinen sorgenvollen Blick erkennen konnte. In dem Moment, als sich auch von Backbord ein Boot näherte, zögerte sie nicht mehr.
Sie riss den Steuerbalken nach Backbord und rannte nach vorn zum Bug und stürzte sich in die tobenden Fluten des Sees. Laut schrie sie dabei den Namen ihres Geliebten in die Nacht und für einen göttlichen Moment wehte das weiße Kleid über den Wellen, ihr Schleier löste sich aus Aurelias Haar und zuckte einem Blitz gleich durch die Luft. Dann wurde sie vom schwarzen Wasser verschluckt.
Johann war selbst zum Bug seines Bootes gestürzt, als er gesehen hatte, wie sich seine Liebste in den See warf. Ohne zu überlegen, schrie er seinerseits ihren Namen in den Wind und folgte ihr in die Fluten. Die Soldaten schauten sich mit fragenden Gesichtern an und versuchten, die beiden im dunklen Wasser zu erkennen.
Tatsächlich schimmerte Aurelias Kleid wie ein Geist durch die Wellen. Auch Johann konnten sie auf einmal ausmachen, knapp unter der Wasseroberfläche. Beide waren sie wie von einem schwachen Glühen erhellt und die Soldaten beobachteten staunend, wie sich beide unter Wasser umarmten. Alles wirkte unnatürlich langsam, irgendwie unwirklich, schwebend. Die beiden Liebenden fanden sich, schwammen sich in die Arme. Dann glitten sie unter Wasser weg, Richtung Seemitte und lösten sich schließlich unter den Blicken der verblüfften Verfolger auf, wurden eins mit dem See.
Unverrichteter Dinge kehrten die Soldaten des Vogts zurück, berichteten, was sie gesehen hatten. Egal, wie sehr der Vogt tobte und seinen Untergebenen Folter androhte, sie blieben bei ihrer Geschichte und keiner wagte es, an diesem Tag noch einmal auf den See hinauszufahren, um nach ihr zu suchen. Zu groß war das Wunder, dessen Zeuge sie geworden waren und die damit verbundene Angst.
Mit Staunen hörten auch Aurelias Eltern die Geschichte. Auch wenn sie für viele kaum zu fassen war, sie glaubten sie augenblicklich. Das war Aurelia, eins mit dem See. Wenn sie auch ihren Berührungen entschwunden war, so würde sie auf ewig leben, dessen waren sie sich sicher.
Und auch heute noch, wenn der Wind den See aufpeitscht und unter dunklen Wolken die Wellen gehen, sieht man Aurelia, wie sie, angetrieben und getragen von ihrem geliebten Johann, im weißen Kleid auf den Wellenkämmen reitet.
Philip Messmerlebt mit seiner Frau und drei Kindern in Sulgen in der Schweiz. Nach einigen Jahren als Journalist und Redaktor versucht er nun als Lehrer, in seinen Schülerinnen und Schülern die Freude am Schreiben zu wecken. Er schreibt gerne Geschichten, Theaterstücke und Hörspiele in kurzer und längerer Form.
*
Die Odenwälder Riesen
Eine Sage aus dem Odenwald
„Na, wie geht es denn heute meinem lieben Enkel“, sprach der Großvater, der sowohl seinen Sohn als auch seine Schwiegertochter besuchte, um auf deren Sohn aufzupassen, damit sie ins Kino gehen konnten.
„Ihm geht es heute schon besser. Sein Fieber ist nicht mehr so hoch“, antwortete die Schwiegertochter.
„Das ist schön“, sagte der Großvater.
„Ist es für dich auch wirklich in Ordnung, wenn du heute Abend auf ihn aufpasst?“, fragte Benjamins Mutter.
„Natürlich! Mach du dir keine Sorgen. Ich habe ein Buch mitgebracht, aus dem ich vorlesen möchte“, antwortete der Großvater.
Die Eltern des Jungen verabschiedeten sich und verließen mit guten Gewissen die Wohnung.
„Was für ein Buch hast du denn mitgebracht? Etwa eine Fantasiegeschichte?“, fragte der Junge neugierig.
„Nur nicht so hastig, mein kleiner Benjamin“, sprach der Großvater und setzte sich auf einen Stuhl, der neben dem Bett seines Enkels stand. „Dies ist ein ganz besonderes Buch. Es ist eine Sage über das Odenwälder Felsenmeer. Ich dachte, weil deine Eltern und du im nächsten Monat dort wandern wollt, erzähle ich dir etwas über den Odenwald und bringe dieses Buch mit“, grinste der Großvater seinen Enkelsohn an, nebenbei zeigte er ihm das Buch, welches er in der Hand hielt.
„Och, das ist ein olles Buch. So was mögen die Erwachsenen. Das langweilt mich. Ich will eine Geschichte mit Riesen, Trollen, Zwergen und mit jeder Menge Abenteuern“, gab der kleine Benjamin aufgeweckt von sich, als er in seinem Bett aufrecht saß, in der Hoffnung, sein Großvater würde ihm vielleicht doch seinen Wunsch erfüllen.
„Warum soll es in dieser Sage nicht um Riesen gehen? Diese Sage ist extra geschrieben für Kinder und ich bin sicher, das Buch wird dir gefallen“, entgegnete ihm sein Großvater.
„Okay, dann lies vor“, äußerte sich Benjamin, ohne große Erwartungen in dieses Buch zu setzen, was der Großvater aus seiner Stimme deutlich vernahm. Der Junge lehnte sich in seinem Bett zurück auf sein Kopfkissen und blickte seinen Großvater stillschweigend an, weshalb der Großvater seinen Enkel angrinste, als er mit dem Vorlesen des Buches begann.
„Lange Zeit bevor die Menschen auf der Erde lebten, hausten einst zwei Riesen im schönen Odenwald in der Gegend von Reichenbach. Riesen galten schon immer als streitlustige Wesen, trotzdem konnten sie gut miteinander auskommen“, las der Großvater vor, bis sein Enkel ihn unterbrach.
„Aber warte mal! Wie können die Riesen denn gut miteinander auskommen, wenn sie streitlustig sind?“, fragte Benjamin interessiert.
„Warte ab, der Satz ist noch nicht zu Ende. Du wirst es verstehen“, gab der Großvater in einem ruhigen Ton von sich, dann las er nach dem Räuspern seiner Stimme weiter vor, „denn jeder hatte sein eigenes Reich, was durch das Lautertal getrennt wurde.“
Darauffolgend blickte der Großvater seinen Enkel mit erhobenem Zeigefinger an. Benjamin nickte mit seinem Kopf. Dies wusste der Großvater richtig zu deuten.
„Der eine Riese lebte auf dem Felsberg und trug den Namen Felsenhocker. Der andere Riese lebte auf dem Hohenstein, dieser hieß Felsenbeißer“, las der Großvater grinsend vor.
Anschließend wendete er sich vom Buch ab, blickte seinen Enkel an und erklärte ihm: „Er trug wohl deshalb diesen Namen, weil er schon immer mehr Gesteine und Felsen in seinem Reich hatte als Felsenhocker.“
„Ach so, okay“, gab Benjamin belanglos von sich.
„Lange Zeit herrschte Frieden zwischen diesen beiden Riesen, bis eines Tages die beiden anfingen, sich heftig zu streiten“, las der Großvater weiter aus dem Buch vor, als urplötzlich sein Enkelsohn ihn erneut unterbrach.
„Aber Großvater, wer hat denn die Riesen entdeckt? Irgendjemand muss sie doch gesehen haben, wenn es diese Sage gibt?“, fragte der Junge neugierig.
„Tja, mein lieber Benjamin, das weiß ich auch nicht. Lass mich weiter vorlesen“, gab der Großvater von sich, er nahm auf dem Stuhl eine bequemere Sitzposition ein, hielt das Buch in die Höhe seines Gesichtes und setzte seine Lesestunde mit seinem Enkel fort. „Niemand weiß, was der Auslöser ihres Streites war. Jedenfalls schienen sich die beiden Riesen nicht mehr beruhigen zu wollen.“ Wieder wendete sich der Großvater vom Buch ab. „Vermutlich stritten sie sich so heftig, dass sie selbst im Endeffekt nicht mehr wussten, worum es überhaupt in ihrem Streit ging“, äußerte sich der Großvater. „Wie auch immer. Lesen wir weiter!“, gab er von sich, während er seine Brille nach oben schob, die ständig von seiner Nase abwärtsrutschte.
„Der Streit artete in einem unvorstellbaren Maße aus. Nichts und niemand war vor ihnen sicher, noch nicht mal sie selbst“, las der Großvater und warf seinem Enkel kurze Blicke zu.
„Möchtest du eine Pause?“, fragte der Großvater, nachdem er den eigenartigen Gesichtsausdruck von Benjamin sah. „Du siehst überanstrengt aus“, fügte der Großvater hinzu.
„Ich überanstrenge mich nicht, ich sehe nachdenklich aus. Es klingt komisch. Wie kann man sich so sehr streiten, dass man nicht mehr weiß, worum es in diesem Streit überhaupt ging?“, wollte der Junge wissen.
„Tja, weißt du ,mein Lieber, manchmal kann ein Streit so heftig werden, dass man streitet und streitet. Letzten Endes geht es oftmals nur darum, den Streit zu gewinnen, aber nicht darum, das Problem zu lösen“, antwortete der Großvater.
Darauf blickte Benjamin seinen Großvater stumm an, bis der aus dem Buch weiter vorlas.
„Die beiden Riesen beschimpften sich, fuchtelten mit den Armen herum und zeigten sich gegenseitig ihre Muskeln an den Oberarmen. Aber dies war nicht alles. Es kam noch schlimmer. Einer der Riesen begann, den anderen mit Steinen zu bewerfen. Die Erde vibrierte, das Brüllen der Riesen ertönte immer lauter und furchterregender. Lange warfen sie die Steine gegenseitig auf sich zu. Felsenbeißer hatte die besseren Aussichten, diesen Kampf zu gewinnen, da er über mehr Steine in seinem Reich verfügte. Doch Felsenhocker gab nicht nach. Er warf mit Steinen zurück, so gut und so lange er konnte. Doch all seine Kräfte ließen irgendwann nach. Die Zeit war gekommen, wo Felsenhocker das Nachsehen hatte. Felsenbeißer vergrub seinen Gegner mit seinen werfenden Felsbrocken“, las der Großvater vor, als er die letzte Seite umdrehte.
„Was denn? Felsenhocker ist gestorben?“, fragte Benjamin schockiert.
„Ob er gestorben ist, weiß man nicht. Man sagt, wenn man auf den Felsberg hart auftritt, dann kann man Felsenhocker noch stöhnen hören. Und so entstand das Felsenmeer. Ende der Sage!“, gab der Großvater von sich, woraufhin er das Buch zuklappte.
„Und man kann ihn wirklich noch hören, den Felsenhocker?“, fragte der neugierige Junge nach.
„So heißt es. Ich bin mir sicher, wenn du mit deinen Eltern dort hinfährst, dann wirst du jede Menge Spaß haben. Ihr werdet durch den Wald marschieren und auf jede Menge Felsen treffen, über die ihr klettern könnt. Dir wird das bestimmt sehr gefallen, dafür wird dein Vater schon sorgen“, lachte der Großvater mit seinem Enkel, als sich plötzlich die Tür öffnete.
„Es ist schön, euch beide bei so guter Laune zu sehen“, sprach Benjamins Vater.
„Ich habe deinem Sohn die Sage von den Odenwälder Riesen vorgelesen. Ich glaube, sie hat ihm gut gefallen“, lächelte der Großvater.
„Ja, das hat sie“, platzte es aus dem kranken Jungen heraus, „kommst du morgen wieder? Gerne darfst du mir die Sage erneut vorlesen“, gab Benjamin fragend von sich.
„Wenn du das möchtest“, sprach der Großvater grinsend.
Der Junge nickte.
Daraufhin verabschiedete sich der Großvater von der jungen Familie. Er stieg in sein Auto und fuhr nach Hause.
Benjamin hingegen freute sich bereits auf den nächsten Tag. Ganz nebenbei überlegte er, welches Bild er seinem Großvater bis dahin wohl malen könnte.
Sonja Haas ist 48 Jahre alt, wohnt im hessischen Lampertheim. Ihre Hobbys sind Lesen so wie das Schreiben von Geschichten. Mit ihren Kurzgeschichten konnte sie Erfolge in diversen Anthologien verbuchen.
*
Wolfsbrunnen
Eine Sage aus Heidelberg
Gequält von einem Traum wache ich auf. Blut im Wasser ist, was mir in Erinnerung bleibt. Ich schüttle meinen Kopf. Die Zukunft vorauszusehen, ist etwas, worauf ich nicht stolz bin. Entweder werde ich angesehen, als wenn man mich für verrückt hält, oder die Person, die diese Vorahnungen betreffen, fragt mich nach Dingen, die ich nicht sehen kann. Es ist nicht so, dass ich einem die Hand auflege und alles sehe, als wäre ich selbst dabei. Nein, meist verfolgen mich diese Visionen in meinen Träumen. Ich sehe die Person oder das, was passiert ist. So wie heute. Ich habe nur das Geschehen gesehen. Um welchen Menschen es sich handelt, weiß ich nicht.
Ich richte mich auf und reibe meine Stirn, sodass ich versuchen kann, das Pochen in meinem Kopf wegzumassieren. Nach ausgiebigem Wassertrinken, womit ich erhoffe, den Schmerz noch mehr zu lindern oder gar ganz zu beseitigen, und nachdem ich etwas Nahrung zu mir genommen habe, mache ich mich auf dem Weg in die Stadt.
Die Heidelberger sind heute gut aufgelegt, kaum eine schlechte Aura ist zu spüren. Bei jeder Person, die mir entgegenkommt, versuche ich, zu erkennen, ob es die Person aus meinem Traum ist. Viele grüßen mich mit: „Grüß Gott, Jetta.“ Andere wieder mit: „Einen schönen Tag, Jutta.“ Manche wenige sagen: „Gott zum Gruße, Vellatta.“ Ich nickte nur freundlich. Schon vor langer Zeit habe ich es aufgegeben, die Menschen zu belehren, dass ich Vetta heiße. Es kommt auf die Region an, wer mich wie nennt. Einige sagen sogar nur Wahrsagerin zu mir.
Obwohl ich bei diesem Begriff etwas zwiegespalten bin. Wahrheit ist ein zweischneidiges Schwert und vorhersagen kann ich ja nur die Bruchstücke, die ich im Traum gesehen habe. Ja, sie werden meist wahr, doch will sie nicht jeder hören. Immer dieser Rattenschwanz.
Auf dem Markt kaufe ich mir verschiedene Kräuter für mein Essen und Mixturen. Hier ist am meisten los, aber trotzdem bleibt mir die Person meiner Vision verborgen. Stundenlanges Schlendern durch die Straßen sorgt nur dafür, dass ich Hunger bekomme.
Vom Schloss auf dem Jutenhügel gehe ich Richtung Wald, als die Sonne beginnt, den Schatten vor mir zu werfen. Ich habe mir Pilze zu den Kräutern eingebildet und letztens eine Stelle entdeckt, wo sehr leckere zu finden sind. Sie befinden sich in der Nähe einer Quelle.
Gemächlich schlendere ich dorthin, genieße die letzten Sonnenstrahlen, die meinen Geist erwärmen. Der Wind weht leicht und hinterlässt auf meiner Haut dieses prickelnde Gefühl. All meine kleinen, feinen Härchen stellen sich auf. Als würde mein Körper mir sagen: „Gleich geschieht etwas!“ Mein Blick wandert über das satte Grün der Wiese zum Waldrand. Zu sehen ist hier aber niemand. So langsam glaube ich, dass ich einfach zu wenig Schlaf bekommen habe und nur einen Albtraum hatte. An den Bäumen vorbei gehe ich weiter in Richtung Quelle. Die Sonne strahlt von hinten und wirft meinen Schatten lang gestreckt vor mich. Leicht erhöht sich der Boden, bis er sich in einer Senke vertieft. Knurren ist zu hören. Ich kann jedoch nicht einordnen, aus welcher Richtung es kommt.
Die Quelle liegt im Dunkeln. Vielleicht kommt das Knurren von da? Oder doch zwischen dem Wäldchen her? Die Haare am Arm richten sich wieder auf. Gerade als ich die Wölfin mit den Jungtieren erkenne, ist sie schon auf dem Sprung und greift mich an. Nun wird mir klar, wessen Schicksal ich gesehen habe. Mein eigenes! Weglaufen oder gar kämpfen würde nichts bringen oder ändern. Ich werde heute das Zeitliche segnen.
Ihre Zähne bohren sich in meinem Hals. Ich schreie vor Schmerzen auf und knalle mit dem Rücken auf dem Boden. Warm sickert das Blut aus meinen Wunden, als sie immer wieder zuschnappt. Mein letzter Atemzug ist getan.
Plötzlich reiße ich meine Lider auf. „Wo ...“
„Sprecht nicht, Wahrsagerin“, höre ich die tiefe Stimme eines Mannes.
Ich blicke nach links und erkenne den alten Einsiedler, den ich schon öfter in den Wäldern gesehen habe. Er sitzt mit seinem vernarbten Gesicht auf dem Stuhl neben mir. Mein Finger zeigt auf meinen Hals. Ich möchte tot sein und nicht hier liegen.
„Die Wölfin dachte, ihr seid tot und ließ von euch ab. Ein Schuss und sie ist mit ihrem Wurf in das Wäldchen geflüchtet.“
„Danke“, krächze ich.
„Dankt mir nicht“, meint er. „Menschen aus Heidelberg haben euch gesehen und glauben, ihr seid gerissen worden.“
„So wie du“, geht mir durch den Kopf.
„Ich an eurer Stelle würde nicht nach Heidelberg zurückkehren.“
Langsam nicke ich. Als Hexe bezeichnet zu werden, weil man gerettet wurde, kann mehr Schwierigkeiten verursachen, als einfach weiterzuziehen.
Er wendet sich ab und zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Habe ich mich vielleicht getäuscht und habe die Vergangenheit gesehen? Oder ist es doch mein eigenes Schicksal gewesen und es hat vorherbestimmt, diesen Weg mit ihm zu gehen? Er lebt seit Jahren hier in den Wäldern, jetzt scheine auch ich das tun zu müssen. Möglich, dass dies unser Weg ist.
„Ihr solltet noch etwas ausruhen“, sagt er und steht auf.
Langsam lasse ich mich auf die Pritsche nieder. Während ich ihn beobachte und meinen Gedanken nachgehe, dämmere ich ein.
Die Zeit vergeht, mir geht es dank seiner Pflege immer besser. Ich bin keine Wahrseherin mehr. Keine Vision hat mich seither eingeholt. Wir sind ab nun Wanderer. Das Land ist groß und womöglich gibt es irgendwo ein neues Heim für uns.
Meine Geschichte wird weitergetragen und eine Sage entstehen – von der Wahrsagerin und dem Wolfsbrunnen.
Luna Day wurde 1982 in Wertingen geboren und wuchs in Augsburg auf, wo sie immer noch mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern lebt. Ihre Liebe zum Schreiben entdeckte sie durch Harry Potter und Roll-Play-Games. Sie tippt Kindergeschichten, aber auch Fantasy- und Liebesgeschichten.
*
Beatus und die Menschen am Thunersee
Eine Sage vom Thunersee
Schwer atmend stützen sich Beatus und sein Begleiter Justus auf ihre langen Pilgerstäbe. Für die Mühen des Aufstiegs auf den schwarzen Berg – so hieß der Brünigpass vor rund 2000 Jahren noch – werden sie mit einer grandiosen Aussicht belohnt. Wie ein silbernes Band zieht sich in der Tiefe der Wendelsee – von dem heute als vergleichsweise kleine Pfützen nur noch der Brienzer- und Thunersee übrig geblieben sind – durch das Tal.
„Ich bin gespannt, wo unsere Reise enden wird“, sagt Beatus. „Lange wird es wohl nicht mehr dauern, hat mich doch der Heilige Petrus persönlich beauftragt, den rauen Berglern das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden. Und wenn ich mich so umschaue, all die Berggipfel, weit kann es nicht mehr sein.“
Die Ahnungen des Beatus’ bestätigen sich. Am übernächsten Tag kommen sie am Thunersee im Dörfchen Sundlauenen an. Nicht nur in den rußgeschwärzten Hütten, sondern in den Herzen der Bewohnerinnen und Bewohner braucht es dringend mehr Licht. Das Licht Jesu Christi. Die beiden Pilger schaudert, welch Aberglaube die Sundlauener für bare Münze halten.
Druiden sind ihre Lehrer und die Opferstätten auf dem Hohlenstein am Kienberg und auf der felsigen Platte vor der Drachenhöhle lassen keine Zweifel aufkommen: Hier werden Menschenopfer dargebracht. Aber gerade mit diesem in der Grotte hausenden Drachen ist es so eine Sache. Selbst Menschenopfer vermögen den üblen Lindwurm weder zu besänftigen noch zu vertreiben.
Als Beatus vom Elend und der Not hört, denen die Sundlauener durch dieses Ungetüm ausgesetzt sind, verspricht er, Remedur zu schaffen. „Die Erde ist des Herrn, und alles, was darauf kreucht und fleucht“, sagt er, „im Morgengrauen werde ich im Namen des einzig wahren Gottes dieses Untier vertreiben.“
Betend verbringen Beatus und Justus die Nacht. Noch bevor die Sonne hinter den Bergen hervorblinzelt, schnüren sie die Schuhe, ziehen die Mäntel über, ergreifen ihre Pilgerstäbe und machen sich auf den Weg zur Höhle.
Ob der Drache spürt, dass sein letztes Stündlein schlagen könnte? Jedenfalls hören die beiden ihn schon von Ferne toben. Aus allen Ritzen der Höhle quillt Rauch und Dampf. Schon bald sind auch die großen, grünen Augen zu sehen. Beatus kreuzt die erhobenen Arme vor seinem Gesicht. Furchterregend faucht der Drache den Ankömmlingen entgegen. Aus dem aufgerissenen Schlund zischen Feuerzungen und es stinkt nach Schwefel.
Entschlossen tritt Beatus vor das Untier. „Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, weiche von hier“, beschwört er die Bestie.
Mit ohnmächtigem Wutgeheul rast der Drache aus der Höhle, springt in die Höhe und stürzt erbärmlich kreischend in den See. Dieser scheint zu kochen, so brodelt es. Das Untier windet sich, zuckt noch ein-, zwei- und noch einmal erbärmlich röhrend zusammen – und versinkt.
Frenetisch jubelnd nehmen Klein und Groß, Alt und Jung im Dorf den Befreier in Empfang. Sie greifen nach ihm, um ihn auf den Schultern durch das Dorf zu tragen.
„Aufhören“, gebietet Beatus dem Treiben Einhalt, „lasst diesen Unfug sein.“ Er steigt auf einen am Straßenrand stehenden Felsblock, ergreift das Wort und verkündet den versammelten Frauen, Männern und Kindern die frohe Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. Schweigend lauschen sie ihm zu. Als er geendet hat, rennen sie los, zerstören ihre Opferstätten und bitten Beatus, bei ihnen zu bleiben, um sie in ihrem neuen Glauben zu unterrichten. Das tut dieser gerne. Er beschließt, um niemandem zur Last zu fallen, bei der Höhle, in der das Untier gehaust hatte, eine Klause zu errichten.
Nicht nur die Menschen sind froh, diesen schrecklichen Lindwurm los zu sein. Nein, Zwerge wohnen in verborgenen Felsklüften oberhalb des Sees. In diese trieb der Drache einst die scheuen kleinen Wesen, als er ihre Höhle in Beschlag genommen hatte.
In der Regel meiden Zwerge den Kontakt mit den Menschen. Mit Beatus freunden sie sich aber an. Aus Dankbarkeit, sie vom Drachen befreit zu haben, stellten sie sich in seinen Dienst. So kann sich Beatus um seine hauptsächlichen Aufgaben kümmern – der Verkündigung des Evangeliums und dem Versorgen der Armen und Kranken.
Tagein, tagaus gibt es für die Zwerge zu tun. Eine Gruppe managt den Haushalt, hält die Klause sauber, besorgt Holz und Wasser und kocht. Andere richten einen Stall ein und treiben aus der Höhe Gämsen ins Tal. Deren Milch schmeckt köstlich, wie auch der daraus hergestellte Käse. Eine weitere Zwergenschar legt unterhalb der Höhle einen Garten an. Gemüse und Obst sprießen reichlich. Und Heilpflanzen: Arnika, Schafgarbe, Quendel, Spitzwegerich … Das Wenigste, was wächst und hergestellt wird, beansprucht Beatus für sich selbst. Aber er ist froh darum, gibt es doch viele Hilfsbedürftige und Leidende in der Gegend.
Bald haben durch das Wirken von Beatus und Justus rund um den See Menschen begonnen, an Christus zu glauben. Wie praktisch wäre da ein Boot, um ans andere Ufer zu gelangen. Die Gläubigen brauchen Lehre und Unterweisung.
Aus unerfindlichen Gründen gelingt es aber weder Beatus noch den Zwergen, ein Boot zu bauen. Sobald es zu Wasser gelassen wird, sinkt es. Ist es die Rache des Lindwurms, dass er durch Beatus aus der Höhle vertrieben worden? Als Gott die erfolglosen Bemühungen sieht, hat er Bedauern und vollbringt ein Wunder. Es ermöglicht Beatus, auf seinem Mantel sitzend über den See zu fahren.
Ausgerechnet einmal an Ostern versagt der Mantel seinen Dienst. Ja, richtig störrisch ist er, könnte man sagen. In keiner Weise lässt er sich lenken.
„Oh Gott im Himmel“, klagt Beatus, „ich sollte doch schon bald, um Gottesdienst zu halten, ennet dem See, in Einigen sein.“
Gott repariert aber nicht das Boot des Beatus, sondern gibt dessen Gewissen einen Schups. Jetzt dämmert es ihm. Er war ohne Pilgerstab losmarschiert. Der Weg zum See ist aber steil. Da entriss er gedankenlos als Behelfs-Wanderstab bei einem Haus am Gartenzaun eine Holzleiste. Wie konnte er nur. Er hat fremdes Eigentum entwendet und zerstört. Unverzüglich kehrt er um und repariert den Zaun. Und siehe da. Nach vollbrachter Tat versieht der Mantel – wie ein Schwan über den See gleitend – wieder seinen Dienst.
Die Sonne steht schon im Zenit. In Einigen ist die Kirche gerammelt voll und Beatus fehlt noch immer. „So was“, wird ringsum geraunt, „das sind wir von ihm gar nicht gewohnt.“
Da fasst sich Justus ein Herz, steigt auf die Kanzel und beginnt, zu predigen. Als Beatus endlich ankommt, setzt er sich still auf die hinterste Kirchenbank und lauscht den Worten des Justus’. Was er zu hören bekommt … Na ja, dass sich Justus keine Mühe gibt, kann man wirklich nicht sagen. Aber das Sprechen ist und bleibt seine Sache nicht. Dass den Gottesdienstbesuchern in der warmen Kirche dabei reihum die Augen zufallen … wer kann es ihnen verübeln …
Etwas anderes jagt Beatus aber den Schrecken in die Glieder. Unter der Kanzel sitzt leibhaftig der Teufel. Er hat ein Bocksfell aufgespannt und notiert hämisch grinsend die Namen derer auf, welche, statt auf Gottes Wort zu hören, sich ein Nickerchen gönnten.
„Hi, hi, hi“, kichert Satan leise, „das wird ein böses Erwachen geben, wenn ich beim Jüngsten Gericht vor dem Allmächtigen die Namen dieser Penner verlese. Während des Gottesdiensts schlafen … die können sich den Eintritt ins Paradies abschminken.“
Das weiß auch Beatus. Wenn die armen Seelen am Schluss der Predigt das Amen verschlafen, sind sie hoffnungslos verloren. Aber wie ist Abhilfe zu schaffen? Durch Rufen, Schreien, Poltern? Den Gottesdienst zu stören, ist noch die größere Sünde, als diesen zu verschlafen.
Während Beatus sorgenvoll um sich blickt, notiert und schreibt der Teufel Name und Name auf. Das Bocksfell ist schon vollgekritzelt und noch immer sind nicht alle Schläferinnen und Schläfer vermerkt.
„Ich brauche mehr Platz“, sagt der Teufel, beißt sich an einem Ende des Fells fest, klemmt das andere Ende zwischen seine Füße und zieht das Fell mit aller Kraft auseinander. Er zieht und zieht und übertreibt dabei. Das Fell reißt und – wumm – prallt der Kopf des Satans krachend an die Kanzel.
Laut dröhnt der Knall des Aufpralls durch die Kirche und weckte die Schläferinnen und Schläfer auf. Gerade rechtzeitig, kurz bevor Justus zum Ende der Predigt das Kreuz schlagen und mit einem kräftigen Amen den Gottesdienst beenden kann. Beschämt verlässt der Teufel mit einer großen Beule am Kopf die Kirche. Beatus lächelt leise vor sich hin. Glücklich darüber, gegen 500 Seelen vor der ewigen Verdammnis bewahrt zu haben.
Alt und lebenssatt stirbt Beatus im Alter von 100 Jahren in seiner Klause. Versorgt und gepflegt durch Justus und seine Freunde, die Zwerge. Als letzten Dienst bestatteten sie Beatus neben der Höhle. Justus zieht ins unbewohnte Justistal, um dort ein Leben zu führen, den Engeln nahe und ohne predigen zu müssen.
Hans Peter Flückiger, geboren 1952, aus Solothurn (Schweiz). Erst Heimleiter/Spitalverwaltungsfachmann. Später freischaffender Journalist. Erst literarische Texte 2016. Diverse Publikationen in Anthologien und für Blogs. www.geschichten-gegen-langeweile.com.
*
Die Hexeneiche bei Elkenroth
Eine Sage aus dem Westerwald
Einst gab es eine Zeit, als sogar die Häuser noch Namen hatten. Diese hatten meist einen Bezug zu den Bewohnern, sei es der Beruf oder die Herkunft. Manchmal auch ein bestimmtes Ereignis oder einfach nur eine Beschreibung.
Auch im Westerwald, im heutigen Elkenroth, gab es zu dieser Zeit ein Haus, das den wenig schönen Namen Fluchs trug. Dieser Name hatte – zum Leidwesen der Bewohnerin – durchaus einen Grund. Die alleinstehende Frau lebte zwar alleine in diesem Haus, musste es aber mit einem Dämon teilen. Genau gesagt war es eine Hexe, eine von der unangenehmen Sorte, um nicht zu sagen – eine bösartige.
Diese böse Hexe machte der armen Frau das Leben zur Hölle. Was die Frau auch versuchte, um die Hexe loszuwerden, nichts klappte, die Hexe verschwand nicht, sondern quälte die arme Frau immer mehr. So, als wolle sie sich dafür rächen, dass die Frau sie loswerden wollte. Sie gab Tag und Nacht die schlimmsten Geräusche von sich, warf Gegenstände umher und ließ die Nahrungsvorräte der Frau mehr als einmal verderben. Brachte die Frau frisches Obst aus dem eigenen Garten ins Haus, so konnte es passieren, dass eine Schüssel mit Äpfeln innerhalb einer Stunde verfaulte und schimmelig wurde. Ein Becher mit frischer Milch wurde häufig sauer, noch während die Frau ihn austrank.
Die Frau wusste sich nicht anders zu helfen, als am Rande ihres Gartens eine kleine Hütte zu bauen, um dort ihre Vorräte aufzubewahren. Das war zwar mühsam und umständlich, aber es war die einzige Möglichkeit, sich Vorräte zu verschaffen. Das Wirken der Hexe war nämlich zum Glück auf das Haus beschränkt.
Nun hatte die Frau nicht die Mittel, um einfach ein neues Haus zu erwerben. Gerne hätte sie ihr Haus verkauft und ein neues gekauft oder gebaut, aber natürlich wollte niemand ihr Haus haben. Wusste doch jeder um das schlimme Treiben darin. Auch war das Geschehen weit über die Ortsgrenze hinaus bekannt, sodass sie keine Chance hatte, es loszuwerden.
Längst hatte sie alle gängigen, damals bekannten Methoden der Hexen-Austreibung selbst versucht. Allerdings hatte absolut nichts geholfen, weder Gebete noch das Ausräuchern oder das Verbrennen von dafür geeigneten Kräutern. Selbst die bei einem Henker erworbenen Gegenmittel, gewonnen aus den Knochen der Hingerichteten, erwiesen sich als wirkungslos. Der einzige Effekt auf all das war eine gesteigerte Wut der Hexe, die in ihrem Zorn auf die Hausbesitzerin immer bösartiger wurde und der Frau das Leben zur Hölle macht.
In ihrer Verzweiflung wandte die Frau sich schließlich an das nahe Kloster und bat dort um Hilfe. Wer sollte jetzt noch einen Rat wissen, wenn nicht die frommen Männer, die doch wissen mussten, wie man das Böse besiegen konnte?
Nachdem sie endlich zu Abt vorgelassen worden war und ihr Problem schildern durfte, berieten sich die Priester mit dem Abt, was zu tun sei. Und ob man überhaupt etwas tun konnte. Zum Glück für die Frau gab es einen Pater, der Erfahrung mit bösen Wesen hatte und es sich zutraute, mit der Hexe fertig zu werden. Schon am nächsten Tag ging er mit der Frau zu ihrem Zuhause.
Während er die ihm bekannten Gebete und Beschwörungen sprach, besprengte er das Haus mit Weihwasser. Mehrmals sprach er die Gebete und Beschwörungsformeln, ehe sie endlich Wirkung zeigten.
Mit irrem, wütendem Gekreische fuhr die Hexe aus dem Haus und wollte sich auf den Pater stürzen, um ihn zu zerreißen. Da der Pater aber wusste, wie Hexen reagieren, hatte er sich natürlich entsprechend geschützt, was die Hexe noch wütender machte. Aber es half alles nicht, der Pater wusste, wie er die Hexe bannen konnte. So trieb er die tobende und kreischende Hexe vor sich her und dem nahen Walde zu.
Als die Hexe merkte, dass sie nichts ausrichten konnte, änderte sie ihre Taktik. Sie flehte der Pater an, sie doch gehen zu lassen. Sie wollte ihre Heimat nicht verlassen. Sie bettelte den Pater an, sie doch zurück ins Dorf zu lassen. Sie wolle sich auch eine andere Bleibe suchen und die Frau nicht mehr belästigen.
Umsonst, denn der Pater fiel nicht auf sie herein und gab ihr nicht nach. Er trieb die Hexe vor sich her, bis zu einer alten Eiche, damals ein heiliger Baum. Er bannte die Hexe in die Eiche, die sie niemals verlassen sollte.
Die Hexe schrie und tobte, dann jammerte und flehte sie, der Pater möge ihr doch wenigsten erlauben, sich jedes Jahr einen kleinen Schritt in Richtung Dorf zu bewegen. Dann könne sie irgendwann, wenn ohnehin alle Beteiligten schon lange verstorben seien, in ihr Haus zurückkehren. Sie erflehte dies als kleine Gnade vom Pater, doch dieser ließ sich nicht beirren und verbannte die Hexe auf ewig in die Eiche.
Seither kann man des Nachts das Jammern und Stöhnen der Hexe hören, wenn man aufmerksam hinhört.
Die Eiche steht heute noch im Wald bei Elkenroth und ist auch als solche gekennzeichnet. Über den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte ist nichts bekannt.
Margit Günster,Jahrgang 1963, ist Hauswirtschaftsmeisterin und in diesem Beruf seit über 30 Jahren tätig. Seit über 25 Jahren diverse Veröffentlichungen (Gedichte, Geschichten und Fotos) in Zeitungen, Zeitschriften, Fachzeitschriften und Kalendern. Lebt in Boden, einem kleinen Ort im Westerwald.
*
Mitterfelser Teufelsfelsen
Eine Sage aus Mitterfels
Es war zu der Zeit, als der Teufel noch ohne Verwandlung oder Verkleidung zugange sein konnte, wenn er wieder einmal Lust verspürte, den Menschen etwas anzutun oder sie vom rechten Weg abzubringen. Wenn dann irgendwann mal irgendwo irgendjemand meinte, ihn an einem seiner Merkmale erkannt zu haben, hieß es, der hätte den Leibhaftigen gesehen, weil ein jeder sich fürchtete, seinen wahren Namen auszusprechen.
Dem Teufel gefiel es natürlich, dass die Leute so großen Respekt vor ihm hatten. Doch andererseits konnte er es kaum ertragen, dass sie den einen ungleich höher achteten. Und so richtig wild wurde er, wenn sie dem Dreifaltigen gemeinschaftlich und arg feierlich auf offener Bühne die Ehre erwiesen.