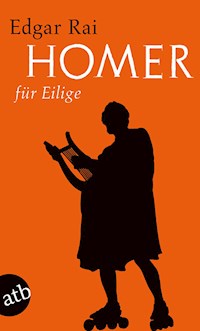6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Eine rasante Geschichte vor den Kulissen Berlins Eigentlich hat Frieda sich alles ganz einfach vorgestellt: Tasche packen, in den Zug steigen, nach Berlin fahren und ihren Vater suchen. Soweit der Plan. Doch wie soll man inmitten des Großstadtgetümmels einen Mann finden, von dem man nicht mehr weiß als seinen Künstlernamen? Doch Frieda beschließt, ihr Schicksal selbst zu bestimmen und schon beginnt ein aufregendes Großstadtabenteuer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Ähnliche
Edgar Rai
Salto rückwärts
Roman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Für Leoni, Moritz und Nelly
Oft liegt das Ziel nicht am Ende des Weges, sondern irgendwo an seinem Rand.
Ludwig Strauss (1892–1953)
DAVOR
1
Ich hab Mist gebaut. Dachte ich jedenfalls. Bis vorgestern. Aber dann ist das mit Jonas und Felix und Nelly passiert, und das mit Kai natürlich. Und seitdem steht mein Leben kopf. Ich hab noch überhaupt keinen Schimmer, wie das alles weitergehen soll, aber darauf kommt es vielleicht auch gar nicht an. Ich bin übrigens Frieda. Letzte Woche hatte ich Geburtstag, am 4. August, um genau zu sein. Bin vierzehn geworden. Ein total doofes Alter. Dachte ich. Irgendwie kein Kind mehr, aber vom Erwachsensein noch kilometerweit entfernt, noch keine richtige Frau, aber auf jeden Fall kein Mädchen mehr. Mit fünfzehn oder sechzehn, dachte ich, da bist du endlich wer. Aber auch da habe ich mich getäuscht. Jetzt weiß ich, dass man mit vierzehn auch schon wer sein kann.
An meinem Geburtstag jedenfalls hat alles angefangen. Mama war nicht da, ich meine Natascha – so heißt meine Mutter. Jedenfalls war sie mal wieder nicht da. Dabei hatte sie mir hoch und heilig versprochen, dass wir uns einen schönen Tag machen würden, nur sie und ich – wo die anderen vier As alle schon im Urlaub waren. Die anderen vier As, das sind Lara, Anna, Sophia und Mira, die eigentlich Palmira heißt und sich in einen Alien verwandelt, wenn du sie mit ihrem vollständigen Namen ansprichst. Zusammen sind wir die fünf As, weil alle unsere Namen mit A aufhören. Und alle außer mir waren im Urlaub. Eine Geburtstagsfeier fiel also schon mal flach. Ich hätte mit Henni und Josi feiern können und normalerweise hätte ich die auch eingeladen, aber ohne die vier As wäre das gewesen wie Burger mit Pommes – ohne Burger. Nicht, dass Pommes nicht schmecken würden, aber ohne Burger fehlt eben das Beste. Dann lieber mit Mama einen schönen Tag machen, shoppen, Schwimmbad, Eis, Kino …
Zwei Tage vor meinem Geburtstag kam Mama dann mit einer DVD nach Hause, als Geschenk verpackt. Casino Royal, mein Lieblingsfilm. Sie wollte essen gehen, »Wohin du willst, Süße«, und danach mit mir zusammen den Film ansehen. Wir gingen ins Mexicali. Da kriege ich Mama sonst nur rein, wenn ich ihr eine Eins in Latein vorlege oder so, mit anderen Worten: nie. Sie hasst Burger, egal ob mit oder ohne Pommes, und als sie sagte, es schmecke ihr heute richtig gut, hatte ich bereits einen ersten Verdacht. Zu Hause lagen dann plötzlich zwei Pakete auf dem Couchtisch, in Seidenpapier mit Schleifchen drum. Die Puma-Sneakers, von denen ich ihr vorgeschwärmt hatte, und die Bogner-Tasche, die ich so gerne als Reittasche haben wollte. Und da wusste ich, dass etwas faul sein musste.
»Sagst du es mir freiwillig oder muss ich bohren?«, fragte ich.
»Was meinst du denn?«
»Ich meine, warum mein Geburtstag plötzlich zwei Tage früher stattfindet.«
»Ach Frieda«, sagte sie und dann fiel sie in sich zusammen.
Eigentlich ist Mama ganz in Ordnung. Ein bisschen hysterisch, aber sie gibt sich Mühe und nervt nicht so wie Tante Katharina, zu der ich gleich noch komme. Diese »Ach Frieda«-Nummer allerdings kann ich echt nicht mehr hören. Das macht Mama immer, wenn sie ein schlechtes Gewissen hat. Dann schrumpelt sie zusammen wie ein Ballon und landet vor dir auf dem Fußboden. Das Dumme daran ist: Sie macht das ziemlich gut und zum Schluss tut sie mir meistens mehr leid, als ich sauer auf sie sein kann. Es sei denn, es passiert zwei Tage vor meinem vierzehnten Geburtstag und ohne meine vier As.
»Lass mich raten …« Vor Wut warf ich die neuen Sneakers auf den Boden. Goodbye, unser Kater, jaulte auf, sprang vom Sofa und verkroch sich unter dem Couchtisch. »Die Kollektion ist verschwunden, der Laufsteg ist explodiert, die Models sind verhungert …«
»Ach Frieda …«
»Und hör auf mit deinem blöden ›Ach Frieda‹!«
Ich rannte die Treppe rauf und schlug die Zimmertür hinter mir zu. Ich hasse es, wenn ich weinen muss. Dann fühle ich mich jedes Mal wie ein doofes, kleines Kind. Und Mama sollte es auf gar keinen Fall sehen.
Mama wartete eine Weile, bevor sie an die Tür klopfte. Ich lag auf dem Bett.
»Bin nicht da!«, rief ich.
Kurz darauf klopfte sie wieder.
»Bin immer noch nicht da!«
Natürlich machte sie trotzdem auf.
»Mann Mama, du weißt genau, dass du nicht in mein Zimmer gehen sollst, wenn ich nicht da bin.«
»Entschuldige bitte, aber ich dachte, ich kann mal eine Ausnahme machen. Schließlich bist du nicht da und wirst es nie erfahren.«
»Sehr witzig.«
Danach hatte sie mich schon fast wieder auf ihrer Seite, aber so einfach wollte ich es ihr nicht machen. Also drehte ich mich zur Wand, sagte gar nichts und wartete auf die Erklärung, die gleich kommen würde.
»Miriam hat angerufen«, fing Mama an, »das Fitting war eine Katastrophe. Ich hatte alles akribisch vorbereitet, aber drei der Models sind kurzfristig ausgefallen und jetzt muss alles neu angepasst werden. Frieda, Schatz, glaub mir, das war wirklich nicht vorherzusehen.«
Ich drehte mich zu ihr um. »Es ist nie vorherzusehen, Mama. Und trotzdem passiert es immer wieder.«
Mama ließ den Kopf sinken und verkniff sich ein weiteres »Ach Frieda!«. Jetzt tat sie mir doch leid. Sie hatte nun mal viel zu tun, und wenn sie bei den Messen nicht dabei war, drohte der Auftritt ihres Labels jedes Mal im Chaos zu versinken. Trotzdem war übermorgen mein vierzehnter Geburtstag.
»Ich hab gestern mit Katharina gesprochen«, sagte Mama. »Sie freut sich, wenn du kommst.«
»Kotz, würg.«
Womit wir bei Tante Katharina wären. Sie ist Mamas Schwester. Wenn Mama unterwegs ist, muss ich normalerweise zu ihr. Sie hat ein extra Zimmer für mich, das sie Gästezimmer nennt, auch wenn ich bei ihr noch nie Gäste gesehen habe und alles, was im Schrank hängt, von mir ist. Tante Katharina gibt sich Mühe, genau wie Mama, nur dass es bei ihr einfach nicht funktioniert.
Ich glaube, es liegt daran, dass sie keine eigenen Kinder hat. Sie wollte nie welche, sagt sie. Glaube ich aber nicht. Jedenfalls behandelt sie mich immer noch wie eine Sechsjährige, und wenn Mama länger als drei Tage weg ist, kriegen wir uns unter Garantie in die Haare. Letztes Jahr, als ich zum ersten Mal meine Tage bekommen habe, war ich ausgerechnet bei ihr. Ob sie mir vielleicht eine von ihren Slipeinlagen geben könne, habe ich gefragt, darauf lief sie durch die Wohnung, als käme gleich der Papst zu Besuch. »Das Mädchen bekommt seine Tage«, rief sie und griff sich das Telefon. »Ich muss sofort deine Mutter anrufen.«
Wenn ich ins Bett gehe, fragt sie mich immer noch, ob ich mir auch wirklich die Zähne geputzt habe, und bis ich meine Tage bekam, wollte sie mir Gutenachtgeschichten vorlesen. Am meisten aber nervt mich, wenn sie mir Essen auf den Teller schaufelt, obwohl ich längst satt bin. »Du brauchst was auf die Rippen«, sagt sie. Dabei bin ich überhaupt nicht dünn. Das letzte Mal, als ich bei ihr war, habe ich ihr das auch gesagt: »Ich bin nicht zu dünn. Ich bin einfach nur nicht so dick wie du.« Danach schmollte sie tagelang wie ein Baby.
Aber Moment mal! Was hatte Mama da eben gesagt? Ich setzte mich auf die Bettkante. »Du hast vorhin erfahren, dass du nach Mailand musst …«
»Nach Paris, Süße.«
»Mir doch egal! Von mir aus nach Sibirien. Jedenfalls hast du vorhin erfahren, dass du wegmusst, und hast gestern schon mit Katharina telefoniert?«
Mama ist die schlechteste Lügnerin, die man sich vorstellen kann. »Ich …«, stammelte sie.
»Du hast mich belogen!« Jetzt war ich erst richtig sauer. »Du hast längst gewusst, dass du an meinem Geburtstag nicht da sein würdest! Igitt, Mama! Das ist so …« – ich suchte nach dem passenden Wort, fand aber keins – »… brruuaargh von dir!«
Mama sah aus, als würde sie sich gleich in weißen Schleim verwandeln und die Treppe ins Wohnzimmer runterglibbern.
»Ach Fr…«
»Und hör endlich auf mit deinem blöden ›Ach Frieda‹!«
Ich schickte sie aus dem Zimmer und drehte mich wieder zur Wand. Vor Wut trat ich gegen den Bettpfosten und verstauchte mir den großen Zeh. Darüber wurde ich so wütend, dass ich nicht mal mehr weinen konnte, was wiederum ganz gut war. So lag ich, bis es dunkel wurde.
Ich war schon halb eingeschlafen, als ich Mama ins Zimmer kommen hörte. »Wie gut, dass Frieda nicht da ist«, flüsterte sie.
Dann setzte sie sich auf mich drauf und tat so, als bemerke sie mich gar nicht, und ich rief »Du tust mir weh«, und sie sagte »Nanu, du bist ja doch da«, und dann kitzelte sie mich durch, bis ich keine Luft mehr bekam, und entschuldigte sich und sagte, dass ich recht hätte und es wirklich total doof von ihr gewesen wäre, mich zu belügen, aber sie hätte doch so gerne meinen Geburtstag mit mir gefeiert und sei einfach zu feige gewesen und, wie auch immer, sie hoffe, sie hätte etwas daraus gelernt, und wie wär’s, wenn ich als Geste der Versöhnung einen Wunsch frei hätte, irgendeinen, und da sagte ich: »Alleine zu Hause bleiben.«
»Du willst nicht zu Katharina?«
»Du hast gesagt, ich hab einen Wunsch frei.«
»Aber Katharina freut sich, wenn du …«
»Ich weiß, Mama, aber ich nicht.«
Sie überlegte kurz, bevor sie ihren letzten Versuch unternahm: »Aber du bist doch erst …«
»Vierzehn!«, rief ich dazwischen. »Ab übermorgen bin ich vierzehn und damit beschränkt geschäftsfähig – was immer das heißt.«
Sie nahm eine Haarsträhne und wickelte sie um ihren Finger.
»Steh mal auf«, sagte sie und dann stellten wir uns einander gegenüber. Sie strich mir über die Schultern. »Jetzt geh ich dir schon nur noch bis zur Nase.«
Ich sagte nichts und dann sah ich, dass sie beinahe angefangen hätte zu weinen.
Sie räusperte sich: »Was willst du denn machen – so alleine die ganze Zeit?«
»Fernsehen und Süßigkeiten essen.«
»Aber du sollst doch nicht immer …«
Typisch Mama: Ironiefaktor null. »War’n Scherz, Mama. Mir wird schon was einfallen.«
»Aber sind deine Freundinnen nicht alle im Urlaub?«
Noch mal typisch Mama: mir Dinge erzählen, die ich schon weiß. »Danke, dass du mich daran erinnert hast.«
»Okay«, seufzte sie. »Aber nur unter der Bedingung, dass Katharina einmal am Tag vorbeikommt und nachsieht, ob alles in Ordnung ist.«
»Okay, aber nur unter der Bedingung, dass sie nicht versucht, mich zu mästen.«
Mama fasste mich wieder an den Schultern. »Wie erwachsen du schon bist. Und wie einsichtig.« Sie versuchte, mich auf die Stirn zu küssen, kam aber nur bis zur Nase. »Was für eine tolle Tochter ich habe.« Jetzt musste sie sich doch eine Träne aus dem Augenwinkel wischen. »Wenn ich wieder da bin, gehen wir als Erstes ins Kino und dann fliegen wir in den Urlaub, wohin du willst, eine Woche, mindestens.«
2
Am Tag vor meinen Geburtstag hatte ich mich noch gefreut. Ich konnte machen, wozu ich Lust hatte, egal was. Ich konnte ins Kino gehen und Chips essen, bis mir schlecht wurde. Ich konnte bis um elf schlafen, mir Toast machen, im Bett frühstücken und alles vollkrümeln, die Kelly-Clarkson-CD einlegen, voll aufdrehen und auf dem Balkon tanzen. Dann kam mein Geburtstag und ich blieb bis mittags im Bett liegen, ohne mir Frühstück zu machen. Schon bei dem Gedanken daran, dass niemand außer mir in der Wohnung war, fühlte ich mich wie bei Omas Beerdigung. Ich drehte mich von links nach rechts und von rechts nach links, scheuchte Goodbye aus dem Zimmer und stand erst auf, als um halb eins das Telefon klingelte.
Es war Mama und eigentlich rief sie nur an, um mir zu sagen, dass sie total im Stress sei und später noch mal anrufen würde. Irgendwann riefen dann noch Lara aus Südafrika, Sophia von Sardinien und Mira von irgendeiner Südseeinsel an. Ich freute mich jedes Mal, dass eine der anderen As an meinen Geburtstag gedacht hatte, und war danach immer noch ein bisschen trauriger, alleine in München zu sitzen. Um halb vier war es wieder Mama: Sie hatte immer noch tausend Sachen gleichzeitig zu tun und würde es später noch mal probieren. Dann klingelte es an der Tür und Tante Katharina kam mit einer selbst gebackenen Schwarzwälder Kirschtorte, und das war am traurigsten von allem. Was konnte schlimmer sein, als sich ausgerechnet an seinem vierzehnten Geburtstag mit einer Tante, die man nicht mochte, über eine Torte hinweg anzuschweigen?
»Für mich nur ein ganz kleines Stück«, sagte Tante Katharina und schob geziert den Tortenheber unter ein Stück, das für mich ganz normal groß aussah. Wenig später war sie bei ihrem dritten ganz kleinen Stück angelangt, während ich mein erstes noch immer kaum angerührt hatte. »Schmeckt’s dir nicht?«, fragte sie mit einem Sahnebart auf der Oberlippe.
»Doch«, sagte ich.
Als sie endlich, endlich, endlich gegangen war, ließ ich mich auf das Sofa fallen, drehte mich auf den Rücken, auf die Seite und auf den Bauch, legte die Füße mit den neuen Sneakers erst auf dem Tisch ab, anschließend auf dem Sofa und dann, den Kopf nach unten, auf der Rücklehne. Ich legte mir eins der großen Kissen auf den Kopf, anschließend bedeckte ich meinen ganzen Körper mit ihnen. Schließlich zog ich die Sitzpolster heraus, legte mich auf das Gestell und türmte so viele Polster und Kissen über mir auf, bis alles wieder einstürzte. Zum Schluss arrangierte ich alles auf dem Boden zu einer Sitzburg, legte die neue DVD ein, ließ mich rücklings in mein Lager fallen und schaltete den Fernseher ein.
Ich sah mir den ganzen Film an, inklusive Trailer und Bonusmaterial. Die Szene im Casino, nachdem Bond sein ganzes Geld verloren hat und mit Vespa auf dem Balkon steht, zweimal. Und die im Zug, als er und Vespa sich gegenübersitzen, sogar dreimal. Als es nichts mehr gab, das ich nicht schon mindestens einmal gesehen hatte, merkte ich, dass ich schon seit Stunden Hunger hatte. Goodbye saß zu meinen Füßen und starrte mich aus seinen blauen Augen an, als wolle er sagen: »Glaubst du etwa, ich habe keinen Hunger?«
Wenn man es genau nimmt, ist Goodbye übrigens gar nicht unser Kater, sondern Sörens. Und eigentlich heißt er auch nicht Goodbye, sondern Manfred. Sören ist Mamas letzter Freund. Gewesen. Und Goodbye, also Manfred, ist alles, was von ihm noch übrig ist, seine Hinterlassenschaft, wie Mama es nennt. Ich bin ganz froh, dass Goodbye geblieben ist. Genauso froh wie darüber, dass Sören nicht geblieben ist. Sein Kater war mir von Anfang an sympathischer.
Als Mama Sören zum ersten Mal mit nach Hause brachte, war er noch ganz höflich. Gut, er hatte einen Schnauzbart und sah auch sonst aus wie aus einem alten Western, aber Mama hatte so ein hoffnungsvolles Leuchten in den Augen und da dachte ich, na schön, ich muss den Schnauzbart ja nicht küssen. Beim zweiten Mal fläzte Sören sich auf unser Sofa, als wäre es seine Wohnung, und begrüßte mich mit »Na, Schätzchen«. Beim dritten Mal brachte er seinen Kater mit und Mama flog in seine Arme und rief: »Mucki, mein Mucki!« Und damit meinte sie Sören, nicht seinen Kater. Danach bin ich immer nach oben in mein Zimmer geflüchtet, sobald er durch die Tür kam.
Der Spuk dauerte ungefähr drei Monate, dann fand Mama heraus, dass ihr Mucki verheiratet war und seine Frau keine Ahnung hatte, was ihr Mann sonst noch so trieb. Als Mama ihn fragte, was er sich dabei gedacht habe, fing Sören an, sich zu winden wie die Klematis auf der Dachterrasse. Seine Ehe sei zerrüttet, er habe es seiner Frau schon lange sagen wollen, aber sie sei so wahnsinnig schwierig, sehr labil, streng genommen reif für die Psychiatrie, bla bla bla … Mama meinte hinterher, seine Nase sei länger und länger geworden. Jedenfalls hat sie ihm gesagt, er könne sich melden, sobald er seiner Frau »reinen Wein« eingeschenkt hätte – auf keinen Fall vorher! –, und ihn aus der Tür geschoben.
Ich kam aus meinem Zimmer und stand noch oben auf der Galerie, da sah sie zu mir auf und sagte: »Ich schätze, das war’s, Frieda.«
Danach war ihre Kraft plötzlich verpufft und sie sank auf das Sofa, die Hände zwischen die Oberschenkel geklemmt.
»Vielleicht kommt er ja wieder«, meinte ich und hoffte das Gegenteil.
»Sollte mich wundern. Hab ihm letzte Woche tausend Euro geliehen.«
Ich ging zum Kühlschrank und mixte ihr einen Campari Orange mit etwas mehr Campari, als sie sonst nahm. Sie sagt immer, Campari Orange erinnert sie an Italien.
»Sören war nicht der Richtige«, versuchte ich sie zu trösten und ließ mich neben ihr auf das Sofa fallen.
Mama nahm einen großen Schluck. »Weiß ich doch.«
»Und warum weinst du dann?«
»Weil er nicht der Richtige war.«
Ich nahm sie in den Arm. Das geht ganz gut, seit ich größer bin als sie. Mama sagt, das hätte ich den Genen meines Erzeugers zu verdanken. Der Kater sprang auf das Sofa und rollte sich in ihrem Schoß zusammen, als wollte er sich für das Betragen seines Herrchens entschuldigen.
»Und was ist mit Manfred?«, fragte ich.
Sie strich ihm über den Kopf: »Den behalten wir natürlich – wo ich schon tausend Euro für ihn bezahlt habe. Wir können ihn ja ›Auf Nimmerwiedersehen‹ nennen.«
»Ja, oder ›Goodbye‹.«
Seitdem haben wir einen Kater mit Namen Goodbye. Goodbye saß also vor mir und schien zu sagen: »Komm ja nicht auf die Idee, dir etwas zu essen zu holen, ohne mir etwas zu geben!« Deshalb ging ich in die Küche, nahm zwei Teller aus dem Schrank und schnitt für Goodbye und mich jeweils ein extragroßes Stück aus der Schwarzwälder Kirschtorte.
»Hier.« Ich stellte seinen Teller neben meine Sitzburg auf das Parkett. »Sollst ja nicht leben wie ein Hund.«
Mama wäre ausgerastet, wenn sie das gesehen hätte. Den Teller im Schoß, sah ich mir den Film noch mal von vorne an. Jetzt, wo Tante Katharina nicht mehr da war, schmeckte die Torte richtig gut. Wenn sie eins kann, dann Kuchen backen. Muss man ihr lassen. Aber nicht einmal die Torte konnte darüber hinwegtäuschen, dass heute mein vierzehnter Geburtstag war und ich nichts Besseres zu tun hatte, als alleine mit einem Siamkater namens Goodbye vor dem Fernseher zu sitzen.
Es war Viertel vor zehn, als Mama zum dritten Mal anrief. Ich drückte die Pausentaste. James Bond und Vespa saßen sich gerade im Zug gegenüber. Das war die Szene, die ich mir vorhin schon dreimal angesehen hatte. Ich erwischte Vespa exakt in dem Moment, in dem sie sich in Bond verliebt, nämlich als er ihr sagt, dass sie ein Heimkind ist. Vespa versucht noch, die Fassade zu wahren, und lächelt überlegen, aber eigentlich ist sie schon verloren. Sie reden die ganze Zeit übers Pokerspielen, dabei ist ihre Unterhaltung auch nichts anderes: Der eine versucht, den anderen auszuspielen. Und gleich, wenn Mama und ich fertig telefoniert hätten, würde Vespa Bond auf den Kopf zu sagen, dass auch er eine Waise war.
»Hallo Mama«, sagte ich.
»Frieda, mein Schatz, wie geht’s dir?«
Sie klang so, wie sie klingt, wenn sie einen echten Horrortag hinter sich hat. Und der war noch lange nicht vorbei. Meiner übrigens auch nicht, aber das wusste ich da noch nicht.
»Gut«, versuchte ich zu lügen, aber sie merkte sofort, dass ich in Wirklichkeit traurig war.
»Ach Frieda, es tut mir soooo leid«, sagte sie. »Ich verspreche dir hoch und heilig: Das nächste Mal krieg ich es irgendwie hin.«
Das nächste Mal wird es nicht mehr dasselbe sein, dachte ich. Irgendwie ist nie was wie beim letzten Mal. Vespa sah immer noch James Bond in die Augen – vielleicht der glücklichste Moment ihres Lebens. Wenn ich die Pause gedrückt ließ, würde sie bis in alle Ewigkeit den schönsten Moment ihres Lebens erleben, schöner als in jedem Märchen. Aber die Wirklichkeit ist anders. Und am Schluss stirbt Vespa.
»Du sagst ja gar nichts«, sagte Mama.
»Mama?«
Ich bin sicher, sie wusste, was ich sie gleich fragen würde. Trotzdem tat sie ahnungslos.
»Was denn?«, fragte sie.
»Erzähl mir, wie das mit meinem Vater war.«
»Ach Frieda …« Sie seufzte. »Das hab ich dir doch schon so oft erzählt.«
»Dann erzähl es mir eben noch mal.«
Es folgte eine ziemlich lange Pause. Bestimmt überlegte sie, ob sie nicht noch irgendwie da rauskommen könnte. Aber sie wusste, dass ich mich nicht abwimmeln lassen würde. Nicht an meinem Geburtstag.
»Oh Schatz, hier ist noch soo viel zu tun …«
Ich sagte nichts.
»Also schön«, sagte sie schließlich. »Was willst du wissen?«
Ich blickte zum Fernseher und schaute Daniel Craig über die Schulter.
»Wie sah er aus?«, fragte ich.
»Oh, er sah gut aus, sehr gut. Groß …«
»Wie groß?«
»Hm, weiß nicht, also eins neunzig bestimmt. Und er hatte diese schwarzen Augen und dieses … geheimnisvolle Etwas …«
Und dann erzählte mir Mama zum x-ten Mal, wie sie und Suse, eine Kommilitonin von damals, zufällig in diesen kleinen Club geraten waren, wo gerade die Speed Queens aus Berlin ihre Instrumente aufbauten. Der Club war nur zu einem Drittel gefüllt, Mama und Suse standen etwas verloren in der Gegend herum. Ein schlaksiger Typ, den Suse unwiderstehlich fand, quatschte sie an und verschwand ebenso plötzlich, wie er aufgetaucht war. Kurz darauf zwinkerte er ihnen von der Bühne aus zu und setzte sich hinter das Schlagzeug. Carlos, der in dieser Nacht mein künftiger Vater werden sollte, war der Gitarrist.
Mama war von der ersten Sekunde an hypnotisiert und starrte Carlos das ganze Konzert über an, als könne er mit seiner Gitarre Wasser in Wein verwandeln. Von der Musik bekam sie kaum etwas mit. Nach dem Konzert, Suse und sie wollten gerade aufbrechen, kam der Schlagzeuger und lud sie in den Bandraum ein. Und als Mama reinkam, saß Carlos da (wahrscheinlich saßen da auch noch andere, aber Mama sah nur Carlos), in einem speckigen Ledersessel mit aufgeplatzten Armlehnen, die Gitarre auf den Knien, und lächelte sie an. Hätte er sie an diesem Abend gefragt, ob sie mit ihm kommen und den Rest ihrers Lebens in der Sahara zubringen wollte, hätte sie ohne Zögern mit Ja geantwortet. Glücklicherweise fragte er sie nur, ob sie mit ins Hotel kommen wolle.
Mama schlich sich aus dem Hotel, bevor es hell wurde. Carlos schlief noch. Es war ihr wahnsinnig peinlich, dass sie ihm wie ein Groupie ins Hotel gefolgt war, und sie wollte auf keinen Fall im Frühstücksraum sitzen und von den übrigen Bandmitgliedern beschmunzelt werden.
»Und danach hast du nie wieder etwas von ihm gehört«, brachte ich die Geschichte zu Ende.
»Und er nicht von mir«, antwortete Mama. »Ich glaube, er hieß Simon mit Nachnamen. Als ich mal in Berlin war, habe ich ihn im Telefonbuch gesucht, aber nichts gefunden.«
»Das war alles – du hast im Telefonbuch geschaut? Keine Nachforschungen, keine Anfragen, kein Privatdetektiv?«
»Ehrlich gesagt: Ich war ganz froh, dass kein Carlos Simon drinstand. Ich glaube nicht, dass ich den Mut gehabt hätte, ihn anzurufen. Und auf diese Weise habe ich ihn eben einfach nie gefunden.«
»Aber wolltest du ihn denn nicht finden?«, fragte ich. »Ich meine: Hast du nie gedacht, dass ihr … keine Ahnung, dass ihr füreinander bestimmt seid oder so? Oder dass deine Tochter ihren Vater brauchen könnte?«
»Bis du ungefähr drei warst, da hab ich manchmal solche Gedanken gehabt«, gab Mama zu, »aber danach eigentlich nicht mehr.« Sie machte eine Pause und ich konnte das hektische Treiben im Hintergrund hören, das immer herrscht, wenn eine große Show ansteht. »Sieh es doch mal so: Wenn uns das Schicksal einander zugedacht hätte, dann wären wir auch zusammengekommen. Und da das nicht passiert ist, hat mir das Schicksal offenbar zugedacht, dich alleine großzuziehen.«
Wir sprachen noch kurz miteinander, dann legten wir auf. Ich war verärgert. Sonst war Mama nie so – schicksalsergeben. Ich fand das doof. Wenn man nicht versuchte, sein Schicksal selbst zu bestimmen, konnte man auch nicht erwarten, dass es machte, was man von ihm wollte. Ich blickte zum Fernseher. Da waren sie immer noch: zwei Waisenkinder, die ihre Seelenverwandtschaft erkennen. Und Vespa war noch immer gefangen im schönsten Moment ihres Lebens, so romantisch, dass es kaum auszuhalten war. Ich drückte die Play-Taste. Vespa sagte zu Bond: »… und da Ihre Einschätzung meiner Person auf Heimkind hinauslief, vermute ich, Sie sind selbst eins.« Und Bond wusste, dass sein Bluff aufgeflogen war.
Ich griff nach der Fernbedienung und schaltete den Fernseher aus. Goodbye hatte sich auf einem Kissen zusammengerollt und schlief. Sein Teller sah aus, als käme er frisch aus der Spülmaschine. Ich bin keine Waise, dachte ich, nicht mal eine Halbwaise, auch wenn in meiner Geburtsurkunde steht ›Vater unbekannt‹. Ich wusste nur einfach nicht, wer mein Vater war, und er wusste nicht, wer ich war. Woher auch? Schließlich hatte er nie erfahren, dass es mich überhaupt gab.
Als Nächstes stand ich auf und machte drei Dinge:
1. Ich nahm meine neue Tasche, ging nach oben, öffnete meinen Kleiderschrank und stopfte wahllos ein paar Anziehsachen hinein.
2. Ich nahm meine letzten 20 Euro, die 50, die ich von Katharina bekommen hatte, und die 200, die Mama für den Notfall dagelassen hatte, und steckte alles in mein Portemonnaie.
3. Ich stellte Katharinas Torte, vielmehr das, was davon übrig war, auf den Boden, füllte Goodbyes Wasserschale auf und schüttete einen halben Sack Katzenstreu in sein Klo. Das würde notfalls für eine ganze Woche reichen. Außerdem war in drei Tagen Montag, dann kam Frau Schenk und machte die Wohnung sauber. Bis dahin konnte Goodbye ein ungezügeltes Junggesellenleben führen.
»Good bye, Goodbye«, sagte ich und strich ihm über den Rücken.
Sein Nackenfell zuckte kurz, aber seine Augen blieben geschlossen. Ich nahm mein Handy und den Schlüssel, schaltete das Licht aus und ging. Denn wenn man nicht versuchte, sein Schicksal selbst zu bestimmen, dachte ich, konnte man auch nicht erwarten, dass es einem entgegenkam.