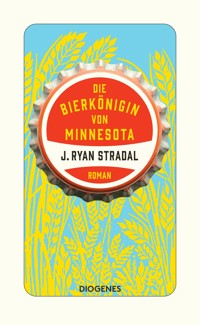21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für Betty war er die Rettung aus existenzieller Not. Für Florence eine Bürde und der Ort ihrer schlimmsten Niederlage. Für Mariel ist er ein Traum, in dem sie sich selbst verwirklicht. Für Julia ist er eine bloße Legende, die nichts mehr mit ihr zu tun hat: Im ›Lakeside Supper Club‹ am Bear Jaw Lake in Minnesota trotzen vier Frauen dem Leben auf ganz unterschiedliche Weise ihr Quäntchen Glück ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
J. Ryan Stradal
Samstagabend im Lakeside Supper Club
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Kathrin Bielfeldt
Diogenes
Für Auden,
wenn er möchte
EINS
Mariel, 1996
Mariel Prager glaubte an den Himmel, denn sie war bereits einmal dort gewesen. Sie erzählte gern, dass er eine schreckliche Ähnlichkeit mit Minnesota hätte. Der zweitbeste Ort, nach dem Himmel, war ihrer Erfahrung nach eine bestimmtes Sorte Restaurant, die man im oberen Mittleren Westen fand, Supper Club genannt. Wann immer sie einen guten betrat, fühlte sie sich gleichzeitig willkommen und ein bisschen wie irgendwo außerhalb der Zeit. Die Einrichtung wäre altmodisch, die Drinks stark, das Essen würde geliebte Erinnerungen wachrufen, und all das zu einem anständigen Preis.
Seit ihrer Kindheit hatte Mariel unzählige Tage in Floyd und Betty’sLakeside Supper Club am malerischen Bear Jaw Lake in Minnesota verbracht. Das Gebäude war nicht sonderlich malerisch, lediglich ein zweistöckiges braunes Holzhaus mit leuchtend roter Eingangstür und hohen Fenstern zum See hinaus. Auf dem Schild draußen stand SEIT1919GUTES ESSEN ZU GUTEN PREISEN, und weil jeder Neon vertraute, lag die Pflicht, dieses Versprechen einzuhalten, bei der Eigentümerin, die seit zwei Wochen Mariel hieß. Wenn es nach ihr ging, dann begann eine anständige Mahlzeit in einem Supper Club mit einer kostenlosen Portion Gewürzhäppchen und einem Korb Brot, gefolgt von einer Runde Brandy Old Fashioned, dann eine üppige, herzhafte Mahlzeit, mit Fisch am Freitag, Prime-Rib am Samstag und als Nachtisch einen minzig-schokoladigen Grashopper-Pie.
Vor seinem Tod hatte Mariels Großvater Floyd ihr gesagt, sie wäre nun so weit, die alleinige Eigentümerin zu werden, doch an diesem Morgen wünschte sie, dass jemand anderes – irgendjemand anderes – stattdessen zuständig wäre. Nachdem sie die Tür ihres Hauses verschlossen hatte, wollte Mariel sich in den See werfen und davontreiben.
Eine lange Zeit hatte sie sich um die Bar des Lakeside gekümmert. Das war der Job, den sie beibehalten hatte, seit sie die neue Eigentümerin war, denn es war die beliebteste Kneipe im Norden. Es war laut und verqualmt, ihre Hände waren nie trocken, sie setzte sich nie hin, und sie liebte es. Jedes Sommerwochenende waren der hufeisenförmige Tresen und der holzgetäfelte Speisesaal brechend voll mit Menschen, die frisch vom Angeln und vom Softballspielen oder in Autos aus den Twin Cities hochgefahren kamen. Es war der Ort, den die Menschen wählten, um die bedeutungsvollsten Abende ihres Lebens zu feiern, und es war ein Vergnügen, im Mittelpunkt von allem zu stehen.
Doch nach dem, was am Vorabend passiert war, hatte sie zu nichts davon Lust, doch das spielte keine Rolle. Wenn sie nicht zur Öffnungszeit um 17:00 Uhr hinter der Bar stand, würden die Leute reden.
Mariels ruhiger, friedlicher Weg zur Arbeit war immer ihr liebster Moment des Tages gewesen. Von Tür zu Tür dauerte es genau vierundfünfzig Sekunden, um in normalem Tempo ihre Einfahrt hochzugehen, die Landstraße sowie den Schotter-Seitenstreifen zu überqueren und dann über den asphaltierten Parkplatz – die Zeit, die man brauchte, um einen perfekten Old Fashioned zu mixen. Der Weg beinhaltete zwei ihrer liebsten Gerüche, den scharfen, irdenen Hauch von Kiefern an einem Ende und die hartnäckige Mischung aus abgestandenem Zigarettenrauch und frittiertem Fett am anderen, Gerüche, die sie immer mit Sehnsucht und Vergnügen verband. Wenn sie auf dem Weg einem Tier begegnete, gab sie ihm einen Namen, wie an dem Tag, als sie ein Eichhörnchen sah, das sie Pronto nannte. Doch wichtiger noch, wenn sie es von zu Hause bis zum Supper Club ohne Unterbrechung schaffte, würde es ein guter Tag werden, garantiert. Am Tag zuvor hatte ihr Mann Ned sie in der Einfahrt aufgehalten, um sie zu küssen, bevor er über das Wochenende wegfuhr, und es war der schlimmste Tag seit Langem gewesen.
An diesem Morgen schaffte es Mariel beinahe. Sie war bereits ein paar Schritte auf dem Lakeside-Parkplatz, als jemand ihr den Tag ruinierte.
»Mariel!«, brüllte eine Frauenstimme aus einem weißen Kombi. Es war Hazel, die Älteste ihrer Stammgäste aus der Bar.
Mariel seufzte und drehte sich zu ihr um. »Wie geht’s, Hazel?«
»Besser, als ich verdiene«, erwiderte Hazel. »Also, wo warst du gestern Abend? Du bist einfach weg und hast uns sitzen gelassen.«
»Mir war übel, also bin ich früher nach Hause gegangen.« Mehr brauchte Hazel nicht zu wissen.
»Oh, Himmel. Verdorbener Magen?«
Mariel entschied, einfach zu nicken.
Hazel antwortete mit einer kurzen, übertriebenen Grimasse. »Na ja, heute siehst du wieder gut aus. Übrigens, schickes T-Shirt.«
Mariel musste an sich hinuntergucken, um sich zu erinnern, was sie trug. Es war das T-Shirt eines Bruce Springsteen Konzerts von vor sechzehn Jahren. Vermutlich das letzte Mal, dass sie in einem Konzert gewesen war.
»Danke. Also, ich sollte zur Arbeit gehen.«
»Eine Sache noch. Deine Mutter hat mich angerufen. Jemand muss sie nach dem Pfannkuchenfrühstück von der Kirche abholen, und sie will wissen, ob du das machen könntest.«
Mariel hatte ihre Mutter über zehn Jahre lang nicht gesehen. Bis vor zwei Wochen, bei Floyds Beerdigung und Trauerfeier. Sie hatten kurzen Blickkontakt gehabt, aber nicht miteinander gesprochen.
»Warum hat sie nicht einfach angerufen?«, fragte Mariel.
»Sie meinte, sie hätte es dreimal versucht und endlos klingeln lassen.«
Mariel war an diesem Morgen beim Arzt gewesen, also könnte es sein, dass die Behauptung ihrer Mutter stimmte, aber als sie zu Hause war, hatte niemand angerufen.
»Warum kann denn keine der Freundinnen, bei denen sie gerade übernachtet, sie fahren?« Das Letzte, was Mariel von ihrer Mutter gehört hatte, war, dass sie seit Floyds Beerdigung ständig in irgendeinem Gästezimmer ihrer diversen Kindheitsfreundinnen übernachtete. Die Tatsache, dass Florence bisher noch nicht nach Winona in ihr Zuhause zurückgekehrt war, war beunruhigend. Irgendetwas war im Busch.
»Sie bat ausdrücklich um dich.« Hazel sah zufrieden aus, ein schlechtes Zeichen. »Ich kenne deine Mom seit sechzig Jahren. Es wird langsam Zeit, Mariel. In unserem Alter weiß niemand, wie lange man noch hat.«
Mariel hasste es, wenn ältere Leute diese Karte spielten, besonders im Namen anderer älterer Leute. Ihrer Erfahrung nach traf das für jeden in jedem Alter zu.
»Ich denke darüber nach.«
Würde sie das tatsächlich heute tun? Sie bemerkte einen gelbbauchigen Specht im Baum über sich, dessen rot gekrönter Kopf herumschoss und der mit seinem kleinen, gottlosen Hirn zweifelsohne eine weitere Zerstörung ihrer Bäume ausheckte. Dann bemerkte sie einen weiteren, einen Ast darüber. Vielleicht vereinten sie ihre Kräfte und würden sich schon bald in einer entzückenden Pestwolke auf sie herabsenken und den Wald, die Gebäude, die Menschen und alles andere dem Erdboden gleichmachen. Dann würde es hier viel ruhiger werden, und sie könnte endlich einen entspannten Samstag verbringen.
»Denk nicht zu lange darüber nach.« Hazel lachte. »Florence Stenerud lässt man nicht warten.«
Obwohl sie die vergangenen fünfzig Jahre noch nicht mal in der Nähe von Bear Jaw gelebt hatte, war Mariels Mutter in der Gegend weiterhin überall bekannt, wurde irgendwie geliebt und oft gefürchtet. Es hatte sich wohl herumgesprochen, dass gegen jeden, der Florence auch nur im Geringsten enttäuschte, gegen jeden, der ihr Unannehmlichkeiten bereitete oder ihre Erwartungen nicht erfüllte, kurz darauf als Vergeltung eine Schar haltloser Gerüchte in die Welt gesetzt wurde. Sollte Mariel ihre Mutter also nicht zu angemessener Zeit von der Our Savior’s Lutheran Church abholen, würde die Stadt folglich bald hören, dass Mariel bei einem Autounfall schwer verletzt worden sei oder unter einem umgefallenen Baum feststeckte oder eine seltene, unheilbare Krankheit hatte, sich scheiden ließ oder ein deftiger Cocktail des zuvor Genannten, dessen war sich Mariel sicher.
Mariel sah auf die Uhr. Es war zehn. »Wie lange habe ich noch, Hazel?«
»Das Pfannkuchenfrühstück geht bis elf, aber sie würde gern um halb elf abgeholt werden.«
»Okay, ich mach’s«, sagte Mariel und überraschte damit sogar sich selbst.
Wenn sie daran dachte, irgendwann wieder mit ihrer Mutter zu reden, hatte Mariel stets das Bild einer tränenreichen Aussöhnung am Sterbebett vor Augen gehabt, gefolgt von ein paar Jahrzehnten des Bedauerns, und das war für sie in Ordnung. Doch vielleicht war es an der Zeit, wie Hazel sagte. Mariel würde sowieso einen schlechten Tag haben.
Die eigentliche Stadt Bear Jaw lag knapp zwölf Kilometer vom Bear Jaw Lake entfernt, was die europäischen Eindringlinge sicher deshalb getan hatten, um zukünftige Touristen zu verwirren, von denen es inzwischen reichlich gab. Um diese Uhrzeit waren die meisten Touristen und See-Anwohner noch in ihren Blockhütten, also wäre der Verkehr stadteinwärts erträglich. Abgesehen von einem grünen Klärgruben-Laster der Firma Borglund Services, der vor ihr fuhr, war der einzige Mensch, der in dieselbe Richtung fuhr wie Mariel, eine Frau Mitte fünfzig mit hellem silber-gesträhntem Haar auf einem silberfarbenen Fahrrad gewesen.
Aus Mariels Radio erklang ein interessantes Lied über einen Typen, der umgebracht werden wollte, weil er ein Loser war. Sie flippte durch die verschiedenen Sender, bis sie bei einem Song von Mariah Carey landete, der es gut ging oder zumindest besser.
Mariel hatte sich tatsächlich innerlich darauf vorbereitet, auf der Beerdigung mit ihrer Mutter zu sprechen. Doch es hatte einfach nie einen Moment gegeben, an dem Florence nicht ständig von Menschen umgeben gewesen war. Über die Jahre hatte es Augenblicke gegeben, in denen sie das dringende Bedürfnis verspürte anzurufen, Momente, an denen ein normaler, ausgeglichener Mensch seine normale, ausgeglichene Mutter angerufen hätte. Doch Mariel brachte es nie über sich. Vor zwei Wochen hatte Mariel wichtige Neuigkeiten gehabt, etwas, von dem sie nicht wollte, dass ihre Mutter es über Dritte hörte. Sie war schwanger. Oder war es bis zum Vorabend gewesen.
Sie hatte es ihrem Mann noch nicht erzählt. Ned war nach wie vor unten in den Twin Cities und schaute sich mit seinen Freunden Baseballspiele an. Sie konnte warten. Ned sah Tim, Eric und Doug nur zweimal im Jahr, und sie wollte ihm nicht die Zeit mit ihnen verderben.
Ihre Ärztin, Theresa Eaton, hatte gesagt, wenn es zu einer Fehlgeburt käme, würde das in den ersten zwölf Wochen geschehen. Bei ihr passierte es nach sechs Wochen und zwei Tagen, während der Arbeit, direkt nachdem die Küche geschlossen hatte. Sie hatte den Tag über leichte Blutungen gehabt und Theresa angerufen, die meinte, das sei normal.
»Wir sehen uns in ein paar Tagen«, hatte Theresa gesagt, »um nach dem Herzschlag zu schauen.«
Doch an diesem Abend, als Mariel für einen Gast einen Midori Sour mixte, spürte sie plötzlich einen stechenden Schmerz. Sie rannte zur Toilette, verschloss die Kabinentür und setzte sich. Ihr war schwindelig, und es fühlte sich an, als würden ihre Gedärme herausfallen. Sie wusste es, noch bevor sie sich überwand hinzusehen. Ihr ganzer Körper wollte schreien. Sie presste ihre Faust in den Mund und weinte so leise wie möglich, um niemanden zu stören.
Nachdem sie sich gesäubert hatte, schlich Mariel sich, ohne jemandem etwas zu sagen, hinten hinaus. Sie würde sich später entschuldigen und allen erzählen, dass ihr übel gewesen sei. Mariel dachte an ihre beiden Saisonangestellten an der Bar und hoffte, sie würden kein falsches Bild von ihr bekommen. Als sie die Hintertür aufschob, fühlte sie sich so einsam und kalt wie nie zuvor.
Draußen roch Mariel frischen Zigarettenrauch. Erleichtert stellte sie fest, dass es Big Al war, der schon seit der Zeit vor ihrer Geburt Chefkoch im Lakeside war. Irgendwann wollte sie selbst mal Chefköchin werden, und Floyd und Big Al hatten ihr alles beigebracht, was auf der Speisekarte stand. Abgesehen von Ned, war er vermutlich am ehesten das, was sie Familie nennen würde.
»Gehst du schon?«, fragte Big Al überrascht.
»Magen verdorben«, erklärte sie ihm und schaute bewusst in die andere Richtung. Wenn er ihr Gesicht sehen würde, wüsste er, dass sie log. Warum hatte sie ihm überhaupt so früh von der Schwangerschaft erzählt? Sie hätte es doch besser wissen sollen. Aber sie war so glücklich gewesen, und auch das konnte sie unmöglich vor ihm verbergen.
»Soll ich stattdessen nachher zumachen?«
»Ja«, sagte sie, schaffte es aber nicht, die Trauer aus ihrer Stimme herauszuhalten.
»Oh, nein«, sagte er, als verstünde er.
Sie wäre beinahe zusammengebrochen und hätte ihm alles erzählt. Stattdessen entschuldigte sie sich und ging in der Dunkelheit nach Hause.
Vielleicht würde sie es niemandem erzählen. Sie hatte ein Baby verloren, doch so würden es die meisten Menschen nicht sehen. Ihre Reaktionen würden niederschmetternd für sie sein. Sie würden sie umarmen und Sachen sagen wie Es hat einfach nicht sein sollen. Oder Das passiert ganz vielen. Oder Versucht es doch einfach noch mal! Sie würden erzählen, dass die Mom ihrer Freundin Cathy in fünfundzwanzig Jahren neun Fehlgeburten hatte. Doch sie wussten nicht, was Mariel und Ned durchgemacht hatten, nur um dieses eine Mal schwanger zu werden. Und Cathys Mom hatte sieben Kinder. Mariel jedoch keines.
Aber was noch niederschmetternder war, dass Mariel auch ohne Kind gut klarkam. Und das würde sie auch auf lange Sicht. Seit Jahren waren es nur Ned und sie, und alles war gut. Doch nachdem sie erst mal entschieden hatten, ein Baby zu wollen, konnte Mariel an nichts anderes mehr denken – selbst nachdem beide von ihren Empfängnisproblemen erfahren hatten und wie schwierig es für sie werden würde. Und jetzt das, nach all der Zeit und dem Geld, das es gekostet hatte, und den Prozeduren, die sie über sich hatten ergehen lassen müssen. Nicht zurück auf Los, denn so etwas gab es nicht. Ihr Körper würde entweder ein Kind austragen oder einen Verlust ertragen. Wie auch immer, wäre der Platz dafür nun frei.
Und nun brannte sich der Verlust unausgesprochen durch ihre Erinnerungen, auf der verzweifelten Suche nach einem Schuldigen. Sie fand einen. Mariel hatte die Garnituren der Drinks nie angerührt, nur um die Getränke damit zu servieren, doch Freitagabend, zwei Stunden vor der Fehlgeburt, bekam sie plötzlich Hunger. Und weil ihre üblichen, herzhaften Snacks zwanzig Schritte entfernt in ihrem Büro lagen, war sie zu faul und aß drei grüne Cocktailkirschen. Seit Monaten nahm sie ausschließlich Lebensmittel zu sich, die gut für die Fruchtbarkeit waren, und hatte nie etwas Künstliches angerührt. Viel später würde sie herausfinden, dass die Kirschen keine Rolle dabei gespielt hatten, doch das war zu dem Zeitpunkt unwichtig. Es war ihr einziger Ausbruch aus einer Routine. Nun lagen alle grünen Kirschen im Müll und würden nie mehr in ihrer Bar auftauchen.
Es war alles nur wegen dieser Kirschen, sagte sie sich. Es war nicht, dass Neds Sperma fast keine Motilität besaß oder sie eine abnehmende Zahl an Follikeln. Es waren weder ihre überflüssigen Pfunde noch ihr früherer exzessiver Alkoholkonsum oder die Tatsache, dass sie fast neununddreißig war. Sie konnte ihrem fehlerhaften, rebellischen Körper verzeihen und nach vorne sehen, weil sie das musste. Doch bis dahin würde sie es niemandem erzählen.
Mariel war sicher: Wenn ihre Mutter je herausfände, dass sie eine Fehlgeburt gehabt hatte, würde Florence sie einem Sturm an Gründen aussetzen, warum es Mariels Schuld wäre, und das war das Letzte, was sie gerade gebrauchen konnte. Zum ersten Mal, seit sie eingewilligt hatte, ihre Mutter abzuholen, fragte sich Mariel, warum sie es so eilig hatte.
Im Radio sang Mariah Carey darüber, wie ein Baby immer Teil von ihr sein und die Liebe zwischen ihr und dem Baby nie sterben würde. Mariel hatte dieses Lied schon tausendmal gehört, aber jetzt war es offensichtlich: Der Mensch, der dieses Lied geschrieben hatte, hatte ein Kind verloren. Und, meine Güte, konnte sie in Mariahs Stimme hören, dass sie sich erneut ein Baby wünschte.
Mariel schaute kurz hinunter, um den Sender zu wechseln, und als sie wieder aufschaute, sah sie einen wunderschönen Hirsch über die Straße rennen, einen makellosen Terry-Redlin-Zehnender. In dem Moment, als sie auf die Bremse stieg, hörte und spürte sie einen lauten Aufprall, sah den perfekten Hirsch durch die Luft trudeln und verschwinden. Dann wurde alles schwarz.
Wo war sie? Mariel löste ihre Hände vom Lenkrad und öffnete die Augen. Ihr Wagen stand im Leerlauf auf dem Seitenstreifen, doch sie konnte sich nicht erinnern, angehalten zu haben. War sie tot? Jemand anderes müsste Florence abholen. Was für ein hirnverbrannter erster Gedanke als Tote. Vielleicht war dies die Hölle. Oder, weniger spannend, war sie überhaupt nicht tot.
Mariel sah in die Spiegel. Aus keiner der beiden Richtungen kam ein Auto. Erst als sie sich vornüberbeugte, um aus dem Wagen auszusteigen, merkte sie, dass ihr der Nacken wehtat. Als sie die Front ihres kleinen blauen Dodge inspizierte, sah sie, dass der Scheinwerfer und der Blinker auf der Beifahrerseite zertrümmert waren. Der Radkasten war zerschrammt, und der Kühlergrill war teilweise eingedellt, doch dann bemerkte sie noch etwas anderes.
Der wunderschöne Hirsch lag zuckend und blutend im Straßengraben, und zwei seiner Beine waren gebrochen wie Zuckerstangen in ihrer Verpackung. Er würde hier nicht mehr wegrennen, so viel war klar. Sie schaute in seine dunklen Augen. Er schien zu wissen, dass er sterben würde. Jemand musste ihn töten und ihn von den furchtbaren Schmerzen erlösen. Und wenn nicht bald jemand vorbeikäme, sah es so aus, als müsste Mariel das tun.
In Nord-Minnesota hatten viele Menschen in ihrem Fahrzeug etwas dabei, mit dem man ein großes Säugetier hinrichten konnte. Ned und sie gehörten nicht dazu. Beim Durchwühlen des Kofferraums fand sie lediglich eine große Wasserflasche, eine Steppdecke, Starthilfekabel, einen Benzinkanister, eine ungeöffnete Schachtel Schoko-Minz-Kekse und eine Flasche Frostschutzmittel. Noch nicht mal ein Messer.
Sie sah den Hirsch an und dachte darüber nach, die Starthilfekabel zu nehmen und ihm damit so lange auf den Kopf zu schlagen, bis er starb, doch das erschien ihr schwierig und grausam. Stattdessen packte sie den alten roten Benzinkanister am Griff. Er war fast voll, also war er schwer genug.
Mariel betrachtete das zuckende Gesicht des Hirsches und fragte sich, ob sie ihm mit diesem Kanister den Schädel einschlagen konnte. Eine gefühlte Ewigkeit stand sie da, den Kanister in der Hand, und entschuldigte sich bei dem Hirsch, während das zauberhafte, verletzte Geschöpf um Atem rang.
Dann hörte sie eine Frauenstimme hinter sich.
»Was haben Sie damit vor, ihn abfackeln? Heiliger Christus!«
Mariel drehte sich um und sah, wie eine Frau mittleren Alters von einem silbernen Fahrrad sprang. Mariel kannte sie, da war sie sicher, konnte aber keinen Namen zuordnen. Aus der Nähe war das Gesicht der Frau faltig, wunderschön und ungerührt, und das Silber in ihrem langen braunen Haar glitzerte in der Sonne wie Lametta.
Während die Frau den Hirsch anstarrte, atmete sie einmal tief durch und sah dann Mariel an. »An dem Trottel ist eine anständige Menge Fleisch.«
»Genau das habe ich auch gedacht.« Mariel nickte, obwohl sie das eindeutig nicht gedacht hatte. Sie hatte Hirsche noch nie als Trottel betrachtet, und als sie die Szene in ihrem Kopf nachspielte, musste sie schmunzeln.
Die Frau schien auch amüsiert zu sein. »Wo haben Sie ihn erwischt?«
»Ich weiß nicht. Ich glaube, an den Beinen.«
Als die Frau den Reißverschluss ihrer leichten Jacke aufzog, sah man darunter ein graues Tank-top, einen Werkzeuggürtel und ein blankes Jagdmesser mit schwarzem Griff. Sie näherte sich dem Hirsch von hinten und schnitt ihm mit einer schnellen Bewegung die Kehle durch.
»Qualitätswerkzeug spart einem Zeit und Geld«, sagte die Frau, als wäre dies die offensichtliche Moral der ganzen Szene. Sie wischte die Klinge am Fell des toten Tieres ab, und genau da und dort entschied Mariel, dass sie mit dieser Frau befreundet sein wollte.
Sie hieß Brenda Kowalsky, und wie sich herausstellte, wohnte sie nur knapp zwei Kilometer entfernt.
»Ich hole meinen Sohn, damit er mir hilft, den hier aufzubrechen«, sagte sie und meinte den Hirsch. »Ich fahre nach Hause und rufe ihn an. Sie bleiben hier und sagen den Leuten, Sie wären als Erste hier gewesen.«
Mariel wartete ungefähr eine Viertelstunde darauf, dass Brenda und ihr Sohn auftauchten, während Florence Jean Stenerud weiterhin in der sonnengesprenkelten Eingangshalle der Our Savior darauf wartete, abgeholt zu werden. Inzwischen würde Mariel frühestens um Viertel nach elf an der Kirche sein. Sie sagte sich, dass sie keine Schuld am Unmut ihrer Mutter hatte. Es war ja nicht so, als hätte man die Frau in der Wüste Gobi ausgesetzt. Sie war umgeben von ihren ältesten Freundinnen in einem klimatisierten Gebäude voller starkem Kaffee und gutem Frühstück. Ihre Mutter würde es in dieser Umgebung sicherlich noch eine weitere halbe Stunde aushalten.
Mariel überprüfte, ob ihr Wagen noch verkehrstauglich war, und sofern sie nicht beide Scheinwerfer bräuchte, war alles in Ordnung. Sie hatte den Motor gerade wieder abgestellt, als ein glänzender Dodge Ram Pick-up neben ihr anhielt. Der Fahrer war ein gepflegter junger Mann, dessen kantige Gesichtszüge sie wiedererkannte. Er arbeitete im Beerdigungsinstitut der Stadt. Brenda winkte ihr vom Beifahrersitz aus zu.
»Kyle will wissen, ob du das Herz haben möchtest.«
Mariel brauchte ein paar Sekunden, um den Satz zu verarbeiten. Ihr war noch nicht mal ansatzweise in den Sinn gekommen, dass sie etwas von dem Wildbret abbekommen würde, und sagte es ihnen. »Ich schätze, weil Sie die ganze Arbeit haben«, erklärte sie.
»Sie sind diejenige, die ihn angefahren hat«, sagte Brenda. »Rein rechtlich gehört das Fleisch Ihnen. Mein Sohn wird es sogar für Sie zerlegen, wenn Sie mit zu uns kommen würden. Sie sind doch nicht in Eile, oder?«
Angesichts dieser liebenden Mutter und ihrem erwachsenen, hilfsbereiten Sohn dachte Mariel an Florence.
»Nein«, sagte Mariel.
Sie folgte Brenda und Kyle eine lange Schotterstraße hinunter und ließ die Stadt, die Kirche und ihre Mutter immer weiter hinter sich, in Richtung einer ausgedehnten grünen Farm, die sie noch nie zuvor bemerkt hatte. Unmittelbar flüsterte irgendetwas an diesem Ort ihr zu, und sie wusste, dass sie ihn so schnell nicht verlassen würde.
ZWEI
Florence, 1934
Zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens passierte nie etwas Gutes. Davon war Florence nicht nur überzeugt, es war bewiesen. Niemand, der einen um diese Uhrzeit aufweckt, hat etwas Anständiges anzubieten oder möchte irgendwelche guten Nachrichten mit einem teilen. Die Mitte der Nacht ist der Zeitpunkt, an dem einem Dinge genommen werden.
»Florence, Florence«, flüsterte ihre Mutter Betty ihr ins Ohr und schüttelte sie.
Florence wachte auf, öffnete aber nicht die Augen.
»Bist du wach?«, fragte ihre Mutter. »Ich habe diesen Ort satt, lass uns einen anderen suchen.«
»Schon wieder?«, fragte Florence. Ihre Mutter hatte in letzter Zeit eine Menge Orte satt, in der Regel zwischen Mitternacht und fünf Uhr morgens. »Irgendwie gefällt es mir hier.«
Tat es wirklich. Außerdem hatte sie sich ihr Leben lang einen Garten gewünscht, und dieses Haus hatte hinten ein kleines Fleckchen Erde, wo sie eine einzelne Rhabarberstaude gepflanzt hatte. Das war nicht viel, aber sie gehörte ihr.
»Nein, tut es nicht«, sagte ihre Mutter. »Hier, zieh deine Jacke an.«
»Kann ich mich nicht noch umziehen?«
»Ich habe deine Sachen bereits gepackt. Du kannst dich umziehen, wenn wir irgendwo angekommen sind.«
»Wohin gehen wir?«
»Lass uns das herausfinden«, sagte ihre Mutter und lächelte.
Die häufigen, frühmorgendlichen Fluchten waren für Florence stets beängstigend gewesen. Mit zunehmendem Alter jedoch wurde ihr klar, dass ihre Angst weder jemandem half noch die Entscheidungen ihrer Mutter beeinflusste und dass es härter und weltläufiger war, genervt zu sein. Diesmal nervte es Florence ganz besonders, dass ihre Mutter entschieden hatte, in einer so kalten Nacht zu fliehen. Schließlich gab es Wettervorhersagen, die die Leute in ihre Planung mit einbeziehen konnten, doch manchmal schien ihre Mutter gegen gesunden Menschenverstand immun zu sein. Vor zwei Tagen, an ihrem zwölften Geburtstag, war es zehn Grad wärmer gewesen, und selbst wenn es ein lausiges Geburtstagsgeschenk gewesen wäre, wieder auf der Straße zu sein, ohne einen Platz zum Schlafen, wäre ihr das lieber gewesen als zu erfrieren.
Als wäre Florence noch nicht ausreichend beunruhigt, musste sie sich an diesem Morgen schon wieder einen von Betty Millers Lieblingssprüchen anhören: »Ablehnen kann man immer.« Seit ihre Mutter vor vielen Jahren ihr Auto verkauft hatte, hatte sie eine Menge Mitfahrgelegenheiten abgelehnt. Aber um drei Uhr morgens schien es nicht so, als gäbe es genug Autos und Lastwagen auf den Straßen von Lake City, Minnesota, um besonders wählerisch sein zu können. Doch ihre Mutter war es und sagte es den verschmähten Fahrern auf eine Art ins Gesicht, bei der sie sich geschmeichelt fühlen konnten.
»Oh, wir können nicht mit Ihnen mitfahren«, erklärte sie einem deutlich betrunkenen Mann in einem zigarrenverqualmten Studebaker. »Wir müssen auf jemand weniger Attraktiven warten.«
Als der Mann verwirrt davonfuhr, funkelte Florence ihre Mutter böse an. »Der Mann sah überhaupt nicht gut aus. Warum lügst du die so an?«
»Männer sind empfindlich, Liebling«, sagte Betty. »Wenn ich einem Mann sage, dass er zu viel getrunken hat und sich womöglich selbst umbringt, könnte er das als eine Beleidigung auffassen. Und Männer verlieren oft Anstand und Beherrschung, wenn sie sich beleidigt fühlen.«
»Warum müssen wir ausgerechnet jetzt gehen? Was stimmte denn mit dem Haus nicht?«
Mit dem Haus, in dem sie gelebt hatten, stimmten natürlich eine Menge Dinge nicht. Weswegen ihre Mutter, aus Prinzip, dem Eigentümer, einem Mann namens Maylone, keine Miete gezahlt hatte. Er war schmierig und gemein, hatte einen kleinen, dünnen Schnurrbart und sah ihre Mutter auf eine verstörende Weise an. Dennoch war es besser gewesen als an den meisten Orten, an denen sie geschlafen hatten. Sie hatten fast noch nie irgendwo gewohnt, wo es eine Toilette im Haus sowie fließend warmes Wasser gab. Und nur gelegentlich hatten sie mal Strom. Florence hatte ihrer Mutter sogar gesagt, sie würde ihr freiwillig helfen, ein komplettes Haus zu putzen, wenn sie nie wieder eine Nacht in einem Elendsviertel verbringen müssten. Doch selbst wenn sie an einem halbwegs anständigen Ort gelandet waren, fand Betty immer einen Grund, wieder zu gehen.
»Es verletzt die Ehre deiner Großmutter Julia, wenn wir unseren Lebensstandard weiter zurückschrauben«, sagte Betty. Julia war eine Winthrop, erinnerte ihre Mutter sie gern.
Florence hatte sich immer begeistert beteiligt, wenn ihre Mutter darüber fantasierte, wo sie heutzutage wären, wenn Henry Winthrops Vermögen nicht nur unter seinen vier Söhnen aufgeteilt worden wäre, sondern er auch Florences Großmutter Julia miteinbezogen hätte. Was immer in Julias Richtung gekleckert wäre, hätte jedoch inzwischen längst die Erde verlassen, gemeinsam mit Julia. Dass Betty und Florence nichts Greifbares aus der verschwundenen Welt der Winthrops mit ihren Frühlingsgalas, Großindustriellen, privaten Chefköchen, Hausmädchen und Butlern besaßen, machte den Traum nicht weniger berauschend. Über ein Jahr lang erzählte Florence jedem, den sie kennenlernte, sie hieße Florence Winthrop, bis sie eines Tages mitbekam, wie jemand sagte: Schau, selbst bei den Winthrops geht es bergab.
»Julia Winthrop würde vermutlich mit uns auf der Straße sitzen«, sagte Florence.
»Das würde sie ganz sicher nicht. Und wir sitzen nicht auf der Straße, wir entscheiden uns, wo wir als Nächstes leben werden. Los, komm, lass uns zu der Tankstelle gehen.«
Florence wollte ihre beiden Koffer in dieser Nacht nicht noch weiter schleppen – sie waren bereits einen Kilometer gelaufen, nur um bis zum Highway zu kommen –, doch nachdem ihre Mutter erst mal losgelaufen war, hatte sie keine andere Wahl, als zu folgen. Aus der Nähe sah es nicht aus wie eine nette Tankstelle; es sah aus wie ein schäbiges kleines Haus, in dessen Vorgarten ein paar Zapfsäulen standen. Außerdem hatte sie eindeutig noch nicht geöffnet. Mit anderen Worten, sie sah perfekt aus, was Betty Miller betraf.
»Über kurz oder lang kommt hier unser Prinz oder unsere Prinzessin vorbei, und bis dahin wird uns niemand schikanieren«, sagte Betty, während sie auf einer ausgeblichenen weißen Bank zwischen ihren Koffern saß und den dünnen Hals reckte, um mit ihren wachsamen Augen in die stille Dunkelheit zu schauen.
Florence rollte sich wärmesuchend in Richtung ihrer Mutter zusammen und schlief wieder ein.
Als Florence das nächste Mal die Augen öffnete, war es Morgen, und sie stellte überrascht fest, wie nah sie ihrer Mutter war, als wäre der Koffer zwischen ihnen bewegt worden. Sie keuchte, setzte sich auf, schaute unter der Bank nach, dahinter und auf beiden Seiten. Alle vier Koffer, die ihre Kleidung enthielten, ihre Bücher und Kleinigkeiten, alles, was sie besaßen und über Jahre angesammelt hatten, war fort. Florence wusste nicht, ob sie weinen oder ohnmächtig werden sollte.
»Mama«, sagte Florence unter Tränen und schüttelte ihre Mutter wach. »Wo sind unsere Sachen?«
Bettys Augen klappten auf, und als sie die Worte ihrer Tochter hörte, schien es, als wäre sie zwei Sekunden lang so in Panik, wie es ein normaler Mensch sein sollte, der gerade alles verloren hatte, was er besaß. Dann ging dieser Moment vorbei, Betty holte tief Luft, lächelte und nickte. »Jemand hat uns ausgeraubt«, sagte sie. »Gut. Jetzt kommen wir schneller voran.«
»Nein! Nein!«, schrie Florence ihrer Mutter erschöpft und stinkwütend ins Gesicht. »Da war all meine Kleidung drin!«
»Na ja, es war sowieso nur ein Haufen Lumpen. Die Hälfte davon hat dir kaum noch gepasst. Jetzt besorgen wir dir ein paar neue Sachen.«
»Das sagst du ständig! Jetzt habe ich nichts anderes mehr anzuziehen als das, was ich trage!«
»Nun, das ist doch ein anständiger Anfang. Besser, als nackt zu sein. Wir werden neue Kleidung erhalten, wenn sie zu uns kommt. Und das passiert, wenn es passiert, und keine Sekunde später.« Dann schaute ihre Mutter in die andere Richtung und sprang auf die Beine. »Oh, schau, ich kann unser Glück kaum glauben.«
Ein glänzender schwarzer Oldsmobile, gefahren von einer allein reisenden jungen Frau, hielt an der Tankstelle. Florences Mutter fuhr viel lieber bei Frauen mit. Weibliche Fahrer stellten persönlichere Fragen, woraufhin Betty ausgeklügelte Lügenmärchen über ihre derzeitigen Lebensumstände heraufbeschwor, speziell, wenn sie nach ihrem Ehemann gefragt wurde. Über die Jahre hatte Florence ihre Mutter dreißig verschiedene Ehemänner beschreiben hören, die Tischler, Maurer, Mechaniker oder Verkäufer waren sowie jedem Zweig des Militärs angehörten. Diese Männer waren Katholiken und Protestanten gewesen, Demokraten, Republikaner und Sozialisten, Stadtkinder und Farmerssöhne. Doch kein einziges Mal beschrieb sie Florences tatsächlichen Vater.
Florence konnte nicht hören, was ihre Mutter dieser Frau über ihre derzeitige Zwangslage erzählte, doch es zeigte Wirkung. Sie bestiegen ein warmes, sauberes Auto in Richtung Red Wing.
»Sie besucht ihre Schwester«, flüsterte Betty ihrer Tochter zu. »Und ihre Schwester hat vielleicht etwas Kleidung für uns übrig. Aber sie kann uns nicht direkt hinbringen, weil der Ehemann der Schwester dort sein könnte. Also werden wir irgendwo warten, und sie kommt und holt uns, wenn die Luft rein ist.«
Innen war der Wagen sauber und ordentlich, abgesehen von einem Buch auf dem Rücksitz, mit dem Titel Ein Zimmer für sich allein von Virginia Woolf.
»Ich muss nach wie vor zu einer Tankstelle, da diese nicht geöffnet war«, sagte die Fahrerin zu ihnen. »Sind Sie vor irgendwem auf der Flucht?«
Florences Blick begegnete dem ihrer Mutter.
»Ich sehe uns lieber als hoffnungsvoll, nicht als verängstigt«, sagte ihre Mutter.
»Sie müssen für mich nichts fingieren«, sagte die Frau und benutzte ein beeindruckendes Wort, das ernst und einschüchternd klang. »Ist ein Mann hinter Ihnen her?«
»Ja, er heißt Mr. Maylone«, erwiderte ihre Mutter nach einem Augenblick und nannte ihr den Namen ihres letzten Vermieters. »Und wenn er es nicht schon ist, dann wird er es bald sein.«
»Bitte sagen Sie mir, wenn Sie diesen Mr. Maylone sehen, dann setze ich dem ein Ende.«
Florence gefiel diese Frau. »Er hat fettiges braunes Haar und einen distinguierten kleinen Schnurrbart«, sagte sie und hoffte, die Frau mit ihrem Vokabular zu beeindrucken.
»Distinguiert. Nettes Wort«, sagte die Frau und schaute hinter sich, um ihr zuzunicken.
»Wie heißen Sie?«, fragte Florence.
»Marielle«, antwortete die Frau.
Es gibt nur eine Handvoll Gelegenheiten im Leben, in denen der Zufall eine echte Rolle darin spielt, das Schicksal eines Mädchens zum Guten zu wenden. Rückblickend war Florence bewusst, dass diese Frau, Marielle, im Grunde nur zwei Fremden, die sie bestimmt schon bald wieder vergessen würde, ein wenig Freundlichkeit entgegenbrachte. Angesichts der Folgen jedoch würde Florence den Rest ihres Lebens Ausschau nach Marielle halten, in der Hoffnung, sich anständig bei ihr revanchieren zu können, weil sie als Kind dazu nicht in der Lage gewesen war.
In Red Wing angekommen, setzte Marielle sie an einem Jorby’s ab, dem örtlichen Schnellrestaurant. Betty wählte Plätze am Tresen neben einem pummeligen Herrn mit sanftem Gesicht, der ein grünes Sakko trug und sich das dünner werdende Haar über die rosafarbene Kopfhaut gekämmt hatte. Seit sie sich gesetzt hatten, belehrte er einen bebrillten Jungen, der hinter dem Tresen Kaffee einschenkte und kaum älter als Florence sein konnte. Er sagte dem Jungen, er solle aus dem Restaurantgeschäft aussteigen und einen Abschluss in Jura machen.
Ihre Kellnerin lächelte den Jungen an. »Bei Nathanerreichen Sie da gar nichts«, erklärte sie dem Mann. »Er ist einer der Söhne des Eigentümers.«
Florence betrachtete den unglücklich aussehenden Jungen und dachte, dass sie nicht mit ihm tauschen wollte. Nur wegen seiner Eltern zu lebenslanger Plackerei in einem Restaurant gezwungen zu werden, das musste man sich mal vorstellen. Ihre Mutter und sie hatten Möglichkeiten.
Der Mann in dem grünen Sakko lächelte Nathan an. »Jeder ist seines Glückes Schmied.«
Die Kellnerin lachte und wandte sich schließlich Florence und ihrer Mutter zu. Sie betrachtete sie mit unverkennbarem Mitleid. Sie mussten so müde und schmutzig aussehen, wie sie sich fühlten. »Na, holpriger Morgen?«
»Überhaupt nicht. Es geht uns ganz großartig«, sagte Betty. »Wir treffen uns hier mit einer Freundin, und ich dachte, wir könnten uns eine kleine Erfrischung gönnen, während wir warten.«
»Na dann, okay. Was darf ich Ihnen beiden bringen?«
»Für mich nur Kaffee, ich bin nicht hungrig«, sagte Betty. »Und für meine Tochter, was immer sie möchte.«
Florence hatte noch nicht mal Zeit gehabt, die Speisekarte zu studieren, doch sie war hungrig, also nannte sie das Erste, was ihr in den Sinn kam. »Haben Sie Pfannkuchen?«
»Na, klar. Wie viele möchtest du?«
Für Florence war das davon abhängig, wie viel Geld ihre Mutter hatte. Florence hasste es, wenn ihre Mutter sie aus einem Restaurant schmuggelte, ohne die Rechnung zu bezahlen. Dann bekam sie von dem Essen immer Bauchweh. »Mama? Wie viele darf ich haben?«
»So viele du möchtest«, erwiderte Betty lächelnd.
Oh-oh, dachte Florence. Genau in dem Moment entschied sie, dass sie das nie tun würde, wenn sie erwachsen war; sie würde stets ehrlich sein, egal, wie andere sich dabei fühlten. Vielleicht sollte sie direkt jetzt damit anfangen. Sie war müde, wütend, und es platzte einfach aus ihr heraus. »Nein, Mama, ich meine, wie viele können wir uns leisten?«
Bettys verdammtes Lächeln wich immer noch nicht aus ihrem Gesicht. »Was habe ich dir gerade gesagt?«
»Ich nehme einen«, erklärte Florence der Kellnerin.
»Ein Pfannkuchen«, sagte die Kellnerin. »Kommt sofort.«
Während sie warteten, legte Florence die Ausgabe von Ein Zimmer für sich allein vor sich auf den Tresen und begann zu lesen.
»Woher hast du das Buch?«, fragte ihre Mutter.
Florence sah nicht auf. »Die Dame, die uns mitgenommen hat, hat es mir gegeben.«
»Daran erinnere ich mich gar nicht. Hast du der netten Dame etwa das Buch gestohlen?«
»Habe ich nicht. Ich stehle nicht, Mama. Anders als andere Leute.«
»Nun«, sagte ihre Mutter und beäugte das Buch, »wie dem auch sei, es sieht noch gut aus. Vielleicht können wir es verkaufen, wenn du es durchgelesen hast.«
Fünf Minuten später schob die Kellnerin einen dampfenden Teller mit vier Pfannkuchen zwischen Florences Ellenbogen. Sie dufteten nach einem ganz besonderen Ort, einem, den sie unendlich vermisste.
Sie wusste noch, wie sie vor langer Zeit in dem großen gelben Haus aufgewacht war, in einem Bett, das ganz allein ihr gehörte, in einem Zimmer, das ganz allein ihr gehörte, und wie sie irgendwo im Haus Stimmen von Erwachsenen hörte und genau dieser Duft von unten zu ihr hochströmte. Mit anderen Worten, sie dufteten himmlisch.
Das letzte Mal, als sich Florence wirklich sicher und glücklich fühlte, war an einem Morgen vor vielen Jahren gewesen, also sah so vielleicht der Himmel aus. Ein großes gelbes Haus an der Grand Avenue in St. Paul, mit Eltern, die Pfannkuchen buken und nach oben riefen, sie solle hinunterkommen, bevor sie kalt würden.
»Mit einem Gruß von deinem Nachbarn«, sagte die Kellnerin.
Der Mann mit dem freundlichen Gesicht lächelte Florence an. »Du hast ausgesehen, als bräuchtest du mehr als den einen.«
Florence war mit ihrem »Vielen Dank, Sir« noch nicht ganz am Ende, als ihre Mutter sie mit einer Flut an Dankbarkeit übertönte.
»Oh, Sie unglaublich großzügiger Mensch«, verkündete Betty. »Sie. Sind. Ein. Engel. Sie sind ein Engel, der zwischen uns auf Erden wandelt. Wie könnten wir uns je, je bei Ihnen revanchieren?«
Der Mann wirkte ein wenig überrascht. »Keine Ursache. Hätten Sie auch gern ein Stück Pie? Jorby’s hat die besten in Minnesota, und ich habe sie alle schon probiert.«
Florence wusste, was ihre Mutter als Nächstes sagen würde. »Wir könnten heute Nachmittag Ihr Haus putzen. Wir könnten Ihr Geschirr abwaschen. Ihre Kleidung waschen. Alles.« Florence hasste diese Art der Arbeit. Sie hasste es auch, wie ihre Mutter ihr den lieben langen Tag, während sie bei Leuten die Fußböden wischten und deren Toiletten schrubbten, vorhielt, sie solle dankbar für diese ehrliche Arbeit sein, und wenn sie ihr so wenig gefiel, dann solle sie besser einen reichen Mann heiraten.
»Nein, ernsthaft, keine Ursache«, sagte der Mann und lächelte Florence an. Nette Männer waren nicht immer gute Nachrichten. Sie hatte schon festgestellt, wie ansonsten höfliche und großzügige Männer ihre Mutter ansahen, und Florence war alt genug, um die Bedeutung gewisser Komplimente oder Gesten zu verstehen. Doch je genauer sie ihn musterte, desto weniger schien dieser Mann wie die anderen zu sein.
»Los«, sagte er, »iss sie, bevor sie kalt werden.«
Während Florence aß, erfuhr sie den Namen des Mannes, Floyd Muller, und dass er vorhatte, an dem Abend den ganzen Weg hoch nach Norden, nach Bear Jaw zu fahren, wo er ein Lokal besaß.
»Die Majestic Lodge?«, fragte Betty. Jeder hatte schon von der Majestic Lodge gehört, aber Florence und Betty waren noch nie jemandem begegnet, der es sich leisten konnte, dort zu übernachten.
»Nein, aber in der Nähe«, sagte Floyd. »Nur vierhundert Meter die Straße hoch.«
»Können wir mit Ihnen mitkommen?«, platzte Florence heraus. Und sie beschloss, ein Wort zu benutzen, mit dem sie ihn beeindrucken wollte. »Ich habe gehört, die Gegend da oben sei sehr reizvoll.«
»Das könnte stimmen.« Floyd lächelte.
Ihre Mutter guckte finster. »Bear Jaw ist ganz oben im Norden, mitten in den Wäldern.«
»Ich würde es gern sehen«, sagte Florence.
»Nun, die Entscheidung liegt nicht bei dir. Wenn ich in Red Wing Arbeit finde und einen Ort, wo wir unterkommen können, würde ich gern bleiben. Außerdem kennen wir hier die nette Lady, Marielle.«
Floyd sah sie ein wenig erstaunt an. »Sie sind hergekommen, ohne hier eine Unterkunft zu haben?«
»Wir werden schon etwas finden«, erklärte ihre Mutter ihm. »Marielle wird uns aushelfen. Sie müsste jetzt jede Minute eintreffen.«
Florence setzte sich auf und schaute sich im Diner um, falls die Dame schon eingetroffen war und sie sich irgendwie verpasst hatten. Und dann sah sie ihn. Einen Mann mit fettigem braunem Haar und einem distinguierten kleinen Schnurrbart.
Einen Moment lang saß sie wie erstarrt da. Dann gab sie ihrer Mutter einen Rippenstoß. Wie hatte er sie gefunden? Es spielte keine Rolle. Alle ihre Gedanken drehten sich nur noch darum, was jemand wie er Menschen wie ihnen antun könnte.
Florence schaute erneut flüchtig zu dem Mann hinüber. Vielleicht war es nicht Mr. Maylone. Vielleicht aber doch. Es könnte jeder der Männer sein, den ihre Mutter über die Jahre übers Ohr gehauen hatte. Welche Rolle spielte es da, ob es der Letzte in der Reihe war?
»Schau nicht in seine Richtung«, flüsterte Florence. »Sonst erkennt er dich.«
»Oh nein«, sagte ihre Mutter und wandte sich wieder dem freundlichen Mann zu. »Es tut mir sehr leid, Mr. Muller, aber wir müssen jetzt gehen.«
»Stecken Sie in Schwierigkeiten?«
Florences Mutter nickte.
»Wohin wollen Sie? Ich dachte, Sie hätten vor, auf Ihre Freundin zu warten.«
»Ich weiß nicht«, sagte Betty. »Aber wir müssen jetzt sofort hier weg.«
»Lass uns doch mit ihm fahren, Mama«, sagte Florence.
»Wir können nicht einfach mit ihm mitfahren. Es ist zu weit. Außerdem hat er es nicht angeboten. Es ist unhöflich, sich selbst einzuladen. Wir werden schon jemanden finden.«
»Ich biete es an«, sagte Floyd. »Wenn Sie jetzt sofort fahren müssen, dann biete ich es Ihnen an.«
»Dort oben findet er uns nie, Mama«, erklärte Florence ihrer Mutter, in der Hoffnung, das wäre ein überzeugendes Argument. »Niemand findet uns da.«
Die Fahrt den Highway 61 hoch schien ewig zu dauern. Zunächst fuhren sie in den Lärm und Dreck von St. Paul hinein und wieder hinaus und dann vorbei an den beruhigenden Farmen und durch die Wälder des Nordens. Florence las die Schilder der Städte mit Namen wie White Bear Lake, North Branch, Beroun, Hinckley und Sandstone. Florence war in St. Paul geboren, in dem Haus an der Grand Avenue, das einst das Zuhause ihrer Großmutter Julia Winthrop Miller gewesen war. Doch noch vor Ende des Tages würde sie weiter von ihrem Geburtsort weg sein, als sie es je gewesen war.
Florence saß auf dem Rücksitz und schaute aus dem Fenster auf die endlos vielen Bäume, die merkwürdigen Sumpfgebiete, die großen Seen und die kleinen und kleiner werdenden Dörfer, die sich wie Geheimnisse entlang der nimmermüden, sich ausdehnenden Wildnis verbargen. Doch die Erwachsenen vorne verpassten mal wieder alles. Sie unterhielten sich und witzelten über Dinge, die zu traurig schienen, um lustig zu sein, doch ihre Mutter lachte wirklich herzhaft. Es war schön zu hören.
Betty schien sich in Floyds Gesellschaft so wohlzufühlen, wie Florence es schon seit Jahren nicht mehr bei ihr gesehen hatte. Anders als andere Männer war Floyd in Bettys Gegenwart weder schmeichlerisch noch nervös. Er berührte Betty nie, erwähnte nie ihr Aussehen oder schien sonst irgendetwas zu sagen, um sie zu beeindrucken. Florence vermutete, jemand wie er sei mit dem Ausdruck »Gentleman« gemeint. Bald fragte Betty ihn, ob er wüsste, ob die Majestic Lodge Mitarbeiterinnen suche. Sie beschrieb es als einen Traumjob für ein Mädchen wie sie. Das war der Punkt, an dem Florence den Verdacht hegte, ihre Mutter würde Floyd mögen. Betty nannte sich selbst nur dann Mädchen, wenn Jugendlichkeit ein nützliches Attribut war.
»Traumjob?«, fragte Floyd. »Ich werde niemandem seinen Traumjob vermasseln, aber ich kenne einen Laden, der besser bezahlt. Einen Dollar fünfzig mehr pro Woche.«
»Einen Dollar fünfzig?« Florence tat nicht nur so, als wäre sie beeindruckt. »Wo?«
Florence hoffte, dass das Lokal, das er nennen würde, ruhig war und sauber, wie eine Bibliothek oder ein kleines Museum am Straßenrand. Sie betete, dass es nicht nur irgendein schäbiges Restaurant war. Die einzige Arbeit, die sie in ihrem Alter in einem Restaurant machen durfte, war, Tische abzuräumen und das Geschirr zu spülen. Und selbst wenn dabei auch etwas zu essen für sie abfiel, bedeutete es auch, dass sie mit der endlosen Reihe an halb geleerten Tellern oder kaum angerührten Speisen konfrontiert war, die Gäste wegwarfen. Die Menge an Nahrungsmitteln, die andere Menschen hemmungslos verschwendeten, war so deprimierend, dass es beinahe nicht auszuhalten war.
»Mein Restaurant«, sagte er. »Ich könnte noch ein Paar Hände gebrauchen. Vielleicht auch zwei Paar Hände.«
Floyd warf einen Blick nach hinten auf Florence, die darauf achtete, nicht zu lächeln.
»Oder auch nur ein Paar Hände«, sagte Floyd. »Entschuldige, Florence. Ich sollte nicht für andere Menschen sprechen.«
»Also, ich bin dabei«, sagte Betty. »Für was auch immer Sie mich brauchen. Ich bin mir für keinen Job zu schade.«
»Und wo werden wir wohnen?«, fragte Florence. Das war dreist, das wusste sie, doch einer der wenigen Vorteile, die man als Kind hatte, war die Freiheit, direkte Fragen zu stellen, und das war ein Privileg, das sie so lange auszunutzen gedachte wie möglich.
Bettys Kopf fuhr herum, und sie starrte ihre Tochter wütend an. »Florence Jean!«, blaffte sie und wandte sich dann mit strahlendem Gesicht wieder Floyd zu. »Ich entschuldige mich für meine Tochter. Sie können uns bei irgendeinem Motel absetzen, was auf Ihrem Weg liegt.«
Bei dem Wort »Motel« gab sich Florence keiner Illusion hin. Das war alles nur Schau. Nachdem Floyd sie abgesetzt hatte, würden sie sehr wahrscheinlich wieder weggehen und sich einen billigen Zeltplatz suchen oder in einer Bushaltestelle schlafen.
»Ist schon in Ordnung«, sagte Floyd. »Wir haben ein paar Hütten für Gäste auf unserem Gelände, und wenn eine davon frei ist, können Sie dort kostenlos einige Tage unterkommen, wenn Sie möchten, bis Sie etwas Besseres finden.«
Ihre Mutter schien gleichermaßen verwirrt und entzückt zu sein. Es war zu schön, um wahr zu sein, und das machte sie beide nervös. Betty bedankte sich bei Floyd und drehte sich dann zu ihrer Tochter um. »Sag Danke, Florence.«
Florence hütete sich, irgendwem im Vorfeld für etwas zu danken. Sie starrte aus dem Fenster auf so hohe Bäume, wie sie sie noch nie zuvor gesehen hatte, auf die endlose Zahl wunderschöner Bäume, während die wiederholte Aufforderung ihrer Mutter zunächst an Lautstärke zunahm, dann an Schrille und dann aufgab.
DREI
Ned, 1980 – 1981
Als Kind war das Jorby’s Neds Lieblingsrestaurant gewesen. Man bekam den ganzen Tag ein Frühstück, es besaß einen sich drehenden Pie-Turm, unendlich viele Getränke und eine Speisekarte, die so lang und fabelhaft war, dass Ned nie müde wurde, dort zu essen. Was er auch tat, zumindest fünfmal pro Woche, während der ersten vierundzwanzig Jahre seines Lebens. Kostenlos.
1921 eröffneten Neds Großeltern Eddie und Norma Prager – mit vier Säcken Gold Medal Mehl, einem Nudelholz und einem Traum – in Red Wing, Minnesota, an einer ungepflasterten Straße namens Constitutional Route 3 das ursprüngliche Jorby’s Bakery and Café. Innerhalb eines Jahrzehnts wurde die CR3 Teil des Interstate Highways 61, und das Jorby’s wurde sein beliebtester Rastplatz für Autofahrer im südlichen Minnesota.
Es war ein klassisches amerikanisches Familienrestaurant, wo alle so kommen konnten, wie sie waren, wo das Personal die Stammgäste kannte und die großzügigen Portionen einem beim Bezahlen das Gefühl gaben, man hätte dafür einen echten Gegenwert erhalten. Als Neds Vater, Edward Prager, das Jorby’s1965 von Eddie und Norma erbte, musste er mitansehen, wie sich Franchiseunternehmen von außerhalb wie McDonalds und Howard Johnson’sin Minnesota ausbreiteten, und war der Ansicht, Jorby’s müsse sich den Mittleren Westen für seine Familienrestaurants sichern, bevor jemand von außerhalb es tat.
Innerhalb eines Jahrzehnts gab es zu beiden Seiten des Mississippis landauf, landab überall Jorby’s, in rückständigen Farmer-Kleinstädten und in aufblühenden Vorstädten. Einige nannten es Gleichschaltung. Andere nannten es neoliberale Wirtschaft. Die Wahrheit lag irgendwo dazwischen. Egal, ob es einem gefiel oder nicht, eröffnete ein Jorby’s in der Stadt und drängte familiengeführte Lokale aus dem Geschäft, unabhängig davon, ob sie nun mies oder großartig waren. Einige ehemalige Familienbetriebe hatten Glück und wurden zu Jorby’s. Am Ende waren unzählige Familienrestaurants pleite und ein einzelner Mann häufte ein unerhörtes Vermögen an.
Ned konnte nie sagen, ob es Glück gewesen war oder weise Voraussicht oder die Tatsache, dass sein Vater ein reicher, charismatischer Misanthrop war, der nie ein Nein als Antwort akzeptierte. So ein Mensch war Ned nicht, doch das spielte keine Rolle. Bei solch immensen Profiten könnte die Zukunft für jeden gerechter sein, fand er, besonders für die Angestellten. Musste sie einfach sein. Neds Mutter Ellen, die in einem Jorby’s als Assistentin der Restaurantleitung arbeitete, als sie Edward kennenlernte, war seiner Meinung. Beide hielten nichts von den Kompromissen in Edwards Strategie. Die Pies wurden nicht länger frisch vor Ort gebacken. Der Kaffee war wässriger. Die Portionen wurden kleiner. Die Gehälter stagnierten. Die Moral, Kompetenz und Loyalität ihres Koch- und Bedienungspersonals ließ nach. So konnte es nicht weitergehen.
Doch genau das tat es. 1980 gab es einundneunzig Jorby’s, verteilt über zehn Bundesstaaten, mit Plänen für ein Dutzend weitere. Eines Tages würden sie alle Ned gehören, und vielleicht könnte dann diese Lawine an rücksichtslosem Wachstum und Veränderung aufgehalten oder zumindest überdacht werden. Alles, was er bis dahin tun musste, war Zeit zu investieren.
Das war für Ned der leichte Teil. Es gab nach wie vor keinen Ort auf der Welt, an dem er lieber wäre. Der schwierige Teil war es, Geschäftsführer der neuen Filiale in Minneapolis zu sein. Sein Vater hatte ihm versprochen, ihn zum stellvertretenden Direktor der ganzen Kette zu machen, wenn er es schaffte, den Standort drei Monate hintereinander profitabel zu machen, oder ein volles Jahr durchhielt – was immer zuerst eintraf. Ned war dankbar, denn er kannte keinen aus seinem Jahrgang an der University of Minnesota, der mit vierundzwanzig bereits in der Führungsriege war.
Aber Ned wusste natürlich auch, dass er irgendwann jemanden finden musste, mit dem er diese Zukunft teilen konnte. Über die Jahre war er mit ein paar wundervollen intelligenten jungen Frauen ausgegangen, aber jeder von ihnen schien etwas Wichtiges zu fehlen. Er wusste nicht genau, was es war, bis es ihm eines kalten Minnesota-Morgens im Dezember 1980 beim Farmers-Bounty-Frühstück über den Weg lief.
Er saß mit seiner jüngeren Schwester Carla in der riesigen Eck-Sitznische im Jorby’s in Minnesota. Ned hatte sich ausgemalt, dass Carla später, wenn er den Familienbetrieb leitete, seine rechte Hand werden könnte, und als sie für die Weihnachtsferien vom College nach Hause kam, teilte er ihr mit, welchen Weg sie einschlagen sollte.
»Also, Dad und ich haben uns Folgendes gedacht«, sagte er. »Du solltest Jura studieren und dich dann hocharbeiten, um unsere Firmenanwältin zu werden. Du würdest mein Consigliere werden wie Tom Hagen in Der Pate. Wäre das nicht cool?«
»Ne, gar nicht«, sagte Carla. »Wenn ich Anwältin werde, dann eine von der Sorte, die nachts durch die Straßen geht und Vergewaltigern ins Gesicht schießt.«
Gott, er liebte sie. Sie war der erbittertste Mensch, den er je kennengelernt hatte, mehr noch als sein Vater, und sie würde fantastisch darin sein, Selbstjustiz zu üben, aber dann würde er sie kaum noch zu Gesicht bekommen. »Ich dachte eher an so etwas wie Unternehmensfinanzen.«
Carla lehnte sich in der Sitznische zurück, verschränkte die Arme und schnalzte verächtlich mit den Lippen. »Macht keinen Spaß. Wie wäre es damit, ein Jorby’s zu leiten, so wie du? Das will ich.«
Carla war vermutlich der einzige Mensch auf Erden, der Jorby’s noch mehr liebte als er. Sie war auch intelligenter als er, war besser organisiert und hatte ein geschickteres Händchen fürs Geschäft. Doch sie war die Zweitgeborene, und ihr Vater war ein altmodischer Frauenfeind. Der Familienbetrieb würde eines Tages in Neds Hände gelegt werden. Etwas anderes war undenkbar. Wenn Ned irgendwann einen Sohn bekäme, würde er Jorby’s erben. Was aus Carla werden sollte, war seit ihrer Geburt das Familiendilemma.
»Ein Jorby’s zu leiten ist übrigens kein Spaß. Das ist echt schwer.«
Carla sah sich im Restaurant um. Eigentlich war Frühstückszeit, doch das Lokal war gähnend leer. »Mit den – was – eins, zwei, drei Gästen kann das so schwer nicht sein«, sagte sie und zeigte auf jeden Einzelnen von ihnen. »Unternimmst du hier in der Gegend eigentlich irgendwas, Marketing oder Werbung, um mehr Leute durch die Tür zu bekommen?«
»Noch nicht.« Die Wahrheit war, dass man Jorby’s hier als feindlichen Eindringling ansah, und das war nicht ganz falsch. Ein paar Tage zuvor war ein großer dicker Mann in einem braunen Anzug hereingekommen, hatte Ned von oben bis unten gemustert, den Kopf geschüttelt und gesagt: »Scheiß Gentrifizierungsarschloch.«
»Vermutlich bin ich das«, hatte Ned geantwortet. »Und ich bin außerdem konfliktscheu.«
»Reicher weißer Nerd«, hatte er am nächsten Tag eine Frau sagen hören.
»Wow, einen Nerd