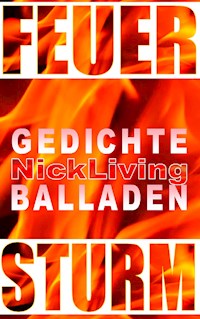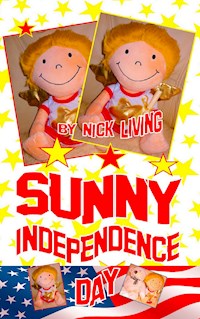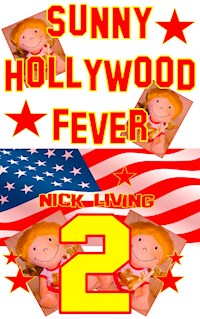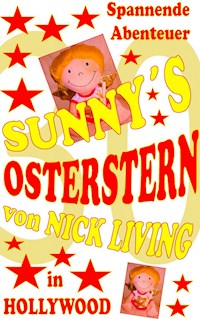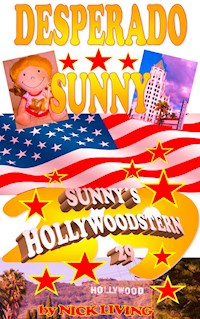Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Geister in San Diego? Möglich ist das schon. Wieder sind es die unfassbaren, schier unglaublichen Begebenheiten, die in diesem Werk dargestellt werden. Das, was wir sonst nicht sehen, nicht wahrhaben wollen, vielleicht nicht verstehen können, wird ans Licht geholt. Es sind Episoden aus dem Leben, aus dem ganz normalen Alltag, welche dann doch nicht mehr so ganz normal erscheinen mögen. Dabei kommt es gar nicht darauf an, etwas Unnormales zu entdecken. Vielmehr ist es ein Fingerzeig auf jene Dinge, die unser Leben bestimmen, es bereichern und eben doch alltäglich sind, auch, wenn sie gespenstische Züge haben mögen. Am Ende sind sie dann doch immer wieder ein Spiegel unserer Zeit und unseres eigenen Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Der König von San Diego
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Die Fahrt nach San Diego
San Diego Ghost
Der König von San Diego
Wieder war es soweit, der kleine Sunny aus Hollywood fuhr mit seiner Mami nach San Diego, weil die Großmutter Geburtstag hatte. Die beiden wollten einen Geburtstagskranz auf das Grab der Großmutter legen und ein wenig bei ihr verweilen. Darauf hatte sich Sunny schon seit Tagen gefreut. Er hatte seine Großmutter so lieb und war damals so traurig, als sie starb. Er erinnerte sich so gern an die schöne Zeit, als sie noch lebte und so gern wäre er viel öfter in dieser wunderschönen Stadt. Aber er lebte ja in Hollywood, und das war schließlich die Stadt der Träume. Und vielleicht fiel ihm ja noch etwas anderes ein, um öfter in San Diego sein zu können. So fuhren die beiden über den großen breiten Freeway nach San Diego und Sunny legte mit Tränen in den Augen einen herrlichen Blumenkranz auf Großmutters Grab. Dabei war ihm, als sei sie in diesen Minuten ganz nah bei ihm. Er konnte es sich nicht erklären, aber er kannte dieses Gefühl sehr genau. Denn es war das gleiche Gefühl, welches er immer hatte, wenn sein lieber Papa bei ihm war. Lange saßen er und seine Mami noch neben der kleinen Grabstelle und erinnerten sich an all die vielen schönen Erlebnisse, die sie damals mit der Großmutter hatten. Schließlich liefen sie wieder an der kleinen Bar vorüber, in welcher die Großmutter so oft war. Davor stand ein Mann, der ein sonderbares Königskostüm trug. Niemand nahm Notiz von ihm und er stand nur einfach da und schaute traurig auf das weite Meer hinaus. Der kleine Sunny stellte sich neben ihn, und als die Mami ihn ermahnte, doch weiter zu laufen, sprach er den vermeintlichen König an: „Sag mal, bist Du wirklich ein richtiger König?“ Dabei schaute er den verkleideten Mann mit großen Augen an und wartete gespannt auf eine Antwort. Doch es kam keine, der Mann starrte nur immer schweigend aufs Meer hinaus und die Mami zog Sunny schließlich am Ärmel.
Sunny blieb nichts weiter übrig, als weiter zu laufen, doch er musste andauernd an den traurigen König denken. Immer wieder drehte er sich nach ihm um und entdeckte plötzlich, dass der sich doch nach ihm umschaute. Freudestrahlend winkte ihm Sunny zu, und als der zurückwinkte, riss sich Sunny von seiner Mami los und rannte noch einmal zu ihm zurück. Die Mami hatte aufgegeben, ihren kleinen Sohn erneut zu ermahnen, setzte sich auf eine Bank in der Sonne und schloss ein wenig die Augen. Unterdessen stand Sunny wieder bei dem fremden Mann und wollte mit ihm sprechen. „Seit wann stehen Sie denn hier?“, fragte er den Fremden. Der vermeintliche König schaute Sunny an und antwortete: „Schon seit heute Morgen. Ich warte auf Leute wie Dich, damit ich sie aufheitern kann.“. Sunny musste tatsächlich lachen, aber nicht über das bunte Königskostüm des Fremden, sondern über dessen Erklärung. Immerhin hatte der ja selbst so traurig geschaut und Sunny konnte gar nicht glauben, dass er zur Aufheiterung der Leute vor der kleinen Bar stand. „Das stimmt ja gar nicht!“, sagte er frech, „Du hast ja gar nicht gelacht, sondern ganz traurig geguckt. Ich hab´s genau gesehen!“ Der Fremde, der sich ertappt fühlte, meinte mit hängendem Kopf, dass er arbeitslos sei und eigentlich auch gar nichts zu lachen hätte. Außerdem hatte man ihm aufgetragen, an dieser Stelle die Leute zu animieren, um in die Bar zu kommen. Wenn er es nicht täte, dann würde man ihm nichts mehr zahlen und er würde wohl oder übel irgendwann verhungern. Sunny tat das sehr leid, doch er sagte: „Dann solltest Du aber auch wirklich lachen, sonst kommt ja eh keiner.“ Der Fremde sah das natürlich ein und rückte umständlich seine viel zu weiten Königskleider zurecht. Dann stellte er sich kerzengerade vor Sunny auf und versuchte, zu lachen. Doch es gelang ihm einfach nicht. Stattdessen liefen ihm dicke Tränen übers Gesicht. Sunny konnte sich das alles nicht mehr länger mit ansehen. Und nachdem er einen verstohlenen Blick zu seiner Mami auf der Bank warf und feststellte, dass die noch immer die warme Sonne genoss, rief er: „Dann muss ich Dir eben helfen! Komm, gib mir mal die Königskrone und den bestickten Umhang. Ich zeig Dir, wie man das macht! Ach so … mein Name ist übrigens Sunny!“ Der Fremde stellte sich ebenfalls vor, meinte, dass er Clark hieße, nahm schleunigst die Krone vom Kopf und setzte sie Sunny auf. Dann warf er ihm den bunten Umhang über die Schulter und stellte fest, dass der einfach viel zu lang war. Sunny aber war das vollkommen egal. Zu allem entschlossen zog er den langen Umhang hinter sich her und kehrte damit offensichtlich den schmalen Eingansbereich vor der kleinen Bar sauber. Dabei musste er so herzhaft lachen, dass ein Passant in einem vornehmen Anzug stehen blieb und den kleinen Jungen fragte, warum er so fröhlich sei.
Sunny schaute dem Mann mitten ins Gesicht und meinte dann ungerührt: „Sieht man das nicht? Ich bin der König von San Diego und das Haus hinter mir ist meine Bar. Wenn Sie Lust haben, dann kommen Sie doch mal rein. Hier treffen sich all die Leute, die gerne lachen!“ Der Mann staunte und musste dann ebenfalls laut lachen. Doch dann meinte er, dass er den König von San Diego noch gar nicht kannte. Er wollte ihn näher kennenlernen und fand es einfach großartig, dass dieser vermeintliche König noch so klein war.
So einen König hatte er wirklich noch nie gesehen. Außerdem fand er diese Idee einfach großartig … ein König in San Diego … warum eigentlich nicht? Clark stand hinter der Häuserecke und beobachtete neugierig das schier unglaubliche Geschehen. Hatte er es in den ganzen vergangenen Tagen nicht ein einziges Mal fertiggebracht, die Leute zu animieren, schaffte es dieser kleine kecke Junge innerhalb von wenigen Minuten, die Leute auf sich aufmerksam zu machen! Sunny, der alle Hände voll mit seinem viel zu langen Umhang zu tun hatte, stellte sich dem gut gekleideten Mann vor und meinte, dass er eigentlich aus Hollywood käme. Da stellte sich auch der Mann vor und sagte: „Ich bin kein König, aber der Bürgermeister dieser schönen Stadt, und wenn Du willst, dann machen wir Dich tatsächlich zum König! Das wäre wirklich eine wunderbare Attraktion!“ Sunny stutzte, wäre am liebsten im tiefsten Keller verschwunden und hätte sich dort irgendwo in einer dunklen Ecke versteckt.
Denn das ausgerechnet der Bürgermeister von San Diego vor ihm stand und ihn in dieser Maskerade sah, war ihm absolut nicht recht. Er musste dringend aus dieser verrückten Nummer raus und erzählte dem Bürgermeister, dass er mit seiner Mami oft nach San Diego käme, weil hier das Grab seiner lieben Großmutter sei.
Und der Bürgermeister hörte sich alles an und freute sich, dass dieser kleine Junge so aufmerksam war. Er winkte Sunnys Mami, die noch immer auf der Bank saß, zu und lud Sunny mitsamt seinem Königskostüm zu einem kleinen Fest am Nachmittag ein. Er brauchte dazu nur wieder hierher zu dieser kleinen Bar zu kommen, dann würde er schon sehen … Sunny freute sich natürlich riesig, konnte allerdings nicht versprechen, ob auch seine Mami damit einverstanden war.
Der Bürgermeister aber war sich ganz sicher, dass Sunny kommen würde, und verabschiedete sich von ihm. Sunny suchte nach Clark, von dem er das Kostüm hatte, und fand ihn schließlich in der kleinen Bar. Er bat Clark, dass er ihm das Kostüm für einen Nachmittag überließ.
Er würde es nach der Feier selbstverständlich zurückgeben. Clark war einverstanden, wenngleich er nicht so genau wusste, ob er da noch wach war. Denn der Whisky schien ihm wohl ziemlich gut zu schmecken … So schnell er konnte lief Sunny zu seiner Mami und erzählte ihr von dem Bürgermeister und der Einladung. Die Mami war einverstanden und meinte, dass sie dann eben abends wieder heimfahren würden, wenn die Feier vorüber sei. Sunny freute sich schon riesig auf den Nachmittag. Bis es soweit war, spazierten die beiden am Hafen entlang und aßen ein riesengroßes wohlschmeckendes Erdbeereis. Am Nachmittag liefen sie zur kleinen Bar zurück.
Sunny war ganz aufgeregt und schon von Weitem sah er die aufgebaute Bühne vor der Bar. Dutzende Menschen waren gekommen und der Bürgermeister stand auf der Bühne und winkte Sunny freudestrahlend zu. Er rief den kleinen Jungen sogleich nach oben und bat ihn, die Königskleider anzulegen. Sunny, der die Sachen in einem Beutel bei sich trug, kramte sie heraus und zog sich schnell hinter einem großen Paravent um. Als er sich wieder zeigte, waren unzählige bunte Scheinwerfer auf ihn gerichtet. Der Bürgermeister klatschte laut in die Hände und da applaudierten auch all die vielen Leute, die vor der Bühne standen. Auch Clark war darunter und hatte Tränen in seinen Augen. Dass ausgerechnet sein bescheidenes Königskostüm einen solchen Erfolg hatte, konnte er einfach nicht fassen. Der Bürgermeister drückte Sunny die Hand und sprach dann ins Mikrofon: „Leute von San Diego, ab heute haben wir einen König! Es ist Sunny, der König von San Diego! Er wird mich, wenn er Zeit hat, bei meinen Amtsgeschäften unterstützen und die Gäste durch unsere Stadt führen. Seine Großmutter hatte einst hier gelebt und somit ist Sunny ja auch irgendwie mit San Diego verbunden. Also, während der Festlichkeiten am Hafen könnt Ihr alle mit dem neuen König sprechen.“. Sunny war so gerührt, dass er sich andauernd die Tränen aus den Augen wischen musste. Doch dann sah er Clark, der schweigend in der Menschenmenge stand. Er sah all die vielen Leute, die ihm zujubelten und fand das alles plötzlich gar nicht mehr so lustig, Er trat ans Mikrofon und sprach leise: „Danke für diesen Applaus. Aber ich kann ja gar nicht immer bei Euch sein, denn ich komme ja aus Hollywood. Und da bin ich viel zu selten in Eurer wunderschönen Stadt. Aber während ich nicht da sein kann, überlasse ich meine Königsgeschäfte jemandem, der immer am Ort ist … mein Freund Clark! Begrüßt ihn und lernt ihn kennen! Er ist genau der richtige für diesen Job!“ Damit winkte er Clark zu sich auf die Bühne. Vor den Augen der Menschen zog er sein Königskostüm aus und setzte Clark letztendlich die Krone auf den Kopf. Der wusste gar nicht, wie ihm geschah. Plötzlich wurde er von so vielen Menschen angeschaut und beachtet. Das hätte er sich nie ihm Leben träumen lassen. Er war nicht mehr arm und arbeitslos – er war nun König von San Diego – welch ein Wunder! Der Bürgermeister verstand Sunny natürlich und wünschte Clark ganz viel Erfolg bei seiner neuen Arbeit. Clark war überglücklich, denn nun hatte er endlich wieder eine Aufgabe. Er war König und unterstützte den Bürgermeister bei dessen wichtiger Arbeit, wie er nur konnte. Sunny umarmte Clark und wünschte ihm viel Glück. Dann verließ er die Bühne und der Bürgermeister schaute ihm traurig nach. Solch einen aufgeweckten mutigen Jungen hatte er wirklich noch nie gesehen. Sunny ging zu seiner lieben Mami, die in der Menschenmenge wartete, und drückte sie ganz fest. Dann winkte er den Leuten noch einmal zu und Clark schaute weinend dem kleinen Jungen hinterher, als dieser mit seiner Mami den Platz vor der kleinen Bar verließ. Als die beiden schließlich den langen Weg zurück nach Hollywood antraten, schaute Sunny noch einmal zurück. Zwischen den Bäumen, unterhalb des Highways entdeckte er für einen kurzen Moment die Großmutter, die ihm lächelnd zuwinkte. Und Tage später erfuhr er, dass der Urahn der Großmutter einst selbst König war:
König in San Diego!
1.
Seit kurzer Zeit lebte Tim auf dem Lande. Er hatte ein kleines Häuschen von seinen Großeltern geerbt und fühlte sich dort pudelwohl. Leider gab es nur einen Nachteil, den er im Moment jedoch leider nicht abstellen konnte. Um frisches Wasser zu bekommen, musste er zu einer nahen Quelle laufen. Dort sprudelte frisches kaltes Wasser. Beinahe täglich ging Tim dorthin und war glücklich, dass es diese Quelle gab. Im Keller des alten Häuschens entdeckte er einen großen steinernen Krug. Er fand, dass sich dieses Gefäß hervorragend eignete, um das Wasser von der Quelle ins Haus zu transportieren. Die Eimer, die er besaß, waren zu klein und er musste zu oft gehen. Mittlerweile war es Sommer geworden und die Hitze drückte gnadenlos vom Himmel herab. Jeden Tag musste er mehrmals mit dem großen Krug zu der kleinen Quelle laufen, um Wasser zu holen. Auch an einem brütend heißen Sonntag war das wieder so. Das Wasser, welches Tim am Vorabend geholt hatte, ging schnell zu Ende. Schon am Morgen musste er wieder zur Quelle. Er füllte den großen Krug und tapste über die große Wiese zurück zu seinem Haus. Es war wirklich unerträglich heiß und Tim schwitzte, wie lange nicht mehr. Doch es half nichts, der Krug musste zum Haus gebracht werden.
Plötzlich jedoch schwankte der Krug und entwickelte eine Art Eigenleben. Er ruckelte und zuckte, vibrierte und sprang in seinen Händen hin und her. Tim versuchte, ihn festzuhalten. Doch es gelang ihm nicht – er entglitt ihm schließlich und fiel ins Gras. Sämtliches Wasser floss aus ihm heraus und Tim musste wohl oder übel noch einmal los laufen, um den Krug zu befüllen. Bis unter den Rand ließ er das klare Wasser hinein plätschern. Dann nahm er den Krug fest in beide Hände und schleppte ihn über die Wiese. Mittlerweile war er derart ins Schwitzen gekommen, dass es ihm schon übel wurde.
Er hatte Angst, einen Sonnenstich zu bekommen. Doch der Krug musste heim! Aber es geschah genauso, wie eben. Mitten auf der Wiese begann der Krug in seinen Händen zu vibrieren und riss sich regelrecht von ihm los. Tim hatte den Eindruck, der Krug wollte nicht bei ihm bleiben. Irgendeine Kraft riss ihn Tim aus den Händen. Erneut fiel er auf die Wiese und alles Wasser ergoss sich über die Pflanzen und versiegte schließlich schnell in der ausgetrockneten Erde. Tim konnte sein Pech nicht verstehen, hielt er doch den Krug so wie immer in den Händen … fest und sicher. Das eigenartige Vibrieren und Rucken konnte er sich einfach nicht erklären. Vielleicht lag das ja an der starken Hitze, dass er plötzlich schwach wurde und den Krug losließ? Da er jedoch dringend das Wasser brauchte, musste er noch einmal zu der Quelle gehen. Wieder ließ er den Krug mit Wasser volllaufen. Und wieder trug er ihn über die Wiese. Und wieder vibrierte es unerträglich in seinen Händen und Tim konnte den Krug nicht mehr halten. Der Krug fiel auf die Wiese und prallte dabei auf einen harten Stein. Laut scheppernd zerbrach er und Tim starrte auf die zahllosen Scherben im Gras. Womit sollte er nun Wasser holen? Vielleicht mit all seinen Eimern … er musste sie schnellstens holen. Als er so nachdachte, sah er eine kleine Maus durchs Gras hüpfen. Sie labte sich an einem Rest Wasser, welches sich in einer Scherbe des zerborstenen Kruges befand. Tim beobachtete das kleine Mäuschen und blieb ganz ruhig stehen, um es nicht zu erschrecken. Doch plötzlich torkelte die Maus und fiel leblos um. Tim erschrak sich fürchterlich. Was war mit der kleinen Maus nur geschehen? Sie hatte doch nur. Ein furchtbarer Gedanke schoss ihm durch den Kopf … sollte das Wasser etwa. Er entschloss sich, ins Dorf zu fahren, um dort seine Beobachtung zu schildern. Die tote Maus wickelte er vorsichtig in ein Taschentuch und nahm sie mit. Es stellte sich heraus, dass das Quellwasser vergiftet war. Ein nicht weit entfernter Chemiebetrieb hatte eine Havarie. Größere Mengen giftiger Chemikalien sind dabei in den Erdboden gelangt und bis zur Wasserader der Quelle gesickert. Die Quelle wurde sofort gesperrt und gesichert. Glücklicherweise kam niemand zu schaden. Doch wäre Tim der Krug nicht aus den Händen gefallen … nicht auszudenken, wenn er von dem vergifteten Wasser getrunken hätte.
Schon nach wenigen Tagen erhielt er seinen Wasseranschluss. Bis dahin trank er Mineralwasser aus dem Supermarkt. Als er eines Tages in den Keller ging, um einen Wasserschlauch an einen seiner neuen Wasserhähne anzuschließen, wunderte er sich sehr. In der Ecke stand sein alter Krug. Und er war nicht zerbrochen und hatte auch keine Risse …
2.
Stacey und Jody waren eng befreundet. Sie waren noch sehr jung und unternahmen sehr viel miteinander. Doch am tollsten fanden sie es, abends über den Friedhof spazieren zu gehen. Es war zugegebenermaßen ein recht ungewöhnliches Hobby, welchem sie sich verschrieben hatten. Doch sie hatten mit dem alten Friedhofsverwalter abgesprochen, wenn auf einem Grab die Blumen oder Einpflanzungen nicht ganz in Ordnung waren, diese wieder anständig auf die Gräber zu stellen. Auch an jenem düsteren Novemberabend des Jahres 1995 trieben sich die beiden Mädchen mal wieder stundenlang auf dem Friedhof herum.
Eigentlich war ihnen nicht sehr wohl zumute, doch sie hatten eine Menge Spaß, als sie sich über die neuesten Erlebnisse mit den Jungs aus ihrer Clique unterhielten. Es wurde immer dunkler und die beiden hatten sich so richtig verquatscht. Erst als die Uhr auf dem Gebäude der Friedhofsverwaltung schlug, schauten sie erschrocken auf ihre Armbanduhren. Es war bereits zwanzig Uhr und sie mussten dringend ins Wohnheim ihrer Universität. Gespenstisch pfiff der Wind um die alten Grabsteine und verfing sich im morschen Geäst der umstehenden Eichen. Die Geräusche, die sie plötzlich hörten, versetzten sie in Angst und Schrecken. Es knisterte und knackte ganz in ihrer Nähe. Noch nie waren sie so lange auf dem Friedhof unterwegs. Sie liefen los und durchquerten das Gelände.
Allerdings mussten sie durch ein Areal des Friedhofs, welches etwas abseits lag und schlecht einsehbar war. Dort standen die ältesten Grabsteine und manches Grab wurde seit Jahren nicht mehr gepflegt. Die beiden Mädchen wussten genau, was ihnen bevorstand, denn nur ungern gingen sie durch diese alten Grabstellen. Sie hielten sich an den Händen fest, und als es schließlich auch noch zu regnen begann, hielten sie es vor Kälte und Gruseln einfach nicht mehr aus. Sie husteten schon und hatten noch immer ein gehöriges Stück Weg vor sich. Plötzlich endete der Weg. Und obwohl sie wussten, wo sie hinwollten, schien es doch nun, als ob sie sich verirrt hätten.
Sie standen zwischen den alten Grabsteinen und schauten sich ängstlich um.
Überall starrten sie die kalten steinernen Gesichter der Figuren an, die einst auf den Grabstellen befestigt wurden. Und im düsteren Licht einer einsamen hin- und herpendelnden Laterne verschwammen die Schatten dieser Figuren ganz merkwürdig und bildeten furchtbare und verzerrte monsterähnliche Silhouetten. Die Mädchen standen unschlüssig und zitternd vor der Wiese und wollten gerade wieder umkehren, um den rechten Weg zu suchen. Da bemerkten sie zwischen den alten Grabsteinen zwei rote Lichter hindurch blinken. Sie ahnten bereits, was das zu bedeuten hatte. Doch sie wollten es nicht glauben. Denn einen Teufel hatten sie noch nie gesehen. Und auf einem Friedhof schon gar nicht.
Trotzdem war ihnen die Sache nicht geheuer. Nur, wohin sollten sie fliehen? Sie wussten ja den Rückweg nicht mehr. Stacey zog ihr Handy aus der Jackentasche.
Doch es war wie verhext … das Handy hatte keinen Empfang. Und egal, wo sie sich auch postierte, nirgends bekam ihr Handy das erforderliche Netz. Und Jody trug überhaupt kein Handy bei sich. Den beiden wurde eiskalt und ihnen lief ein eiskalter Schauer über den Rücken. Denn immer wieder tauchten die beiden roten Lichter vor ihnen auf. Vollkommen verängstigt versteckten sie sich hinter einer hohen Grabstele. Stacey schaute nach oben und entdeckte einen entsetzlichen Vogel, der in Stein gehauen auf der Stele thronte. Er hatte ein böses Gesicht, doch Genaueres konnten die beiden nicht erkennen. Denn es war einfach zu dunkel.
Das düstere Licht der Laterne begann zu flackern. Die Mädchen hatten Angst, dass es verlöschen könnte. Doch sie wollten ihr Versteck nicht aufgeben. Zu groß war die Angst, dem Teufel zu begegnen. Aber so oft sie auch hinter der Stele hervorschauten, immer sahen sie die beiden roten Lichtpunkte vor sich. Sie schwebten über der Wiese, nicht weit von ihnen entfernt. Plötzlich verschwanden sie und an deren statt ertönte ein merkwürdiges Zischen. Die Mädchen zitterten vor Angst und hielten sich aneinander fest. Vermutlich war ihnen der Teufel schon dicht auf den Fersen und würde sich in Kürze brüllend auf sie stürzen. Die Laterne flackerte immer stärker und spendete kaum noch Licht. Es reichte einfach nicht aus, um zu erkennen, worum es sich bei den roten Lichtern handelte. Plötzlich vernahmen sie Stimmen und erschraken fürchterlich. Sie versteckten sich hinter einem dichten Gebüsch und hielten sich aneinander fest. Und plötzlich hörten sie jemand sprechen: „Hallo, sind Sie da? Ich weiß, dass Sie hier sind. Hallo!“ Die Mädchen glaubten schon, ihr Ende sei in greifbarer Nähe, da erkannten sie die Stimme. Es war der Friedhofsverwalter.
Er suchte wohl schon nach den beiden Mädchen. Denn sie hatten ihre Fahrräder am Friedhofsgebäude abgestellt und der Verwalter, der noch einmal ins Büro wollte, um etwas zu holen, hatte sie bemerkt. Vermutlich machte er sich Sorgen, weil er die beiden Mädchen kannte und genau wusste, dass sie noch nie so viel Zeit auf dem Friedhof verbrachten. Er kam ihnen schon entgegen und es war seine Taschenlampe, welche dieses seltsame Licht verbreitete. Der Verwalter meinte, dass er wegen eines Augenfehlers nur mit diesem rötlichen Licht etwas in der Dunkelheit erkennen konnte. Die beiden Mädchen allerdings fanden das schon sehr sonderbar. Der Verwalter begleitete sie noch bis zum Friedhofsgebäude. Dort dankten ihm die Mädchen noch einmal für die Hilfe. Ohne ihn hätten sie den Weg ganz sicher nie gefunden. Und Stacey bemerkte noch lakonisch: „Nur gut, dass wir ein Kreuz umhängen haben. Da konnte uns wenigstens der Teufel nichts anhaben.“. Der Friedhofsverwalter lächelte ganz merkwürdig und schaute den beiden Mädchen misstrauisch nach, als diese schließlich mit ihren Fahrrädern den Friedhof verließen.
Als sie fort waren, verschlechterte sich das Wetter mehr und mehr. Der Friedhofsverwalter aber zog sich seine schwarze Kapuze über den Kopf und lief langsamen Schrittes zwischen den Gräbern entlang. Dabei leuchteten seine Augen plötzlich feuerrot auf und aus seinem Mund zischte eine grelle Flamme.
Schließlich verschwand er in der großen alten Stein-Stele mit dem furchterregenden Vogel obendrauf. Man hatte ihn nie wieder gesehen …
3.
Seit vielen Jahren lebte der Fürst, Sir Heidolf schon auf seinem wunderschönen Schloss in den Bergen. Er war schon alt, doch ging er mit der Zeit und hatte sich erst kürzlich eine sündhaft teure Luxuslimousine zugelegt. Die jedoch fraß beinahe sein ganzes Vermögen auf. Über die Jahre hatte er viele Schätze in seinem alten Schloss angehäuft, die er allerdings nach und nach wieder versetzen musste.
Doch der allergrößte Schatz war ohne Zweifel seine Tochter Melanie. Sie zählte achtzehn Jahre und sollte nun verheiratet werden. Und obwohl sich die Zeiten stark verändert hatten, suchte der Fürst seit Langem einen passenden Prinzen aus einem fernen Lande, der seiner Tochter ebenbürtig sein sollte. Aber es war schwer, jemanden bei seinen zahlreichen Auslandsaufenthalten zu finden. Die Etikette verbat, dass er sich für seine Tochter auf Brautschau begab. Außerdem wollte
er es so geheim wie nur möglich angehen lassen. Eines Tages aber meldete sich ein sehr gut aussehender junger Mann im Schloss. Er gab vor, aus dem fernen Russland zu kommen und ein Prinz zu sein.
Als Sir Heidolf von ihm wissen wollte, welchem Königshaus er angehörte, zögerte der junge Mann zunächst mit seiner Antwort. Doch dann klärte er den Fürsten auf, dass er Lord Nikki von Arnulfstein sei und über ein sagenhaftes Vermögen, in Höhe von sage und schreibe 1,3 Milliarden Dollar verfügte. Dem Fürsten verschlug es beinahe die Sprache und er fand die Art und Weise, wie auch die Zurückhaltung des vermeintlichen Prinzen sehr anständig. Er wollte ihn deswegen unbedingt als seinen Nachfolger deklarieren. Außerdem wollte er seine Amtsgeschäfte und das Schloss endlich einem Erben übergeben, der auch das Anwesen wieder gehörig auf Vordermann bringen würde. Melanie jedoch, die den Prinzen bereits heimlich beobachtete, wollte ihn nicht. Sie wollte gar nicht erst mit ihrem Vater darüber sprechen, doch der Fürst ließ nicht mit sich reden. Und nachdem er sich den ganzen Tag zurückgezogen hatte, um nachzudenken, unterbreitete er am Nachmittag seiner Tochter schließlich den lang durchdachten Entschluss. Er wollte, dass Melanie diesen jungen Prinzen heiratete. Bis zur Hochzeit sollte er nun als Gast im Schlosse weilen. Ihm wurde ein gemütliches Zimmer im Westflügel des Schlosses hergerichtet, in welches er mitsamt seiner Habe, die er sich später nachschicken ließ, einzog. Doch schon eine Woche später war die sprichwörtliche Hölle los.
Aufgeregt lief das Personal durch die Gänge des Schlosses, und alle hatten nur ein einziges Thema … der Anwärter auf die Hand der Fürstentochter war tot! Man fand ihn leblos in seinem Bett liegend, und in seiner Brust steckte ein Dolch. Das fatale an der Angelegenheit aber war, dass dieser Dolch ausgerechnet dem Fürsten selbst gehörte. Er war eine Trophäe, die sich seit dreihundert Jahren von Generation zu Generation weiter vererbte. Der Fürst war vollkommen außer sich und plapperte den ganzen Morgen lang nur wirres Zeug. Als ihn schließlich Kommissar Spencer von der Kripo verhörte, redete sich der Fürst um Kopf und Kragen. Nervös und ängstlich gab er zu, dass es sich um seinen eigenen Dolch handelte und das er am Abend noch im Zimmer des jungen Prinzen war, um mit ihm zu sprechen. Bei diesem Gespräch überschrieb der Prinz dem Fürsten sogleich eine größere Geldsumme, damit die Hochzeit und alle sonstigen Auslagen beglichen werden konnten.
Zudem sollte die Fürstentochter Melanie sofort einen Betrag von mehreren Millionen Dollar erhalten, damit sie vorm Altar auch wirklich „Ja“ sagte. Da überdies das Schloss des Fürsten dringend renovierungsbedürftig war und auch schon Personal entlassen werden musste, weil das Geld ausging, hatte er nun auch ein Motiv. Spencer vermutete, dass die vermeintlichen Mühen des Fürsten, der Tochter Melanie einen Mann zu versorgen, nur einen einzigen Sinn hatten … nämlich den, einen reichen Mann zu finden, um sich dann an seinem Geld zu bedienen. Dennoch passte das alles nicht so recht zusammen. Denn es wäre ja viel zu offensichtlich, wenn sich der Fürst am Geld eines Ermordeten labte. Außerdem war die Fürstentochter noch nicht einmal mit dem Prinzen verheiratet. Es wäre doch viel besser, wenn der Geldgeber am Leben bliebe und irgendwann eines natürlichen Todes starb, während das Schloss auf Vordermann gebracht wurde.
Nein, der Tod des jungen Prinzen musste einen völlig anderen Hintergrund haben.
Hatte vielleicht Melanie selbst …? Doch warum hätte sie das tun sollen? Sie wäre ja reich verheiratet worden und würde im Falle einer Trennung auf keinen Fall verarmen. Auch diese Vermutung schob Spencer schnellstens beiseite. In diesem Schloss musste es irgendein Geheimnis geben. Als der Dolch auf Fingerspuren untersucht wurde, fanden sich keine darauf. Hatte sie der Täter bereits abgewischt? Dem Kommissar fiel jedoch eine schwarz gekleidete Zimmerfrau auf. Sie war die Einzige, die trotz des wirren Durcheinanders im Schloss schweigend durch die Gänge schlich. Sie war schon alt und ihr Gesicht zeigte tiefe Falten.
Spencer beobachtete sie genau. Doch sie schien das zu bemerken und fragte ihn: „Ich sehe, dass Sie mich immerzu beobachten. Haben Sie vielleicht schon einen bestimmten Verdacht?“ Spencer war professionell genug, um zu wissen, dass er dieser Frau die Wahrheit sagen musste.
Wenn er flunkerte oder ihr etwas vormachen wollte, würde sie es sofort bemerken. Er gab zu, dass er darüber nachdachte, wie sie zu dieser Sache stünde. Die Kammerfrau senkte den Kopf und sprach leise ein Gebet. Dann schaute sie den Kommissar nachdenklich an und sagte: „Ich muss Sie enttäuschen. Ich habe den jungen Herrn nicht erstochen. Doch ich weiß von einem Geheimnis, welches wie ein Fluch über diesem Schlosse liegt. Vor dreihundert Jahren wurde auf dem Schloss schon einmal jemand ermordet.
Es war eine Kräuterhexe, deren Name mir leider unbekannt ist. Sie lebte lange hier. Doch bevor sie auf dem Scheiterhaufen verbrannte, sprach sie einen bösen Fluch. Ihre Überreste wurden auf dem alten Friedhof, der sich einst hier befand, beerdigt. Doch wenig später wurde der Friedhof eingeebnet. Nichts sollte mehr an die alte Kräuterhexe erinnern …“.
Spencer wusste nicht so genau, ob er der alten Kammerfrau glauben sollte oder nicht. Immerhin hatte er sich schon einige skurrile Aussagen zu diesem Fall anhören müssen. Doch von einem alten Friedhof hatte bisher noch niemand gesprochen. Er ließ sich die alten Baupläne des Schlosses zeigen und stellte fest, dass es im Jahre 1703 tatsächlich eine solche Baumaßnahme gab. Außerdem war deutlich sichtbar, dass sich zuvor an dieser Stelle ein Friedhof befand. Er wollte mehr über diese seltsame Kräuterhexe erfahren. Doch die Informationen waren spärlich. Niemand wusste so genau, ob sie überhaupt gelebt hatte, geschweige ihre Gebeine einst auf dem Friedhof begraben lagen. So musste sich Spencer allein auf die Suche begeben. Er untersuchte die alten Schlossmauern und durchsuchte die alten Katakomben, die sich unter dem Schloss befanden. Lange fand er nichts, doch eines Abends entdeckte er ein altes schmiedeeisernes Kreuz, welches verrostet und teilweise von Schutt bedeckt in einer Ecke lag. Mühsam zog er es unter dem Geröll hervor und befreite es von dem darauf befindlichen Schmutz. Er fand eine Inschrift, einen Namen, der in das Metall eingearbeitet war. Doch die Schrift war einfach nicht mehr richtig zu erkennen. Mit viel Fantasie glaubte er, den Namen Lina Essex zu entziffern.
Doch ob es sich bei dieser Dame um die sagenhafte Kräuterhexe handelte, wusste er nicht. Noch einmal befragte er die Zimmerfrau. Doch die gab nochmals vor, den Namen der Hexe nicht zu wissen.
Und so nahm sich Spencer vor, selbst eine Nacht in den Katakomben zu verbringen. Zwar glaubte er eher nicht an überirdische Mächte, an Hexen und böse Zauber. Doch ein seltsames Gefühl veranlasste ihn, diese letzte Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Dazu holte er sich die Geisterseherin Liane Hartford ins Schloss. Ihr eilte der Ruf voraus, sie spürte sogar die schwächsten Erdstrahlen auf und könnte gute und bösartige Geister sehen. Miss Hartford war eine junge, sehr gut aussehende Frau, die eigentlich mitten im Leben zu stehen schien. So wunderte sich der Kommissar, dass sich diese Dame mit Zauberei und Geistern befasste. Doch Miss Hartford beruhigte ihn. Sie meinte, dass sie lediglich die Energie spürte, die von diversen Objekten ausging, mehr nicht. Sie sagte, dass zu ihrer Tätigkeit keine große Zauberei und schon gar keine übernatürliche Hexerei gehörten. Gemeinsam schritten sie die alten verwitterten Steintreppen ins Kellergewölbe hinab. In dem Raum, wo der Kommissar das eiserne Kreuz gefunden hatte, stellten sie ihre Liegestühle auf und richteten sich für die Nacht ein. Miss Hartford hatte etliche elektronische Gräte mitgebracht, die sie an den rauen Felswänden platzierte. Sie schloss die Geräte an einen merkwürdigen Oszillografen an, von dem sie meinte, er würde die Energiestrahlen messen und schließlich auch aufzeichnen. Eher misstrauisch beobachtete Spencer die Aktivitäten der Seherin.
Draußen tobte unterdessen ein heftiges Gewitter und das eindringende Regenwasser lief an den Felswänden hinunter.
Es war kalt und feucht und sehr unbehaglich. Doch die beiden harrten eisern in dieser halbdunklen Einsamkeit der Katakomben aus. Bis Mitternacht verging die Zeit recht schnell. Miss Hartford saß vor ihrem Oszillografen und wertete die Kurven aus. Schließlich drehte sie sich zu Spencer um und meinte, dass sie noch nichts bemerkt habe, was auf eine erhöhte Energie oder auf eine Geistererscheinung hindeutete. Spencer rollte mit seinen Augen und stöhnte. Sollte das Ganze vielleicht doch der falsche Weg gewesen sein? Aber wie sollte er sich sonst auf die Spuren einer Kräuterhexe begeben, bei welcher er ja nicht einmal wusste, ob es sie überhaupt gab? Gerade fielen ihm die Augen zu, da zischte plötzlich Miss Hartford: „Da … da ist was! Ich sehe es genau! Starke Energiefelder sind im Raum!“ Sie deutete mit ihrem Zeigefinger auf eine stark ausschlagende Kurve. Verständnislos beäugte sich Spencer die Kurve und sagte dann gelangweilt: „Na und … das sagt noch gar nichts.“ Doch Miss Hartford schien vollkommen aus dem Häuschen zu sein. Immer wieder deutete sie auf die heftig ausschlagende Kurve und schloss schließlich ihre Augen. Dann flüsterte sie beschwörend: „Wir müssen jetzt ganz still sein, sonst vertreiben wir sie wieder. Sie ist hier. Lina Essex … die Hexe … sie ist es … sie ist hier! Ich sehe sie genau. Sie will uns irgendetwas sagen …“. Der Kommissar hatte längst bereut, sich auf diesen Hokuspokus eingelassen zu haben. Doch er musste die Nummer jetzt durchstehen und kam da nicht mehr raus. So spielte er einfach mit und erkundigte sich nach dem Aussehen der vermeintlichen Hexe.
Doch Miss Hartford schwieg und deutete plötzlich auf die Felswand vor sich. Da flimmerte etwas und der Kommissar traute seinen eigenen Augen nicht mehr.
An der Felswand erschien eine alte Frau in langen schwarzen Kleidern und starrte die beiden schweigend an. Sie hielt etwas in der Hand. Es sah aus wie Papierbogen.
Miss Hartford näherte sich der Erscheinung und blieb in respektvollem Abstand regungslos stehen. Und selbst Kommissar Spencer starrte wie gebannt auf die Felswand. Noch immer schien er sich nicht damit abgefunden zu haben, dass es zwischen Himmel und Erde wohl doch mehr zu geben schien, als er bislang zu glauben bereit war. Kopfschüttelnd betrachtete er sich die alte Frau und studierte ihr Gesicht. Sollte das wirklich diese Kräuterhexe sein? War das Lina Essex? Er hielt es einfach nicht mehr aus und wollte der Sache auf den Grund gehen. Vorsichtig erhob er sich und wollte sich der Felswand nähern. Doch da blitzte das Bild grell auf und verschwand. Miss Hartford war entsetzt. Laut schrie sie den Kommissar an: „Sind Sie verrückt! Sie haben den Geist nun für immer verjagt und alles war für die Katz!“ Doch so ganz für die Katz schien das Ganze wohl doch nicht gewesen zu sein. Irgendetwas segelte vor der Felswand zu Boden. Miss Hartford bückte sich und hob es auf … Es waren jene Papierbogen, die die rätselhafte Frau in ihren Händen gehalten hatte. Wie war es nur möglich, dass die Bogen in die Wirklichkeit und damit in die heutige Zeit gelangten? Konnte so etwas wirklich funktionieren oder war das alles nur ein großer Spuk und sinnreich eingefädelt von dieser angeblichen Geisterseherin Miss Hartford? Auf den Bogen war ein undeutlicher und handschriftlich verfasster Text zu sehen. Doch es half nichts, diesen Text an Ort und Stelle zu entziffern. Da sich die ganze Nacht keinerlei Energieschwankungen mehr zeigten, brachen die beiden schon sehr früh am nächsten Morgen die Untersuchung ab.
Spencer bedankte sich bei Miss Hartford und ersuchte sie, Stillschweigen über das Erlebte zu wahren. Dann gab er die Textbogen zur Untersuchung ins Polizeipräsidium. Dort stellte sich heraus, dass die Papierbogen circa dreihundert Jahre alt waren. Und sie gehörten tatsächlich einer Lina Essex, die man als Kräuterhexe verbrannte. Zuvor aber war sie die Ehefrau des Fürsten von Finkenbart. Sie hatte also den alten Sir Finkenbart geehelicht, dem einst dieses Schloss gehörte. Als sie hinter die heimlichen Liebschaften des Fürsten kam, wusste sie zu viel und hätte wegen ihrer Unbefangenheit dem Fürsten gefährlich werden können. So wurde sie kurzerhand zur Kräuterhexe abgestempelt und musste fortan jahrelang ihr Dasein in den Katakomben des Schlosses fristen. Schließlich wurde sie in einer Nacht- und Nebelaktion zum Tode verurteilt. Noch vor dem Scheiterhaufen rief sie laut: „Ihr könnt mich zwar töten, doch wird mein Fluch über Euch kommen! Wenn in dreihundert Jahren ein männlicher Nachfahre meines Mörders an dieses Schloss zurückkehrt, um hier als Fürst zu leben, wird er sterben …“. Wenig später verschwand der alte Sir Finkenbart bei einer Wildschweinjagd und wurde nicht mehr gefunden. Damit hatte Spencer einen Teil des Geheimnisses gelüftet. Es gab also diese sagenhafte Lina Essex, die beim damaligen Fürsten in Ungnade fiel und umgebracht wurde. Selbst der Dolch, mit welchem der junge Prinz dreihundert Jahre später ermordet wurde, gehörte der alten Fürstin. Sie hatte sich ihn zu Verteidigungszwecken schmieden lassen. Als der Kommissar den Stammbaum des ermordeten jungen Prinzen genauer studierte, bemerkte er, dass dieser ein direkter Nachfahre des damals verschollenen Fürsten von Finkenbart war. Als er schließlich zum Schloss kam, um irgendwann die Fürstentochter Melanie zu ehelichen, erfüllte sich Linas Fluch auf grausame Weise. Denn es war Sir Finkenbart selbst, der damals den Scheiterhaufen unter seiner Noch-Ehefrau Lina Essex entzündete …
4.
Stan war ein gefragter Musiker. Jahrelang war er auf Tournee und kannte bereits die ganze Welt. Wenn er dann an seinem Klavier saß und die Tasten mit seinen empfindsamen Fingern berührte, schien es ihm, als berührte er damit seine Seele.
Als Kind hatte er immer davon geträumt, sich selbst besser kennenzulernen. Doch erst als er das Klavierspiel für sich entdeckte, wusste er, wie es möglich war, diese Tür aufzustoßen. Die Tür zu seiner Seele. Und diesen magischen Moment, wenn er den ersten Ton mit seinem Klavier erzeugte, genoss er immer wieder aufs Neue. Überall auf dieser großen weiten Welt hatte er seine Fans. Fanklubs bildeten sich und alle wollten ihn sehen, mit ihm sprechen. Er wurde in Dutzende Talkshows eingeladen, und wenn er doch einmal Zeit für sich hatte, dann las er in seinen Büchern. Doch immer seltener kam es dazu, denn wenn er erschöpft von seinen Konzerten ins Hotelzimmer kam,
wollte er nur noch schlafen. Und das möglichst lange und tief. So verwandelte sich sein Leben immer mehr in eine öffentliche Veranstaltung. Anfangs liebte er diesen Medienrummel und sonnte sich in seinem Ruhm. Doch nach Jahren ruhelosen Lebens keimte in ihm immer öfter der Wunsch, sich von der Medienwelt wieder zurückzuziehen. Leider war das kaum mehr möglich, denn er hatte zu viele Termine und er war über viele Jahre hinaus restlos ausgebucht. An jenem Abend, an welchem er wieder einmal die Stunden in einer der großen Konzerthallen dieser Welt mit seinem wundervollen Klavierspiel veredelte, spürte er, wie eine bis dahin niemals zuvor gekannte Leere in ihm aufstieg. Er fühlte einfach nichts mehr, und als er die Tasten berührte, war da keine Spannung mehr und keine Seele. Er war jedoch so professionell, dass es wohl keinem auffiel. Nur ein seltsam gekleideter alter Mann, der im Publikum saß, schien sich zu wundern. Nachdenklich saß er in der dritten Reihe und schaute zu Stan am Klavier. Und Stan schien die Blicke zu bemerken, zu spüren. Erwirkte ein wenig verunsichert und nervös. Als das Konzert beendet war, der tosende Applaus verklungen war, rannte Stan in den Saal. Vielleicht konnte er den Fremden ja noch sehen und vielleicht sogar sprechen. Doch der war, wie die meisten anderen Zuschauer längst fort.
Niedergeschlagen trottete er in seine Garderobe zurück. Sein Manager brachte ihm die unzähligen Blumensträuße, die er vor und auf der Bühne eingesammelt hatte. Er stellte sie in einen großen Sektkühler und erkundigte sich nach Stans Befinden. Als Stan lächelnd bemerkte, dass er sich großartig fühlte, ging der Manager noch einmal die Termine des nächsten Tages mit ihm durch. Schließlich verabschiedeten sich die beiden und Stan lief noch ein wenig durch die nächtliche Großstadt. Er wollte abschalten, auf andere Gedanken kommen. Er spürte diesen Geruch von Zigaretten und Bier.
Es roch nach Freiheit und nach Abenteuer. Eine gewisse Spannung lag in der Luft. Eine Spannung, die aufforderte, noch etwas Verrücktes zu erleben. Die Großstadt bot Dutzende Möglichkeiten, sich in irgendeiner Bar am Rande der Zeit die Stunden zu versüßen. Stan kannte das alles zur Genüge. Und er wollte es nicht.
Er wollte auch nicht in sein Hotelzimmer, denn dort warteten lediglich die Einsamkeit und die Eintönigkeit auf ihn. Er wollte nichts mehr von Terminen und Konzerten, die noch anstanden, wissen. Er wollte nur ganz allein für sich sein. Er wusste nicht einmal, was er wirklich wollte, schaute sich die bunten flirrenden und blinkenden Leuchtreklamen an. Junge Leute zogen durch die Straßenschluchten und suchten das Abenteuer. Von irgendwoher drang laute Musik an seine Ohren. Autosirenen vermischten sich mit der nächtlichen Geschäftigkeit der Stadt.
Über eine schmale Gasse gelangte er an einen breiten Fluss. Dort wurde es etwas ruhiger. Er atmete tief ein und hielt die Luft sekundenlang an. Wirre Gedanken kamen ihm in den Sinn: „Was wäre, wenn ich jetzt tot bin, einfach nicht mehr da wäre? Würde sich die Welt dann noch weiter drehen? So ganz ohne mich?“ Und als hätte jemand diese Frage verstanden, stand ein alter Mann hinter ihm und sagte leise: „Natürlich würde sie das tun!“ Stand fuhr herum, erschrak aber nicht.
Denn es war der alte Mann, der ihm bereits bei seinem Konzert im Zuschauerraum aufgefallen war. Lächelnd schaute er Stan mitten ins Gesicht und schien wohl fragen zu wollen: „Was hast Du denn gedacht, was die Welt ohne Dich anfangen würde?“ Stan fragte ihn, woher er gewusst habe, was er gerade gedacht hatte. Dabei warf er seinen Kopf herum und stierte gelangweilt in den dunklen schwarzen Fluss. Der Fremde holte tief Luft und sagte dann: „Das war nicht schwer zu erraten. Was denkt ein erfolgreicher Mann, der an einem einsamen Fluss mitten in der Nacht herumläuft? Sucht er etwa das pralle Leben, dort am Fluss? Wohl eher nicht!“ Stan fand die Antwort gut und setzte sich auf einen herumliegenden Stein. „Ich bin so leer“, sagte er dann, „Weißt Du, was ich machen kann? Ich fühle mich nicht mehr wohl und jeder Tag in der Öffentlichkeit wird zur Last. Es ist zwar so wunderschön, dass mich die Menschen lieben.
Doch ist diese Liebe nicht auch erdrückend? Kann ich nicht einfach raus? Ich will doch nicht immer geliebt werden. Ich habe manchmal das Gefühl, einfach davonzurennen, zu fliehen aus dieser Wirklichkeit. Bin ich vielleicht nicht mehr normal, dass ich so denke? Was soll ein Bettler sagen, der mich so reden hört?“ Der Fremde schwieg eine Weile und die Stille war beinahe gespenstisch, ja sogar angst einflößend. Aber vielleicht wusste der Fremde auch gar keinen Ausweg? Doch dann sagte er: „Niemand wird Dir da raus helfen. Nur Du selbst. Du hast es einst so gewollt und Du hast es auch jetzt in der Hand, es zu steuern. Denn niemand anders, als Du selbst bestimmt, was aus Deinem Leben wird und wie es weitergehen soll. Der Erfolg ist ja auch nicht von allein gekommen. Du hast ihn geschaffen, Du ganz allein. Und nun fragst Du plötzlich einen Wildfremden, wie Du weitermachen sollst? Ist das fair? Schiebst Du nicht einfach Deine Sorgen und die Verantwortung auf einen Fremden ab?“ Stan schaute noch immer in den düster dahin strömenden Fluss. Mit einer solchen Antwort hatte er wahrlich nicht gerechnet. Hier unten, wo es so einsam war, wo nur der Mond ihn beobachtete, hier unten am Fluss bekam er einen Spiegel vorgehalten. „Was soll ich Deiner Meinung nach machen?“, fragte er den Fremden und sein Ton wurde etwas härter und zickiger. „Jahrelang habe ich gekämpft und geackert und hatte soviel Freude bei der Arbeit. Ich habe mein Klavier und meine Musik so sehr geliebt und jetzt? Ich bin so tot und Du sagst mir, ich kann das nur Selbst ändern? Ja, wie sollte ich das denn tun? Da hast Du wohl auch kein Rezept, was?“ „Ach!“, stöhnte der Fremde laut, „Wenn wir einmal nicht mehr weiter wissen und unser tolles Leben ins Stocken gerät, dann jammern wir und wollen so die Aufmerksamkeit anderer auf uns lenken. Nur deswegen, weil wir zu feige sind, etwas zu tun. Nein mein lieber, das kann Dir niemand abnehmen. Nicht ich und auch kein anderer. Doch einen Rat kann ich Dir geben.
Verlagere Deine Sehnsüchte und Deine Träume nicht zu weit nach oben. Bleibe realistisch und freue Dich, dass Du so gesund sein darfst. Während sehr viele andere Menschen schwere Krankheiten ertragen müssen, nicht sehen dürfen oder an medizinische Geräte angeschlossen sind, darfst Du Dich Deinen Träumen und Deinen Tränen hingeben. Darfst diese wundervolle Welt sehen und die Vögel am Morgen singen hören. Schau, wie am Morgen die Sonne lacht und selbst wenn es regnet, freue Dich, dass Du ihn erleben kannst. Das kann nicht jeder. Weißt Du, das Leben besteht nicht nur aus Konzerten, aus Terminen und noch mehr Erfolg.
Es besteht vor allem aus … dem Leben selbst. Und Du bist derjenige, der es allein gestalten darf. Freu Dich doch, dass es so ist. Und wenn Dir eben so ist, dass Du nicht mehr in der Öffentlichkeit arbeiten willst, warum tust Du es dann noch? Warte nicht so lange, ändere Dein Leben.
Aber weiß darum, dass Du der Macher bist und nicht der, der es Dir rät. Und fürchte Dich nicht. Denn Du bist stark und wirst es schaffen, weil Du einen starken Willen hast. Also, ran an den Speck und nicht so viel herumgejammert!“ Der Fremde lief ans Ufer des Flusses und spielte mit dem Wasser. Dann rief er laut: „Schau, das ist das Leben! Dieses Wasser, aus dem wir alle gekommen sind. Das Wasser fragt nicht, es fließt und fließt und fließt. Und es weiß genau, wie es zu fließen hat. Es ist nicht ins Stocken geraten so wie Du. Mann … Junge … Du lebst! Freu Dich dran!“ Stan stand auf und lief ebenfalls zum Ufer. Er hielt seine Hände ins kühle Wasser und spürte, wie sich das erfrischende Nass zwischen seinen Fingern hindurchschlängelte. Nichts schien es aufzuhalten. Es fand immer seinen Weg. Und es war so einfach. Ohne langes Gerede suchte sich das Wasser den besten Weg und plätscherte dabei so munter dahin, dass es eine Freude war, ihm zuzusehen. Es war so mutig, so konsequent und musste nicht nachdenken.
Nein, es tat, was es immer tat – es floss! Plötzlich ertönte lautes Hundegebell.
Stan drehte sich um und entdeckte zwei Männer, die mit einem Hund unterwegs waren. Sie unterhielten sich angeregt und hatten wohl eine Menge Spaß dabei, denn immer wieder mussten sie lachen.
Stan wollte noch etwas zu dem Fremden sagen, doch der war plötzlich nicht mehr da. Nirgendwo am Ufer konnte er ihn entdecken. Die beiden Männer liefen an Stan vorbei und fragten ihn, ob er Lust hätte, mit ihnen noch auf ein Bier in eine Kneipe zu gehen. Und Stan schaute noch einmal zum Fluss hinunter, sah, wie sich im Wasser das Licht des Mondes spiegelte, und sagte schließlich laut und klar verständlich: „Ja, ich komme mit!“ …
5.
Der 14jährige Craig spielte gern am Computer. Je ausgefeilter die Spiele waren, desto wohler fühlte er sich. Er musste unbedingt die neuesten Spiele besitzen und trieb sich deswegen immer wieder auf diversen Messen und bei einschlägigen Treffen herum. Doch sein Taschengeld reichte nicht mehr aus und die Eltern wollten ihm nicht mehr geben. Und die Spiele waren nicht gerade billig. So kam es, dass er sich das Geld für seine Leidenschaft abends im Park zusammen stahl. Er lauerte Leuten auf, die gerade von der Arbeit kamen, um ihnen das hart erarbeitete Geld abzunehmen. Selbst vor älteren Leuten machte er nicht halt. Bisher ging diese Masche immer gut und Craig konnte sich an den darauf folgenden Tagen die neuesten Spiele besorgen.
Und noch etwas, das beinahe noch viel schlimmer war als seine Spielsucht war die Tatsache, dass in den Spielen die Gewalt und der Terror an der Tagesordnung waren. Je mehr Tote es gab, umso toller fand er das Spiel. Seine Eltern, die stets versucht hatten, das zu unterbinden, wurden einfach nicht mehr fertig mit Craig. Sie probierten wahrlich alles, was man sich nur vorstellen konnte, um ihn auf andere Gedanken zu bringen. Doch Craig ließ sich einfach nicht mehr abbringen von diesem verrückten Treiben. Irgendwann war er so aufgeputscht, dass ihm das Geld, welches er abends im Park stahl, auch schon nicht mehr ausreichte.
Außerdem versorgte er sich heimlich mit Drogen und sein Leben schien vorbei, bevor es richtig begann. Sein Vater hatte ihm bereits angedroht, ihn vor die Tür zu setzen, wenn er sein Leben nicht änderte.
Nur die Mutter konnte das nicht übers Herz bringen. Sie liebte ihren Sohn über alles, und bevor ihn der Vater raus warf, wollte sie für ihn beten. Jeden Abend, bevor sie ins Bett ging, flehte sie um Hilfe, Craig doch endlich wieder auf den rechten Weg zu bringen. Doch es schien wie verhext. Das Böse in Craig schien die Oberhand zu gewinnen und ihn nicht mehr loslassen zu wollen. Er trieb sich nun schon die ganze Nacht in den Parkanlagen herum, kiffte und stahl. Irgendwann wurde er von der Polizei aufgegriffen und eingesperrt. Die Mutter schaffte es, ihn dort herauszuholen, doch der Officer meinte, dass das nicht ewig so weiter gehen könnte. Irgendwann würde Craig wohl vor einem Staatsanwalt enden. Und seine schlimme Karriere würde er dann im Knast weiterführen dürfen.
An einem regnerischen Samstagabend war mal wieder das Geld alle und Craig musste in den Park, um sein verbrecherisches Werk zu vollbringen, andere Leute zu beklauen. Diesmal jedoch war irgendetwas anders … aus irgendeinem Grund war die Straße, die zum Park führte, gesperrt. Craig konnte weder eine Baustelle noch eine andere Ursache für diese Sperrung entdecken. So blieb nur noch der Umweg durch ein naheliegendes Wäldchen, um in den Park zu gelangen. Doch es half nichts, wenn er an neue Drogen herankommen wollte, brauchte er dringend das nötige Kleingeld. So lief er los.
Besorgt schaute ihm die Mutter durch die verregneten Fensterscheiben nach. Tränen liefen ihr übers Gesicht und sie hatte bereits die schlimmsten Befürchtungen.
Sie sah ihren Sohn, den sie doch so sehr liebte, schon in einer Gefängniszelle dahinvegetieren. Aber sie wusste, dass es nichts half, Craig alles zu verbieten. Er würde es dennoch tun. Und dann hätte sie ihn vielleicht für immer verloren. Sie zog die Gardine zu und legte sich nachdenklich ins Bett. Vater schlief schon und sie wusste, sie konnte ihn nicht mit diesen Dingen behelligen. Er war nicht so geduldig und würde seine Drohung wahr machen und Craig vor die Tür setzen. Das wäre das Ende! Craig lief durch die Pfützen und der Weg durch das Wäldchen wollte einfach kein Ende nehmen. Ihm war kalt, doch der Gedanke an das Geld und die Drogen vernebelte ihm die Sinne. Er wollte es so und fand sich wohl damit zurecht. Plötzlich kam er an einen kleinen Weiher. Er lag so friedlich unter den Bäumen, dass Craig einen Moment stehen blieb. Nebel stieg von der Wasseroberfläche und das Mondlicht verfing sich darin wie ein Irrlicht. Und es war ganz seltsam, Craig hatte plötzlich so ein unbekanntes Gefühl in sich. Es war eher eine Frage, die in ihm aufstieg und für eine Sekunde wusste er nicht so genau, ob er wirklich weiter gehen sollte.
Doch da waren sie wieder, diese unguten Gedanken, dieser Drang, das Unbekannte, das Abenteuer erleben zu müssen. Er konnte sich überhaupt nicht dagegen wehren. Der Nebel, der über dem Weiher waberte, breitete sich mehr und mehr aus. Hatte es wirklich Sinn, weiter zu gehen? Craig lehnte sich an einen Baum und zündete sich eine Zigarette an. Genüsslich inhalierte er das würzige Nikotinaroma und starrte in den Nebel. Doch was war das … aus dem Nebel überm Weiher formten sich plötzlich Blasen. Sie sahen aus wie Luftblasen, die aus der Tiefe eines Sees aufstiegen. Was hatte das zu bedeuten? Craig warf die eben erst angezündete Zigarette wieder weg und beobachtete interessiert das merkwürdige Schauspiel. Immer mehr Blasen formten sich über der Wasseroberfläche und wurden immer größer. Und als ob das noch nicht aufregend genug war, entstanden Bilder in den Blasen. Sie liefen ab wie Filme und Craig erschrak fürchterlich … diese seltsamen Filme kannte er von irgendwoher. Kein Zweifel … da war er selbst zu sehen … in unterschiedlichsten Szenarien … doch alles zeigte sein eigenes Leben. Wie konnte das nur möglich sein? Wer erlaubte sich einen solch üblen Scherz mit ihm? Waren das da vor ihm seine wirren Träume, seine furchtbaren Gedanken oder schon sein verkorkstes Leben? Oder vielleicht doch nur eine entsetzliche Fata Morgana? Irritiert lief er zum Ufer und tappte nervös von einem Bein auf das andere. Gleichzeitig beobachtete er das Geschehen in den vermeintlichen Luftblasen. In einer Blase sah er sich, wie er einen Joint rauchte, in einer anderen Blase bestahl er gerade eine alte Frau im Park, die auf diese Weise ihr bisschen Geld verlor. Dann sah er seine Mutter, wie sie um ihn weinte und bangte und verzweifelt mit ihm sprach. Doch in der größten Blase sah er ein merkwürdiges bedrohliches Gebäude … es war ein Gefängnis … und er saß auf einem Holzhocker in einer dunklen schmierigen Zelle … wurde immer älter und lag plötzlich leblos auf einer Holzpritsche. Zum Schluss erschien ein riesiges Kreuz über allen Blasen und Craig las entsetzt die Inschrift auf dem überdimensionalen Kreuz … Craig Fuller, sein eigener Name! Das war zu viel für ihn! Am ganzen Leibe zitternd rannte er zurück. Er rannte und rannte und schließlich kam er zu Hause an. Und es war ganz seltsam, die Mutter schien bereits auf ihn gewartet zu haben, sie öffnete ihm die Tür und schloss ihn in ihre Arme. Woher hatte sie nur gewusst, dass er gerade jetzt kam? Die beiden hielten sich ganz fest und Craig sagte nur leise: „Ich bin wieder Zuhause Mama.“
Und die Mutter schwieg, sagte nur: „Ich weiß mein Sohn, ich weiß.“ Nie mehr ging Craig in den Park und es schien, als sei eine Erleuchtung in seine Sinne gefahren. Keiner in der Familie konnte sich das erklären, nicht einmal Craig selbst. Der Officer wunderte sich und besuchte die Familie. Er freute sich, dass Craig wieder auf dem richtigen Wege war, und wünschte ihm alles Gute. Und eines Tages ging er mit seiner Mutter durch das Wäldchen, um ihr den Weiher zu zeigen, wo er die merkwürdigen Luftblasen gesehen hatte. Doch am Weg durch das Wäldchen, der geradewegs in den Park führte, fanden sie keinen solchen Weiher.
Craig glaubte, er habe sich geirrt oder gar verlaufen. Doch als er sich später beim Officer nach diesem Weiher im Wäldchen erkundigte, sagte der nur: „Einen Weiher hat es in diesem Wäldchen niemals gegeben …“
6.
Jeffs Geburtstagsfeier war wirklich wunderschön. Er wurde vierzig Jahre alt und seine Eltern hatten ihm einige sehr brauchbare Dinge geschenkt. Doch über etwas ganz bestimmtes freute sich Jeff ganz besonders … eine in schwarzes Leder gebundene Ausgabe eines Gedichtbandes seines Lieblingsautoren Jim Clancy. Jeff liebte die gefühlvollen Gedichte dieses nahezu unbekannten Schriftstellers. Und als die Feier zu Ende war, las er im Bett noch etliche Seiten in diesem Buch. Am nächsten Tag wollte er in die Stadt, um einige wichtige Dinge zu erledigen. Doch unterwegs musste er noch zur Tankstelle, um den Wagen zu betanken. In den Auslagen fiel ihm auf, dass man dort den gleichen Gedichtband anbot, den auch er zum Geburtstag geschenkt bekam. Er wies die junge Frau an der Kasse darauf hin. Die drehte sich um und meinte dann: „Tatsächlich, das habe ich bisher noch gar nicht bemerkt. Aber
gut, dass Sie es entdeckt haben.“. Jeff meinte, dass er das Buch sehr gut fand und jederzeit weiter empfehlen könnte.
Schließlich fuhr er weiter und ging in den Supermarkt. In einem dortigen Bücherregal sah er ihn wieder, diesen Gedichtband. Und diesmal wunderte er sich, denn das Buch galt eigentlich als sehr selten. Wie konnte es dann einfach so in den Läden herumstehen? Er fand das sehr merkwürdig und wollte sich beim Personal danach erkundigen. An einem Regal stand ein junger Mann und füllte gerade die Regalreihen auf. Jeff befragte ihn nach dem Gedichtband. Doch der junge Mann schaute ihn nur ungläubig an-vermutlich hatte er gar keine Ahnung, was sich in den Regalen so befand. Als Jeff ihm jedoch das Buch zeigen wollte, war es nicht mehr da. Jeff war sich allerdings auch nicht mehr so sicher, wo genau er es gesehen hatte. Dennoch kam ihm diese Sache langsam mehr als merkwürdig vor.
Der Einkauf im Supermarkt dauerte nicht sehr lange. Als er schließlich alles im Auto verstaut hatte, fuhr er noch zur Post. Dort waren eine Menge Leute und Jeff wollte nicht so lange warten. Er schaute sich in dem kleinen Post Shop um und entdeckte ihn wieder, den Gedichtband von Jim Clancy. Diesmal wollte er es jedoch genau wissen und griff nach dem Buch. Doch wie seltsam … er griff ins Leere! Jeff verstand nun gar nichts mehr. Wie konnte das nur sein? Litt er etwa an Wahnvorstellungen? Er hatte doch das Buch genau vor sich gesehen. Und auf einmal stand das Buch wieder im Regal, genau vor ihm. Irritiert schaute er sich um. Niemand schien sein zugegebenermaßen seltsames Verhalten bemerkt zu haben. Und noch einmal griff er nach dem Buch. Doch er bekam es nicht zu fassen. Kaum, dass sich seine Hand dem Buch näherte, verschwand es auch schon wieder. Dafür polterte es plötzlich laut vor ihm. Erschrocken zuckte er zusammen-was war das? Als er in seinen Einkaufskorb schaute, lag das Buch darin. Es musste wohl aus dem Regal hineingefallen sein. Doch es wurde noch mysteriöser … an der Kasse entdeckte er erneut dieses Buch. Es lag auf dem Förderband und schien keinem Kunden zu gehören. Die Kassiererin schien das gar nicht zu bemerken. Oder konnte sie das Buch vielleicht gar nicht sehen? Offenbar konnte nur Jeff dieses Buch sehen. Er nahm das Exemplar, welches eben in seinen kleinen Tragekorb gefallen war, heraus. Und er wunderte sich erneut … das Buch war gar nicht verpackt. Irgendjemand musste die Schutzhülle entfernt haben. Vielleicht hatte dieser „Jemand“ bereits darin gelesen? Jeff schlug das Buch auf und erschrak … bis auf die erste Seite waren alle folgenden leer. Wie konnte das nur möglich sein? Jeff schlug die erste Seite auf. Dort stand nur eine einzige Strophe eines Gedichtes … und er las:
Die Warnung!
Geh nach Haus zum Vater schnell
Rette ihn, ihm geht’s nicht gut
Eh die Sonne nicht mehr hell,
geh nach Haus und mach ganz schnell
Sonst vergeht des Vaters Blut
Nun hielt ihn nichts mehr! Denn es gab keinen Zweifel mehr – seinem Vater musste es sehr schlecht gehen. Aber wo befand sich Mutter? Er stellte den Korb zurück zu den anderen und fuhr so schnell er konnte zum Haus seiner Eltern.
Noch konnte er keinen Hinweis auf ein eventuelles Unglück oder eine Katastrophe erkennen. Auch einen Krankenwagen sah er nicht. Doch als er ins Haus ging und laut nach den Eltern rief, bekam er keine Antwort. Im Wohnzimmer fand er seinen Vater schließlich vor. Er lag auf dem Fußboden und rührte sich nicht mehr. Sofort alarmierte Jeff den Notarzt.
Der traf rasch ein und der Vater konnte gerade noch gerettet werden. Der Notarzt meinte mit ernster Miene: „Ihr Vater hatte einen Herzinfarkt. Wären Sie nicht gekommen, wäre er mit Sicherheit gestorben.“. Jeff war erleichtert und erfuhr später, dass seine Mutter kurzfristig zu den Großeltern gefahren war. Sie kam sofort ins Krankenhaus und alle waren glücklich, dass es dem Vater wieder besser ging. Jeff blieb vorerst bei der Mutter und täglich fuhren sie ins Krankenhaus, um den Vater zu besuchen. Als Jeff bei einem dieser Besuche den Gedichtband mitnahm, um seinem Vater etwas daraus vorzulesen, wunderte er sich sehr. Denn auf der ersten Seite war ein völlig anderes Gedicht, als am Unglückstag. Und auch auf den restlichen Seiten fand er kein einziges Gedicht mit dem Titel: „Die Warnung!“ …
7.
I