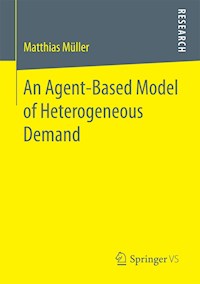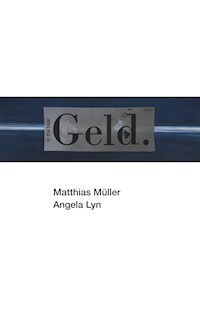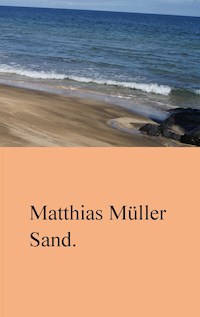
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Sand.“ schildert zwei Biographien. Andreas Stark ist krank, ein ehemaliger Journalist. Er lernt, die Menschen neu kennen - Anna und sich selbst. Ody kommt in London an - um zu leben, um Mensch zu werden. Den tödlichen Winter im Osten kann er hinter sich lassen. Was heisst heimkehren, was heisst aufbrechen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
“Imagination ist nicht ein Zustand,
es ist die menschliche Existenz an sich.”
Aus: William Blake “Milton”, 32. Bild.
Das Gedächtnis ist wie ein Sandstrand, in das das Leben sein Schwemmgut einlagert, und wenn Stürme wirbeln, gehen Dinge unter und tauchen später auf, oder gar nie mehr. Schreibt einer, macht er sich daran zu entdecken, was sich in den Dünen des Gedächtnisses verbirgt.
Andreas Starks Lebensmotor ist voller Sand, er ist todkrank. Es ist kein schmerzvoller Vorgang an sich. Der Motor stottert einfach, bald wird er erliegen. Und Stark sieht die Düne, die sich rund um ihn aufbaut, als die Möglichkeit, vergessen zu können. Normal zu werden. Undifferenziert zu werden. Teil der Speicher des Gewesenen zu werden. Und es spielt keine Rolle, was das Gewesene war, wie es war. Stark stirbt.
Odysseus liegt am Strand. Das Wasser schwappt über ihn. Odysseus ist verwundet, oder müde, oder abwesend. Er ist nicht das Strandgut, das angeschwemmt wird und langsam im Sand versinkt. Nein, er wird aufstehen, sich vom Strand entfernen und ins Leben gehen. Er verlässt die Düne, das Gedächtnis, in das er eingelagert war.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
I
Andreas Stark hat lange geschlafen und geträumt. Es scheint ihm jedenfalls so, als er aufwacht. Er hat ein Abenteuer erlebt. Kaum ist er aufgestanden, geht er zu seinem Pult, nimmt ein leeres Blatt Papier und schreibt die Geschichte auf, die er geträumt hat. Als er sie liest, merkt er, dass es eine Kindergeschichte ist. “Yoko taucht” heisst sie. Menschen tauchen ins Wasser, Menschen reden im Wasser, Menschen sind aufgehoben, Menschen sind eins. Es ist das Bild eines Ganzen, zerbrechliche Musik ist zu hören, das „Ankerlied“. Stark spürt Sehnsucht, etwas Trauer. Wie konnte er das träumen? Ist es das Ziel, das er erreichen muss? Stark lässt den Kugelschreiber übers Blatt gleiten, halb bewusst, halb schlafend. Abtauchen, ja das wäre schön, wegtauchen, in eine andere Welt. So wie Kinder das können, wenn sie spielen. Sie werden eins mit ihrem Tun, gehen auf im Spiel. So stellt sich Stark das Tauchen vor, ganz da sein, und nie angestrengt, aufgehoben im Wasser, eine wunderbare Balance zwischen Schweben und Sinken.
Stark ist jetzt wach.
Odysseus fährt wieder übers Meer, mit seinen Gefährten Troja verlassend, nach seiner Heimat Ithaka und seiner Gattin Penelope strebend. Odysseus wird dabei gejagt von einem Traum, der ihn in der Nacht nach der grossartig gewonnenen Schlacht heimgesucht hat. Er sieht sich während des Traums im wütenden Meer von turmhohen Wellen hin und her geworfen, aus der Tiefe des Meeres in die Höhe geschleudert und wieder metertief ins Wasser gedrückt. Während des unbarmherzigen Sturms verliert er das Bewusstsein und wird an einen Strand geworfen. Dort spricht aus der Höhe die grosse Stimme, es ist die Stimme des Löwen: “Also wird der Polyp dem festen Lager entrissen, Kiesel und Sand hängen an den Gliedern des Heimatlosen.“ Odysseus bleibt in dem Traum halbtot am Strand liegen, aus der Geschichte gerissen, heimatlos geworden. Der starke Wind bläst.
Vor seiner Abreise füllt er an Trojas Strand noch etwas Sand und ein paar Steine in einen Sack. Er möchte den Traum beschwichtigen, ihm sagen, dass er vorbei ist. Eine Gewohnheit, die er beibehalten wird.
Ob er sich zu einer Irr- oder einer Erkundungsfahrt aufmacht, das vergisst er allmählich. Ein paar Wochen nach Verlassen Trojas kommt er mit seinen Männern in Ismaros an, der Stadt der Kikonen, wo sie sich alle die jungen Weiber und die Schätze teilen. Danach schlagen die Kikonen zurück, Flucht.
Er und seine Genossen finden die gebirgige Insel AeAea, in deren Talboden Kirke ihr Lager eingerichtet hat. In den Wäldern wohnt wildes Getier, um Kirkes Revier schlendern Löwen mit langen Mähnen, die sie sich mit Säften aus Amphoren gefügig macht. Die Löwen steigen schmeichelnd an den Männern empor und wedeln mit ihren Schwänzen. Am Abend, als die Begierden des Tranks, der Speise und des Geschlechts gestillt sind, schliesst Odysseus seine Augen und beginnt zu singen: von den grossen Schlachten, den schönen Frauen, muskulösen Helden, den stolzen Schiffen, vom Wein auf Ithaka, das für ihn ein unerreichbares Paradies geworden ist. Manchmal singt die schöne Kirke mit und webt singend ihren grossen unsterblichen Teppich, den sie einst über die ganze Erde legen möchte, damit sie ihr Reich werde. Kirke weiss Odysseus’ Balladen auf ihrem Lager mit tausendfachen Freuden zu danken. Nach sieben Jahren schickt Kirke Odysseus weg, nicht ohne ihm die kommenden Gefahren zu schildern und ihn auf seine Aufgabe hinzuweisen: „Suche das Ende, den Ort, wo Du die Dunkelheit verlassen kannst.“ Odysseus füllt eine Kelle des leuchtend-weissen Sandes von AeAea in seinen Sack.
Bei den Lästrygonen, dem tüchtigen Hirtenvolk, sitzt er mit Antiphates am Abendfeuer. Kirke hat ihn vor dem König gewarnt: “Er wird dir ein schreckliches Ende bereiten, fliehe ihn und besteige nicht das Lager seiner Gattin!” Aber Antiphates bietet Odysseus und seinen Gefährten ein üppiges Mahl und allen auch seine Frau an, die so unersättlich sein soll wie eine hungrige Löwin. “Es ist genug da, Odysseus, lass dich gehen.” Und Antiphates verrät ihm, weshalb es den Lästrygonen derart wohl ergeht: “Ein Mann ohne Schlaf erfreut sich doppelten Lohnes: des Lohnes als Rinderhirte und des Lohnes als Schafhirte. Du verstehst Odysseus, des Tags die männlichen Gefährten, des Nachts die weiblichen. Genug Fleisch da, um den Schlaf zu vergessen.” Und auf der Burg des Antiphates entschliesst sich Odysseus dazu, nicht mehr zu schlafen, denn er will sich nichts mehr entgehen lassen, er will ihn empfangen, den doppelten Lohn. Er will haben, was zu haben ist, sehen, was zu sehen ist, hören, was zu hören ist. Er sagt sich: “Mag ich auch über die Meere irren: Solange ich immer neue Eindrücke empfange und mir genügend Rinder und Schafe zur Verfügung stehen, wird es mich nicht ärgern.” Es ist die Gattin des Antiphates, die Odysseus‘ Männern im Traum erscheint und sie warnt. Sie verlassen die Lästrygonen. Rot ist der Sand, von dem Odysseus eine Kelle voll in seinen Sack leert.
Orkane blasen Odysseus und seine Männer zurück an den Strand von Kirkes Insel. Für Odysseus folgen weitere lustvolle Monate bei der Zauberin, die Odysseus’ Männer in Schweine verwandelt hat. Odysseus hört ihre Stimme und wird sie immer wieder hören: “Edler Laertiad, erfindungsreicher Odysseus. Deine Männer habe ich in Schweine verwandelt, weil ihr meinen Rat nicht befolgt habt. Aber sie werden bald wieder ihre Rüstung anziehen, und ihr werdet losfahren. Mich aber wirst du nie vergessen. Du wirst an mich denken, listenreicher. Fahre zu Teiresias, an den Rand zur Unterwelt, er wird dir den Weg weisen, und ich werde dir beistehen.” Odysseus sieht die Wölbung ihres Busens, wenn sie sich zum Knüpfen über den unsterblichen Teppich beugt, er sieht ihre roten Lippen, die rosa Schleier über ihren nackten Körper, den er jeden Abend in seinen Armen hält. Odysseus kostet jede Gelegenheit aus, er schläft nicht mehr.
Bei den Lotophagen verliert Odysseus alle seine Gefährten. Sie sind zu müde um weiterzureisen, während Odysseus’ gewählte Schlaflosigkeit ihn dazu zwingt, immer weiter zu gehen, immer neue Erlebnisse zu suchen.
Hinter der Insel der Lotophagen, deren Strände voller grauen Sands sind, gerät er in seichtes und übel riechendes Wasser. Es ist das Abwassermeer der Lotophagen, deren verschwenderischer Lebensstil Berge aus Müll und Ströme aus giftigem Abwasser produziert. Der Wind bläst hier kaum mehr. Odysseus muss sich über das Wasser treiben lassen, das stinkt und dessen Dämpfe ihn einnebeln. So kann er auch die hellblonden Sirenen nicht sehen. Kirke hat ihn vor ihnen gewarnt: “Sie werden nicht singen, so wie es die Legende erzählt. Nein, sie werden Trauben nach dir werfen und sich vor dir enthüllen, um dich von dem Weg zu Teiresias abzubringen. Verbinde dir die Augen, Odysseus.” Aber Kirkes Warnung ist vergeblich, denn er kann die Sirenen wegen der Giftwolken nicht sehen. Als er den Felsen der Sirenen passiert und schnell eine Handvoll des graphitenen Sandes in seinen Sack kippt, hört er einen Gegenstand in seinem Boot aufschlagen, es ist ein Radio.
Stark liegt im Spital, kein Notfall. Jede Woche wird er dreimal an den Dialysator angeschlossen, Hämodialyse, Blutwäsche. Seine Niere machts nicht mehr. Das Gift bleibt im Körper. Stark könnte das gerecht finden. Es ist ein Kreislauf, das ewige Spiel von Ursache und Wirkung: wer Gift produziert, soll es auch behalten. Weshalb also das Gift ausscheiden? Und welches Gift ist es denn eigentlich? Stark findet Gefallen am Gedanken vom geschlossenen Kreislauf, wenn der nur nicht in den Tod führte.
Stark liegt im Spital, bedeckt mit einer Wolldecke, die ihn an die Alten im Pflegeheim erinnert, wo jetzt seine Mutter lebt. Der Arzt sagt zu Stark: “Es hilft ihrem Körper, wenn sie sich vorstellen, was während dieser vier Stunden vorgeht. Bleiben sie in Gedanken mit ihrem Blut, wandern sie mit. Manche Patienten fühlen sich befreiter, wenn sie zu Hause darüber nachdenken, wie ihre Niere eigentlich funktionieren müsste.” Stark sieht das Blut durch den Shunt in die Arterie eindringen, durch die Blutpumpe beschleunigt, mit Heparin verdünnt, über den arteriellen Blasenfänger gehts in den Dialysator, wo sich Blut und Spülflüssigkeit an einer Membran treffen, durch ihre Poren diffundieren die Abfallstoffe, Schlacken, Gifte, alles auf Körpertemperatur gewärmt, das gereinigte Blut sammelt sich in den venösen Blasenfänger und wird wieder in den Körper entlassen.
Eine Broschüre prägt den Begriff “harnpflichtige Stoffe”. Ja, wenn die Pflicht erfüllt würde! Pflicht seines Körpers wäre es, die Abfall-Stoffe dem Harn zuzuführen, und die Pflicht des Harns wäre es, diese aufzunehmen, gleichsam Ausschaffungs-Asyl zu gewähren. Aber seine Niere und sein Harn entsprechen der Pflicht nicht, sind ungehörig, rebellisch oder einfach faul – es könnte dasselbe sein.
Stark gerät ins Sinnieren: Ist aufgrund der Krankheit sein Harn sauber, weil die Niere ihren Dienst nicht mehr tut und darin keine Gifte entlässt? Ist das ein sauberes Wässerchen, das er in der Regel alle drei Stunden lässt? Wenn ja, könnte man es als Spülmittel im Dialysator verwenden, den Kreislauf des Blutreinigens also doch körperintern behalten und von der Versorgung durch eine körperfremde Flüssigkeit unabhängig machen; alles mit dem Resultat, dass er am Schluss doch wieder seinen eigenen verschmutzten Harn liesse?
Sein Harn hätte ja die nötige Körpertemperatur, und der Dialysator wäre nichts als ein anderes Organ, das der Benutzer lediglich für ein paar Stunden mietete. Oder, wenn er es kaufte, es wiederum ausleihen könnte an andere, deren Nieren ihre Pflicht nicht erfüllen. Das entspräche dann im weitesten Sinne dem Tatbestand des Organhandels, der selbstverständlich sofort zu legalisieren wäre, eine Volksinitiative wäre einzureichen, Unterschriften sammeln, was wiederum schwierig wäre, da die Sammler ja zum Entgiften in den Kliniken liegen. Es wäre eine Diskrimierung der Volksrechte erster Güte, eine Klage am Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte müsste eingereicht, vorausgesetzt, dass die dort genügend Dialyse-Geräte besitzen!
Starks Dialyse-Meditation wächst sich aus zu einem Gedanken-Geschwür, das sein Hirn überwuchert und es lahmzulegen droht. Immerhin ähnelt sie den Assoziationsketten, wie er sie für seine besten Recherchen knüpfte, als er noch Journalist war. Aber Stark ist arbeitsunfähig, todkrank, erschöpft. Den Rat seines Arztes, zu meditieren, hätte er am besten in den Wind geschlagen, denkt er, oder, um im Bild zu bleiben, seinen Gedankensturm durch einen geistigen Dialysator schicken müssen, den man allerdings nirgends erwerben kann. Spülflüssigkeit, verunreinigt durch abzuführende Gedanken. Die Geräte müsste man auf Redaktionen einführen, denkt Stark, jetzt doch ein wenig erleichtert.
Kein Lüftchen weht. Odysseus’ Schiff dümpelt durch die vergiftete Kloake. Odysseus ist allein, er hat seine zwölf verbliebenen Gefährten auf der Insel der Lotophagen gelassen. Odysseus ist betäubt von den giftigen Dämpfen, er ist seiner Sinne nicht mehr mächtig, der Kopf weich wie eine Qualle, er schläft nicht mehr. Das Radio, das ihm die Sirenen ins Boot geworfen haben, ist dem Helden geblieben. Es spielt immer das gleiche Lied: “I can’t get no satisfaction“. Odysseus gerät ins Delirium: er ist der Sieger, die wunderschöne Penelope gefreit, Troja befreit, mit der sagenhaften Helena verkehrt, immens die Güter, die er nach seiner Heimkehr geniessen kann. Und zu Hause wird die Schlachterei weitergehen, das weiss er jetzt schon. Er wird alle Freier köpfen, die sich während seiner Abwesenheit ihr Nest bei Penelope eingerichtet haben und ihren Sohn Telemachos töten wollten. Denn Odysseus wähnen sie alle schon tot.
Aber jetzt diese Kloake, Odysseus steckt fest. “Get no satisfaction.“ Odysseus ist schlaff, die Gier schlummert in ihm, wie ein Löwe mit halbgeschlossenen Augen, jederzeit bereit aufzuspringen. Er schläft nicht.
Jeden zweiten Tag im Spital. Der Dialysator summt, und Stark denkt über Nieren und Blutbahnen nach, die Empfehlung des Arztes zu meditieren beachtend. Aber er findet keinen Einstieg, keine Dauer. Seine huschenden Gedanken werden durchstossen von der einen Frage, die er nur im Beruf gestellt hat: Warum? Zwei knappe Antworten hat Stark schon erhalten. Seine Ex-Frau meint am Schluss nur noch in schnippischer Verachtung: “Zu viel hineingefressen und gesoffen: alles Schnaps, mein Lieber.” Starks Chef sagt: “Viel zu begabt, mein Lieber.” Manchmal sagt sich Stark heute: Da lag wohl zu viel Gift auf den Pulten und in den Köpfen der Redaktion. Damals sagte ich dem: Informationen, die der Einordnung und Entschlackung bedurften. Die Redaktion als vermeintliche Niere des Datenstroms, mit der Aufgabe, gut von schlecht zu trennen. Das war pure Anmassung. Was waren denn schon die Kriterien, die die “Niere” berücksichtigte, um unterscheiden zu können? Bürger-Ethik, Wohlstandsverliebtheit, Extremismus-Verachtung, Besserwissensollen? Die “Niere” hat nie funktioniert. Das tröstet Stark nicht. Er fragt warum: warum ich?
Nachdem ihn seine Frau verlassen hat, trifft sich Stark einbis zweimal in der Woche mit seiner Nachbarin. Gelegentlich verbringen sie die Sommerabende auf ihrer Veranda, einen leichten Roten getrunken, grillierte Würste mit Kartoffelsalat gegessen, über Kinder gesprochen. Man lernt sich kennen. Stark erzählt von seiner Scheidung, Anna davon, wie ihr Liebhaber ohne Vorankündigung verschwunden ist. Die zwei plaudern miteinander, es entstehen keine Spannungen. Stark jagt nicht. Anna arbeitet als Buchhalterin in der örtlichen Spinnerei, vor und nach der Arbeit gibt es für sie nichts anderes als ihre Töchter. Die sind drei und fünf Jahre alt, beide blondgelockt, Hand in Hand, Stark sieht die beiden immer zusammen.
Eines Abends wollen sie von ihm ins Bett gebracht werden. Er erzählt ihnen die Geschichte vom Mädchen, das eine Kaugummi-Maschine erfunden hat, danach die Geschichte von Yoko, die tauchen geht. Dominique und Francine schlafen, ehe Stark die Geschichte beendet hat. Ruhig heben und senken sich ihre Oberkörper. Dominique, die jüngere, hat ihre linke Hand in das Haar von Francine gelegt, das matte Licht der Nachttisch-Lampe zeigt den Flaum auf ihrer Haut und legt einen Lichtschleier um ihr Haar. Stark bleibt sitzen und betrachtet die Mädchen, er schaut zum Fenster, sieht den halbvollen Mond. Stark sitzt da und wartet auf seine Tränen. Ruhig heben und senken sich die Oberkörper der Mädchen. Er wischt sich die Tränen nicht ab. Anna hat es gesehen, aber nichts gesagt.
Doch die Bilder geben ihm nicht Frieden. Stark spürt das Reissen in sich, das Zerreissen, das ihn zerstören kann. Stark würde sich als Nichtsnutz und Versager bezeichnen. Ihm kommt es lächerlich vor zu weinen.
Nun erreicht Odysseus doch noch Land. Die Insel der einäugigen Kyklopen ist umgeben von frischem Wasser. Der sagenhafte, gewalttätige Riese Polyphemos ist abgereist. Die Insel ist jetzt übersät von Bildschirmen, alle stumm. Sie zeigen Listen mit Links zum Begriff “Kathy“. Gemeint ist die eine Kathy, die Dem, dem Sänger, “satisfaction” geben sollte. Odysseus tippt auf die Links, die immer neue Informationen, Bilder und Videos über Kathy zeigen. Die Kyklopen müssen einen Filter in die Software eingebaut haben. Von den Dutzenden an Kathys, die es sicher auch im World Wide Web gibt, taucht immer nur die eine auf, “Leggy Texan Belle”, liest Odysseus. Eigentlich müsste er jetzt gegen die Kyklopen kämpfen.
Odysseus sitzt vor den Bildschirmen. Er sieht sich die Informationen über “Kathy” an. Es sind Tausende von Links, ein Labyrinth, ein irrer Weg. Die Welt scheint vom blonden Haar besessen, vom Mager-Körper einer Frau. Liebesbriefe und frivole Fantasien sind im Netz, das weltweit sein soll, abgelegt. Abhandlungen über ihr Liebesleben mit Dem, Psycho-Analysen, Horoskope, einer zitiert Nostradamus und folgert, es komme zur Wiederverheiratung. Kathy wird unter den “Stars auf Krücken” aufgelistet, weil sie einmal einen Fuss übertreten hat. Ein Yoga-Video wird unter ihrem Namen verkauft, eine norwegische Waldkatze trägt ihren Namen, und ein Herr Ken Bell hat am 11. Oktober 1997 dem Blumenbett bei der Eingangstüre zum Haus von Dem und Kathy Erde entnommen, die er jetzt im rein elektronischen “Museum of dirt” zeigt. Odysseus starrt seit Tagen auf die Bildschirme. Er kann damit nicht aufhören, noch ein Link, noch eine Art, Kathy zu huldigen. Es ist seltsame Besessenheit. Sie macht keinen Lärm und ist doch nicht aufzulösen. Es ist ein Rausch, eine Trance. Odysseus ist gefangen im Netz des World Wide Web, im flachen Meer der Projektionen und Huldigungen, die alle miteinander verbunden scheinen und auf den einäugigen Bildschirmen sichtbar werden. Längst schon ist sein Hirn abgeschaltet, es lallt, als würde er seinen eigenen Träumen zusehen. Odysseus klickt sich von Seite zu Seite und lallt. Aber er schläft nicht. Der Löwe in ihm beginnt gleich, ihn mit Träumen zu versorgen.
Andreas Stark fährt jede Woche dreimal mit dem Zug ins Spital, von Knorringen nach Winterthur. Die Reise erscheint ihm absurd, denn der Mensch reist, um Ziele zu erreichen, und nicht um nicht zu sterben. Anscheinend braucht es jetzt sogar öffentliche Verkehrsbetriebe, um sein Überleben zu sichern. Der Kreislauf, der in ihm nicht mehr funktioniert, ist erweitert worden um Billettschalter, Billettkontrolle, das Rumpeln über sich langsam verschiebende Gleise. Im gleichen Wagen sitzen meist dieselben gutaussehenden Frauen, die am Nachmittag mit den immer gleichen gut aussehenden Einkaufstaschen zurückfahren. Aussteigen im grösseren Bahnhof der Stadt, rechts derselbe Blumenladen mit demselben Angebot, links die Kaffeebar, später rechts das Stadttheater aus Blech, das Spital, immer fünf Minuten warten, gegen vier Stunden am Gerät angeschlossen, und dann wieder zurück. Alle zwei Tage. Weil sein innerer Kreislauf der Entgiftung nicht mehr reibungslos läuft, ist er nach aussen gestülpt worden, in eine routinierte Bewegung, die ihn ärgert. Nach fünf Stunden ist Stark wieder dort, wo er vorher war, zu Hause. Entgiftet.
Stark denkt während der Fahrt an seine Tochter Anja, die mit Freundinnen ausserhalb von Zürich lebt. Sie hat das Gymnasium abgeschlossen und wird im Herbst die Universität besuchen und dann wohl auch jeden Tag diese Reisen hin und zurück unternehmen, die sie unter Umständen gar nicht als sinnlos empfinden wird, sondern fürs Lernen, Kontakteknüpfen nutzen wird. Stark erinnert sich an Mädchen, die sich offensichtlich fürs Ausgehen in der Stadt im Zug vorbereiteten, indem sie aus der Flasche Weisswein tranken. Das traut er Anja nicht zu. Er hat vergessen, welches Fach Anja studieren möchte - das kann doch nicht sein, dass ich das vergessen habe, Starks Faust schlägt auf die Ablage vor dem Zugsfenster, niemand bemerkt es.
Im Zug nach Winterthur trifft er Rita, die mit ihm die Grundschule besucht hat und die in der kirchlichen Jugendgruppe, deren Besuch für die Jugend Knorringens gewissermassen zum Pflichtprogramm gehörte, während zwei oder drei Monaten seine Favoritin gewesen war. Sie haben sich nie aus den Augen verloren, und jetzt redet das Dorf von der unglückseligen Rita, sie, die Unglück auslöst und dadurch selber unglücklich geworden ist. Sie sagt Stark, sie müsse für eine Verhandlung den Hauptsitz ihrer privaten Haftpflicht-Versicherung aufsuchen und auf der Hauptwache der Kantonspolizei ein Protokoll unterschreiben, und schon weint sie. Stark mag nicht mit Rita reden. Es ist eine schlimme Geschichte, die Knorringen für zwei Tage zum Schweigen und danach zum Tuscheln gebracht hat. Vor zwei Wochen hat Rita, morgens um elf Uhr, einen Unfall verursacht, es gab Tote. Seither fährt sie den Schulbus nicht mehr.
Der Traum des Löwen, der Odysseus auf den Lotophagen erscheint: Flammen werden durch das Gehirn geschleudert. Sie erfassen, was Odysseus denkt, also will Odysseus nicht denken. Aber da wird schon Helena ins Flammenmeer geworfen, zerplatzt jämmerlich. Auch Penelope, die Krieger in Troja, Odysseus Gefährten auf seiner Irrfahrt, die Schiffsflotte, Odysseus’ Landgut auf Ithaka - alles in Schutt und Asche gelegt. Nur die Gehirne der Männer erfasst das Feuer nicht. Sie schwimmen im Meer und werden von Kathy gefischt. An Land legt sie eines nach dem andern auf einen Stapel. Das Feuer kann Kathy nichts anhaben: “Nein mein Lieber, wer das Feuer entfacht, den wird es nicht verschlingen.” Kathy nährt das Feuer mit Zeitschriften, Versandkatalogen, Computern. Sie wirft ein Netz über die Gehirne und trägt sie in ein blitzblankes Labor. Es könnte ein Operationssaal sein. Kathy legt die Gehirne unter einen Presshammer. Es bleiben kleine rechteckige Platten übrig, es sind flache Bildschirme, die Kathy mit Computern verbindet.
Odysseus hebt die Lider an. Er sitzt einsam vor den Bildschirmen und erkennt in ihnen die reine Gier, die Gier nach allem, Geld, Fleisch, Zerstörung, Krieg. Es ist die Gier, die ihn gefangen hält und darüber hinwegtäuschen soll, dass er schon lange tot ist.
Das Netz der Gier, das Kathy auswirft, fischt nicht in der Tiefe des Ozeans, es schöpft nur die Oberfläche ab. Dort liegen die Gehirne, und in ihnen die masslosen Wünsche, der Unrat, das Zer- und Erbrochene. Die Insel der Kyklopen ist das Gefängnis derjenigen, die ihren Gehirnen zusehen, die zu Bildschirmen geworden sind. Hier gibt es kein Entrinnen.
Jetzt kann Odysseus kämpfen, er erhebt sich und zertrümmert in kalter Wut die Bildschirme, setzt sich in sein Boot und stösst ab. Kein Lärm, das Radio hat er auf der Insel vergessen. Der Sand, den er in seinen Sack schöpft, ist grau, vermischt mit ein paar roten Körnern.
Rita, die Schulbus-Fahrerin, besucht Stark. Sie wirkt müde, fahrig. Es ist ihm unangenehm, er möchte nicht hören, was sie zu sagen hat. Die zwei Mädchen, die die Schulbus-Fahrerin überfahren hat, das sind Dominique und Francine, Annas zwei Mädchen. Aber mit Rita ist er aufgewachsen, er kann sie nicht wegweisen. Ihre Müdigkeit wirkt der seinen so nah.
Rita setzt sich in Starks Wohnzimmer, ohne ihre Jacke auszuziehen: “Ich muss dir etwas sagen. Du hast ja Anna und ihre Töchter gut gekannt, das hat sich herumgesprochen. Aber du kennst nur die eine Seite, meine kennst du nicht. Ich möchte sie aufdecken und die Schuld benennen. Mach damit, was du willst, es kann auch in der Zeitung erscheinen. Ich muss es einfach jemandem erzählen, sonst ersticke ich noch.” Stark hört Rita zu, er muss ihr zuhören, und Fragen muss er keine stellen, nur zuhören. Es verwirrt ihn, und einmal kommt es ihm vor, als sei er im Spital in seinen Dialyse-Gedankensprüngen: Kommt jetzt zusätzlich zu dem Gift in mir auch noch das Gift des Dorfes in mein Haus?
Rita ist Mitglied des ehrenamtlichen Kirchenvorstands. Sie führt das Sekretariat, schreibt Protokolle, erledigt die Korrespondenz des Vorstands und des Präsidenten. Bevor Rita geheiratet hat, arbeitet sie auf einer Gemeindekanzlei. Sie hat die Kirche wieder häufiger besucht, als einer ihrer halberwachsenen Söhne beinah an einem geplatzten Blinddarm gestorben wäre. Im Dorf hat man immer gesagt: Für den Job im Kirchenvorstand hätten wir keine bessere Besetzung finden können.
Rita ist jetzt 42, eine fürsorgliche Frau mit freundlichem Auftreten und gewinnendem Äussern, nicht sehr sorgfältig gekämmtes halblanges, nussbraunes Haar, schlanke Figur. Sie trägt meistens Jeans, das haben ihr ihre zwei Söhne beigebracht. Ihre Ehe ist zuverlässig, ihr Mann unter der Woche meist auf Verkaufstouren in ganz Europa unterwegs. Rita ist dankbar für die Aufgaben, die ihr der Vorstands-Präsident Alois Günther stellt. Er zeigt Vertrauen in ihre Fähigkeiten, lässt sie gewähren, überlässt ihr ganze Briefwechsel zur selbständigen Erledigung. Rita und er kommen sich nah. Während einer Wochenend-Retraite in den Bergen diskutieren sie stundenlang miteinander, erste Berührungen. Er besucht sie eines Morgens zu Hause, sie lieben sich. Rita geniesst die Aufmerksamkeit ihres Liebhabers, ihre Position in dem kirchlichen Verwaltungsgremium, aber sie kann es nie mit ihrer Religiosität verbinden, die sie selbst als volkstümlich, naiv empfindet. Nun ist der Kirchenpflege-Präsident in Knorringen – wie oft in den ländlichen Regionen - zugleich auch der Gemeindepräsident. Und der vergibt die Arbeiten in der Gemeinde. Ein Schulbus muss angeschafft werden, weil Knorringen gewachsen ist. Auf den umliegenden Weilern wohnen nicht mehr nur Bauern, sondern auch die Familien von Bürolisten und Computerspezialisten, die in der Stadt arbeiten. Günther stellt Rita als Schulbus-Fahrerin ein, weil er denkt, dass sie nicht nur ehrenamtliche Arbeiten ausführen soll. Rita ist geschmeichelt. Nach ein paar Wochen schlägt er ihr vor, mit dem verdienten Geld eine Wohnung in der Stadt zu mieten, damit sie sich in aller Ruhe treffen können. Dann ist der Unfall passiert.