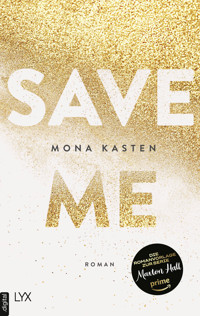
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Maxton Hall Reihe
- Sprache: Deutsch
Sie kommen aus unterschiedlichen Welten.
Und doch sind sie füreinander bestimmt.
Geld, Glamour, Luxus, Macht - all das könnte Ruby Bell nicht weniger interessieren. Seit sie ein Stipendium für das renommierte Maxton Hall College erhalten hat, versucht sie in erster Linie eins: ihren Mitschülern so wenig wie möglich aufzufallen. Vor allem von James Beaufort, dem heimlichen Anführer des Colleges, hält sie sich fern. Er ist zu arrogant, zu reich, zu attraktiv. Während Rubys größter Traum ein Studium in Oxford ist, scheint er nur für die nächste Party zu leben. Doch dann findet Ruby etwas heraus, was sonst niemand weiß - etwas, was den Ruf von James‘ Familie zerstören würde, sollte es an die Öffentlichkeit geraten. Plötzlich weiß James genau, wer sie ist. Und obwohl sie niemals Teil seiner Welt sein wollte, lassen ihr James - und ihr Herz - schon bald keine andere Wahl ...
"Lache, weine und verliebe dich. Mona Kasten hat ein Buch geschrieben, das man nicht aus der Hand legen kann!" Anna Todd über Begin Again
Sexy, mitreißend und glamourös - die heiß ersehnte neue Trilogie von Spiegel-Bestseller-Autorin Mona Kasten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmungZitat1234567891011121314151617181920212223242526272829303132DanksagungLeseprobeDie Romane von Mona Kasten bei LYXDie AutorinImpressumMona Kasten
SAVE ME
Roman
Zu diesem Buch
Geld, Luxus, Partys, Macht – all das könnte die 17-jährige Ruby Bell nicht weniger interessieren. Schon seit sie sieben Jahre alt ist, hat sie nur einen einzigen Wunsch: an der University of Oxford zu studieren. Jetzt, kurz vor ihrem Abschluss, ist ihr Traum zum Greifen nahe. Alles, was sie tun muss, ist, noch ein weiteres Jahr am Maxton Hall College zu überstehen – die renommierteste und teuerste Privatschule Englands. Seit sie eines der begehrten Stipendien ergattert hat, versucht sie unsichtbar zu sein und ihren Mitschülern so wenig wie möglich aufzufallen. Vor allem von James Beaufort, dem heimlichen Anführer des Colleges, hält sie sich fern. Er ist zu arrogant, zu reich, zu attraktiv, und er verkörpert alles, was Ruby an der High Society Englands nicht ausstehen kann. Zum Glück hat er keine Ahnung, dass Ruby überhaupt existiert – zumindest bis jetzt. Denn als Ruby etwas sieht, was sie nicht hätte sehen dürfen, ist ihr Tarnumhang von einem Moment auf den anderen verschwunden. Mit einem Mal weiß James ganz genau, wer sie ist, und setzt alles daran, sicherzustellen, dass sie den Ruf seiner Familie nicht zerstören wird. Ruby ist irritiert – zum einen, weil James plötzlich überall zu sein scheint, wo sie auch ist, vor allem aber, weil es ihr zunehmend schwerer fällt, das heftige Knistern, das zwischen ihnen herrscht, zu ignorieren. Dabei ist James Beaufort der letzte Mann, zu dem sie sich hingezogen fühlen sollte. Das weiß Ruby. Und doch lässt ihr Herz ihr schon bald keine andere Wahl …
Für Lucie
I was the city that I never wanted to see, I was the storm that I never wanted to be.
GERSEY, ENDLESSNESS
1
Ruby
Mein Leben ist in Farben unterteilt:
Grün – Wichtig!
Türkis – Schule
Pink – Maxton-Hall-Veranstaltungskomitee
Lila – Familie
Orange – Ernährung und Sport
Lila (Embers Outfitbilder machen), Grün (neue Textmarker besorgen) und Türkis (Mrs Wakefield nach dem Lernstoff für die Arbeit in Mathematik fragen) habe ich heute bereits erledigt. Es ist das mit Abstand beste Gefühl der Welt, einen Punkt auf meiner To-do-Liste abzuhaken. Manchmal schreibe ich sogar Aufgaben auf, die ich längst abgeschlossen habe, nur um sie direkt im Anschluss durchstreichen zu können – dann allerdings in einem unauffälligen Hellgrau, damit ich mir nicht ganz so sehr wie eine Schummlerin vorkomme.
Wenn man mein Bullet Journal aufschlägt, erkennt man auf den ersten Blick, dass sich mein Alltag zum größten Teil aus Grün, Türkis und Pink zusammensetzt. Doch vor knapp einer Woche, zu Beginn des neuen Schuljahres, kam eine neue Farbe zum Einsatz:
Gold – Oxford
Die erste Aufgabe, die ich mit dem neuen Stift notiert habe, lautet:
Empfehlungsschreiben bei Mr Sutton abholen
Ich fahre mit dem Finger über die metallisch schimmernden Buchstaben.
Nur noch ein Jahr. Ein letztes Jahr am Maxton Hall College. Es kommt mir beinahe unwirklich vor, dass es jetzt endlich losgeht. Vielleicht sitze ich schon in dreihundertfünfundsechzig Tagen in einem Seminar über Politik und werde von den intelligentesten Menschen der Welt unterrichtet.
Alles in mir kribbelt vor Aufregung, wenn ich darüber nachdenke, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis ich weiß, ob mein größter Wunsch in Erfüllung geht. Ob ich es wirklich geschafft habe und studieren kann. In Oxford.
In meiner Familie hat noch nie jemand studiert, und ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass meine Eltern nicht nur müde gelächelt haben, als ich ihnen zum ersten Mal verkündet habe, dass ich Philosophie, Politologie und Ökonomie in Oxford studieren möchte. Damals war ich sieben.
Aber auch jetzt – zehn Jahre später – hat sich daran nichts geändert, außer dass mein Ziel zum Greifen nah ist. Nach wie vor kommt es mir vor wie ein Traum, dass ich es überhaupt so weit geschafft habe. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich Angst habe, plötzlich aufzuwachen und festzustellen, dass ich doch noch an meine alte Schule gehe und nicht an die Maxton Hall – eine der renommiertesten Privatschulen Englands.
Ich werfe einen Blick auf die Uhr, die über der wuchtigen Holztür des Klassenzimmers hängt. Noch drei Minuten. Die Aufgaben, die wir bearbeiten sollen, habe ich gestern Abend schon fertig gemacht, und jetzt habe ich nichts anderes zu tun, als darauf zu warten, dass diese Stunde endlich zu Ende geht. Ich wippe ungeduldig mit dem Bein, wofür ich augenblicklich einen Hieb in die Seite ernte.
»Autsch«, zische ich und will zurückhauen, aber Lin ist schneller und weicht aus. Ihre Reflexe sind unglaublich. Ich vermute, dass das an der Tatsache liegt, dass sie seit der Grundschule Unterricht im Fechten nimmt. Da muss man schließlich auch schnell wie eine Kobra zustechen können.
»Hör auf, so hibbelig zu sein«, gibt sie zurück, ohne den Blick von ihrem vollgeschriebenen Blatt zu nehmen. »Du machst mich nervös.«
Das lässt mich stutzen. Lin ist nie nervös. Zumindest nicht so, dass sie es zugeben oder zeigen würde. Doch in diesem Moment erkenne ich tatsächlich einen Anflug von Beunruhigung in ihren Augen.
»Tut mir leid. Ich kann nicht anders.« Wieder fahre ich die Buchstaben mit den Fingern nach. In den letzten zwei Jahren habe ich alles getan, um mit meinen Mitschülern mithalten zu können. Um besser zu werden. Um allen zu beweisen, dass ich zu Recht auf die Maxton Hall gehe. Und jetzt, wo der Bewerbungsprozess für die Universitäten beginnt, bringt die Aufregung mich fast um. Selbst wenn ich wollte, könnte ich dagegen nichts machen. Dass es Lin ähnlich zu gehen scheint, beruhigt mich allerdings etwas.
»Sind die Plakate eigentlich schon angekommen?«, fragt Lin. Sie schielt zu mir rüber, und eine Strähne ihrer schulterlangen schwarzen Haare fällt ihr ins Gesicht. Sie streicht sie sich ungeduldig aus der Stirn.
Ich schüttle den Kopf. »Noch nicht. Bestimmt heute Nachmittag.«
»Okay. Morgen nach Bio verteilen wir sie, oder?«
Ich deute auf die entsprechende pinkfarbene Zeile in meinem Bullet Journal, und Lin nickt zufrieden. Wieder schaue ich auf die Uhr. Nur mit Mühe kann ich mich davon abhalten, erneut mit den Beinen zu wippen. Stattdessen fange ich möglichst unauffällig an, meine Stifte einzupacken. Sie müssen mit der Feder alle in dieselbe Richtung zeigen, deshalb brauche ich ohnehin länger dafür.
Den goldenen Stift jedoch packe ich nicht ein, sondern stecke ihn feierlich in das schmale Gummiband meines Planers. Ich drehe die Kappe so, dass sie nach vorne zeigt. Nur so fühlt es sich richtig an.
Als es schließlich klingelt, schießt Lin schneller von ihrem Stuhl hoch, als ich es für menschlich möglich gehalten hätte. Mit hochgezogenen Brauen schaue ich sie an.
»Guck nicht so«, sagt sie, während sie sich ihre Tasche über die Schulter schiebt. »Du hast angefangen!«
Ich erwidere nichts, sondern verstaue nur grinsend den Rest meiner Sachen.
Lin und ich sind die Ersten, die den Raum verlassen. Mit schnellen Schritten durchqueren wir den Westflügel von Maxton Hall und biegen bei der nächsten Abzweigung nach links ab.
In den ersten Wochen habe ich mich in dem riesigen Gebäude ständig verlaufen und bin mehr als einmal zu spät zu den Unterrichtsstunden gekommen. Mir war das unendlich peinlich, auch wenn die Lehrer nicht müde wurden, mir zu versichern, dass es den meisten Neuankömmlingen in Maxton Hall so geht wie mir. Die Schule gleicht einem Schloss: Sie hat fünf Stockwerke, einen Süd-, West- und Ostflügel und drei Nebengebäude, in denen Fächer wie Musik und Informatik unterrichtet werden. Die Abzweigungen und Wege, auf denen man sich verirren kann, sind unzählig, und dass nicht jede Treppe automatisch auch in jedes Stockwerk führt, kann einen in die Verzweiflung treiben.
Doch während ich am Anfang vollkommen verloren war, kenne ich das Gebäude inzwischen wie meine Westentasche. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich den Weg zu Mr Suttons Büro auch mit verbundenen Augen finden würde.
»Ich hätte mir mein Empfehlungsschreiben auch von Sutton schreiben lassen sollen«, grummelt Lin, während wir den Flur entlanggehen. Venezianische Masken zieren die hohen Wände zu unserer Rechten – ein Kunstprojekt des letzten Abschlussjahrgangs. Ich bin schon das eine oder andere Mal davor stehen geblieben und habe die verspielten Details bewundert.
»Wieso?«, frage ich und notiere mir in Gedanken, unserem Hausmeister zu sagen, dass er die Masken in Sicherheit bringen muss, bevor hier am Wochenende die Back-to-School-Party steigt.
»Weil er uns mag, seit wir die Abschlussfeier letztes Jahr gemeinsam organisiert haben, und er weiß, wie engagiert wir sind und wie hart wir arbeiten. Außerdem ist er jung, ambitioniert und hat selbst gerade erst seinen Abschluss in Oxford gemacht. Gott, ich könnte mich echt ohrfeigen, weil ich nicht auch auf die Idee gekommen bin.«
Ich tätschele Lins Arm. »Mrs Marr hat auch in Oxford studiert. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass es besser ankommt, wenn man von jemandem empfohlen wird, der schon ein bisschen mehr Berufserfahrung hat als Mr Sutton.«
Skeptisch sieht sie mich an. »Bereust du etwa, dass du ihn gefragt hast?«
Ich zucke bloß mit den Schultern. Mr Sutton hat Ende des letzten Schuljahres zufällig mitbekommen, wie sehr ich mir wünsche, nach Oxford zu gehen, und mir daraufhin angeboten, ihn über alles, was ich wissen möchte, auszuquetschen. Auch wenn er ein anderes Fach studiert hat, als ich es vorhabe, konnte er mich mit einer ganzen Menge Insiderinformationen versorgen, die ich alle gierig aufgesaugt und später sorgfältig in meinem Planer notiert habe.
»Nein«, antworte ich schließlich. »Ich bin mir sicher, dass er weiß, worauf es in der Empfehlung ankommt.«
Am Ende des Flurs muss Lin links abbiegen. Wir vereinbaren, später noch mal zu telefonieren, und verabschieden uns dann schnell voneinander. Ich werfe einen Blick auf meine Uhr – fünf vor halb zwei – und lege an Tempo zu. Mein Termin mit Sutton ist um halb zwei, und ich will mich auf keinen Fall verspäten. Ich rausche an den hohen Renaissance-Fenstern vorbei, durch die goldenes Septemberlicht in den Flur geworfen wird, und zwänge mich durch eine Gruppe von Schülern, die in der gleichen royalblauen Schuluniform stecken wie ich.
Niemand nimmt Notiz von mir. So läuft das in Maxton Hall. Obwohl wir alle die gleiche Uniform tragen – blau-grün karierte Röcke für die Mädchen, beige Hosen für die Jungs und maßgeschneiderte dunkelblaue Jacketts für alle –, ist nicht zu übersehen, dass ich hier eigentlich nicht hingehöre. Während meine Mitschüler mit teuren Designertaschen in die Schule kommen, ist der Stoff meines khakigrünen Rucksacks an manchen Stellen mittlerweile so dünn, dass ich jeden Tag damit rechne, dass er reißen wird. Ich versuche mich davon nicht einschüchtern zu lassen, auch nicht von der Tatsache, dass sich manche hier benehmen, als würde ihnen die Schule gehören, nur weil sie aus wohlhabenden Familien stammen. Für sie bin ich unsichtbar, und ich tue alles dafür, dass das auch so bleibt. Bloß nicht auffallen. Bis jetzt hat das gut funktioniert.
Ich dränge mich mit gesenktem Blick an den restlichen Schülern vorbei und biege ein letztes Mal rechts ab. Die dritte Tür auf der linken Seite ist die von Mr Sutton. Zwischen seinem und dem Büro davor steht eine schwere Holzbank, und ich lasse meinen Blick von ihr zu meiner Uhr und wieder zurück wandern. Noch zwei Minuten.
Ich halte es keine Sekunde länger aus. Entschlossen streiche ich meinen Rock glatt, richte mein Jackett und überprüfe, ob meine Krawatte noch an Ort und Stelle sitzt. Dann trete ich an die Tür und klopfe.
Keine Antwort.
Seufzend nehme ich doch auf der Bank Platz und schaue in beide Richtungen des Flurs. Vielleicht holt er sich noch schnell etwas zu essen. Oder einen Tee. Oder Kaffee. Was mich daran denken lässt, dass ich heute besser keinen hätte trinken sollen. Ich war ohnehin schon aufgeregt genug, aber Mum hatte zu viel gekocht, und ich hatte ihn nicht wegkippen wollen. Jetzt zittern meine Hände leicht, als ich einen erneuten Blick auf meine Armbanduhr werfe.
Es ist halb zwei. Auf die Minute genau.
Erneut blicke ich den Gang entlang. Niemand in Sicht.
Vielleicht habe ich nicht laut genug geklopft. Oder – und der Gedanke treibt meinen Puls in die Höhe – ich habe mich vertan. Vielleicht ist unser Termin nicht heute, sondern morgen. Ich zerre hektisch am Reißverschluss meines Rucksacks und hole meinen Planer heraus. Aber als ich hineinschaue, ist alles richtig. Richtiges Datum, richtige Uhrzeit.
Kopfschüttelnd schließe ich meinen Rucksack wieder. Normalerweise bin ich nicht so durch den Wind, aber der Gedanke, dass bei meiner Bewerbung irgendetwas schiefgehen und ich deshalb nicht in Oxford angenommen werden könnte, lässt mich beinahe durchdrehen.
Ich ermahne mich selbst, wieder runterzukommen. Entschlossen stehe ich auf, gehe zur Tür und klopfe erneut.
Diesmal höre ich ein Geräusch. Es klingt, als wäre etwas zu Boden gefallen. Vorsichtig öffne ich die Tür und spähe in das Zimmer.
Mein Herz setzt aus.
Ich habe richtig gehört.
Mr Sutton ist da.
Aber … er ist nicht allein.
Auf seinem Schreibtisch sitzt eine Frau, die ihn leidenschaftlich küsst. Er steht zwischen ihren Beinen, beide Hände um ihre Schenkel gelegt. Im nächsten Moment packt er sie fester und zieht sie nach vorne auf die Tischkante. Sie stöhnt leise in seinen Mund, als ihre Lippen erneut miteinander verschmelzen, und vergräbt die Hände in seinem dunklen Haar. Ich kann nicht erkennen, wo der eine von ihnen anfängt und der andere aufhört.
Ich wünschte, ich könnte meinen Blick von den beiden abwenden. Aber ich schaffe es nicht. Nicht, als er seine Hände noch weiter unter ihren Rock schiebt. Nicht, als ich seinen schweren Atem höre und sie leise »Gott, Graham« seufzt.
Als ich mich endlich aus meiner Schockstarre befreie, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wie meine Beine funktionieren. Ich stolpere über die Türschwelle, und die Tür geht so schwungvoll auf, dass sie gegen die Wand knallt. Mr Sutton und die Frau springen auseinander. Er reißt den Kopf herum und sieht mich im Türrahmen. Ich öffne den Mund, um mich zu entschuldigen, aber alles, was ich hervorbringe, ist ein trockenes Keuchen.
»Ruby«, sagt Mr Sutton atemlos. Seine Haare sind völlig zerzaust, die oberen Knöpfe seines Hemds geöffnet, und sein Gesicht ist gerötet. Er kommt mir fremd vor, gar nicht mehr wie mein Lehrer.
Ich spüre, wie mir eine mörderische Hitze in die Wangen jagt. »Ich … tut mir leid. Ich dachte, wir hätten einen …«
Da dreht sich die junge Frau um, und der Rest des Satzes bleibt mir im Hals stecken. Mein Mund klappt auf, und eisige Kälte breitet sich in meinem Körper aus. Ich starre das Mädchen an. Ihre türkisblauen Augen sind mindestens genauso weit aufgerissen wie meine eigenen. Ruckartig wendet sie den Blick ab, senkt ihn auf ihre teuren High Heels, lässt ihn über den Boden schweifen und sieht dann Mr Sutton – Graham, wie sie eben noch geseufzt hat – hilflos an.
Ich kenne sie. Insbesondere kenne ich ihren rotblonden, perfekt gewellten Pferdeschwanz, der in Geschichte immer vor mir baumelt.
In Mr Suttons Unterricht.
Das Mädchen, das hier eben mit meinem Lehrer geknutscht hat, ist Lydia Beaufort.
Mir wird schwindelig. Außerdem bin ich mir sicher, mich jeden Moment übergeben zu müssen.
Ich starre die beiden an und versuche alles, um die letzten Minuten aus meinem Kopf zu löschen – aber es ist unmöglich. Ich weiß es, und Mr Sutton und Lydia wissen es auch, das kann ich deutlich an ihren schockierten Mienen erkennen. Ich mache einen Schritt zurück, Mr Sutton mit ausgestreckter Hand einen auf mich zu. Ich stolpere erneut über die Türschwelle und kann mich gerade so fangen.
»Ruby …«, fängt er an, aber das Rauschen in meinen Ohren wird immer lauter.
Ich mache auf dem Absatz kehrt und renne los. Hinter mir kann ich hören, wie Mr Sutton erneut meinen Namen sagt, diesmal deutlich lauter.
Aber ich laufe einfach weiter. Und weiter.
2
James
Jemand malträtiert mit einem Presslufthammer meinen Schädel.
Das ist das Erste, was ich realisiere, als ich langsam wach werde. Das Zweite ist der nackte warme Körper, der halb auf meinem liegt.
Ich werfe einen Blick zur Seite, aber alles, was ich erkenne, ist eine honigblonde Haarmähne. Ich kann mich nicht daran erinnern, Wrens Party mit jemandem verlassen zu haben. Wenn ich ehrlich sein soll, kann ich mich gar nicht daran erinnern, die Party verlassen zu haben. Ich schließe die Augen wieder und versuche, Bilder vom letzten Abend hervorzurufen, aber alles, was ich noch weiß, sind ein paar unzusammenhängende Gedankenfetzen: Ich, betrunken auf einem Tisch. Wrens lautes Lachen, als ich hinunterstürze und vor seinen Füßen auf dem Boden lande. Alistairs warnender Blick, als ich eng mit seiner großen Schwester tanze und mich fest gegen ihre Rückseite presse.
Oh, fuck.
Vorsichtig hebe ich die Hand und streiche dem Mädchen das Haar aus der Stirn.
Doppel-fuck.
Alistair wird mich umbringen.
Ruckartig setze ich mich auf. Ein stechender Schmerz schießt durch meinen Kopf, und einen Moment lang ist mir schwarz vor Augen. Neben mir grummelt Elaine etwas Unverständliches und dreht sich auf die andere Seite. Gleichzeitig stelle ich fest, dass es sich bei dem Presslufthammer um mein Handy handelt, das auf dem Nachttisch liegt und vibriert. Ich ignoriere es und suche den Boden nach meiner Kleidung ab. Einen Schuh finde ich in der Nähe vom Bett, den anderen direkt vor der Tür unter meiner schwarzen Hose und dem dazugehörigen Gürtel. Mein Hemd liegt über dem braunen Ledersessel. Als ich es überstreife und zumachen will, merke ich, dass ein paar Knöpfe fehlen. Ich stöhne auf und hoffe inständig, dass Alistair nicht mehr da ist. Er braucht weder das zerstörte Hemd zu sehen, noch die roten Kratzer, die Elaine mit ihren pink lackierten Fingernägeln auf meiner Brust hinterlassen hat.
Mein Handy beginnt erneut zu vibrieren. Ich werfe einen Blick auf das Display, und der Name meines Vaters leuchtet mir entgegen. Großartig. Es ist kurz vor zwei an einem Schultag, mein Kopf fühlt sich an, als würde er jeden Moment platzen, und ich hatte mit ziemlicher Sicherheit Sex mit Elaine Ellington. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist die Stimme meines Vaters in meinem Ohr. Entschlossen drücke ich ihn weg.
Was ich jedoch brauche, ist eine Dusche. Und frische Klamotten. Ich schleiche mich aus Wrens Gästezimmer und schließe so leise wie möglich die Tür hinter mir. Auf dem Weg nach unten begegnen mir die Überreste der letzten Nacht – ein BH und mehrere andere Kleidungsstücke hängen über dem Treppengeländer, überall im Foyer sind Becher, Gläser und Teller mit Essensresten verteilt. Der Geruch von Alkohol und Rauch liegt in der Luft. Es ist nicht zu übersehen, dass hier bis vor wenigen Stunden eine Party gefeiert wurde.
Im Salon finde ich Cyril und Keshav. Cyril pennt auf dem teuren weißen Sofa von Wrens Eltern, und Kesh sitzt auf dem Sessel beim Kamin. Auf seinem Schoß hat es sich ein Mädchen bequem gemacht, das die Hände in seinem langen schwarzen Haar vergräbt und ihn leidenschaftlich küsst. Die beiden sehen aus, als würde die Party gerade wieder losgehen. Als Kesh sich kurz von ihr löst und mich entdeckt, wirft er den Kopf in den Nacken und lacht los. Ich zeige ihm im Vorbeigehen den Mittelfinger.
Die opulenten Glastüren, die in den Garten der Fitzgeralds führen, sind weit geöffnet. Ich trete hinaus und muss die Augen zusammenkneifen. Das Sonnenlicht ist nicht sonderlich grell, fühlt sich aber trotzdem an wie ein Stich direkt in meine Schläfe. Vorsichtig blicke ich mich um. Hier draußen sieht es nicht besser aus als im Haus. Eher im Gegenteil.
Auf den Liegen beim Pool finde ich Wren und Alistair. Sie haben ihre Arme hinter dem Kopf verschränkt, die Augen hinter Sonnenbrillen verborgen. Ich zögere nur einen Moment, dann schlendere ich zu ihnen.
»Beaufort«, sagt Wren erfreut und schiebt die Brille hoch, sodass sie auf seinem krausen schwarzen Haar sitzt. Zwar grinst er breit, aber ich kann trotzdem erkennen, wie fahl seine dunkelbraune Haut wirkt. Er muss einen ziemlichen Kater haben, genau wie ich. »Nette Nacht gehabt?«
»Kann mich nicht richtig erinnern«, antworte ich und wage einen Blick in Alistairs Richtung.
»Fick dich, Beaufort«, sagt dieser, ohne mich anzusehen. Sein Haar schimmert golden in der Mittagssonne. »Ich habe dir gesagt, dass du deine Finger von meiner Schwester lassen sollst.«
Mit dieser Reaktion habe ich gerechnet. Unbeeindruckt hebe ich eine Braue. »Ich habe sie nicht in mein Bett gezwungen. Tu nicht so, als könnte sie nicht selbst entscheiden, mit wem sie Sex haben will.«
Alistair verzieht gequält das Gesicht und gibt ein unverständliches Brummen von sich.
Ich hoffe, dass er sich wieder einkriegen und mir die Sache nicht ewig nachtragen wird, schließlich kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Und eigentlich habe ich auch keine Lust, mich vor meinen Freunden zu rechtfertigen. Das muss ich zu Hause schon oft genug.
»Wehe, du brichst ihr das Herz«, sagt Alistair nach einer Weile und sieht mich durch die spiegelnden Gläser seiner Pilotenbrille an. Obwohl ich seine Augen nicht erkennen kann, weiß ich, dass sein Blick nicht wütend, sondern eher resigniert ist.
»Elaine kennt James, seit sie fünf ist«, wirft Wren ein. »Sie weiß genau, was sie von ihm zu erwarten hat.«
Wren hat recht. Elaine und ich wussten gestern beide, worauf wir uns einlassen. Und auch wenn ich mich an kaum etwas erinnern kann, habe ich ihre atemlose Stimme noch deutlich im Ohr: Das passiert nur ein Mal, James. Ein einziges Mal.
Alistair will es nicht wahrhaben, aber seine Schwester ist genauso wenig ein Kind von Traurigkeit wie ich.
»Wenn deine Eltern das erfahren, werden sie augenblicklich eure Verlobung ankündigen«, fügt Wren nach einer Weile amüsiert hinzu.
Ich verziehe die Mundwinkel missmutig. Meine Eltern sind schon seit Jahren scharf darauf, mich mit Elaine Ellington zu verloben – oder irgendeiner anderen Tochter einer wohlhabenden Familie mit riesigem Erbe. Aber mit achtzehn habe ich deutlich Besseres zu tun, als auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, was oder wer nach meinem Schulabschluss auf mich zukommt.
Auch Alistair schnaubt verächtlich. Er scheint genauso wenig angetan zu sein von der Idee, mich demnächst als neues Mitglied seiner Familie begrüßen zu dürfen. Gespielt gekränkt drücke ich mir die Hand auf die Brust. »Das klingt ja fast, als möchtest du nicht, dass ich dein Schwager werde.«
Jetzt schiebt er die Brille hoch in sein gewelltes Haar und funkelt mich aus dunklen Augen an. Langsam wie ein Raubtier erhebt er sich von der Liege. Obwohl er eine schlanke Figur hat, weiß ich, wie stark und schnell er sein kann. Das habe ich beim Training oft genug am eigenen Leib erfahren.
Der Blick, mit dem er mich ansieht, lässt mich erahnen, was er vorhat.
»Ich warne dich, Alistair«, knurre ich und mache einen Schritt nach hinten.
Es geht schneller, als ich blinzeln kann. Plötzlich steht er direkt vor mir. »Ich habe dich auch gewarnt«, erwidert er. »Hat dich leider nicht interessiert.«
Im nächsten Moment versetzt er mir einen heftigen Stoß vor die Brust. Ich stolpere nach hinten, direkt in den Pool. Der Aufprall treibt mir die Luft aus der Lunge, und einen Moment lang weiß ich nicht, wo oben und unten ist. Das Wasser rauscht in meinen Ohren, die pochenden Kopfschmerzen kommen mir unter Wasser noch viel schlimmer vor.
Dennoch tauche ich nicht sofort auf. Ich lasse meinen Körper schlaff werden und verharre in derselben Position, mit dem Gesicht nach unten. Ich starre auf die Kacheln des Pools, die ich von hier nur verschwommen erkennen kann, und zähle in Gedanken die Sekunden. Für einen Moment schließe ich die Augen. Es ist beinahe friedlich still. Nach einer halben Minute geht mir allmählich die Luft aus, und der Druck auf meiner Brust nimmt zu. Ich lasse eine letzte dramatische Luftblase nach oben steigen, warte weiter, und dann …
Alistair springt in den Pool und packt mich. Er reißt mich mit sich an die Oberfläche, und als ich die Augen aufmache und seinen geschockten Blick sehe, muss ich gleichzeitig losprusten und nach Luft schnappen.
»Beaufort!«, schreit er fassungslos und stürzt sich auf mich. Seine Faust landet in meiner Seite – verdammt, seine Schläge sind hart –, und er versucht, mich in den Schwitzkasten zu nehmen. Dadurch, dass er kleiner als ich ist, funktioniert das nicht so, wie er es sich erhofft hat. Wir rangeln einen Moment, dann bekomme ich ihn zu fassen. Mit Leichtigkeit hebe ich ihn hoch und schmeiße ihn so weit wie möglich von mir. Wrens Lachen dringt an mein Ohr, als Alistair mit einem lauten Platschen untergeht. Als er wieder auftaucht, starrt er mich einen Moment lang so wütend an, dass ich erneut losprusten muss. Alistair hat, wie alle Ellingtons, ein totales Engelsgesicht. Selbst wenn er bedrohlich aussehen will – seine hellbraunen Augen gepaart mit den blonden Locken und seinen scheißperfekten Gesichtszügen machen das einfach unmöglich.
»Du bist ein Wichser der übelsten Sorte«, sagt er und spritzt mir einen Schwall Wasser entgegen.
Ich wische mir mit der Hand übers Gesicht. »Tut mir leid, Mann.«
»Schon okay«, erwidert er, bespritzt mich aber weiter mit Wasser. Ich breite die Arme aus und lasse es über mich ergehen. Irgendwann hört er auf, und als ich ihn ansehe, schüttelt er nur lachend den Kopf.
Da weiß ich, dass zwischen uns alles in Ordnung ist.
»James?«, erklingt eine vertraute Stimme.
Ich wirble herum. Meine Zwillingsschwester steht am Beckenrand und verdeckt die Sonne. Sie war gestern nicht auf der Party, und einen Moment lang glaube ich, dass sie mir die Hölle heißmachen will, weil ich mit den Jungs heute den Unterricht geschwänzt habe. Aber dann schaue ich richtig hin, und mir wird eiskalt: Ihre Schultern sind schlaff, die Arme hängen kraftlos neben ihrem Körper. Unsere Blicke meidend, starrt sie auf ihre Füße.
So schnell ich kann, schwimme ich zu ihr und steige aus dem Pool. Mir ist egal, wie nass ich bin, ich fasse sie bei den Oberarmen und zwinge sie, den Kopf zu heben und mich anzusehen. Mein Magen macht einen Salto. Lydias Gesicht ist rot und geschwollen. Sie muss geweint haben.
»Was ist los?«, frage ich und halte sie ein bisschen fester an den Armen. Sie will den Kopf wegdrehen, aber das lasse ich nicht zu. Ich umfasse ihr Kinn, damit sie meinem Blick nicht ausweichen kann.
In ihren Augen schimmern Tränen. Meine Kehle wird trocken.
»James«, flüstert sie heiser. »Ich habe Mist gebaut.«
3
Ruby
»Hier ist perfekt«, sagt Ember und bringt sich zwischen dem Stechginster und dem Apfelbaum in Position.
Überall in unserem kleinen Garten sind Äpfel verteilt, die wir noch einsammeln müssen. Aber auch wenn unsere Eltern bereits seit Tagen drängeln – Äpfel pflücken steht in Lila erst am Donnerstag in meinem Kalender.
Ich weiß jetzt schon, dass in dem Moment, in dem Ember und ich die Körbe ins Haus bringen, zwischen Mum und Dad ein Streit ausbrechen wird, wer den größeren Anteil bekommt. Wie jedes Jahr plant Mum nämlich, Kuchen und Teigtaschen zu backen, die sie in der Bäckerei zum Probieren auslegen kann, während Dad gefühlt Hunderte von Marmeladen in den abenteuerlichsten Geschmacksrichtungen kochen will. Im Gegensatz zu Mum hat er in dem mexikanischen Restaurant, in dem er arbeitet, leider niemanden, dem er sie zum Probieren geben kann. Das bedeutet, dass Ember und ich wahrscheinlich wieder als Versuchskaninchen herhalten müssen, was im Falle eines neuen Tortilla-Rezepts echt toll sein kann – bei Apfelmarmelade mit Kardamom und Chili allerdings überhaupt nicht.
»Was meinst du?«
Ember steht in geübter Pose vor mir. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie gut sie das kann. Ihre Haltung ist locker, und sie schüttelt kurz den Kopf, damit die Locken ihrer langen hellbraunen Haare noch etwas wilder fallen. Als sie lächelt, strahlen ihre grünen Augen förmlich, und ich frage mich, wie es sein kann, dass sie nach dem Aufstehen schon so wach aussieht. Ich habe es bisher nicht mal geschafft, meine Haare zu kämmen, und mein gerader Pony steht mit Sicherheit senkrecht in Richtung Himmel. Und meine Augen, die die gleiche Farbe wie Embers haben, leuchten überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie sind so müde und trocken, dass ich ständig blinzeln muss in dem Versuch, das unangenehme Brennen loszuwerden.
Es ist kurz nach sieben Uhr morgens, und ich habe die halbe Nacht damit verbracht, wach zu liegen und über das zu grübeln, was ich gestern Nachmittag gesehen habe. Als Ember vor einer Stunde in mein Zimmer gekommen ist, hatte ich das Gefühl, gerade erst eingeschlafen zu sein.
»Du siehst toll aus«, antworte ich und hebe die kleine Digitalkamera hoch. Ember gibt mir das Signal, und ich schieße drei Bilder, danach verändert sie ihre Pose, dreht sich zur Seite und wirft mir – oder besser gesagt der Kamera – einen Blick über die Schulter zu. Das Kleid, das sie heute trägt, hat einen schwarzen Bubikragen und ein auffälliges, blaues Muster. Sie hat es von Mum stibitzt und etwas abgeändert, damit es eine Taille bekommt.
Seit ich denken kann, ist Ember übergewichtig, und sie kämpft regelmäßig damit, Kleidung für ihren Körperbau zu finden, die tailliert ist. Leider ist der Markt davon nicht gerade überschwemmt, und sie muss ständig improvisieren. Zu ihrem dreizehnten Geburtstag hat sie sich von unseren Eltern ihre erste eigene Nähmaschine gewünscht, mit der sie seitdem Kleidung näht, die ihr gefällt.
Ember weiß inzwischen ganz genau, was ihr steht. Sie hat ein tolles Händchen für Streetstyle. Zu ihrem heutigen Kleid hat sie beispielsweise eine Jeansjacke und weiße Sneakers mit silbernen Fersen kombiniert, die sie selbst bemalt hat.
Mir ist vor ein paar Tagen in einem Modemagazin eine Jacke aufgefallen, deren Stoff wie das Material aussah, aus dem Müllsäcke gemacht sind. Ich habe die Nase gerümpft und schnell weitergeblättert, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, bin ich mir ziemlich sicher, dass Ember die Jacke wie ein Supermodel rocken würde.
Mit Sicherheit hat das viel mit dem Selbstbewusstsein zu tun, das sie ausstrahlt – vor der Kamera, aber auch im wirklichen Leben.
Das war nicht immer so. Ich erinnere mich noch an die Tage, an denen sie sich todunglücklich in ihrem Zimmer verkrochen hat, weil sie in der Schule gehänselt wurde. Damals wirkte Ember klein und verletzlich, aber mit der Zeit hat sie gelernt, ihren Körper zu akzeptieren und das, was andere über sie sagen, zu ignorieren.
Ember hat kein Problem damit, sich als »dick« zu bezeichnen. »Es ist einfach nur eine Beschreibung«, erklärt sie immer, wenn jemand über ihre Wortwahl überrascht ist. »Wie ›schlank‹ oder ›dünn‹. Es ist nur ein Wort – und zwar kein negatives.«
Es war ein langer Weg, bis Ember das gelernt hat, was der Grund ist, warum sie ihren Blog eröffnet hat. Sie wollte anderen, die in einer ähnlichen Situation wie sie sind, dabei helfen, sich selbst zu akzeptieren. Ember teilt der Welt seit über einem Jahr mit, dass sie sich schön findet so, wie sie ist, und hat sich mit ihren leidenschaftlichen Beiträgen zum Thema Plus Size Fashion eine Community aufgebaut, innerhalb der sie als Vorreiterin und Inspirationsquelle gilt.
Auch Mum, Dad und ich haben unglaublich viel von ihr gelernt – nicht zuletzt, weil sie uns immer wieder mit Artikeln rund um das Thema versorgt – und sind wahnsinnig stolz auf das, was sie geschafft hat.
»Ich glaube, ich habe es schon«, sage ich, nachdem ich auch ihre dritte Pose abgelichtet habe. Ember kommt sofort zu mir und schnappt sich die Kamera. Als sie sich durch die Aufnahmen klickt, kräuselt sich ihre Nase kritisch. Bei einem der Bilder, auf denen sie über die Schulter blickt, lächelt sie aber schließlich.
»Das nehme ich.« Sie drückt mir einen Kuss auf die Wange. »Danke.«
Zusammen gehen wir durch den Garten zurück ins Haus und versuchen dabei, unsere Füße zwischen den heruntergefallenen Äpfeln zu platzieren. »Wann geht der Beitrag online?«, frage ich.
»Morgen Nachmittag, habe ich gedacht.« Sie wirft mir einen Seitenblick zu. »Meinst du, du hättest heute Abend noch Zeit, einmal drüberzuschauen?«
Eigentlich nicht. Ich muss heute nach dem Unterricht die Plakate für die Feier am Wochenende aufhängen und danach mein Referat in Geschichte weiter ausarbeiten. Außerdem muss ich mir einen Plan überlegen, wie ich an mein Empfehlungsschreiben gelange, ohne jemals wieder ein Wort mit Mr Sutton sprechen zu müssen. Allein der Gedanke an gestern – an Lydia Beaufort auf seinem Schreibtisch und an ihn zwischen ihren Beinen – lässt die Übelkeit wieder in mir aufsteigen. Die Geräusche, die die beiden gemacht haben …
Ruckartig versuche ich mir die Erinnerung aus dem Kopf zu schütteln, was allerdings nur zur Folge hat, dass Ember mich verwundert ansieht.
»Mache ich gerne«, sage ich schnell und schiebe mich an ihr vorbei ins Wohnzimmer. Ich kann Ember nicht in die Augen sehen. Wenn sie die Ringe unter meinen Augen entdeckt, weiß sie sofort, dass irgendwas nicht stimmt, und ihre Fragen kann ich gerade ganz und gar nicht gebrauchen.
Nicht, wenn ich Mr Suttons ersticktes Stöhnen einfach nicht aus meinen Ohren bekomme, egal, wie sehr ich es auch versuche.
»Guten Morgen, Schatz.«
Die Stimme meiner Mutter lässt mich zusammenzucken, und ich bemühe mich schleunigst, meine Gesichtszüge unter Kontrolle zu bekommen und normal auszusehen. Oder wie auch immer man eben aussieht, wenn man seinen Lehrer nicht beim Rummachen mit seiner Schülerin erwischt hat.
Mum kommt zu mir und drückt mir einen Kuss auf die Wange. »Alles in Ordnung? Du siehst müde aus.«
Anscheinend muss ich das mit dem normalen Gesichtsausdruck noch mal üben.
»Ja, ich brauche nur Koffein«, murmle ich und lasse mich von ihr zum Frühstückstisch manövrieren. Sie füllt eine Tasse mit Kaffee und streichelt noch einmal über meinen Kopf, bevor sie sie vor mir auf den Tisch stellt. Ember geht währenddessen zu Dad und zeigt ihm die Bilder, die ich von ihr gemacht habe. Sofort legt er die Zeitung beiseite und beugt sich über das Display. Er lächelt, wobei die leichten Falten um seine Mundwinkel tiefer werden. »Sehr hübsch.«
»Erkennst du das Kleid, Liebling?«, fragt Mum. Sie beugt sich von hinten über ihn und legt die Hand auf seine Schulter.
Dad hebt die Kamera höher, und hinter den Gläsern seiner Lesebrille wird sein Blick nachdenklich. »Ist das … ist das das Kleid, das du bei unserem zehnten Jahrestag anhattest?« Er schaut über die Schulter zu Mum, und sie nickt. Mum und Ember haben in etwa den gleichen Körperbau, weshalb Ember zu Beginn ihrer Nähmaschinen-Karriere einiges an Kleidung zur Verfügung hatte, mit der sie herumexperimentieren konnte. Anfangs war Mum immer traurig, wenn Ember sich vernäht und die Kleider mehr oder weniger zerstört hat, aber das passiert kaum noch. Inzwischen freut sie sich über alles, was Ember aus ihren alten Kleidern und Blusen zaubert.
»Ich habe es tailliert und einen Kragen drangenäht«, sagt Ember. Sie setzt sich an den Tisch und schüttet Cornflakes in eine der Schüsseln, die Mum für uns bereitgestellt hat.
Auf Dads Gesicht breitet sich ein Lächeln aus. »Es ist wirklich sehr schön geworden«, sagt er und greift nach Mums Hand. Er zieht daran, bis ihr Gesicht auf seiner Höhe ist, dann gibt er ihr einen zärtlichen Kuss.
Ember und ich sehen uns an, und ich weiß, dass sie das Gleiche wie ich denkt: Ugh. Unsere Eltern sind so verliebt ineinander, dass einem manchmal ein bisschen schlecht davon werden kann. Aber wir tragen es mit Fassung. Und wenn ich bedenke, was mit Lins Familie passiert ist, weiß ich zu schätzen, dass meine eigene intakt ist. Zumal wir für das starke Band, das uns verbindet, hart arbeiten mussten.
»Sag mir Bescheid, wenn dein Beitrag online ist«, sagt Mum, nachdem sie neben Dad Platz genommen hat. »Ich will ihn gleich lesen können.«
»Okay«, antwortet Ember mit vollem Mund.
Wir müssen uns beeilen, wenn wir rechtzeitig zum Schulbus kommen wollen, also kann ich verstehen, dass sie so schlingt.
»Du schaust aber vorher noch mal drüber, oder?«, fragt Dad an mich gewandt.
Auch nach über einem Jahr ist Dad noch skeptisch, was Embers Blog angeht. Ihm ist das Internet nicht geheuer, vor allem nicht, wenn seine Tochter Bilder und Gedanken von sich dort preisgibt. Es hat Ember einige Kraft gekostet, Dad davon zu überzeugen, dass ein Modeblog für Plus Size Fashion eine gute Idee ist. Aber Ember hat Bellbird mit so viel Enthusiasmus und Mut angegangen, dass Dad eigentlich keine andere Wahl hatte, als es ihr zu erlauben. Seine einzige Bedingung ist, dass ich – als vernünftige große Schwester – Embers Blogartikel testlese und die Bilder überprüfe, bevor sie sie postet, damit keine Details aus unserem Privatleben im Netz landen. Aber seine Sorge ist unbegründet. Ember arbeitet sorgfältig und professionell, und ich bewundere sie für das, was sie mit Bellbird in so kurzer Zeit schon erreicht hat.
»Na klar.« Ich schiebe mir ebenfalls einen Löffel Cornflakes in den Mund und spüle ihn mit einem großen Schluck Kaffee runter. Jetzt ist Ember diejenige, die mich angewidert ansieht, aber ich ignoriere sie. »Ich komme heute ein bisschen später, nur dass ihr euch nicht wundert.«
»Ist viel los in der Schule?«, fragt Mum.
Wenn du wüsstest.
Am liebsten würde ich Mum, Dad und Ember erzählen, was passiert ist. Ich weiß, dass es mir danach besser gehen würde. Aber ich kann nicht. Mein Zuhause und Maxton Hall sind zwei verschiedene Welten, die nicht zusammengehören. Und ich habe mir geschworen, sie niemals zu vermischen. Deshalb weiß in meiner Schule niemand etwas über meine Familie, und deshalb weiß meine Familie auch nichts über das, was in Maxton Hall passiert. Diese Grenze habe ich an meinem ersten Tag an der Schule gezogen, und es war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Ich weiß, dass Ember sich oft über meine Verschlossenheit ärgert, und ich habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn meine Eltern es nicht schaffen, ihre Enttäuschung schnell genug zu verstecken, wenn ich auf ihr »Wie war dein Tag?« nicht mehr als »Okay« antworte. Doch mein Zuhause ist meine Ruheoase. Hier zählt Familie und Loyalität und Treue und Liebe. In Maxton Hall zählt nur eine Sache: Geld. Und ich habe Angst, dass ich unseren friedlichen Ort zerstören werde, wenn ich Dinge von dort mit hierher schleppe.
Abgesehen davon, dass es mich nichts angeht, was Mr Sutton und Lydia Beaufort miteinander treiben, würde ich die beiden ohnehin niemals verpetzen. Dass in Maxton Hall niemand etwas über mein Privatleben weiß, funktioniert nämlich nur, weil ich mich eisern an die Regel halte, die ich für mich selbst aufgestellt habe: Bloß nicht auffallen! Seit zwei Jahren setze ich alles daran, für den Großteil meiner Mitschüler unsichtbar zu bleiben und unterhalb ihres Radars zu laufen.
Wenn ich die Sache mit Mr Sutton jemandem erzähle oder damit zum Schulleiter gehe, würde das einen Skandal auslösen. Das kann ich nicht riskieren, schon gar nicht jetzt, wo ich so nah an meinem eigentlichen Ziel bin.
Lydia Beaufort und ihre gesamte Familie – vor allem ihr scheußlicher Bruder – sind genau die Art von Menschen, zu denen ich meilenweit Abstand halten sollte. Die Beauforts führen den ältesten und größten Herrenausstatter Englands. Sie haben nicht nur überall im Land, sondern vor allem auch überall in Maxton Hall ihre Finger mit im Spiel. Sogar unsere Schuluniformen wurden von ihnen entworfen.
Nein. Mit den Beauforts sollte ich mich auf keinen Fall anlegen.
Ich werde einfach so tun, als wäre nichts passiert.
Als ich meine Mutter schließlich anlächle und »Halb so wild« murmle, weiß ich, wie gezwungen es aussehen muss. Umso dankbarer bin ich, als sie nicht nachhakt und mir stattdessen kommentarlos eine weitere Tasse Kaffee einschenkt.
Die Schule ist der Horror. Ich versuche, mich auf den Unterricht zu konzentrieren, aber meine Gedanken schweifen ständig ab. Zwischen den Stunden habe ich panische Angst, Mr Sutton oder Lydia auf dem Flur zu begegnen, und sprinte förmlich von einem Klassenzimmer zum nächsten. Lin wirft mir mehr als einmal einen schrägen Blick von der Seite zu, woraufhin ich mich selbst ermahne, mich zusammenzureißen. Das Letzte, was ich will, ist, dass sie anfängt, Fragen zu stellen, auf die ich ihr keine Antworten geben kann. Zumal ich mir ziemlich sicher bin, dass sie mir die Ausrede nicht abgenommen hat, dass ich mich gestern im Termin geirrt und mein Empfehlungsschreiben deshalb noch nicht habe.
Nach der letzten Stunde gehen wir gemeinsam zum Sekretariat und holen die Plakate ab, die gestern endlich mit der Post gekommen sind. Ich wäre lieber erst mal in die Mensa gegangen – mein Magen hat in Biologie so laut geknurrt, dass sogar der Lehrer sich einmal nach mir umgedreht hat –, aber Lin hatte die Idee, dass wir auf dem Weg dorthin schon ein paar aufhängen und so Zeit sparen können.
Wir beginnen in der Aula, wo wir das erste Plakat gemeinsam an einer der mächtigen Säulen befestigen. Als ich sicher bin, dass die Klebestreifen halten, trete ich ein paar Schritte zurück und verschränke die Arme. »Was meinst du?«, frage ich Lin.
»Perfekt. An der Stelle fällt es jedem auf, der durch den Haupteingang hier reinkommt.« Sie dreht sich zu mir und lächelt. »Das ist echt hübsch geworden, Ruby.«
Ich betrachte die verschlungenen schwarzen Buchstaben, in denen die Back-to-School-Party angekündigt wird, noch eine Weile. Doug hat uns wirklich eine tolle Grafik gezaubert – die Schrift kombiniert mit den dezenten Sprenkeln in Gold sieht auf dem silbernen Hintergrund edel und glamourös aus, gleichzeitig aber auch modern genug, dass es als Schulparty durchgeht.
Maxton Hall ist für seine legendären Partys bekannt. In dieser Schule wird alles gefeiert – Schulstart, Schulende, Gründungstag, Halloween, Weihnachten, Neujahr, Rektor Lexingtons Geburtstag … Das Budget, das dem Veranstaltungsteam zur Verfügung steht, ist schwindelerregend hoch. Aber – wie Lexington uns immer wieder ins Gedächtnis ruft – das Image, das wir uns mit erfolgreichen Events aufbauen, ist mit Geld nicht zu bezahlen. Denn die Maxton-Hall-Partys sind nur in der Theorie für die Schüler. In erster Linie will man Eltern, Sponsoren, Politiker und alle anderen Menschen mit viel Geld anlocken, die unsere Schule finanzieren und durch ihre Unterstützung dafür sorgen, dass ihre Kinder den besten Start ins Leben bekommen – und auf direktem Weg in Cambridge oder Oxford landen.
Als ich auf die Schule gekommen bin, musste ich mich für eine extracurriculare Aktivität entscheiden, und das Veranstaltungskomitee erschien mir die beste Wahl: Ich liebe es, zu planen und zu organisieren, und dort kann ich im Hintergrund agieren, ohne dass meine Mitschüler Notiz von mir nehmen. Dass ich so einen Spaß an der Sache haben würde, habe ich nicht erwartet. Und auch nicht, dass ich mir zwei Jahre später die Leitung des Teams mit Lin teilen würde.
Lin dreht sich zu mir, ein breites Grinsen auf ihrem Gesicht. »Ist es nicht das beste Gefühl der Welt, dass uns dieses Jahr niemand herumscheuchen kann?«
»Ich glaube, ich hätte keinen einzigen weiteren Tag unter Elaine Ellingtons Fuchtel ertragen, ohne sie zu verprügeln«, gebe ich zurück, und Lin kichert leise. »Lach nicht. Ich meine es ernst.«
»Das hätte ich gerne gesehen.«
»Und ich hätte es gerne getan.«
Elaine war eine unausstehliche Teamleiterin – herrisch und unfair und faul –, aber die Wahrheit ist, dass ich ihr natürlich niemals etwas zuleide getan hätte. Abgesehen davon, dass ich nichts von Gewalt halte, hätte ich damit auch gegen meine Regel verstoßen, alles dafür zu tun, um hier nicht aufzufallen.
Aber jetzt hatte es sich ohnehin erledigt. Elaine hat ihren Abschluss gemacht und die Schule verlassen. Und dass ihre diktatorische Art bei den anderen im Team ebenso wenig ankam wie bei uns, hat sich herausgestellt, als Lin und ich zu ihrer Nachfolgerin gewählt wurden – eine Tatsache, die mir noch immer unwirklich vorkommt.
»Sollen wir die beiden Plakate noch aufhängen und dann essen gehen?«, frage ich, und Lin nickt.
Zum Glück ist die Stoßzeit längst vorbei, als wir schließlich die Mensa betreten. Die meisten Schüler sind schon auf dem Weg zu ihren Nachmittagskursen oder nutzen noch die letzten Sonnenstrahlen im Park der Schule. Nur vereinzelt sind Tische besetzt, sodass Lin und ich es schaffen, einen der guten Plätze am Fenster zu ergattern.
Nichtsdestotrotz vermeide ich es, den Blick von meiner Lasagne zu nehmen, als ich mein Tablett durch den Raum zu unserem Tisch balanciere. Erst als ich mich gesetzt, die restlichen Plakate auf dem Stuhl neben mir und meinen Rucksack auf dem Boden abgestellt habe, wage ich es, mich umzusehen. Lydia Beaufort ist nirgends zu sehen.
Gegenüber von mir breitet Lin ihren Planer vor sich aus und beginnt, ihn zu studieren, während sie an ihrem Orangensaft nippt. Ich sehe chinesische Zeichen sowie Dreiecke, Kreise und andere Symbole auf den Seiten und bewundere sie einmal mehr für ihr System, das so viel cooler aussieht als die Farben, mit denen ich arbeite. Allerdings erinnere ich mich daran, dass ich Lin einmal gebeten habe, mir zu erklären, welches Zeichen welche Bedeutung hat und für welchen Anlass sie es verwendet, und ich nach einer halben Stunde schon den Überblick verloren und aufgegeben habe.
»Wir haben vergessen, Rektor Lexington ein Musterplakat ins Fach zu legen«, murmelt sie und streicht sich das schwarze Haar hinters Ohr. »Das müssen wir gleich noch machen.«
»Geht klar«, sage ich mit vollem Mund. Ich glaube, ich habe Tomatensoße am Kinn, aber das ist mir total egal. Ich habe mörderischen Kohldampf, wahrscheinlich, weil ich außer ein paar Cornflakes seit gestern Nachmittag nichts hinunterbekommen habe.
»Ich muss meiner Mum heute noch bei einer Ausstellung helfen«, sagt Lin und deutet auf eines der chinesischen Zeichen. Ihre Mutter hat vor einiger Zeit eine Kunstgalerie in London eröffnet, die zwar gut läuft, bei der sie Lin allerdings häufig unterstützen muss – auch unter der Woche.
»Wenn du früher losmusst, kann ich den Rest auch allein aufhängen«, biete ich ihr an, doch sie schüttelt den Kopf.
»Unsere Abmachung war faire Arbeitsteilung, als wir den Job angenommen haben. Wir machen das entweder gemeinsam oder gar nicht.«
Ich lächle sie an. »Okay.«
Ich habe Lin schon zu Beginn des Schuljahrs gesagt, dass es mir nichts ausmacht, ab und zu einen Teil ihrer Arbeit mitzumachen. Ich mag es, anderen zu helfen. Vor allem meinen Freunden – denn so viele habe ich davon nicht. Und ich weiß, dass die Situation bei ihr zu Hause nicht einfach ist und sie oft mehr gefordert wird, als es eigentlich zumutbar ist. Vor allem wenn man bedenkt, dass sie daneben auch das hohe Pensum unseres Unterrichts erfüllen muss. Aber Lin ist mindestens genauso ehrgeizig und auch genauso stur wie ich – wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir uns so gut verstehen.
Dass wir uns gefunden haben, grenzt eigentlich an ein Wunder. Denn als ich nach Maxton Hall gekommen bin, hat sie noch in ganz anderen Kreisen verkehrt. Damals saß sie in der Mittagspause an einem Tisch mit Elaine Ellington und ihren Freundinnen, und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, sie anzusprechen, auch wenn wir beide im Veranstaltungsteam waren und mir ein paarmal aufgefallen war, dass sie ihren Planer ähnlich penibel pflegt wie ich.
Aber dann hatte ihr Vater einen waschechten Skandal am Hals, der dafür gesorgt hat, dass Lins Familie nicht nur ihr Vermögen verlor, sondern auch die Kreise, in denen sie verkehrten. Plötzlich war Lin in den Pausen allein – ob ihre Freunde nichts mehr mit ihr zu tun haben wollten oder ob Lin sich für das, was passiert ist, einfach nur zu sehr geschämt hat, weiß ich nicht. Was ich allerdings weiß, ist, wie es sich anfühlt, auf einen Schlag alle Freunde zu verlieren. Mir war es so gegangen, als ich von meiner alten Highschool in Gormsey hierher gewechselt bin. Ich war mit allem überfordert gewesen – den hohen Anforderungen im Unterricht, den außerschulischen Aktivitäten, der Tatsache, dass alle hier so anders waren als ich – und hatte es die erste Zeit nicht geschafft, die Kontakte nach Gormsey aufrechtzuerhalten. Meine Freunde dort haben mir deutlich zu verstehen gegeben, was sie davon hielten.
Im Nachhinein weiß ich allerdings, dass wahre Freunde sich nicht ununterbrochen über einen lustig machen, nur weil man gerne etwas für die Schule tut. Ich habe Worte wie »Streber« und »Klugscheißerin« immer mit einem Lachen abgetan, obwohl ich das überhaupt nicht lustig fand. Und ich weiß auch, dass es nichts mit Freundschaft zu tun hat, wenn die anderen keinerlei Verständnis dafür aufbringen können, dass man in einer besonderen Situation ist. Sie haben mich nicht ein einziges Mal gefragt, wie es mir geht oder ob sie mich unterstützen können.
Damals hat es unheimlich wehgetan, diese Freundschaften so zerbrechen zu sehen, zumal auch in Maxton Hall niemand etwas mit mir zu tun haben wollte – oder überhaupt Notiz von mir nahm. Ich stamme nicht aus einer reichen Familie. Statt Designertaschen habe ich einen sechs Jahre alten Rucksack, statt eines glänzenden MacBooks einen Laptop, den mir meine Eltern vor Schulbeginn gebraucht gekauft haben. An den Wochenenden bin ich nicht auf den angesagten Partys, über die alle die gesamte nächste Woche sprechen – für die meisten meiner Mitschüler existiere ich schlichtweg nicht. Mittlerweile finde ich das gerade gut, aber die ersten paar Wochen in Maxton Hall habe ich mich unheimlich einsam und isoliert gefühlt. Bis ich Lin kennengelernt habe. Nicht nur die Tatsache, dass sie und ich etwas Ähnliches mit unseren Freunden durchgemacht haben, hat uns verbunden. Lin teilt auch zwei meiner größten Hobbys: Sie organisiert für ihr Leben gern, und sie liebt Mangas.
Ich kann nicht sagen, ob wir uns kennengelernt hätten, wäre die Sache mit ihren Eltern nicht gewesen. Aber auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass sie die Zeit vermisst, in der sie hier einen Namen hatte und mit Menschen wie den Ellingtons rumhing, bin ich dankbar, dass ich sie habe.
»Dann geh du zum Rektor und häng auf dem Weg dahin die Plakate an der Bibliothek und dem Lerncenter auf. Den Rest übernehme ich, okay?«, schlage ich vor.
Ich halte Lin die Hand zum High five hin. Für einen Moment sieht es so aus, als wollte sie etwas erwidern, aber dann lächelt sie nur dankbar und klatscht ab. »Du bist die Beste.«
Jemand zieht den Stuhl neben mir zur Seite und lässt sich darauf nieder. Lin wird von einer Sekunde auf die andere kreidebleich. Ich runzle die Stirn, als sie mit aufgerissenen Augen erst mich anstarrt, dann die Person, die sich neben mich gesetzt hat, und wieder mich.
Ganz langsam drehe ich mich zur Seite – und blicke geradewegs in türkisblaue Augen.
Wie jeder an der Schule kenne ich diese Augen, nur habe ich sie noch nie aus dieser Nähe gesehen. Sie sind Teil eines markanten Gesichts mit dunklen Brauen, ausgeprägten Wangenknochen und einem arrogant geschwungenen, schönen Mund.
James Beaufort hat sich neben mich gesetzt.
Und er sieht mich an.
Von Nahem wirkt er noch gefährlicher als aus der Ferne. Er ist einer derjenigen in Maxton Hall, die sich benehmen, als würde ihnen die Schule gehören. Und genau so sieht er auch aus: Seine Haltung ist aufrecht und selbstsicher, seine Krawatte sitzt perfekt. An ihm sieht die eigentlich recht gewöhnliche Schuluniform erstklassig aus, als wäre sie für seinen Körper gemacht worden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass seine Mutter sie designt hat. Das Einzige an ihm, was nicht akkurat ist, sind seine rotblonden Haare, die im Gegensatz zu denen seiner Schwester nicht perfekt gestylt, sondern wild durcheinander sind.
»Hey«, sagt er.
Habe ich ihn schon mal reden gehört? Brüllend auf dem Lacrosse-Feld oder betrunken auf den Maxton-Hall-Partys, ja, aber nicht so. Sein »Hey« klingt vertraut, und das Funkeln in seinen Augen ist es auch. Er tut so, als wäre es etwas völlig Normales, dass er sich in der Mittagspause neben mich setzt und mich anspricht. Dabei haben wir noch nie ein Wort miteinander gewechselt. Und das soll eigentlich auch so bleiben.
Vorsichtig blicke ich mich um und schlucke schwer. Nicht alle, aber eindeutig ein paar Köpfe haben sich in unsere Richtung gedreht. Es fühlt sich an, als wäre der Tarnumhang, den ich seit zwei Jahren trage, ein Stück weit verrutscht.
Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut.
»Hey, Lin. Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich deine Freundin kurz entführe?«, fragt er, ohne auch nur ein einziges Mal von mir wegzusehen. Sein Blick ist so intensiv, dass mir ein Schauer über den Rücken jagt. Es dauert eine Weile, bis ich verstehe, was er gesagt hat. Im nächsten Moment reiße ich den Kopf zu Lin rum und versuche ihr wortlos zu verstehen zu geben, dass es mir etwas ausmachen würde, aber sie schaut mich gar nicht an, sondern nur James.
»Klar«, krächzt sie. »Geht nur.«
Ich schaffe es gerade so, mir meinen Rucksack vom Boden zu schnappen, dann liegt James Beauforts Hand auf meinem unteren Rücken, und er bugsiert mich aus der Mensa. Ich gehe extra einen Schritt schneller, damit seine Hand verschwindet, aber selbst danach kann ich seine Berührung noch fühlen, als hätte sie sich durch den Stoff meines Jacketts in meine Haut gebrannt. Er führt mich um die große Treppe im Foyer herum und kommt erst dahinter an einer Stelle zum Stehen, wo unsere Mitschüler, die noch immer in die Mensa und aus der Mensa herauslaufen, uns nicht länger sehen können.
Ich kann mir vorstellen, was er möchte. Da er mich in den letzten zwei Jahren kein einziges Mal auch nur angesehen hat, muss es mit der Sache zwischen seiner Schwester und Mr Sutton zu tun haben.
Erst als ich mir sicher bin, dass uns niemand mehr hören kann, drehe ich mich zu ihm um. »Ich glaube, ich weiß, was du von mir willst.«
Seine Lippen verziehen sich zu einem leichten Lächeln. »Tust du das?«
»Hör zu, Beaufort …«
»Ich fürchte, ich muss dich an dieser Stelle unterbrechen, Robyn.« Er macht einen Schritt auf mich zu. Ich weiche nicht zurück, sondern sehe ihn nur mit hochgezogener Braue an. »Du wirst das, was du gestern gesehen hast, schnellstens vergessen, verstanden? Sollte ich herausfinden, dass du auch nur ein Sterbenswörtchen darüber verlierst, sorge ich dafür, dass du von der Schule fliegst.«
Er drückt mir etwas in die Hand. Wie benommen senke ich den Blick und versteife mich, als ich realisiere, was es ist.
In meiner Hand liegt ein schweres Bündel aus Fünfzig-Pfund-Scheinen. Ich schlucke trocken.
So viel Geld habe ich noch nie in der Hand gehalten.
Ich blicke auf. James’ überhebliches Grinsen spricht Bände. Es sagt mir deutlich, dass er ganz genau weiß, wie sehr ich das Geld gebrauchen könnte. Und dass er sich das Schweigen von jemandem nicht zum ersten Mal erkauft.
Sein Blick und seine gesamte Haltung sind so selbstgefällig, dass ich plötzlich von einer unglaublichen Wut erfasst werde.
»Ist das dein Ernst?«, frage ich zwischen zusammengebissenen Zähnen und halte das Geldbündel hoch. Ich bin so wütend, dass meine Hände zittern.
Jetzt sieht er nachdenklich aus. Er greift in die Innentasche seines Jacketts, holt ein zweites Bündel hervor und hält es mir entgegen. »Mehr als zehntausend sind nicht drin.«
Völlig fassungslos starre ich das Geld an, dann wieder in sein Gesicht.
»Wenn du bis zum Ende des Terms die Klappe hältst, können wir das Ganze verdoppeln. Schaffst du’s bis zum Ende des Schuljahres, vervierfachen wir es.«
Seine Worte wiederholen sich in meinem Kopf, immer und immer wieder, und das Blut kocht in meinen Adern. Wie er vor mir steht, zehntausend Pfund vor meine Füße wirft und mir so den Mund verbieten will. Als wäre das nichts. Als würde man das eben so machen, wenn man mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde. Mit einem Mal wird mir etwas ganz deutlich bewusst:
Ich kann James Beaufort nicht bloß nicht ausstehen.
Ich verabscheue ihn. Ihn und alles, wofür er steht.
Wie er lebt – ohne Rücksicht oder Angst vor Konsequenzen. Wenn man den Namen Beaufort trägt, ist man unantastbar. Egal, was man anstellt – Papas Geld wird es schon irgendwie richten. Während ich mir seit zwei Jahren den Arsch aufreiße, um auch nur eine winzige Chance zu haben, in Oxford genommen zu werden, ist die Highschool für ihn nichts als ein Spaziergang.
Es ist unfair. Und je länger ich ihn anstarre, desto wütender werde ich darüber.
Meine Finger verkrampfen sich um die Scheine in meiner Hand. Fest beiße ich die Zähne aufeinander und reiße den dünnen Papierstreifen auf, der das Bündel zusammenhält.
James runzelt die Stirn. »Was …«
Ruckartig hebe ich die Hand und schmeiße das Geld in die Luft.
James erwidert meinen stoischen Blick eisern, die einzige Reaktion ist der pochende Muskel an seinem Kiefer.
Noch während die Scheine langsam zu Boden segeln, drehe ich mich um und gehe.
4
Ruby
Ein rotblonder Pferdeschwanz wippt vor meinem Gesicht. Ich richte meine ganze Wut gebündelt auf ihn.
Das ist alles Lydias Schuld! Hätte sie nicht mit unserem Lehrer rumgemacht, hätte ich die beiden nicht erwischen und sie mich nicht bei ihrem Bruder verpetzen können. Dann könnte ich mich jetzt auf den Unterricht konzentrieren und müsste mich nicht in Gedanken darüber aufregen, dass er mich Robyn genannt hat. Oder dass ich fünftausend Pfund durch die Gegend geworfen habe.
Ich vergrabe das Gesicht in den Händen. Unfassbar, dass ich das tatsächlich getan habe. Das Geld nicht anzunehmen, war natürlich richtig. Aber trotzdem – seit gestern Nachmittag schießen mir lauter Dinge durch den Kopf, für die ich es gut hätte verwenden können. Unser Haus zum Beispiel. Seit Dads Unfall vor acht Jahren haben wir es zwar Stück für Stück umgebaut und barrierefrei gemacht, aber einige Ecken könnten noch verbessert werden. Außerdem gibt unser Auto langsam, aber sicher den Geist auf, und wir sind alle auf das Fahrzeug angewiesen. Besonders Dad. Mit den vierzigtausend Pfund, die James mir zum Ende des Schuljahres geboten hat, hätte ich einen neuen Kleinbus kaufen können.
Ich schüttle den Kopf. Nein, ich würde niemals Schweigegeld von den Beauforts annehmen. Ich bin nicht käuflich.
Ich ziehe meinen Planer unter meinem Geschichtsbuch hervor und schlage ihn auf. Alle Punkte für heute sind bereits abgehakt. Der einzige, der mich nach wie vor höhnisch anschimmert, ist: Empfehlungsschreiben bei Mr Sutton abholen.
Mit zusammengebissenen Zähnen starre ich auf die Buchstaben. Am liebsten würde ich sie mit Korrekturflüssigkeit löschen – genau wie die Erinnerung an Mr Sutton und Lydia.
Zum ersten Mal seit Stundenbeginn wage ich einen Blick über Lydias Kopf hinweg nach vorne. Mr Sutton steht am Whiteboard. Er trägt ein kariertes Hemd, über das er einen dunkelgrauen Cardigan gezogen hat, sowie die Brille, die er im Unterricht immer aufhat. Sein Dreitagebart ist gepflegt, und auf seinen Wangen kann ich die Grübchen sehen, die alle aus unserem Kurs immer anhimmeln.
Um mich herum ertönt plötzlich Gelächter – er hat einen Witz gemacht.
Einer der Gründe, weshalb ich ihn immer so gemocht habe.
Jetzt kann ich ihn nicht einmal mehr ansehen.
Ich verstehe das nicht – Mr Sutton ist gut genug, um es nach Oxford zu schaffen, studiert dort jahrelang, darf kurz nach seinem Abschluss an einer der renommiertesten Privatschulen Englands unterrichten, und das Erste, was er macht, ist, etwas mit einer Schülerin anzufangen? Wieso, um Himmels willen?
Sein Blick trifft meinen, und im nächsten Moment verrutscht sein Lächeln eine Spur. Lydia vor mir versteift sich. Ihre Schultern werden starr, ebenso ihr Nacken, als würde sie sich mit aller Kraft dagegen wehren, sich zu mir umzudrehen.
Ich senke meinen Blick so hastig auf meinen Planer, dass meine Haare wie eine dunkle Wolke vor mein Gesicht fliegen. Den Rest der Stunde verharre ich genau in dieser Position.
Als die Schulglocke endlich klingelt, fühlt es sich an, als wären Tage vergangen, nicht neunzig Minuten. Ich lasse mir so viel Zeit wie möglich. Wie in Zeitlupe packe ich meine Sachen zusammen und verstaue sie sorgfältig in meinem Rucksack. Dann schließe ich den Reißverschluss, so langsam, dass ich jedes einzelne Zähnchen einrasten hören kann.
Erst nachdem die Schritte und die Stimmen meiner Mitschüler allmählich leiser werden, stehe ich auf. Mr Sutton stopft gedankenverloren seine Unterlagen in eine Mappe. Er wirkt angespannt, jedes bisschen Humor, das er eben noch zur Schau getragen hat, ist aus seinen Zügen verschwunden.
Die einzige Schülerin, die noch mit uns im Raum ist, ist Lydia Beaufort. Sie verharrt an der Tür, blickt mit angespanntem Kiefer zwischen mir und Mr Sutton hin und her.
Das Herz klopft mir bis zum Hals, als ich meinen Rucksack schultere und nach vorne gehe. In einigem Abstand zum Pult bleibe ich stehen und räuspere mich. Mr Sutton sieht mich an. Seine goldbraunen Augen sind voller Bedauern. Ich kann sein schlechtes Gewissen förmlich spüren. Seine Bewegungen sehen aus wie die eines Roboters.
»Lydia, würdest du uns allein lassen?«, fragt er, ohne sie anzusehen.
»Aber …«
»Bitte«, fügt er sanft hinzu und lässt seinen Blick kurz zu ihr schweifen.
Mit zusammengepressten Lippen nickt sie und wendet sich ab. Sie schließt die Tür des Klassenzimmers leise hinter sich.
Mr Sutton wendet sich wieder an mich. Er macht den Mund auf, um etwas zu sagen, aber ich komme ihm zuvor.
»Ich wollte mein Empfehlungsschreiben für Oxford abholen«, sage ich schnell.





























