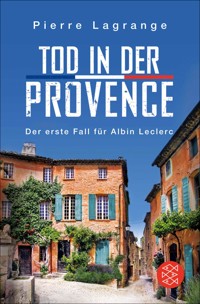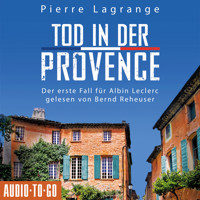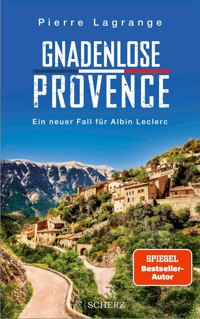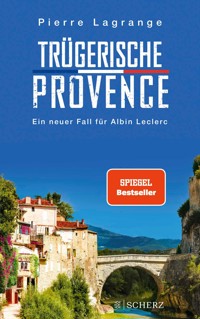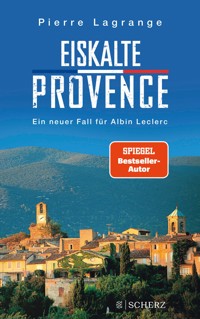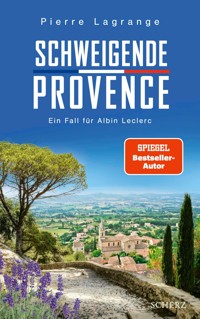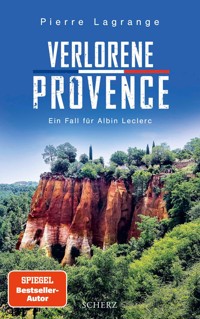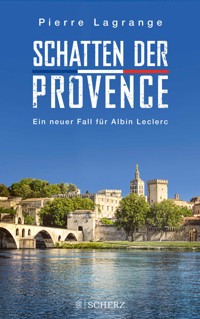
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Commissaire Leclerc
- Sprache: Deutsch
Ein neuer Fall für Commissaire Albin Leclerc Die Vergangenheit wirft dunkle Schatten über die Provence Commissaire Albin Leclerc kommt nicht zu seinem wohlverdienten Ruhestand. Denn der Überfall auf einen Kunsttransport mit wertvollen Gemälden findet ausgerechnet kurz vor Carpentras statt. Der Coup geht schief, die Polizei entdeckt im Versteck der Räuber einen unbekannten Cézanne und einen Van Gogh. Alles weist darauf hin, dass sie aus einem geheimen Depot mit Nazi-Raubkunst stammen. Zum Ärger der beiden Polizisten Theroux und Castel mischt sich Albin mit seinem Mops Tyson in ihre Ermittlungen ein. Dabei ist er ihnen immer einen Schritt voraus. Als es plötzlich Tote gibt, gerät Albin ins Visier der Täter. Plötzlich geht es für ihn um Leben und Tod…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Pierre Lagrange
Schatten der Provence
Ein neuer Fall für Albin Leclerc
Über dieses Buch
Commissaire Albin Leclerc kommt nicht zu seinem wohlverdienten Ruhestand. Denn der Überfall auf einen Kunsttransporter mit wertvollen Gemälden findet ausgerechnet kurz vor Carpentras statt. Der Coup geht schief, die Polizei entdeckt im Versteck der Räuber einen unbekannten Cézanne und einen van Gogh. Alles weist darauf hin, dass sie aus einem geheimen Depot mit Nazi-Raubkunst stammen. Zum Ärger der Polizisten Theroux und Castel mischt sich Albin mit seinem Mops Tyson in die Ermittlungen ein. Dabei ist er ihnen immer einen Schritt voraus. Doch da gibt es den ersten Toten - der eben noch auf Albins Liste der Verdächtigen stand. Als noch mehr Morde geschehen, gerät auch Albin ins Visier der Täter …
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Pierre Lagrange ist das Pseudonym eines bekannten deutschen Autors, der bereits zahlreiche Krimis und Thriller veröffentlicht hat. In der Gegend von Avignon führte seine Mutter ein kleines Hotel auf einem alten Landgut, das berühmt für seine provenzalische Küche war. Nach ›Tod in der Provence‹, ›Blutrote Provence‹ und ›Mörderische Provence‹ ist ›Schatten der Provence‹ der vierte Band der Erfolgsserie um den liebenswerten Commissaire Leclerc und seinen Mops Tyson.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: Ventura Carmona/Getty Images
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491004-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
Leseprobe des fünften Bandes
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Prolog
Marseille, Januar 1943 bis August 1944
Die Explosionen ließen die Fenster vibrieren und das Geschirr im Schrank klirren. Der Junge erbebte und zuckte so heftig mit der Hand, dass die Holzeisenbahn aus den Gleisen fuhr und umfiel. Sein Name war Baptiste. Er hatte das Spielzeug vor drei Wochen zu Weihnachten bekommen. Er weinte und hielt sich gegen den Lärm die Ohren zu. Er lief zu seiner Mutter, die im Sessel saß und strickte. Sie sah mit ernster Miene zum Fenster hinaus und betrachtete die Kondenswassertropfen, die innen an der Scheibe hinabliefen. Nur manchmal zuckte ihr Auge, wenn es erneut ohrenbetäubend krachte und ein weiteres Gebäude in der Altstadt einstürzte.
Baptiste klammerte sich an ihre Beine und drückte das Gesicht in ihren Schoß. Er drehte den Kopf zur Seite und sah hinüber zum Vater, der unbeweglich auf dem Sofa saß und Zeitung las. Seine Hände waren groß. Sie zitterten ein wenig, während er mit dem Zeigefinger die Zeilen auf der Titelseite entlangfuhr.
In dem Text stand, dass die Polizei eine Ausgangssperre verhängt hatte, während das Quartier am Alten Hafen gesprengt wurde. Es hieß, dass alles abgerissen werde, damit schöne neue Wohnungen gebaut werden können. Der Stadtteil hatte einen sehr schlechten Ruf. In Le Panier, dem mittelalterlichen Korbmacherviertel, herrschte das Verbrechen. Alles war vom Rotlichtmilieu geprägt. Dort wohnten viele Immigranten und Juden. Im Le Panier versteckten sich außerdem viele Widerstandskämpfer. Es gab ein unübersichtliches Gewirr aus schmalen Gassen und kleinen Plätzen, das von der Polizei und den deutschen Besatzern schlecht zu kontrollieren war. Angeblich sollte es in der Neujahrsnacht einen Anschlag gegeben haben, woraufhin die Nazis durchgesetzt hatten, dass das gesamte Quartier dem Erdboden gleichgemacht und gesäubert werden sollte. Was nun seit einigen Tagen geschah. Eigentlich hatten die Deutschen ein viel größeres Gebiet am Hafen sprengen wollen, sich aber von der Präfektur auf eine Fläche von vierzehn Hektar herunterhandeln lassen, wenn sie sich im Gegenzug nicht die Hände schmutzig machen mussten. Das erledigten nun die Franzosen, während die Wehrmacht die Aktion lediglich überwachte und sicherte.
Insgesamt wurden vierzigtausend Menschen polizeilich überprüft und fast dreißigtausend Bewohner vorübergehend nach Fréjus evakuiert. Sechstausend Menschen wurden festgenommen, fast achthundert Juden deportiert und am Ende rund eintausendfünfhundert Gebäude gesprengt.
Eine ganze Kleinstadt.
Der Junge wusste von alledem nichts. Aber er hatte beim Milchholen kürzlich gesehen, wie die deutschen Soldaten alles abriegelten. Überall hatte es lautes Geschrei gegeben. Schüsse knallten. Die Echos waren über die Straßen und Plätze gehallt. Er hatte gesehen, wie Menschen aus den Häusern getrieben und wie Vieh auf Lastwagen verladen wurden, die dann eilig fortfuhren.
Die Straßen der Stadt waren voll von Uniformierten, Motorrädern mit Maschinengewehren und sogar Panzern gewesen. Baptiste hatte aufgeschnappt, dass es eine große Razzia gab – ohne zu wissen, was genau das eigentlich war – und dass Zigtausende Bürger überprüft, verhaftet und weggebracht wurden. Niemand wusste, wohin. Abends hatte Baptiste seine Eltern belauscht und gehört, wie sein Vater der Mutter davon erzählte, dass er einen Zug mit Waggons voller Menschen gefahren hatte. Am selben Tag hatte sein Vater sich betrunken.
Jetzt faltete er die Zeitung zusammen und stand auf. Er ging durch das Wohnzimmer zum Teppich, auf dem die Schienen der Holzeisenbahn in einem Kreis aufgebaut waren. Er ging in die Hocke, nahm die Lok auf und setzte sie behutsam wieder in die Spur. Er winkte Baptiste zu sich und sagte, dass ein Lokomotivführer niemals sein Führerhaus verlassen dürfe und es seine heilige Aufgabe sei, die Fracht sicher ans Ziel zu bringen – was auch immer um ihn herum geschehe.
»Der Zug«, sagte der Vater zu Baptiste, »muss immer weiterrollen.«
Wenige Wochen später nahm er Baptiste mit zur Arbeit. Es war ein ungewöhnlich kalter Märztag. Beim Atmen bliesen schneeweiße Wolken aus ihren Mündern. In dem Bahnhof Saint Charles und davor wimmelte es nur so von deutscher Wehrmacht und Polizei. Die Soldaten trugen graue Mäntel, Stahlhelme und Gewehre. Einer fuhr dem Jungen lächelnd durch die Haare, als der Vater seinen Ausweis vorzeigte und sagte, wer er war und wohin er wollte. Der Soldat nickte, zwinkerte dem Jungen zu und sah gleichzeitig freundlich und traurig aus. Vielleicht hatte er auch einen Sohn in seinem eigenen Land und vermisste ihn.
Baptiste folgte seinem Vater. Sie bestiegen die Lok, die bereits vibrierte und schnaufte wie ein aufgeregtes Tier, das nur darauf wartete, losgelassen zu werden. Baptiste lächelte. Er liebte es, neben seinem Vater im Führerhaus zu stehen und auf all die Instrumente und Hebel zu blicken, deren Funktion sich ihm nicht erschloss und die er sich im Leben nicht trauen würde, auch nur mit den Fingern zu berühren. Später einmal, wenn er selbst ein Mann war, würde er vielleicht auch eine solche Lok führen dürfen.
Schließlich fuhren sie los, ohne Waggons. Sie nahmen die Strecke, die in Richtung Paris aus Marseille hinausführte, und ließen die Stadt hinter sich, die noch vor einem Jahr eine freie Zone unter der Vichy-Regierung gewesen war. Vor Weihnachten waren die Deutschen dann doch eingerückt, weil sie von Nordafrika aus eine Invasion in der Provence befürchteten – mit der Hafenstadt Marseille als Dreh- und Angelpunkt.
Die Lok hielt an einem kleinen Bahnhof in der Gegend von Rognac, das an einem großen Binnensee lag, dem Étang de Berre. Dort standen drei Waggons auf den Schienen. Neben dem Bahnhofsgebäude parkten fast zehn Opel Blitz. Die Auflieger der LKWs waren mit Planen überspannt. Baptiste sah überall deutsche Soldaten. Sie trugen Maschinenpistolen. Einige waren damit beschäftigt, Gegenstände in die Waggons zu tragen. Der Junge sah große Kisten, die offensichtlich so schwer waren, dass sie zum Teil von drei Männern geschleppt werden mussten. Er sah zusammengerollte Teppiche, wuchtige Spiegel, die reich verziert waren. Er sah Möbel, die wirkten, als stammten sie aus einem Schloss. Er sah Statuen aus Marmor und Bronze.
Und er sah Bilder – Gemälde in allen möglichen Größen. Einer der Soldaten hob gerade ein weiteres von der Ladefläche eines LKWs. Baptiste stockte der Atem. Seine Augen weiteten sich. Noch nie in seinem jungen Leben hatte er ein solches Gemälde gesehen. Es hatte die Ausmaße einer Tischplatte. Der Nachthimmel war in so blauen Farben gemalt, dass sie selbst auf die Distanz zu leuchten schienen. Darauf tanzten Funken, Spiralen und andere verrückte Muster über einem Haus, aus dem goldenes Licht fiel. Es war, als brannten die wirren Kreise und bewegten sich und als fiele pures, gleißendes Gold aus den Fenstern des Gebäudes, das ein Gasthaus sein mochte.
Baptiste sah ein weiteres Gemälde, das von zwei Soldaten getragen wurde. Es war kleiner als das wilde blaue Bild und zeigte ein gänzlich anderes Motiv. Fast erschien es, als habe jemand mit der Schere ein Stück aus der Landschaft herausgeschnitten und in einen Rahmen gesteckt. War das wirklich Malerei oder eine Fotografie? Nein, das konnte nicht sein, denn das Bild war ja farbig. Farbige Fotos gab es nicht, hatte der Vater einmal erzählt, und in dem Bild schienen sämtliche Töne der Natur vorzukommen – jene Töne, die es an einem heißen Tag im Dunst des Nachmittages gab. Baptiste kannte die Landschaft: Es waren die Montagne Sainte-Victoire. Die Familie hatte einmal einen Ausflug in diesen Gebirgszug unternommen.
Dann verschwand auch dieses Bild in einem der Waggons. Baptiste bekam den Mund nicht zu. Er wollte den Vater am Hemdzipfel zupfen und fragen, was es mit all diesen Schätzen auf sich hatte, die von den LKWs verladen wurden. Doch der Vater sprach gerade mit einem Offizier, an dessen Mantelaufschlägen Totenkopfembleme befestigt waren. Er nickte immer wieder und erklärte dem Deutschen etwas über eine Wegstrecke und Weichen, die zu stellen seien, und zeigte auf einer Karte, wo er mit der Lok anhalten könne. Der Offizier sah sich alles sehr genau an und gab dann Anweisungen auf Deutsch an seine Leute weiter, worauf die Motorräder mit den Beiwagen angelassen wurden und die Gespanne mit röhrenden Motoren fortfuhren. Dann wurden die Waggons an der Lok befestigt. Als alles erledigt war, kam der Offizier zurück, gab dem Vater ein Zeichen zur Abfahrt, lächelte und warf Baptiste eine Tafel Schokolade zu. Der Junge würde sie nicht essen. Er hatte Angst davor, dass mit der Süßigkeit etwas nicht in Ordnung sein könnte. Der Deutsche hatte Totenköpfe an der Uniform und an der Mütze gehabt – und Totenköpfe, das hatte Baptiste in der Schule gelernt, waren das Symbol für Gift.
Baptiste legte die Schokolade zur Seite. Ihm lagen Hunderte Fragen auf der Zunge, aber der Vater schwieg, und deswegen traute sich der Junge nicht, auch nur eine einzige zu stellen. Stattdessen schwieg auch er und sah zum Fenster hinaus.
Eine Zeitlang fuhren sie auf der Hauptroute, wie der Vater Baptiste erklärte. Sie kamen an eine Gabelung, wo ein Motorradgespann und zwei deutsche Soldaten neben einer Weiche standen und diese entweder bewachten oder eigens für die Lok umstellten. Jedenfalls bog die Lok nun ab auf ein anderes Gleis. Hier sah die Strecke aus, als werde sie kaum genutzt. Schließlich gelangten sie an eine weitere Abzweigung, wo wiederum ein Motorrad wartete. Von nun an ging es auf einer mit Unkraut und Büschen dicht bewachsenen Strecke weiter, die wahrscheinlich seit Jahrzehnten nicht mehr befahren wurde. Sie führte zwischen ockerfarbenen Felsen hindurch, und nach einer scharfen Biegung sah Baptiste die Haltestelle, einige verfallene Mauerreste und Gebäude sowie einen Stollen, der direkt in den Berg getrieben worden war. Es schien sich um eine verlassene Mine zu handeln. Hoch über dem von dicken Trägern und Streben gestützten Eingang, der offensichtlich in das Innere des felsigen Massivs führte, war ein uralter Wachturm zu erkennen. Einige Soldaten standen neben den Gleisen und schienen bereits auf sie zu warten. Es waren deutlich weniger Männer als zuvor.
Die Lok stoppte, und Baptiste verfolgte, wie die Waggons entladen wurden und die Deutschen alles in die Tunnelöffnung transportierten, wo andere Soldaten damit beschäftigt waren, ein großes Tor aufzubauen und eine Mauer hochzuziehen, in die das Tor wohl eingepasst werden würde. Wieder sprach der Vater mit einem Offizier. Baptiste versuchte, noch einmal einen Blick auf die Gemälde zu werfen. Aber dieses Mal sah er sie nicht, denn als er sich umdrehte, um aus der Lok zu schauen, fasste der Vater Baptistes Kopf und drehte ihn zurück in die andere Richtung. Er sah hinab zu seinem Sohn, schüttelte schwach den Kopf und legte dabei den Zeigefinger an seine Lippen. Ein Zeichen, still und verschwiegen zu sein. Baptiste gehorchte. Und dann fuhren sie wieder zurück nach Marseille.
Baptiste hatte sich nie getraut, den Vater nach dem Grund der Fahrt zu fragen und nach den Bildern, und der Vater hatte nie darüber gesprochen. Wochen und Monate nicht. Auch nicht im folgenden Jahr, als ein solcher Aufruhr in der Stadt herrschte wie damals an dem Tag, an dem das Hafenviertel gesprengt worden war und die große Razzia stattgefunden hatte. Wiederum waren die Straßen voll von Deutschen – aber dieses Mal flohen sie. Überall wurde geschossen, es gab Explosionen, und vor lauter Angst machte Baptiste in einer dieser Nächte ins Bett. Aber die Mutter hatte ihm über den Kopf gestreichelt und gesagt, dass nun alles gut werde.
Schließlich war es ruhiger in der Stadt geworden – bis auf den Jubel und die Musik, die durch die Gassen hallten. An einem Morgen sah Baptiste seinen Vater und seine Mutter zum ersten Mal, seitdem die Deutschen in der Stadt aufgetaucht waren, wieder lächeln und sich einen Kuss geben. Die Sonne schien. Es war ein heißer Tag.
»Komm«, sagte der Vater zu Baptiste. »Wir machen einen Ausflug. Nur du und ich.«
Sie fuhren zu zweit mit dem LKW von Onkel Clement, der ein Schrottunternehmen besaß, aus der Stadt hinaus. Schließlich bog der Vater von der Hauptstraße auf eine kleinere Straße ab, dann wieder und ein erneutes Mal, bis sie auf einem Feldweg beinahe querfeldein fuhren. Einige Minuten später wusste der Junge, wo sie sich befanden. Er erkannte die Haltestelle am verlassenen Bergwerk und den aus grauem Stein gebauten Wachturm auf dem hohen Felsen. Damals, als Baptiste und sein Vater mit der Lok gekommen waren, hatte er es nicht so gut sehen können, doch nun erinnerte ihn die schmucklose, verfallene Festung an die massiven Mauern von Chateau d’If auf der Gefängnisinsel vor Marseille.
»Das ist Gosier de la Terre«, sagte der Vater, der den Blick von Baptiste bemerkt hatte. »Der Schlund der Erde. Schon im Mittelalter wurde in dem Bergwerk nach Silber gesucht. Sogar die Katharer haben sich hier versteckt, sagt man. Erst vor fünfzig Jahren wurde die Mine aufgegeben.« Er legte den Rückwärtsgang ein und sah sich über die Schulter um. »Weißt du, wer die Katharer waren, Baptiste?«
Baptiste verneinte.
»Das lernst du noch in der Schule. Die Deutschen glaubten, dass die Katharer den Heiligen Gral gefunden haben. Weißt du, was der Heilige Gral ist?«
Baptiste nickte. Er hatte ein Buch über König Artus und seine Tafelrunde.
»Sind sie deswegen nach Frankreich gekommen?«, fragte Baptiste.
Der Vater schmunzelte und verneinte. »Sie sind aus anderen Gründen gekommen. Aber sie haben überall im Süden danach gesucht, sogar hier in Gosier de la Terre. Sie dachten, die Katharer hätten ihn hier in der Tiefe versteckt. Aber sie haben den Heiligen Gral nirgends gefunden.« Der Vater machte eine Geste zu Baptiste. »Jetzt halt dich gut am Türgriff und am Sitz fest, Junge.«
Was Baptiste tat. Der Vater gab Vollgas. Der Motor jaulte auf. Steine spritzten auf. Die Reifen furchten durch den Untergrund. Schließlich gab es ein lautes Krachen und gleichzeitig einen heftigen Ruck. Baptiste fühlte sich, als säße er in einer Schiffschaukel, die in voller Fahrt gebremst wurde.
Dann setzte der LKW wieder ein Stück vor, und der Motor wurde ausgestellt. Baptiste und sein Vater stiegen aus. Die Sonne brannte auf ihrer Haut. Der Junge sah das zersplitterte Tor, das die Deutschen errichtet hatten, um den Eingang zum Stollen zu verschließen. Der Vater nahm die Hand des Jungen. Langsam gingen sie voran, passierten das Tor und wurden von der dunklen Kälte des Schachtes umfangen. Ein Licht flammte in der freien Hand des Vaters an, eine Plane wurde zurückgeschlagen.
Vor den Augen des Jungen tauchten mit einem Mal die leuchtenden Spiralen auf, die ihn seit jenem Tag so oft in seinen Träumen heimgesucht hatten und in seinen Gedanken im Himmel über Marseille erschienen waren, wenn er nicht schlafen konnte und aus dem Fenster seines Zimmers in die Nacht hinausgesehen hatte. Neben dem Gemälde stand das Bild von den Bergen sowie einige weitere, allesamt unter Planen aus Textilgewebe versteckt und an die felsige Wand des Schachtes gelehnt, die der Vater nun der Reihe nach zurückschlug. Gestapelte Kisten, Statuen, goldglänzende Möbel, Bilder … So musste es aussehen, dachte Baptiste, wenn man ein Museum leerräumte und alle Exponate achtlos in einem Abstellraum sammelte.
Der Vater wandte sich lächelnd zu Baptiste. Das Licht der Grubenlampe in seiner Hand tanzte über den Steinboden.
»Der Gral«, sagte der Vater mit hallender Stimme, »ist nur eine Legende, Baptiste. Es ist ein anderes Wort für einen unermesslichen Schatz.« Er legte Baptiste die Hand auf die Schulter und drückte sie sanft. »Schau dir das an, mein Sohn«, flüsterte er mit bewegter Stimme. »Die Nazis waren sehr dumme Menschen. Sie konnten den Gral nicht finden – dabei haben sie ihn selbst hergebracht. Nur du und ich wissen das. Nur wir beide.«
1
Das Bild mit der Ansicht von den Montagne de Sainte-Victoire wurde in eine große Holzkiste gepackt und war nach wenigen Minuten fertig zum Verschicken. Es gehörte zu den sehr wenigen Gemälden von Paul Cézanne, über die das Musée Granet in Aix-en-Provence verfügte. Eigentlich eine Schande. Der große Sohn der Stadt, und das Granet hatte nur die wenigen Gemälde, die ihm vom Louvre als Dauerleihgaben gegeben worden waren, dachte Jean Villeneuve. Und jetzt gingen sie noch auf die Reise – wiederum als Leihgaben, und zwar zur großen Cézanne-Ausstellung, die in Lyon vorbereitet wurde. Dabei galt das Museum, in dem er als Kurator arbeitete, als eines der reichsten in Frankreich und wäre zumindest wirtschaftlich nicht auf die acht exemplarischen Cézanne-»Almosen« aus Paris angewiesen gewesen, die es 1984 erhalten hatte. Das Granet lag mitten in der Stadt, wo es unmittelbar an die Kirche Saint-Jean-de-Malte grenzte und in einer ehemaligen Priorei des Malteserordens untergebracht war. Es verfügte über eine umfangreiche archäologische Sammlung sowie viele Gemälde, zum Beispiel von Matisse, Léger, Ingres und weiteren namhaften Künstlern.
Villeneuve quittierte einige Papiere, die das auf hochwertige Kunsttransporte spezialisierte Unternehmen benötigte. Er war gerade vierzig Jahre alt geworden und hatte den hellen Seersucker-Sommeranzug an, der stets wie seit drei Monaten getragen aussah – selbst wenn er frisch aus der Reinigung kam. Er fuhr sich durch die tiefschwarzen, kräftigen Haare, die vermutlich ein Erbe seiner arabischen Vorfahren waren, und schob das schwarze Nerd-Brillengestell auf die Nasenspitze, um darüber hinwegzublicken. Auf kurze Distanz sah er ohne Brille besser, und für ein Gleitsicht-Modell fühlte er sich noch nicht alt genug.
Schließlich war er fertig mit dem Papierkram und folgte dem verpackten Cézanne, der von zwei Museumsassistenten zum Hinterausgang getragen wurde. Dort wartete ein weißer Transporter der Firma Léonard mit zwei Mann Besatzung. Während das letzte Gemälde verladen wurde, überzeugte sich Villeneuve von der akkuraten Lagerung der kostbaren Lieferung im Laderaum des Transporters. Immerhin ging es hier um eine Versicherungssumme von mehreren hundert Millionen Euro. Das Cézanne-Werk »Die Kartenspieler« war zum Beispiel eines der teuersten Gemälde der Welt und erst vor wenigen Jahren für zweihundertundfünfzig Millionen Euro versteigert worden, was einigen Aufschluss über den Wert der Bilder dieses Malers gab. Deswegen kamen für den Transport nur spezielle Speditionen wie Léonard in Frage, mit denen das Museum schon seit Jahren zusammenarbeitete. Die Mitarbeiter waren speziell geschulte und bewaffnete Kräfte, die Fahrzeuge schwer gepanzert und mit allerneuesten Sicherheitssystemen ausgestattet. Die zu fahrenden Routen wurden erst kurzfristig nach einem Zufallsprinzip festgelegt.
Villeneuve sprang von der Ladefläche und atmete tief durch. Sein Herz schlug für die Kunst, aber im Moment schlug es Purzelbäume. Bei aller Routine: Es war schon eine sehr besondere Situation, sich von solch exponierten Werken zu trennen, und sei es nur zeitweise.
Villeneuve verfolgte, wie die Hecktüren geschlossen wurden. Dann klopfte er gegen die Seitenwand des Transporters. »Alles klar«, sagte er. »Gute Fahrt.«
Er blieb so lange an der Lieferantenpforte stehen, bis der Wagen aus seinem Sichtfeld verschwunden war. Dann ging er wieder hinein, um sich darum zu kümmern, dass an den Plätzen der Cézannes für die Dauer der Entleihung Reproduktionen aufgehängt wurden. Die meisten Betrachter würden das wahrscheinlich nicht einmal merken.
Als der erste Platzhalter im Musée Granet an Ort und Stelle befestigt wurde, hatte der Transporter es gerade bis zum Krankenhaus an der Avenue Philippe Solari geschafft. Von dort aus gab es zwei direkte Routen, die nach Lyon führen würden: geradewegs über die Autobahn A7, oder man nahm die Nationalstraße über Grenoble, was allerdings ein ziemlicher Umweg war. Aber der Transporter von Léonard war kein normaler, weswegen er auch keine normale Route benutzte.
Der Fahrer hieß Roger, ein Mann im mittleren Alter. Er trug ein Léonard-Poloshirt, eine Sonnenbrille und hatte einen beachtlichen Schnurrbart. Sein Beifahrer hieß Gerard. Er war ähnlich gekleidet, breitschultrig und mit einer Glock 17 bewaffnet, die in einem Schulterholster steckte. Außerdem führte er einen Gurt mit sich, an dem Handschellen, Pfefferspray, eine Maglite, ein Elektroschocker sowie zwei Ersatzmagazine für die Glock befestigt waren. Die Ausrüstung lag im Fußraum, weil man damit unmöglich vier oder fünf Stunden lang sitzen konnte. Denn so lange würde es fraglos dauern, bis sie Lyon erreichten.
Das Navigationssystem im Wagen war an einen Zufallsgenerator gekoppelt, der alle paar Minuten die Route neu zusammenstellte, die auch über Nebenstrecken, Dörfer und verschiedene Autobahnauf- und -abfahrten führen konnte. So genau wusste man das nie. Die Strecke wurde minütlich in der Léonard-Zentrale in Nîmes per GPS kontrolliert und an die Polizei gemeldet. Außerdem gab es ein abhörsicheres Funkgerät, über das alle dreißig Minuten ein Statusbericht abgegeben werden musste. Am Heck und an der Front des Fahrzeugs waren Kameras angebracht, die fortlaufend Bilder an die Zentrale sendeten, wo sie auf Festplatten aufgenommen wurden.
Faktisch war ein Kunsttransporter von Léonard eine fünf Tonnen schwere uneinnehmbare Festung und zudem mit Panzerglas ausgestattet, das einem Schnellfeuergewehrbeschuss aus nächster Nähe standhalten konnte. Die Reifen waren speziell gefertigt und quasi unzerstörbar. Das Fahrwerk war mit Stahlplatten verstärkt und hielt eine durchschnittliche Minenexplosion aus. Um den ebenfalls verstärkten, feuersicheren Aufbau des Wagens zu knacken, brauchte man schon einen Raketenwerfer. Roger nahm außerdem regelmäßig an Fahrtrainings teil und hatte die gleiche Ausbildung wie die Chauffeure von einflussreichen Staatsministern. Gerard hatte früher bei der Fremdenlegion gedient und später in einer Spezialeinheit der Polizei von Marseille, bevor er in die Privatbranche gewechselt war. Zudem gab es ein weiteres Zwei-Mann-Team mit identischer Ausbildung, das dem Transporter in einigem Abstand folgte und ein ziviles Fahrzeug verwendete, im heutigen Fall einen silbernen BMW mit rund dreihundert PS.
Das Navigationssystem führte den kleinen Konvoi zunächst über Rognes und Lambesc bei Salon-de-Provence auf die A7, um den Gebirgszug des Luberon zu umfahren. Von der Autobahn bogen Roger und Gerard allerdings schon bei Avignon-Nord wieder ab und gelangten auf den Schnellweg Avignon-Carpentras. Bei Monteux lotste sie das Navi in Richtung Loriol du Comtat auf die D107, die hier Route de Loriol hieß. Schließlich ging es ab von der D107, und zwar auf den sehr schmalen Chemin de Talaud. Der Wagen passierte einige Gewächshäuser und bog kurz vor einem Geflügelhof auf eine noch schlechtere und schmalere Straße ab, weswegen Roger langsam fahren musste. Falls ein LKW im Gegenverkehr um die Ecke gerauscht kam, würde es sehr knapp werden, unfallfrei aneinander vorbeizukommen.
Roger fluchte am Steuer, aber er war Kummer mit dem dämlichen Zufallsgenerator gewohnt. Gerard beugte sich nach unten, um aus einer Tupperware-Dose im Fußraum einen Energieriegel zu nehmen. Als er sich wieder aufrichtete, sah er eine langgestreckte Kurve vor sich. Links und rechts wuchsen Pinien und Büsche am unbefestigten Straßenrand, neben dem zu beiden Seiten Entwässerungsgräben verliefen.
Gerard wollte gerade Rogers Beschwerde über das bescheuerte Navigationssystem zustimmen, als das Fahrzeug vom heftigen Schlag einer ohrenbetäubenden Explosion erschüttert und mit solcher Wucht seitlich von etwas getroffen wurde, dass die Reifen vom Boden abhoben. Gerard und Roger flogen trotz der Sicherheitsgurte wie Puppen im Führerhaus herum. Der Transporter wurde wie durch einen unsichtbaren Boxhieb aus der Spur geschleudert. Mit den Reifen, die noch den Boden berührten, geriet er in den Straßengraben. Roger verlor vollends die Kontrolle. Der Wagen ruckte und bockte. Dann kippte er auf die Seite und pflügte durch die Büsche, bis er mit der Front vor eine Pinie knallte und schließlich zischend und fauchend liegenblieb.
Einige Momente lang geschah überhaupt nichts. Schließlich schnallten sich Gerard und Roger ab und stellten fest, dass sie augenscheinlich unverletzt waren. Gerard griff nach seiner Waffe und lud sie durch. Roger fasste nach dem Funkgerät. Es war nicht einfach, aber Gerard gelang es, sich hinzustellen und halb auf dem Armaturenbrett, halb auf den Sitzen Fuß zu fassen. Er blickte in den großen Außenspiegel, in dem die Straße hinter dem Transporter zu sehen war. In seinem Kopf schwirrte es, und in seinen Ohren hatte sich ein Klingeln breitgemacht. Er blinzelte einige Male, damit sich seine Sicht klärte, während Roger panisch einen Notruf an die Zentrale absetzte. Ein weißer Rauchnebel hing über der Straße. Er war zu dünn, um von einer Nebelgranate zu stammen. Also musste ihn die Explosion verursacht haben.
Schließlich sah Gerard einige Männer auf die Straße laufen. Sie trugen dunkle Overalls und Masken mit Sehschlitzen sowie automatische Waffen. Zwei von ihnen zielten auf den silbernen BMW, der mitten auf der Straße stehen geblieben war. Ein dritter Mann kam aus dem Unterholz. Er trug etwas auf der Schulter, das er ebenfalls auf den Wagen gerichtet hielt. Es war unschwer zu erkennen, dass es sich um eine Panzerfaust handelte. Damit war klar, was den Transporter eben seitlich erwischt haben musste – zum Glück nicht voll, sonst wäre alles explodiert. Es war außerdem klar, dass die Sicherheitscrew im BMW keine Chance hatte. Die Türen öffneten sich. Die Männer stiegen aus, hoben die Hände über den Kopf und knieten sich auf die Straße, um sich dann auf den Bauch zu legen.
Im nächsten Moment stürmten drei weitere Maskierte aus dem Busch und hielten auf den LKW zu. Zwei Männer mit automatischen Langwaffen. Ein Mann, der eine schwere Flex trug, verschwand hinter dem Heck des LKW. Eine Sekunde später erfüllte lautes, metallisches Kreischen die Luft, während die zwei Schützen sich um das Führerhaus aufstellten, die Schnellfeuergewehre im Anschlag.
Eine Glock 17 gegen zwei Schnellfeuergewehre. Denk erst gar nicht darüber nach, sagte sich Gerard.
Er schaute zu Roger, der ihn mit weit aufgerissenen Augen ansah und weiterhin panisch in das Funkgerät brüllte. In seinem Blick spiegelten sich Angst und Verwirrung wider, ungläubiges Entsetzen über das, was gerade um ihn herum geschah. Gerard ging es nicht anders. Doch der Profi in ihm sagte: Hier drin bist du sicher, solange du nicht den Helden spielst. Die Schützen waren weder an ihm noch an Roger interessiert. Sie wollten die Bilder, und hier, im Führerhaus des gepanzerten Wagens, konnte Gerard und Roger nichts geschehen. Es war ein kleiner Bunker. Die Türen und Seitenwände waren mit Stahl verstärkt. Die Scheiben konnten einem Beschuss standhalten – sicher nicht auf Dauer und aus kurzer Distanz, aber immerhin. Die Männer würden sich außerdem kaum die Mühe machen und die Zeit nehmen, Roger und Gerard zu zwingen, das auf der Seite liegende Fahrzeug zu verlassen. Zu umständlich, zu zeitraubend. Sie wollten lediglich sicherstellen, dass die Besatzung des Transporters ihnen nicht in die Quere kam, und Gerard hatte das auf gar keinen Fall vor.
Gerard blickte nach vorn durch die Windschutzscheibe. Wenige Meter davor standen die beiden Männer mit den Gewehren und Sturmhauben. Die Art, wie sie den Überfall angegangen waren, wie sie die Waffen hielten, welche sie benutzten … Das waren keine Amateure, dachte Gerard, während sich das Kreischen der Flex zu einem ohrenbetäubenden Jaulen steigerte. Nein, die Männer kannten sich aus und waren ebensolche Profis wie er selbst. Also hob er die Hände an, um die Männer sehen zu lassen, dass er nichts plante. Er ließ die Glock in seiner Rechten demonstrativ fallen. Sie landete im Fußraum neben der Mittelkonsole.
»Bist du verrückt!?!«, herrschte Roger ihn an.
»Nein«, rief Gerard gegen den Lärm zurück. »Nur nicht lebensmüde!«
An Rogers Gesichtsausdruck war abzulesen, wie er innerhalb eines Augenblicks eins und eins zusammenzählte. Dann tat er es Roger gleich und ließ die Sprechmuschel vom Funkgerät fallen und zeigte den Schützen ebenfalls seine Hände.
Einen Moment später folgte ein lautes Krachen vom Heck. Das Kreischen der Flex hörte schlagartig auf. Rumpeln und Rufen folgte.
»Die kommen nicht weit«, hörte Gerard Roger reden, wendete den Blick aber nicht von den Räubern ab, die nach wie vor auf die Windschutzscheibe zielten. »Die Zentrale ist alarmiert. Die haben keine Chance. Was denken die, was sie mit den Bildern anfangen wollen? Wie haben die uns überhaupt gefunden? Die müssen uns überwacht haben. Gehackt. Aber die kommen nicht weit. Gott, die werden doch nicht schießen? Schießen die gleich? Die müssen doch wissen, dass sie …«
»Schnauze«, raunte Gerard, während aufgeregt klingende Stimmen aus dem Funkgerät krächzten. »Die wissen ganz genau, was sie tun. Du und ich – wir sind ganz entspannt. Wir bewegen uns keinen Zentimeter und zeigen weiter unsere Handflächen. In spätestens fünf Minuten ist der Spuk vorbei, und niemandem wird etwas passieren.«
2
Abel hörte seinen eigenen Atem überlaut und spürte das Herz gegen die Brust pochen, als wolle es sich einen Weg nach draußen bahnen. Unter der Sturmhaube war es heiß und stickig. Er schwitzte unter der Schutzweste. Die Muskeln in seinen Armen brannten vom Halten des Sturmgewehres, dessen Lauf er nach wie vor auf die Scheibe des Transporters richtete. Dabei waren die Gewehre eigentlich nicht sehr schwer. Er und die anderen waren mit nagelneuen HK416 von Heckler & Koch bewaffnet, dem künftigen Standardgewehr der französischen Armee. Abel wusste nicht, woher die Waffen stammten. Das galt auch für die leichte Panzerfaust, eine kurze Röhre mit der Bezeichnung AT4, ebenfalls aus Militärbeständen. Was sie trotz der geringen Größe anrichten konnte, hatte er eben verfolgt: einen tonnenschweren gepanzerten Sicherheitstransporter umwerfen, als sei er eines dieser Hotwheels-Autos, mit denen Abels Sohn spielte.
Er starrte auf die Scheibe und die beiden Männer dahinter. Sie hielten ihre Hände hoch. Aber von ihnen ging ohnehin keine Gefahr aus. Durch das Sicherheitsglas konnten sie nicht schießen und nach draußen gelangen sowieso nicht. Die Fahrertür war blockiert, weil der Wagen mit allem Gewicht darauf lag. Die schwere und mit Stahl verstärkte Beifahrertür müsste man öffnen wie die Luke von einem U-Boot und dann umständlich herausklettern. Das würden die zwei Kerle nicht wagen. Der einzige ernstzunehmende Gegner war die Zeit, und die verrann unaufhörlich.
Luc schien mit der Flex fertig zu sein. Das laute Kreischen hörte auf. Es krachte heftig, als eine der beiden Hecktüren des Transporters aufschlug und auf den Straßenbelag fiel. Dann herrschte für einige Momente fast völlige Stille. Die Grillen zirpten. In der Ferne war das Geräusch eines Treckers zu hören. Im Motorraum des Lieferwagens zischte es leise. Schließlich kletterte Luc hinein. Olivier, der neben Abel stand, schulterte sein Gewehr und lief los, um Luc zu helfen. Abel blieb stehen, wo er war, und sah, dass sich auch Elian seine Waffe, die Panzerfaust, am Gurt umhängte und sich in Richtung Heck bewegte.
Im Gehen klappte er den kleinen Transportwagen aus Aluminium auf, der etwas größer als eine reguläre Sackkarre war und über dicke Gummireifen verfügte, um auch auf unwegsamem Gelände gut bewegt werden zu können. Etwas weiter hinten waren die anderen beiden damit befasst, die Insassen des BMW mit Kabelbindern zu fesseln. Schließlich tauchten Luc und Olivier wieder auf und legten mehrere flache Holzkisten auf dem Transportwagen ab. Jede war etwa halb so groß wie ein Türblatt. Darin steckten die Gemälde von Paul Cézanne, die zum Glück nicht sehr groß waren, dafür ungeheuer wertvoll. Immens. Man konnte mit Fug und Recht sagen, dass gerade eine halbe Milliarde Euro umgepackt und in den Lieferwagen verfrachtet wurde, der mit den Fluchtfahrzeugen in der Parallelstraße hielt und in spätestens drei Minuten abfahren würde. Alles war exakt geplant und auf die Sekunde genau getaktet. Es waren sieben Minuten für die gesamte Aktion kalkuliert. Zwölf bis vierzehn Minuten brauchte die Polizei, um so weit draußen auf dem Land vor Ort zu sein. Das machte fünf bis sieben Minuten Vorsprung – ausreichend, um in alle Himmelsrichtungen zu verschwinden und in der Zeit die Fahrzeuge zu wechseln. Falls nichts schiefging.
Dann ging etwas schief.
3
Die beiden Sous-Brigadiers Claude Boniot und Yves Chamier in einem Auto – das war eine problematische Konstellation in diesem Sommer. Boniot war Fan von Olympique Marseille, dem mehrmaligen Zweitplatzierten der Ligue 1. Chamier hingegen war Anhänger des Clubs Paris St. Germain, der in vier Jahren hintereinander Meister geworden war. Die Polizisten waren auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall, der sich auf einer Landstraße ereignet hatte. Verletzte gab es wohl nicht und nur einen geringen Blechschaden, der beim Abbiegevorgang geschehen war. Aber der Fahrer des neuwertigen Mercedes hatte darauf bestanden, dass die Polizei hinzugezogen wurde. Also hatten Boniot und Chamier die Routinestreife unterbrochen, um den Unfall aufzunehmen.
Die Klimaanlage stand auf Anschlag. Draußen war es irre heiß und trocken. Die Sonne brannte durch die Seitenscheibe auf Boniots Unterarm. Gelegentlich kamen Funkcodes durch, die sich mit elektronischen Piepgeräuschen an- und abmeldeten. Aber davon ließen sich die beiden Polizisten nicht ablenken und hörten der Leitstelle nur mit einem Ohr zu.
»Und mal im Ernst«, sagte Boniot, »und ohne Quatsch: Ich verstehe nicht, wie du im Süden leben kannst und Paris-Fan bist.«
Chamier lachte und steuerte den Streifenwagen weiter geradeaus. »Das hat doch damit nichts zu tun.«
»Aber ja«, erwiderte Boniot. »Eine Frage der regionalen Identität. Du hast Marseille vor der Tür. Also unterstützt du Marseille.«
»Wer hat dir denn den Quatsch erzählt?«
»Was ist denn in den vergangenen Jahren Gutes aus Paris gekommen? So ganz allgemein?«
»Laetitia Casta.«
»Die stammt nicht aus Paris.«
»Alle Models stammen aus Paris.«
»Sie aber nicht. Ich habe in der Jolie gelesen …«
Chamier lachte erneut. »Du liest die Jolie?«
»Die von meiner Frau.«
Chamier lachte immer noch. »Haste dir Schminktipps angelesen, mein Süßer?«
»Um sie dir zu geben, damit du deinen Neymar bezirzen kannst.«
»Neymar ist ein Gott.«
»Ein teurer Gott, für zweihundertzweiundzwanzig Millionen Euro aus Barcelona gekauft …«
»Er ist jeden Cent wert.«
Sie verstummten beide, als die Leitstelle per Funk den Code für einen bewaffneten Raubüberfall auf einen bewachten Sicherheitstransporter meldete. Der Alarm galt für alle Einheiten und damit auch für Boniot und Chamier, die sich mitsamt einem weiteren Streifenwagen, der gerade Verkehrskontrollen machte, in der unmittelbaren Nähe befanden. Also checkte Boniot das Navi und sagte Chamier, welche Richtung er zum Einsatzort nehmen musste. Chamier schlug sauer mit der Faust aufs Lenkrad. Er hatte sich auf einen geruhsamen Dienst gefreut und hatte eigentlich keine Lust, sich bei dieser Hitze um etwas so Aufwändiges wie einen Raubüberfall zu kümmern. Er nahm die nächste Abzweigung und stellte das Blaulicht und die Sirene an. Boniot fluchte ebenfalls, weil er wie Chamier mit einem durchschnittlichen Arbeitstag mit durchschnittlichen Vorfällen gerechnet hatte. Chamier und Boniot wechselten einen genervten Blick. Sie dachten beide dasselbe. Bewaffnete Raubüberfälle waren ärgerlich. Bewaffnete Raubüberfälle mit flüchtigen Tätern waren noch ärgerlicher. Aber Raubüberfälle auf bewachte Sicherheitstransporte mit schwerbewaffneten Tätern, die noch vor Ort waren – die ganz große Scheiße. Chamier dachte an die Ausrüstung im Kofferraum, wo die Maschinenpistolen und die Schutzwesten lagen. Er hoffte, dass sie nicht darauf zurückgreifen müssten und es sich rächen könnte, dass er schon seit fast einem Jahr das Schießtraining geschwänzt hatte.
4
Abel drehte sich herum und starrte in die Luft wie ein Jagdhund, der Witterung aufgenommen hat. Auch die anderen gefroren scheinbar in der Bewegung – Luc, Olivier, die beiden am BMW, bei denen es sich um die Fournier-Brüder handelte, eineiige Zwillinge einer Klapperschlange mit dem Temperament eines Geysirs. Sie alle hörten dasselbe: eine Polizeisirene. Sie klang sehr nah, musste eben erst eingeschaltet worden sein, und der Klang kam näher. Wie auf Knopfdruck geriet wieder Bewegung in die Truppe. Alles ging jetzt viel schneller bei Luc, Olivier und Elian. Die Fourniers kamen angelaufen, um sie zu unterstützen. Allen war klar, dass sich ihr Zeitpuffer gerade in Luft aufgelöst hatte.
Abel blickte zur Seitenstraße, wo die Fluchtfahrzeuge parkten. Schien alles frei zu sein. Er schaute wieder zurück – und sah schließlich den Streifenwagen, der mit Blaulicht herangerast kam. Luc und Olivier setzten sich in Gang. Sie schoben den Karren mit den Gemälden in Richtung Fahrbahnrand. Von dort aus müssten sie ihn einige Meter querfeldein und eine Böschung hinaufmanövrieren. Elian unterstützte sie und fluchte, weil der Raketenwerfer am Gurt verrutschte und sich zwischen seinen Beinen verfing, was ihn ins Stolpern und fast zum Stürzen brachte.
Abel schlug das Herz bis zum Hals. Dass sie von der Polizei überrascht werden würden, war nicht vorgesehen. Ja, es war als Worstcase ins Kalkül gezogen worden. Es war immer der schlechteste aller Fälle, dass man erwischt wurde, und dann gab es sowieso nur eine Antwort: Take the money and run.
Was natürlich nicht immer so einfach war. Zum Beispiel jetzt, denn der Streifenwagen kam etwa fünfzig Meter vor Abel mit quietschenden Reifen zum Stehen.
Was jetzt?, fragte sich Abel. Abwarten, schießen, fliehen? Am besten abwarten, entschied er. Luc und Olivier Deckung geben. Dann selbst zu den Fluchtwagen laufen und nichts wie weg.
Doch die Fournier-Zwillinge entschieden anders.
Links und rechts neben Abel krachte es mehrfach. Heiße Patronenhülsen flogen ihm wie Konfetti um die Ohren. Die Brüder feuerten kurze Salven auf den Streifenwagen ab. Abel sah noch, wie sich die Insassen duckten. Im nächsten Moment wurden die Fahrzeugscheiben blind. Kugeln stanzten Löcher in das Auto, das sich mit durchdrehenden Reifen in einer Wolke aus weißem Qualm rückwärts bewegte. Die Zwillinge marschierten voran und feuerten weiter. Die Lampen am Polizeiwagen zerplatzten. Er rumpelte über einen Grünstreifen, rasierte Büsche um und gelangte schließlich auf die wenige Meter weiter verlaufende Parallelstraße, auf der er stehenblieb.
Abel hob sein Gewehr – unschlüssig, ob er ebenfalls schießen sollte. Aber es schien vorerst vorbei zu sein. Die Fournies wechselten die Magazine und liefen dann geduckt los, um den übrigen zu den Fluchtfahrzeugen zu folgen. Abel beschloss, ihnen zu folgen. Er drehte sich noch einmal herum, suchte mit der Spitze des Gewehrlaufs die Fahrbahn ab, die zwei Gefesselten, die Leute im Lieferwagen. Keiner machte Mucken. Alles ruhig. Trotzdem besser, den Rückweg zu decken. Abel bewegte sich einige Meter rückwärts auf der Straße, ohne das Gewehr herunterzunehmen. Dann musste er sich doch umdrehen und spurtete los, um so schnell wie möglich zum Fluchtfahrzeug zu gelangen. Vielleicht hatten sie ja noch eine Chance zu entkommen. Abel betete jedenfalls dafür. Auch dafür, dass die Fourniers die beiden Polizisten in dem Streifenwagen nicht erschossen hatten. Denn ansonsten wäre in wenigen Minuten nicht nur der Teufel hinter Abel und den anderen her, sondern zugleich sämtliche seiner Dämonen und Höllenhunde, die Blut sehen wollten …
5
Boniot öffnete die Tür und ließ sich aus dem Wagen fallen, der quer auf der Parallelstraße stand, dampfte und fauchte. Chamier hing in den Sicherheitsgurten und wirkte ziemlich tot. Die Räuber hatten das Auto perforiert, und da es mit der Beifahrerseite voran zum Stehen gekommen war, hatte Chamier offenbar reichlich einkassiert.
Vielleicht lebte er noch. Aber Boniot konnte ihm jetzt nicht helfen. Er musste seinen eigenen Hintern retten, raus aus diesem Gefängnis und in sichere Deckung. Er hatte eben per Funk durchgegeben, dass sie unter schweren Beschuss geraten waren. Jeden Moment müsste der zweite Streifenwagen eintreffen, der in der Nähe zu Verkehrsüberprüfungen unterwegs war. Das würde nicht so viel bringen – diese Räuber hatten jede Menge automatische Waffen dabei und setzten sie rücksichtslos ein. Doch bis wirklich ernstzunehmende Verstärkung vor Ort war, könnte es noch einige Zeit dauern, wusste Boniot. So lange musste er durchhalten und am Leben bleiben.
Boniot schlug auf dem von der Sonne heißen Asphalt auf. Er suchte hinter dem Vorderreifen und der Motorhaube Deckung, lehnte sich mit dem Rücken an. Dabei fiel ihm auf, dass es ihn ebenfalls erwischt hatte. Sein rechtes Bein fühlte sich eiskalt und gleichzeitig so heiß an, als habe jemand kochendes Wasser darüber geschüttet. Die Uniformhose hatte sich am Oberschenkel mit Blut vollgesogen.
Er blickte wieder auf und sah, dass eine Absperrung auf der Straße stand. Als ob hier Bauarbeiten stattfanden. Es gab aber keine.
Boniot legte sich flach auf den Boden und rollte sich auf den Bauch. Er fasste die Dienstwaffe mit beiden Händen, rutschte ein Stück nach rechts und linste unter dem Auto hindurch in die andere Richtung. Er sah in einiger Entfernung eine weitere Absperrung. Am Straßenrand parkte ein hellblauer VW Lieferwagen mit der Aufschrift von einer Kanaluntersuchungsfirma. Außerdem hielt dort ein ebenfalls hellblauer Van mit derselben Aufschrift. Beide Autos waren umlagert von mehreren maskierten Bewaffneten. Einige schienen damit beschäftigt zu sein, etwas zu verladen. Einer kam rückwärts aus einem Gebüsch, das Gewehr auf die Parallelstraße gerichtet, wo der Sicherheitstransporter auf der Seite lag. Zwei andere bewegten sich auf die Straßenmitte, um mit den Gewehren auf Boniot und den Streifenwagen zu zielen.
Scheiße, die würden doch nicht …
Boniot hielt den Pistolengriff fest umklammert und richtete den Lauf auf die Räuber. Er betete. Allerheiligste Mutter Gottes …
Aber die Leute schossen nicht, sahen ihn auch nicht. Aus ihrem Blickwinkel, das wurde Boniot jetzt klar, konnten sie das nicht. Vielleicht nahmen sie sowieso an, dass er und Chamier tot waren – zumindest außer Gefecht gesetzt. Sie sicherten lediglich die Straße und würden erst dann einen Kugelhagel entfachen, wenn Boniot als Erster mit dem Schießen begann.
Boniot dachte: Solange ich mich ruhig verhalte, passiert mir nichts. Ich bleibe hier liegen, rühre mich nicht und blute vor mich hin, bis Hilfe kommt.
Dann fielen ihm zwei Tatsachen auf.
Er konnte die Fronten der Autos sehen. Die Schlussfolgerung daraus war: Wenn sie losfuhren, würden sie voll auf Boniot zuhalten. Die andere Tatsache war, dass sein Streifenwagen quer und mitten auf der Fahrbahn stand und ihren Weg blockierte. Eher, dachte Boniot, würden die Räuber ihn rammen und zur Seite schieben, als in drei Zügen auf der Fahrbahn zu wenden und eine andere Fluchtroute zu wählen. Es war klar, was in diesem Fall aus Boniot werden würde: Hackfleisch.
Damit änderte sich seine Situation innerhalb kürzester Zeit ein weiteres Mal dramatisch. Denn Boniot hatte kein Interesse daran, unter den Reifen eines Fahrzeugs zerquetscht zu werden. Aber wenn er nun zur Seite robbte, würden ihn die Schützen sehen und bestimmt das Feuer eröffnen. Außerdem lebte Chamier vielleicht noch. Er durfte ihn nicht seinem Schicksal überlassen.
Dann wurden Türen zugeworfen. Boniot vernahm Rufe. Die Leute schienen mit dem Verladen ihrer Beute fertig zu sein. Die ersten stiegen in die Fahrzeuge. Im nächsten Moment hörte Boniot Polizeisirenen. Sie kamen aus der anderen Fahrtrichtung.
Die Schützen wirbelten herum und drehten Boniot den Rücken zu.
Gott sei Dank, dachte Boniot im ersten Moment, sie zielen nicht mehr auf mich. Im zweiten geriet er in Panik. Denn den Räubern musste klar sein, dass sie auf der Straße jetzt zwischen zwei Polizeifahrzeugen eingekeilt waren. Sie könnten entweder versuchen, mit ihren Fluchtfahrzeugen querfeldein die Böschung hinab auf die Parallelstraße zu gelangen, wo sich der umgestürzte Transporter befand.
Oder sie würden sich ihren Weg freischießen.
Ja. Nach seiner Einschätzung würden sie genau das tun. Daran hatte Boniot keinen Zweifel. Hier würde jeden Moment ein weiteres Mal die Hölle losbrechen.
Er schluckte schwer, atmete einige Male tief durch und legte sich noch flacher auf den Boden, so dass seine Fäuste und die Unterseite des Waffengriffs auf dem Asphalt lagen und die Position der Pistole stabilisierten. Optimal zum Zielen.
Boniot wollte nicht als Hackfleisch enden.
6
Abel keuchte in die Sturmhaube, als er die zweite Polizeisirene hörte. Er wirbelte um die eigene Achse, um in die Richtung zu zielen, aus der der Wagen kam.
Er sah das Auto. Die Besatzung musste cleverer als die andere oder bereits gewarnt worden sein. Jedenfalls kamen die Polizisten gar nicht erst näher und stellten das Fahrzeug in etwa hundert Metern Entfernung quer auf die Fahrbahn.
Blockiert von beiden Seiten, dachte Abel. Eingekeilt. Nein, so war das nicht geplant gewesen.
Er hörte, wie die Motoren der Fluchtfahrzeuge ansprangen. Luc saß am Steuer des Lieferwagens. Olivier fuhr den anderen. Das heißt: Wohin denn fahren, denn die beschissene Straße war ja an beiden Enden blockiert!
Elian stieg in den Transporter, fuchtelte mit der Panzerfaust herum und wechselte einige Worte. Dann entschied er sich anders und stieg wieder aus. Das hatte nichts Gutes zu bedeuten, nahm Abel an. Elian lud die Waffe, während die Zwillinge sich mitten auf der Straße aufbauten und die Gewehre in Anschlag nahmen – ohne jede Deckung, die Vollidioten.
Einen Augenblick später krachten mehrere Schüsse. Die Fourniers hatten das Feuer auf den zweiten Polizeiwagen eröffnet. Abel presste sich dicht an den Aufbau des VW Transporters und nahm das Sturmgewehr ebenfalls hoch, um die Zwillinge zu unterstützen. Aber noch schoss er nicht, wartete ab. Er blickte zur Seite und sah, wie sich Elian auf den Boden kniete und die AT4 auf die Schulter legte, um den bereits ausgeschalteten Polizeiwagen anzuvisieren. Wie es aussah, wollte er die Straße freipusten. Dann sprangen die Fourniers geduckt in Deckung, während von der anderen Seite her die Polizisten das Feuer erwiderten. Abel nahm das Fahrzeug ins Visier und gab einige kurze Feuerstöße ab.
Verdammte Scheiße, dachte er. Das alles hier dauerte viel zu lange. Sie hatten bereits kostbare Minuten verloren und verloren nun weitere, indem sie sich eine Schießerei leisteten.
»Alle hinter mir weg!«, rief Elian.
Abel sah zu ihm. Elian klemmte die Wange dicht an das Rohr der Panzerfaust, um zu visieren. Einen Wimpernschlag später schrie er auf. Sein Standbein klappte einfach zur Seite. Das Knie verschwand in einem roten Nebel. Offenbar hatte in dem anderen Streifenwagen doch jemand überlebt und schoss nun, bevor eine panzerbrechende Rakete auf ihn abgefeuert würde. Abel wirbelte herum, um Elian Deckung zu geben, der nochmals aufschrie, als er schon halb am Boden lag und ihn ein weiterer Schuss traf. Er hielt sich krampfhaft an der Panzerfaust fest, die jetzt …
Kacke, dachte Abel.
Ein dumpfer Knall. Weiße Wolken tauchten an beiden Enden der Panzerfaust auf. Mit einem lauten Zischen löste sich die Rakete aus der AT4 und explodierte wenige Meter weiter, wo sie den hinter dem VW Transporter geparkten Van erwischte. Die Wucht wirbelte den Wagen in die Luft, als sei er auf eine Mine gefahren. Die Zwillinge flogen wie Puppen durch die Luft. Die Druckwelle der Explosion traf Abel wie ein Tritt vor den Brustkorb. Alles um ihn herum tanzte, drehte sich, wirbelte. Dann schlug er mit dem Kopf auf etwas auf und stellte verwirrt fest, dass er auf der Straße lag, das dampfende und zischende Polizeiauto direkt vor sich. Er musste fast zehn Meter durch die Luft gesegelt sein. Er bekam keine Luft, rollte sich auf die Seite und hörte nur ein Klingeln in den Ohren. Schließlich vernahm er eine Stimme, die er nicht zuordnen konnte. Jemand schrie ihn an. Abel sah sich um – da war ein Gesicht unter dem Polizeiwagen. Jemand lag dort auf dem Boden und zielte auf ihn. Abel verstand nicht, was er sagte. Er wollte nur wieder atmen können. Und er wollte weg hier. Fort. Alles um ihn herum rauchte und qualmte. Sein Gewehr lag neben ihm.
»Hände über den Kopf!«, brüllte ihn der unter dem Auto liegende Mann an. »Hände über den verdammten Kopf!«
Abel versuchte es. Wollte sich auch abtasten und prüfen, ob noch alles an ihm dran war. Aber nichts wollte ihm gelingen. Dann fuhr mit einem Mal alle Kraft aus ihm. Die Welt um ihn herum wurde weiß, und er glitt in dieses allumfassende Nichts, das ihn mit einer unendlich wunderbaren Schwerelosigkeit in Empfang nahm.
7
Albin zog an der Zigarette und stieß eine Wolke Rauch aus. Er sah ihm hinterher, bis er sich im blendenden Weiß des bedeckten Himmels verlor, unter dem die Provence seit gestern wie unter einer Dunstglocke kochte. Es war heiß und schwül wie in den Tropen. Die duftschwangere Luft war zum Schneiden. Jeder hoffte, dass bald ein erlösendes Gewitter kam, wonach es jedoch nicht aussah.
Albin blickte wieder zurück auf die Zeitung, die er mehrfach gefaltet hatte, damit er sie in einer Hand halten und lesen konnte. Der Wetterbericht erklärte, dass das unerträgliche Klima etwas mit der Sahara und bestimmten Windphänomenen zu tun habe. Nach Albins Meinung lag es eher daran, dass sich das Klima generell veränderte und die Sahara sich immer weiter ausbreitete. Manche Geologen behaupteten, sie sei längst in Spanien angekommen. Dort war es nach Albins Wissen zwar schon immer heiß und sandig gewesen. Kein Wunder, dass die Mauren sich dort pudelwohl gefühlt hatten. Aber die Qualität von »heiß und sandig« war in den vergangenen Jahrzehnten wohl eine neue geworden. Auf der Hand lag jedoch, dass überall auf der Welt immer öfter merkwürdige Stürme und heftige Regenfälle sowie weitere Phänomene auftauchten, die es früher nicht gegeben hatte.
Auf der anderen Seite mochte das alles nur Einbildung sein. So nach dem Motto: Früher war alles besser. Früher waren Sommer noch Sommer und Winter noch Winter. Und las man ältere Bücher von Achtzehnhundertsoundsoviel, dann fluchten die Menschen darin, dass man sich auf das Wetter nicht mehr verlassen könne, dass die Sommer von früher mit den heutigen nicht zu vergleichen wären und damals Winter wenigstens noch Winter gewesen seien. Vor über hundert Jahren! Also war dieses Klimaphänomen vielleicht zu großen Teilen auch ein Phänomen des Älterwerdens. Oder auch nicht, denn an einem gab es keinen Zweifel: Es veränderte sich etwas, und die Gletscher verschwanden. Das konnte man zweifelsfrei auf Fotografien von damals und heute feststellen. Daran gab es nichts zu deuteln. Ob der Grund dafür allerdings tatsächlich die Umweltverschmutzung war – wer wusste das schon. Gut war sie fraglos nicht für das Klima, das sich andererseits in der Eiszeit ebenfalls sehr deutlich verändert hatte, ohne dass jeder Amerikaner einen SUV mit in die Wiege gelegt bekam und in chinesischen Großstädten Dauersmogalarm herrschte.
Trotzdem fragte sich Albin manchmal, in welcher Welt seine Enkelin Clara wohl leben würde, wenn sie in sein Alter kam. Vielleicht waren Tropenstürme dann längst an der Tagesordnung – und die Sensation wäre ein Tag ohne Orkan. Vielleicht war bis dahin Marseille vom Meer verschlungen und die Menschen trugen alle Chips hinter den Ohren, mit denen sie telefonieren und sich Fernsehbilder direkt ins Gehirn senden lassen konnten.
War das eine erstrebenswerte Welt? Albin zog erneut an seiner Zigarette. War es eine Welt, nach der man sich sehnen sollte oder vor der man warnen musste? Tja, aber wie war es denn mit seiner eigenen Welt? Wenn er fünfzig Jahre zurückschaute, ungefähr auf das Jahr 1970 – müsste man dann vom Standpunkt eines Zeitgenossen vor Smartphones warnen? Oder vor der Tatsache, dass sich jeder Mensch mit jedem anderen auf der Welt innerhalb von Millisekunden verbinden und kommunizieren konnte? Dass Autos sich selbst lenkten und mit Strom fuhren statt mit Benzin?
Du machst dir zu viel unnütze Sorgen, sagte Tyson.
»Ich weiß«, erwiderte Albin in Gedanken. »Ich höre ja schon auf.«
Tyson lag unter dem Bistrotisch zu Albins Füßen und blickte hechelnd nach oben. Der kleine Kerl litt ebenfalls unter dem Klima. Tyson war Albins Mops. Die Kollegen von der Polizei hatten ihm das Tier zum Ruhestand geschenkt, damit er etwas Zerstreuung hatte und eine Beschäftigung und niemanden mehr nerven würde. Tja, da hatten sich die Kollegen geschnitten, denn Albin hatte sich immer wieder in Angelegenheiten eingemischt, die ihn nichts mehr angingen. Und Tyson hatte ihm immer wieder ein Alibi dafür gegeben, an Orten herumzuspazieren, an denen er eigentlich nichts verloren hatte.
Doch damit war jetzt ein für alle Mal Schluss und Albin Leclerc endlich im Ruhestand angekommen. Feierabend.
Er hatte sich mit seiner Tochter Manon versöhnt, die vor ihrem psychopathischen Mann aus Paris geflohen war und mit Albins Enkelin Clara jetzt in der Provence lebte, wo Albin ihr mittlerweile eine kleine Wohnung besorgt hatte – außerhalb von Carpentras zwar, aber nahe genug an seiner, um schnell zur Hilfe zu sein, falls sein wahnsinniger Schwiegersohn wieder auftauchen sollte. Für Clara hatten sie einen Platz im Kindergarten gefunden, von wo Albin das Mädchen fast jeden Tag abholte. Ihre Mutter half in Veroniques Blumenladen aus. Manon verstand sich inzwischen wirklich ausgezeichnet mit Albins Lebensgefährtin Veronique, die bereits selbst Oma war. Kurz: Albin hatte Familie, eine Aufgabe und trug Verantwortung. Schluss damit, sich weiter in Polizeiangelegenheiten einzumischen und sich in Gefahr zu begeben. Er hatte gelernt, loszulassen. Er war jetzt ein anderer Mensch. Runderneuert.