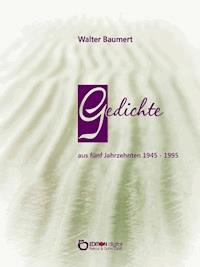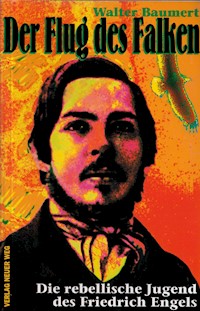Schau auf die Erde – Der Flug des Falken. Zweites Buch: Abschied von den Träumen E-Book
Walter Baumert
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schau auf die Erde – Der Flug des Falken
- Sprache: Deutsch
Ein Mensch wächst ins Leben, ein Mensch, mit dem man lachen und weinen, zweifeln und hoffen kann. Der wohlbehütete Fabrikantensohn, mit überdurchschnittlicher Intelligenz begabt und von großem Gerechtigkeitsempfinden erfüllt, wird zwischen der Zuneigung zu den Eltern, der Liebe zu Gott und der Armut und Ungerechtigkeit in der nächsten Umwelt hin und her gerissen. Seine Versuche, sich aufzulehnen, bringen ihn oft in Bedrängnis und führen zur harten Entscheidung des Vaters, dass er Kaufmann zu werden habe. Nebenbei bildet er sich, sucht er Gleichgesinnte, streitet Nächte hindurch, schreibt Gedichte und liebt - das Arbeitermädchen Agnes, die todkranke Pianistin Magdalena, die wenig ältere Susanne, die kapriziöse Jane, dann lernt er Mary Burns kennen. Ein junger Mensch in seinem Widerspruch, in seiner Entwicklung wird dargestellt: Friedrich Engels. Die „gute alte Zeit“ um 1830 war keineswegs eine beschauliche Epoche. Auch wenn der preußische Obrigkeitsstaat für Friedhofsruhe gesorgt zu haben scheint, gärt es in deutschen Landen. In dieser Zeit des Vormärz wächst der junge Engels heran, Sohn eines Wuppertaler Textilfabrikanten. Schon früh stößt Friedrich auf den Gegensatz von industriellem Aufschwung und dem Elend der arbeitenden Menschen. Schritt für Schritt löst er sich aus der beengten Umgebung des Elternhauses. Begegnungen mit immer neuen Menschen geben Friedrich neue Anstöße, die Halbheiten manches Vorbildes reizen zum Widerspruch, das Unrecht zur Rebellion. Das Buch erschien 1981 sowohl in der DDR als auch in der BRD und erreichte eine Gesamtauflage von 250 000 Büchern. Nach dem Buch entstand 1985 der 4-teilige Film für das DDR-Fernsehen der DDR „Flug des Falken". Das 2. Buch schildert die Zeit seiner kaufmännischen Ausbildung in Bremen, in der er unter dem Namen „Friedrich Oswald“ zahlreiche Beiträge, aber auch erste Lyrik- und Prosaarbeiten, in fortschrittlichen Zeitungen veröffentlichte. INHALT: Sinfonia eroica Audienz bei einem Dichter Poetische Berufung Die Hölle des Zweifels Schild und Schwert Ich suche das Feuer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Walter Baumert
Schau auf die Erde – Der Flug des Falken. Zweites Buch: Abschied von den Träumen
Die rebellische Jugend des Friedrich Engels
ISBN 978-3-86394-555-8 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1981 unter dem Titel „Schau auf die Erde“ im Verlag „Neues Leben Berlin“ und gleichzeitig unter dem Titel „Der Flug des Falken“ im Weltkreis-Verlag Dortmund.
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2014 EDITION digital® Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
Erstes Kapitel: Sinfonia eroica
Am späten Nachmittag wurde der Himmel schwarz. Tiefdunkle Gewitterwolken türmten sich über dem Tal. Die demütigen Häuser der Stadt Elberfeld schienen sich noch tiefer unter die Blätterdächer der mächtigen Buchen zu ducken. Wer unterwegs war, beeilte sich, unter ein schützendes Dach zu kommen. Es war ein Sonntag, Anfang Februar siebenunddreißig, und der Versammlungssaal der reformierten Kirche im Stadtzentrum war bis auf den letzten Platz mit den schwarz gekleideten Pietisten der reformierten Gemeinde gefüllt. Wer durfte es wagen, die wöchentliche Bußandacht zu versäumen, seit Friedrich Wilhelm Krummacher nach dem Tod seines Onkels dessen strenges Kirchenregime noch erheblich verschärft hatte? Tief gebeugte Sünder waren überall in den Bankreihen zu sehen. Schweiß perlte auf Stirnen. Nervös irrten Augen umher. In den Gesichtern stand Angst davor geschrieben, aufgerufen zu werden von der Stentorstimme des Geistlichen, angeklagt schwerer Vergehen gegen die Gebote Gottes. Wer konnte sicher sein, ob nicht irgendeines der kleinen Laster,die man sich insgeheim gönnte, ausgekundschaftet und zur Anzeige gebracht worden war, von einem hämischen Nachbarn vielleicht, einem guten Freund oder gar von der eigenen Frau? Unendlich war die Liste sündigen Tuns. Jeder Lebensgenuss wurde unnachsichtig geahndet, das Lesen eines Romanbuches etwa, das man sich verbotenerweise aus Köln mitgebracht hatte, oder gar der heimliche Besuch des Theaters in Düsseldorf, der Aufenthalt in der „Bierkirche" oder einer noch schlimmeren Lasterhöhle der weiteren Umgebung.
Die Gerechten freilich, die stets unter dem Herrn wandelten, die alten Weiber, die heruntergekommenen, verarmten Handwerksmeister, die ständig das Gebetbuch zur Hand hatten, während ihre Gesellen die Arbeit verrichteten, die saßen hier eifernd, mit schadenfrohen Gesichtern und warteten mit wollüstiger Begier auf das allwöchentliche Scherbengericht gegen die Schamlosen, Verworfenen, Hemmungslosen ...
An diesem wolkenverhangenen Nachmittag jedoch mussten sie vergebens warten. Keine Einzelvergehen wurden heute abgeurteilt. Es galt einem viel schlimmeren Unheil zu begegnen, einem gefährlichen Anschlag der Lutheraner, Freigeister, Ketzer und Götzenanbeter gegen die Unbeflecktheit und Reinheit der frommen Stadt. Pastor Krummacher wies aus der Kirche hinaus nach Norden, dorthin, wo gleich neben dem Rathaus jener tempelartige Säulenbau aus der Franzosenzeit stand, dem die ketzerischen Stadtväter von damals den heidnischen Namen Museum gegeben hatten. Jeder kannte den Stein des Anstoßes. Mit seinem überdimensionalen Dach könnte man ihn in der Abenddämmerung für ein zwar riesenhaftes, aber harmloses Kamel halten. Doch es war das Trojanische Pferd Satans. Gottlob war der gewaltige Saal mit seinen tausend Sitzplätzen seit Jahren leer geblieben. Dank der Wachsamkeit der Pietistengemeinde konnten die einmal vorgesehenen Theatergastspiele und Konzerte erfolgreich verhindert werden. Zwar belastete dies schmerzhaft das Stadtsäckel, aber das Seelenheil blieb gewahrt. Nun aber hatte ein Herr Potthof als neuer Direktor die Verwaltung des Museums übernommen. Unter stillschweigender Duldung des lauen Bürgermeisters wagte er es, das größte Orchester der Rheinprovinz zu verpflichten. Nach seinem Willen sollte dort in einigen Wochen das erste Sinfoniekonzert der Calvinistenstadt stattfinden! „Welch frevlerische Verschwörung!“, schrie der Prediger seiner erschauernden Gemeinde empört zu. „Hört in euch hinein! ob nicht auch in euch selbst eine Stimme ist, die euch einreden will, was sei da schon dabei, ein Konzert? Hört sich nicht auch der König hin und wieder ein Konzert an und ist doch ein frommer Mann? Wie soll uns ein Konzert wankend machen können in unserem Glauben? Ich aber sage euch, niemand und niemand ist gefeit vor den Fallstricken des Widersachers! Satan ist schlau und raffiniert genug, euren genussgierigen geilen Sinnen eine Labsal zuzubereiten, wohlfeil, verführerisch, fütternd - scheinbar besser als die Schrift mit ihren freilich mühseligen Anforderungen. Ich warne euch, ich warne euch! Wer Erbauung sucht für seine Seele in anderem als in dem geheiligten Wort Gottes, der ist den Klauen Luzifers schon bedeutend näher als den Händen Gottes! Wollt ihr es darauf ankommen lassen, die Gnade Gottes zu verwirken?"
„Nein!“, schrie es flehentlich im Chor aus den Bankreihen der Gläubigen, die sich davor ängstigten, dass der Prediger seinen berüchtigten fürchterlichen Schilderungen der Höllenqualen eine erneute grausige Variante hinzufügen könnte.
„Wollt ihr, dass Gott zornig seine Hand von unserer Stadt abzieht?"
„Nein!"
„Dann sorge jeder nach Kräften dafür, dass hier nicht Sodom und Gomorrha einzieht wie ringsum draußen im Land, sondern der Friede Gottes erhalten bleibt. Wehe den Versuchern! Wehe den Verführern und Aufwieglern!"
Nach kalten Januartagen wehte es frühlingshaft lau von den Bergen. Den Sonntag hatte Friedrich zu Hause verbracht; nun befand er sich auf dem Weg zurück nach Elberfeld, ein hoch aufgeschossener Jüngling, der Mutter und Vater längst überragte. Zweieinhalb Jahre waren seit dem Tag vergangen, als er ins Gymnasium aufgenommen worden war. Seine langen Beine trugen ihn rasch über die Chaussee. Er fühlte das Bündel knisternden Papiers an seiner Brust und war in Gedanken schon im Hantschkehaus, wo die Freunde ihn längst erwarteten, zum ersten Tabakskollegium nach den Weihnachtsferien, oben im geräumigen Giebelzimmer der Brüder Gräber. Seine neuesten Gedichte hatte er für den Abend versprochen. Nicht wenig Mühe und manche Zeit hatten sie gekostet. Welch Verhängnis, als poetisches Talent zu gelten im Kreis unersättlicher Freunde, deren Verlangen nach neuen und immer wieder neuen Versen ans fantastische grenzte! Das Verseschmieden á la Heine, Lenau und einem ganz jungen neuen Dichter namens Ferdinand Freiligrath, der wie ein Komet mit neuartigen Rhythmen und kühnen Bildern am Himmel der Poesie aufgetaucht war, war nach dem Verbot des „Jungen Deutschland“ zur Manie geworden, der sich jeder Sekundaner mit geradezu wütender Besessenheit hingab. Mit recht unterschiedlichem Resultat, wie die ersten Dichterlesungen im Dachgeschoss der Gräbers erwiesen, und die Mehrzahl der jungen Poeten erntete gewaltige, unbeabsichtigte Heiterkeitserfolge. Nur ein Vortrag war von andächtiger Stille begleitet, dem ernsthafte Besprechung folgte. Das war der Friedrichs, von Stund ab anerkannter Poet der Schule.
Was ist’s, was mich schrein, was mich weinen macht, was mein Herz zerreißt Nacht um Nacht ...
Ein unerwarteter, überwältigender Erfolg! Wer noch versteckte Vorbehalte hatte unter den Sprösslingen seriöser Geistlicher, hoch dotierter Ärzte, geadelter Regierungsbeamter und Gymnasialprofessoren gegen den jungen Eindringling aus dem verachteten Kaufmannsstand, der akzeptierte ihn von da an als gleichberechtigten Gymnasiasten und vollwertigen Kameraden.
Seit Michaelis trug Friedrich stolz die Primanerkokarde an der Schülermütze. Schon drehten sich die Gespräche um das bevorstehende Abitur, zukünftige Studienfächer und Universitäten. Offiziell war das Rauchen erlaubt, und zum Tabakkollegium hatte le fameux Clausen seine Teilnahme zugesagt! Schon ein Grund, zu zittern und zu zagen vor dem großen Auftritt, mit dem Schicksal zu hadern, das einen in die Rolle des Haus- und Hofpoeten gedrängt hatte. Vielleicht hätte ich doch statt der Verse meinen ersten Prosaversuch, das Fragment einer Korsarenerzählung, mitnehmen sollen, überlegte Friedrich? Aber er schob diesen Einfall gleich wieder beiseite. Welch kindisches Unterfangen, sich an eine Geschichte aus dem griechischen Befreiungskampf heranzuwagen! Das mittelländische Meer, die Inselwelt der Ägäis, Freischärler, Hochseeschiffe, Seeleute - als er begann, glaubte er sich dort wie zu Hause zu fühlen. Beim Schreiben aber merkte er, dass er so gut wie gar nichts wusste über diese Welt. Nicht einmal ein Stück Nordsee hatte er bis jetzt zu sehen bekommen ...
Als er, mit diesen Gedanken beschäftigt, die ersten Häuser Elberfelds erreichte, lagen die Straßen schon in abendlicher Ruhe. So eintönig und hässlich ihm die Stadt als Kind erschienen war, mittlerweile hatte er ihre graue Prosa liebengelernt. Die drei glücklichen Jahre in ihren Mauern waren wie im Flug dahingegangen. In lebendiger Erinnerung war noch der Tag, als er an Vaters Seite zum ersten Mal das stille Haus Papa Hantschkes betrat, das inzwischen längst zu seinem zweiten Daheim geworden war. Jeder Winkel war ihm vertraut, sommers der Platz am Steintisch unter der Linde, an frostigen Winterabenden die Bank neben dem Butzenofen in der Diele, die herben Landschaften und schlichten Porträts der flämischen Schule an den Wänden, die alten Bücher in den Regalen, seine eigene, abgeschiedene Kammer im Hintergeschoss, wo eine neue kleine Bibliothek herrliche Schätze der Weltliteratur enthielt, den Homer und den Äschylus, Ovid und Horaz, Dante, Petrarca, Villon, Shakespeare, Moliere, Lessing, Byron und Shelley. Hier glätteten sich die Wogen innerer Zweifel, die ihn seit Mesolongion bedrängt hatten. Hier erhielten die Bilder menschlicher Erbärmlichkeit, die er zu sehen bekam in jungen Jahren, Fabrikkinder, demütige Pietisten, Karrenbinder, Kettensträflinge, neue Konturen. In den Gefilden des Geistes, der Literatur, der Kunst erstrahlte das Menschliche in besserer Gestalt! Unablässiges Streben nach Erkenntnis, Wahrheit, geistiger Vollkommenheit - dafür lohnt es zu leben! Eher soll über mir der Himmel einstürzen, als dass ich je diese lichte Welt wieder verlasse, um in die Fußstapfen Vaters zu treten, der dabei ist, in schnöden Gewinn- und Verlustrechnungen seiner weitverzweigten Unternehmungen, Spekulationen, Beteiligungen zu ersticken ...
Plötzlich wurde Friedrich aus seinen Gedanken gerissen. Am Ende der Straße war ein Mann im Pietistenmantel dabei, ein weiß leuchtendes Plakat von der Anschlagtafel zu reißen. Der Mann lief geduckt davon, als Friedrich seine Schritte beschleunigte. Halb zerrissen flatterten die Papierfetzen im Wind. Als Friedrich sie zusammensetzte, las er die Ankündigung des Sinfoniekonzertes im Saal des Museums. Das berühmte Gürzenich-Orchester sollte hierherkommen! Den Namen Beethoven las er, die Sinfonie „Eroika“ als Höhepunkt. Ein Traum, den er bis jetzt nur aus einem dürftigen Klavierauszug kennengelernt hatte! Sein Herz jubelte. Diese Neuigkeit wird die Stimmung im Tabakskollegium gewaltig erhöhen!
Der Teufel soll den Schurken holen, der den Namen Beethoven von der Anschlagtafel reißt!
Er ging rasch die Straße weiter zur nächsten Anschlagtafel. Auch hier war das Plakat heruntergerissen. Nur noch Reste klebten. Seine Empörung wuchs. Da hörte er von einer Nebenstraße her den Schreckensruf eines Mannes: „Hilfe, zu Hilfe!“ Der Schrei wurde erstickt. „Der Satan schickt dich!“, brüllte eine zweite Stimme. Friedrich jagte erregt in die Richtung. Weitere Männerstimmen unterschied er, krachende Schläge, Zersplittern von Holz. Atemlos erreichte Friedrich die Nebenstraße. Das Licht einer Fackel flackerte dort. Auf eine gespenstige Szene blickte er. Zwei Männer in langen schwarzen Mänteln, die Kapuzen bis ins Gesicht gezogen, hielten den Plakatkleber fest, einen alten Mann, den Friedrich zuweilen bei seiner Arbeit gesehen hatte. Sein Karren war umgekippt, die Leiter zerbrochen. Die Gestalten waren dabei, das Zerstörungswerk zu vollenden. Der Mann mit der Fackel gab das Kommando. Geruch von Petroleum schlug Friedrich ins Gesicht. Ohne Besinnung stürzte er sich auf einen der Männer. Beim ersten Anprall gelang es, den alten Mann freizubekommen. Zetermordio schreiend, rannte der Befreite davon. Friedrich sah noch, wie die brennende Fackel auf den Karren flog. Eine Stichflamme loderte auf. Dann trafen ihn Faustschläge ins Gesicht, in die Magengrube. Hände umklammerten seinen Hals. Er stürzte zu Boden. Sein Kopf schlug aufs Pflaster. Fußtritte trafen ihn. „Weg“, hört er eine Stimme. Schritte entfernten sich hastig.
Einige Sekunden blieb Friedrich reglos liegen, hörte, wie sich Fenster und Türen öffneten. Mühsam richtete er sich auf und wischte sich das Blut aus dem Gesicht. Die Gasse war hell erleuchtet von dem Feuer. Leute kamen auf ihn zu. Eine Frau im Morgenmantel mit einer Nachthaube beugte sich über ihn. Ein Mann angelte seine Schülermütze aus der Gosse. „Ein Primaner vom Gymnasium!“, rief er aus. „Ist das der Brandstifter?“, fragte jemand.
„Um Himmels willen“, protestierte die Frau, die seinen Kopf stützte. „Er wollte dem Plakatkleber helfen.“ Friedrich erhob sich. „Die Schurken können nicht weit sein!“, sagte er. Eine Frau schlug die Hände zusammen. „Mein Gott, der junge Engels aus Barmen!“
„Pietisten waren es, Männer in langen schwarzen Mänteln!“, erklärte Friedrich den Leuten, die betreten, achselzuckend dastanden. Die Frau mit der Nachthaube nahm seinen Arm. Friedrich presste sein Taschentuch gegen die Stirn. In schweigende verschüchterte Gesichter sah er. „Danke“, sagte er. „Es geht schon!“ Grußlos lief er davon.
An der Ecke hob er eines der Plakate auf, die überall verstreut herumflatterten, faltete es zusammen. Seine Stirn hatte aufgehört zu bluten. Auf dem Weg zum Hantschkehaus dachte er über das Geschehnis nach. Das breite Gesicht Krummachers tauchte in seinen Vorstellungen auf, die heruntergezogenen Mundwinkel, der düster flackernde Blick ... Er will das Konzert verhindern, mit allen Mitteln. Angst vor Beethoven hat der Calvinistenpapst. Der beschränkte Seelenverkäufer zittert vor der Macht des Genies! Ein heftiges Lachen schüttelte ihn. Das wilde, kämpferische Grundmotiv des ersten Satzes, ein Lieblingsstück Mamas auf dem Klavier, in das Onkel August zuweilen seine Zaubergeige feurig hineingemischt hatte, kam ihm in den Sinn. Pfeifend stieg er die Treppe zum Boden hinauf, wo die Freunde ihn erschreckt empfingen. Willig ließ er sich von Frau Hantschke die Stirnwunde behandeln, während die neugierigen Kameraden seine Geschichte anhörten. „Das Konzert muss stattfinden“, schloss er. „Die Musik Beethovens soll Herrn Krummacher um die Ohren schmettern und seine Pietistenseelen aus ihrer Selbstgerechtigkeit aufrütteln. Wir werden die ganze Stadt mit neuen Plakaten zukleben!“
Der junge Direktor Potthof war schnell gewonnen. Er brachte neue Plakate. Gleich am nächsten Tag begannen die Vorbereitungen. In Frau Hantschkes Waschkessel wurde Kleister gerührt, Töpfe und Eimer damit gefüllt, Bürsten und Pinsel beschafft. Das halbe Gymnasium war aufgeboten. Die Aktion fand in einer sternenlosen Nacht statt. In zwei Stunden waren Hunderte der Plakate geklebt. Keine Hauswand, keine Gartenmauer, kaum eine der dicken Buchen wurde verschont, und am Morgen, drei Tage vor dem Konzert, konnte kein Elberfelder Bürger mehr als zwanzig Schritte durch die Straßen tun, ohne auf ein Plakat mit der Ankündigung des Beethovenkonzerts zu stoßen. In wenigen Stunden waren die Karten bis auf den letzten Platz ausverkauft.
Am Abend des Konzerts erstrahlte das Museum im Lichterglanz von tausend Kerzen. Friedrich stand mit den Primanern am Eingang, verteilte Freibilletts an die Gymnasiasten, die sich an der nächtlichen Plakataktion beteiligt hatten, und beobachtete den Ansturm der Besucher. Die halbe Stadt, alles, was nicht zur Krummachergemeinde gehörte, war auf den Beinen. Vergeblich bemühten sich Hunderte von Leuten, noch Karten zu ergattern. Aber auch genug renommierte Pietisten wollten sich das Ereignis nicht entgehen lassen. Amüsiert registrierten die Gymnasiasten Damen, die ihre Gesichter hinter dichten Schleiern verbargen, Herren, die die Köpfe tief in ihre Schals einzogen, um nicht erkannt zu werden.
Da wurde Friedrichs Aufmerksamkeit auf die Einlasstür gelenkt. Der Kontrolleur hatte einen schmächtigen Jungen erwischt, der sich ohne Karte einschmuggeln wollte. Er mochte zwei Jahre jünger als Friedrich sein und der Kleidung nach ein Kaufmannslehrling. Vor ihm stand neben dem Kontrolleur ein strammer Hüter des Gesetzes in Galauniform, säbelklirrend und mit drohender Amtsmiene. Friedrich sah, wie der Junge ängstlich verlegen in seinen Taschen kramte. Er empfing einen Hilfe suchenden Blick aus zwei großen melancholischen Augen. Rasch trat Friedrich zum Kontrolleur. Noch bevor der Gendarm sich einmischen konnte, hielt er dem Saaldiener eine Freikarte unter die Nase. „Das ist seine Karte.“ Der Mann blickte zuerst verdutzt auf.
„Etwas nicht in Ordnung?“, fragte Friedrich ungnädig, von oben herab.
Der Kontrolleur verbeugte sich devot. „Doch, doch. Alles in Ordnung, junger Herr!“ Der Polizeiwachtmeister verschwand. Der Kaufmannslehrling durfte verdattert, hochrot vor Glück, passieren. Das Klingelzeichen ertönte. Es war auch für Friedrich Zeit, seinen Platz einzunehmen. Wenige Augenblicke später versank die Alltagswelt um ihn. Die Musik packte ihn und wühlte sein Innerstes auf.
Wer noch nie eine Beethovensinfonie gehört mit vollem Orchester, wer sich bisher kümmerlich zu begnügen hatte mit dürftigen Klavierfassungen, der behaupte nicht, auch nur einen Schimmer von der Ausdruckskraft der größten Musik des Jahrhunderts zu besitzen!
Was Friedrich als Kind nur geahnt im Atem der aufblühenden Natur, im Anschaun der weißen Wolken im hohen Blau, im Hinstaunen zur Unendlichkeit der Sternenwelt am Nachthimmel, was er später empfunden im schweigenden Tannenwald, beim Entdecken der Faustdichtung, hier wurde es zum Erlebnis: Der stürmische Drang, sich loszureißen aus den dumpfigen Niederungen der Alltagserbärmlichkeit, um dem Vollkommenen zuzustreben, das, nur das war die Bestimmung, die Gott den Menschen zugewiesen hatte! Nein, es war nicht fromm, demütig das Haupt in den Staub zu drücken, es war niedrig und feige. Du bist ein Mensch, Krone der Schöpfung, Herr deiner Gefühle, deiner Gedanken, deines Willens. Und wenn dich das Leid niederdrücken will, wenn du zu ersticken drohst im Morast - erhebe dein Haupt, steh auf und kämpfe!
Friedrich flüchtete vor dem Beifallstoben im Saal, vor den Freunden, die Potthof zur Siegesfeier eingeladen hatte. Allein wollte er sein. Aber draußen wurde er von dem Kaufmannslehrling aufgehalten. Der Junge drückte seine Hand, suchte nach Dankesworten. Friedrich sah die Ergriffenheit in den großen dunkeln Augen. „Komm mit!“, forderte er den Unbekannten auf. Mit langen Schritten stürmte er voran, durch die engen Gassen der Stadt, hinaus in die Berge. Erst auf der Höhe des Ullenbergs blieb er stehen. Auf die dunkle Welt konnte man von hier oben hinabsehen, in den Himmel, wo die letzten Gewitterwolken trieben. Die Wipfel der gewaltigen Kiefern, die hier nur noch vereinzelt standen, bogen sich im Wind, der sie umrauschte.
Noch kein Wort hatte Friedrich mit seinem Begleiter gewechselt. Jetzt brach er das Schweigen. „Ich habe noch nie eine Sinfonie von Beethoven mit vollem Orchester gehört. Aber nun weiß ich es: Wenn es Gott überhaupt für nötig hält, zu den Menschen zu sprechen, dann nicht durch das Salbadergewäsch der Pfaffen! Sondern durch diese Musik. Und ich weiß nun auch, warum die Mucker ein Gesicht schneiden, wenn der Name Beethoven fällt! Mein Vater will, dass ich in seine Fußstapfen trete. Ein Leben zwischen Schacher, Gebeten und plüschverbrämter Familienidylle - wie widerwärtig, ekelhaft, tötend angesichts der gewaltigen Kraft solcher Musik!“ Er fügte leise hinzu: „Schande, ewige Schande über den, der einmal, auch nur ein einziges Mal in seinem Leben diese Botschaft in sich vernommen hat und danach feige zurückkehren kann in die erbärmliche Welt der Philister!“
Der Kaufmannslehrling blickte ihn unsicher an, erstaunt, wie es schien, Zeuge der geheimsten Gedanken eines Fremden zu werden.
Am Himmel tauchte die Mondsichel hinter einem Wolkenfetzen auf. Unerwartet begann der Begleiter zu sprechen.
Friedrich horchte auf. Der Junge hatte eine weiche schöne Stimme. Was er sprach, waren Verse. Wundersame Verse, die Friedrich noch nie gehört hatte.
Eroika! Weithin eröffnet sich der Blick! Unendlichkeit, vor der das Herz erschauert. Und neu und frei kehrn wir zur Welt zurück! Genug geweint, gehadert und getrauert! Ein Stern fiel in die dumpfe Nacht. Das ewig Werdende! In uns ist es erwacht!
„Wo hast du diese Verse her?“, fragte Friedrich.
Verlegen senkte der Junge den Kopf. „Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Sie fielen mir so ein. Im Konzert, auf dem Weg hierher, als Sie sprachen, ich weiß es nicht genau.“ Friedrich stand eine Sekunde wie erstarrt. Dann packte er den erschreckten Burschen bei den Schultern, schüttelte ihn und jubelte: „Zum Teufel, Kerl, in dir steckt ein Dichter!“
„Ein Dichter?“
„Ja, ein Dichter!“, rief Friedrich. Er nahm die Hand des Jungen. „Wie heißt du?“
„Weerth, Georg. Aus Detmold.“
„Habt ihr da ein Zaubermittel? Erst ein Grabbe, dann Freiligrath und jetzt noch ein Weerth!“
Der Junge wollte etwas entgegnen, aber Friedrich ließ ihm keine Zeit. „Komm!“, forderte er ihn stürmisch auf und rannte den Abhang hinunter zur Stadt. „Ich habe auch Verse geschrieben“, stieß er im Laufen hervor. „Stümpereien zwar. Wirkliche Stümpereien. Aber diese Nacht darf nicht vergehen, ohne dass du sie kennengelernt hast.“
Es war so viel Lebensfreude in ihm erwacht, Beethoven und ein symphatischer Junge, in dem ein dichterisches Talent schlummerte, einer, der ihn vielleicht verstehen würde, besser als die Pfarrers- und Beamtensöhnchen, die allzu nüchtern und bedächtig waren im Denken. Hochgestimmt führte er den neuen Bekannten in die Schwanenstraße. Da prallte er plötzlich zurück. Was war das? Vor dem Hantschkehaus stand das Kabriolett des Vaters ...
„Warte, warte hier! Mein alter Herr ist erschienen. Irgendetwas ist los. Ich ahne, nichts Gutes!“
Während er langsam ins Haus ging, überlegte er, was seinen Vater hierhertrieb. Ein Unglück daheim? Er erschrak. Aber nein, dann hätte man jemand anderes geschickt ...
Auf der Diele brannte Licht. Er klopfte. Frau Hantschke öffnete ihm die Tür, hilfloses Bedauern im Gesicht. Papa Hantschke saß auf der Ofenbank, niedergeschlagen und schuldbewusst. Am Kamin sah er seine beiden Koffer, gepackt. Mitten im Raum stand Vater. Friedrich fuhr zusammen. Ein einziges Strafgericht war Vaters Gesicht. Verdammung blitzte ihn aus zornigen Augen an. Kein Wort der Begrüßung, keins der Erklärung.
„Die Rechnung lassen Sie mir bitte zukommen“, kam es jetzt unfreundlich, fast feindselig aus Vaters Strichmund, „und ebenso auch das Abgangszeugnis meines Sohnes.“ Papa Hantschke antwortete bloß mit einem müden Nicken.
Vater wandte sich nun an seinen Sohn: „Verabschiede dich bei Madame und Monsieur Doktor Hantschke und nimm deine Koffer!“
Friedrich rührte sich nicht. „Kannst du mir nicht sagen, was das alles bedeutet?“
„Dafür wird noch genug Zeit sein!“, sagte Vater kurz und reichte Dr. Hantschke, der sich erhoben hatte, die Hand. „Verzeihen Sie nochmals die späte Störung, und nehmen Sie meinen Dank bitte entgegen. Ich möchte es Ihnen glauben, dass Sie das Beste gewollt haben. Auf Ihre Art. Aber es ist mein Sohn. Vor dem Herrn trage ich die Verantwortung. Sie werden das verstehen.“ Damit ging er an Friedrich vorbei zum Flur.
„Mein Gott“, rief Friedrich, „darf ich denn nicht wenigstens erfahren, was geschehen ist?“
„Folge deinem Vater, Friedrich“, bat Papa Hantschke. „Bitte! Er hat Gründe, dich von der Schule zu nehmen. Wir lassen dich ungern ziehen. Du sollst wissen, dass du uns ans Herz gewachsen bist, ein guter Schüler, ein gern gesehener Hausgenosse.“
„Und ein lieber, lieber Junge“, fügte jetzt Frau Hantschke mit Tränen in den Augen hinzu. Ihre Arme schlangen sich um seinen Hals. Sie küsste ihn unter Schluchzen.
„Beeil dich!“, befahl Vaters Stimme. „Die Nacht ist bald zu Ende.“ Papa Hantschke gab ihm die Koffer in die Hand. „Alles Gute und viel, viel Glück!“
Benommen ging Friedrich mit den Koffern hinaus. Dort wartete sein neuer Freund mit fragend aufgerissenen Augen. Nur einen traurigen, ratlosen Blick konnte Friedrich ihm zuwerfen. Dann war schon das Kabriolett erreicht.
Tausend wirre Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Alles, was er getrieben hatte in den letzten Wochen, rekapitulierte er. Aber er fand keine Erklärung für diese Katastrophe. Da, als die letzten Häuser der Stadt hinter ihnen lagen, brach sein Vater endlich das Schweigen. Mit einer Stimme voll Sarkasmus und Erbitterung begann er: „Ihr haltet uns wohl für ehrliche Kaufleute? Nein, das sind wir nicht! Sehet unser Geschütz, offen und verborgen, unsere Munition, unsere Waffenkammer an, und Ihr werdet leicht feststellen, dass wir solches elendes Krämerhandwerk nur zum Schein treiben ...“
„Vater ...“ Friedrich versuchte sich Gehör zu verschaffen. Schon nach dem ersten Satz wusste er, dass aus dem Text seiner Korsarengeschichte zitiert wurde. Mit einem Schlag waren ihm alle Zusammenhänge klar. Man hatte in seinem Zimmer das unbedeutende Manuskript seines Prosaversuchs aufgestöbert ... Warum hab ich es bloß nicht besser versteckt!
Vater hob seine Stimme noch und zitierte weiter. Jedes Wort der Erzählung schien er auswendig zu kennen. Und jedes Wort war Anklage, heilige Empörung. „Wir sind andre, bessere Leute, echte Hellenen, Menschen, die die Freiheit zu schätzen wissen - Korsaren ...“ Vater brach ab. „Reicht es dir, oder soll ich noch weiter zitieren? Vielleicht noch den Schulaufsatz über jenen Heine, Sohn einer ehrbaren Kaufmannsfamilie, der jetzt in Paris ein Lotterleben führt und sich für frivole Beschmutzung seines Vaterlandes bezahlen lässt?“
„Heine! Ein Dichter ist er und weltberühmt. Dass er in Paris leben muss ...“
„Und so einer willst du auch werden. Dafür habe ich dich auf das Gymnasium geschickt!“
Friedrich schwieg. Es war sinnlos, dem Vater klarzumachen, wie wenig ernst es ihm selbst mit seinen dichterischen Versuchen sei, dass er wegen seiner Liebhaberei nicht vom Weg der Wissenschaft abweichen werde.
„Geahnt hab ich es, geahnt!“, schimpfte Vater weiter. „Es konnte nicht gut gehen. Mit einem Lutheraner als Direktor, Freigeistern unter den Lehrern! Das beste Gymnasium in Preußen! Der Teufel muss mich geritten haben, auf deinen Großvater zu hören!“
„Aber wo mach ich jetzt mein Abitur?“, fragte Friedrich.
In noch größere Wut versetzte dieses Stichwort Vater. „Abitur, dichten, studieren - nur nicht ins verächtliche Krämerhandwerk wie der Vater! Damit ist Schluss, endgültig Schluss! Morgen beginnt deine Kaufmannslehre bei Engels und Söhne. Auf dem Kontorbock werden dir deine Flausen vergehen, das schwöre ich dir!“
Vater ließ die Peitsche knallen. Das Pferd beschleunigte seinen Gang. Verbissen blickte der Kaufmann geradeaus. Und Friedrich begriff, dass es aus war, endgültig vorbei mit allen Hoffnungen, mit allen hochfliegenden Plänen. Lieber Gott, alle Gedanken lehnten sich gegen das Unfassbare auf, wenn es dich gibt, irgendwo, dann tu etwas! Sende einen Blitzstrahl, einen Wirbelsturm. Was habe ich verbrochen, dass du meine Zukunft, mein Leben zerstören lässt mit brutaler Hand?
Der Vollmond warf ein fahles Licht auf die Landstraße. Die Lichter in der „Bierkirche“ kamen in Sicht, das Haus des Lampenmachers, die Turmspitze der Christuskirche. Noch einmal klangen die Trompetenstöße des siegreichen Eroikamotivs in ihm auf. Aber ganz plötzlich erstickte das Motiv. Dumpfe Ödheit, erdrückende Leere breiteten sich aus. Himmel! Warum zeigst du mir erst das Licht, um mich dann zurückzuschleudern in die tiefste Finsternis?
Da vernahm er von hinten Pferdegetrappel. Der Strahl zweier Blendlaternen kam heran. Rasch näherte sich die sechsspännige preußische Eilpost Düsseldorf - Halle. Vater lenkte das Kabriolett zum Straßenrand. Opas Gesicht tauchte in Friedrichs Gedanken auf, eine letzte Hoffnung, der Strohhalm, an den sich ein Ertrinkender klammert ... Er sprang auf, mit einem Satz landete er auf der Chaussee. Die Postkutsche war heran. Die Beine jagten los. Eine Hand bekam den Gepäcktender zu fassen. Ein Ruck ging durch den Körper. Die Füße federten im Sprung. Da war er oben, jagte mit der Kutsche nach Osten ... Im Mondlicht tauchte noch einmal Vaters Gestalt auf mit hoch erhobenen Händen. Sekunden später war die Distanz schon zu groß, um noch etwas zu erkennen.
Unbemerkt gelangte er bis Hagen. Vor dem Pferdewechsel am Stadtrand sprang er ab und versteckte sich im Dickicht. Ein Rollkutscher brachte ihn bis Hamm. Nachts kam er an.
In Opas Häuschen brannte noch Licht. Am Gartentor zitterten Friedrich die Knie. Über ein Jahr hatte er den Großvater, der kränkelte und kaum noch das Haus verließ, nicht gesehen. Zweifel am Sinn dieser kopflosen Fahrt hierher kamen ihm. Wie könnte Opa ihm helfen? Unsicher fasste seine Hand nach dem Klingelzug.
Erschrecken erst auf Omas Gesicht, das sehr alt geworden war seit dem vorletzten Sommer, dann Freude, schließlich Erblassen und Tränen.
„Mein Junge, mein lieber Junge. Dass du kommst, dass sie dich geschickt haben ... Wie wird er sich freuen, dein armer, armer Opa.“
„Geht es ihm nicht gut?“
Großmutter schluchzte auf. „Ach, mein lieber Junge, mein lieber Junge! Bald, bald wird es ihm gut gehen.“
Friedrich erschrak. Kein Wort brachte er heraus. Seine Kehle war wie zugeschnürt. Er folgte Oma ins Haus.
Auf dem Sofa in der Bibliothek lag Opa. Ein klein gewordenes blasses Gesicht im weißen Kissen. Er hörte Omas Stimme nicht, die die Ankunft des Enkels ankündigte. In weite Ferne schien Opa schon gerückt, weg von den Seinen, weg von der Erde. Erst als Friedrich sich über ihn beugte, kehrten seine Gedanken zurück, ein Leuchten ging über sein Gesicht. „Bist du es, mein Fritz, bist du es wirklich?“
Friedrich nahm die bleiche Hand, drückte sie.
„Schön, dass ich dich noch einmal sehe. Wie groß du geworden bist, groß und stark!“
Alle Lebensgeister kehrten noch einmal zu dem Sterbenden zurück. Er ließ sich von den Fortschritten an der Schule erzählen. Bei einem Besuch in Hamm hatte Dr. Hantschke höchstes Lob über den Enkel geäußert. Friedrich wollte ihm nichts sagen von dem Vorfall der vergangenen Nacht. Aber seine Verstellungskünste reichten nicht aus, um den Kranken zu täuschen. Schließlich gestand er ihm, was geschehen war. Die eingesunkenen Augen sahen ihn lange an. „Mein armer Junge“, flüsterte die matt gewordene Stimme, „mein armer Junge.“ Opas Augen schlossen sich.
Schreckensbleich stürzte Friedrich aus dem Zimmer. Oma eilte mit dem Arzt herbei. „Er schläft“, stellte der Arzt fest. „Es ist noch nicht das Ende.“ Zu dem hoffnungsvollen fragenden Blick Omas zuckte er mit den Schultern. „Manchmal gibt es Wunder.“
Friedrich blieb neben Oma im Zimmer sitzen. Eine Stunde hielt er sich wach. Dann übermannte ihn ein unruhiger Schlaf. Im Morgengrauen rüttelte ihn Omas Hand wach. Ihr Gesicht sagte ihm, dass alle Hoffnung vergeblich war. „Er möchte dir noch etwas sagen“, stammelte Oma.
Friedrich neigte sein Ohr an den Mund des Sterbenden.
„Mach deiner Mutter nicht noch mehr Kummer und füg dich deinem Vater! Ich weiß, wie sehr sie dich lieben, ihren Ältesten, ihren ganzen Stolz. Versprich mir das!“
„Ja, Opa“, Friedrich nickte, „ja!“
„Meine Welt - Suche im Vergangenen, Flucht ins Geistige, Traumbilder und Schatten ...“ Er schüttelte den Kopf. „Über das Lebendige können sie nicht hinwegtäuschen. Mein Leben...“ Er brach ab. Ein qualvoller Seufzer entrang sich seiner Brust. „Deinen eigenen Weg musst du suchen ..., deinen eigenen, mein Fritz!“ Der Kopf richtete sich plötzlich auf. Unruhe flackerte in seinen Augen. Abgerissen kamen die Worte jetzt: „Schau auf die Erde ... und ... fürchte ... dich ... nicht!“ Der Kopf sank zurück. Eine Bewegung machte die weiße Hand noch zu Friedrich hin, dann glättete sich plötzlich das Gesicht zu einem sanften Lächeln. Die Augen erstarrten. Es ist das Ende, das Ende. Friedrich warf sich über den Großvater und weinte.
Omas Hände zogen ihn sanft fort. Leise ging er aus dem Zimmer, durch die Küche zum Garten. Die Morgenluft fächelte kühlend das Gesicht. Grell ist das Licht, das Vogelgezwitscher, das Öffnen und Schließen einer Tür in einem der Nachbarhäuser ... In einer fremden Welt steht er, allein, verlassen. Die Einsamkeit droht ihn zu ersticken. Warum gibst du uns das Leben, um es wieder zu nehmen mit grausamer Hand, warum, Herrgott, warum?
Die Griesheims trafen ein und Onkel Ludwig mit den Kindern, die Leben ins Haus brachten, lärmende Gleichgültigkeit, die schmerzte und zugleich beruhigte, das Entsetzliche einordnete in den natürlichen Lauf der Dinge.
Die Eltern kamen erst anderen Tags aus Barmen an, Mama ein verstörtes, hilfloses Bündel an Vaters Arm, Vater mit stummem Vorwurf im Blick. Oma sagte: „Es war eine Fügung, dass er Friedrich noch einmal sehen konnte. Es war seine letzte Freude.“ Erst nach der festlich-prunkvollen Beerdigung richtete Vater das Wort an ihn. Kein Wort des Vorwurfs über seine Flucht. Stattdessen die großzügige Erlaubnis, das Schuljahr am Gymnasium beenden zu dürfen. Ein winziger Hoffnungsfunke glomm in Friedrich auf, verlosch jedoch rasch wieder. Als er in das entschlossene Gesicht seines Vaters sah, da wusste er: Es war nur ein Aufschub. Kein Abitur, keine leuchtende Zukunft im Reich der Wissenschaft. Am 15. September ging es unerbittlich ins Joch der Kaufmannslehre.
Zweites Kapitel: Audienz bei einem Dichter
Als am 20. Juni 1837 Wilhelm I., König von Großbritannien, König von Irland und König von Hannover, ohne legitime Kinder starb und die englische Krone auf seine Nichte, die achtzehnjährige Viktoria, überging, war es vorbei mit der hundertzwanzigjährigen englisch-hannoveranischen Personalunion. Nach deutschem Erbfolgerecht konnte nur ein männlicher Erbe die Krone übernehmen. Der glückliche Gewinner dieser Vorschrift wurde Wilhelms jüngerer Bruder Ernst August, Herzog von Cumberland. Nunmehr souveräner Herrscher über ein Königreich, hoffte er, sich endlich von dem riesigen Schuldenberg, der sich bei seinem ausschweifenden Bonvivantleben angehäuft hatte, befreien zu können. Seine neuen Untertanen empfingen ihren ersten eigenständigen König mit gebührendem Respekt, sodass dem neu gebackenen Monarchen rührselig-väterlich zumute wurde. Doch seine erste Amtshandlung, der lang ersehnte habgierige Griff in die Staatskasse, stieß unerwartet auf Hindernisse. Die Minister machten ihn schonend darauf aufmerksam, dass in Budgetfragen ohne Bewilligung durch die Ständeversammlung nichts zu machen sei. Diese Eröffnung echauffierte den Lebegreis über alle Maßen. Er erfuhr, dass sich Bruder Wilhelm selig in unglaublicher Kurzsichtigkeit während der Zeit der Unruhen, die der Julirevolution gefolgt waren, von den deutschen Hinterwäldlern eine Verfassung mit einer so idiotischen Klausel hatte abringen lassen. Die Stände verweigerten die Auslösung ihres erlauchten Herrn von der Meute seiner Gläubiger. Das königliche Blut kochte. Er jagte die Ständeversammlung nach Hause. Den ersten Sommer erholte er sich grollend in Karlsbad und Baden-Baden. Bei seinen deutschen Kollegen, die bei aller Armut ihrer Länder ein ausschweifendes, fideles Kurleben entfalteten, holte er sich Rat, wie man mit deutschen Untertanen zu verfahren habe. Als „gottbegnadeter" legitimer Monarch kehrte er zurück, erklärte die Verfassung für abgeschafft und entband die Beamten ihres Treueides auf das Grundgesetz. Mit den mündlichen Versicherungen ihrer Königstreue gab er sich nicht zufrieden. Bei seinen Kreditaufnahmen in der britischen Geschäftswelt hatte er den fatalen Wert unterschriftlicher Quittungen kennengelernt. So ließ er eine untertänigste Huldigungsadresse auf seine erlauchte Person erdichten und legte sie den Staatsdienern zur Unterzeichnung vor. Die Beamten zierten sich nicht. „Wir unterschreiben alles", erklärte ein Zyniker unter den Ministern, „Hunde sind wir ja doch!“ Das Volk staunte, aber rührte sich nicht. „Auch die Advokaten müssen unterschreiben!“, drängelte der Alte eigensinnig. Oft genug hatte diese widerliche Gattung Mensch ihn aufs Kreuz gelegt, wenn er Schuldverschreibungen nicht anerkennen wollte. Sodann fiel ihm ein, dass es da noch die königliche Universität in Göttingen gab. „Auch diese teachers meiner Highschool!“, forderte er. Und auch die Mehrheit der würdigen Professoren quittierte.
Sieben unter ihnen aber verweigerten die Unterschrift, erklärten ihre Verfassungstreue und protestierten gegen den Willkürakt, sieben aufrechte Wissenschaftler, Männer mit Rang und Namen, der berühmte Staatsrechtler Friedrich Christoph Dahlmann, die Gebrüder Jakob und Wilhelm Grimm, der weltbekannte Physiker Wilhelm Weber, der begabte Geschichtsschreiber Georg Gottfried Gervinus, der Jurist Wilhelm Eduard Albrecht und der Orientalist Georg Ewald.
Im Kontor auf dem Lehrlingsbock hockte Friedrich schweigsam und unbewegt. Teilnahmslos malten seine Hände Zahlenreihen und Worte aufs Papier, Offerten, deren Sinn ihn nichts anging. Im grauen Einerlei spulten sich die Bürostunden ab. Die Gespräche im Hintergrund, die schalen billigen Späße des Kommis mit den Besuchern, die kleinen, hinter seinem Rücken betriebenen Gaunereien, die mitfühlende Art des schattenhaft-schmächtigen Buchhalters Dürholt, mit der dieser ihm Aufträge erteilte - was interessierte es ihn?
Eines Nachmittags erschien Bracke, der feiste ehemalige Expedient, der inzwischen zum Handelsreisenden der Firma avanciert war, im Kontor. Mit lauten Redewendungen in schlechtestem Französisch protzte er hinter vorgehaltener Hand mit schlüpfrigen Abenteuern seiner Pariser Nächte.
Friedrich blieb angewidert über seinen Tisch gebeugt und beendete die Kopie einer Auftragsbestätigung. An Vater Rostand musste er denken. Wie alt mochte er sein, wenn er noch lebte? Ach, die alte Mühle steht nicht mehr, und die unendlichen Tage kindlicher Zuversicht sind dahin.
Mechanisch begannen seine Hände zu zeichnen. Ein Beethovenporträt. Ein Vogel im Käfig. Eine gebrochene Rose, die am Boden verwelkt. Dann: eine Karikatur Dürholts.
Der Buchhalter saß ihm schräg gegenüber in der anderen Ecke des Kontorraums, zusammengekrümmt, mit rot glühenden Backen und fliegenden Händen. Ein Bild eifernden Fleißes, ein armseliger Wurm, der sich im Dienst an der Firma verzehrte.
Plötzlich hämmerte eine hämische Lachsalve Brackes an Friedrichs Ohr. Brackes dicke Hand zog das Blatt vom Tisch. „A la bonheur“, schrie er. „Hervorragend getroffen!“ Er hob das Blatt hoch. „Ist er nicht köstlich porträtiert, unser altes Inventar Dürholt? Dünn, und krumm wie ein Regenwurm!“
Die Kontorbesatzung lachte schallend. Friedrich riss wütend Bracke das Blatt aus der Hand, zerknüllte es.
Er ging zum Pult Dürholts, der blass in sich zusammengekrochen war. „Entschuldigen Sie!“
Der Alte erwiderte nichts. Nur einen entgeisterten, verstörten Blick warf er auf Friedrich. Die Kontorbesatzung schwieg.
„Warum gleich so heftig, Junior“, lenkte Bracke ein. „Es war doch nur ein Scherz.“
Schulterzuckend ging Friedrich zu seinem Platz zurück. Er hatte das Gefühl, ersticken zu müssen.
Bracke trat anbiedernd zu ihm. „Da Sie sich für Zeichnungen interessieren, Junior, kann ich Ihnen die neueste Kollektion der Serie ,Nocturnes de l’amour’ ablassen!“ Er breitete ein paar Postkartenbilder mit pornografischen Abbildungen auf dem Pult aus.
Angeekelt schob Friedrich die Bilder zurück. „Merken Sie nicht, dass Sie mir auf die Nerven gehen, Herr Bracke!“
Bracke strich die Karten wieder ein. „O du heilige Unschuld“, brabbelte er. „Dann eben nicht!“
Spätabends, nach den Kontorstunden, suchte Friedrich die Einsamkeit in den vertrauten Wäldern. So ging er jeder Begegnung mit den Gymnasiasten aus dem Weg, die öfter von Elberfeld herüberkamen, um ihn zum Tabakskollegium einzuladen. Roth, der getreue Freund, war wie er in der Kaufmannslehre gelandet als designierter Nachfolger seines Onkels, der eine Knopffabrik im fernen Plauen betrieb. Die alten Kadetten waren in alle Winde verweht. Auf Kontorböcken saßen die Fabrikantensöhne, in Lehrerseminaren und Gewerbeschulen die Beamtensöhne, schon im Militärdienst standen die Ärmeren.
Manchmal kam er zu Plätzen, wo er an jenen Sommersonntagen mit Agnes gesessen hatte. Wo mochte sie leben? Was war aus ihr geworden? Stärker denn je schmerzte die Erinnerung an sie, wenn bei Tisch daheim, im Kontor, in der Singakademie Anspielungen auf Friedrichs erwachende Männlichkeit und die Beziehungen zum anderen Geschlecht gemacht wurden, wenn in der Christuskirche die jungen Mädchen aufgeputzt mit ihren Reizen kokettierten oder „rein zufällig“ nach dem Sonntagsbraten die flüggen Cousinen und Nachbarstöchter auftauchten, die Lauras, Idas, Julias, Luisas und wie sie alle hießen, um ihn mit schmachtenden Blicken zu verzehren und in irgendwelches inhaltsleeres Gegackel zu verstricken.
Vorsichtig nahm er seine Erkundigungen nach Agnes’ Aufenthaltsort wieder auf. Bei der Mutter stieß er auf ärgerliche Ablehnung. Bei Onkel August erntete er schallendes Gelächter mit eindeutigem Hinweis auf die immense Auswahl unter den Fabrikmädchen. Bei den Frauen und Männern in der Fabrik antwortete man auf alle Fragen nur mit feindseligem, misstrauischem Schweigen.
Eines Sonnabendnachmittags trieb er sich bei der Lohnauszahlung herum. Vielleicht sehe ich jenen Jungen wieder, der mir einmal Auskunft gegeben hat? Vielleicht eine der Frauen, die bei ihrer Mutter ein und aus gingen?
Dürholt besorgte die Auszahlung mit feierlichem Gesicht. Es war noch sommerliches Wetter, die Prozedur fand im Freien vor dem Kontorgebäude statt. Die Mechaniker, Meister und Vorarbeiter hatten schon freitags ihren Lohn im Kontor in Empfang genommen. Jetzt traten zuerst die Färber an, die Aristokraten unter den Fabrikarbeitern. Aufrechten Ganges kamen sie heran, ernst und würdig. Es ging sehr feierlich zu und nahm Zeit in Anspruch. Jedem der Männer mit den gebleichten Händen und den vom Dampf gegerbten Gesichtern wurden die Münzen umständlich vorgezählt. Die meisten konnten schreiben, nur einige der ganz Alten setzten drei Kreuze auf die Liste. Onkel Caspar selbst nahm sich die Zeit, dabeizustehen, mit jedem ein leutseliges Wort zu wechseln, über Gesundheit, Wohlbefinden der Familie, den Garten, die Kinder. Diese Männer antworteten unbefangen, redeten den Onkel mit „Herr Engels“ oder mit „Prinzipal“ an und behielten die Mütze auf dem Kopf. Dann erschienen die Drucker. Die bekamen Tüten, die sie misstrauisch nachrechneten. Auch bei ihnen blieb Onkel Caspar stehen. „Stimmt alles?“, fragte er diesen und jenen, der dann kurz die Mütze lüftete. „Jawohl, Herr.“ Onkel Caspar zog sich nun zurück. Die Kommis brachten große Kästen mit Lohntüten. Aus den Fabriktoren strömten die Weber und Spinner, dicht gefolgt von den vielen Frauen und Mädchen. Abseits warteten die Kinder, deren Lohn den Vätern, Müttern oder älteren Geschwistern mit ausbezahlt wurde. Jetzt traten die Kommis in Aktion, die je einen Kasten übernahmen.
Friedrich sah den Jungen, den er suchte. Aber auch ihn fragte er vergeblich. Wie alle gab er vor, nichts von Agnes zu wissen. Friedrich wollte schon gehen. Da zog etwas seine Aufmerksamkeit auf sich. Im Dachschatten der Expeditionsrampe stand der Oberschlichtmeister und nahm von einer älteren, armselig gekleideten Frau Geld in Empfang, die danach mit gebeugtem Rücken, bedrückt, wie es schien, zum Tor ging. Jetzt hielt der Mann eine zweite Weberin an, die vergeblich versucht hatte, an ihm vorbeizuhuschen. Flehend redete die Frau auf ihn ein. Friedrich ging näher heran. Er sah, dass auch diese Frau dem Oberschlichtmeister Geld aus ihrer Lohntüte gab. Sie weinte. „Womit soll ich meine fünf Mäuler stopfen?“
Friedrich packte den Mann am Arm. „Warum nehmen Sie der Frau Geld ab?“
„Ich, Geld?“
Friedrich riss ihm die Hand auf. Drei Geldstücke rollten zu Boden. Friedrich hob sie auf.
„Was wollen Sie“, stotterte der Mann. „Ich hatte es ihr geliehen.“
Friedrich wandte sich an die Arbeiterin. „Hat er Ihnen das Geld geliehen?“
Die Frau schüttelte den Kopf, mit ängstlich-entgeistertem Blick.
„Warum haben Sie es ihm gegeben?“ Die Frau schwieg. Friedrich zeigte auf die ältere Frau am Tor. „Und ihr dort haben Sie doch auch Geld abgenommen? Auch geborgt?
„Ja doch, ja. Zum Teufel!“
„Der reinste Bankier!“, höhnte Friedrich. Da hörte er die Stimme eines Webers. „Er lügt! Er lässt sich von den Frauen bezahlen, damit sie in Lohn und Brot bleiben können!
Der Oberschlichtmeister wollte sich fluchend davonmachen. Friedrich hielt ihn fest. Die Arbeiter schlossen einen Ring um beide. In der Kontortür erschien Onkel Caspar. „Was ist hier los?“
„Er erpresst Geld von den Frauen. Ich habe ihn ertappt, Onkel. Nimm ihn mit. Er soll seine Taschen leeren.“ Friedrich bat die Leute, vor dem Kontor zu warten und auch die ältere Frau als Zeugin herzuholen.
Im Prinzipalbüro fanden sich bei dem Oberschlichtmeister sechsundachtzig Silbergroschen und ein Berg Heller, mehr als der Mann im ganzen Monat verdiente. Aber er beharrte hartnäckig auf der Behauptung, dieses Geld verborgt gehabt zu haben. Friedrich wusste es besser. „Ich werde es beweisen!', rief er. Er öffnete die Tür zum Kontor. Die Leute warteten hier. Vorne die Weberin, deren Name Hanna Gronneberg war. Auch die alte Frau war gekommen. „Diese werden bezeugen, auf welche niederträchtige Weise dieser Gauner zu dem Geld kommt.“
Was nun geschah, war unfassbar! Keine der Frauen bestätigte seine Anklage. Ja, geborgt, geborgt, geborgt, sagten sie aus. Auch Frau Gronneberg, so dringlich er sie auch mahnte, die Wahrheit zu sagen.
Es war wie in einem bösen Traum.
Da halfen keine Bitten, keine Beschwörungen, kein wütendes Aufbegehren. Die Frauen senkten die Köpfe und schwiegen.
„Genug!“, entschied Onkel Caspar und wandte sich an die Frauen: „Zukünftig werdet ihr kein Geld mehr bei dem Herrn Oberschlichtmeister borgen! Wenn ihr in Not seid, kommt hierher! Geht jetzt!“
„Jawohl, Herr!“, murmelten die Frauen und verließen mit tiefem Knicksen das Büro.
Erschüttert, zitternd vor Zorn und Empörung, sah Friedrich, wie Onkel Caspar dem Erpresser das Geld zurückgab. „Entschuldige dich bei ihm“, hörte er den Onkel sagen.
„Nie, niemals!“, rief er wütend.
„Gehen Sie!“, sagte der Prinzipal zu dem Oberschlichtmeister. Mit leichtem Grinsen ging der Kerl an Friedrich vorbei.