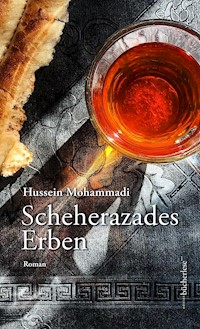
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition bücherlese
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Welt des afghanischen Bauern Ahmad ist klein, sein Leben einfach und es scheint trotz aller Schwierig-keiten in Ordnung, bis zu jenem Tag, der sein Leben vollständig verändern wird. Seine geliebte Tochter Masomah, die mit dem Sohn des Bruders verheiratet werden sollte, ist verschwunden, fortgelaufen mit einem Jungen aus dem Nachbardorf. Eine frei gewählte Verbindung aber ist für Masomah nicht vorgesehen und ihre Flucht führt zu schweren Konsequenzen für Vater und Tochter. Fortan bewegt sich Ahmad zwischen dem Verhaltenskodex einer traditionellen Gesellschaft, den sozialen Zwängen seines Heimatdorfs in der afghanischen Provinz und dem unbeirrbaren Versuch, die schmerzlich vermisste Tochter zu finden und zu schützen. Vor dem Hintergrund dieser persönlichen Katastrophe entfaltet der Roman in spannenden Episoden die Leben von fünf miteinander verbundenen Menschen, die vom Einbruch des Unerwarteten unterschiedlich betroffen werden. Dabei gelingt Hussein Mohammadi ein aufregender Spagat zwischen der Poesie orientalisch inspirierten Erzählens und der ungeschönt-packenden Darstellung des Lebens in der afghanischen Gesellschaft vor der erneuten Machtübernahme der Taliban im August 2021.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hussein Mohammadi
Scheherazades Erben
Roman
Aus dem afghanischen Persisch ins Deutsche übertragen von Sarah Rauchfuß
In tausendundeiner Nacht hat Scheherazade dem König einst ihre Geschichten erzählt. In Afghanistan entstehen tausendundeine Geschichte rund um die Uhr. Die Menschen erzählen sie einander und haben darin eine außergewöhnliche Virtuosität entwickelt.
INHALT
AHMAD
AHMADS WELT
ZABIH
NADSCHIB
ZAINAB
LAILA
MASOMAH
GLOSSAR
AHMAD
»Kabul hat sich sehr verändert«, murmelte Eshagh. Wieder und wieder kam ihm dieser Satz über die spröden, aufgeplatzten Lippen.
In der Tat hatte sich vieles hier gewandelt. Hohe Neubauten waren aus dem Boden geschossen und hatten dieser Stadt ein fremdartiges Gesicht verliehen. Die Sonne spielte hinter den Häusern Verstecken. Alte und neue Häuserfronten verliefen hier Seite an Seite und erzeugten ein wundersames Gewebe. Menschen und Autos verstrickten sich in den breiten Straßen Kabuls zu einem Knäuel, in dem jeder versuchte, auf dem eigenen Weg voranzukommen. In ihrem einfarbigen Kleid hatte die Stadt in der Vergangenheit einen ebenmäßigen Eindruck gemacht. Jetzt war sie bunter geworden und ihre Gewänder vielfältiger. In unterschiedlichen Moden sah man die Menschen in der Stadt hinaufund hinunterlaufen. Ihre Blicke und Schritte streiften überall umher und allerlei Dinge durchzogen ihre Gedanken. Direkt unter der Haut dieser Stadt lagen zahlreichen Geschichten verborgen, und um sie dem Herzen dieser Gesellschaft zu entlocken, brauchte man die Stadt bloß einmal zu schütteln und schon rannen die Geschichten den Bewohnern über die Lippen.
Inmitten des Lärms und des grauen Dunstes, der über der ganzen Stadt hing, verfolgten Ahmad und Eshagh, zwei Brüder, die schon etwas in die Jahre gekommen waren, ihre eigene Geschichte. Der Weg nach Kabul war weit und die stundenlange Autofahrt hatte Eshagh erschöpft. Seit er das Dorf das letzte Mal verlassen hatte, war einige Zeit vergangen. Lange Fahrten wie diese war er nicht gewohnt. Mehrmals hatte er anhalten müssen, um sich zu strecken und zu beugen. Während der Reise hatte er unablässig geraucht. In der Stadt angekommen, waren sie gleich an der ersten Kreuzung in einen Stau geraten. Eshagh fixierte die Straße, die vielen Menschen und unterschiedlichen Gefährte. Mit derart viel Verkehr hatte er nicht gerechnet. Überall Autos, kleine und große Verkehrsmittel. Hinter den Lenkrädern junge und alte Menschen, überreizt durch das warme Wetter und den Stau. Hupen und Geschrei war zu hören. »Da vorne sieht es nach einem Unfall aus«, meinte Eshagh. »Gott steh mir bei! So wie es in dieser verdammten Stadt zugeht, werde ich auch noch einen Unfall haben. Aus jedem Loch fährt hier jemand auf einem Motorrad oder Fahrrad auf die Straße und wohin man auch schaut, fehlt es nicht an unaufmerksamen Leuten, die nicht nach vorne gucken, wenn sie die Fahrbahn überqueren. Die gucken nicht geradeaus und laufen einem einfach so vors Auto! Hier muss es doch ständig Unfälle geben. Seit wir in der Stadt sind, waren wir schon mehrmals kurz davor. Und es wird nicht besser«, seufzte er und ließ das Fenster etwas herunter, um sich die nächste Zigarette anzuzünden.
Vom Beifahrersitz aus warf Ahmad einen flüchtigen Blick auf seinen jüngeren Bruder. Kaum zu glauben, dass sie nur zwei Lebensjahre voneinander trennten. Ließe man jemanden spontan schätzen, hätte er sicher auf mindestens zehn getippt. Während das Haar an Eshaghs Schläfen neuerdings von vereinzelten weißen Strähnen durchzogen wurde, war Ahmads Haar bereits vollständig ergraut.
Eshagh blies den Zigarettenqualm durch einen kleinen Schlitz zum Fenster hinaus. Dennoch stieg Ahmad immer ein Teil davon in die Nase. Er beklagte sich nicht. Aufgrund der Hitze hatten sie entschieden, das Fenster nicht zu weit herunterzulassen. Die Abgase und der Schmutz der Autos reizten ihre Kehlen und machten ihnen das Atmen schwer. Seit sie die Stadt erreicht hatten, ließ dieses Brennen in der Kehle die beiden immer wieder husten. Ahmad zog eine kleine Dose aus der Westentasche hervor. Seine groben, schwieligen Hände drehten ihren Deckel, auf dem ein Spiegel eingelassen war, herum. Mit einem kleinen Ruck ließ er aus der Dose eine Prise Naswar auf seine geöffnete Handfläche fallen. Anschließend schraubte er die Dose wieder zu und steckte sie zurück an ihren Platz. Mit zwei Fingern drückte er den feuchten Tabak auf seiner Handfläche zusammen und schob sich den Priem in die Wange. Dann lehnte er sich etwas zurück. Von dem Schweiß, der seine Kleidung unter den Armen und auf dem Rücken durchtränkte, nahm er kaum Notiz. Er starrte bloß aus dem Fenster, mit diesem Gesicht, das aussah, als hätte es während der ganzen Lebensspanne seines Besitzers noch kein einziges Mal gelächelt.
Um den Kopf trug Ahmad einen schwarzen Turban und am Körper die einfache Kleidung der Dörfer, die sauber, aber verwaschen und an einigen Stellen geflickt war. Einen der Schuhe, die er trug, hatte er mit einigen der Fäden, die sonst in den Webstuhl seiner Frau eingespannt wurden, eigenhändig repariert. Er war alt geworden, machte aber noch immer einen zähen Eindruck. Mit einem bestickten Taschentuch wischte er sich den Schweiß aus dem Gesicht. Er war unruhig und müde, aber an Schlaf war nicht zu denken. Über seiner Oberlippe war die Narbe einer alten Schnittwunde zu sehen. Sie stammte aus seinen Jugendjahren. Obwohl seither Jahrzehnte vergangen waren, war die senkrechte Kerbe noch gut zu erkennen. Als seine Tochter noch klein war, hatte sie immer wieder mit der Hand über diese Narbe gestrichen und ihm kuriose Fragen dazu gestellt. Als stamme diese alte Verletzung, die oberhalb der Lippe ihres Vaters seine Haut kräuselte, aus einer ruhmreichen Schlacht. Für Ahmad hingegen war sie nur ein Relikt aus Zeiten, in denen er dumm und unerfahren gewesen war. Für einen Moment schloss er die Augen und stellte sich das Gesicht seiner Tochter vor. «Masomah», flüsterte er. Seit gestern war er im Irrgarten seiner Gedanken verloren. Ihm war zumute, als befände er sich bereits im Barzach, und dieser Ort, der die Lebenden von den Toten trennt hielte nichts als Qualen und das Gefühl der Ohnmacht für ihn bereit. Er öffnete die Augen wieder. Die Bitterkeit des Naswar stieg ihm langsam in den Kopf. Sein Herz schlug schneller. Er versuchte, an nichts zu denken. Um seinem Inneren zu entfliehen, wandte er das Gesicht der farbenfrohen Welt Kabuls zu. Bis gestern hatte er tagtäglich nur Berge und Täler und Häuser aus Lehm und Stroh gesehen. Seine weitesten Wege führten ihn nur bis in die Nachbardörfer, um dort Besorgungen zu machen oder etwas zu verkaufen. Nie zuvor in seinem Leben war er in Kabul gewesen. Diese Stadt erschien ihm wie eine Vision im Schlaf, wie ein chaotischer Traum, in dem die Ereignisse sich überschlugen und von dem man beim Erwachen kaum etwas erinnerte. Das Dorf hingegen war ein klar umrissenes Bild. Hier kannte Ahmad jede Ecke und auch die Umgebung war wie ein Film in seinem Bewusstsein gespeichert.
Jedes Mal, wenn er in jenen Stunden, in denen er so weit fort war von seinem Zuhause, an das Dorf dachte, bestürmten Fragen seinen Geist: Was tat seine Frau jetzt? Waren die Nachbarn schon bei ihnen gewesen, um herumzuschnüffeln? Was hatte Nabi mit seiner Tochter vor? Worüber sprachen die Leute im Dorf, wenn sie sich trafen? Hatten sich die Altehrwürdigen des Dorfes schon zusammengesetzt? Wie sprach man im Dorf jetzt von seiner Tochter? Er kannte die Antworten auf diese Fragen. Er hatte diese Geschichte bereits einige Male miterlebt. Es war eine sich wiederholende, traurige Geschichte. Und jetzt hatte es ihn getroffen.
Eshagh befand sich in einem ähnlichen Zustand wie sein Bruder. Er war übermüdet und unruhig zugleich. Bisher hatte er sich gelassen gegeben. Solange alles lief wie geplant, hatte sich dieser Anschein von Ruhe bewahren lassen. Vor Jahren war er einmal mit ein paar Verwandten in Kabul gewesen, um an einer Hochzeit teilzunehmen. Es schüchterte ihn ein, dass sich seither so viel verändert hatte. Die Bevölkerung musste um ein Vielfaches gewachsen sein und jeder hier schien Geld zu haben, sich ein Haus zu bauen. Das ganze Durcheinander machte ihn nervös. Er fragte sich, wie er in dieser riesigen Stadt seine Nichte finden sollte und hoffte, sie würden wenigstens zu der Adresse gelangen, die er bei sich trug. Auf der Suche nach einem Restaurant mit dem Namen Anar, das im Paghman-Bezirk sein sollte, lenkte er das Auto durch die endlosen Straßen und Gassen Kabuls. Einige Male versuchte er, von Passanten die genaue Adresse des Restaurants zu erfragen. Die Stadt erschien ihm wie ein Irrgarten. Mal wurde ihm eine falsche Adresse genannt, dann wieder verfuhr er sich. Einmal hatte er es sogar bis zu einem Restaurant mit dem Namen Anar geschafft, aber irgendetwas stimmte dort nicht mit den Angaben überein, die er von Zabih erhalten hatte. Er warf einen prüfenden Blick in den Spiegel und rückte die weiße Kappe zurecht, die er auf dem Kopf trug. Über die Ecke des Spiegels schielte er zu seinem Bruder hinüber. Er atmete tief ein und begann nachzudenken. Er machte sich Sorgen. Ob sein Bruder womöglich ganz andere Pläne hatte? Die Probleme standen ihm bis zum Hals. So sehr die anderen Dorfbewohner Eshagh auch rühmten und achteten, Ahmad blieb für sie ein Trottel, jemand, der vom richtigen Weg abgekommen war.
Die beiden Brüder hatten während der langen Tour nicht miteinander gesprochen. Ahmads Schweigen bereitete Eshagh Unbehagen. Dass sein Bruder so emotional und mitfühlend sein konnte, würde noch zu Problemen führen, befürchtete er. Für ihr Problem gab es nur eine einzige Lösung. Und an dieser hielt Eshagh fest.
Eshagh parkte den Wagen im Schatten eines Baumes und zog ein letztes Mal an seiner Zigarette. Kräftig blies er den Rauch zwischen den Lippen hervor. Den Filter warf er in die Abwasserrinne am Straßenrand. Sein Blick fiel auf einen älteren Mann, der an einen Baum gelehnt stand - neben sich eine kleine Schubkarre, an der Seite einen großen Besen - und an einem Glas heißem schwarzen Tee nippte. Er sah Eshagh an und schüttelte bedauernd den Kopf. Dieser nahm die Geste des Mannes wahr, ließ sich aber nichts anmerken. Ahmad stieg ebenfalls aus dem Wagen. Er ging zu einer Häuserecke und spuckte in die Abwasserrinne. Die Rückstände des Naswar klaubte er in seinem Mund mit der Zunge zusammen und spuckte sie, verflüssigt mit etwas Speichel, hinterher. Er kam etwas näher an Eshagh heran, der sich jetzt mit einem jungen Straßenverkäufer unterhielt. Der junge Mann gestikulierte fortwährend mit den Händen, zeigte immer wieder geradeaus und erklärte ihnen, wo genau in der Schah-Tscheragh-Straße das Restaurant Anar zu finden sei. Dann musterte er die beiden Brüder mit einem schnellen Blick und versuchte, sie zu seinem mobilen Stand hinüberzubugsieren. »Es scheint, sie beide sind gerade erst in Kabul angekommen. Wollen Sie für Ihre Frau und Ihre Kinder nicht ein paar Geschenke kaufen? Oder etwas für sich selbst? Ich habe hier alles: Socken, Hosen für Männer und Frauen, schlichte Unterkleider oder auch bestickte. Alles zu günstigen Preisen. Wenn sie mehrere Kleidungsstücke kaufen, kann ich Ihnen ein gutes Angebot machen.«
Ahmad ließ seinen Blick über den vierrädrigen Wagen schweifen, auf dem sich Kleider für junge Männer häuften. Rundherum war auf dem Wagen ein Rahmen aus Metall angebracht worden, der oberhalb und auf der einen Seite mit einem dicken Stoff bespannt war. Die Farben der Kleidungsstücke waren verblasst und verwaschen. Lediglich die Räder des Wagens schienen neu zu sein. Der junge Mann fuhr fort, seine Waren zu loben und anzupreisen. »Danke für Ihre Hilfe«, fiel Eshagh, der kein Interesse hatte, etwas zu kaufen, ins Wort. »Wir brauchen nichts.» Mit diesen Worten stieg er zurück in den Wagen und Ahmad folgte ihm unverzüglich. In der Hoffnung, mit seiner Hartnäckigkeit doch noch zu Geld zu kommen, hatte der junge Mann noch etwas sagen wollen, es aber lieber gut sein lassen, als er die Gesichter der beiden Brüder gesehen hatte. Vor sich hinmurrend ging er zu seinem Wagen zurück.
AHMADS WELT
war so klein, dass er in Kabul unter all den Menschen, die im Auto an ihnen vorbeifuhren, nach bekannten Gesichtern Ausschau hielt. Manchmal meinte er, jemanden erkannt zu haben. Im Dorf kannte er alle, sogar aus den Nachbardörfern kannte er viele. Er blickte nacheinander in die Gesichter der Mädchen, um vielleicht das seiner Tochter darunter zu finden. Aber dann dachte er sich: Nein, meine Tochter ist verschleiert. Meine Tochter schminkt sich nicht so stark. Die Hälfte ihres Haars schaut nicht so hervor. Auf den Tschador seiner Tochter war ein sternförmiges Muster gestickt. Würde er dieses Muster auf einem der Tschadors hier in der Stadt entdecken, dann könnte er ganz sicher sagen: »Das ist sie.«
Die Mädchen, die nah beieinander über den Basar gingen, erregten die Aufmerksamkeit der beiden Brüder und natürlich auch die der anderen Männer. Als stünde er seinen Erzfeinden gegenüber, biss Eshagh vor Verachtung die Zähne zusammen und sagte, während er die Männer anblickte: »Solche wie die haben die Gesellschaft verdorben. Diese schamlosen Teufel haben das Land um den Frieden gebracht und nur Unheil angerichtet. Ich frage mich wirklich, was aus dem Ehrgefühl der Männer in dieser Stadt geworden ist. Die Geschichten von dem Lotterleben hier hört man schon bis in unsere Dörfer. Und irgendwann führen sie dann auch unsere Töchter in die Irre. Dass Mädchen und Frauen zu Hause bleiben sollten, das haben die Taliban schon ganz richtig gesehen. Sie sollten waschen, kochen und schnell heiraten. Dann Kinder bekommen und fügsame Ehefrauen werden. Wenn man sie freilässt, ruinieren sie die Gesellschaft.«
Ahmad hörte seinem Bruder nicht zu. Er beobachtete die langen schwarzen Haare, die ein sanfter Wind unter dem bunten Kopftuch eines der Mädchen hervortänzeln ließ. Er dachte an seine Tochter, deren Haare ebenfalls so lang und schwarz waren. Er fühlte, wie sich sein Herz zusammenzog. Sie fehlte ihm sehr. Einen solchen Schmerz hatte er nur ein einziges Mal gefühlt, als er – noch jung – seine Eltern verloren hatte. »Meine Tochter, warum hast du das getan?«, flüsterte er vor sich hin.
Er wünschte, er wäre zurück auf den Feldern und würde wieder den Acker pflügen. Er wünschte sich, all dies geschähe nur im Schlaf und dass er aus diesem Albtraum erwachen und seine Tochter sehen würde, wie sie morgens in den Stall ging, um die einzige Kuh, die sie hatten, für das Frühstück zu melken. Lächelnd goss sie Schwarztee mit Milch in kleine Gläser. Golchaman legte frisches, warmes Tandooribrot auf das ausgebreitete Tuch. Wie gewöhnlich hatte er noch geschlafen, als seine Frau aufgestanden war, um den Ofen anzuheizen, damit alle frisches warmes Brot zum Frühstück hatten. Dieses Brot gab ihnen doppelte Kraft für die Arbeiten im Haus und auf dem Feld. Die Erinnerungen an diese Morgenstunden waren jetzt nur noch Tagträume. Sie würden sich für ihn nicht wiederholen. Er hatte seiner Tochter beim Aufwachsen zugesehen. Wie glücklich war er gewesen, als sie geboren wurde. Die Leute im Dorf hatte Ahmads große Freude verwirrt. Söhne zu bekommen war für sie von großer Wichtigkeit. Ahmad aber hätte sich nicht mehr freuen können. Seine Tochter war das Licht seines Hauses geworden. Ein weiterer Grund, glücklich zu sein. Niemals hätte er gedacht, dass sie ihm einmal so ein Schicksal bescheren würde. Wie konnte er diesem Albtraum nur entfliehen? Er wollte doch nichts, außer zu diesen Morgenstunden an der Seite seiner Tochter und seiner Frau zurückzukehren. Er wäre bereit, seinen ganzen Besitz Gott zu überlassen, wenn er stattdessen zu seinem vergangenen Leben zurückkehren und noch einmal von vorne beginnen könnte.
Als Ahmad erfahren hatte, dass seine Tochter verschwunden war, und noch dazu mit einem Jungen aus dem Nachbardorf, hatte sich sein ganzes Leben verdunkelt. Nie zuvor war er so außer sich, so verzweifelt gewesen. Er erinnerte sich an das Gesicht seiner Frau, die ihren Schleier zur Seite gezogen hatte und zwischen den Ackerfurchen hindurch auf ihn zuhastete.
Ahmad hielt die Schaufel in der Hand. Er schaute dem Wasser nach, wie es sich über die Erde schlängelte. Er folgte dem Lauf, jederzeit bereit, ihn mit seiner Schaufel zu ändern, damit jeder Teil des Feldes gleichmäßig bewässert würde. Er beobachtete, wie der Boden und die kleinen und großen Erdklumpen das Wasser aufsogen und ihre Farbe wechselten. Die Pflanzen, die jetzt ihre Köpfe aus der Erde gestreckt hatten, würden bis zur Erntezeit weiterwachsen. Ahmad warf einen Blick zum Himmel, von dem eine stolze Sonne herabschien. Es hatte seit einiger Zeit nicht geregnet. Aber nun, ein Dürrejahr war es auch nicht. Die Altehrwürdigen der Dörfer hatten sich zusammengesetzt, um das Wasser gerecht zu teilen. Die Dorfbewohner waren einigermaßen zufrieden. Noch zwei Monate und man würde ernten können.
Er nahm seine weiße runde Kappe vom Kopf und wischte sich mit einem großen Tuch um seinen Hals den Schweiß weg. Unter den Armen und an den Seiten war seine Kleidung ganz durchgeschwitzt. Er war hungrig und warf einen Blick in Richtung Dorf. Eine schwarze Gestalt lief von dort auf ihn zu. Er lächelte. Sie ist ein bisschen spät dran, sagte er sich. Vor einer Stunde hätte Golchaman ihm sein Mittagessen bringen sollen. In diesem Moment war er sich sicher gewesen, dass die schwarze Gestalt seine Frau war, die ihm sein Mittagessen bringen wollte. Auf den angrenzenden Feldern saßen die Bauern im lebhaften Gespräch beieinander. Manchmal zogen sie sich in die Schatten der Bäume zurück, um sich vor der sengenden Sonne zu schützen. Zur Essenszeit begaben sie sich in die Hütte, die sie aus den Bastfasern und Zweigen der Bäume gebaut hatten, um dort gemeinsam zu speisen oder Tee zu trinken. Zur Erntezeit kam die ganze Familie. Dann war auf den grünen und fruchtbaren Feldern ein reges Treiben zu beobachten. Alle kamen zusammen, um die Ernte zu feiern und dieser gedeihlichen und frohen Atmosphäre beizuwohnen. Alle liebten diese Zeit und verbrachten glückliche Tage zusammen. Ein blinder alter Mann kam in Begleitung seines Sohnes und dessen Familie. Der alte Mann setzte sich in eine Ecke und begann mit altehrwürdiger, herzerwärmender Stimme seine Liebesghaselen zu singen. Die Männer und Frauen spürten die sengende Hitze nicht mehr. Die Stimme des Alten gab ihnen Kraft, heiter setzten sie ihre Ernte fort und hofften, die nächsten Jahre mögen so glücklich verlaufen wie dieses.
Golchaman kam sehr schnell näher. Es ist ein bisschen spät geworden, sagte sich Ahmad, aber es ist doch nicht notwendig, so viel Aufhebens wegen eines Mittagessens zu machen. Hin und wieder stolperte sie und drückte die frisch aufgeworfene Erde mit ihren Füßen nieder. Ahmad ging auf sie zu und rief ihr entgegen: »Langsam, langsam, Frau! Ich verhungere schon nicht.«
Ein Ende von Golchamans Tschador schleifte auf der Erde. Sie keuchte.
»Masomah, Masomah …«, stieß sie zwischen den Atemzügen hervor. Sie ließ sich vor Erschöpfung auf dem Boden nieder. Mit einer Ecke des Tschadors wischte sie sich die Schweißperlen aus dem sonnenverbrannten Gesicht. Ihr Atem beruhigte sich etwas, dann brach sie in Tränen aus.
»Was ist mit Masomah? Sprich doch, Frau. Ist ihr etwas passiert?«, fragte Ahmad. Golchaman atmete ein paarmal tief ein und sagte dann mit zitternder Stimme: »Ich kann sie nicht finden.«
Ahmad starrte seine Frau, wie sie dort vor ihm auf dem Boden kauerte und vor Sorge weinte, unverwandt an. Die heiße Erde unter ihr ließ sie noch stärker schwitzen, schon standen ihr wieder Schweißperlen im Gesicht. Ahmads Knie zitterten, er setzte sich vor sie auf den Boden, griff ihr schmales Kinn und sagte wütend: »Was soll das heißen, du findest sie nicht? Erklär mir doch, was passiert ist. Du hast mich fast zu Tode erschreckt.«
Mit Augen voller Tränen begegnete Golchaman dem strengen Blick ihres Mannes. Schluchzend sagte sie: »Morgens ist sie zu den Nachbarn ein paar Gassen weiter gegangen, zum Haus von Shah Gholam, Khadidschahs Vater. Masomah sagte, sie wolle dort vorbeigehen, um zu helfen, Khadidschahs Hochzeitskleid zu nähen. Sie blieb sehr lange weg. Irgendwann ging ich los, um sie nach Hause zu holen, aber Khadidschahs Mutter sagte, sie sei gar nicht bei ihnen gewesen. Also bin ich zu den anderen Nachbarn gegangen, aber dort hatte auch niemand Masomah gesehen. Ich hätte mich verfluchen können. Aber wo hätte sie denn allein hingehen sollen?«
Ahmad war unschlüssig, was er tun sollte. Er wollte vermeiden, so außer sich zu geraten wie seine Frau. »Hast du bei meinem Bruder nachgefragt? Vielleicht ist sie bei Nabi. Vielleicht ist sie bei ihm«, sagte er.
Golchaman knetete ihren Tschador. »Da geht sie doch nicht hin. Du weißt ganz genau, dass sie Nabi nicht leiden kann. Und wenn sie dorthin gegangen wäre, was hätte sie denn für einen Grund gehabt, mich anzulügen?«, antwortete sie und weinte weiter.
Ahmad schaute sich um. Ein paar Leute auf den Nachbarfeldern schauten neugierig zu ihnen herüber. Besorgt und ärgerlich sagte er zu ihr: »Steh auf und rede nicht so laut! Ich will hier nicht mein Gesicht verlieren. Komm, steh auf, wir gehen nach Hause! Wo immer sie auch hingegangen ist, vielleicht ist sie inzwischen wieder zurück.« Und dann zu sich selbst: Masomah ist verschwunden? Wo könnte sie sein? Es gibt doch in diesem kleinen Dorf keinen Ort, an den man gehen könnte, außer zum Haus des Nachbarn. Ihm bebte das Herz bei diesen Gedanken. Sie ist kein Junge, von dem sich, wo immer er sei, sorglos sagen ließe, zum Abend ist er wieder da. Sie ist ein Mädchen. Es gibt für sie keinen Ort, an den sie gehen könnte.
Er ergriff die Hand seiner Frau und zog sie vom Boden hoch. Golchaman rückte ihren Schleier zurecht. Ohne der





























