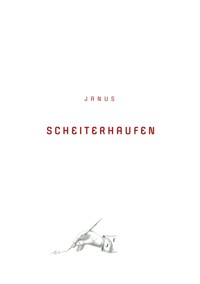
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist ein kleines, aber gewichtiges Büchlein. Es besteht aus drei kurzen Erzählungen, die mit ihrem langen Sinn vielleicht die Kraft haben, einige Lebensgeister zu erschrecken, von denen die Menschen vormals und heute befallen sind. Der erste Lebensgeist ist die Kunst. Der zweite Lebensgeist ist die Liebe. Der dritte Lebensgeist ist der Fortschritt. Wovon bist du besessen, lieber Leser? Wohin geht dein Glaube? Was bringt dir Ordnung und Sinn ins Leben? Denn das ist es, was all diesen Lebensgeistern am Ende ja gemein ist – sie gaukeln uns Sinn und Bedeutung vor. Das ist ihre Macht, deshalb beschwören wir sie herauf, davon zehren sie und wir gleichermaßen und halten uns im Leben. Was aber, wenn der Betrug auffliegt? Was, wenn der Geist zurück in die Flasche verschwindet? Die folgenden drei Erzählungen handeln von den so Zurückgelassenen, von den entgeisterten Menschen, von ihren tragischen Fällen des Scheiterns. Ihr Beispiel soll uns gute Lehren bringen und uns rüstig machen gegen schädliche Heimsuchungen und schlechte Luft. Dieses Büchlein ist kein Ergebnis lustiger Stunden. Es soll daher auch nicht schnell und nebensächlich gelesen werden. Vielmehr möchte man sich dafür die nötige Zeit geben – und es ist ja auch wirklich nicht allzulang. Wer aber trotzdem nur unachtsam darüber wegfliegt, wird viele Schleier vor den Augen haben und Rätselraten bis dorthin, dass es – ich gebe es gerne zu – an mancher Stelle ganz unlesbar sein wird. Doch das soll uns jetzt nicht weiter hindern, denn bekanntlich ist alles Anfangen schwer. Jeder soll sein Bestes geben – Autor und Leser – im Sagen und Hören und Sich-Verstehen. Was kann schon Schlimmeres dabei herauskommen als ein Irrtum?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
JANUS
SCHEITERHAUFEN
DREI ERZÄHLUNGEN
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor/die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine / ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors/der Autorin, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
© 2023 JANUS
Oberländerstraße 21 / 81371 München
Paperback ISBN 978-3-384-08559-7
eBook ISBN 978-3-384-08560-3
Druck und Distribution im Auftrag JANUS:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwörtchen
Die Kunst – erste Erzählung
Die Liebe – zweite Erzählung
Der Fortschritt – dritte Erzählung
SCHEITERHAUFEN
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
Vorwörtchen
Der Fortschritt – dritte Erzählung
SCHEITERHAUFEN
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
Vorwörtchen
Dies ist ein kleines, aber gewichtiges Büchlein. Es besteht aus drei kurzen Erzählungen, die mit ihrem langen Sinn vielleicht die Kraft haben, einige Lebensgeister zu erschrecken, von denen die Menschen vormals und heute befallen sind.
Der erste Lebensgeist ist die Kunst.
Der zweite Lebensgeist ist die Liebe.
Der dritte Lebensgeist ist der Fortschritt.
Wovon bist du besessen, lieber Leser? Wohin geht dein Glaube? Was bringt dir Ordnung und Sinn ins Leben? Denn das ist es, was all diesen Lebensgeistern am Ende ja gemein ist – sie gaukeln uns Sinn und Bedeutung vor. Das ist ihre Macht, deshalb beschwören wir sie herauf, davon zehren sie und wir gleichermaßen und halten uns im Leben. Was aber, wenn der Betrug auffliegt? Was, wenn der Geist zurück in die Flasche verschwindet? Die folgenden drei Erzählungen handeln von den so Zurückgelassenen, von den entgeisterten Menschen und ihren tragischen Fällen. Ihr Beispiel soll uns gute Lehren bringen und uns rüstig machen gegen schädliche Heimsuchungen und schlechte Luft.
Dieses Büchlein ist kein Ergebnis lustiger Stunden. Es soll daher auch nicht schnell und nebensächlich gelesen werden. Vielmehr möchte man sich dafür die nötige Zeit geben – und es ist ja auch wirklich nicht allzulang. Wer aber trotzdem nur unachtsam darüber wegfliegt, wird viele Schleier vor den Augen haben und Rätselraten bis dorthin, dass es – ich gebe es gerne zu – an mancher Stelle ganz unlesbar sein wird.
Doch das soll uns jetzt nicht weiter hindern, denn bekanntlich ist alles Anfangen schwer. Jeder soll sein Bestes geben – Autor und Leser – im Sagen und Hören und Sich-Verstehen. Was kann schon Schlimmeres dabei herauskommen als ein Irrtum?
Die Kunst – erste Erzählung
Die Welt ist die Welt. Sie ist weder gerecht noch ungerecht, weder schön noch unschön, nicht böse, nicht gut, hat nichts Freundliches oder Hartes, will weder etwas sagen, noch will sie gehört oder verstanden sein. Dasein und Dasein allein! Alles andere, das darüber gesprochen wird, sind Zuschreibungen, die nichts Eigentliches feststellen als die Seelenkrankheit allein der Feststellenden, ihre Unzulänglichkeit, ihre Mangelverhältnisse, ihr fliehendes und zurückblickendes Wesen, das Sentiment und Sentimentalität auf widersinnige Weise zusammenwirft und das sie dann – dumm wie Menschen sind – Weltschmerz heißen. Dabei sollten sie es doch besser Menschenschmerz nennen!
Der Fehler … der Fehler … der Fehler … warum sucht man ihn nur immer im „Anderswo“? Warum immerzu wegschieben, loswerden, am besten jemandem unterjubeln noch, der – nichts Böses im Sinn – des Weges kommt? Ich sage: Der Fehler ist das halbe Menschsein. Ich sage: Neige dich hinüber. Ich sage: Umarme deine schlechtere Hälfte zum besseren Ende.
Gustav Spitzer blätterte zur nächsten Seite des Manuskripts. Er las gewöhnlich nicht allzu viel, doch wenn er es tat, begnügte er sich nicht mit Alltäglichem. Dann wollte er tiefer schauen in neue Gebiete hinein, wollte sehen, ob deren Untergründe schlüpfrig oder trittfest waren, wollte wissen, welche Dinge dort wohnten und ob sie nahe am Boden krochen oder ihnen Flügel gewachsen. Nach solchen Texten schaute er aus. Mitunter waren sperrige Brocken dabei, an denen die besten Zähne lange kauen – Plato und Plotin, Meister Eckhart und Cusanus, Hegel und Marx, aber auch Lessing, Wieland und Goethe, Novalis und Heine und Weitere desselben Wohlklanges. Das handgeschriebene Manuskript hingegen, durch das er sich soeben arbeitete, hatte merkwürdigerweise aber keinen Absender. Es hatte zwischen den Seiten eines „Kompendiums der philosophischen Anklänge“ gelegen. Ein Freund, der Bibliothekar in der städtischen Bibliothek war, hatte es darin gefunden, war neugierig geworden, hatte es wohl selbst mit einigem Gewinn gelesen und empfahl es daher Gustav an, von dem er wusste, dass die Beschäftigung mit derlei Grenzgedanken ihm harte Freuden machte. Gustav freute sich denn auch darüber nicht wenig und begann bald darauf, es interessiert zu studieren. Der Umstand, dass das Manuskript ohne Absender und offenbar versteckt in einem Buche gelegen, rührte zudem seine Neugier. Gut möglich, dass es sich um einen beträchtlichen Fund handelte, der bisher nicht öffentlich und daher im Augenblick ihm allein nur zugänglich war. Gut möglich auch, dass es ein anonymer Text eines bedeutenden Autors war. Dass es sich beim Autor um einen Kundigen handeln musste, erkannte Gustav einmal an den Gedanken, die tiefer gingen und in die er selbst nicht immer gut hinabfand. Mehr noch aber an der Aufmachung, die er besser zu deuten wusste als alle anderen Menschen. Das Geschriebene war klein, dennoch leserlich und akkurat. Es gab keine vorgefassten Zeilen, die Abstände dazwischen stimmten jedoch auffallend, was den Eindruck der Genauigkeit noch verstärkt haben würde, wäre da nicht die Schrift gewesen. Es lag eine gewisse Hast darin, etwas Vorauseilendes, sich förmlich Überschlagendes. Als ob bei der Niederschrift des einen Buchstabens der nächste und übernächste schon nicht mehr erwartet werden hätte können. Dies erkannte man gut an den Anschlüssen und Endungen, die direkt und scharf ineinander übergingen. Genauso verhielt es sich wieder mit den Abständen der einzelnen Wörter, die dadurch oft zusammengeschrieben wurden. Offenbar hatte der Autor die folgenden Wörter schon so ungeduldig im Gedanken, dass er schier vergessen hatte abzusetzen und die Feder unvermittelt von einem in das nächste Wort raste. Natürlich war versucht worden, einige dieser Fehler mittels mehrfacher Durchstreichung im Nachhinein unkenntlich zu machen. Das aber verstärkte nurmehr den hastigen Eindruck und die unziemlichen Zusammenrückungen waren auch danach noch gut erkennbar, sofern man nur genauer darauf achtete. Zudem waren viele dieser Fehler auch gar nicht ausgebessert worden und als Merkwürdigkeiten einfach mitten im Lauftext ohne Weiteres stehen geblieben. Man las dann manches von „buckligenWasserträgerneignerTränenmeere“ oder von „selbstentwaffnendenSpiegelfechtern“ und verspürte beim Lesen den unruhig arbeitenden Geist, der sich dahinter verbarg.
Dann waren da noch die Seiten. Das Papier war von ausgesprochen guter Qualität. Woher es stammte, war nicht leicht auszumachen, da weder Prägung noch Wasserzeichen darauf zu sehen waren. Das war nun – die Güte erwägend – doch sonderbar.
Gewöhnlich werden derart hochwertige Erzeugnisse ausgewiesen. Und so alt, dass es vor dem Aufkommen entsprechender Produktionsbetriebe per manus ecclesiae von incognitus gefertigt wurde, war es auch wieder nicht. Die Seiten hatten ein eigenartiges Format, das nicht genau, aber in etwa quadratisch war. Die Seitenränder schienen zudem etwas unregelmäßig und offenbar nicht scharf geschnitten zu sein. Sie waren sichtbar ausgefranst und fühlten sich flaumig an, sobald man mit den Fingerspitzen die Seiten umblätterte. Die Oberfläche war weich, aber eben. Gustav untersuchte die Blätter und bewegte die Hände darüber wie ein Klavierspieler. Er legte die Fingerspitzen auf die Oberfläche und schob sie vor und zurück, um in der Tat darauf zu spielen. Die Seiten machten dann nämlich schöne Geräusche, die umso heller klangen, je schneller die Finger darüber glitten und umso satter wurden, je mehr Gewicht er auf sie legte. Gustav schloss dabei die Augen, dass ihm durch Sehen nicht etwa sein Empfinden behindert wurde, und fand, dass er niemals ein besseres Papier gespürt hatte. Er wusste nicht, wo man dergleichen kaufen konnte, minder was ein solches denn kosten würde. Das – zusammengenommen mit dem Augenscheinlichen – machte den Schluss wahrscheinlich, dass die Seiten unter einigen Umständen selbst hergestellt und nicht für den Handel bestimmt gewesen waren. Und obwohl Gustav nach wie vor nicht bestimmen konnte, woher das Papier denn stammen und wer es beschrieben haben könnte, freute er sich doch über seine kleinen Feststellungen, die ihm bis hierher gelungen waren.
Es war spät und Gustav hatte zu lange schon mit dem Manuskript zugebracht. Es war Zeit, zu arbeiten. Gustav war Künstler, und als solcher zwar recht frei in seinen Angelegenheiten und Arbeitszeiten. Doch wusste er, dass auch die Kunst nicht für sich alleine existieren konnte – dafür war er nicht romantisch genug. Die Kunst bedarf eigener Grundlagen, die jeder Schaffende sich geflissentlich sicherzustellen niemals ganz entheben kann. Natürlich entwickelte man diese Grundlagen weiter, gab ihnen ein neues Aussehen, kombinierte vieles und fantasierte noch mehr, dass es aussah, als wäre das Ergebnis völlig eigenständig und neu, ganz ohne andere Bezüge. Dennoch durfte ein guter Künstler sich nie allzu weit vom Gegenstand der Untersuchung entfernen, sofern kein Kitsch dabei herauskommen sollte. Selbst das Schöne ist am Ende auf Sinn und Bedeutung ausgelegt. Er glaubte von daher, dass der Nachvollzug geistiger Grenzgänge der wesentlichste Beitrag sei, den man selbst sich geben könne. Nur daher mühte er sich überhaupt ab mit der Lektüre von Philosophischem und nahm es also für ein gutes und notwendiges Übel. Philosophie … wahre Irrungen … irre Wahrheiten … für Gustav waren diese Denkübungen – so beeindruckend diese oft anzuhören sind – dennoch allesamt falsche Verrenkungen und bestenfalls eine primitive Vorstufe dessen, was in seiner raffiniertesten Form als Kunst auftritt. Die Philosophie erging sich wie Sisyphos seit jeher in zwecklosen Versuchen, „die Wahrheit“ der Dinge zu explizieren und dingfest zu machen. Doch sie besitzt gar nicht die Mittel, zu „begreifen“ (mancher mag das schon als Beweis nehmen), dass die Wahrheiten, die sie sucht sich nicht festhalten lassen und entschwinden, sobald man sie packen will. Die Wahrheit war – was Gustav anging – nicht zum Anfassen, sondern zum Ansehen. Die Kunst machte sie sichtbarer und leuchtender als Philosophenworte es je fertigbrächten. Also entwickelte er als Künstler das höchste Selbstverständnis und setzte sich selbst auf den wolkigen Gipfel hoch über alle Skepsis, von wo aus es in alle Richtungen nur niederging und abfiel. Die anderen „Sucher“ liefen – soweit es Gustav anging jedenfalls – entweder ziellos im Tale durcheinander oder blieben während des Aufstiegs an spitzen Felsen hängen, zu müde und ängstlich, noch weiter zu klettern. Einige dieser Verwirrten vermeinten auch schon auf dem Gipfel angelangt zu sein, da sie bereits oberhalb der Wolkendecke wanderten. Diese ist wirklich dicht wie eine weiße Wand und verhehlt jeden Blick über die eigne Lage und Stellung. So kann man leicht meinen, sich schon am Gipfel und ganz oben zu befinden, obzwar eigentlich erst ein kleiner Vorsprung genommen und das meiste an Aufstieg noch zu bewältigen ist. Dies ist übrigens der Grund, warum auch echte Gipfelstürmer sich nie ganz gewiss wähnen können. Nur in wenigen Augenblicken der Erkenntnis verzieht sich nämlich die ständige Wolkendecke und öffnet die freie Sicht nach allen Seiten, dass man sich in der Welt ganz klar gewahre. Dann sieht man seine Hände, seine Füße, den Berg, die Ebene, Mensch und Tier, alles Unbelebte und am Ende deutlich und in vollem Zusammenhang sich selbst. Dies ist der Zustand der Wahrheit und jedes Suchenden heiligste Sehnsucht.
Lebensweisheit, dass dieser Zustand nicht fortbestehen darf. Alles verschwindet nach einiger Zeit wieder hinten dem weißen Schleier und man wird zurückgeworfen in die Ungewissheit. Eine unsinnige Übung also? Doch ein weiterer Sisyphos? Vielleicht … aber besser kurz als gar nie „gesehen“ zu haben. Daher höre der Künstler niemals auf zu schaffen. Auch wenn er einmal auf dem Gipfel angelangt ist, muss er es „schaffen“, dort zu bleiben, wenn nötig mit Fühlen, Tasten, Ergreifen, Festhalten. Alles nur, um – sobald man merkt, dass man doch plötzlich wieder tiefer steht – sich erneut aufwärts zu schwingen. Alles das nur, um richtig zu stehen, sobald das himmlische Kind die Wolken auseinanderstäubt. Alles, um sich in Stellung zu bringen für die Klarheit. Alles, um bereit zu sein für die Wahrheit, wenn sich diese zu zeigen wünscht. Genau darum machte Gustav Philosophie. Sie war ihm ein Steigbügel und sicherer Halt zu einem guten und festen Standpunkt für seine Kunst. Aber mehr war sie auch nicht!
Als Künstler war Gustav privilegiert. Praktisch gab es zu der Zeit keinen, der das Handwerk besser beherrschte. Er kannte alle Methoden und Werkzeuge, wusste mit allem meisterhaft umzugehen, ordnete sämtliche Stile und Richtungen, konnte ohne Mühe alles nachmalen – oft viel besser als die Originalen – und hatte, das war am wichtigsten, den reinsten Sinn für alles Schöne so tief eingepflanzt, dass sein Pinsel nichts Minderwertiges fabrizieren konnte. Gustav arbeitete immer an mehreren Kunststücken zugleich. Er brauchte daher ein Atelier, das nicht zu klein war und dessen Grundriss die Möglichkeit zur Aufteilung bot. Jeder Bereich wurde so ein eigenes Dekorationsprogramm, indem Gustav einem Stoff und Thema seine persönliche Auffassung gab. Insgesamt arbeitete er in drei großen Räumen, die alle über ein Vorzimmer erreichbar waren. Jeder der Räume war dabei nachgerade der Weise angelegt, die den darin befindlichen Kunststücken am ehesten entsprachen und sie zu befördern im Stande waren. Gustav veränderte dafür die Bedingungen jeweils so, dass alles kleinlich aufeinander abgestimmt war. Er verrückte Möbel, verhängte Fenster und Wände, entfernte Teppiche, machte hier Ordnung, dort Unordnung, verstellte den Raum, veränderte das Licht und vieles, vieles mehr. Jeder der Räume war daher für sich genommen schon kunstvoll, und mancher, der darein getreten, hätte diese wohl als ganze Kunstwerke und abschließend anerkannt. Das waren kleine, wundersame Welten, die besonders seichte Gemüter in tiefe Verzückung tauchen konnten. Gustav konnte diese Mandarinentümeleien aber nicht gut ertragen und ließ daher niemand Rührseligen zu. Manchmal kam ihn seine Schwester Leoni besuchen, sie musste aber wie jeder andere draußen warten, vor der geschlossenen Haustür und wurde durchaus nicht eingelassen, bis alles vollständig und fertiggestellt war. Man ging dann eben spazieren oder in die nahe gelegene Wirtschaft, um eine Erfrischung zu nehmen. Auf die natürliche Frage, wie die Arbeit vor sich ginge oder ob man denn einen kurzen Blick darauf werfen könne, kamen immer ausweichende Gebärden und grimmiges Murmeln, was für sich genommen zwar ganz unverständlich, doch zusammengenommen unmissverständlich war und dem Fragenden die Rolle des unsittlich Quengelnden zuwies, dergestalt dass jedes Anteilige guten Willens sogleich zurückgedrängt wurde und erstarb. Und so trotzte Gustav allen wohlmeinenden Eindringlingen und schützte seine Arbeit vor Verunreinigungen, die sich ohne Zweifel ansonsten ungünstig auf das Ergebnis ausgewirkt hätten. Das Profane, das Kitschige, war ihm spinnefeind, selbst wenn es aus Unschuld geboren und frei von Lüge vorgebracht war. Zu viele dieser unschuldig-schuldigen Reaktionen musste er bereits ertragen, dass er davor regelrechte Angst entwickelt hatte. Angst, dass das Profane allein durch Wiederholung auf ihn überginge, für ihn irgendwie natürlich und normal wurde, sich unbemerkt und schleichend Eintritt verschaffte in sein feines Gemüt. Alleine die Vorstellung, wie Leoni mit verklärten Augen rufen würde „Huch, wo bin ich denn hier hereingeraten?“ oder „Gustl, da hast du dir ja viele, putzige Universen gemacht, die schöner nicht sein könnten“ oder „Ei, das ist ja eine ganze Zauberwelt! Eine Zauberwelt!“ machte ihn rasend vor Wut. „… eine ganze Zauberwelt …“ keine Verwechslung könnte dümmer sein. Es wäre so, als sagte man „das Teleskop, das sind viele schöne, hellglänzende Sterne“ oder „die Brille, das ist das Buch, das mir klare Erkenntnisse gibt“ oder „der Begriff, das ist dasjenige, das der Fall ist“. Und so gestattete Gustav niemandem vor der Zeit den Zutritt zu seinen Kunststücken. Einen aber gab es doch, dem er dieses Privileg zugestanden und das war Richard. Den allein nahm er gelegentlich mit ins Atelier, seine Reaktionen zu beobachten und diesen womöglich etwas Nützliches abzugewinnen. Richard sprach nicht, daher bestand kaum die Gefahr, sich an stumpfen Reden den Geist abzuwetzen oder womöglich gar einschlägige Verletzungen davonzutragen. Das war eine gute Sache. Freilich will man sagen, wie doch eigentlich scharfe Reden viel tiefer schneiden, aber davor glaubte Gustav sich allerdings gefeit und fürchtete sich nicht vor der grün beglasten Allerweltsbrille, die Kleist seinerzeit so erschreckt hatte. Vielmehr waren es Dummheiten, die ihn angingen und die um vieles gefährlicher waren. Richard tat aber weder das eine noch das andere. Er gebärdete sich lediglich, was Gustav auch lieber war, da solche Äußerungen wesentlicher und daher wahrheitsfähiger waren als irgendwelche Bemerkungen – mochten sie nun stumpf oder noch so raffiniert geschliffen daherkommen. Und so war diese „stille“ Form der Kritik die einzige, die man ernst zu nehmen hatte und die einem ernsten Künstler ernstliche Wirkungen seiner ernsten Kunst anzeigen konnte. Solch ein stiller Kritiker war also Richard. Wo andere wie eigenwillige Sturmböen waren, die ein wackeliges Boot gewaltig auf Abwege bringen konnten, war Richard ein Leuchtturm, der mit Zwinkeraugen die Richtung anzeigte und vor den schrecklichen Untiefen der geistlosen Stumpfsinnigkeit warnte.





























