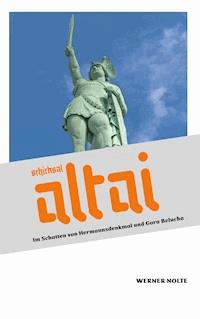
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auf dem Vormarsch im Ural überrascht im Sommer 1945 der Major Nacke eine der "Einsatzgruppen" bei einem Massaker an Zivilisten. Er erschießt die Mörder, die deutsche Uniformen tragen. Vorgesetzte und Kameraden in der Abwehr retten ihn vor Kriegsgericht und Hinrichtung. Nach dem Sieg des Dritten Reiches sucht der Ritterkreuzträger im Frühling 1946 als Knecht im lippischen Blomar die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Ein konspiratives Gespräch mit einem Freund aus der Abwehr zeigt ihm, dass seine Aktion im Ural nicht vergessen ist. Die Partei hat die Deportation aller nicht linientreuen Volksgenossen beschlossen. Seine Familie steht auf der Liste. Ein Attentat auf ihn wird befürchtet. Abwehr und Wehrmacht können die Deportation nicht verhindern, reaktivieren aber ein Projekt, in dem Betroffene als Wehrbauern unter dem Schutz von Gebirgsjägern im sibirischen Altaigebirge siedeln sollen. Nacke soll einige lippische "Trecks" in die Taiga führen. Er schafft es, mit Hilfe des vernünftigen Ortsgruppenleiters die Panik in Blomar einzugrenzen, die Selbstmorde zu stoppen und eine Reihe geeigneter Familien zu rekrutieren. Mit Hilfe der Abwehr neutralisiert er den hasserfüllten Kreisleiter Kronshagen. Unter Lebensgefahr retten zwei mutige Bauern eine junge russische Zwangsarbeiterin vor dem KZ. Nacke verliebt sich in Anna und heiratet sie. Kronshagen hat nach dem Mord an einer Agentin der Abwehr einen tödlichen "Unfall". Im menschenleeren Altai bereitet sich die 7. Gebirgsdivision auf die Aufnahme der Wehrbauern vor. Korruption in der Wehrmacht auch dort. Der Ring wird von der Feldgendarmerie zerschlagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dank
meiner Frau und allen Freunden, die mir halfen durch Interesse, Ermutigung, vielfältige Hinweise und sogar durch „Flugstunden“ mit dem Fieseler Storch am Simulator.
Dazu zählen June Bach, Rudolf Baudler, Christine Köhler, Irmgard und Klaus Schmidt und, wie immer bei allen wichtigen Projekten, Konstantin Köhler.
Der Autor
wurde im ehemaligen Fürstentum Lippe geboren und wuchs dort auf. Er lebt heute im Rheinland.
Für Inge
Inhaltsverzeichnis
Sommer 1945
Prolog I
Prolog II
Frühjahr 1946
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Frühjahr 1947
Sommer 1945
Prolog I
Der Major fluchte, als sein Hinterkopf auf den Ersatzreifen knallte. Er schob den Stahlhelm zurück, zog die Luft durch die Zähne und beugte sich auf dem unbequemen Sitz im Beiwagen vor, um seinen Rücken zu schonen. Es half nicht viel. Der Weg, wenn er denn die Bezeichnung verdiente, war von zu vielen im Lehm fest gebrannten Fahrzeugspuren durchzogen. Trotz des langsamen Tempos schaukelte und rüttelte die schwere BMW R 75. Hätte er doch dem Rat der Ärzte folgen und im Lazarett bleiben sollen?
Am frühen Morgen hatte ihn in Orenburg ein Versorgungskonvoi mitgenommen. Die Fahrt durch die Mittelgebirgslandschaft des Südural auf den üblichen schlechten Straßen und über einige von den Pionieren geschlagene Behelfsbrücken war lang und anstrengend gewesen. Im Divisionsgefechtsstand nördlich des Bergbau-Städtchens Sibaj hatte ihn am Nachmittag der Obergefreite Kleinschmidt, allgemein KS genannt, erwartet, sein Bursche, Fahrer und Vertrauter.
Major Nacke meldete sich in Abwesenheit des Kommandeurs beim 1a zum Dienst, ehe er wieder in den Beiwagen stieg. Eine Stunde über die Sandwege der Federgrassteppe und sie sahen die namenlose Ansammlung strohgedeckter Lehmhütten zwischen Sibaj und Magnitogorsk mit dem Gefechtsstand des 2. Bataillons Grenadierregiment Nr. 65.
Der Empfang unspektakulär. Sein Vorgänger hatte bereits ein anderes Kommando übernommen, und nach den langen Kriegsjahren wurde auf aufwendige Zeremonien verzichtet. Der Adjutant, Oberleutnant Ricken, ließ die Soldaten des Bataillonsstabes in brütender Sonne auf der staubigen Dorfstraße antreten, Hauptmann Koch, Chef der 1. Kompanie, machte Meldung und übergab ihm das Bataillon mit wenigen Sätzen.
Nacke antwortete mit einer Ansprache, die Offiziere und Mannschaften durch ihre Kürze erfreute.
„Danke, Hauptmann Koch. Lassen Sie wegtreten. Offiziere und Beamte zu mir.“
Er ließ sich über Personalbestand, Krankenstand, die Situation bei Ausrüstung, Munition, Verpflegung, Treibstoff und den Frontverlauf unterrichten.
Das Bataillon war auf Soll-Stärke. Die neue Politik machte Nicht-Deutschen, ausreichende Sprachkenntnisse und militärische Grundausbildung vorausgesetzt, den Dienst in bisher rein deutschen Infanterie-Einheiten möglich. So befehligte er nun Engländer, Niederländer, Belgier und sogar Ukrainer. Nacke störte das nicht. Angehörige eines ihrer sogenannten Ostbataillone hatten seine Kompanie vor einem Jahr herausgehauen. Nach der Zusage einer gewissen Autonomie kämpften diese rein ukrainischen Einheiten aufopferungsvoll und tapfer gegen die verhaßten Bolschewiken.
Gegen Abend wurde es kühler. Er streifte eine Tarnjacke über und startete einen seiner beliebten Alleingänge, trotz Rickens Bedenken. Das völlige Fehlen von Informationen über die Einheiten an seiner westlichen Flanke fand er ebenso beunruhigend wie der fehlende Kontakt zur SS-Division „Hohenstaufen“, die das nördlich gelegene Magnitogorsk erobert hatte.
„Die Masse der SS ist schnell vorgerückt und hat später das vor uns in Reserve gehaltene 2. Schützenregiment nachgezogen. Wir haben keinen Befehl zum Vorgehen“, hatte Ricken erklärt.
Sie passierten den nordwestlichen Vorposten des Bataillons und bewegten sich vorsichtig am östlichen Ufer des Ural-Flusses entlang. KS fuhr die schwere Maschine routiniert.
„Bin ich froh, daß Sie wieder zurück sind, Herr Major“, rief Kleinschmidt gegen den Lärm des Motors, ohne den Blick einen Augenblick vom Pfad vor ihnen zu nehmen. Nacke wußte, das war die Wahrheit. Der Obergefreite, kaum jünger als er, sah zu ihm auf, auch wenn der Major nicht so recht wußte warum. Jedenfalls konnte er sich auf KS blind verlassen, im Krieg eine Lebensversicherung. Er bedankte sich mit einer Handbewegung ohne das Gelände aus den Augen zu lassen.
Manchmal führte der Pfad, wie jetzt, ein Stück über die Krone des vernachlässigten Deiches. Nacke berührte seinen Fahrer am Unterarm. KS bremste, ließ die Motorradbrille am Hals baumeln. Gegen Einsicht vom anderen Ufer waren sie durch Weiden und Schwarzerlen geschützt, deren sattes Grün sich wohltuend vom Braun des verdorrten Steppengrases abhob.
Der Major suchte die riesige Ebene mit dem Glas ab. Weit hinten einzelne kahle Hügel. Sonst nichts. Keine menschliche Siedlung, nur schwarze Rauchwolken im Norden. Er streckte KS das Glas hin.
Jetzt, da der Motor schwieg, genoß Nacke die plötzliche Stille. Das Niedrigwasser des Flusses strömte leise, und nach einer Weile wagten die Vögel wieder zu singen. Er atmete tief durch und lauschte dem Wispern des Windes im Gras.
„Sehen Sie, Herr Major, die Stadt brennt immer noch“, riß ihn KS aus dieser Stimmung. Der Obergefreite löste seine Feldflasche vom Koppel und reichte sie hinüber. Nacke trank und grinste. Das Wasser war mit einem Schuß Wodka veredelt. Er hätte es sich denken können.
„Ja, das waren Stukas und Arados. Bin gespannt, wann wir dort Stahl erzeugen werden. Wissen Sie, daß die Stadt der größte Stahlproduzent der UdSSR war? Der Russe hat die Werke noch einmal mit Klauen und Zähnen verteidigt, meine ich. Oberleutnant Ricken sprach von erheblichen Verlusten auf unserer Seite.“
Ein Geräusch aus dem Westen ließ beide nach oben schauen. Als hätte ihre Erwähnung sie herbeigerufen, erschien, silbern in der Abendsonne, eine Formation Arados, des ersten Düsenbombers der Welt. Die Maschinen mußten kein feindliches Jagdflugzeug fürchten, aber ohnehin hatten die Düsenjäger Me 262, von allen nur „Schwalbe“ genannt, mit ihren R4M-Raketen den Himmel über Rußland von Ratatas und Jaks leergefegt.
Nacke erinnerte sich an die Erleichterung der Bodentruppen, als feindliche Aufklärer, Jäger und Bomber nach und nach verschwanden. Die absolute Lufthoheit war die Wende gewesen, zusammen mit der Beendigung der US-Rüstungslieferungen an die Russen nachdem die neuen Elektro-U-Boote die Atlantik-Schlacht gewonnen hatten.
„Die sind unterwegs zum sibirischen Industriegebiet um Nowosibirsk. Vorwärts KS. Ein Stück fahren wir noch.“ Er nahm die Kartentasche und notierte ihre Position. Kleinschmidt schob die Brille über die Augen, startete den Motor. Bald mußten sie den Deich verlassen. Unten umfuhr KS großräumig einen Windbruch. Sie stießen auf einen Pfad, dem sie nach Norden folgten.
Nach einigen Minuten spürte der Obergefreite wieder die Hand auf dem Arm. Er bremste, der Motor schwieg. Langsam legte sich der aufgewirbelte Staub. Nacke befahl mit einer Handbewegung Stille.
„MG-Salven“, wagte sich Kleinschmidt vor. Er hatte Recht. Entfernt, aber unverkennbar.
„Das schauen wir uns an.“
Der Obergefreite fuhr an. Sie rollten in der zunehmenden Dämmerung, links vom Deich gedeckt, langsam weiter. Das Geräusch der Feuerstöße, von längeren Pausen unterbrochen, wurde lauter. Sie waren jetzt deutlich zu orten, nördlich, am gegenüber liegenden Ufer.
Wieder hielt KS nach einer Geste des Majors. Der suchte kurz die Umgebung diesseits des Flusses mit dem Glas ab, sprang aus dem Beiwagen und rannte mit seiner MP gebückt den flachen Damm hinauf. Er ließ sich hinter ein Weidengebüsch sinken. Ein erneuter Feuerstoß. Ein deutsches MG 42, kein Zweifel.
Mit dem Glas schaute er hinüber zum jenseitigen Ufer, ließ es gleich wieder sinken. Seine Rechte fuhr über die Augen. Mit den Bewegungen eines sehr alten Mannes hob er das Glas erneut.
Wieder feuerte das MG und wieder stürzte eine Anzahl der am Ufer aufgereihten Zivilisten das Prallufer hinunter, Männer, Frauen und, ja, Kinder, manche in den Armen ihrer Mütter. Zwischen den Feuerstößen hörte er ihr Weinen und Schreien. Nacke setzte das Glas ab, sank kurz in sich zusammen. Er kam zu sich, rutschte die Böschung hinunter.
„Das MG. Schnell.“
Er überließ es dem Obergefreiten, es vom Beiwagen zu nehmen und rannte, vom Deich gedeckt flußaufwärts in Richtung der Exekutionen. Er warf sich ins trockene Gras, kroch den Deich hinauf und zwang sich, noch einmal hinüber zu sehen. Die MG-Stellung war auf gleicher Höhe. Die Bedienungsmannschaft trug Wehrmachtsuniform. Daneben stand breitbeinig ein Hauptmann mit gezogener Pistole und dirigierte das Blutbad.
Als er KS keuchend neben sich spürte, riß er ihm die schwere Waffe aus der Hand, preßte den Kolben in die Schulter. „Nehmen Sie den Gurt.“ Kleinschmidt warf dem Major einen Blick zu - und erkannte das vertraute Gesicht kaum wieder, bleich, wutverzerrt.
„Also doch“, hörte er ihn flüstern. „Die Wehrmacht erschießt Zivilisten, und die Mörder tragen unsere Uniformen.“
Der erste Feuerstoß verfehlte die MG-Stellung, der zweite hinterließ einen blutigen Haufen aus Fleisch, Knochen und wertlosem Metall.
Der Obergefreite hielt den Atem an. Mit dem Ausatmen entfuhr ihm das Wort, das allein dieser Situation angemessen war: „Scheiße“. Hatte sein Major gerade Kameraden erschossen? Als altes Frontschwein wußte er wann Ärger drohte. Er öffnete den Mund zum Protest, aber die Worte wollten sich nicht formen.
Der Hauptmann in nun blutbespritzter Uniform stierte auf den Haufen zu seinen Füßen. Ein Feuerstoß zersägt ihn, ehe er den Blick heben konnte. Die fünf Figuren der Postenkette fielen wie Dominosteine. Gespenstisch beleuchtete der Feuerschein der in Brand geschossenen drei LKW die Szene.
Nacke ließ das MG fahren, sackte in sich zusammen. Er wandte sich ab und kotzte ausgiebig und stöhnend in einen Horst Ringdisteln. Er verfluchte seinen sensiblen Magen, der ihn aber nicht gehindert hatte, sich das Ritterkreuz zu verdienen.
KS starrte zu ihm hinüber. Das Würgen und Röcheln vor und nach Kampfhandlungen war er gewohnt. Aber war der Chef nun verrückt geworden? Der Gurt fiel klirrend aus seinen Händen.
Wie gewohnt, ließ er den Major in Ruhe, nahm dessen Glas. Am anderen Ufer rannten und stolperten Zivilisten in alle Richtungen davon. Reglose Gestalten lagen an der Böschung, eine hing grotesk schwankend an einer aus dem Steilufer herausragenden Wurzel. Treibende Leichen verschwanden hinter einer Flußbiegung.
Prolog II
Von Winther betrachtete durch sein Monokel den vor ihm stramm stehenden schmalen mittelgroßen Mann, die Uniform tadellos sauber, wenn auch mit deutlichen Gebrauchsspuren. Das Ritterkreuz trug er wohl wieder in der Tasche. Wenn der Kerl nur ein bißchen anpassungsfähiger wäre. Er wischte mit seinem Taschentuch die Schweißperlen vom kahlen Schädel.
„Stehen Sie bequem, Nacke. Besser noch, Sie setzen sich.“
„Danke, Herr General.“
Der Major schob einen kaum noch gebrauchstüchtigen Holzstuhl mit Brandspuren zum mit Papieren beladenen Küchentisch, der dem Kommandeur der 22. Infanterie-Division als Schreibtisch diente. Der schaltete den Volksempfänger ein. Bald verschönte ein Wiener Walzer die Atmosphäre im einzigen bewohnbaren Zimmer des Blockhauses am Rande des Städtchens Sibaj. Die zerborstenen Fensterscheiben brachten keine Kühlung.
Der General schwieg und Nacke erinnerte sich an ihr letztes Gespräch in diesem Raum vor drei Tagen.
Von Winther hatte ihm aufgrund seiner Meldung einen vorgefertigten Bericht über den „Vorfall“ zur Unterschrift vorgelegt. Danach war er auf einer Erkundungsfahrt am Ufer des Flusses unter MG-Beschuß geraten und hatte das Feuer auf die offensichtlichen Partisanen in deutschen Uniformen erwidert. Kein Wort von den Erschießungen der Zivilisten.
Nacke hatte sich damals geweigert, den Massenmord unter den Tisch fallen zu lassen und damit des Generals Geduld einer harten Probe unterzogen.
„Ich dachte mir, daß das nicht einfach wird mit Ihnen. Also, seit ich gestern Abend durch Ihren Fahrer Ihre Meldung bekam, habe ich mich mit nichts anderem beschäftigt als mit diesem Mist. Sie scheinen nicht einmal zu wissen, was Sie angerichtet, in welchem Wespennest Sie gestochert haben. Sie müssen mir Zeit verschaffen, das zu regeln.“
So hatte Nacke schließlich widerwillig unterschrieben, aber zur Konsternation des Divisionskommandeurs gleichzeitig um seinen Abschied gebeten. Der hatte sich zunächst geweigert, diesen Unsinn auch nur zu diskutieren, ihm dann Bedenkzeit eingeräumt.
„Also, Nacke“, knurrte er nun. „Die drei Tage sind um, und um das gleich zu sagen, ich habe diese Zeit dringend gebraucht.“
Robert Nacke hatte schwere Tage und schlaflose Nächte hinter sich. Er war todmüde. Pochende Kopfschmerzen erschwerten die Konzentration. Selbst die Musik der Genies aus Wien peinigte ihn.
So ließ er sich Zeit und betrachtete den jenseits des Tisches sitzenden Menschen, als habe er ihn noch nie gesehen. Der massige Körper und der große Schädel ließen weder an den ehemaligen Ulanen-Offizier noch an alten Adel denken. Von Winthers Handeln jedoch hatte seine Herkunft immer verraten. Er verdankte dem General viel und ihn, der trotz des Rangunterschiedes ein väterlicher Freund geworden war, mußte er jetzt enttäuschen. Er richtete sich auf dem knarrenden Stuhl auf.
„Es tut mir sehr leid, Herr General, aber ich habe meine Meinung nicht geändert. Ich will diese Uniform ausziehen, die nun auch von Kindermördern getragen wird. Ich träume jede Nacht von diesem Grauen, sehe die Bilder, höre die Schreie, und ich bin ausgelaugt von diesem langen Krieg.“
Von Winther ließ das Einglas in die linke Hand fallen, rieb mit Daumen und Zeigefinger der Rechten seine Nasenwurzel und überließ eine Weile den Herren Strauß das Feld.
Er atmete schwer.
„Ich habe erwartet, daß Sie sich so entscheiden. Aber noch mal zu den Fakten. Diese Mörder gehören nicht zur Wehrmacht, obwohl sie leider unsere Uniform tragen. Diese ‚Einsatzgruppen’ sind“, des Generals Stimme wurde leise und bitter, „Verbrecherbanden aus SS- und Polizeieinheiten, sogar Zuchthäuslern. Unter dem Deckmantel der Partisanenbekämpfung sollen sie den Osten judenfrei machen und die russische Intelligenz und alles ‚Minderwertige’ vernichten. Sie sind keiner Wehrmachtsdienststelle verantwortlich oder unterstellt. Die Armeekorps und Divisionen wissen oft nicht, ob und wo sie in ihren Befehlsbereichen ihr Unwesen treiben.“
Er zündete umständlich eine Papyrossi an, sog den Rauch in die Lungen. Der strenge Geruch von Machorka verbreitete sich im Raum. Das goldene Feuerzeug klopfte den Takt des „Frühlingsstimmen-Walzers“ auf der Tischplatte.
Von Winther suchte die Augen des Jüngeren.
„Kommandeure im Generalsrang haben versucht, durch Proteste oder Eingaben den Verbrechen Einhalt zu gebieten. Höhere Ränge wurden entlassen, andere fielen vor Kriegsgerichten fiktiven Anklagen zum Opfer. Das, um Ihnen zu zeigen, daß nicht alle im Offizierskorps tatenlos zusehen, Proteste aber sinnlos sind und um Ihnen klar zu machen, was Sie unwissentlich angerichtet haben. Im Gegensatz zu unserem letzten Gespräch weiß ich jetzt, es geht um Ihren Kopf. Und der wackelt, selbst wenn Sie auf einen nur durchschnittlich begabten Militärjuristen als Ankläger treffen. Schließlich haben Sie aus deren Sicht eine Reihe von Kameraden gemeuchelt. Mit anderen Worten, es geht heute nicht darum, ob Sie aus dem Dienst ausscheiden und ob ich zustimme. Es geht um das Wie und Wann.“
Der General streifte die Asche an der rostigen Konservendose ab und sah dem Rauchwölkchen nach, das ein sanfter Luftzug durch den Raum trieb. Eine Weile gab er Nacke Zeit zu begreifen.
„Sie haben wieder unwahrscheinlichen Dusel. Erstens ist Ihr Regimentskommandeur im Urlaub. Der würde uns Schwierigkeiten machen. General Wolff, als Kommandeur des XXX. Armeekorps mein direkter Vorgesetzter, wie Sie wissen auch problematisch, ist in Berlin.“
Das Klingeln des Telefons unterbrach den General. Er lauschte eine Weile. „Danke, gut gemacht.“
„Unsere Taktik, den Vorfall selbst zu melden, war die einzig richtige. Ich hatte die Meldung per Kurier an die 11. Armee geschickt, an von Manstein persönlich. Er ist ein alter Freund von der Kadettenanstalt Lichterfelde. Der rief mich auf einer abhörsicheren Leitung an und tobte. Natürlich hat er den Unsinn mit den Partisanen nicht geglaubt. Für ihn ist das zunächst einmal Kameradenmord. Aber ich kenne ihn. Jedenfalls hat er bei seinem Armee-Kriegsgericht eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die im Sande verlaufen wird. Was sollen die Juristen tun? Es gibt keine Zeugen, und an den Generalfeldmarschall wagt sich niemand heran.“
Von Winther sah den draußen hin und her flitzenden Schwalben zu.
„Also höre ich Sie sagen. Wo ist das Problem?“
Er senkte die Stimme.
„Neben dieser offiziellen Seite gibt es noch eine andere. Die Vorgesetzten der von Ihnen Erschossenen sind nicht dafür bekannt, aufzugeben. Die können immer noch einen Partisanenüberfall oder einen Unfall inszenieren. Wäre nicht das erste Mal. Deshalb müssen Sie nicht nur von hier, sondern auch aus der Wehrmacht verschwinden. Sie sind der einzige Zeuge der Schießerei.“
„Und mein Fahrer? Major Becker hatte ihn zum Verhör mitgenommen.“
Der General drückte seine Zigarette aus und lächelte sparsam.
„Dieser Kleinschmidt ist Ihnen ergeben. Er wollte von keiner Schießerei wissen.“
Hinter dieser Behauptung vermutete Nacke mit Recht eine Frage.
„Wir sind seit Jahren zusammen, ich habe ihm das Leben gerettet, meint er.“
Der Wehrmachtssender hatte sich zu den „Geschichten aus dem Wiener Wald“ vorgearbeitet. Von Winther beugte sich vor.
„Bei der Fahrt hierher auf dem bewußten Krad gerieten Major Becker und ihr Obergefreiter in einen Hinterhalt. Sie wurden getrennt. Dem Chef der Divisions-Feldgendarmerie gelang die Flucht. Das Krad ging in Flammen auf. Trotz einer Suchaktion wurde der Obergefreite nicht gefunden. Der Mann gilt als vermißt.“
Als Nacke hochfahren wollte, hob der General die Hand, wurde noch leiser.
„Das ist die offizielle Version. Danach ist und bleibt Kleinschmidt verschwunden. In Wirklichkeit ist er mit falschen aber guten Papieren nach Orenburg gelangt und hat dort eine neue Identität erhalten. Wurde mit dem Telefonat gerade bestätigt. Er ist irgendwo in Rußlands Steppen und Wäldern. Wird wieder auftauchen, wenn sich der Staub gelegt hat.“
Robert Nacke war sprachlos. Erinnerungen an seine Ausbildung bei den Brandenburgern kamen wieder hoch. Er begann die Gefahr zu begreifen, in die er sich, Kleinschmidt und auch den General gebracht hatte. Welch ein Aufwand wurde da getrieben? Mit dem Zeigefinger der Rechten versuchte er einen pochenden Muskel unter seinem Auge zu beruhigen.
„Der Stabsarzt im Lazarett, der Sie bei Ihrer letzten Verwundung behandelt hat, war keine Leuchte seiner Zunft. Er hätte Sie nie k.v. schreiben dürfen. Ich habe hier ein neues Gutachten vom Armeearzt. Sie sind nicht mehr kriegsverwendungsfähig und scheiden aus dem aktiven Dienst aus, in Ehren und mit den üblichen Soldzahlungen. Die Armee regelt den Papierkram.“
Er ließ Nacke keine Zeit, das zu verdauen. Er drehte die Lautstärke der Musik herunter und lauschte. Jetzt hörte es auch der Major. Ein Flugzeug näherte sich brummend, eine kleine Maschine. Kurz darauf verstummte das Motorengeräusch.
Von Winther stand auf. „Kommen Sie.“
Als sie draußen jenseits der Posten waren, übergab er Nacke die Krankenakte.
„Das drüben“, er wies auf den Fieseler Storch auf einem Wiesenstreifen, der durch einen Windsack als Flugfeld ausgewiesen war, „ist ein Kurier-Flieger der Armee. Er bringt Sie nach Orenburg. Ihr Gepäck ist an Bord. Auf dem Behelfsflughafen dort wartet eine Ju 52, ein Verwundeten-Transport nach Kazan. Sie melden sich beim Piloten und nennen ihm das Codewort „Armageddon.“ Er bringt Sie in zwei Etappen nach Moskau.“
Nacke hatte Mühe, den Ereignissen zu folgen. Ehe er Fragen stellen oder Protest äußern konnte, hörte er den General:
„Je schneller Sie weg sind, desto besser für uns alle.“ Auf dem letzten Halbsatz lag eine leichte Betonung.
„In Moskau übernimmt Sie ein Kamerad und bringt Sie auf das ostpreußische Gut eines Freundes. Sie tauchen erst wieder auf, wenn das alles hier vorbei ist.“ Er machte eine umfassende Handbewegung.
Der General atmete tief durch, reichte Nacke die Hand.
„Machen Sie, daß Sie fortkommen, Robert. Alles Gute!“
Von Winther wandte sich um und schritt schnell davon. Nacke blieb nichts, als seinem straffen Rücken eine tadellose Ehrenbezeugung zu erweisen.
Frühjahr 1946
Kapitel 1
„Hüh, Lüwwert. Drückst Dich wieder, was?“
Von der Schmitze ermuntert legte sich der Kaltblüter ins Geschirr. Der Pflüger packte die Sterze fester.
Im dichten Hagen nebenan überschlugen sich die Stimmen der kleinen Sänger. Die Sonne wärmte und entlockte den frisch umgebrochenen Schollen Kindheitserinnerungen. Wie nahe war ihnen die Erde gewesen.
Über den schweißdunklen Kruppen der Füchse der Kirchberg. Die ersten Austriebe der Rotbuchen hatten seine Flanke mit grünem Schleier überzogen. Wilde Kirschbäume setzten weiße Tupfer. Bald würde der Bismarckturm über einem Blättermeer thronen. Da hinauf waren sie im Sommer mit den Eltern geklettert. Das blühende Heidekraut rechts und links des steinigen Pfades hatte nicht interessiert, denn in einer Bude neben dem massigen Turm aus Bruchstein warteten Brause oder Eis. Die seltenen Leckereien wurden nach Erklimmen der vielen Stufen im feuchtkühlen Turminneren auf der Plattform verzehrt, bei guter Sicht mit Blick auf Hermannsdenkmal im Süden und Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Porta Westfalica im Norden.
„Brrr“. Am Ende des langgestreckten Feldes hielt das Gespann. Peider schüttelte schnaubend Kopf und Mähne. Lüwwert fegte mit dem Schweif Bremsen von der Kruppe. Robert Nacke kippte den Pflug, wischte mit dem Handrücken über die Stirn und schob eine braune Strähne unter die Schirmmütze. Er wandte sich um und sah zufrieden auf die sauber ausgerichteten Reihen, auf die eine Staubfahne hernieder sank. Zwei Saatkrähen pickten in der Furche.
„Wieviel Korn hast Du getrunken?“ Der alte Niedermeier hatte gemurrt, als er seine ersten Versuche inspiziert hatte. Kein Wunder. In Ostpreußen hatten sie ihn nicht pflügen lassen.
Es hatte gedauert, aber nun waren seine Furchen wie vom Lineal gezogen. Daran wurde jeder Landmann gemessen, egal in welcher Provinz des Reiches. Inzwischen hatte er Freude an dieser Arbeit. Er liebte die Pferde und den Kontakt zur „Mutter Erde“.
Nacke schüttelte unwillig den Kopf. Blut- und Bodenromantik hatten die Nazis gründlich mißbraucht.
Er rückte die Leinen über der Schulter zurecht.
„Hüh, Peider, hüh, Lüwwert!“
Das weckte die dösenden Gäule. Er wendete das Gespann und dirigierte es in die Furche zurück. Die Füchse zogen mächtig an. Mit feinem Zischen zerschnitt die blanke Pflugschar den Ackerboden.
Im Tal Blomar mit dem grünen Turmhelm der neugotischen Kilianskirche, die ihn an seinen alten Pastor Hundertmark, an Taufe und Konfirmation erinnerte.
Seit er vor 10 Jahren gegangen war, hatte sich wenig verändert. Wie auch? Im Krieg war nicht privat gebaut worden. Hausbesitzer waren froh, mit den vorhandenen Mitteln den Verfall zu verhindern.
Zwischen Blomar und den Feldern lag der Voßhof unter einer mächtigen Eiche. In den letzten Monaten war ihm das Bild vertraut geworden. Viele Stunden hatte er in wohltuender Einsamkeit hier oben verbracht.
„Langweilst Du dich nicht, so allein?“, fragte seine Mutter.
„Aber nein! Ruhe und Einsamkeit tun mir gut.“
Er konnte ihr nicht sagen, welche Erinnerungen zu verarbeiten waren. Auch die genauen Umstände seines Ausscheidens hatte er für sich behalten.
Die Wochen in der melancholischen Landschaft Ostpreußens, die körperliche Arbeit und die Abende am See, allein mit Wasser, Wald und Wind, hatten Körper und Seele geholfen. Allmählich waren die Gesichter der Sterbenden blasser, ihre Schreie leiser, und die Albträume seltener geworden.
Nur ein Traum hatte ihn verfolgt, ihn stöhnend hochfahren und schweißgebadet erwachen lassen. Immer dieselbe Szene. Manchmal nach zwei oder drei ruhigen Nächten war die Hoffnung gekeimt, es sei vorbei. Aber noch jedes Mal hatte er sich getäuscht. Da waren wieder die Zivilisten am Ufer des Flusses, da war das Rattern des deutschen MGs.
Selbst bei der Feldarbeit kamen die Szenen hoch. Er verdrängte es nicht, und ganz langsam begann er es zu verarbeiten.
Ob ihm das je vollständig gelingen würde? Er wußte es nicht. Er konnte nur warten und hoffen - und sich fürchten vor der nächsten Nacht. Vielleicht hülfe Beten, doch das hatte er längst verlernt. Merkwürdig. Nach dem Verlust des christlichen Glaubens hatte er sich als Zwölfjähriger gut gefühlt, überlegen, von Zweifeln nicht geplagt. Er hatte schon als Kind viel von Logik gehalten und als ihm ein älterer Freund die Genesis zerpflückte, hatte er in jugendlicher Unbekümmertheit das gebrechliche Glaubensgebäude eingerissen und den Trümmern den Rücken gekehrt. Heute näherte er sich zögernd und zweifelnd wieder den Ruinen.
Der Verlust des anderen Glaubens, den an das Reich, an dessen geschichtliche Aufgabe, an die Berechtigung des Krieges mit allen seinen Begleiterscheinungen, hatte ihn hingegen leer und ausgehöhlt gelassen. Dabei hatte er dem Nationalsozialismus und seiner Ideologie nie angehangen. Er hatte das System hingenommen, manchmal verachtet, dann doch wieder respektiert. Es hatte eine starke Wehrmacht geschaffen. Sie würde Deutschland, auf das er stolz war, den Sieg erkämpfen. Sein Vaterland würde den Rang in der Welt einnehmen, der ihm zustand.
Gewiß, da waren Zweifel gewesen. Zu groß die Opfer der deutschen Soldaten, viel größer der Blutzoll der Gegner, von den Zerstörungen und Leiden der Zivilbevölkerung ganz zu schweigen. Konnte ein Ziel, wie groß auch immer, das alles rechtfertigen? Auch waren da immer Gerüchte gewesen. Sogenanntes minderwertiges Leben vernichtet, die Juden nicht nur deportiert, sondern ausgerottet. Die Unpolitischen im Offizierskorps hatten die Achseln gezuckt: Feindpropaganda das Meiste. Sicher, man wußte von Übergriffen der SS. Ein Krieg gegen die halbe Welt war kein Spaziergang. Aber für ihn hatte festgestanden: Die Ehre der Wehrmacht war unbefleckt. Sie führte bei aller Härte einen anständigen Krieg. Und dann kam der nächste Sieg, die nächste Schlacht, die nächste große Aufgabe. Wer mochte sich mit Gerüchten befassen? Bis jener Sommerabend seine nagenden Zweifel auf das fürchterlichste bestätigt hatte.
Und er hatte erkannt, daß es Leute im System gab, die auch gegenüber der Wehrmacht vor nichts zurückschreckten. Er war einsam geworden. Das Militär war seine Heimat gewesen.
In den Wochen auf Groß Balgastein hatte er nichts gehört, auch nicht vom General, bis dann im Herbst ein Kradkurier kam, das alberne „Armageddon“ murmelte und ihn mit seinen Habseligkeiten zum nächsten größeren Bahnhof brachte, dem Ausgangspunkt einer langen Bahnfahrt.
Motorengeräusch unterbrach seine Gedanken und lenkte seinen Blick auf die hundert Meter entfernte Landstraße. Von Bretrup herunter kommend, war ein Wehrmachtskrad jetzt auf seiner Höhe, verlangsamte die Fahrt und bog nach links in den zum Voßhof führenden Feldweg ein. Ein Krad! Die Erinnerung an jenen Abend im Ural kam wieder hoch.
„Brrr!“ Wie immer befolgten die Füchse dieses Kommando willig.
Ein Wehrmachtskrad auf dem Voßhof? Ungewöhnlich! Hierher verirrte sich nur selten ein motorisiertes Fahrzeug. Autos, Krafträder und Treibstoff waren knapp. Und was hatte Niedermeier mit der Wehrmacht zu tun? Er spürte Unbehagen.
Unten an den Kopfweiden des Teiches stoben schnatternd die Enten auseinander. Ein Soldat im Kradmantel stapfte über die mit Butterblumen gelb getupfte Wiese des Baumhofes zwischen weiß heraufleuchtenden Stämmen den Hang hinan. Der Mann am Pflug sah ihm mit wachsender Unruhe entgegen. Vor ihm angekommen absolvierte der Landser eine tadellose Ehrenbezeugung und meldete, wie auf dem Kasernenhof:
„Obergefreiter Krause mit einer Nachricht für Herrn Major Nacke von Herrn Hauptmann de Wendt.“
Er streifte einen Stulpenhandschuh ab und holte aus der Innentasche seines Mantels einen Umschlag ohne Anschrift und Absender.
Rüdiger de Wendt war der einzige Kontakt zu den ehemaligen Kameraden. Seit seiner Kommandierung zum Wehrkreis in Münster, waren sie sich auch geographisch näher.
„Rühren“, sagte der Landmann mechanisch - und ärgerte sich. Warum spielte er mit bei dieser Komödie? Das war Kabarett. Er mußte lächeln. ‚Ganz Rüdiger’, dachte er.
Er schlang die Leinen um die Sterze, wischte seine Rechte an der blauen Arbeitshose ab, riß den zerknitterten Umschlag auf. Ungläubig las er die in Druckschrift auf neutralem Allerweltspapier verfaßte Nachricht.
Kapitel 2
Die Kartoffelschale ringelte sich in gleichmäßiger Spirale ehe sie in den Eimer platschte. Ohne ihre Arbeit zu unterbrechen blickte Hanna Tölke mitleidsvoll auf die schlanke Gestalt ihrer Tochter am Fenster.
Wie so oft in letzter Zeit fiel ihr auf, daß Lina den linken Oberarm massierte. Sie hatte die Schürze abgelegt und spähte seit 10 Minuten hinter der Tüllgardine die Straße hinunter in Richtung Kilianskirche. Erfkamp war spät heute.
Ihre Mutter in der schwarzen Kleidung älterer Lipperinnen unterdrückte einen Seufzer und fischte die nächste Kartoffel aus dem kalten Waschwasser. Jeden Morgen die gleiche Szene. Sie wußte, das Milchholen, früher willkommene Abwechslung mit Gelegenheit zum Klatsch, war für Lina zur Qual geworden. Einige Nachbarinnen, selbst solche, mit denen sie sich damals gut verstanden hatten, gingen auf Distanz. Schon das schmerzte. Andere ließen hämische Bemerkungen fallen. Dem hatte Lina nur Schweigen entgegenzusetzen, nachdem sie ein- oder zweimal quälende und für sie verletzende Diskussionen entfacht hatte mit verheerenden Folgen für ihr angeschlagenes Selbstbewußtsein. Niemand war ihr beigesprungen. Das Beste, was sie erwartete war peinliches Schweigen.
Ihr selbst blieben bei Einkäufen in Fräulein Dröges Kolonialwaren-Laden auf der anderen Straßenseite oder bei Begegnungen in der Stadt ähnliche Erlebnisse nicht erspart. Ihr Angebot, die Milch zu holen, hatte Lina abgelehnt. Es ging um ihren Sohn. Sie wollte sich nicht drücken.
Leises Summen des Wasserkessels und das Knacken der Scheite im Herd verstärkten die lastende Stille in der Wohnküche. Hanna Tölke hielt es nicht länger in ihrer Ecke. Die halb geschälte Kartoffel fiel in den Eimer zurück. Sie schüttelte die Schürze aus. Mit unbewußter Geste fuhr ihre Hand über die mit einem Mittelscheitel straff nach hinten gekämmten grauen Haare. Sie ging zu ihrer Tochter hinüber und legte ihr wortlos die Hand auf die Schulter, ehe sie am Herd ein Holzscheit in die Flammen schob. Ärgerlich rieb sie beißenden Qualm aus den Augen und wischte mit ihrer Schürze einen nur in ihrer Einbildung vorhandenen Fleck auf der mit Ruß blank polierten Herdplatte weg.
Gedämpftes Schellen auf der Straße. Es wirkte elektrisierend auf Lina. Sie stieß sich vom Fenster ab, riß den emaillierten Milchtopf vom Küchentisch, rannte aus dem Zimmer ohne die Tür zu schließen und flog die Treppen hinunter. Heute mußte es ihr gelingen, zuerst am Milchwagen zu sein. Sie riß die Haustür auf und sah - sie war zu spät.
Der altgediente Braune hielt, auch ohne Kommando, wie jeden Tag vor Krachts Haus, den Nachbarn zur Linken. Erfkamp wickelte gerade die abgegriffenen Zügel um die Bremse am Bock und legte die Glocke zur Seite, als Paula Helwig mit energischen Schritten aus dem Krachtschen Haus trat, in dem sie zur Miete wohnte. Linas Fuß stockte. Das Verhältnis zu dieser Frau, Leiterin der Blomarer NS-Frauenschaft, war nie herzlich gewesen. Jetzt aber tat sich die überzeugte Nationalsozialistin mit herabsetzenden Äußerungen und übler Nachrede besonders hervor.
Aber es half nichts. Sie ging mit gesenktem Kopf über den Plattenweg und durch das Gartentörchen zum Wagen. Ihr „Moin“ wurde von Erfkamp freundlich erwidert, wie immer. Paula, schon angekommen, antwortete mit schneidigem „Heil Hitler“, wobei sie ihre Nachbarin aus Basedow-Augen herausfordernd anschaute, ehe sie dem Milchmann den Topf hinhielt.
„Das Übliche“. Das kam militärisch knapp. Ihre Linke überprüfte den Sitz der Dauerwelle.
Erfkamp, mit der Arroganz dieser Kundin vertraut, fuhr gleichmütig mit seinem verbeulten Aluminium-Meßbecher in eine der großen Milchkannen und ließ einen Liter Vollmilch in den Milchtopf der Kundin rinnen. Lina atmete auf, doch zu früh.
Während sie dem untersetzten Milchmann ihren Topf hinhielt, schlurfte in Puschen die wegen ihrer scharfen Zunge gefürchtete alte Epmeier von gegenüber heran.
„Moin, Paula, moin Heinrich. Da kriegt der Ritterkreuzträger aber gute deutsche Vollmilch. Ja, ja, Heldentum ist anstrengend.“
Ihr meckerndes Lachen ließ die vereinzelten schwarzen Haare am Kinn zittern. Lina Nacke spürte, wie sich ihr Gesicht mit Röte überzog. Sie gab Erfkamp eilig das abgezählte Geld und hastete ohne Gruß mit hochgezogenen Schultern, die Augen auf dem Boden, zurück.
„Wiedersehen, Frau Nacke“, rief ihr der Milchmann nach.
Im Weggehen hörte sie Paula. „Wohl weniger das Heldentum als das Mistfahren. Was Sofie?“ Hämisches Gelächter verfolgte Lina bis in ihren gepflegten Vorgarten.
Mit zitternden Händen öffnete sie die Haustür, im Unterbewußtsein den notwendigen Neuanstrich registrierend. In der Veranda blieb sie stehen, unterdrückte die aufsteigenden Tränen und legte die Stirn an die kühle weißgetünchte Wand.
Warum konnte sie das nicht überhören? Warum ging ihr die Hetze so unter die Haut? Den Männern schien das nicht viel auszumachen, oder sie zeigten es nicht. Ihre Linke fuhr zum Herzen.
Sie gab sich einen Ruck und stieg wie eine alte Frau die Treppen hinauf, mußte stehenbleiben. Um sich abzulenken, zwang sie sich zum Nachdenken darüber, wie die ausgefransten Kanten des Läufers zu säumen seien.
In der Wohnküche saß ihr Vater im langärmeligen Flanell-Unterhemd am Tisch. Die Hosenträger hingen schlampig herunter. Wilhelm Tölke hatte die Arme aufgestützt und sog schlürfend ein eingeweichtes Weißbrotstück zwischen die schadhaften Zähne. Er ergänzte den Bissen genüßlich mit einem Stück Leberwurst. Milchkaffee rann über die weißen Kinnstoppeln. Lina atmete tief durch. Plocken konnte man auch dezenter essen. Sie wich dem prüfenden Blick seiner hellblauen wäßrigen Augen aus.
Tölke, allenfalls mittelgroß, war trotz seiner 66 Jahre schlank und drahtig, im Gegensatz zu seiner rundlichen Frau. Als ehemaliger Ziegler hatte er sich eine Vorliebe für deftiges Essen, die die lippische Küche immer befriedigte, und für Kautabak sowie Korn in flüssiger Form erhalten, beides Produkte, die von den Frauen des Hauses nicht geschätzt wurden. Sein weißer Schnurrbart zeigte häufig Spuren schwarzen Priems, der zum Bedauern der Frauen in ausreichender Menge zu beschaffen war, im Gegensatz zum Branntwein.
Er ließ den Löffel in den Kump sinken. Mit Zeigefinger und Daumen der Linken massierte er sein Kinn, während er der einzigen Tochter nach sah, die in der engen Speisekammer verschwand. Er hörte sie die Milch in den Fliegenschrank stellen, ehe sie hervorkam und wortlos die Wohnküche verließ.
Nach kurzem Zögern folgte seine Frau. Sie fand Lina im Schlafzimmer weinend auf dem noch nicht gemachten Bett sitzend. Ihre Mutter setzte sich zu ihr und, seltene Geste bei ihnen, legte einen Arm um ihre Schultern.
„Luit, luit, warum ärgerst Du Dich so? Haben die Dich wieder angegriffen?“ Und ohne eine Antwort abzuwarten, sehr bestimmt, „Jetzt ist Schluß. Morgen hole ich die Milch.“
Sie konnte es nicht äußern, dachte aber kummervoll an die eine oder andere unbedachte Bemerkung, die Lina zur Zeit ihres größten Triumphes entschlüpft war. Und jetzt war Zahltag. Hätte sie nur das alte Wort bedacht, daß nämlich Hochmut vor dem Fall kommt. Schadenfreude freilich hätte es auch so gegeben. Für die „Leute“ war der Abstieg des jungen Nacke vom Major und Ritterkreuzträger zum Knecht ein unerschöpfliches Gesprächsthema bei der Arbeit, beim Einkaufen und am Stammtisch.
„Wie konnte Robert uns das nur antun?“ Lina schluchzte. „Er mußte doch wissen, was das für uns bedeutet. Diese Schande, die Blamage! Hätte er nicht mal an uns denken können?“
Ihre Mutter schaute unwillkürlich hinauf zum Herrn Jesus über dem Bett, der in blauem Gewand segnend durch ein Ährenfeld schritt. Aber an dessen Hilfe glaubte sie nicht so recht. Der Farbdruck war ein Entgegenkommen an den Zeitgeschmack und kein Ausdruck tiefer Religiosität.
Die Schluchzer ließen nach. Die alte Frau seufzte. Täglich diese Diskussionen! Hanna Tölke fand es immer schwerer, Lina zu verstehen und zu bemitleiden. Sie zwang sich, ruhig zu bleiben.
„Da bist Du aber sehr egoistisch. Er hatte seine Gründe. Ich verstehe sie ja auch kaum. Aber es ist schließlich sein Leben, und auf dem Voßhof ist er glücklich. Meinst Du nicht, Du solltest froh und dankbar sein, daß er heil zurückgekommen ist?“
„Ihr versteht mich alle nicht.“
Sie rückte von ihrer Mutter ab. „Keiner versteht mich“, schrie sie plötzlich. „Und wirf Du mir Egoismus vor. Robert ist fast nur noch auf dem Hof, schläft sogar dort. Als hätte er vergessen, was wir alles für ihn getan haben. Fritz hat nur noch seine Schmiede im Kopf und Opa blamiert uns wo er kann mit seinem ewigen Priem, den Zieglergeschichten und der unordentlichen Kleidung.“
Tölke nahm seine Mahlzeit wieder auf, als er Lina laut werden hörte. Einzelheiten verstand er nicht. Doch das war unnötig. Immer dasselbe. ‚Vermuckte Wuiver’, dachte er. Wie seine Frau verfiel er immer wieder in das lippische Platt, was seine Tochter primitiv fand. Er schlürfte vorsichtig den Rest des heißen Kaffees.
Und gleich würde sie die Betten machen. Das überließ sie nicht ihrer Mutter. Alle Kissen und die Oberbetten wurden sauber ausgerichtet, die Laken faltenfrei gestrichen. Schlimmer als bei den 55ern. Und das alles mußte bis spätestens 10 Uhr erledigt sein. Sonst galt man als schlechte Hausfrau. Verdammter Unsinn. War aber den Weibern nicht auszureden.
Am meisten ärgerte ihn die ewig gleiche Begründung bei allen Gelegenheiten: ‚Was sollen die Leute denken?’ Zum Teufel mit den Leuten.
Im Gegensatz zu seiner Frau, die Lippe nie verlassen hatte, war Tölke für einen Lipper herumgekommen in der Welt. Er hatte in Sachsen, am Niederrhein, sogar in Holland und Dänemark Ziegel gemacht, zuletzt als selbständiger Zieglermeister. Nach Jahrzehnten harter Arbeit war er gern für immer heimgekehrt, aber manchmal kam ihm diese Kleinstadt doch miefig vor.
Trotz seines Unmuts begann er sich um Lina Sorgen zu machen. Verdammt schmal war sie geworden. Warum mußte sie sich das dämliche Gerede der Weiber so zu Herzen nehmen? Aber er würde wie üblich den Mund halten. Das war ein heikles Thema.
So wischte er mit dem Handrücken über Mund und Schnurrbart und drückte sich mit den Händen auf dem Tisch hoch. Jetzt im Frühling war im Garten viel zu tun. Er schob die Hosenträger über die Schultern. Im Flur griff er in die Hosentasche und beförderte eine kleine Blechdose und ein Taschenmesser zutage. Er schnitt ein deftiges Stück des schwarzen Kruse Kautabaks ab und schob es mit Behagen hinter einen der verbliebenen Backenzähne.
Unten in der Waschküche nahm er die ausgebleichte Schirmmütze und die grüne Drelljacke vom Haken. Er horchte hinüber zum Schweinestall. Alles in Ordnung. Die beiden Stangenschweine grunzten und schmatzten, offenbar zufrieden mit dem Futter, das er ihnen noch vor dem Frühstück serviert hatte.
Er schleuderte die Puschen achtlos zur Seite, trat in Holsken vor die Tür und schnupperte, wieder versöhnt mit dem Leben, die prickelnde Frühlingsluft.
Kapitel 3
‚Wichtig! Der Mann bringt Dich zu mir. Er ist zuverlässig. In einer Stunde bist Du zurück. Sag Deinem Bauern, Du müssest zu einer Dienststelle in Rinteln. Bitte um Vertraulichkeit. PS.: Verbrenne dies!’
Keine Unterschrift. Nacke war ratlos. Warum diese Geheimniskrämerei? Wie konnte er das Gespann verlassen? Er sah vom Zettel in seiner Hand auf und in das ausdruckslose Allerweltsgesicht des Obergefreiten, runzelte die Stirn. Es war der Stil seines Freundes. Doch das bedeutete nichts.
Krause, wenn das sein richtiger Name war, tat einen tiefen Atemzug und straffte sich. „Ich habe noch eine mündliche Nachricht.“
Er schloß die Augen und sprach langsam und überdeutlich „Tübis or not Tübis säts se kwästschen“.
Robert Nacke starrte ihn verständnislos an. Dann dämmerte es. Er lachte auf, seine Anspannung für einen Moment vergessend. Das räumte jeden Zweifel aus. ‚Tubize or not Tubize, that is the question’. In Tubize, einem kleinen Nest in Belgien, hatte ihre Einheit 1941 gelegen. Rüdiger, immer schlagfertig und seinen Shakespeare im Kopf, hatte zu beider Vergnügen das Hamlet-Wort entstellt. Ein privater Scherz unter Freunden.
Krauses wieder geöffnete Augen guckten gekränkt.
Nacke konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. „Entschuldigen Sie, Obergefreiter. Das gilt nicht Ihnen, sondern heiteren Erinnerungen.“ Und, wieder ernst, „wo finden wir Hauptmann de Wendt?“
„Herr Hauptmann wartet nördlich von hier. Wir brauchen mit dem Krad 10 Minuten.“ Krause sprach so steif, wie er stand.
Ein letzter Blick auf den Boten. Robert Nacke nickte. „Gut, ich komme, muß aber erst den Bauern holen. Halten Sie mal die Pferde.“
Ohne auf eine Reaktion zu warten, drückte er dem Landser die Leinen in die Hand, rannte hinunter zum Hof.
Am Scheunentor schlug Niedermeier den langen Nagel mit wuchtigen Schlägen bis zum Kopf ein, ehe er sich mit argwöhnischer Miene umwandte. Der alte Hofhund kam steifbeinig aus der Sonne herüber und rieb seinen Kopf an Roberts Bein. Sein einjähriger Sprößling sprang an ihm hoch.
„Hasso, Lux, bei Fuß“. Die Schäferhunde gehorchten dem Alten sofort.
„Es tut mir leid, Vater Niedermeier, aber ich muß mit dem Mann in einer dringenden Angelegenheit zu einer Dienststelle nach Rinteln.“
Der Jüngere hatte sich noch nicht an diese Anrede gewöhnt. Niedermeier war von Herkunft und Biografie her ein spröder Mann. Robert war stolz gewesen, als er ihm kürzlich das ‚Du’ angeboten hatte. Aber Respekt und Altersunterschied machten es ihm schwer, ihn mit Vornamen anzureden. Die lippische Formel für solche Fälle paßte gut.
Er fügte schnell hinzu: „Ich denke, ich bin in einer guten Stunde zurück. Willst Du weiterpflügen oder soll ich ausschirren?“
Niedermeiers Backenknochen traten hervor, als seine Zähne das Mundstück der vergammelten Stummelpfeife fester packten. Die grauen Augen bohrten sich in Roberts. Der bemerkte mit Besorgnis die erhöhte Frequenz der aufsteigenden Tabakwölkchen, wie bei einer fahrtaufnehmenden Dampflok. Sie waren Freunde geworden in den vergangenen Monaten und verkehrten als Gleiche miteinander. Aber der Alte haßte es, eine einmal begonnene Arbeit zu unterbrechen, einen Plan zu ändern. Das schätzte der Bauer so an seinem neuen Knecht, daß er die Zuverlässigkeit in Person war. Vielleicht war es die Erinnerung daran, die ihn dazu bewog, bedächtig den Hammer auf den Bretterstapel neben die verrostete Konservendose mit den Nägeln zu legen. Er wischte mit dem mehrfach geflickten Ärmel seines Arbeitskittels über die Stirn, nahm die Pfeife aus dem Mund, spuckte aus.
„Ist gut. Ich pflüge weiter“, brummelte er.
Dann, Robert noch einmal prüfend anblickend: „Hoffentlich nichts Schlimmes?“
„Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es wäre gut, wenn mein kleiner Ausflug unter uns bliebe.“
Schon auf dem Weg rief der Alte über die Schulter zurück: „Kein Problem. Wir sind ja heute allein.“
Das stimmte gottlob. Grischa und Igor, waren mit dem zweiten Gespann unterwegs.
Robert sah dem Bauern gedankenvoll nach. Seine Holzschuhe klapperten über das Kopfsteinpflaster, verstummten auf dem Weg zu den Äckern hinauf.
Der 66-jährige war noch rüstig, aber der Verlust beider Söhne im Krieg und der Tod seiner Frau hatten ihn gebeugt. Manchmal schien der Bauer ein wenig aufgelebt seitdem er, sozusagen als Lehrling, auf dem Hof war. Niedermeier war ein guter Landwirt und strenger Lehrmeister. Es schien ihm Freude zu machen, seine Kenntnisse weiterzugeben, und der Hof, bisher nur mit Hilfe der beiden Russen in Gang gehalten, profitierte von ihrer Zusammenarbeit.
Am großen Fachwerkhaus kratzte Robert, bemüht einer von Ernas Gardinenpredigten zu entgehen, auf dem Holzrost vor der Schwelle den gröbsten Dreck von den Stiefeln. Trotzdem hinterließ er auf dem Weg zu seiner Kammer Spuren auf den großen Steinplatten der Deele. Dort saß er mit dem Bauern manchmal abends am offenen Feuer bei einem Glas Doppelkorn. Sie sprachen emotionslos über unverfängliche Themen, und er fühlte, wie einsam der alte Mann war.
Im weiß gekalkten Raum verriegelte er die Tür, zog die rotweiß karierten Vorhänge vor das Fenster. Er kniete nieder, stieß die Klinge seines Taschenmessers in die Fuge zwischen zwei Dielenbrettern aus altersschwarzer Eiche, hob eines an. Er nahm die Tokarev TT 33 aus dem Versteck, überprüfte sie routiniert und steckte sie hinten in den Hosenbund. Eines der Reservemagazine schob er in die Hosentasche. Er trat die Diele fest, zog die Vorhänge zurück, verließ Kammer und Haus mit schmalem Mund. Mit ihm würde es kein plötzliches Verschwinden, keinen „Unfall“ geben.
Aus der dunklen Kühle des Fletts kommend, blinzelte er ins Sonnenlicht und entspannte sich. Zum Teufel mit den finsteren Gedanken. Es war Frühling.
Die Gäule hatten einen unversehrten Krause entlassen. Er stand an seiner Maschine und trommelte mit den Fingern der Rechten auf den Sattel, doch Robert wusch erst am Brunnentrog den Dreck von den Stiefeln. Es verdroß ihn, schmutzig und in Arbeitskleidung davonzufahren.
Auf dem Weg zum Krad fiel ihm das verschmutzte hintere Nummernschild auf, das nicht zu entziffern war. Er sah hinüber zur Straße. Wegen einiger Windungen des von Büschen gesäumten Feldweges war das Motorrad von dort aus unsichtbar.
Der Obergefreite richtete sich erleichtert auf, griff in eine der Packtaschen und hielt Robert einen Kradmantel hin.
„Darf ich Herrn Major hinein helfen?“ Und, seinem Vorschlag Nachdruck verleihend, „ausdrücklicher Wunsch von Hauptmann de Wendt“.
Robert blickte verständnislos auf dieses Ungetüm, das für ausgesprochen schlechtes Wetter konzipiert war und einen intensiven Gummigeruch ausströmte. Unter der Frühlingssonne würde er noch mehr schwitzen.
Doch er ließ sich schicksalsergeben in den schweren Mantel helfen. Rüdiger tat nichts ohne Grund. Widerspruchslos nahm er auch die Motorradbrille, streifte sie über und saß auf.
Während sie, von einer Staubfahne verfolgt, den Feldweg entlang und die Straße hinauf in Richtung Bretrup knatterten, hatte er Muße, über die Umstände dieses Treffens nachzudenken. Ein flüchtiger Beobachter würde auch ihn für einen Wehrmachtsangehörigen halten, zumal seine von der Landbevölkerung gern getragene grüne Schirmmütze der Feldmütze des Heeres sehr ähnlich war. Das Versteckspiel irritierte ihn. Ob Rüdiger immer noch oder wieder bei der Abwehr war? Sie hatten gemeinsam eine Sonderausbildung bei den Brandenburgern absolviert, aber Rüdiger war nicht zu ihrer Stammeinheit zurückgegangen. Nervös zog er die Mütze tiefer in die Stirn.
Hinter Bretrup fuhren sie in scharfem Tempo in Richtung Asenschanze, zu der die Straße in engen Spitzkehren emporkletterte. Hier mußte Krause Gas wegnehmen, doch heute hatte Robert für die herrliche Aussicht auf Blomar und Umgebung keinen Blick. Einmal oben, beschleunigte der Fahrer wieder. Bald lag auch die Höhensiedlung Windhagen hinter ihnen, und sie brausten auf schnurgerader Straße durch Papenhagen, ein lang gezogenes Straßendorf, den Berg wieder hinunter.
Kaum Verkehr. Gelegentlich ein Pferdefuhrwerk oder ein Radfahrer. Um diese Tageszeit waren die Frauen in Haus und Küche, die Kinder in der Schule. Die Männer arbeiteten auf den Feldern. Gestank von Gülle stieg ihm in die Nase.
Krause konnte sein schnelles Tempo beibehalten. Die herrlichen Rotbuchenbestände beiderseits der Straße, gesäumt von weiß blühenden Schlehenhecken, flogen vorbei. Weiter ging es nach Nordosten. Sie passierten Lüerheide, und die Straße führte wieder bergan in Richtung Hohenhausen.
Die Sonne brannte. Robert schwitzte heftig. Der Fahrtwind kühlte nur Gesicht und Hände.
Es wurde noch einsamer. Bald waren sie auf einem weiteren Höhenzug, rechts begleitet von einem Wiesental. Vor dem Hintergrund großer Mischwälder auf den Höhen leuchteten die Ziegeldächer vereinzelter Höfe. Das Gelb der Butterblumen und das Weiß des Wiesenschaumkrauts überzog die Weiden. Jenseits des vor ihnen liegenden Tales erhob sich der gedrungene Turm der Pfarrkirche von Talhausen. ‚Hat als Schutzpatron den Heiligen Paulus, ging es Robert durch den Sinn, und: ‚Turm romanisch - um 1150. Er hatte sich in den vergangenen Monaten mit den Baudenkmälern seiner Heimat beschäftigt.
Die Straße wand sich nun in Kehren bergab, und noch einmal konnte Robert die meisterliche Kurventechnik seines Fahrers bewundern. Er dachte an KS. Wo mochte der sein? Auch diesen Freund hatte er verloren.
Gerade als er sich fragte, wo die Reise ende, bremste Krause im Talgrund und hielt auf dem Scheitelpunkt einer scharfen Rechtskurve an. Er sah kurz um sich. Wortlos lenkte er das Krad auf einen links im rechten Winkel auf die Straße treffenden schmalen Waldweg, der wegen dichter Büsche an der Einmündung leicht zu übersehen war. Durch einen blau-weißen Teppich aus Lerchensporn führte der Weg unter den Rotbuchen zunächst den Talgrund entlang, dann bergan und verschwand in einer dichten Fichtenschonung auf der Höhe. Nach etwa 100 Metern verstummte der Motor. Die plötzliche Stille war erschreckend bis Robert die Stimmen des Waldes wahrnahm.
Kapitel 4
In der rußschwarzen Schmiede „An den Kämpen“ nahm Fritz Nacke das Flacheisen mit der großen Zange vom Amboß und schob es wieder in die Glut. Er horchte nach draußen, ehe er den ledernen Spitzblasebalg trat. Es war gleich halb acht, und sein neuer Lehrling war nicht erschienen. Das war ungewöhnlich. Helmut Detering hatte Interesse gezeigt.
‚Ein bißchen dürr, der Junge, aber anstellig. Na, wird krank sein, mutmaßte der Schmied. Und, ‚wenn das man nicht einreißt.
Er nahm das gelbrot glühende Eisen aus dem Feuer, legte es nach prüfendem Blick auf den zweihörnigen Amboß. Es verformte sich unter den zielsicheren Schlägen des schweren Hammers. Nacke arbeitete konzentriert. Plaßmeier wollte die Wagenbeschläge gegen 9 Uhr abholen. Wieder schob er das Eisen in die Glut.
Noch ehe er den Blasebalg treten konnte, knirschten Schritte auf dem Vorplatz, verhielten vor der offenen Tür. Der Schmied erkannte Karl Deterings breite Silhouette.
„Korl, kumm herrin. Heuer mol, wo ess de Bengel? Krank?“
Detering schob sich zögernd näher. Nacke hielt ihm den rechten Ellenbogen zur Begrüßung hin während fauchend die Luft aus dem Blasebalg in die Glut fuhr. Funken sprühten.
Der Besucher berührte kurz den schwarz behaarten muskulösen Unterarm und murmelte ein „Moin.“ Nacke hielt den Arbeiter in einer Pantoffelfabrik für einen Schwätzer. Doch heute schwieg er. Deterings Augen hafteten auf seinem derben Schuh, der mit einem Stück schwarzer Schlacke spielte.
„Gong mol do dänne“, brummte der Schmied, schroffer als beabsichtigt. Während die Zange das Werkstück wieder auf den Amboß schob, fragte er: „Was ist los mit Dir? Das ist keine Schande, wenn der Junge einen Tag fehlt.“
„Also, äh,..ehm, er will eigentlich überhaupt nicht mehr kommen.“
„Was heißt das?“, fragte Nacke scharf. „Hör mal, der Junge hat Interesse an der Arbeit“.
Detering schluckte.
„Ja, ja, vielleicht, aber das hier ist trotzdem nichts für ihn. Jedenfalls wird er nicht mehr kommen.“
Nacke vergaß einen Augenblick, den Blasebalg zu treten. Sein Erstaunen wandelte sich in Zorn. Der Kerl log, das war offensichtlich. Er atmete tief durch und fuhr mit seiner Arbeit fort.
„Sag mir den wahren Grund“, forderte er ruhig. „Und erinnere Dich, Du hast mich angefleht, Deinen Jungen in die Lehre zu nehmen.“
Detering ersehnte einen Ortswechsel. Er wischte den Schweiß von der Stirn, mit einem großen weißen Taschentuch, das längst in die Waschmaschine gehörte. Nacke bearbeitete das Eisen. Das verschaffte dem Besucher Zeit. Als das Werkstück abermals im Feuer war, setzte er wieder an.
„Ja, also, nun ja, da ist das Gerede um Deinen Sohn.“ Er hob abwehrend die Hände. „Ich gebe ja da nichts drum, aber die Leute, und Minna meint auch...“
Seine Stimme versagte, als der Schmied sich ihm, den Hammer in der Faust, voll zuwandte.
„Raus!!“
Detering pfiff auf jede Selbstachtung und stürzte aus der Tür. Der Schmied sah ihm, den Hammer halb erhoben, nach. Das war unglaublich, dieser Quatsch. Lina hatte schon zu leiden. Jetzt ging es auch hier los. „Aber nicht mit mir“, brummte er. Heftig sauste der Hammer im Wechsel auf Werkstück und Amboß. Funken sprühten auf seinen Lederschurz.
Nach einigen Schlägen ließ sein Zorn nach. Seine Reaktion erinnerte ihn an Robert, der als Junge nach jedem Anpfiff und jeder Ohrfeige Eierbriketts im Keller zertrümmert hatte. Nach einer Weile war er kohlegeschwärzt wieder aufgetaucht und hatte ein neues Problem, diesmal mit Muttern. Nacke konnte über den kleinen Psychologen immer noch schmunzeln.
Er hob sein Werkstück ins Licht und nickte. Zischend fuhr das Eisen ins Wasser. Dampf stieg auf. Im Schraubstock beseitigten große und kleine Feilen Grate, brachen Kanten. Seine schwielige Hand fuhr prüfend über den Beschlag und legte ihn zur Seite. Nach einem entsagungsvollen Blick auf die Flasche Schöttker Wacholder im Regal, griff er zur verbeulten Aluminium-Feldflasche, die längst ihren braunen Filzbezug eingebüßt hatte. Na ja, Wasser ging auch.
Er spuckte in die Hände und begann ein neues Stück. Der Sonnenfleck, der die verrußte Scheibe eines der Fensterchen durchdrungen hatte und auf dem Amboß ruhte, wanderte unmerklich weiter. Draußen klingelte hin und wieder ein Radfahrer oder ein Fuhrwerk rumpelte vorbei. Aber niemand rief ein „Moin“ durch die offene Tür und blieb stehen, um ein bißchen zu klönen wie früher. Nacke traf das nicht weiter, doch die Arbeit ließ ihm Zeit zum Nachdenken. Das sich seit einiger Zeit langsam ändernde Verhalten von Bekannten, ja Freunden der Familie konnte kein Zufall sein. Dahinter steckte System, ein Kopf, ein Wille.
Natürlich hatte Roberts Wiedereinzug in die Gemeinde als Knecht Spott und Schadenfreude ausgelöst, doch das hatte sich bald gelegt. Feindseligkeiten, persönliche Angriffe hatte es nicht gegeben. Nacke war sicher, daß die Ursache der heutigen Probleme in der Partei zu suchen war. Philip hatte es zwar bestritten, doch der hiesige Ortsgruppenleiter, obwohl ein guter Bekannter und anständiger Kerl, würde es nicht wagen, einen Befehl zur Verschwiegenheit zu mißachten.
Robert und er waren sich einig: Da blieb nur Kronshagen, der Kreisleiter. Ein mächtiger Mann, Stellvertreter des Reichsstatthalters für Lippe und Gauleiters, Koch. Die Szene in Detmold würde er Robert nicht verzeihen.
Er hörte Hufschlag auf dem Kopfstein-Pflaster der Straße und diesmal verstummte das Geräusch auf dem Vorplatz. Das mußte Plaßmeier sein.
„Paul, wo kümmest diu dänne?“, rief der Schmied, schon wieder aufgekratzt. „Du bist zu früh. Setz Dich einen Moment. Dauert nicht lange. Hör mal, nen Schnaps?“
Als Nacke zu dem großen Mann aufsah, stockte die erhobene Rechte mit dem Hammer. Er stellte ihn sachte auf den Amboß. Plaßmeiers meist fröhliche Miene war ernst und der Schmied wußte, hier kommen schlechte Nachrichten.
„Ich kann einen gebrauchen, Fritz. Nimm besser auch ‚nen Doppelten.“
Nacke holte wortlos Flasche und 2 Pinnchen, die seine Frau sofort aus dem Verkehr gezogen hätte. Er hob die Flasche und zitierte den unvermeidlichen Spruch: „Nicht Wacholder allgemein, nein, er muß von Schöttker sein.“
Die 3 Eisenbeine des mit dem Fuß geangelten Hockers verursachten auf dem Ziegelboden ein häßliches Geräusch. Er wischte mit der Hand über den schmutzigen Holzsitz, der davon auch nicht sauberer wurde. „Gong sitten.“
Er selbst schob Werkstück und Hammer zur Seite und setzte sich auf den Amboß.
„Preost! Was hat Dir die Stimmung verhagelt?“
Plaßmeier hob sein Schnapsglas dem Schmied entgegen und kippte den Inhalt mit einem Zug. Nacke trank vorsichtiger, füllte aber das ihm hin gehaltene Glas kommentarlos aufs neue. Sein Kunde war ein Musterbeispiel von Gelassenheit. Es wäre nicht gut, ihn zu drängen.
Mit finsterer Miene kippte der den zweiten Doppelten, guckte leeren Blickes auf das Glas, ehe er es jäh mit gewaltigem Schwung in Richtung Esse schmiß, wo es an der Abzugshaube zerschellte.
„Verdammte Scheiße“, brach es aus ihm hervor.
Kapitel 5
Noch die widersprüchlichsten Empfindungen analysierend fuhr Robert zusammen. Von der Höhe erklang viermaliges Krachen. Keine Schüsse, eher das Brechen trockener Zweige. Der Obergefreite schien aufmerksam mitgezählt zu haben. Er saß ab. Robert folgte zögernd.
„Herr Hauptmann de Wendt ist dort oben.“ Krause wies mit dem Kinn hinauf und streckte die Hand aus. „Darf ich um Mantel und Brille bitten?“
Krause nahm beides entgegen und verstaute es in den Packtaschen. Er salutierte, flüchtig diesmal, wendete die Maschine, trat den Starter, saß auf. Das Motorengeräusch erstarb in Richtung Talhausen.
Robert sah ihm nach. Das Gefühl der Realitätsferne wollte ihn nicht verlassen. Er wandte sich um. Oben am Hang eine Gestalt vor dem Schwarz der Schonung, ein Zivilist, zu weit entfernt, um das Gesicht zu erkennen. Rüdiger ohne Uniform? Kaum vorstellbar. Er wandte seine linke Seite dem Fremden zu, zog die Pistole aus dem Bund, steckte sie in die rechte Hosentasche, die Hand am Kolben lassend.
Die Person kam langsam den Hang hinunter. Der rechte Mantelärmel hing nicht leer. Die Hand war in der Tasche des Trenchcoats. Robert blickte schnell um sich. Niemand sonst.
Doch dann atmete er tief durch. Der linke Arm der Gestalt grüßte mit einer für Rüdiger charakteristischen Geste. Wie konnte er sich so täuschen? Er rannte winkend den Weg hinauf, auf dem verrottenden Buchenlaub gelegentlich ausrutschend, packte schließlich des Freundes linke Hand.
„Mann, Rüdiger! Du erschienst aus der Ferne sehr verdächtig“, stieß er atemlos hervor. „Aber wann habe ich Dich je in Zivil gesehen?“
Er mußte zu Rüdiger de Wendt aufsehen, obwohl sie beide auf gleicher Höhe standen. Der Freund füllte den Trench nicht aus. Der Filzhut kleidete ihn nicht. Auch die derben Schuhe anstelle der Offiziersstiefel paßten nicht zu seiner Persönlichkeit.
Erleichtert wollte Robert seiner immer präsenten Spottlust freien Lauf lassen, als ihn ein zweiter Blick ins Gesicht des Freundes verstummen ließ. Es war blaß und, das war bei dem immer gepflegten Rüdiger sehr ungewöhnlich, nicht rasiert. Die braunen Augen, müde und tief verschattet, wichen seinem Blick aus. Roberts Freude machte großer Beunruhigung Platz.
Er fühlte die Hand auf der Schulter, hörte die kaum vernehmbare Stimme „Laß uns hinaufgehen.“
Wie willenlos folgte er einige Schritte in das Halbdunkel der Schonung, dann, den Weg verlassend, nach links bergan. Sie wanden sich zwischen jungen Fichten hindurch, immer parallel zum Rand des Wäldchens, von außen unsichtbar.
An einem Zipfel der Schonung ließ sich Rüdiger auf die besonnten Mooskissen fallen. Robert setzte sich neben ihn. Sie waren in guter Deckung, konnten aber links durch die Stämme der Rotbuchen hindurch bis zur Straße sehen. Rechts ein sanfter Wiesenhang.
„Gut gewählt, Rüdiger. Du hast in Sachen Taktik nichts verlernt.“
Der Freund entspannte sich ein wenig. Er sah Robert an und lächelte schmal.
„Du siehst gut aus. Die Landluft bekommt Dir.“ Robert hatte zugenommen. Seine rotbraune Gesichtsfarbe zeugte vom häufigen Aufenthalt im Freien. Die scharfen Falten an den Mundwinkeln schienen etwas geglättet. Nur die blauen Augen hatten im Augenblick nichts vom üblichen spöttischen Zwinkern.
Der Mann im Trench rief sich innerlich zur Ordnung.
„Du wirst Dich nach dem Sinn des Indianerspiels gefragt haben“, begann er mit leiser Stimme. „Wir haben nicht viel Zeit. Nur soviel. Es ist wichtig, daß wir nicht zusammen gesehen werden. Anderseits mußte ich Dich dringend sprechen, und…“
Roberts unausgesprochene Fragen erratend, „ein Wehrmachtskrad auf den Straßen ist nichts Außergewöhnliches. Die Kennzeichen hat Krause unkenntlich gemacht. Im Kradmantel wird man auch Dich für einen Wehrmachtsangehörigen halten. Sollte uns hier jemand sehen, hält er uns hoffentlich für Wanderer. Krause wird Dich gleich zurückbringen. Meine Nachricht hast Du verbrannt?“
Robert schüttelte schlechten Gewissens den Kopf, fuhr in seine Hosentasche, reichte dem Freund das Papier. Der klemmte eine Ecke zwischen seine Prothese und einen Stein zu seinen Füßen, holte mit der linken Hand ein Feuerzeug aus der Manteltasche. Beim zweiten Versuch züngelte die kleine Flamme. Das Papier krümmte sich, verwandelte sich in grauweiße Asche, die Rüdiger sorgfältig zwischen Daumen und Zeigefinger zerrieb.
Während Robert verdutzt zuschaute, schreckte ihn eine weitere Frage auf. „Hast Du eine Waffe?“
Er zog wortlos die Tokarev hervor. Der Eindruck eines Wachtraumes, den er seit Krauses Erscheinen hatte, verstärkte sich und damit seine Beklemmung.
Rüdiger betrachtete die Pistole, ohne sie anzurühren.
„Wer weiß davon? Deine Eltern? Dein Bauer? Woher hast Du sie?“ Die Fragen schnell und präzise.
„Niemand weiß davon. Ich bekam sie von einem Kameraden in Greifswald im Lazarett, der kurz darauf starb. Habe mit niemand darüber gesprochen, auch nicht, als ich meine Dienstpistole abgab.“
„Hat sie jemand bei Dir gesehen?“
„Sicher nicht. Sie war im abgeschlossenen Koffer zu Hause und ohnehin, meine Eltern rühren meine Sachen nicht an. Jetzt liegt sie unter dem Fußboden meiner Kammer auf dem Hof.“
„Munition?“
„6 Magazine. Ausreichend für ein ausgedehntes Feuergefecht.“
Rüdiger hob nur leicht die Mundwinkel in Andeutung eines Lächelns. Er fragte nicht weiter, starrte vor sich hin. Seine Linke umklammerte den schwarzen Lederhandschuh der Prothese.
„Glaubst Du ich bin in Gefahr. Sollte ich sie ständig tragen?“
Rüdiger sah ihn kurz an, aber sein Blick schien durch ihn hindurch zu gehen. „Nein, nein, das heißt, wir sprechen später darüber.“
Der Freund, bedrückt und zerstreut, hatte sich wieder abgewandt. Er studierte die Fichtennadeln zu seinen Füßen, straffte sich schließlich.
„Ich kam heute früh mit dem Nachtzug aus Berlin. Ich denke man sieht es mir an.“ Müde lächelnd strich er über seine Bartstoppeln, wurde sofort wieder ernst.
„Was weißt Du über die Besiedelungsaktionen im Osten?“ Robert krauste die Stirn. Was sollte diese Frage?
„Nicht viel. Was man so hört. Reichsbauernhöfe, Rittergüter, Wehrbauern, Generalplan Ost. Aber es gibt auch Gerüchte über Zwangsumsiedlungen.“
„Das sind keine Gerüchte. Ein Großteil der Tschechen und Polen wird gezwungen, in den eroberten Osten zu gehen. Aber in größerem Umfang sind auch politisch nicht zuverlässige Deutsche betroffen. Sie müssen nach Sibirien. Rechtsgrundlage ist ein Führerbefehl und gemeinsame Verordnungen der Ministerien des Inneren, der Justiz und des Reichsministeriums für die Ostgebiete.“
Rüdiger sprach schnell, mit tonloser Stimme, den Blick fest auf seinen Schuhen.
„Die Aktionen werden ausgedehnt. Im Gau Westfalen Nord werden die ersten Transporte zusammengestellt. Auch Lippe ist betroffen, auch Blomar. Deine Eltern und Großeltern stehen auf der Liste.“
Warum war die Stille so betäubend? Nicht nur des Freundes Stimme schwieg. Robert hörte für eine kleine Ewigkeit nicht die Geräusche des Waldes, spürte nicht die Sonne auf der Haut. Eine eisige Klammer preßte seinen Magen zusammen, Übelkeit stieg hoch, oft erlebtes Symptom in Augenblicken höchster Gefahr. Er kämpfte wie ein Ertrinkender gegen die Welle der alles überflutenden Verzweiflung. War es das, worauf er im Unterbewußtsein all die Monate gewartet hatte. Die Rache des Regimes?
Er bemerkte nicht die Papiere in Rüdigers Hand bis der sie ihm sacht in den Schoß legte.
Er nahm sie abwesend hoch.
Briefkopf: „Parteikanzlei“
Der mit der Maschine geschriebene Text verschwamm vor seinen Augen. ‚Gegner der Bewegung... - ...abfällige Kritik... - ...Parasiten am Volkskörper... - ...Bewährung im Osten. Gez. Im Auftrag des Leiters der Parteikanzlei – Unterschrift’(unleserlich).
Angeheftet eine lange Namensliste mit der Überschrift „Blomar“ An der Spitze die Namen seiner Eltern und Großeltern. Am Fuß: „Kronshagen, Kreisleiter – Stellvertreter des Reichsstatthalters.“
Rote Wut trieb Robert das Blut ins Gesicht und verdrängte für einen Augenblick die Angst. „Das Schwein“, preßte er hervor. Die Papiere sanken zu Boden. Seine Hände begannen unkontrolliert zu zittern. Er krampfte sie um seine Knie.
Der Freund wagte erst jetzt, ihn anzuschauen. Unter Roberts rechtem Auge zuckte unablässig ein Muskel. Vor diesem Augenblick und dieser Verzweiflung hatte er sich seit Tagen gefürchtet. Jetzt kam eine neue Sorge hinzu. Er wußte, was Roberts Ausbruch bedeutete. Kronshagen, ein Parteibonze, wie ihn kein Karikaturist besser hätte zeichnen können, haßte Robert. Der hatte ihn bei einem Empfang in Detmold aus Anlaß der Verleihung des Ritterkreuzes nach einer schwülstigen Rede mit einer passenden Erwiderung öffentlich blamiert.
Rüdiger faßte nach seinem Arm. Er spürte das Zittern, sein Griff wurde fester.
„Kronshagen ist nicht wichtig. Wir müssen ein Problem lösen“, flüsterte er eindringlich.
Robert sah ihn an, Hoffnung im Blick. „Du kannst uns helfen, nicht wahr? Du bist deshalb in Berlin gewesen?“





























