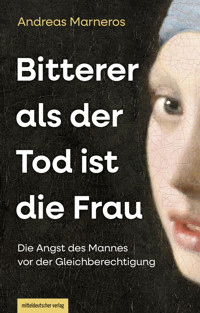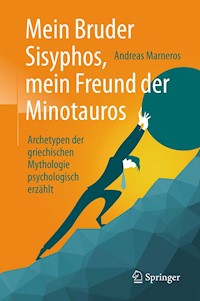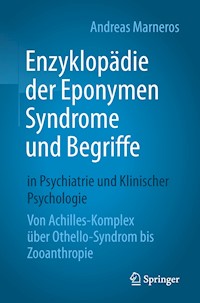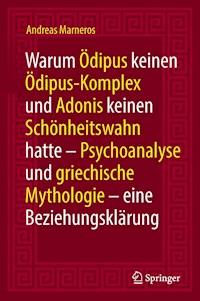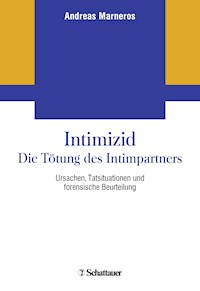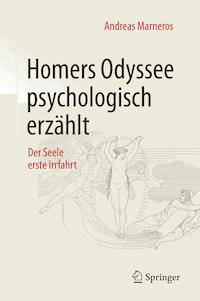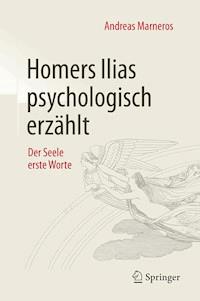7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Warum töten Eltern ihr eigenes Kind? Der Psychiater und Gerichtsgutachter Andreas Marneros beleuchtet den Hintergrund solcher Taten und fragt nach ihrer möglichen Prävention. Denn die Fallgeschichten, die er erzählt, machen deutlich, dass Kindstötung nicht immer aus Brutalität oder Vernachlässigung geschieht, sondern oft unter dem Diktat einer schweren psychischen Krankheit, deren frühzeitige Erkennung und Behandlung tragische Folgen unter Umständen verhindern kann. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Ähnliche
Andreas Marneros
Schlaf gut, mein Schatz
Eltern, die ihre Kinder töten
FISCHER E-Books
Inhalt
Vorbemerkung
Es war eine ARD-Journalistin, die den Stein ins Rollen brachte. Die ARD beabsichtigte, eine Sendung über «Mütter, die töten» zu produzieren. Da ich zu diesem Thema einiges publiziert hatte, wollte sie mich dazu interviewen. Als ich erwähnte, dass manche der Eltern, die ihr Kind töteten, dies aus Liebe taten, bemerkte sie offensichtlich beeindruckt: «Sie sind der Erste, der das so sagt. Wir haben darüber auch mit anderen Fachleuten gesprochen. Doch eine solche Formulierung hören wir in dieser Form zum ersten Mal. Genau so können wir es unserem Publikum erklären.»
Nach diesem Gespräch begannen in mir die Erinnerungen an Anne und die anderen hochzusteigen. Vor allem aber war es Anne, die mir wieder in den Sinn kam. Anne hat mich sehr beeindruckt, wie die weiteren Seiten zeigen werden. Und jetzt, nach diesem Gespräch, verspürte ich erneut dieses Gefühl der Verpflichtung. Ähnlich wie zu der Zeit, als ich die «Sexualmörder» und «Hitlers Urenkel» schrieb. An dem Tag, an dem mich die Journalistin besuchte, war ich gerade mit dem Manuskript «Hitlers Urenkel. Rechtsradikale Gewalttäter – Erfahrungen eines wahldeutschen Gerichtsgutachters» fertig geworden. Dieses Buch hatte mich sehr beansprucht, und eigentlich hatte ich das Bedürfnis nach einer «Schreibpause». Auch passten die beiden Themen gar nicht zusammen.
Aber die Erinnerungen ließen sich nicht vertreiben. Erinnerungen an das Entsetzen in der Öffentlichkeit, an manche betroffene Fragen meiner Mitarbeiter, an manche «Schlachten» im Gerichtssaal, wo ich versucht hatte, die Prozessbeteiligten vom «Guten im Bösen» und dem «Bösen im Guten» zu überzeugen. Und diese Erinnerungen verlangten nach Mitteilung. Alles, was wir in kleinen Runden, Seminaren und Kolloquien, in Vorlesungen und Gerichtsverhandlungen diskutiert und erläutert hatten, wollte ich auch einem breiteren Publikum zugänglich machen. Ich wollte es mitteilen, um aufzuklären und um für Verständnis für manchen Unglücklichen zu werben.
Wenn Mütter und Väter ihr eigenes Kind töten, ist das für die meisten Menschen etwas Unvorstellbares. Unvorstellbar und der Bruch eines doppelten Tabus: Zu töten und das eigene Kind auszulöschen.
Menschliches Leben darf nicht durch andere Menschen vernichtet werden. Wenn dies aber doch unausweichlich scheint, bedient sich die menschliche Gesellschaft verschiedener Rechtfertigungen für diese Ausnahmesituation – des Krieges, der Todesstrafe, der Notwehr. Abgesehen jedoch von den genannten Ausnahmen bleibt in allen Kulturen das menschliche Leben tabu.
Das zweite Tabu betrifft das eigene Kind. Das Leben, das man selbst in die Welt gesetzt hat, das Leben, für dessen Gedeihen man die Verantwortung trägt.
Eltern, die ihre eigenen Kinder töten, werden von vielen für Monster gehalten. Schon seit mythischen Zeiten ist das so. Seit der Zeit des Goldenen Vlieses und der Medea. Seit der Zeit, als Euripides die Tötung des eigenen Kindes für unvereinbar mit dem Verhalten eines zivilisierten Menschen erklärte und eine solche Tat als Ausdruck der Barbarei ansah.
Eltern, die töten – ganz besonders Mütter, die töten –, sind aber in vielen Fällen keine Monster. Sie können im Gegenteil liebende Eltern sein. In vielen Fällen sind die tötenden Eltern selbst Opfer. Opfer, die zu Tätern wurden. Opfer, die Opfer bleiben. Das ganze Leben lang. Buße und Sühne gibt es kaum. Für die meisten von ihnen jedenfalls nicht.
Um eine solche Tat zu verstehen, muss man zunächst einmal den Täter kennen. Seine Lebensgeschichte. Seine Persönlichkeit. Sein Leiden. Seine Motive. Dabei stellt sich heraus, dass viele der Mütter und Väter, die getötet haben, tragische Gestalten sind, die ihrem Schicksal kaum entfliehen konnten. So, wie die Helden der griechischen Tragödien.
Bevor man verurteilt, muss man verstehen.
Und bevor man verstehen kann, muss man wissen.
Lassen Sie mich einige Geschichten erzählen. Über Fälle, die ich als Gutachter und als Psychiater persönlich kennen lernte.
Die Geschichten, die ich in diesem Buch darstelle, waren noch sehr prägnant in meiner Erinnerung. Tragödien sind offensichtlich unvergesslich. Ich hoffe, dass es mir gelingt, manches Tragische und Unvorstellbare zu erklären. Verständnis zu wecken, das uns hilft, in manchen Fällen vielleicht Schreckliches zu verhindern.
Teil A: Tötung aus Liebe – der erweiterte Suizid
Anne und Christian
Liebe, die versklavt
Es war ein wunderschöner sonniger Septembertag. Der letzte Sonntag in diesem Monat. Die Sonne strahlte, wärmte und machte glücklich. Ob sich alle bewusst darüber waren, dass es eine Art Abschiedsparty der Sonne war? Bald würden kalte, dunkle und graue Tage folgen. Und heute wollten alle Menschen noch einmal etwas von der Sonne haben, bevor sie Abschied nahm.
Der Englische Garten in München war voller Menschen: Spaziergänger, Radfahrer, Jogger, spielende und glücklich lärmende Kinder. Jugendliche spielten auf dem Rasen Fußball, Federball, Volleyball und maßen ihre Kräfte – immer mit Blick auf die vorbeigehenden Mädchen. Junge Paare tauschten Zärtlichkeiten aus. Der Teich war voll von den unterschiedlichsten Booten. Familien mit Kindern amüsierten sich prächtig darauf, und junge Paare genossen die romantische Zweisamkeit auf dem Wasser.
Anne, bekleidet mit einem leichten Trenchcoat – den sie trotz der Wärme nicht ausgezogen hatte – drehte mit kleinen, langsamen Schritten enge Kreise in der Nähe des Ufers. Sie ging nicht weiter weg, da sie in der Nähe der Wiese bleiben musste. Christian war nämlich dort und ließ seinen neuen großen Drachen hoch zum Himmel steigen. Anne blieb in Christians Nähe. Sie blieb fast immer in seiner Nähe. Auch Christian entfernte sich selten weit von Anne – seiner Mutter. Er wollte es so, und auch sie wollte es gern so haben.
Anne schien die glücklich lärmende Umgebung nicht zu beachten. Die strahlende Sonne, die Bäume, die schon begonnen hatten, Rotgold und warm leuchtendes Gelb zu tragen, das Licht und das Wasser, die Menschen und Tiere schienen weit von ihr entfernt zu sein. Die ganze lärmende Freude schien an ihr vorbeizuziehen, schien sie nicht zu erreichen.
Anne setzte sich langsam auf eine Bank am Ufer, so dass sie sowohl in Richtung Wasser sehen als auch Christian im Auge behalten konnte. Anne verlor Christian nie aus den Augen. Anne konnte es nicht ertragen, Christian aus den Augen zu verlieren. Sie saß da und dachte intensiv über Christian nach. Doch auch Frank ging ihr nicht aus dem Kopf.
Frank war ein gut aussehender 38-jähriger Mann. Er war drei Jahre älter als sie. Von Beruf war er Musiklehrer und unterrichtete am gleichen Gymnasium wie sie. Anne war von Beruf ebenfalls Lehrerin. Menschlich verstanden sie sich gut. Ein paar Mal waren sie gemeinsam essen gegangen oder musizierten miteinander. In der Regel taten sie das zusammen mit anderen Freunden. Nachdem ihr Mann sich vor drei Jahren von ihr hatte scheiden lassen, zeigte Frank zunehmendes Interesse an Anne. Damit war er nicht der Einzige. Auch andere gut aussehende, gebildete und gut situierte Männer interessierten sich für Anne. Kein Wunder, denn Anne war eine elegante, schlanke Frau mit schwarzen langen Haaren und großen dunklen Augen. Ihre Gesichtszüge erinnerten sehr an mediterrane Schönheiten. Man neigte dazu, sie mit Figuren auf griechischen Amphoren und Vasen oder mit römischen Wandmalereien zu vergleichen. Ihr Stimme war sanft und warm. Sie sprach fast immer leise und langsam. Wenn sie sprach, richteten sich ihre großen schwarzen Augen auf ihr Gegenüber. Die Wärme, die sie ausstrahlte, kam dadurch besonders zum Ausdruck. Vor ihrer Ehe mit Eduard hatte sie viele Verehrer gehabt. Sie entschied sich jedoch für den jungen, etwas unbeholfenen, manchmal kindlich-hilflos wirkenden Eduard. Sie war damals ein junges Mädchen und studierte Germanistik an der Maximilians-Universität in München. Eduard studierte an einer Theater- und Filmakademie. Fünf Jahre später wurde die Ehe geschieden. Die beiden waren zu unterschiedlich, um auf Dauer zusammen leben zu können. Während ihrer Ehe war Christian zur Welt gekommen. Kurz vor der Scheidung war er gerade vier Jahre alt geworden.
Nach der Scheidung meldeten sich neue Verehrer bei Anne. Doch sie hatte alle abgewiesen. Anne war so enttäuscht von der Ehe mit Eduard, dass sie nicht wieder das Risiko einer Beziehung eingehen wollte. Manchmal meinte sie auch, dass es zu früh für eine neue Beziehung sei. Am häufigsten aber entdeckte sie bei sich, dass Christian der wichtigste Grund war, solche Beziehungen zurzeit abzulehnen. Genauer gesagt: ihre Hingabe für Christian. Wenn sie mit jemandem etwas unternahm, hatte sie immer das bedrückende Gefühl, Christian zu vernachlässigen. Christian allein zu lassen. Das Gefühl, dass Christian allein, ungeschützt und hilflos mit einem mehr oder weniger fremden Babysitter unglücklich sein könnte. Sie fühlte sich befreit, wenn der Abend vorbei war und sie zu Christian zurück konnte. Im Kino, im Theater oder in Konzerten begann irgendwann, mitten während der Vorstellung, eine Geduldsprobe. Ihre Gedanken waren dann nur noch bei Christian und bei sich selbst. Sie hatte das Gefühl, sie verletze eine Pflicht. Die Pflicht, immer für Christian da zu sein. Er war bereits von seinem Vater allein gelassen worden, und das verdoppelte ihre Pflicht als Mutter. Dachte sie zumindest. Nach der Scheidung zog Christians Vater von München weg. Er ging nach Hamburg zu einer anderen Frau und arbeitete dort am Theater. Seine Kontakte zu Christian beschränkten sich auf immer seltener werdende Telefonate und rare Besuche. Christian klammerte sich buchstäblich an die Mutter. Er verlangte dabei wenig und ließ seine Ansprüche auch kaum sichtbar werden. Doch sowohl Anne als auch die anderen bemerkten, wie wohl sich Christian in der Nähe seiner Mutter fühlte. Wie wohl er sich fühlte, wenn er seiner Mutter eine Freude machen konnte. Und er machte seiner Mutter viel Freude. Christian merkte auch, dass seine Mutter immer für ihn da war. Nachdem der Vater weggezogen war, hatten Christian und Anne alles gemeinsam unternommen. Es entstand eine engste Mutter-Sohn-Beziehung zwischen ihnen.
Ja, die beiden wurden unzertrennlich. Es war eine gegenseitige tiefe Liebe, die sie füreinander empfanden. Für Anne war Christian der Mensch, den sie über alles liebte. Alles in ihrem Leben hatte nur ein Ziel: das Wohlergehen und das Glück ihres Kindes. Es war aber nicht nur Liebe, nicht nur Fürsorge, Hingabe und ein Gefühl der Pflicht zur Aufopferung, das sie für Christian empfand. Vielmehr war es eine glühende Besessenheit.
Anne war von ihren Gefühlen okkupiert. Sie konnte nichts anderes tun als das, was für Christian gut war. Auch wenn das auf ihre Kosten ging. Auch wenn das Verzicht für sie bedeutete. Die okkupierende Liebe für Christian ließ ihr keine Freiheit mehr. Auch nicht die Freiheit, ihr Leben zu genießen. Auch nicht die Freiheit, ihr Leben anders zu gestalten. Aus Angst, dass sie dadurch Christian schaden könnte.
So hatte sie alle Angebote für eine neue Beziehung ausgeschlagen. Obwohl sie in den rebellischen 60er Jahren im weltoffenen München studiert und die sexuelle Revolution miterlebt hatte, hielt sie nicht viel von passageren kurz andauernden Beziehungen. In ihrem Kopf war es klar: «Jeder soll die Freiheit haben, glücklich zu werden, so, wie er es will und kann. Auch durch die Trennung von Sexualität und Liebe, von Sexualität und Moral.» So sprach Annes Verstand. Aber ihr Herz verlangte tiefe, stabile, unerschütterliche Gefühle. Es verlangte nach Ordnung – auch in der Liebe. Nach Ordnung, auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Freizügigkeit in der Sexualität, Freizügigkeit in den zwischenmenschlichen Beziehungen war für sie gleichbedeutend mit Unordnung.
Und es gab nichts, was sie weniger ertragen konnte als Unordnung.
Eine fesselnde Ordnung. Eine diktierte Pflicht
Diese Liebe zur Ordnung, ja diese Fixierung auf Ordnung, war ihr in ihrer Ehe zum Verhängnis geworden. Da prallten zwei Welten aufeinander: auf der einen Seite ihr Drang nach Ordnung, auf der anderen Seite Eduards chaotische Unordnung. Was Anne an Eduard anfangs so anziehend gefunden hatte – seine kindlich anmutende Hilflosigkeit, seine Sympathie erweckende Unbeholfenheit, seine ganze Persönlichkeit, die Annes Hilfsbereitschaft weckte –, führte während der wenigen Ehejahre sehr bald zur Konfrontation zwischen Ordnung und Unordnung.
Annes Ordnungsliebe – die nicht nur Eduard übertrieben fand – erstreckte sich nicht nur auf zwischenmenschliche Beziehungen, Prinzipien und immaterielle Dinge, sondern ganz besonders auch auf den Alltag. Kein Glas, kein Teller, kein Besteck durfte nach Beendigung des Essens, auch nicht für ein paar Minuten, ungespült und unsortiert bleiben. Kleine Fusseln auf dem Teppichboden mussten sofort aufgehoben werden. Die Betten mussten direkt nach dem Aufstehen gemacht werden. Die Wäsche im Wäscheschrank war fast wie mit einem Lineal sortiert. Der Schreibtisch und seine Schubladen waren eine Musterausstellung für Ordnung: die Schreibfläche sauber und glänzend poliert. Nie ein Stück Papier. Nie ein Bleistift. Kein offenes Buch. Keine leere Kaffeetasse. Nichts als Sauberkeit und Ordnung! In einer Schublade lagen die Bleistifte, immer gut gespitzt, stets an der gleichen Stelle. Daneben, säuberlich getrennt, die Kugelschreiber. In einem separaten Fach lagen die drei Füllfederhalter. Korrespondenzpapier lag in der zweiten Schublade, schnurgerade sortiert. Die Bücher im Bücherregal waren nach Größe und Farbe sortiert. Die Dekoration stand auf den Regalen symmetrisch in gleichen Abständen, millimetergenau angeordnet.
Anne hatte nicht viele Freunde. Die wenigen aber, die sie hatte, waren echte tiefe Freundschaften. Einige davon dauerten bereits viele Jahre seit ihrer Schulzeit an.
Schon als sie 20 Jahre alt war, bemerkte Anne, dass sie eine Neigung zum Konservatismus hatte. Konservative Werte sprachen sie an. Familie, Kirche, Gemeinde, gesellschaftliche Aufgaben spielten eine ganz große Rolle in ihrem Leben. Das führte zusätzlich zu ausgewählten, ja fast eingeengten sozialen Aktivitäten.
Das Vokabular und die Gedanken Annes waren schon immer von zwei Worten bestimmt: Ordnung und Pflicht. Alles war für sie Pflicht. Und Pflicht stand über allem. Pflicht gegenüber Christian, Pflicht gegenüber dem Ehemann, Pflicht gegenüber den Eltern, Pflicht gegenüber den anderen. Die Pflicht war für sie unverletzbar. Sie war zentral. Sie diktierte neben der Ordnung ihren Lebensablauf, ihre Lebensziele, ihre Lebensgestaltung.
Aber Pflicht ist auch Ordnung.
Diese beiden Worte – Pflicht und Ordnung – waren für sie eins.
Aus der Verschmelzung der beiden Begriffe Ordnung und Pflicht entsprangen Gewissenhaftigkeit und Akkuratesse. Für ihre Kollegen in der Schule, für die Schüler in der Klasse war sie wie eine lebende Uhr. Keine Minute, nein, keine Sekunde kam sie zu spät. Wenn unvorhersehbare, von ihr nicht beeinflussbare Umstände zur Verzögerung oder Verspätung führten, war sie unruhig, nervös und todunglücklich. Sie versuchte, Staus zu vermeiden. Sie fuhr vorsichtig, um mögliche Unfälle abzuwehren. Anne entwickelte besondere Strategien, um alle möglichen Faktoren, die die Ordnung stören könnten, abzuwehren.
Ihre Genauigkeit war legendär. Die Zahlen mussten bis zur dritten Stelle nach dem Komma stimmen. Die Worte «ungefähr», «zirka» oder «schätzungsweise» waren ihr fast unbekannt. Auf jeden Fall benutzte sie sie extrem selten. Sie beeindruckte und nervte manchmal auch ihre Umgebung mit ihrer Exaktheit.
Anne hatte panische Angst vor Schuld. Eines ihrer Lebensprinzipien war es, sich nichts zuschulden kommen zu lassen. Auch vor finanziellen Schulden fürchtete sie sich. Schulden bedeuteten für sie Unsicherheit, Unberechenbarkeit. Niemals in ihrem Leben hatte sie einen Kredit aufgenommen, obwohl sie gern ein eigenes Haus besessen hätte. Das aber wäre mit Schulden verbunden gewesen. Für Anne undenkbar. So etwas kam nicht in Frage.
All das war Eduard fremd. Er hatte keinen Bezug zur Ordnung und konnte auch keine Ordnung halten. Anne schimpfte nicht mit ihm, sondern behandelte ihn wie ein unordentliches Kind. Sie sammelte die liegen gelassenen Strümpfe und Unterwäsche ein und brachte Schreibtisch, Esstisch, Wohnzimmer und Küche immer wieder in Ordnung. Sie brachte das Badezimmer wieder zum Glänzen und legte die durchwühlte Wäsche im Wäscheschrank in eine Linie. Anne schimpfte nicht, doch Eduard empfand es so, auch wenn sie nichts sagte. Es genügte, wenn sie aufstand, um die gerade auf den Boden geworfenen Strümpfe aufzuheben. Es genügte, wenn sie das unordentlich auf dem Schreibtisch gelassene Papier ordentlich weglegte. Oder wenn sie erneut den Staubsauger in die Hand nahm, um Krümel vom Teppich zu saugen. Eduard empfand das als einen unausgesprochenen Vorwurf. Mehr noch – als Sklaverei. Seine Sklaverei. Er fühlte sich überhaupt nicht wohl in dieser Welt der absoluten Ordnung.
Es kam zu Auseinandersetzungen, wobei Eduard laut und unbeherrscht schimpfte, Anne aber mit Schweigen antwortete.
Eduard hatte einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, der häufig wechselte. Seine Vorstellungen von sexueller Moral hatten nicht das Geringste gemeinsam mit denen Annes. Er definierte Treue ganz anders, als sie es tat. «Es gibt natürlich Pflichten, doch nur solange der Mensch kein Sklave der Pflicht wird. Jeder ist für sich selbst zuständig. Für sich selbst verantwortlich», dachte Eduard.
Er fühlte sich durch Anne eingeengt, eingeschränkt, als hätte sie ihm seine Freiheit «geraubt». Christian, den er auf seine Art und Weise liebte, empfand er als eine zusätzliche Einschränkung seiner Freiheit. Vor allem dann, als sich zeigte, dass die Beziehung zwischen Mutter und Sohn immer intensiver, immer enger wurde. Eduard fühlte sich immer unfreier, immer eingeengter. Auch Anne fühlte sich in dieser Situation unglücklich und unerfüllt, doch sie rebellierte nicht. Sie fühlte sich Eduard gegenüber verpflichtet. Bis er rebellierte und ging.
Seitdem waren sechs Jahre vergangen. Christian war inzwischen ein aufgeweckter zehnjähriger Junge geworden. Und Anne lebte für Christian. Nur für Christian.
Dann kam Frank, der sensible, kultivierte, gut aussehende Musiklehrer. Nach einigen Monaten erwiderte Anne seine Gefühle. Sie fühlte sich bei ihm wohl, gut aufgehoben, geborgen. Sie fühlte sich fast glücklich mit ihm. Aber nur fast. Christian kam immer wieder dazwischen. Nicht, dass das Kind irgendwelche Ansprüche hatte oder irgendwelche Klagen geäußert hätte. Nicht, dass es irgendwelche Verhaltensmuster zeigte, die als Protest zu verstehen gewesen wären. Nein, im Gegenteil, Christian verstand sich gut mit Frank. Wenn sie sich trafen, spielten die beiden zusammen. Auch gingen sie manchmal gemeinsam zum Fußballspielen oder ließen im Englischen Garten den Drachen steigen. Das alles gefiel Anne sehr. Und trotzdem. Wenn sie mit Frank allein war, wenn sie ins Kino, ins Theater, ins Konzert oder in ein Restaurant gingen, machte sich ihr überempfindliches Gewissen bemerkbar. Immer war der Gedanke im Hinterkopf, dass sie die Pflichten gegenüber Christian verletzt haben könnte oder gerade verletzte. Das brachte einen bitteren Beigeschmack in ihr Essen. Einen Riss in den Film. Eine Unruhe ins Konzert. Sie konnte dann all diese Dinge nicht mehr genießen. Trotzdem kam sie damit einigermaßen zurecht.
Doch nur bis gestern.
Gestern hatte Frank ihr einen Heiratsantrag gemacht. Zuerst hatte sie sich sehr gefreut. Doch dann erzählte Frank, wie er sich ihr gemeinsames Leben vorstellte. Er wollte mit ihr reisen und viel Zeit mit ihr verbringen. Es wäre doch auch möglich, dass Christians Vater, Eduard, sich intensiver um Christian kümmerte. Er könnte ihn doch häufiger nach Hamburg mitnehmen und einen großen Teil der Ferien mit ihm verbringen, so dass auch sie beide ein wenig mehr Zeit für sich selbst hätten. Und das Kind hätte mehr vom Vater. Dann erzählte Frank, dass er gern auch eigene Kinder hätte. Er wollte gemeinsam mit Anne Kinder haben. «Mindestens drei», sagte er lächelnd.
«Und Christian?», fragte Anne schüchtern. «Ja, Christian wird gleich behandelt wie seine Geschwister», sagte Frank, «doch ich bestehe darauf, dass sich Christians Vater etwas mehr um ihn kümmert.» Anne gab keine Antwort auf Franks Heiratsantrag. Sie bat um Verständnis. Sie wollte etwas mehr Zeit haben, um darüber nachzudenken.
Und sie dachte nur daran. Heute, an diesem wunderschönen Septembersonntag konnte sie an nichts anderes denken, als an diesen Heiratsantrag. Vor allem aber dachte sie an die Folgen des Antrags. An die Folgen für Christian. Dabei geriet sie fast in Panik, als sie sich vermeintliche Trennungen von Christian vorstellte. Dass Christian oben im kalten Hamburg allein mit dem unbekümmerten Eduard sein könnte. Weit weg von ihr, für eine längere Zeit. Weg aus ihrem Blickfeld. Eine Horrorvision. Und dann die drei gewünschten Kinder. Welche Zeit bliebe denn dann noch für Christian?
Anne wusste es genau, an diesem schönen sonnigen Septembersonntag. Sie wusste schon jetzt, dass sie den Antrag ablehnen würde. Das hatte sie bereits gewusst, noch bevor Frank von Heirat gesprochen hatte.
Fast in Panik, als könnte etwas Unsagbares geschehen, rannte sie zu Christian. Sie umarmte ihn innig und küsste ihn, hastig und mehrere Male. Christian war nicht sehr überrascht. Er kannte solche Verhaltensweisen seiner Mutter schon von klein auf. Sie gingen gemeinsam nach Hause.
Die Nacht, die immer wiederkehrt
Anne ließ sich nicht anmerken, dass sich allmählich eine Niedergeschlagenheit in jeder Zelle ihres Körpers breit machte. Eine Niedergeschlagenheit, die sie bereits aus früheren Jahren kannte. Sie hatte keinen Appetit. Es machte ihr auch große Mühe, mit Christian ihr allabendliches Ritual zu zelebrieren. Normalerweise aßen sie gemütlich zusammen zu Abend, erzählten sich ihre Erlebnisse vom Tag und hatten dabei oft viel Spaß. Heute aber war es anders. Anne war beim Abendessen wortkarg und sprach nur mit großer Mühe mit Christian. Als er schließlich im Bett lag, küsste sie ihn auf die Stirn, machte das Licht aus und ging aus dem Zimmer. Entkräftet und innerlich leer warf sie sich auf den erstbesten Sessel. Sie ließ das Zimmer dunkel und grübelte stundenlang. Es begann sich wieder dieses Gefühl in ihr auszubreiten, dass alles um sie herum schwarz würde. Kein Licht am Horizont. Keine Freude.
Anne bekam große Angst. «Sie kommt wieder, sie kommt wieder», murmelte sie verzweifelt. Mit großer Mühe hatte sie sich fürs Bett fertig gemacht. Erst spät in der Nacht schlief sie ein, gequält von allen möglichen schwarzen Gedanken. Sie schlief sehr unruhig und hatte Angstträume. Um drei Uhr morgens war sie wieder wach. Sie konnte nicht mehr schlafen, war aber auch nicht fähig aufzustehen. So blieb sie im Bett und grübelte. Um 6.30 Uhr klingelte der Wecker. Christian und sie mussten zur Schule. Ihr fiel auf, wie viel Kraft sie benötigte, um sich für die Schule fertig zu machen. Ihre Glieder waren schwer wie Blei. Ihre Bewegungen waren langsam und ihr Gesichtsausdruck matt. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen. Mühsam gelang es ihr, für Christian Frühstück zu machen. Sie selbst hatte lustlos ein paar Schluck Kaffee getrunken, nicht mehr.
Der Weg zur Schule schien unendlich lang. Sonst war es nur eine Sache von zehn Minuten gewesen. Christian plauderte pausenlos. Sie bekam kaum etwas davon mit.
Anne liebte ihren Beruf sehr. Sie liebte die Schule, und sie war beliebt. Sie hatte kaum je Probleme mit Kollegen, und zu den Schülern hatte sie einen guten Kontakt. Obwohl manche Schüler sie als streng erlebten, vor allem, wenn es um Ordnung, um Genauigkeit und um Sauberkeit ging. Aber ihre Fähigkeiten zuzuhören, sich um die Kinder und besonders um die schwächeren Schüler liebevoll zu kümmern, glichen das aus. Ja, Anne liebte ihren Beruf sehr, und sie liebte auch diese Schule.
Doch heute war es anders. Die Schule schien bedrohlich. Wie ein Berg, den sie nicht besteigen konnte. Sie hatte Angst vor dem Unterricht. Angst, ihn nicht bewältigen zu können. Angst vor den Schülern und Angst vor den Kollegen. Doch sie wusste nicht, warum sie diese Angst empfand.
Die Zeit bis zur großen Pause schien unendlich langsam zu vergehen. Mit großer Erleichterung hörte sie die Klingel, welche die große Pause ankündigte. Sie wartete, bis alle Schüler die Klasse verlassen hatten. Dann sammelte sie langsam, sehr langsam und völlig erschöpft ihre Sachen zusammen. Mit kleinen schweren Schritten schleppte sie sich zum Lehrerzimmer. Dort suchte sie sich eine Ecke, wo sich kein Kollege aufhielt. Sie drehte den Sessel in Richtung Wand und warf sich hinein. Es dauerte jedoch nicht lange und Frank erschien. Er fragte, ob er sich zu ihr setzen dürfe. Mit leiser Stimme stimmte sie zu. Anne versuchte, ihm ein müdes Lächeln zu schenken. Dabei versuchte sie auch, ihren Zustand zu verbergen. Frank fragte sie direkt, erwartungsvoll und irgendwie verschwörerisch: «Und?»
«Was und?»
«Wie stehen meine Chancen? Wie steht es mit meinem Antrag?»
Anne antwortete nicht sofort. Sie versuchte, ihm irgendwie auszuweichen. Sie hatte Angst vor dieser Frage.
«Müssen wir das jetzt besprechen?», fragte sie leise. «Können wir das nicht später tun?»
«Nein, ich platze vor Ungeduld», sagte Frank, «ich möchte es jetzt wissen.»
Anne schwieg. Sie schaute zu Boden, starrte in den leeren Raum, ihre Augen wurden feucht. Ihre Lippen und ihre Gesichtsmuskeln zuckten.
«Was ist denn los?», fragte Frank. «Bist du krank? Fühlst du dich nicht wohl?»
«Nein, es ist nicht so schlimm. Es geht mir gut. Ich bin nur ein wenig erschöpft.»
«Warum gehst du nicht nach Hause?», fragte Frank.
«Ach, es wird schon gehen. Ich kann doch nicht den Unterricht ausfallen lassen.»
«Gut. Und wie ist es mit meinem Antrag?», fragte Frank unerbittlich. Sie hielt die Tränen zurück und sagte leise: «Frank, ich kann deinen Antrag leider nicht annehmen. Frag mich bitte nicht warum. Ich erkläre dir das ein anderes Mal.»
«Aber warum denn?», protestierte Frank. «Wir verstehen uns so gut. Wir fühlen uns wohl miteinander. Warum nicht?»
«Ich erkläre dir das ein anderes Mal, bitte», sagte sie leise.
«Nein, ein Wort musst du mir dazu sagen», beharrte Frank. «Ich bitte dich darum.»
Anne sammelte sich und sagte mit leiser Stimme: «Wegen Christian … Wegen meiner Verpflichtungen gegenüber Christian. Christian … Ich kann meine Pflichten gegenüber Christian nicht verletzen.»
«Ich verstehe das nicht», sagte Frank fast unbeherrscht.
«Bitte, Frank, ich kann jetzt nicht. Ich habe keine Kraft mehr.»
Frank stand auf. Er blieb einige Sekunden stehen, schaute auf den Sessel, in dem Anne zusammengekauert saß, und entfernte sich langsam. Dabei schaute er noch ein paar Mal in Annes Richtung. Verständnislos und enttäuscht.
Anne fühlte sich unendlich allein. In dem Moment, wo Frank aufgestanden war und ging, war es, als würde die ganze Welt von ihr weichen. So, als ob sie ganz allein in einem schwarzen Vakuum sitze. Sie wollte ihm zurufen: «Bitte bleib. Bitte.» Aber sie konnte es nicht.
Gegen 14.00 Uhr war die Schule zu Ende. Anne nahm Christian an die Hand und ging mit ihm nach Hause. Sie liebte diesen Moment, sie hatte dann immer das Gefühl, dass sie seit dem Morgen etwas Sinnvolles getan und etwas abgeschlossen, eine Pflicht erfüllt hatte. Normalerweise freute sie sich auf die lebhaften Erzählungen von Christian, der ihr immer mit großem Schwung von den Erlebnissen des Tages berichtete. Doch heute war es anders. Sie ließ Christian zwar erzählen, doch sie nahm kaum wahr, was er sprach. Auf Fragen antwortete sie mechanisch mit «Ja» oder «Nein» oder «Ich weiß nicht». So etwas war für sie sehr ungewöhnlich. Christian dachte, dass seine Mutter heute sehr müde sei. Deshalb hörte er auf zu schwatzen. Zu Hause bereitete Anne ein einfaches Mittagessen für Christian. Sie selbst hatte keinen Appetit. Sie brachte einfach nichts herunter. Sie trank etwas Saft, schleppte sich in ihr Schlafzimmer und legte sich aufs Bett. Sie konnte nicht schlafen, obwohl sie sich unendlich müde fühlte. Unendlich matt und unendlich schwach. Und sie konnte nicht denken. Ihr Kopf war wie leer gefegt. Einen Gedanken aber hatte sie doch. Einen Gedanken, der immer wiederkehrte, ihr Angst machte: «Sie kommt wieder. Sie kommt wieder», dachte sie. «Lieber Gott, mach, dass sie nicht wieder kommt.»
Inzwischen war es Nachmittag geworden. Anne spürte wieder etwas Leben in ihren Körper zurückkehren. Der große Fels, der den ganzen Vormittag auf ihre Brust gedrückt hatte, begann kleiner und kleiner zu werden. Sie spürte einen leichten Hunger, und ihre Glieder waren nicht mehr so bleischwer. Die Gedanken kehrten allmählich zurück. So sammelten sich ganz langsam wieder ihre Kräfte – wie das Wasser in einer Lache, nachdem es geregnet hat. Gegen 17.00 Uhr fühlte sie sich stark genug, etwas im Haushalt zu tun und sich dann um Christian zu kümmern. Ein kleines Lächeln erschien auf ihren Lippen. Sie begann zu hoffen.
«Nein, sie ist nicht gekommen. Gott sei Dank, sie ist doch nicht gekommen. Lieber Gott, ich danke dir. Ich bin nur erschöpft, und ich bin im Stress. Die Entscheidung, die ich wegen Frank treffen musste, hat mich mehr belastet, als ich dachte. Das ist der Grund für meinen Zustand.»
Je später der Abend wurde, desto besser ging es ihr. Anne hatte versucht, ein einigermaßen gutes Abendessen für Christian und sich selbst zu kochen. Der Appetit war zwar nicht groß, doch diesmal konnte sie etwas essen. Sie konnte Christian auch bei seinen Hausaufgaben helfen. Dann setzte sie sich auf seine Bettkante, und sie sprachen ein Weilchen miteinander. Christian erzählte gerade etwas Faszinierendes vom Kosmos. Welche Möglichkeiten die Astronauten hätten, das All zu erobern, was sie dort erwartete und Ähnliches. Anne hatte Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, hörte aber zu. Während des Gesprächs streichelte sie ab und zu sein blondes Haar oder hielt seine Hand. Nach dem Gute-Nacht-Kuss kehrte sie ins Wohnzimmer zurück, schaltete den Fernseher aus und begann erneut zu grübeln. Wenn auch nicht so negativ, nicht so schwarz und nicht so perspektivlos wie am Morgen. Sie hatte die Hoffnung, sie sei nur erschöpft. Diese Woche war die letzte Schulwoche vor den Herbstferien. In den Ferien wollte sie mit Christian in Südtirol eine Woche Urlaub machen. Sie fuhren immer in dasselbe Hotel, denn sie fühlten sich dort beide sehr wohl und glücklich. Nach solch einem Urlaub kamen sie immer voller Energie zurück.
Die Woche verging langsam, nach demselben Muster wie der Montag. Aber irgendwie ging es doch. Anne fehlte keinen einzigen Tag in der Schule. Sie schlief schlecht, jede Nacht erwachte sie gegen drei und konnte dann nicht weiterschlafen. Sie konnte aber auch nicht aufstehen, so müde und zerschlagen fühlte sie sich. Dann schaffte sie es immer irgendwie, Christian und sich für die Schule fertig zu machen. Wohlwollende Kollegen fragten, ob ihr etwas fehle. Sie antwortete immer: «Mir fehlt nichts, ich bin bloß sehr müde. Am Freitag ist der letzte Arbeitstag, dann gehe ich in die Ferien. Es wird schon gehen.»
Die Ferien kamen, und die beiden fuhren in Annes kleinem Auto nach Südtirol. Die Fahrt war anstrengend. Anne fuhr unkonzentriert. Sie konnte die Landschaft nicht genießen wie sonst. Gott sei Dank hatte Christian seine Musikkassetten mitgenommen. Er setzte die Kopfhörer auf und hörte seine Musik.
Die Fahrt dauerte ungewöhnlich lange. Nicht wegen des dichten Verkehrs, sondern wegen Annes Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten. Sie musste alle halbe Stunde anhalten, um Luft zu holen, wie sie später sagte. Christian begann, etwas ungeduldig zu werden. Anne litt nicht nur unter der langen Fahrt, sondern auch unter dem Gefühl, dass sie Christian damit quälte. Als sie endlich am Urlaubsort ankamen, lief Christian sofort zu den Orten, die er kannte. Dort traf er auch andere Kinder, die er bei früheren Aufenthalten schon getroffen hatte. Er freute sich. Nicht so Anne. Total erschöpft nahm sie die Koffer aus dem Auto.
Der Urlaub brachte nicht die erhoffte Erlösung. Im Gegenteil, sie konnte sich kaum an den Bergen erfreuen, die sie immer so geliebt hatte. Die Spaziergänge waren für sie eine Qual. Zum Frühstück ging Christian allein, genauso wie zum Mittagessen. Nur abends konnte sie mit Mühe etwas essen. Christian bemerkte die Veränderung bei seiner Mutter und reagierte traurig. Er fragte immer wieder besorgt, was los sei, und bekam immer wieder die gleiche Antwort: «Nichts Besonderes, mein Schatz. Ich bin einfach müde, nicht mehr.»
Anne begann, Schuldgefühle gegenüber Christian zu haben. Es kamen ihr Gedanken wie: «Du bist eine schlechte Mutter. Du kümmerst dich überhaupt nicht um Christian. Das Kind ist unglücklich, und du bist daran schuld. Dass Eduard dich verlassen hat und Christian vaterlos aufwächst, ist deine Schuld. Eduard hatte keine Schuld daran, nur du. Und jetzt das mit den Ferien. Du verdirbst Christian die Ferien, du verdirbst ihm das ganze Leben. Seine Zukunft. Du bist schuld daran. Du bist keine gute Mutter. Du versagst als Mutter genauso, wie du als Ehefrau versagt hast. Im Leben ist es auch nicht besser, auch dort bist du eine Versagerin. Du taugst nichts, weder als Mutter noch als Ehefrau noch als Lehrerin. Wozu taugst du denn? Zu nichts.»
Andere Gedanken hatte Anne nicht mehr. Es waren immer dieselben Schuld- und Versagensgefühle – pessimistische, negative Gedanken.
Während des Urlaubs bemerkte Anne noch etwas anderes. Sie konnte nicht mehr Ordnung halten. Ihr ganzes Leben war Ordnung gewesen. Und jetzt wirkte das Hotelzimmer nur halbwegs aufgeräumt, bis das Zimmermädchen kam. Sie vernachlässigte ihre Körperpflege, worauf sie früher immer pedantisch geachtet hatte. Sie hatte keine Kraft mehr dafür.
Zwei Tage vor Beendigung des Urlaubs fiel Anne zum ersten Mal auf, dass sie beim Spaziergang, als sie an dem kleinen Friedhof vorbeigingen, fast sehnsüchtig auf die Gräber schaute. Die Toten hatten alles hinter sich. Die hatten keine Qualen mehr. «Besser tot als lebendig», kam ihr in den Sinn. Dieser Gedanke erschreckte sie sehr.
«Und Christian?», war ihre innere Reaktion.
«Was wird mit Christian, wenn du stirbst? Er bleibt allein und völlig ungeschützt auf dieser freudlosen, schwarzen Welt zurück. Um Gottes willen, du darfst nicht solche Gedanken haben.»
Und die Schuldgefühle gegenüber Christian fanden neue Nahrung.
Die Rückfahrt nach München war doppelt so anstrengend wie die Hinfahrt. Die Autos auf der Straße erschienen ihr wie Raketen, wie Torpedos, die mit großer Geschwindigkeit um sie herumflogen und sie und Christian bedrohten. Sie selbst dagegen war langsam, sehr langsam. Pausen machte Anne nun noch häufiger als auf der Hinfahrt, ganz zum Ärger von Christian. Auch deshalb hatte sie Schuldgefühle. Es war Sonntag, als sie zurückkehrten. Ein wunderschöner, sonniger Oktobertag. Der goldene Oktober machte seinem Namen alle Ehre. Die Wälder feierten ein Fest der Farben. Gelb, Gold, Rot und Rosa. Farben, die durch die Sonnenstrahlen noch intensiver, noch beeindruckender waren. Anne aber sah davon nichts. Sie sah nur Grau. Die Wälder waren grau, und der Himmel war grau. So sah sie auch die Sonne. «Merkwürdig», dachte Anne, «selbst die Sonne ist heute grau.» Der Fels, der auf ihre Brust drückte, wuchs und wuchs. Sie konnte kaum atmen. Ein Kloß saß in ihrem Hals. Der Kopf fühlte sich an, als stecke er in einem Schraubstock, der immer enger und enger angezogen wurde.
Der Tod, die Erlösung und die Liebe
«Sie ist doch gekommen», dachte Anne voller Panik. «Sie ist doch gekommen, die Nacht, die finstere. Sie ist doch gekommen.» Und dann kam wieder der Gedanke: «Besser tot als lebendig. Glücklich die Verstorbenen. Aber du stirbst ja nicht, du kannst nicht erlöst werden.»
«Aber», dachte Anne, «wie wäre es, wenn ich mir selbst das Leben nehme?» Dieser Gedanke versetzte sie in panische Angst. «Welch ein Gedanke? Du willst dich umbringen? Was geschieht dann mit Christian? Das kannst du Christian nicht antun! Du musst leben, für ihn.»
Der Gedanke an die Selbsttötung verschwand wieder. Anne fühlte sich nun doch erleichtert. «Merkwürdig», dachte sie, «ich bin eine gläubige Katholikin, und für die Christen ist Selbstmord eine Sünde. Wie konnte ich so etwas denken? Warum schützt mich mein Glaube nicht davor? Aber Gott sei Dank, Christian schützt mich davor, mich selbst zu töten.» Plötzlich schien ihr der Suizid keine Erlösung mehr.
Bei diesem Gedanken wurde Anne zum ersten Mal bewusst, dass sie in der letzten Woche nicht gebetet hatte. Sie, die gläubige Katholikin, hatte immer viel Kraft im Gebet gefunden. Doch seitdem dieser Zustand begonnen hatte, konnte sie nicht mehr beten. Es war, als ob ihr Glaube versiegt sei. Als ob sie keine Kraft mehr hätte, um zu glauben.
«Sie ist doch wieder gekommen», dachte Anne. «Die Depression ist wieder gekommen.»
Schon ihre Mutter hatte unter schweren Depressionen gelitten und war in psychiatrischen Kliniken behandelt worden. Daran konnte sie sich noch gut erinnern. Sie hatte immer großes Mitleid mit ihr gehabt. Gott sei Dank waren sie und ihr Bruder bereits erwachsen – ihr Bruder war 20 Jahre und sie selbst 18 Jahre alt –, als die Mutter zum ersten Mal an einer schweren Depression erkrankte. Das war Glück im Unglück, denn als ihr Vater starb, war sie gerade zwölf und ihr Bruder 14 Jahre alt gewesen. Der Vater starb an einer Lungenentzündung, und die Mutter war gezwungen gewesen, sämtliche Pflichten zu übernehmen. Sie meisterte diese Aufgabe sehr gut. Sie konnte ihren Kindern viel Liebe geben, und dadurch war es ihnen beiden möglich, unproblematisch aufzuwachsen und zu studieren.
Anne war also kein Kind mehr, als die Mutter zum ersten Mal erkrankte, ihre Erziehung war nicht durch ein solches Erleben gestört worden. Da sie selbst bereits erwachsen war, konnte sie ihrer Mutter in den schweren Stunden beistehen. Erst als sie einen Studienplatz in München bekam, musste sie sich von ihrer Mutter trennen, doch glücklicherweise lagen nur etwa 80 Kilometer zwischen ihrem Wohnort und München, so dass sie die Mutter häufig besuchen konnte. Das Gleiche tat auch ihr Bruder. Es war ein Glücksfall, dass er nach seinem Studium zurück in seine Geburtsstadt kommen und sich dort als Anwalt niederlassen konnte. Er wohnte sogar mit der Mutter im gleichen Haus. Nein, Gott sei Dank hatten die Depressionen der Mutter Annes Entwicklung nicht beeinträchtigt. Doch sie hatten Anne enorm erschüttert, und es hatte ihr wehgetan, die Qualen der Mutter mit ansehen zu müssen.
Dann hatte Anne selbst Depressionen bekommen. Aber nie in einem Ausmaß, wie sie es jetzt erlebte. Trotzdem war es auch früher eine sehr negative Erfahrung für sie gewesen. Sie hatte Angst davor. Auch in der Zeit mit Eduard hatte sie flüchtig diese Depressionen gehabt. Sie dachte, die Eheprobleme seien der Grund. Doch auch nach der Scheidung tauchten sie wieder auf. Die Erklärung war nahe liegend, dass sie durch den Stress während der Scheidung verursacht worden waren. Deswegen war sie nie zu einem Psychiater gegangen. Sie bat nur ihren Hausarzt um Schlafmittel oder ein Medikament gegen die Angst, die sie empfand. Eine richtige Behandlung wurde nicht durchgeführt. Jetzt aber, während dieser Heimfahrt aus den Ferien, wurde ihr bewusst, dass diese Depression viel schwerer war als alle früheren. Vor allem der Gedanke an Selbsttötung, den sie zum ersten Mal verspürte, erschreckte sie unendlich tief.
«Und wenn ich es doch tue? Wenn dieser Gedanke zum Drang, zum Zwang wird? Wenn ich diesem Gedanken nicht widerstehen kann? Was geschieht dann mit Christian? Wo bleibt Christian? Wenn ich das tun würde, wäre es ein Verbrechen gegen ihn, gegen mein eigenes Kind. Nein, Christian darf durch mich keinen Schaden erleiden.
Alles kann ich tun. Nur Christian darf ich nie schaden. Aus diesem hoffnungslosen Leben zu scheiden, wäre für mich eine Erlösung. Für Christian wäre es eine Katastrophe. Du bist eine egoistische Kuh», schimpfte Anne mit sich selbst. «Du musst etwas dagegen tun. Pillen gegen die Schlaflosigkeit und Pillen gegen die Angst vom Hausarzt, das reicht nicht. Morgen früh machst du einen Termin bei einem Psychologen.»
Dieser Gedanke beruhigte Anne ein wenig. Das war eine schwache, aber doch eine Perspektive. Manchmal, in den Nachmittagsstunden wie jetzt, in den Stunden der Aufhellung, konnte sie ihren Zustand ohne Wenn und Aber als «Depression» bezeichnen.
«Psychologe oder Psychiater?», fragte sie sich.
Anne kannte den Unterschied zwischen einem Psychologen und einem Psychiater. Das ist im Übrigen keine Selbstverständlichkeit. Sie wusste auch, dass ein Psychologe, der nicht Mediziner ist, ausschließlich mit Gesprächen, Entspannungsübungen und anderen psychotherapeutischen Mitteln behandeln darf. Ein Psychiater kann mit psychotherapeutischen und biologischen Behandlungsmethoden arbeiten, mit Psychotherapie und mit Medikamenten, wie etwa mit Antidepressiva. Das wusste sie. «Aber wenn man eine psychiatrische Behandlung braucht, wenn man Antidepressiva braucht, ist man krank. Wenn man aber psychologisch behandelt wird, heißt das, dass man Probleme hat. Nur Probleme. Das ist also nicht das Gleiche. Ich habe Probleme. Probleme, die zu Verstimmungen führen. Meine unglückliche Ehe, die Scheidung und jetzt die Entscheidung gegen Frank. Frank, den ich so mag, mit dem ich mich so wohl fühle, wenn ich mit ihm zusammen bin. Das sind Probleme. Es ist nur verständlich, dass sie zu Depressionen führen. Aber krank bin ich nicht, obwohl meine Mutter es war.»
Sie entschied sich für den Psychologen, nicht für den Psychiater. Plötzlich fiel Anne ein Interview ein, das sie vor einigen Monaten im Fernsehen gesehen hatte. Ein Psychiater hatte dort gesagt: «Depressionen sind schwere Erkrankungen, schwerste Erkrankungen. Manchmal sind Depressionen todbringende Erkrankungen. Und es sind lebenslange Erkrankungen, die immer wieder zurückkommen. Im Verlauf der Jahre haben zwei Drittel aller Patienten, die an Depressionen leiden, Suizidgedanken. Ein Viertel dieser Patienten stirbt am Suizid, wenn die Depression nicht richtig behandelt wird.»
Anne fragte sich, ob sie nicht doch zum Arzt gehen sollte, zum Psychiater. Aber schließlich entschied sie sich doch für den Psychologen. «Was ich brauche, ist eine gute psychologische Unterstützung», dachte sie. Am nächsten Tag suchte sie aus den «Gelben Seiten» die Adresse einer Psychologin heraus. Eher zufällig, die Praxis befand sich in der Nähe von Annes Wohnung. Sie bekam gleich einen Termin, weil eine andere Patientin kurzfristig abgesagt hatte. Der Termin lag in den frühen Abendstunden. Anne nahm den Termin dankbar an. «Gut, dass der Termin so spät ist. Um diese Zeit fühle ich mich in der Regel viel besser, und ich kann der Psychologin viel mehr über meinen Zustand erzählen.»
Der Tag verging langsam, wie gewöhnlich in den letzten Wochen. Dieselbe Müdigkeit, dieselbe Schwäche, dasselbe Martyrium – wie jeden Tag. Aber in den letzten Tagen waren auch vermehrt Ängste hinzugekommen. Unbegründete Ängste, für die sie keinen Grund nennen konnte. Das Herz raste, und der Puls erreichte manchmal 120 Schläge pro Minute. Der Mund war dabei trocken, die Hände feucht. Die Atmung beschleunigte sich. Im Kopf war ihr schwindlig. Sie hatte das Gefühl, von Sekunde zu Sekunde in Ohnmacht zu fallen. Es waren Attacken von wenigen Minuten, die ihr aber schwer zusetzten. Nach einer solchen Attacke fühlte sie sich noch schlimmer, als es ihr bis dahin schon ging.
Als sie sich endlich am frühen Abend auf den Weg zu der Psychologin machte, hatte sie doch eine kleine Spur von Hoffnung, dass diese ihr helfen würde. Als Anne auffiel, dass sie Hoffnung hatte, war sie ein wenig überrascht. Sie lebte ja in den letzten Wochen im Zustand der Hoffnungslosigkeit. Kein Licht am Ende des Tunnels. Schon manches Mal hatte sie in den Abendstunden eine Art von leiser Hoffnung verspürt, dass es ihr doch wieder besser gehen könnte. Aber am nächsten Morgen war sie dann wieder von der Lawine der Hoffnungslosigkeit, Zwecklosigkeit, der Sinnlosigkeit überrollt worden.
Die Psychologin war Anfang 40, eine schlanke Frau mit einem ernsten Gesicht und ernstem Blick. «Das ist gut», dachte Anne. «Sie ist nicht so jung, also hat sie sicherlich manche Lebenserfahrung gemacht und kann mich vielleicht besser verstehen als eine Jüngere.» Sie nahm Platz auf dem Stuhl vor dem Schreibtisch der Psychologin. Diese wollte zuerst Annes Personalien wissen: Geburtsdatum, Beruf, Wohnort. Und dann fragte sie: «Wo brennt es denn? Was kann ich für Sie tun?» Anne erzählte, dass sie sich seit einiger Zeit niedergeschlagen fühle, kein Interesse, keinen Antrieb und keinen Appetit habe. Sie könne auch keine Freude mehr empfinden. Sie berichtete weiter, dass sie sich so schlecht um alles kümmere, vor allem um Christian. Dass sie ihre Arbeit nicht mehr schaffe, dass sie niemanden besuchen und von niemandem Besuch haben wolle. Sie fügte hinzu: «Ich hatte auch früher schon so etwas. Nach meiner Scheidung aber häufiger.»
«Scheidung?», bemerkte die Psychologin. «Erzählen Sie mir über Ihren Mann und Ihre Scheidung. Warum ist er weggezogen? Aber alles bitte von Anfang an.»
Anne versuchte, zusammenhängend über Eduard, die Ehe, die Ehekrise und die Scheidung zu sprechen. Es war schwierig für sie, so lange zu reden. Es war schwer, sich all diese traurigen Erlebnisse wieder in Erinnerung zu rufen. Mühsam, einer fremden Person, die sie vorher nie gesehen hatte, darüber Einzelheiten zu erzählen. Doch sie versuchte es.
Anne sprach mit leiser Stimme und schaute der Psychologin selten direkt in die Augen. Als sie es dann – am Ende ihrer Erzählung – aber tat, war sie zuerst überrascht, dann fast erschrocken. Die Psychologin hatte feuchte Augen, konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Dann begann sie offen zu weinen und sagte mit leiser Stimme: «Diese Scheiß-Männer. Diese Scheiß-Männer. Genau dasselbe habe ich vor einigen Wochen auch mitgemacht.» Mit dem letzten Satz sprang sie aus ihrem Stuhl, rannte zu Anne und versuchte, sie weinend zu umarmen.