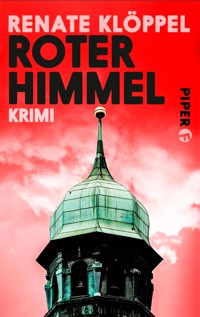2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Spätabends kommt Professor Alexander Kilian in sein Institut an der Freiburger Universität, um sich mit der Studentin Xenia Elytis zu treffen, doch zu seinem Entsetzen findet er sie in einem Labor tot am Boden liegend. Im Gegensatz zur Polizei ist er fest davon überzeugt, dass sie umgebracht wurde. Zu seinem eigenen Schutz verschweigt er, was ihn wirklich mit der attraktiven jungen Frau verband, und beginnt die Suche nach ihrem Mörder. Dabei zieht sich das Netz aus Lügen und Intrigen, in das sich Kilian verstrickt hat, immer weiter zu, bis auch sein eigenes Leben auf dem Spiel steht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
ISBN 978-3-492-98044-9
© für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2013 © Piper Verlag GmbH, München 2011 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © Honza Krej, Markus Pfaff / Shutterstock.com Karten: Cartomedia, Karlsruhe Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2011
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Fahrenheitbooks die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Warum er? Warum musste ausgerechnet er die Tote finden? Diese Tote. Hier in seinem Institut, wo er sie nicht einmal zu Lebzeiten hatte sehen wollen.
Alexander Kilian starrte in das leblose Gesicht. Er brauchte die Frau nicht zu berühren, um zu wissen, dass er ihr nicht mehr helfen konnte.
Sie lag auf dem Rücken vor der großen Beckmann-Ultrazentrifuge auf dem gefliesten Boden des Zelllabors, den Kopf leicht zur Seite gedreht. Der Mund war geöffnet und der Unterkiefer der Schwerkraft folgend zur Seite abgesunken. Die halb geschlossenen dunklen Augen gaben der Toten den schläfrig-sinnlichen Ausdruck, der ihn an der Lebenden gleichermaßen fasziniert wie abgestoßen hatte. Sie war sehr blass. Wie Wachs, dachte er, wie weiße Kerzen auf einem Altar, und er fragte sich, ob Tote immer so aussahen. Oder war das, was sie zu Boden geworfen hatte, doch nur eine Ohnmacht, aus der es ein Erwachen gab? Er war Mediziner, aber Wissenschaftler, und als Professor für Molekulargenetik sah er keine Toten.
Alexander Kilian beugte sich zu dem reglosen Körper herunter, berührte neben dem Kragen der engen Bluse den Hals, der noch warm war, suchte den Puls, aber da war kein Herzschlag zu fühlen, gar nichts war da mehr.
Als er sich wieder aufrichtete, stand Schweiß auf seiner Stirn. Er sank auf einen Laborschemel, stützte die Ellenbogen auf den Arbeitstisch und vergrub den Kopf in den Händen. Er musste an einen steilen Hang denken, den er immer weiter hinuntertaumelte, mit jedem Schritt, den er tat, tiefer hinab in den Abgrund, ohne Hoffnung, sich jemals wieder daraus zu befreien. Der Abgrund tat sich immer auf, wenn er an das Geheimnis dachte, das ihn mit dieser Frau verband. Er hatte sich schon aufgetan, als sie noch lebte.
Die Polizei, dachte er, aber er ging nicht zum Telefon, noch nicht. Er ließ sich neben der Toten auf die Knie sinken und strich ihr ganz sanft über das dunkle, schulterlange Haar. Er betrachtete sie lange. Entsetzen, Verzweiflung oder Trauer? Er wusste nicht genau, welches Gefühl am stärksten war. Angst? – Ja. Er hatte Angst, weil diese Frau nicht mehr lebte. Vor allem Angst.
Ein Geräusch erschreckte ihn, und er fuhr zusammen, als hätte ihn jemand bei etwas Verbotenem ertappt. Doch niemand beobachtete ihn, niemand war zu dieser späten Stunde im Labor, nur der große Kühlschrank neben der Tür war angesprungen. Er stand auf, zu hastig, denn das Zimmer fing an, sich um ihn zu drehen. Schwankend und unsicher sank er wieder auf den Laborschemel. Er fühlte sich plötzlich schlecht, als hätte er mit der zarten Berührung der Haare eine unzüchtige Handlung an der Toten vorgenommen.
Endlich hob er den Hörer ab und rief die Polizei. Dann wartete er. Er war froh über die Minuten, die ihm blieben. Er brauchte sie, um sich Antworten auf die Fragen zurechtzulegen, die man ihm stellen würde. Wie gut kannte er die Tote? Er konnte nicht leugnen, sie überhaupt gekannt zu haben. Xenia Elytis. Frau Brändle hatte ein gutes Gedächtnis. Seine Sekretärin würde sich erinnern, dass sich die Tote wegen einer Doktorarbeit bei ihm beworben hatte. Er hatte abgelehnt, weil er Verwicklungen befürchtete, schon damals. Sieben oder acht Monate lag ihr erster Auftritt in seinem Institut zurück. Und seither? Er würde zugeben müssen, dass es nicht bei dieser einen Begegnung geblieben war.
Aber was auch immer ihn mit dieser Frau verband, mit ihrem Tod hatte er nichts zu tun. Gar nichts. Die Polizei würde ihm glauben und ihn nicht mit unangenehmen Fragen in die Enge treiben. Nicht in dieser Sache. Er war ja nicht einmal da gewesen, als sie noch lebte, noch viel weniger im Augenblick ihres Todes.
Dieses bleiche Gesicht! Er hatte nicht die geringste Ahnung, woran sie gestorben sein konnte. Plötzlicher Herztod bei einer so jungen Frau? Oder ein Verbrechen? Mord? In ihrem Alter hörte man nicht einfach auf zu leben. Er hatte keinen Augenblick gezögert, gleich die Polizei anzurufen und nicht den Notarzt. Weil er gar nichts anderes in Erwägung gezogen hatte als ein Verbrechen? Gift vielleicht? Sah man so aus, wenn man vergiftet worden war?
Eine Sektflasche und eine fast volle Flasche Orangensaft standen unter der Spüle neben dem Papierkorb auf dem Boden, vier leere Gläser auf den Arbeitstischen, ein noch halb gefülltes auf einem Photometer. Daneben lag eine aufgerissene Tüte mit Kartoffelchips. In den Laborräumen war Essen und Trinken verboten, aber offenbar kümmerte sich niemand darum, wenn er nicht im Haus war. Nein, nicht einmal dann, wenn er anwesend war. Nicht einmal er kümmerte sich immer darum.
Er stand auf und hob die Sektflasche hoch. Sie war leer. Als er sie zurückstellte, wurde ihm bewusst, dass er seine Fingerabdrücke auf dem Glas hinterlassen hatte. Wie dumm war er eigentlich, sich auf diese Weise in das Geschehen hineinziehen zu lassen? Er nahm sein Taschentuch und wischte die Flasche ab, wo er sie eben berührt hatte. Den Rest ließ er unverändert.
Plötzlich hatte er das Bedürfnis, sich die Hände zu waschen. Er machte einen Bogen um das Waschbecken im Labor und ging zur Toilette, um nicht noch mehr Spuren in dem Raum zu hinterlassen, wo er die Tote gefunden hatte. Minutenlang ließ er warmes Wasser über seine Hände laufen. Ein schmales Gesicht sah ihm im Spiegel dabei zu. Im Neonlicht erschien ihm sein Gesicht wie das eines Fremden. Bei dieser Beleuchtung wirkte es wie aus Wachs, geradeso wie das der Toten. Ein ebenmäßiges Gesicht unter vollen grauen Haaren, aber wie künstlich schien es ihm, dabei älter, als er es in Erinnerung hatte, und mit einem bläulichen Schimmer auf der fahlen Haut. Sechsundfünfzig Jahre war er vor Kurzem geworden, dreißig Jahre älter als die Tote. Unzufrieden zeigte er seinem Ebenbild die Zähne. Es drohte mit der gleichen abstoßenden Gebärde zurück. Er wandte sich ab von dem alternden Mann, der er selbst sein sollte.
Als Alexander Kilian ins Labor zurückkehrte, hörte er in der Ferne ein Martinshorn. Es näherte sich rasch und verstummte.
Warum war er hier, jetzt, eine halbe Stunde vor Mitternacht? Was würde er der Polizei sagen? Dank moderner Technik war heute so vieles offensichtlich und überprüfbar. Die SMS von Xenia hatte er sofort gelöscht, weil er jede Nachricht löschte, nachdem er sie gelesen hatte. Das würde er jedenfalls behaupten, wenn sie ihn danach fragten. Ob auf dem Handy der Toten noch zu lesen war, was sie ihm geschrieben hatte? Er würde nicht umhin kommen, bei der Wahrheit zu bleiben, wenn sie ihn fragten.
Sphinx. Dieses Wort war ihm schon durch den Kopf gegangen, als sie zum ersten Mal in seinem Arbeitszimmer vor ihm stand. Ohne Ankündigung, ohne den Umweg über seine Sekretärin, ohne Termin hatte sie an seiner Tür geklopft und war eingetreten wie eine Vertraute, die jederzeit willkommen ist. Er wusste damals ihren Namen nicht, aber er kannte sie vom Sehen: eine der Studentinnen aus der ersten Reihe des Hörsaals, wenn er seine Vorlesung hielt, eine von denen, die jedes seiner Worte mitschrieben, egal, wie unbedeutend es war. Eine von denen, die sich hoffnungslos zu ihm hingezogen fühlten, schon deswegen, weil er eine Berühmtheit war. Das war jedenfalls seine Einschätzung gewesen. Aber sie sah nicht aus wie eine besonders eifrige Studentin, und sie trat auch nicht so auf. Sie war auf eine geradezu unverschämte Weise anders, als sie ihm in seinem Arbeitszimmer gegenüberstand: sie fragte nicht, sie bat nicht, sie forderte, auch wenn sie ihr Ansinnen in einen Wunsch kleidete. Kein verlegenes Lächeln, als sie ihr Anliegen vorbrachte, kein ängstlich forschender Blick, kein Erröten, als er sie viel zu lange wortlos ansah.
Sie hatte ihren Namen gesagt, Xenia Elytis. Und gleich im nächsten Satz: »Ich möchte bei Ihnen promovieren.«
Er hatte kaum zugehört, hatte nur Blicke für dieses rätselhafte Gesicht mit den großen dunklen Augen unter den halb geschlossenen Lidern gehabt. Schon zu diesem Zeitpunkt hatte er gewusst, dass diese Frau in sein Leben eingreifen würde wie kaum eine andere. Sie war überhaupt nicht schön in diesem ersten Augenblick, jedenfalls hatte sie nichts von dem, was man landläufig als schön bezeichnet. Die Nase war groß und etwas zu breit in dem schmalen Gesicht, auch der Mund schien groß, die Oberlippe sehr voll und stark geschwungen. Xenia Elytis – eine Griechin? Jedenfalls ein Gesicht wie aus der griechischen Antike. Eine Sphinx, wenn da nicht die schläfrigen Augen gewesen wären. Aber keine ägyptische, wie die gewaltige in Stein gehauene Große Sphinx von Gizeh. Wie eine griechische Sphinx sah sie aus, wie eine Schwester der neunköpfigen Wasserschlange Hydra und des Höllenhundes Kerberos. Wie jene Männer verschlingende Todesdämonin, die der junge Ödipus besiegte. Als Lohn dafür hatte der seine leibliche Mutter Iokaste zur Gemahlin bekommen.
Als Alexander Kilian lange genug dieses Gesicht betrachtet hatte, war sein Blick auf die enge Bluse gefallen, deren oberste Knöpfe geöffnet waren, auf den Ansatz ihrer großen Brüste. Um seine Augen von der aufreizenden Wölbung loszureißen, hatte er seinen Blick weiter gesenkt und war an ihrer Taille hängen geblieben. Lang und schmal war sie, als habe jemand den biegsamen Körper in der Mitte in die Länge gezogen. Nur Busen und Po, den er mehr ahnte als sah, hatten die runden Formen bewahrt.
Hatte er gesprochen, während er sie so lange anstarrte? Er wusste es nicht. Sie stand viel zu dicht vor ihm und schaute ihn an, ohne Lächeln, ohne Flirt, sondern mit einem großen Ernst und einer anmaßenden Direktheit. Er wusste, dass alles entschieden wäre, wenn er die Hand ergriff, die sie nach ihm ausstreckte. Sie wollte ihn. Deshalb war sie hier.
»Alle Doktorandenstellen sind vergeben«, sagte er. »Vielleicht im nächsten Semester, aber ich kann Ihnen nichts versprechen.« Er trat zwei Schritte zurück, sah auf die blühenden Kastanien vor dem Fenster und fühlte sich etwas sicherer. Das nächste Semester war noch weit.
»Ich brauche keine bezahlte Stelle. Ich brauche nur einen Platz, an dem ich arbeiten kann, in einem Institut, wo ich auf die wichtigsten Zeitschriften zugreifen kann, und einen Professor, der meine Arbeit zulässt. Ich brauche nicht einmal ein Thema von Ihnen.«
Sie fragte nicht, sie kündigte vielmehr an, dass sie ihre Arbeit an seinem Institut schreiben würde, jetzt und nicht im nächsten Semester, und die ihm zugedachte Rolle war die eines willenlosen Zuschauers.
»Es tut mir wirklich leid«, begann er wieder und sprach von den vielen, die nach einer Doktorarbeit fragten – fast jede Woche komme jemand zu ihm, zeitweilig habe er sogar eine Warteliste geführt. Und während er sich in Gedanken verzweifelt an seine Ina und ihr gemeinsames Glück klammerte, das er nicht von dieser Sphinx stören lassen wollte, erfand er immer neue Begründungen. Er machte mehr Worte, als es seiner Glaubwürdigkeit zuträglich war, redete immer mehr, nur um diese Würgegöttin loszuwerden. »Tut mir leid«, beteuerte er. »Wirklich. Es tut mir sehr leid.«
Er ging zur Tür, ehe sie noch etwas erwidert hatte, drückte auf die Klinke und hielt ihr die Tür auf. Sie sah ihn unter den schweren Lidern ohne erkennbare Regung an – sehr lange, sehr sicher, dann drehte sie sich wortlos um, ein angedeutetes Nicken zum Abschied, und schritt hoch erhobenen Hauptes an ihm vorbei aus dem Zimmer. Nicht als Verliererin, sondern als Siegerin, die weiß, dass ihre Stunde noch kommen wird.
»Vielleicht später«, rief er ihr nach und warf die Tür ins Schloss. Am liebsten hätte er noch einen Riegel vorgeschoben. Diese Frau machte ihm Angst. Er blieb mitten im Zimmer stehen und fühlte sich erschöpft, als habe er sich mit größter Not und unter Aufbietung all seiner Kräfte im letzten Augenblick aus dem Schlund der Hölle befreit.
Am nächsten Tag erzählte er Frau Brändle von Xenias Bewerbung um eine Doktorandenstelle, als sei sie eine Studentin wie jede andere, und bat sie, im Studierendensekretariat deren Werdegang zu erfragen. Er habe dies vergessen. Xenia hatte bereits ein Medizinstudium abgeschlossen, erfuhr er wenig später, und studierte jetzt in Freiburg, Straßburg und Basel Biotechnologie.
Nach der Begegnung in seinem Arbeitszimmer war Xenia nicht mehr in seine Vorlesung gekommen. Wochenlang hatten seine Augen nach dem blassen Gesicht und den dunklen Augen gesucht, aber irgendwann vergaß er sie. Oder redete sich das zumindest ein. Nur von Zeit zu Zeit und in den unpassendsten Situationen tauchte ein Gesicht vor ihm auf, das nur Xenias sein konnte.
Schritte auf der steinernen Treppe der alten Jugendstilvilla, in die das Institut für Molekulargenetik vor Jahren eingezogen war, rissen ihn aus seinen Gedanken. Sie kamen.
Er blieb auf seinem Schemel sitzen. Es gab keinen Grund, irgendetwas zu beschleunigen. Sie würden ihn finden, und dann würden die Dinge ihren Lauf nehmen. Da musste er jetzt durch, irgendwie und ohne selbst Schaden zu nehmen. Wenn er sich nicht in Widersprüche verwickelte, würde niemand erfahren, welches Vergehen ihn mit dieser Frau verband. Tote reden nicht. Und wenn dieses Geheimnis, das er verschweigen wollte, der Grund für ihren Tod und die Spur zu ihrem Mörder war?
Draußen auf dem Flur war es laut geworden, Türen wurden geöffnet und wieder geschlossen, eine Männerstimme rief seinen Namen. Er erhob sich widerwillig und trat in den Flur. Ein paar Meter von ihm entfernt, halb verdeckt durch die hohen Kühlschränke an der Wand des Labortraktes, standen zwei Beamte in Uniform: ein Mann, den er von hinten sah, und eine junge Frau mit blondem Pferdeschwanz, die ihm jetzt ein ratloses und verzagtes Gesicht zuwandte. Ein Kindergesicht, dachte er. Immer öfter erschienen ihm junge Erwachsene wie halbe Kinder. Das musste an seinem fortschreitenden Alter liegen.
Er begrüßte die Beamten. Die Jugend der beiden und ihre offensichtliche Unsicherheit stimmten ihn zuversichtlich, was seine eigene Rolle betraf, aber sie waren nicht von der Kripo, sie waren nur die Vorhut von der Schutzpolizei.
»Ich führe Sie jetzt zur Toten.« Alexander ging voran, und für einen kurzen Augenblick hatte er den verrückten Gedanken, das Labor wäre leer. Keine Leiche, die Tote wäre nur in seinem Kopf gewesen. Natürlich lag sie noch so da, wie er sie verlassen hatte.
Die junge Polizistin beugte sich über die leblose Frau, die kaum älter war als sie selbst. Große, erschreckte Kulleraugen, das völlige Gegenteil des verhangenen Blicks seiner Sphinx. Er konnte den Anblick des reglosen Gesichtes nicht länger ertragen und sah aus dem Fenster. Unten auf der Straße blitzten in regelmäßigen Abständen die blau-weißen Lichter des Notarztwagens. Ihr Stroboskoplicht warf flackernde blaue Bilder in die Nacht, blaue Äste an unsichtbaren Bäumen, blaue Dachrinnen, wo er keine Häuser sah, ein Arzt in blau aufblitzendem Kittel, zwei Sanitäter, die sich so ruckartig bewegten, als seien sie in einen alten Stummfilm geraten.
Der Polizist, ebenso erschrocken und hilflos angesichts des Todes eines jungen Menschen wie seine Kollegin, verließ eilig das Labor und ging dem Arzt entgegen. Es war wie die Flucht vor etwas, dem er doch nicht entkommen konnte. Als er zurückkam, war sein Gesicht zuversichtlicher. Der Arzt an seiner Seite schien ihm Mut zu machen, doch auch der konnte nichts anders tun, als den Tod festzustellen.
Als draußen zwei unauffällige Limousinen vorfuhren, zog sich Alexander in das Nebenzimmer des Labors zurück, wo neben einem Spülbecken zwei große Autoklaven aufgestellt waren. Ohne das Licht einzuschalten, sank er wieder auf einen der drehbaren Schemel, die überall standen, und harrte mit hängendem Kopf darauf, dass die Kripo ihn finden würde. Er brauchte nicht lange zu warten.
»Herr Kilian?«
Alexander Kilian hob den Kopf. Ein Mann in Zivil war in den Rahmen der offenen Tür getreten und verdunkelte den kleinen Raum. Wie ein Scherenschnitt stand die massige Gestalt vor dem Neonlicht des angrenzenden Labors. Der Mann ohne Gesicht stellte sich vor – Hauptkommissar Mauer oder Lauer, so genau hatte er den Namen nicht verstanden. Er fragte nicht nach. Er hoffte, dass dieser Beamte genauso schnell wieder aus seinem Leben verschwinden würde, wie er darin eingedrungen war.
Mauer oder Lauer oder wie er sonst hieß tat einen Schritt in den Raum hinein und wandte sich dem immer noch Sitzenden zu. Jetzt beleuchtete das Neonlicht das runde Gesicht von der Seite. Es sah auf Alexander herunter, irgendwie mitleidig, nicht fordernd oder forschend, wie der es erwartet hatte.
»Sie haben die Tote gefunden?«
Er nickte.
»Wer ist sie?«
»Xenia Elytis.«
»Hat sie hier gearbeitet?«
Alexander schüttelte den Kopf. Reden, dachte er, er musste reden, das konnte ihn vor Fragen bewahren, die er nicht beantworten wollte. Doch ihm fiel nichts ein.
»Woher kannten Sie die Frau?«
»Sie saß als Studentin in meiner Vorlesung und hat sich vergeblich um eine Doktorarbeit hier am Institut beworben.«
»Warum vergeblich?«
Alexander stockte. Über ihm schwebte das runde Gesicht, die eine Hälfte dunkel, die andere im Licht mit einem beleuchteten Auge über einer fleischigen Wange, einer halben Nase, einem halben Doppelkinn, einem halben Kehlkopf und darüber ein paar Bartstoppeln, die kein Rasierapparat erreichte.
»Ja warum?«, wiederholte er nachdenklich. »Wissen Sie, bei mir bewerben sich so viele Studenten und Absolventen um eine Doktorarbeit, dass ich weder alle annehmen kann noch im Einzelfall behalte, warum ich jemanden abgelehnt habe. In der Regel ist schlichtweg kein Platz frei.« Reden, dachte er wieder, noch mehr reden um jeden Preis, aber seine Gedanken waren bei der toten Sphinx, die ein paar Meter von ihm entfernt am Boden lag und nie wieder aufstehen würde. Noch hatte der Kommissar nicht gefragt, warum er zu dieser späten Stunde hierhergekommen war.
»Und dann war Frau Elytis ganz allein in diesem Haus, obwohl sie nicht hier arbeitet?«
»Scheint so. Ich kam ins Institut, um meinen vergessenen Laptop zu holen und …«
»Und da haben Sie die Tote zufällig im Labor entdeckt?«, setzte der Kommissar den Satz fort.
Alexander Kilian zögerte wieder, vielleicht eine Spur zu lange, um kein Misstrauen zu erwecken.
»Ja. Ich sah Licht brennen und habe nachgesehen, ob noch jemand arbeitet. Da habe ich die Tote gefunden, zufällig, wenn Sie so wollen.«
Er kniff unzufrieden die Lippen zusammen. Selbstverständlich hatte er die Tote zufällig gefunden, das entsprach der Wahrheit. Er hatte eine Lebende erwartet, keine Tote. Es war nicht seine Schuld, dass er nur die halbe Wahrheit sagte. Der Kommissar drängte ihn mit seiner Frage förmlich in diese Richtung. Natürlich hätte er sonst erzählt, dass er hier war, weil Xenia ihn darum gebeten hatte. Aber Xenias SMS hatte er ohnehin nur zufällig gelesen.
Durch Zufall, das war so gut wie gar nicht, und doch hatte diese unberechenbare Macht wieder einmal die Weichen gestellt. Nur der Zufall hatte ihn hineingezogen in den Dunstkreis des Todes und der Verdächtigungen. Sein Handy war zu Boden gefallen, als er heute Abend in seiner Wohnung seinen Mantel achtlos über einen Stuhl geworfen hatte, das war der verhängnisvolle Zufall, dem er diese Katastrophe verdankte. Als er den Apparat aufhob, war ihm die Nachricht von Xenia aufgefallen. Geschrieben war sie um 21.22 Uhr, gegen 23 Uhr hatte er sie gelesen. Ohne seinen zufälligen Blick auf das Handy hätte jemand anders die Tote gefunden und niemand ihn mit dieser Frau und ihrem Tod in Verbindung gebracht. Und alles nur, weil er seinen Mantel nicht an die Garderobe gehängt hatte!
Plötzlich drehten sich seine Gedanken nur noch um diesen Mantel, den er nie ordentlich aufhängte, jedenfalls nicht in seiner eigenen Wohnung, wo er sowieso immer alles irgendwo stranden ließ, was er bei sich trug. Das war seine Art, die er sich von niemandem austreiben lassen wollte, ein kleines bisschen Freiheit, wenigstens in seinen eigenen vier Wänden. Und schließlich sammelte er die Dinge selbst irgendwann wieder auf, wenn ihm danach zumute war oder wenn die Putzfrau auf dem Weg zu ihm war. Ina war da ganz anders mit ihrer Ordnungsliebe. »Warum hängst du deinen Mantel nicht an die Garderobe? Das ist doch keine Mühe!« Hätte er doch bloß wenigstens dieses eine Mal getan, was Ina sagte!
Zwei Stunden nachdem Xenia ihn per SMS darum gebeten hatte, war er im Institut gewesen. Sie hatte keine Andeutungen gemacht, warum er kommen sollte, nur geschrieben, dass es sehr wichtig sei. Hatte sie noch immer Angst wie bei ihrer Begegnung am Flughafen zwei Wochen zuvor? Fürchtete sie sich wieder vor dem großen Mann, von dem sie sich verfolgt gefühlt hatte? Oder wollte sie ihm etwas geben, wie sie es vor ein paar Tagen angedeutet hatte? Eine Nachricht? Oder etwas ganz anderes? Aber warum und vor allem wie war sie ins Institut gekommen? Hatte sie gewusst, dass die anderen dort feierten? Wenigstens auf diese Frage würde er bald die Antwort wissen.
»Es sieht so aus, als habe hier eine kleine Feier stattgefunden«, sagte der Kommissar, als habe er Kilians Gedanken erraten.
»Ja, so sieht es aus.«
»Wissen Sie, wer hier war?«
Alexander zuckte mit den Schultern. »Vermutlich die Mitarbeiter, die normalerweise in diesem Raum arbeiten.«
»Und wer ist das?«
Der Professor nannte ein paar Namen, und der Kommissar angelte ein schwarzes Büchlein und einen Kugelschreiber aus einer der ausgebeulten Taschen seiner bieder-dunkelblauen Winterjacke.
Das Licht, das durch die offene Tür fiel, reichte nicht zum Schreiben, und der Beamte suchte nach einem Lichtschalter. Beim Aufflammen des kalten, weißen Neonlichts schloss Alexander für einen Augenblick die Augen. Als er sie wieder öffnete, war aus dem halben Gesicht ein ganzes geworden, rund wie ein Vollmond, aber nicht kalt und weiß, sondern unter dem fast kahlen Schädel so rosig, dass Alexander seine Wärme zu spüren meinte. Es war ein gutmütiges Gesicht, väterlich wohlwollend geradezu. Trotzdem fühlte er sich unwohl in der grellen Beleuchtung, als könne er im Halbdunkel leichter verbergen, was er nicht offenbaren wollte. Alexander hätte das Licht gern wieder gelöscht, nachdem der Kommissar das Notizbuch wieder eingesteckt hatte, aber er fürchtete, dass er damit dessen Argwohn wecken würde.
»Wann haben Sie Frau Elytis zum letzten Mal lebend gesehen?«
Vielleicht lag es am hellen Licht, vielleicht an seinem schlechten Gewissen, dass Alexander in der Stimme des Kommissars plötzlich einen lauernden Unterton zu hören glaubte.
»Zuletzt sind wir uns zufällig am Zürcher Flughafen begegnet. Ich war auf dem Weg zu einem Kongress in London. Frau Elytis wollte zu ihrer Halbschwester nach Argentinien fliegen, weil ihr Vater dort kurz zuvor bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war.«
»Wann war das?«
»Vor einer Woche vielleicht«, sagte er zögernd, korrigierte sich dann: »Nein, ich bin am Freitag vor zwei Wochen nach London geflogen.«
Warum blickte ihn der Beamte so forschend an? Warum wurde aus dem wohlwollenden Vater plötzlich ein argwöhnischer? Oder bildete er sich das nur ein? Die Begegnung mit Xenia am Flughafen war wirklich Zufall gewesen, nichts sonst. Aber sie war nicht die letzte gewesen.
Der Professor spürte, wie sein Herz unter dem Blick des Kommissars zu rasen begann, trotzdem erwiderte er ihn so gleichmütig, wie es ihm möglich war. – Da war er wieder, dieser Abgrund! Nur der kleinste falsche Schritt, und die bodenlose Tiefe würde ihn unweigerlich verschlingen. Wie hätte er denn wissen sollen, wohin sich das alles entwickelte?
Diese Begegnung am Flughafen! Eine kleine künstliche Felswand hatte seine Blicke angezogen, kaum drei Meter hoch, aus Gips oder Pappmaschee, kein Vergleich mit einer echten Schweizer Felswand, auch das Restaurant im Stil eines Schweizer Chalets am einen Ende der Felswand wirkte wie eine misslungene Karikatur, nicht besser als die Kuhglocken, Kuckucksuhren und Fahnen im »Edelweiß Shop« am anderen Ende. Direkt vor der Felswand war eine Bar, nichts Besonderes bis auf den großen Hackklotz mit eingeschlagener Axt über den Weinflaschen und Spirituosen, wie die Felswand ein unpassender Fremdkörper in der weitläufigen Architektur des Zürcher Flughafens.
Die Frau mit Xenias Gesicht, die an der Bar saß, war eine Fremde, trotzdem blieb er stehen, um sie verstohlen zu mustern. So schräg von vorn betrachtet, erschien ihm ihr Körper noch schlanker, noch zerbrechlicher, als er ihn in Erinnerung hatte. Ihre Augen waren mit dunklem Kajal umrahmt und die Wangen in einer kränklichen Totenblässe übermäßig geschminkt. Sie klammerte sich an ein Glas mit roter Flüssigkeit und sah reglos geradeaus. Alexander blickte auf die Uhr. Höchstens zehn Minuten blieben ihm noch, bis er am Flugsteig sein musste, und er wusste nicht, wie lange er bis dorthin brauchen würde. Trotzdem ging er auf die Bar zu und blieb hinter der Frau stehen.
»Xenia.«
Sie zuckte heftig zusammen und sah sich um, als er leise ihren Namen sagte. Aber diese Frau, die ihn aus aufgerissenen Augen ansah, war nicht seine Xenia, sondern ein furchtsames, bedrücktes Wesen, das jede Ähnlichkeit mit der selbstsicheren Sphinx verloren hatte.
»Willst du verreisen?«
Er versuchte seine Stimme unbefangen klingen zu lassen, aber es gelang ihm nicht. Ihr Anblick lähmte ihn. Sie saß stocksteif da, als wäre sie aus Holz geschnitzt. Als sie endlich antwortete, war ihre Stimme so leise, dass er sie kaum verstehen konnte.
»Ich muss.«
»Warum musst du verreisen?«
»Mein Vater ist tot.«
Vier Worte, fast tonlos hervorgebracht, aber Alexander erschrak, als könne er selbst schuld sein an dem Tod dieses Mannes, dem er nie begegnet war. »Das tut mir leid«, brachte er nur hervor, ohne sich seine Bestürzung anmerken zu lassen.
Er stand noch immer hinter ihr, während sie wieder geradeaus starrte, das Glas nach wie vor zwischen den Händen wie einen rettenden Halt. Sie schwiegen beide.
»Eine Krankheit?«, fragte er endlich und ahnte, dass die Antwort Nein sein würde.
Xenia schüttelte mit einer langsamen und kaum sichtbaren Bewegung den Kopf, ohne Alexander anzusehen.
Er erklomm den Barhocker neben ihr, bestellte bei dem mit einem roten Bauernkittel verkleideten Barkeeper ein Pils, überlegte es sich dann aber anders. Die Zeit, die ihm blieb, würde nicht einmal reichen, um ein brauchbares Bier zu zapfen.
Er wartete, ob Xenia noch mehr erzählte, aber sie schwieg. Stumm und reglos wie eine Schaufensterpuppe saß sie neben ihm, als hätte sie seine Anwesenheit längst vergessen. Der bäuerliche Barkeeper mit dem Gesicht und den Haaren eines eleganten Südeuropäers war in ihrer Nähe stehen geblieben und sah Xenia mit unverhohlener Neugierde an.
Alexander schluckte die böse Bemerkung hinunter, die ihm auf der Zunge lag.
»Ein Unfall?«, fragte er leise.
Wieder eine kaum merkliche Bewegung des Kopfes, dieses Mal ein Nicken.
Als Xenia das Glas zum Mund führte, zitterte ihre Hand so heftig, dass sie etwas von der Flüssigkeit verschüttete. Sie stellte das Glas ab, ohne zu trinken. »Ein Flugzeugabsturz.«
Sie sprach weiter, ehe Alexander noch ein Wort des Bedauerns oder Entsetzens gefunden hatte. Es klang abgehackt und atemlos wie bei einer großen Anstrengung. »Er war auf dem Flug von seiner Farm in der Provinz Corrientes nach Córdoba. Kurz nach dem Start passierte es.« Für einen Augenblick hielt sie inne. »Mein Vater war mit dem Piloten allein in der Maschine. Sie verlor plötzlich immer mehr an Höhe und ist dann fast senkrecht vom Himmel gefallen.« Xenias Augen hatten sich mit Tränen gefüllt. »Sie ist aufgeschlagen wie ein Stein.«
»Und die Ursache?«
»Ist noch nicht bekannt.«
Sie kramte in ihrer Handtasche, fand ein Päckchen Zigaretten und ein Feuerzeug und legte beides mit zitternden Händen auf die Theke.
»Sie dürfen hier nicht rauchen.«
Xenia blickte erst auf den roten Kittel mit den bunten Borten, fand schließlich darüber das Gesicht und sah es an, als verstünde sie die Worte nicht. Sie zog eine Zigarette aus der Schachtel, steckte sie in den Mund, ohne sie anzuzünden, und sog daran. Im Edelweiß-Shop nebenan drängelte sich eine Gruppe Japaner. Ein Kuckuck rief aus einer Uhr, ein zweiter fiel ein, wurde übertönt vom Muhen einer Kuh und dem Klang eines Alphorns. Aus dem Lautsprecher der Bar erklang leise die Stimme von Dean Martin: »You’re nobody till somebody loves you …«
Alexander suchte mit den Augen nach einer Uhr. Er fand keine, aber sein Blick kreuzte sich mit dem eines Mannes vor der künstlichen Felswand. Der Mann war ungewöhnlich groß. Er trug einen eleganten dunkelgrauen Mantel und darüber einen langen hellgrauen Schal, den er kunstvoll gebunden hatte. Über seiner rechten Schulter hing an einem schmalen Riemen eine kleine Herrentasche: Thorsten Schneider, einer der Kollegen, die auf dem besten Wege waren, ihre Erfahrung mit einer eigenen Firma zu Geld zu machen. Alexander wusste nicht, wie lange er schon zu ihnen herübergestarrt hatte. Schneider grüßte mit einem kurzen Nicken und ging rasch weiter.
Es war schon das zweite Mal, dass der ihn mit Xenia antraf. Ob sich Schneider noch daran erinnerte, wie er mit ihr Wochen vor dieser Begegnung auf einer Bank im Stadtgarten gesessen hatte?
Xenia schien ihn gar nicht zu bemerken. Die Tränen in ihren Augen waren zu kleinen Seen geworden, die plötzlich über die Ufer traten und über ihre Wangen liefen.
»Ich habe Angst.« Sie sagte das so leise, dass er sich nicht sicher war, ob er sie richtig verstanden hatte.
»Angst?«
Sie fuhr mit dem Handrücken über ihr Gesicht, verwischte die Tränen, ohne sie zu trocknen, und schwieg.
Alexander griff nach ihrer Hand. »Wovor hast du Angst?«
Er bekam keine Antwort.
Er gab seiner Stimme den mitfühlenden Klang, den man Kindern gegenüber anschlägt, denen etwas Böses widerfahren ist. »Wovor hast du Angst?«, fragte er noch einmal.
Sie schüttelte wortlos den Kopf, und er dachte an das, was er über ihren Vater wusste.
»Hast du Angst, weil dein Vater Dinge erfahren hatte, die ihm gefährlich werden konnten? Hast du Angst, dass er deswegen sterben musste?«
Sie sah geradeaus. Nicht die kleinste Spur einer Antwort, nicht einmal ein Kopfschütteln oder Nicken, als wäre sie plötzlich zu einer Statue erstarrt.
»Hast du Angst um dich?«
Xenia rührte sich nicht.
Ich habe Angst: Einmal mehr gab sie ihm ein Rätsel auf, ohne es zu lösen. Bei allem Mitleid und aller Sorge, die er angesichts des Todes ihres Vaters empfand, flammte plötzlich Zorn in ihm auf. Nein, die Trauer hatte sie nicht verändert. Sie war, wie sie immer gewesen war: rätselhaft. Nicht nur das. Rätselhaft abweisend war sie.
Ein allerletzter Versuch, dachte er. »Kann ich dir irgendwie helfen?«
Xenia verharrte reglos, wie tot, wenn da nicht das Zittern ihrer Hände gewesen wäre.
Die Frau, die hier saß, war ihm fremd geworden und schien alles, was ihn einmal mit ihr verbunden hatte, auslöschen zu wollen. Er stellte noch ein paar Fragen zu dem Unglück, aber sie hatte offenbar nicht die Absicht, mehr über den Tod des Vaters oder über ihre Angst preiszugeben.
»Wie lange bleibst du fort?«
Endlich antwortete sie. »Fünf Tage.«
Xenia hatte ihm nicht viel über ihre Familie erzählt, nur dass sie elternlos aufgewachsen war, das verband ihr Schicksal mit seinem: Er selbst war acht Jahre alt gewesen, als er seine Eltern bei einem Verkehrsunfall verlor. Xenias Mutter hatte ein Biologie- und Germanistikstudium abgebrochen, um ihre Tochter ohne den Erzeuger großzuziehen, den sie kaum gekannt hatte. Sie starb, als sie bei einem Horrortrip unter LSD vor ein Auto lief. Xenia war damals vier Jahre alt. Eine Freundin der Toten nahm Xenia zu sich.
Es gab noch eine Halbschwester, ein Jahr jünger als Xenia. Despina war das einzige Kind aus der kurzen Ehe von Xenias Vater. Auch Despinas Mutter starb früh – es war von einer Krebserkrankung die Rede gewesen. Despina wuchs bei einer Großtante auf. Nach dem Tod von Despinas Mutter war der Vater nach Argentinien gegangen und hatte am Rande der Gran-Chaco-Region neben einem subtropischen Schwemmgebiet des Río Paraná große Ländereien gekauft. Xenia und ihre Halbschwester waren noch Kinder gewesen, als er Deutschland verließ. Vor zwei oder drei Jahren war Despina dann ihrem Vater in dessen Wahlheimat gefolgt, doch wo Despina die Zeichen der Zeit sah – Eukalyptusplantagen für Zellulose und Sojaanbau im großen Stil mit gentechnisch veränderten Pflanzen –, da prangerte der Vater Verbrechen an den Ärmsten der einheimischen Bevölkerung und der Natur an.
Nun also war auch der Mann tot, von dem Xenia zu seiner Verwunderung voller Verehrung als ihrem Vater gesprochen hatte. Und das, obwohl der sich jahrelang gesträubt hatte, sie als sein Kind anzuerkennen. Xenia hatte ihn kaum gekannt, bis er sie im Kampf gegen den Einfluss der mächtigen Agrarkonzerne zu seiner Verbündeten machte.
»Der Passagier Alexander Kilian, abfliegend nach London, wird dringend gebeten, zum Ausgang E 43 zu kommen.« Gleich darauf die Ansage auf Englisch: »Passenger Alexander Kilian …« Die fünf Minuten, die er hatte bleiben wollen, mussten längst vorbei sein.
»Entschuldige, ich muss gehen.«
Er erhob sich ein wenig zu hastig und strich ihr mit einer unsicheren Bewegung über das Haar. Wie ein Onkel, dachte er, wie ein Onkel, der seiner kleinen Nichte pflichtschuldig über das Haar streicht.
»Ich habe Angst vor dem, was auf mich zukommen wird.«
»Was meinst du damit?«
Jetzt schwieg Xenia wieder. Sie schüttelte nur den Kopf, und er wusste nicht, ob sie gehört hatte, dass der Aufruf ihm gegolten hatte.
»Entschuldige, aber ich muss gehen«, sagte er noch einmal und eilte davon.
Zwanzig Minuten bis Gate E! Das Schild sah er jetzt zum ersten Mal. Zwanzig Minuten! Das hätte man ihm doch sagen müssen! Nicht sein chronisch schlechtes Zeitgefühl war schuld, wenn er zu spät kam, sondern die Dame am Check-in. Bis er Gate E erreicht hätte, wäre der Flieger längst gestartet. Drei, vier Schritte lief er schneller, ein unüberlegter Reflex, dann verlangsamte er sein Tempo. Dem Schicksal seinen Lauf lassen, dachte er, langsam weitergehen, ganz langsam, nicht ankommen, bis die Maschine abgehoben hat. Zu Xenia zurückkehren, sie trösten. Keine Fragen stellen, sie einfach nur in den Arm nehmen. Vielleicht würde sie dann über ihre Angst sprechen. Und sein Koffer im Flugzeug? – Egal. Der Kongress? Der würde auch ohne ihn stattfinden. Sein Vortrag? Sein wichtiger Beitrag zu diesem internationalen Symposium über die sensationelle Entdeckung eines lebensverlängernden Gens in einem Fadenwurm? Er ging wieder schneller. Noch fünfzehn Minuten bis zum Ziel, signalisierte ihm ein Schild.
»Passenger Alexander Kilian, Passenger Alexander Kilian …«
In seiner Eile musste er irgendwo den falschen Weg genommen haben, er las nur noch Hinweise auf Gate A und B. Er lief ein Stück zurück, fand eine Rolltreppe in die Tiefe, die er vorher verfehlt haben musste, noch eine zweite – immerhin war er hier richtig, auch wenn sein Weg in den Keller führte – dann Gleise vor ihm, ein Zug, in den er einstieg, was hätte er sonst tun sollen? Er war nicht der einzige Fahrgast, das beruhigte ihn. Wenig später fuhr der Zug los – begleitet vom Muhen einer Kuh und dem Klang eines Alphorns – und war gleich darauf auch schon am Ziel.
»Letzter und dringender Aufruf. Passagier Alexander Kilian …«. Ein paar Minuten später erreichte er die Flugsteige mit dem Buchstaben E. Eine große Halle und darin, er hielt es kaum noch für möglich, Gate E 43. Doch hier war niemand mehr. Gähnende Leere. Da draußen stand sein Flugzeug, keine fünfzig Meter von ihm entfernt. Mit seinem Koffer. Sogar der unförmige Rüssel mit der Gangway, der die mittlere Tür des Flugzeugs mit dem Gebäude verband, war noch nicht zurückgezogen. Doch der Zugang war versperrt. Zu spät, und auch für Xenia war es zu spät. Er würde sie nicht mehr finden.
Und jetzt? Vor Wut schreien? Oder mit dem Fuß aufstampfen?
»Herr Kilian?« Er hatte die Dame nicht kommen sehen. Sie schien nicht einmal richtig böse zu sein. Er murmelte eine Entschuldigung und zeigte ihr seine Bordkarte. Dann stürmte er zum Flugzeug und an den vorwurfsvollen Blicken der anderen Passagiere vorbei auf seinen Platz in der Business Class. Minuten später versank unter ihm das wintergraue Zürich im Wolkenmeer.
Er schloss die Augen. Xenia! Woher kam ihre lähmende Angst? Wovor fürchtete sie sich? Vor dem Flug, weil das Flugzeug ihres Vaters abgestürzt war? Vor José Bustelo und der Auseinandersetzung mit der Saatgutfirma Argigen, in die sich ihr Vater verstrickt hatte? Fürchtete sie Bustelos Rache? Oder war es etwas ganz anderes, wovon er nichts wusste?
»Nach dieser zufälligen Begegnung am Flughafen haben Sie Frau Elytis nicht mehr gesehen?«
Der Professor erschrak. Er brauchte eine Weile, um seine Gedanken in die Gegenwart und zum Kommissar zurückzuholen.
»Nein, weder gesprochen noch gesehen, bis zu dem Augenblick, als ich sie hier gefunden habe.«
Der Kommissar sah ihn unverwandt an. Seine Augen schlossen sich etwas, aber das Lauernde, das Alexander darin zu entdecken glaubte, blieb. Alexander hielt dem Blick stand, doch er fühlte sich plötzlich so schwach wie vor dem Ausbruch einer schweren Krankheit. Seine Antwort war eine Lüge.
Es war so ein Tag gewesen, an dem er schon am Morgen wusste, dass etwas passieren würde. Etwas Unangenehmes, vielleicht sogar etwas Fürchterliches. Seit vier Tagen sollte Xenia aus Argentinien zurück sein, aber er hatte nichts von ihr gehört. Ihr Schweigen, das er sich nicht erklären konnte, und ihr ausgeschaltetes Handy hatten ihn beunruhigt. Vier Tage nur, aber sie kamen ihm vor wie eine Ewigkeit.
Früher als gewöhnlich hatte er an diesem Tag das Institut verlassen. Er wollte vor Einbruch der Dunkelheit in Neuf Brisach sein, wo Xenia seit ein paar Wochen wohnte, ohne dort gemeldet zu sein. Aus Furcht vor einer finsteren, angeblich riesenhaften Gestalt, von der sie sich verfolgt gefühlt hatte, solange sie noch in Lehen wohnte.
Als er bei Breisach den Rhein überquerte, lag das französische Ufer trostlos im Dezembergrau vor ihm, und statt Bäumen ragte der gewohnte Wald aus hässlichen Hochspannungsmasten in den wolkenverhangenen Himmel. Ein paar Minuten später fuhr er zwischen den äußeren Wallanlagen auf die hoch aufragende Stadtmauer aus roten Sandsteinquadern zu. Als achteckiger Stern umgab sie seit drei Jahrhunderten die alte Festungsstadt wie eine chinesische Mauer, deren Mauerkrone unter Gras und Gestrüpp verschwunden war.
Alexander überwand das alte Bollwerk an der Porte de Bâle, die längst zu einem breiten Durchlass geworden war, und parkte seinen Wagen auf einem mit Schlaglöchern übersäten Parkplatz. Er ging ein Stück zwischen den Häusern und dem Wall entlang, dessen Krone sich mit der Stadtmauer vereinigte, kehrte wieder um, war sich in der Dämmerung nicht mehr sicher, was den Weg betraf, und ging dann doch wieder in die erste Richtung. Hier hinter dem inneren Wall duckten sich die niedrigen Häuser: ehemalige Pferdeställe, Kasernen und was das Militär sonst noch brauchte, auch Bürgerhäuser, alles einander ähnlich, aber wie ausgestorben. Von vielen Fassaden blätterte die Farbe und bröckelte der Putz. Ärmliches, verlassenes Weltkulturerbe, geradezu gespenstisch. Kein Mensch war an diesem Tag auf der Straße, nur ein paar Autos fuhren.
Er folgte immer weiter dem Weg am Wall, der hier wie ein hoher Bahndamm hintern den Häusern emporragte, und stieß schließlich auf das alte verfallene Haus, in dem Xenia nun wohnte. Es war eines der wenigen höheren Häuser, eine ehemalige Kaserne vielleicht. Die schiefen, einst grünen Fensterläden waren überall geschlossen, und auch dort, wo Latten fehlten, drang kein Licht in die Dämmerung. Klingelschilder gab es nicht, nur die Reklametafel eines Architekten hing an einem der mit verwittertem Sandstein eingefassten Fenster. Von der auf dem Schild angekündigten Sanierung sah man noch nichts. Im Treppenhaus war eine Fensterscheibe eingeschlagen und auf der Wetterseite des Hauses der Putz vom Backsteinmauerwerk abgefallen. Als er vor ein paar Wochen zum ersten Mal hier war, hatte noch eine albanische Familie im ersten Stock gehaust. Jetzt schien Xenia die einzige Bewohnerin zu sein.
Er bediente den Klingelknopf, der nach seiner Erinnerung zu Xenias Wohnung gehörte, dann den daneben, versuchte einen Knopf nach dem andern, aber alles blieb totenstill und dunkel. Das Haus schien völlig menschenleer zu sein. Er drückte gegen die Haustür, die so grün und verrottet war wie die Fensterläden. Sie öffnete sich knarrend und gab den Weg frei.
Im Flur hing der Geruch von Nässe und Moder, und auch heute funktionierte das Licht nicht. Nur eine Straßenlaterne tauchte das Treppenhaus in mattgraues Licht.
Vorsichtig tastete er sich die Stufen empor, die unter seinem Gewicht beängstigend knackten. Im zweiten Stock drückte er auf den Klingelknopf neben Xenias Wohnungstür. Er lauschte auf das hässliche Scheppern der Klingel, aber nichts rührte sich, bis auf sein Herz, das immer heftiger schlug. Er klingelte noch einmal, wartete. Stille. Ob Xenia gar nicht aus Argentinien zurückgekehrt war? Oder ob ihr hier etwas zugestoßen war, allein in diesem verwahrlosten Haus? Meldete sie sich nicht mehr, weil sie sich nicht mehr melden konnte? Plötzlich hatte er Angst um sie. Er hatte sich schon damals Sorgen gemacht, als er zum ersten Mal dieses schreckliche Haus betreten hatte.