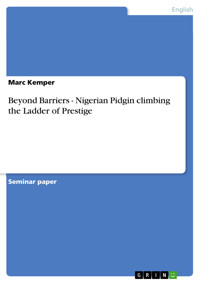Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: INTRONAUTEN
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Welt am Abgrund. Ein Held auf dem Sprung. Eine flüchtige Berührung jeder Person reicht, damit Gregor ihren Tod in einer realistischen Zukunftsvision mitansieht. Die alte "Fluch oder Segen"-Frage ist dabei längst beantwortet: Während ihn seine Fähigkeit einst zum zynischen Eigenbrötler gemacht hat, verlangt sie ihm nun nicht weniger als die Rettung der ganzen Welt an. Dabei ist er schon mit ihrem alltäglichen Wahnsinn zwischen Liebeskummer, Verlustangst, Familienstreit und dem eigenen Älterwerden keinesfalls unterfordert... wird Gregor weit genug über sich hinauswachsen, um das Ende aller Dinge abzuwenden? Ein blutiger Smoothie im Genre-Mixer: Was zunächst als filterlose Klageschrift für Außenseiter begann, vermengt Mystery und schwarzen Humor nun zu einem übernatürlichen Thriller mit maximaler Fallhöhe. Dabei erinnert Vol. 3 mit einem verschmitzten Lächeln daran, dass das Leben hin und wieder ein Drahtseilakt zwischen Menschenhass und Nächstenliebe ist. Nur die richtige Balance bewahrt vor einer harten Landung!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Petra und Frank
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 : A Rush And A Push And The Land Is Ours
Kapitel 2 : Orange Mocha Frappuccino
Kapitel 3 : Arrakis erwacht
Kapitel 4 : Everybody Wants To Rule The World
Kapitel 5 : Eastern Promises
Kapitel 6 : Tausendmal berührt
Kapitel 7 : The Big Trip Up Yonder
Kapitel 8 : Borrowed Time
Kapitel 9 : Safety Not Guaranteed
Kapitel 10 : 1:15 Twin Pines Mall
Kapitel 11 : Threat Level Midnight
Kapitel 12 : Call of the Void
Kapitel 13 : Sans Soleil
1. A Rush And A Push And The Land Is Ours
Ich biss die Zähne zusammen, als er seine Handfläche auf meine Stirn legte. Es ging schon wieder los. Mein Vater und ich trainierten seit Monaten. Er sprach von einer Verschwörung, vom Weltuntergang; davon, dass ich bereit sein müsse für das, was im Nebel vor uns läge. All die Stichpunkte, die heutzutage in dubiosen Internetforen sogenannter Doomsday-Prepper wiedergekäut werden. Meistens von verrückten, von der Gesellschaft vergessenen Männern und Frauen, denen es an einem festen Platz in der Gesellschaft fehlt. Wer weiß - vielleicht wäre ich unter anderen Umständen selbst in diesen Strudel abgerutscht. Doch mein Vater war nichts dergleichen. Es bestand jeder Grund zur Sorge.
Für ihn war ich seine neuste Schachfigur in einer Schlacht, die er seit Jahrzehnten austrug. Dreh- und Angelpunkt dabei war das Phänomen, mit dem ich seit meiner Geburt zu kämpfen hatte: Immer, wenn ich Körperkontakt zu einer anderen Person hatte, riss es mich unter großen Schmerzen in eine mögliche Zukunft. Stets an den Zeitpunkt, an dem diese Person sterben würde. Dabei blieb das körperliche Leid nicht annähernd so lange erhalten wie die immer wieder schrecklichen Bilder der Todesfälle. Eingebrannt hinter meinen Augenlidern. Die meiste Zeit meines Lebens verbrachte ich wach liegend, heimgesucht von den Horrorszenarien sterbender Menschen.
Mein Vater trug etwas Ähnliches in sich und war ebenfalls in der Lage, durch die Zeit zu reisen. Er nannte es den Daedalus, nach dem berühmten Erfinder und Vater von Ikarus aus der griechischen Mythologie. Etwas bedeutungsschwanger, wenn man mich fragte. Für mich war dieser Daedalus schon immer ein Fluch, den es um jeden Preis zu vermeiden galt.
Vermeidung war allerdings keine Option mehr. Dieser Zug war spätestens, als ich selbst Ziel eines terroristischen Todeskults wurde, entschieden abgefahren. Sie wollten das Ende der Welt und nur wer einen Daedalus in sich trug, hatte die Chance, ihre Pläne zu durchkreuzen. Das behauptete zumindest mein Vater, der sich dem Kampf schon vor vielen Jahren mit geballten Fäusten stellte. Ich musste mich auf einen entscheidenden Schlagabtausch vorbereiten... ob ich es wollte oder nicht.
Also ließ ich mich auf alle Prophezeiungen meines Vaters ein. Er trieb mich dazu an, diese Kraft zu kontrollieren; sie sogar zu erweitern, so wie er selbst es auch konnte. Ohne Kontrolle war es kein Wunder, dass ich sie all die Jahre wie eine immense Bürde betrachtet hatte, von der ich mich zu lösen versuchte.
Mein Vater war dank des Daedalus in der Lage, Menschen mit einer Berührung in vergangene Erinnerungen zu senden. In seine eigenen, genauso wie in ihre persönlichen. Dort konnte er nach Belieben wühlen; kein Geheimnis war vor ihm sicher.
»Bereit?«, fragte er mich.
»Henry...«, ermahnte ich ihn und nickte resignierend. »Um ehrlich zu sein: Nicht wirklich. Wir machen das jetzt seit Tagen ohne Erfolg.«
»Versuch es mit einer Erinnerung aus diesem Zimmer. Ich hab es auch nicht auf Anhieb geschafft«, ermutigte er mich und gestikulierte vage in den Raum hinein.
Ich blickte umher. Seine Hand drückte noch immer firm gegen meine Stirn. Es gab eine Erinnerung, doch sie war keine, die ich erneut durchleben wollte.
»Los.«
…
Durch den dichten Nebel, der sich schlagartig schwarz um mich hüllte, drang eine vertraute Stimme.
»Hast du schon wieder mein Deo geklaut?«, hörte ich Elise aus dem Badezimmer rufen.
Meine Füße suchten Halt, als ich einen Schritt durch die Dunkelheit machte.
»Geklaut ist eine zu harsche Vokabel. Sagen wir: Ich hab es genommen und gleichmäßig unter den Armen verteilt. Ist doch völlig ungerecht, dass du das Duftkapital alleine für dich beanspruchst«, entgegnete ich hämisch.
Die Worte fielen mir unkontrolliert aus dem Mund. Es waren jene Worte, die ich damals gesagt habe, als sich diese Szene in der realen Welt zum ersten Mal abspielte. Ich bewohnte meinen eigenen Körper als Beobachter einer längst vergangenen Situation.
»Hast du gerade das Entwenden meiner Pflegeprodukte Karl-Marxisiert? Das ist so albern, dass ich es schon fast wieder respektieren muss«, warf Elise zurück.
»Hey, ich stelle mich jeder Art von Ungerechtigkeit entgegen. Und eine davon ist, dass es Frauen einfacher gemacht wird, besser zu duften. Geh in die Drogerie und sieh dir das Elend doch selbst an: Ihr habt die Auswahl aus unzähligen, real existierenden Düften. Lavendel, Vanille, Honig, die volle Bandbreite der Sinnlichkeit! Und für Männer gibt’s da nur Blödsinn wie Cool & Fresh Extra Dry, oder 48h Active Sport. Was soll das sein? Das prangere ich an!«
Mein Körper ging wie von selbst in die Küche, um einen Snack aus den Schränken in meinen Bauch umzuverteilen.
»Hast du die Kekse komplett aufgegessen?«, fragte ich erstaunt, eine von Keksen gänzlich bereinigte Schublade vorgefunden zu haben.
Elise stand nun mit nichts außer einem Handtuch bekleidet im Türbogen unserer Küche. Ich wurde unweigerlich an unser erstes Mal erinnert, bei dem sie mich mit ihrer Frisch-aus-der-Dusche-Masche auf ganz ähnliche Art und Weise um den Finger wickeln konnte.
»Das würde ich niemals tun!«, sagte sie mit einem Grinsen, welches vor Gericht glatt als Schuldbekenntnis anerkannt worden wäre.
»Dann waren wohl Einbrecher am Werk.«
»Ruf lieber die Polizei.«
»Bis die das Diebesgut gefunden und seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgebracht haben, bin ich verhungert.«
Elise tapste barfuß über die kalten Fliesen zum Kühlschrank und erfüllte den Raum mit ihrer Aura, wobei ihre nassen Locken eine Spur aus Wassertropfen hinterließen. Für einen Moment musterte sie den Inhalt des Kastens, der ihr Gesicht hell erstrahlen ließ.
»Soll ich dir eins meiner weltberühmten Sandwiches machen?«, bot sie an.
»Weltberühmt, weil sie so ungenießbar sind«, lehnte ich mit hochgezogenen Augenbrauen ab. »Ich habe schon so manch exzentrische Nahrungskombination über mich entgehen lassen, aber angebratener Seitan mit Senf und Aprikose? Thanks, but no thanks.«
»Du hast einfach kein Kunstverständnis.«
»Das sagt die Richtige«, warf ich knapp zurück.
»Oh, du denkst ich bin die Richtige?«, witzelte sie und zwinkerte mir zu.
»Vielleicht. Wenn du lernst, wie man ein vernünftiges Sandwich macht«, neckte ich mit ebenbürtiger Energie zurück.
»Ich hab das Spiel deiner faden Normalo-Sandwiches bereits durchgespielt und bin längst in der Experimentierphase angekommen. Picasso wusste beim Malen auch, wo die Augen eigentlich hingehören. Er hat sich nur irgendwann aktiv dazu entschieden, sie eben nicht mehr dort zu platzieren.«
Hätte sie nur so viel Ahnung vom Kochen, wie von Kunst gehabt...
Elise war trotz der negativen Resonanz auf ihre Kreationen vollends von ihren kulinarischen Künsten überzeugt. Zwar ernährte auch ich mich vegan, wunderte mich aber auch ein Jahr später noch darüber, welch sonderbare Kraut- und Fruchtdüfte zusammen mit Elise Einzug in diese Küche fanden.
Wir lachten.
Wir küssten uns.
Der Kuss schmeckte wie Balsam auf meinen Lippen. Wohltuend, so wie er es sollte. Dennoch: In meinem Kopf drang Bitterkeit daran vorbei und überkam jedes noch so vage Überbleibsel von süßem Glücksgefühl.
Ich wusste schließlich bereits, was passieren würde.
Mein Kopf blockierte. Zu schmerzhaft war die Erinnerung, die sich mir seit sieben Monaten immer wieder aufdrängte.
Die Wände vibrierten.
Die Vision wurde instabil.
»Konzentriere dich. Denk daran, wofür du hier bist«, ermahnte mich die Stimme meines Vaters, die zum Takt der Vibrationen in meinem Kopf echote.
Henry schaute zu, trainierte meine Fähigkeiten, indem er mich an meinen Fokus erinnerte. Der Daedalus war wie ein Muskel, der stärker und leistungsfähiger wurde, je mehr man ihn beanspruchte. So viel wusste ich bereits.
Ich war erst nach Jahren der Ausgrenzung in der Grundschule in der Lage, mich in Visionen frei zu bewegen. Mit der Pubertät kam die Chance hinzu, hier und da Gegenstände zu beeinflussen. Die bisher unmögliche Mission war es, etwas aus diesen Visionen in die reale Gegenwart zurückzubringen.
Unzählige Male versuchte ich erfolglos, einen Stein, ein Gänseblümchen oder irgendetwas noch so Insignifikantes durch den Schleier zurück in die Gegenwart zu ziehen.
»Bedrückt dich etwas?«, fragte Elise und holte mich aus meinen Gedanken zurück in den gemeinsamen Moment.
»Es gibt da etwas, das ich dir schon sehr lange sagen wollte.«
Ihr sonst so strahlendes Gesicht verlor schlagartig an Leuchtkraft. Einer der Gründe, warum ich sie so liebte, war ihr Talent, Emotionen zu lesen. Ihr machte man nichts vor - sie war wie ein Seismograph, der auch die kleinsten tektonischen Bewegungen wahrnahm.
Ich verglich das gerne mit einer Farbpalette. Wo ich in der Lage war, Rot, Blau, Gelb, Grün, Orange und all die anderen grundlegenden Farben zu unterscheiden, bewegte sich ihre Wahrnehmung in einem viel spezifischeren Spektrum. Sie erkannte Magenta, Ocker, Falu, Mauve, Taupe und Beige. Ganz ohne ominöse Superkraft zur Zeitmanipulation war ihr bewusst, dass unser Gespräch auf eine Klippe zusteuerte.
Diese Interaktion war mittlerweile sieben Monate her, doch stach jedes Wort genau wie am ersten Tag. Auf der einen Seite bereute ich meinen nächsten Satz – andererseits hatte ich ihn bereits viel zu lang verschwiegen.
»Elise... dein Herz... es wurde dir nicht freiwillig gegeben«, stotterte das Ich meiner Vergangenheit vor mir her. Es versuchte, die Wahrheit wieder herunterzuschlucken, sie zwischen den Zähnen festzuhalten - oder zumindest anders zu formulieren, dass sie zu einem milderen Ende führte.
Während die Worte zwischen Elise und mir widerhallten, waberten die Wände unserer Küche und begannen, einzustürzen. Wie die Oberfläche eines Teiches, in den man einen großen Stein hat fallen lassen, wellten sich die Fliesen, die Tapete, sogar die Schränke. Vergangenheits-Gregor und Elise stritten sich, doch ihre Stimmen rückten in weite Ferne.
Ich kannte mich inzwischen zu gut mit diesen Visionen aus, um nicht zu verstehen, dass ich in wenigen Sekunden in der Gegenwart ausgespuckt werden würde.
Die wuchtigen Wellen stiegen rapide. Binnen weniger Augenblicke bebte der Raum, brachte mich ins Wanken. Ein eingerahmtes Bild von Astrid, meiner Mutter, und Ulrich, meinem Stiefvater, dessen Gesicht ich vor Jahren mit einem Edding überkritzelt hatte, fiel vom Küchentresen zu Boden. Ich war fünf oder sechs, als dieser Moment für die Ewigkeit festgehalten wurde. Ulrichs Gesicht hatte ich dann später, in meiner rebellischen Teenagerzeit, überdeckt. Damals dachte ich noch, er sei mein leiblicher Vater gewesen und hasste ihn dafür, meine kranke Mutter im Stich gelassen zu haben.
Das besann mich darauf, weshalb ich überhaupt in dieser Vision umhergeisterte: Der beim Aufprall des Bilderrahmens entstandenen Scherben zum Trotz griff ich nach dem Foto darin und hielt es so fest ich nur konnte in meiner Hand, um es, wie von Henry verlangt, durch den Schleier des Daedalus in die Gegenwart mitzunehmen.
Der Rahmen glühte. Vielleicht war ich zu emotional, konzentrierte mich nicht ausreichend oder gab mich der Kontrolle des Daedalus nicht genug hin. Und als der Sog begann, mich Molekül für Molekül wieder in die Gegenwart zu saugen, entglitt auch der Bilderrahmen allmählich meinem Griff. Die Küche erstrahlte, blendete meine Sicht. Der Gegenstand in meiner Hand schmolz dahin, verbrannte meine Fingerspitzen. Das zersplitterte Glas verflüssigte sich, die silbernen Tropfen bahnten sich entlang der Falten und Linien meiner Faust ihren Weg. Dann erstrahlte ein Blitz.
Als hätte man einen Lichtschalter betätigt, stand ich plötzlich wieder in der dunklen Gegenwart. Es war derselbe Raum, sieben Monate nach dieser Erinnerung, nach der Trennung von Elise. Ich war derselbe Gregor... nur eben mit einer Prise von dem Typen aus der Sesamstraße, der in einer Mülltonne lebte.
Dasselbe Leben, im selben Haus, nur... leblos. Verstaubt, unordentlich, ohne Licht. Die Jalousien der Fenster waren heruntergelassen. Wo zuvor noch Möbel und Küchengeräte standen, fanden sich nur noch stapelweise Aktenordner.
Love don't live here anymore.
Der Bilderrahmen war in meiner Hand geschmolzen. Nicht einmal Überreste konnte ich sichern. Für mich war nach wie vor unklar, ob es überhaupt möglich war, etwas Haptisches aus einer Vision in die Gegenwart zu transportieren. Henry gelang es selbst nicht - wieso glaubte er, dass ich dazu fähig wäre?
»Wieder nichts?« Betont trocken versuchte sich mein Vater nicht anmerken zu lassen, wie angespannt die Situation für ihn war.
Ich benötigte eine kurze Verschnaufpause, bevor ich auf seine ungeduldige Frage reagierte.
»Offensichtlich nicht«, entgegnete ich genervt und hielt ihm meine lädierten Hände entgegen.
Sorgenfalten zogen über Henrys Gesicht. Keineswegs Sorgen um seinen Sohn. Vielmehr um seine geliebten Pläne.
»Was geschieht mit dem Hier und Jetzt, wenn ich so ungeniert in der Vergangenheit herumstochere?«, fragte ich ihn zu gleichen Teilen, um zu verstehen und um Zeit zum Durchatmen zu schinden.
»So gut wie nichts. Du kannst jedenfalls nicht einfach zurück, irgendwo einen Lottoschein ausfüllen und als Millionär zurückkommen.«
»Es hat doch einen Grund, warum du willst, dass ich diese Fähigkeit erlerne...«
Henry schaute mich argwöhnisch an. Durch seinen Daedalus erkannte er neben unzähligen Todesvisionen auch die Überlebensnotwendigkeit meiner kompletten Kraftkontrolle klar und deutlich.
»Ein bisschen Spielraum gibt es schon. Wenn du in einer Vision stirbst, kommen nur deine menschlichen Überreste zurück«, schilderte er und schaute auf seine Armbanduhr.
»Du weißt, wie man zu Höchstleistungen motiviert«, steuerte ich bei.
»Dann können wir es ja nochmal versuchen. Ich habe das Gefühl, wir stehen kurz vor einem Durchbruch. Und die Zeit wird knapp.«
Eine Erklärung, für was genau er die Zeit ablaufen sah, blieb er mir schuldig.
Zwar kam ich mit leeren Händen aus der Vision zurück, bemerkte aber etwas Sonderbares: Der Duft von Himbeeren lag plötzlich in der Luft. Das Parfum von Elise.
»Nochmal«, wies er mich an und streckte seine Hand nach mir aus.
Doch ehe ich mich mit meinem Vater darüber streiten konnte, klingelte ein Alarm unter einem der um uns herum aufgebahrten Aktenberge.
Auch das noch.
Vor zwei Jahren kämpften wir das erste Mal gegen einen Terroristen mit einer Vogelmaske. Er philosophierte vom Kampf gegen das Böse, während er mit einem undefinierbaren Giftgas hunderte Menschen tötete. Der Pestdoktor, so nannten wir ihn, klang dabei wie ein religiöser Fanatiker aus längst vergangenen Tagen: Bedeutungsschwangere Theatralik, gepaart mit der unumstürzlichen Gewissheit, exklusiv im Recht zu sein, zeichneten ihn aus. Also zusätzlich zu der ganzen Sache mit dem Massenmord, versteht sich.
Nachdem wir ihm das Handwerk legen und das Schlimmste abwenden konnten, stellte der zu dieser Zeit noch für das Kommissariat arbeitende Henry Beweise, Pläne und Hinweise sicher. Und mit sicherstellen war stehlen, bevor die Polizei alles unter Verschluss nimmt, gemeint. Essenzielle Informationen, um in diesem Krieg auch nur ansatzweise angemessen zurückschlagen zu können.
Unter den Habseligkeiten des Pestdoktors befand sich zum Beispiel ein Dokument mit Namen, auf dem auch Henrys und meiner aufgelistet war. Es handelte sich um anvisierte Ziele. Viele, um nicht zu sagen fast alle, waren bereits durchgestrichen. Nur mein Vater, ich und eine dritte Person fehlten scheinbar noch.
Unsere Recherchen ergaben, dass die meisten der durchgestrichenen Personen bei Unfällen oder unter ähnlich unverdächtigen Umständen ums Leben kamen. Erst bei genauer Betrachtung wurde zweifellos deutlich: Es handelte sich um eine Abschussliste des Kultes, auf der Menschen aufgeführt waren, die – und hier spekulierten wir ein wenig – ebenfalls einen Daedalus in sich trugen.
Also stellte Henry einen Alarm ein, der jedes Mal ertönte, wenn einer der übrigen Namen in Nachrichten, Zeitungsartikeln oder jeder anderen Form von verfolgbaren Medien auftauchte. Das Programm war sogar im Intranet einiger Institutionen eingeklinkt - Polizei, Regierungen, soziale Medien; in jeder Sprache, an jedem Ort. Hätte mich der unmittelbare Zugriff auf so viele persönliche Daten nicht so gegruselt, wäre ich beeindruckt gewesen. Nur jemand, der diesen Krieg schon so lange wie mein Vater führte, kann ohne Gewissensbisse auf solche Mittel zurückgreifen.
Henry wühlte durch den unordentlichen Hügel der kryptischen Druckerzeugnisse und fischte ein Smartphone hervor. So begannen in den letzten paar Jahren mehrere Missionen: Tokio, Panama, Rio, Athen, Christchurch, zuletzt London... Henrys Kreuzzug nahm ziemlich schnell eine globale Dimension an.
Sicherlich waren diese Einsätze ein Streitpunkt zwischen Elise und mir, die trotz ihres Herzleidens stets versuchte, irgendwie am Geschehen teilzunehmen.
Leider waren wir auf unseren Einsätzen nie auf der Gewinnerseite, da diese Sekte es immer wieder – trotz unserer besten Bemühungen, ihnen zuvorzukommen – schaffte, ihr tödliches Register weiter abzuarbeiten.
Mein Vater ließ sich davon nicht beirren. Er sah in dieser Liste die Chance, endlich genug Schlagkraft zu vereinen, um diesem Geheimbund entgegenzutreten.
»Mit jedem Träger, den sie töten, wächst ihre Macht – und das hier ist der letzte Name, den wir noch erreichen können.«
Mir war klar, dass viel auf dem Spiel stand. Und so gern ich mich vor der ganzen Situation einfach versteckt hätte, verdeutlichte das, was sie meinem besten Freund Thomas angetan hatten, dass es ohne diese Konfrontation kein Ende geben würde.
Sekundenlang starrte Henry besorgt auf den Bildschirm des Geräts, bevor er sich mir zuwandte.
»Er ist es. Der letzte Name auf unserer Liste: Casey Walden.«
»Der Straßenmusiker, den wir durch halb England verfolgt haben?«, fragte ich verblüfft.
Wir hatten nur wenige Informationen über die Ziele. Manche von ihnen waren bereits auf der Flucht oder lebten absichtlich unter dem Radar, ehe der Kult sie erwischte. Doch zu Casey Walden gab es zahlreiche Daten: Ein heruntergekommener, wenn auch talentierter Folk-Gitarrist, ursprünglich aus Seattle. Seine Karriere stand wiederholt vor dem Durchbruch, den er sich jedes Mal wieder durch die eigene Drogenabhängigkeit zu verderben wusste. Zuletzt war er in der dritten Runde einer amerikanischen Casting-Show ausgeschieden. In England wollten wir ihn retten, bevor der Ibiskult zu ihm gelangte. Wir haben ihn nie gefunden. Eigentlich hätte man vermutet, dass gerade ein so öffentlicher Mensch schnell ausgeschaltet werden würde. Hatte sein Daedalus etwas damit zu tun?
»Walden wurde laut Bericht von einem LKW erfasst. Ist soeben ins Krankenhaus eingewiesen worden.«
»Klingt verdächtig.«
»Es wird noch besser«, verkündete mein Vater und drehte das brüchige Smartphone-Display in mein Sichtfeld. »Er ist in deinem Krankenhaus, hier in der Stadt. Das, in dem Astrid gestorben ist.«
2. Orange Mocha Frappuccino
»Uns ist aber schon bewusst, dass das eine Falle ist, oder?«, versicherte ich mich in der Hoffnung, von Henry in seinen Plan eingeweiht zu werden.
»Offensichtlich«, entgegnete er knapp und drehte den Schlüssel im Zündschloss seines silbernen Viertürers.
Ich nahm einen kräftigen Zug aus einem Durstlöscher, den ich für solche Fälle im Handschuhfach aufbewahrte. Es war das Ende eines warmen Julis und da ich beim Kampf gegen übernatürliche Weltuntergangssekten stets vergesse, ausreichend Flüssigkeit zu mir zu nehmen, räumte ich dem überzuckerten Trinkpäckchen höchste Priorität ein.
Es gab genau zwei plausible Schlussfolgerungen: »Also entweder Casey Walden liegt wirklich im Krankenhaus, zehn Blocks von hier. Kultisten wissen dann ebenfalls Bescheid und warten auf uns. Oder sie haben längst gemerkt, dass wir ihre Abschussliste kennen und ködern uns mit einer fingierten Story ganz gezielt genau dahin, wo sie uns sehen wollen.«
»Korrekt.«
Henry legte den Gang ein und fuhr los.
»Es ist also nicht einmal sicher, dass Casey wirklich noch lebt.«
»Du bist gut vorbereitet«, stellte mein Vater mit einem nahezu unmerkbaren Grinsen auf den Lippen fest.
»Ist das dein Ernst?«
»Natürlich nicht. Aber du hast stets unheimlich viel Glück.«
Er lachte. Wo er recht hatte...
»Der Zugang für die Mitarbeiter ist nicht kameraüberwacht«, bot ich an.
»Wirklich?«
Ungläubig hob Henry eine Augenbraue.
»Unser Gesundheitssystem ist bankrott. Die Sicherheitskamera vor Ort ist noch aus den 90ern. Da ist nichts digital, kein Funk, kein W-LAN. Und das Vorrecht auf die einzige Steckdose an dieser Wand hat die Kaffeemaschine schon vor langer Zeit erhalten«, erklärte ich.
Henry lachte erneut.
»Und schon hat es sich bezahlt gemacht, einen Sohn zu zeugen«, witzelte er und gab meiner Schulter einen sanften Fausthieb. So, wie Väter das mit Söhnen scheinbar machten.
»Dann versuchen wir es so. Du bringst uns da schon durch, kennst bestimmt noch ein paar ehemalige Kollegen«, mutmaßte er nonchalant.
Ich zuckte mit den Schultern und schaltete demonstrativ durch die Radiosender, was ihm als Bestätigung auszureichen schien.
Nach einer Reihe von Radiostationen, auf denen die mit Abstand einfallsloseste Popmusik aller Zeiten lief, fand ich endlich diesen Piratensender wieder, der uns zum punkigen Rhythmus von Time Bomb der Ramones ans Ziel brachte.
»Lenk sie ab, errege aber nicht zu viel Aufmerksamkeit. In der Zeit werde ich herausfinden, wo genau sie unseren vermeintlichen Freund einquartiert haben.«
Henry konnte nicht aus seiner Haut. Für ihn drehte sich alles nur noch um diesen Krieg.
Vielleicht, so nahm ich an, hatten ihn die letzten Jahre voller Chaos und Zerstörung schneeblind gemacht. Alles, was er sah, waren Kultisten. In mir rief sein unbeirrter Fokus eher Sorge als Begeisterung hervor.
»Ich hab ein ungutes Gefühl bei der Sache«, meldete ich an, als wir uns dem Gebäude näherten.
»Du hast immer ein ungutes Gefühl.«
Nun.
Abseits vom Sichtfeld des Krankenhauses geparkt bahnten wir uns zu Fuß den Weg in Richtung Hintereingang. Hier fuhren die Lieferanten, die Krankenwagen, das Personal entlang. Auf dem direkten Weg hätten wir den Helikopterlandeplatz passieren müssen, der von den umliegenden Fenstern sehr gut zu beobachten war. Hätte sich ein Ibis dort verschanzt, wären wir womöglich sofort aufgeflogen. Stattdessen schlichen wir also an großen, fahrbaren Abfallcontainern vorbei, die dank ihres wuchtigen Aufbaus besseren Sichtschutz boten.
Dann erschien die Zufahrtsrampe für Krankenwagen und Transporter vor uns, die durch einen direkten Zugang zur Intensivstation führte. Logischerweise, um Unfallopfern auf kürzestem Weg ärztliche Versorgung zu bieten.
Hinter derselben Tür erwartete uns darüber hinaus eine Treppe in die Kellerebene. Dort war die IT des Hauses, Umkleidekabinen der Mitarbeiter sowie die isolierte Waschküche, in der Operationsinstrumente gekocht und von Keimen befreit wurden. An der Zufahrt stand ein einziger Rettungswagen - wenig Trubel war ein Indikator dafür, dass nicht viel Personal auf den Gängen herumstehen würde.
»Ich gehe runter. Vielleicht kann ich auf ein paar der noch funktionierenden Überwachungskameras zugreifen und finde etwas. Sieh du dich währenddessen auf der Intensivstation um.«
Henry öffnete seine dunkelbraune Lederjacke, unter der er einen Schulterholster verbarg. Schusswaffen sind auf unseren Missionen bisher so gut wie nie zum Einsatz gekommen, darauf verzichten wollte Henry trotzdem nicht. Womöglich war ich dahingehend zu blauäugig, zu idealistisch oder schlichtweg zu feige, aber als er mir ebenfalls eine Pistole anbot, weigerte ich mich, sie anzunehmen. Das hypothetische Szenario, in dem ein Schusswechsel mit diesem Mörderkult zu meinen Gunsten ausgehen würde, erschien mir abwegig. Waffen machen mehr Probleme als sie lösen.
Doch kaum hatte ich den vergilbten Schalter der automatischen Türöffnung betätigt, schallte mir eine altbekannte Stimme entgegen: »Dass ich das noch erleben darf! Gregor, du alte Vogelscheuche!«
»Oh nein«, flüsterte ich zu mir selbst.
Ich hätte es wissen müssen. Direkt hinter dieser Tür befand sich eben nicht nur der Flur, durch den Unfallopfer eingeliefert wurden, sondern auch die besagte, schmeckbar verkalkte Kaffeemaschine, die hier alle Mitarbeiter bei Laune und Verstand hielt. Seitlich schloss sich eine kleine Sitzecke an. Ein Aufenthaltsraum für die Notärzte und Krankentransportfahrer.
Die Stimme gehörte Wolf, einem ehemaligen Kollegen aus meiner Zeit als Sanitäter.
»Na, wie ists bei der Suchtberatung? Hab gehört, du hast da jetzt dein eigenes Büro?«, fragte er in seiner gewohnt übertriebenen Lautstärke. Er musste die 70 Jahre mittlerweile überschritten haben, trug einen schneeweißen Schnauzbart und diese gebräunte, ölige Haut, die alte Männer haben, wenn sie beim jährlichen Sextourismus in Ostvietnam auch mal den Strand unsicher machen.
»Ganz gut. Hab aber den ganzen September über Urlaub und wollte mal vorbeischauen«, antwortete ich, ohne mir mein Desinteresse an einem Plausch anmerken zu lassen.
»Ja perfekt! Michael müsste auch jeden Moment kommen, mit dem haben wir neulich noch über dich gesprochen.«
Michael war mein damaliger Vorgesetzter. Ein klassischer Fall von einem Chef, der von der Arbeit seiner Untergebenen selbst keinen Plan hatte und die Karriereleiter nur durch Glück und rücksichtslose Selbstüberschätzung hinaufgescheitert ist.
»Ach, und das ist Katharina, deine Nachfolgerin«, sagte Wolf und zeigte auf eine füllige Dame in Uniform hinter sich am Fenster. Sie winkte kurz und widmete sich wieder ihrer Zigarette, deren Qualm sie seitlich aus ihrem Mund in Fensterrichtung ausblies.
»Freut mich. Das hier ist mein Dad«, komplettierte ich die Vorstellungsrunde.
Wolf reichte meinem Vater die Hand, der jedoch so tat, als habe er die freundliche Geste nicht bemerkt.
»Das ist wirklich dein Vater«, stellte Wolf fast unhörbar flüsternd fest und richtete den Kragen seines stets zu engen Polohemdes. Gewiss wollte er darauf anspielen, dass auch ich mir hier einen Namen als jemand gemacht hatte, der sich unter absolut keinen Umständen berühren lassen wollte.
»Heute schon irgendwas Spannendes erlebt?«, fragte mein Vater mit fast nicht wiederzuerkennender Intonation. Unglaublich, wie mühelos er einen normalen Menschen imitieren konnte.
»Nicht wirklich. Das Übliche eigentlich, aber meine Schicht hat gerade erst begonnen. Neulich hat sich wieder jemand einen halben Werkzeugkoffer in den Allerwertesten geschoben, das war spannend...«, jauchzte Wolf und füllte seine Tasse mit frisch gekochtem Kaffee auf, als wäre das ein völlig normaler Satz gewesen.
»Aber davon abgesehen ists momentan eher ruhig. Meistens sitze ich hier oder aufm Wagen und bilde mich weiter.«
Es war seit jeher nur eine Frage der Zeit, bis Wolf das Gespräch unweigerlich in Richtung seiner laienhaften Leidenschaft für Naturkunde lenkte.
»In letzter Zeit irgendwas Aufschlussreiches gelesen?«, erkundigte ich mich ähnlich bemüht, glaubhaft interessiert zu klingen.
»Klar! Wusstet ihr zum Beispiel, dass Schmetterlinge die Tränen von Schildkröten trinken?«, verkündete der alte Mann sichtlich fasziniert.
»Cool«, antwortete ich knapp nickend. Wie habe ich das eigentlich all die Jahre ausgehalten? Vielleicht half mir das Wissen, wie er später von uns scheiden würde, die Tage mit ihm auszuhalten. Er würde auf einer Baustelle, auf der er illegale Abkürzungen der Bauregularien anordnete, von einer Abrissbirne zerquetscht werden.
Ich hatte mir oft vorgenommen, ihn zu warnen. Diesen schmerzhaften Tod abzuwenden, damit er hoffentlich durch eine sanftere Art, von uns zu gehen, abgelöst wird. Doch dann saßen wir wieder im Rettungswagen und ich durfte mir Alte-Weiße-Männer-Scheiße anhören: Transsexualität sei lediglich eine Geisteskrankheit, die unsichtbare Hand der Marktwirtschaft regelt das schon mit den Spritpreisen und in der Grundschule müsse wieder mehr gebetet werden.
Dann überließ ich das mit seinem Tod eben wieder dem lieben Gott. Der wird sich schon was dabei gedacht haben.
Noch bevor Wolf für einen weiteren Naturfakt tief Luft holte, lenkte mein Vater das Gespräch seinem Ende entgegen: »Wir wollen auf Station noch jemanden besuchen.«
Gerade, als die kräftezehrende Interaktion überstanden schien, klinkte sich eine weitere Person in das Wiedersehen ein. Ein kleingewachsener, schwer behaarter Mann mit südländischem Teint und den wohl grellgelbsten Crocs an den Füßen, die mein Augenlicht je verarbeiten mussten, kam die Treppe herunter. Sein Antlitz offenbarte sich mit jeder Treppenstufe wie bei einem Faxgerät, das einen ungewollten Mahnbrief etappenweise ausspuckte.
Das war Michael, mein ehemaliger Abteilungsleiter. Von Mitarbeitern wurde er liebevoll Dwayne The Croc Johnson genannt. Ein außerordentlich begeisterungsfähiger Halb-Portugiese mit Hang zur Theatralik, wann immer auch nur das kleinste Detail nicht seinen Vorgaben entsprach. Was in dieser Branche durchaus Sinn ergeben würde - hätte er denn selbst Ahnung von den vielen Aufgaben gehabt, die er nur allzu gern delegierte. Sicherlich einer der vielen Gründe, weshalb ich mein Glück seinerzeit in einer neuen Stelle suchte.
Entkommen konnte ich offensichtlich nicht: Besohlt mit leuchtenden Gummischuhen stand er wieder vor mir und musterte mich mit weit hochgezogenen Augenbrauen.
»Der berühmte Held erweist uns die Ehre!«, stieß er hervor und joggte den Rest der Treppe hinab.
»Ich kanns auch kaum glauben«, schnaubte ihm Wolf über die Distanz des Krankenhausflurs entgegen.
Mein Vater warf mir einen besorgten Blick zu. Die Aufruhr gefährdete unser Vorhaben. Eine Menschentraube aus Schaulustigen rund um einen Typen, der vor ein paar Jahren mal wegen einer übernatürlichen Rettungsaktion in der Zeitung stand, war dem Fortschritt kaum zuträglich.
Noch bevor ich genug Luft in meine Lungen ziehen konnte, um eine dringliche Ausrede zu formulieren, überbrückte Michael die Meter zwischen uns. Seine pelzigen Arme initiierten den Versuch einer Umarmung. Mich beunruhigte, dass Michaels Brusthaar selbst in einem Rollkragenpullover gut zu erkennen wäre, doch an dieser Geste gab es deutlich mehr auszusetzen:
Nach wie vor hatte ich das qualvolle Phänomen nicht unter Kontrolle, welches sich abspielte, wenn ich mit einer anderen Person in Hautkontakt trat.