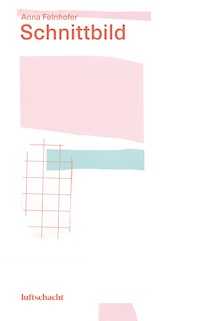
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luftschacht Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Silvester 2016. Fabjan sitzt mit seiner Leica am Fenster. Er blickt auf die vergangenen Monate zurück, in denen er mit einer Frau in ein Spiel geraten ist. Mit jedem Treffen wird er abhängiger von ihr, bis er am Ende überzeugt ist, nicht mehr ohne sie zu können. Frühling 1981. Ein vierzehnjähriges Mädchen wird in die Psychiatrie eingewiesen, nachdem es versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Es vertraut sich einer Psychologin an. Aber ausgerechnet diese Person erweist sich als Falle für die junge Patientin. Sommer 2004. Erik ist zum ersten Mal, seit vor sieben Jahren seine Frau im Urlaub an der Adria verschwunden ist, auf dem Weg in eine Auszeit in den Kitzbühler Alpen. Doch dieser Aufenthalt wird zu einer Belastungsprobe. Herbst 2017. Eine Frau kann seit fünf Nächten nicht mehr schlafen. Sie wird verfolgt und sie weiß, dass es ihre früheren Fehltritte sind, die sie in diesem Herbst einholen. Anna Felnhofer erzählt in ihrem Prosadebüt Schnittbild mit großem Sprachgefühl von Begegnungen zwischen jeweils zwei Menschen, deren augenscheinlichste Gemeinsamkeit der Kontakt zu einer Frau ist, die als Therapeutin mit den Protagonisten in Berührung kommt. Sie ist es gewöhnt, eine Rolle zu spielen, und sie ist eine Meisterin darin; die vier Episoden setzen dort an, wo die Rolle der Therapeutin brüchig wird und wo Sprünge in einer sorgfältig komponierten Fassade allmählich ihr wahres Gesicht freilegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Silvester 2016. Fabjan sitzt mit seiner Leica am Fenster. Er blickt auf die vergangenen Monate zurück, in denen er mit einer Frau in ein Spiel geraten ist. Mit jedem Treffen wird er abhängiger von ihr, bis er am Ende überzeugt ist, nicht mehr ohne sie zu können. Frühling 1981. Ein vierzehnjähriges Mädchen wird in die Psychiatrie eingewiesen, nachdem es versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Es vertraut sich einer Psychologin an. Aber ausgerechnet diese Person erweist sich als Falle für die junge Patientin. Sommer 2004. Erik ist zum ersten Mal, seit vor sieben Jahren seine Frau im Urlaub an der Adria verschwunden ist, auf dem Weg in eine Auszeit in den Kitzbüheler Alpen. Doch dieser Aufenthalt wird zu einer Belastungsprobe. Herbst 2017. Eine Frau kann seit fünf Nächten nicht mehr schlafen. Sie wird verfolgt und sie weiß, dass es ihre früheren Fehltritte sind, die sie gerade einholen.
Anna Felnhofer erzählt in ihrem Prosadebüt Schnittbild mit großem Sprachgefühl von Begegnungen zwischen jeweils zwei Menschen, deren augenscheinlichste Gemeinsamkeit der Kontakt zu einer Frau ist, die als Therapeutin mit den Protagonisten in Berührung kommt. Sie ist es gewöhnt, eine Rolle zu spielen, und sie ist eine Meisterin darin; die vier Episoden setzen dort an, wo die Rolle der Therapeutin brüchig wird und wo Sprünge in einer sorgfältig komponierten Fassade allmählich ihr wahres Gesicht freilegen.
ANNA FELNHOFER, *1984 in Wien, Studium der Psychologie in Wien und Warschau, Promotion 2015. Arbeitet als Wissenschaftlerin und Klinische Psychologin an der MedUni Wien. Gründung und Leitung eines virtuellen Realitäts-Labors (PedVR-Lab) und der internationalen wissenschaftlichen Zeitschrift Digital Psychology. Zahlreiche wissenschaftliche Publikationen und Herausgabe dreier Lehrbücher (UTB, BELTZ).
Parallel dazu literarische Lesungen und Veröffentlichungen unter anderem im Podium, Sterz, Am Erker, in den Konzepten und Lichtungen. Platzierung auf der Shortlist des FM4-Wortlaut-Kurzgeschichtenwettbewerbs 2018 und 2. Platz beim Emil-Breisach-Literaturpreis 2020 der Akademie Graz.
Anna Felnhofer
Schnittbild
Episodenroman
Für Eva.
© Luftschacht Verlag – Wien
luftschacht.com
Alle Rechte vorbehalten.
1. Auflage 2021
Umschlaggestaltung: Elisabeth Danzer
@elisabeth.danzerelisabethdanzer.com
Lektorat: Teresa Profanter
Satz: Luftschacht
gesetzt aus der Metric und der Noe
Druck und Herstellung: Finidr s.r.o.
Papier: Munken Print Cream 100 g/m2, Surbalin glatt 115 g/m2
Gefördert von der Stadt Wien Kultur
ISBN: 978-3-903081-86-4
ISBN E-Book: 978-3-903081-87-1
Wenn jemand alles ist für einen anderen,dann kann er viele Personen in einer Person sein.(Ingeborg Bachmann)
Inhaltsverzeichnis
Milch
Mohn
Minze
Marzipan
Milch
Vielgestalte Fallen, überall lauern sie, zuletzt in der Ödnis der Warteschlange, in der er schwitzend steht, das Paket unter der Achsel, eine Nummer, kein Mensch, dabei aufs Äußerste entschlossen, dem Kreislauf, diesem ständigen Stirb und Werde, zu entkommen. Aber dann stolpert er hinaus und schon in die nächste Falle hinein. Woran er vorbeikommt, das rührt auf, verstört, wie der Anblick der Kastanie vor dem leeren Himmel, oder jener der Kindermütze auf dem Hydranten. Oder der Spatz, das zertretene Köpfchen unter dem Laub, oder die Hundescheiße, die Zigarettenstummel, die schiefe Bordsteinkante, der unabsehbare Verlauf der Straßen, der Lärm, die Leute, man will einfach nur abschließen mit allem.
Was ihm nie gelungen ist: Seine eigene Linie zu ziehen, in die er als Gesamtes eingehen könnte, ohne Risse zu verzeichnen in sich.
Er sperrt die Tür auf und tritt in die kalte Wohnung.
Fünf Monate seit Lenas Auszug. Es war im Sommer gewesen, Mittagsglut schon am Morgen, Sehnsucht nach einem Luftzug, nach Gänsehaut, nach dem flüchtigen Eindruck des Enthobenseins. Er war mit geschlossenen Augen dagelegen, den Kopf überstreckt, den Mund offen, die Hand auf dem steifen Glied, keine ansehnliche Pose, obschon dem Augenblick, den er instinktiv als einen irgendwie aus allem herausgefallenen, außergewöhnlichen, in keinem Fall alltäglichen erfasste, wohl nicht ganz unangemessen. Lena war neben ihm gesessen, nackt wie er, und hatte zunächst mit der Fingerkuppe absichtslos sein Schienbein berührt, dann sein Knie, kurz auch die Innenseite des Oberschenkels, und schließlich das Schambein. Am Ende hatte sie ihm den Ellenbogen in die Rippen gestoßen. „Ich gehe“, hatte sie gesagt. Ihr leichter, biegsamer Körper war dabei ständig in Bewegung gewesen, kein Kinderkörper mehr, wie ganz zu Beginn, als sie noch voreinander hatten bestehen können. Jetzt saß eine Frau neben ihm. Und er wusste, dass diese Veränderung nicht ohne ihn geschehen war.
Er hatte den Ernst des Moments erkannt und seine Tragweite, aber er hatte nichts unternommen. War dagelegen, die Hand im Schritt, hatte daran gedacht, dass sich einem die Zeichen erst im Nachhinein als solche erschließen: Da leben wir tagein, tagaus mit einem Menschen zusammen, richten uns nach ihm, formen uns nach ihm, werden anteilig zu ihm und sind ihm dadurch näher als allen anderen Menschen, und zugleich wissen wir, ahnen es nicht nur, sondern sehen es, tagein, tagaus, dass dieser Mensch ein lächerlicher ist. Und begreifen es dennoch erst hinterher. Wie einem der Verstand nachstolpert, hatte er an jenem Morgen gedacht, während er sich aufgesetzt hatte, die Augen noch immer geschlossen, und sich über seine kindische Hoffnung geärgert hatte, sie mögen einander, wenn es nun schon zu Ende ging, immerhin wieder begegnen, unter anderen Umständen, in einer anderen Zeit, und allem voran frei von den falschen und den richtigen, ja, einfach allen Bildern, die sie sich bislang voneinander gemacht hatten. Tabula rasa. Wieder ihr Ellenbogen, diesmal schmerzhaft. „Ich gehe“, hatte sie gesagt. „Mach die Augen auf, wenn du es sehen willst.“
Er lässt die Tür ins Schloss fallen und streift die Jacke ab, dann auch den Pullover, und bleibt eine Weile so im Halbdunkel des Vorzimmers stehen. Ohne Zeugen. Was wäre, wenn er auf immer so stehen bliebe? Aber dann setzt er doch, weil er es immer so gemacht hat, den Schritt, dann noch einen und noch einen, bis er am Wohnzimmerfenster steht, die Härte der Scheibe zwischen sich und diesem grellen Wintertag, dem letzten des Jahres. Er nimmt die Leica, die griffbereit auf der Fensterbank liegt, und schiebt damit ein weiteres Stück Glas zwischen sich und die Welt. Und so steht er dann, wie er immer steht, die Ellenbogen auf der Fensterbank, die Stirn glatt und kalt, und hält den Atem an, denn er weiß: Die geringste Verschiebung, wenn auch nur um einen hundertstel Millimeter, bringt die Dinge durcheinander, bricht das Bild.
Wie dieses eine Mal, ganz zu Beginn, als sie ihm seine Vorstellungen noch nicht zurückgeworfen hatte. Sie steht nach dem Duschen auf Zehenspitzen vor dem eierförmigen, hoch hängenden Spiegel und zupft ihre Augenbrauen, eine Pobacke höher als die andere, der Rücken zu einem S verbogen, der Nacken in Falten, alles verrückt und verschoben und zugleich vollendet, wie es nur ein werdender Körper sein kann. Dazu die Bikinilinie, die ihre Rückseite in eine hellere und eine dunklere Hälfte teilt, sie gleichsam kartographiert. Er schleicht sich an sie heran, geht hinter dem Türstock in Deckung, streckt sich aus seinem Hinterhalt nach vorn, den Oberkörper balancierend, die Arme gespannt, das Auge am Sucher, und baut mit gesammelter Behutsamkeit das Bild um ihre Form herum auf, achtet dabei auf ihre Lage im Rahmen, achtet auf das Zusammenspiel des Lichtes, auf seine Reflexe wie auch auf die Verletzlichkeit und den wundersamen Zusammenhalt ihrer Haut. Als er aber auf den Auslöser drückt, als er den Augenblick, diesen moment décisif, der Zeit entreißt, ist es zu spät. Lena ist aus dem Bild geglitten.
Ein Auseinander ohne Ineinander, denkt er, und er denkt, dass er das irgendwo gelesen haben muss. Sackgasse. Suspense ohne Auflösung. Im Nachhinein weiß er nicht mehr, wie es gekommen war, ja, wie sie beide überhaupt an dieser Stelle angekommen waren, an diesem unsinnigen Frühlingstag, der so unerbittlich geleuchtet hatte, als habe er sie beide verhöhnen wollen. Lena war, genauso wie er, im kurzärmeligen T-Shirt auf einem Umzugskarton gesessen, hatte ihre sorgfältig pedikürten, jedoch unlackierten Zehen in einen Sonnenfleck getunkt und den Blick durch diese fremde Umgebung wandern lassen, ein wenig erstaunt darüber, wie auch er, dass sie nun hier saß, in dieser unbekannten Wohnung, mit diesem ihr im Grunde unbekannten Mann, der ihr um eine nicht unbeträchtliche Anzahl an Jahren voraus war. Zugleich war es, das wusste sie, auch für ihn sein erster Entwurf für ein Leben zu zweit. Mit ihr, hatte er gesagt, wolle er es wagen, und das hatte dem Kind geschmeichelt.
Also arrangierten sie sich, und was schließlich blieb, waren alberne Details, allenfalls Fußnoten einer Geschichte, die eine gemeinsame hätte werden können: Die Einsicht in fremde Leben, unter Zwang, weil die hohen Fenster auf eine viel zu nahe Häuserfront zeigen; die hellhörigen Außenmauern; die donnernde Zubringerstraße zwei Häuserblocks weiter, darüber die Flugschneise nach Schwechat; die Nachbarn mit ihren Fersen aus Stein; die Duschkabine in der Durchgangsküche zwischen der undichten Waschmaschine und dem altersschwachen Herd; der Gemeinschaftsabort im Stiegenhaus und die aus diesem Umstand folgende Gewohnheit (und das sich kontinuierlich steigernde Geschick), nachts in der Dusche so zu pinkeln, dass der andere von dem Geräusch nicht aufwachte.
Was bleibt, sind diese albernen Details. Vieles vergisst man auch. Wie das plötzliche Anschwellen eines vormals ungekannten Wahns, als er glaubt, einen anderen an ihr zu riechen. Oder die Szene, die er ihr macht, als sie einmal nicht erreichbar ist, oder die Verzweiflung, eines Nachts, als er es nicht mehr mit ihr aufnehmen kann und selbst ihr nachsichtiger Eifer nichts daran zu ändern vermag. Die allmähliche Überzeugung: Er ist diesem Kind nicht gewachsen. Dabei sind es, darauf weist sie ihn wiederholt hin, unter Lachen, weil sie ihn aus Prinzip nicht ernst nimmt, dabei sind es, wie sie sagt, nur zwanzig Jahre, und er ist noch lang kein alter Mann.
Er seufzt. Schließt die Augen. Öffnet sie. Schaut durch den Sucher. Im Schnittpunkt zweier hinabstürzender Linien ruht wie eine Perle das Halbrund einer Pfütze, bis an den Rand wie mit Quecksilber gefüllt. Blaustichig wirft sie den Himmel zurück, diesen schneelosen, wolkenlosen Winterhimmel, und weiter links, etwas abgerückt von ihrem östlichen Ufer, im Zusammenlauf des Bordsteins und der Fahrbahn, zieht etwas vorbei, er sieht es aus dem Augenwinkel. Als er das Objektiv ausrichtet, ist es weg.
Er lässt die Leica sinken. Eine M Monochrom, Typ 246. Ihr fehlt, ohne ihm abzugehen, der charakteristische rote Punkt. Er dreht das griffige Gehäuse um, prüft das Bild. Was enttäuscht, ist nicht der Mangel an Schärfe, sondern die Abwesenheit des Motivs: ein milchheller Fleck auf einem wie mit Kohlestaub benetzten Grund. Die üblichen Macken, er hat die M Monochrom gerade deswegen erstanden; sie lässt sich nicht bitten, diese Feindin der Bewegung. Man muss, um den Fokus auszurichten und das mittige Schnittbild mit dem Sucherbild deckungsgleich übereinanderzulegen, den Winkel dauernd ändern, die Position ständig anpassen, sie zwingt zur Wiederholung, sie ist wie ein Tanz um eine Mitte, die sich unaufhörlich entzieht. Fotografieren als Iteration zur Wirklichkeit. Und selbst dann gelingt es nicht immer, es bleibt stets eine Unschärfe. Er drückt auf den Knopf.
Ob er es wirklich löschen wolle?
Im Rückblick stören die perspektivischen Verschiebungen, man weiß nicht mehr, wann man welche Erfahrung gemacht hat und ob überhaupt. Wie jene mit Lena, im Frühjahr, in ihrem ersten gemeinsamen Urlaub. Schon am ersten Morgen hatte er sie zum Bahnhof gefahren, eine Kapitulation, die sie beide überrascht hatte. Dieses Bild von ihnen, im Mariazellerland, vor einer gleichgültigen Kulisse: Da waren, wie immer, und nur mit Anstrengung zu übersehen, das Warnschild, die Serpentine, die gebürstete Leitplanke als Angelpunkt für die Böschung, und links die jähe Verjüngung der Straße. Er kannte diese Kurve von den Sommern, die er hier als Kind verbracht hatte, kannte auch das elfenbeinerne Kreuz, seine in den Felsen gehauene Nische, darin das rote Flackern, das seit jeher am Leben gehalten wurde. Was neu war, obschon nicht unerwartet, das war der entgegenkommende Wagen. Ein blauer Pick-up mit getönten Scheiben, die Sonne spiegelte, es blitzte, und dann war es, als habe sich der Moment selbst überholt mitsamt dem jungen Nachmittag und seinem flatternden Licht, den hoch liegenden Wolken und einem Himmel, der sich von Gipfel zu Gipfel spannte.
Aber Lena interessierte das nicht. Ihr Blick klebte am Display, die Ohren rot vor Hitze, der Nacken feucht. Sie hatten die Jacken ausgezogen, sie auch die Schuhe, und einen Fuß hatte sie untergeschoben, sodass sie jetzt schief saß, die Schläfe an der Scheibe, eine Schulter wie zur Abwehr hochgezogen. Das helle Haar war in Unordnung geraten, als sie den Pullover ausgezogen hatte, mit überkreuzten Armen über der Brust, wie es Frauen tun, also auch sie, wenngleich es bei ihr nicht ganz richtig wirkte. Wie so vieles, dachte er, das sich ihr noch nicht erschlossen hatte.
Er drehte die Heizung zurück und öffnete die Fenster einen Spalt. Die Bewegung der Scheibe brachte Lena aus der Fassung. Sie sah hoch, ein Ausdruck empörter Verstörung, aber im nächsten Moment hatte sie es vergessen. Lümmelte über dem Handy und warf die Stirn in Falten. Er drehte die Musik lauter. Lichtflecken tanzten im Inneren des Wagens, es flimmerte, und Lena musste die Augen zusammenkneifen, um etwas auf dem Display zu erkennen. Er hatte auf einen Sinneswandel gehofft, auf ein Innehalten und eine Auflösung, aber sie fuhren, als gäbe es keinerlei Verbindlichkeiten mehr zwischen ihnen, jeder in seinem ihm zugestandenen Winkel dieser Welt. Er klappte den Sonnenschutz auf ihrer Seite hinunter, legte beide Hände aufs Lenkrad und versuchte nicht daran zu denken, dass er das Kind, dass das Kind und er, dass sie beide möglicherweise zum letzten Mal, nicht nur hier, sondern überhaupt, ja, dass es vorbei sein könnte.
Serpentinen, gleichmäßig in die Landschaft gewürfelt. Ihn schwindelte, und als sie den steil abfallenden Forstweg schnitten, wusste er: Es war nicht mehr weit. Er stieg aufs Gas, Lena bemerkte es nicht. Schmiegte sich in die Kurven, schaukelte mit, ließ sich von der Fliehkraft mal hierhin, mal dorthin drücken, ließ es mit sich geschehen, lehnte sich nicht auf.
Vorn das Warnschild, zwei schlangenartige Linien, schwarze Vipern, über einem zerbröselnden Hang. Giftgelb in dem Licht. Darunter, leicht nach rechts versetzt, der blaue Pickup und mit ihm zwei Möglichkeiten, die ihn schlagartig vor eine Wahl stellten. Links oder rechts. Er begann zu schwitzen, aber es war zu spät, die Wahl getroffen, die Ereignisabfolge angestoßen, und er konnte nur noch zusehen, wie er das Lenkrad herumriss, wie er dann zuerst den rechten Fuß hochhob, kurz darauf auch den linken, schließlich die Hände vom Lenkrad nahm, als perpetuierte er damit die jahrhundertealte Geste des Kapitulierens, und dabei einen Blick auf das Kind warf, das noch nichts begriffen hatte, vielleicht nichts mehr begreifen würde, und das tröstete ihn in der himmelschreienden Verlorenheit dieses Moments ein wenig.
Ist der Mensch auf gewisse Erfahrungen angewiesen?
Den Beamten erklärte er es später mit Sekundenschlaf, und damit gab man sich zufrieden. Von Glück war die Rede, von einem schicksalhaften Zusammenspiel der Umstände, man stelle sich vor, die Tanne wäre woanders gestanden oder er nicht so schnell gewesen oder die Hilfe nicht gleich vor Ort, und so weiter und so fort, im Grunde aber wollte man sich natürlich gar nichts vorstellen, und so war er den Beamten dankbar, dass sie das Grübeln bald aufgaben und ihn und Lena in die Hände der Ärzte entließen.
Was folgte, war eine süße, sanfte Zeit. Eine unverhoffte Begegnung. Lena erholte sich von ihrer Gehirnerschütterung und der verstauchten Schulter zunächst in der wattigen Dämmerung des Melker Landeskrankenhauses und, als man sich mit ihren Fortschritten zufrieden zeigte, anschließend in der vertrauten, kleinteiligen Welt des gemeinsamen Wohnschlafzimmers. Sie war in dieser Zeit so anschmiegsam, so warm und weich, ja richtiggehend biegsam, wie sie da in seiner Umarmung lag. Und sie schmeckte süß und zugleich würzig und trug den dicken Geruch von Milch auf ihrer Haut. Seine Hand zitterte, wenn er sie berührte, und er näherte sich ihr, wie man sich einem scheuen Tier nähert, auch mit der Leica, und so entstanden diese elfenbeinernen Aufnahmen von ihr, keine anderen Bilder sollten in dem zerbrechlichen Zusammenspiel aus Licht und Schatten jemals wieder diese Perfektion erreichen. Lena in der weichen Nachmittagssonne, ihr Gesicht, umgeben von einem knisternden Haarkranz, die helle, rosige Haut, die über den Wangen spannte und mattrot schimmerte. Das Gepolsterte ihrer kindlichen Hände. Die ungebrochene Glätte ihrer Nägel. Das Leichte, Katzenartige ihrer Bewegungen, die die Leica nicht einfangen konnte, oder nur in Ansätzen, nur in dem zaghaften Abdruck, den sie hinterließen.
Er ertappte sich dabei, dass er sie ständig berühren wollte, sie beim Einschlafen unentwegt hielt und streichelte und an ihr roch, als hätte er Angst, sie könne ihre wundersame Beschaffenheit über Nacht verlieren. Er war in dieser Zeit versöhnt mit allem, und er wollte daran glauben, dass er es bleiben würde. Wochen vergingen, und er war nie glücklicher in seinem Leben. Zugleich begriff er diesen Zustand als einen vorübergehenden, und so enthielt diese Zeit neben dem purzelbaumschlagenden Glück auch eine leise, beständig bohrende Bedrücktheit, nicht eigentlich Trauer, vielmehr die Vorahnung eines Verlustes. Und tatsächlich sprang Lena eines Tages plötzlich wie von einer Eingebung getrieben von ihrem Krankenlager auf, lief in die Küche und dann durch diese hindurch zur Duschkabine, wo sie sich vor dem viel zu hoch angebrachten Spiegel zunächst recht umständlich die Haare zurechtmachte (er beobachtete es aus dem Wohnzimmer), sich dann schminkte, mit Lidstrich und Mascara, wie vor dem Unfall, nur nachdrücklicher, sich, was sie zuvor nie gemacht hatte, die Fuß- und Fingernägel lackierte, sich einen Spitzen-BH und einen schmalen Tanga anzog und am Ende über ihn herfiel, keine Spur von Zerbrechlichkeit. Und als sie so auf ihm saß und sich an seinen Schamhaaren abrieb, als sie ihn so bearbeitete, während er die Augen geschlossen hielt und versuchte, ihr standzuhalten, beugte sie sich unversehens zu ihm hinunter, drückte sein Gesicht auf die Seite und spuckte ihm ins Ohr. Er riss unversehens die Augen auf, sah sie entsetzt an, aber da packte sie seine Hand, umklammerte seinen Zeigefinger und rammte ihn sich in den Anus.
Er sieht auf die Pfütze hinab, auf ihr wolkiges Schmutziggrau. Eine Perle im trüben Asphalt, über ihrer glatten Wange senkt sich der Himmel herab. Die blaue Stunde. Ideal für Available-Light-Fotografien, aber er hat genug. Er steht auf, geht durch das quadratisch angelegte Wohnzimmer in die Küche, die eigentlich ein Vorzimmer ist, und spült die Hände mit lauwarmem Wasser ab.
Er ist jetzt neununddreißig. Ein unbestimmtes Alter, unfreiwilliges Verweilen in der Zeit. Da ist keine festgefügte Vorstellung, der man genügen muss, es ist, so scheint es, an diesem Punkt noch alles möglich. Zugleich aber gibt es Freunde, die dieses Alter nicht überlebt haben, der Krebs beginnt seine Arbeit früh, und wenn es nicht der Krebs ist, dann ein Unfall, ein Aneurysma, irgendeine Unregelmäßigkeit in der inneren oder äußeren Welt, die den Einzelnen bricht. Es ist wie mit seinen Aufnahmen: Zunächst baut man sich seine Welt, baut eine vollendete Symmetrie, ordnet alles entlang des Schnittpunktes zweier Linien an, um das Auge des Betrachters nur auf diesen einen Punkt, dieses Einzige, zu lenken, und dann passiert etwas, links oder rechts davon, und kurz darauf ist die Symmetrie gebrochen, die Perspektive dahin, das Motiv verloren. Es gibt nur diesen einen Versuch.
Er schraubt die gusseiserne Espressokanne auf, nimmt ihren bauchigen Behälter ab, spült ihn ab, spült auch den schlanken Hals und das metallene Sieb, und schnappt sich dann die Handmühle. Als er das Pulver ins Sieb rieseln lässt, riecht es herb, er setzt das dreiteilige Behältnis mit geübten Griffen zusammen und stellt es auf den Herd.
Lenas SMS am Vormittag. Ob er kommen wolle, schrieb sie. Ahnungslose, brutale Lena. Ob er am Abend zur Silvesterfete kommen würde? Dieses wundersame Kind, das sich, nachdem es ein paar Männer in Windeseile und wohl ohne sonderliches Interesse durchprobiert hatte, mit dem nächsten Herren, der sein Vater sein könnte, eingelassen hatte. Harald und sie, schrieb Lena, gäben eine Party. Es gibt Menschen, denkt er, die, wenn sie fallen, nur bergauf fallen können.
Irgendwo im Raum beginnt es zu gurgeln, dann riecht es verbrannt, und kurz bevor der Kaffee bitter wird, hebt er die Kanne von der Platte. Schon der Griff um die henkellose Keramik erwärmt ihn, dann der Schluck, und er will daran glauben, dass er nie mehr frieren muss. Er setzt sich auf die Couch, die sein Bett ist, und sieht sich im Raum um, als sehe er ihn zum ersten Mal. Altbau. Wände wie Schwämme. Er hatte es schon beim Einzug im Frühling geahnt und vorsorglich doppelte Daunendecken und eine mobile Heizung besorgt, die sich bereits nach der dritten Inbetriebnahme verabschiedet hatte, und so bleibt ihm nichts, als ohne Unterbrechung Tee zu kochen, zur Abwechslung auch Kaffee, und Suppen zu löffeln und sich in einer höheren Frequenz, als dies einem Durchschnittserwachsenen zusteht, unter die Dusche zu stellen. Die Gaskosten werden explodieren, aber man muss ja irgendwie ein Mensch bleiben. Dabei ist es, das weiß er, weniger der Frost oder die Dunkelheit, oder überhaupt das bleierne Gewicht eines außergewöhnlich kalten Winters, der Abstieg hatte schon früher begonnen.
Er weiß nicht mehr, warum ausgerechnet Lena. In der Schule hatte sie es immerzu ihren Altersgenossinnen gleichgetan und sich, unter seiner Nachmittagsaufsicht, in den Ecken des Turnsaals herumgedrückt, unablässig kichernd, ununterscheidbar von den Mitschülerinnen, und genauso albern wie sie. Das Anziehendste an ihr war vielleicht noch die Blässe gewesen, diese fast weißen Haare, die unwahrscheinlich helle Haut, das Kieselgrau ihrer Augen und die Adern und ihr vielverzweigtes Netz an den dünnen Stellen, den Schläfen, den Handrücken und Arminnenseiten. Oder ihre kindlichen Bewegungen. Das Unfertige, Unreife an ihr. Am Ende war es aber wohl nur ein dummer Zufall gewesen, der ihrer beider Wege kreuzen ließ, im Herbst nach ihrer Matura, man kannte sich, erkannte einander schon von Weitem auf der Mariahilfer Straße, also blieb man stehen, ein Wort ging in das nächste über, und als man beim Eiskaffee saß, war es, so dachte er, noch nicht zu spät. Ein unverfänglicher Tratsch mit einer ehemaligen Schülerin, man würde ihm nichts vorwerfen können. Aber dann flog ihn eine Bewegung an, eine Kleinigkeit im Grunde, und doch fiel sie auf, trat aus der tumben Gleichmäßigkeit aller sich sonst im Alltag vollziehenden Bewegungen hervor. Sie wischte sich einen Eisrest mit dem Daumen vom Kinn. Eine flüchtige, nichtige Geste. Er saß wie verzaubert und wunderte sich darüber, dass sein Gefühlsrepertoire solche Empfindungen überhaupt zuließ, er wollte es nicht glauben, und er glaubte es noch nicht, als er schon auf ihr lag, verwirrt über die nicht vorhandenen Rundungen, und betreten, weil sie verkrampfte und auch der vierte und fünfte Versuch in jeweils unterschiedlichen Stellungen nicht zum gewünschten Ergebnis führen wollten. Also robbte er hinunter, küsste sie lange und nicht wenig genussvoll, und in einem Moment, da sie es nicht erwartete, glitt er in sie. Und vielleicht war es noch nicht einmal da, dass er es besiegelte. Auch das zweite und dritte Mal geriet ihnen der Sex unbeholfen, und am Ende traf es sich einfach, dass sie aus der elterlichen Wohnung ausziehen wollte und er auf der Suche nach einer größeren war. Es brauchte keine komplizierten Überlegungen, es fügte sich alles ineinander, und einige Wochen später teilten sie die Schlüssel ohne viel Aufhebens untereinander auf: Einer für sie, einer für ihn, und der Ersatzschlüssel bei ihren Eltern.
Eine Beziehung in fast forward.
Bis zum Anbruch des Sommers, diesem späten Nachmittag, als es zu einem unvorhergesehenen Halt kommen sollte. Ein Flugzeug folgte auf das nächste, die Nachbarn hörten Musik am Anschlag, und unten auf der Straße brüllte ein Säugling, aber es war zu warm, um die Fenster zu schließen, also stopfte er sich, eine fast schon mechanische Tätigkeit in diesen neuen Räumlichkeiten, Ohropax in die Ohren und versuchte, sich auf das Buch zu konzentrieren. Sein vierter Anlauf. Die Buchstaben gingen in Wellen, die beruhigend lineare Ordnung des Gedruckten löste sich mit einer beständigen Boshaftigkeit auf, und der Zusammenhalt der Sätze entglitt ihm. Er hielt sich die Stirn, drückte sich die Finger in die Ohren. Und als er gerade das Buch wutentbrannt zuschlagen wollte, nahm er eine Bewegung im Raum wahr, am Rande seines Gesichtsfeldes, in der quadratischen Ausnehmung der Mauer, die in die Küche und zur Duschkabine führte. Er zuckte zusammen, sah nochmals hin, blinzelte, aber alles stand still. „Jetzt nicht“, rief er vorsorglich in die Richtung, aus der nun auch trotz der Ohropax Geräusche zu ihm drangen. Er ärgerte sich über das Flehentliche seiner Stimme, er pflückte die Schaumstoffstöpsel aus den Ohren und räusperte sich: „Lena, ich meine es ernst.“ Das Buch hatte er nun endgültig zugeschlagen und auf seine Knie gelegt. Noch blieb er sitzen, es gab keinen Ausweg, das wusste er, es sei denn, er konnte sie überzeugen. In der Duschkabine wurde es lauter, und er saß wie festgeklebt auf seinem Stuhl. Nun konnte es nicht mehr lange dauern. „Lena, bitte –“, wieder das Erbärmliche in seiner Stimme, er hasste sich selbst dafür. Kurz der Gedanke an die Zeit nach dem Unfall, an ihre elfenhafte Weichheit, die Zartheit ihrer Bewegungen, das Verletzliche ihres Körpers, die Reinheit, ihre Unschuld. Ihr Gesicht hatte, als er es jeden Morgen wachküsste, gestrahlt, und er hätte vor Glück weinen können. Als er sie im Türrahmen erblickte, zuckte er zusammen. Sie stand nackt da, einen Arm um den Bauch, den anderen am Türstock, und zwischen ihren Beinen hing etwas, das da nicht hingehörte, es war ihm nicht unbekannt, wie auch ihr Blick, und er wusste, dass es nun zwecklos war, er hatte verloren, schon beim ersten Mal, als er, weil er dachte, es würde ihm das rekonvaleszente Kind zurückbringen, in die erniedrigende Prozedur eingewilligt hatte. Und so lag er wenig später auf dem Bauch, gehorchte einer Stimme, die nicht ihre war, und versuchte ruhig und gleichmäßig zu atmen und sich zu entspannen, umso mehr als sich ein brennendes Stechen, das ihm bekannt war und den Schrecken potenzierte, durch seinen Unterleib bohrte. Nur nicht weinen, dachte er, und dann wusste er plötzlich, was dieses Gefühl war, das ihm seit Wochen bereits vertraut war. Er hatte Angst vor ihr, eine um Luft ringende, panische Angst. Kein unbekanntes Gefühl: Es war, wie er, so auf dem Bauch liegend, schaudernd feststellte, einem unbestimmten Früher entnommen.
Er trinkt einen Schluck Kaffee und entsperrt das Handy. Öffnet die SMS. Harald und sie laden ein. Er liest nochmals den Namen. Harald. Ein erdiges, körniges Wort. Ein Name, der auf Bodenständigkeit und Bequemlichkeit schließen lässt, auf eine alles in allem versöhnliche Haltung zur Welt, und zugleich auch die Spur eines dunklen Fleckes enthält, einer ungemütlichen Stelle, die besser unberührt bleibt. Ob ein Name, denkt er, zwangsläufig mit der Person übereinstimmen muss? Dann drückt er den Knopf auf der Längsseite des Handys und blickt eine Weile unschlüssig auf das verspiegelte Display, in dem sein Gesicht wie in einem Rahmen gehalten wird.
Als sie ihn dann auch nachts nicht in Ruhe ließ, ihn ansprang, sich an seinen Körper drückte, sich an ihm rieb und ihn an seinen empfindlichen Stellen viel zu grob anfasste, als sie nicht abließ von ihm, selbst dann nicht, als er sie wegstieß, sie kam wieder, hungrig, wild, atemlos. Er war überzeugt, dass es etwas mit dem Unfall zu tun haben musste, man kannte ja die Kuriositäten der Medizingeschichte, Phineas Gage und dergleichen, die durch Unfälle augenblicklich zu anderen Menschen geworden waren, als wäre ein Knopf gedrückt oder ein Schalter umgelegt worden, allesamt Lebendbeweise dafür, dass das, was wir in unserer Mitte für unser Ich halten, unser ganzer Zusammenhalt, lediglich die zufällige Wirkung eines mühselig aufrechterhaltenen, unfallartig entstandenen Gleichgewichts ist. Eine Erschütterung, und es ist dahin. So auch bei Lena. Er fragte Experten, aber sie waren ratlos, wichen aus, legten sich nicht fest, hielten ihm lange, inhaltslose Vorträge oder wimmelten ihn auf der Stelle ab. So blieb er auf seinem Phineas sitzen. Und dieser wuchs sich, je mehr der Frühling in den Sommer überging, desto unaufhaltsamer, zu einem veritablen Ungeheuer aus.
Lenas Spiel wurde immer entfesselter, immer gefährlicher, und als sie ihm eines Nachts die Käsereibe an die Hoden hielt, glaubte er augenblicklich sterben zu müssen. Ihr Gesicht in diesem Moment: Kurz der Eindruck, dass es so eine Situation schon viel, viel früher gegeben hatte, zweifelsohne war es dieselbe knochenbleiche, eigenartig milchig schimmernde Fratze, der er sich schon einmal gegenüber gefunden hatte. Und während er noch fiebrig nach der Antwort, nach dem Wo dieser früheren Begegnung suchte, ließ sie ab von ihm, begnügte sich damit, sich mit seinem Fuß selbst zu befriedigen, und schlief schließlich geräuschvoll ein. Er betrachtete sie, wie sie im Halbdunkel eingerollt neben ihm lag und ihm jetzt, das wusste er, nichts mehr anhaben konnte. Seine Bestie.
Ein andermal schlug sie vor, den Obdachlosen vom Supermarkt auf einen Dreier einzuladen, oder sie hockte sich in einem unerwarteten Moment über sein Gesicht, zog sich blitzschnell die Hose hinunter und entleerte die Blase in seine verdutzte, ekelverzerrte Miene. Als er das Gespräch mit ihr suchte, wandte sie all ihr angeborenes oder erworbenes Geschick an, um ihn am Ende als den Schuldigen und sich selbst als Opfer darzustellen. Es war einer der ersten heißen Tage im Frühsommer, die Stadt ächzte unter der unvermuteten Hitze, sie hatten alle Fenster nach Sonnenuntergang aufgerissen, und von draußen drang der übliche Lärm in die hohen Räume. Schwierig, ein Wort zu verstehen, aber das Gespräch musste, weil es nun einmal begonnen worden war, fortgesetzt werden. Flüchtige Hoffnung auf Veränderung, er hatte genug davon, Zeuge all der Verletzungen zu werden, die ein Mensch einem anderen zufügen kann. „Lena“, sagt er, und merkte, dass es lange her war, dass er ihren Namen ausgesprochen hatte. Entsprechend war ihre Reaktion. Sie blieb mitten in der Bewegung stehen, in der einen Hand die Gießkanne, die andere noch in der dichtwachsenden Topfpflanze, der sie die toten Teile abzupfte. Aber er sprach, was ein Fehler war, gleich weiter, und je länger er das tat, desto lockerer wurde sie. Sie hatte verstanden, war mit einem Mal bereit, hatte ihre Abwehrstellung eingenommen und war wieder voller Angriffslust. Als er das begriff, war es zu spät. Sie baute sich vor ihm auf, lehnte dabei etwas zu lässig an der Lehne und gab das Wort nicht mehr ab. Er musterte dieses fremde Wesen. Gab sich Mühe, ein Stück Gemeinsamkeit herzustellen, versuchte, sie wie früher zu sehen, als Mädchen, dem er die große Pose an der Stuhllehne und seine ausholende Ansprache verzeihen wollte, wie überhaupt alles, was ihr, ihres Alters wegen, noch nicht gelingen konnte. Aber dieses Mädchen von früher, das gab es nicht mehr.
Am Ende blieb ihm nichts, als abzuwarten. Er kroch in sich hinein, besetzte den letzten Winkel seiner selbst und funktionierte aus diesem heraus wie automatisiert. Er fuhr in die Schule, angewidert von dem Gedanken, dass dieses Gebäude unablässig solche Kreaturen wie Lena hervorbrachte, angeekelt auch von sich selbst, weil er nichts dagegen tat, sich nur ständig selbst perpetuierte, sich Tag um Tag, als wäre nichts, an seinen Platz mit dem bequemen Überblick über den Pausenraum setzte und die Kinder im Auge behielt. Ohne einzuschreiten. Feige dort saß und dem allgemeinen Niedergang seinen Lauf ließ. Abends schlich er an ihr vorbei und zum Fernseher, den er, so rasch er konnte, aufdrehte. Das herrliche Flattern der Bilder, ständig sprach einer zu ihm, ständig nährte dieses Wunderding den Eindruck, geborgen, gehalten, ja, irgendwie liebkost zu sein. Wenn sie ins Zimmer kam, duckte er sich, aber meist ignorierte sie ihn. Nachts lag er auf einem handbreiten Streifen am äußersten Rand ihres gemeinsamen Lagers, und wagte nicht sich zu rühren. Gelegentlich begegnete man einander beim Kühlschrank, dies auch wortlos. Ihr Gesicht im kühlblauen Glanz des schwachen Lichtes. Nicht von dieser Welt, dachte er, und er erinnerte sich, dass er das schon einmal irgendwann gedacht hatte. Als sich allmählich die Schulferien ankündigten, überkam ihn Panik. Die Aussicht auf ein auswegloses Aufeinandersitzen, wochenlang, brachte ihn fast um den Verstand, aber dann kündigte sie an, für einige Tage zu verreisen. Wohin, das fragte er nicht, er wünschte ihr, weil er glaubte, das Idiom einer Durchschnittsbeziehung bedienen zu können, alles Gute und küsste sie, als sei nichts gewesen, auf die Wange, sah aber kurz darauf ein, dass er gehörig danebengelegen war. Weit entfernt von durchschnittlich. Als er nach ihrer Rückkehr keinen mehr hochbrachte, fluchte sie, wurde zornig und beschimpfte ihn. Am Ende schmiss sie ihm einen Zettel hin. Eine Nummer und ein Name. Da solle er anrufen, die Frau sei die richtige für derlei Unzulänglichkeiten.
Und dann, endlich, dieser Morgen im Juni.
„Mach die Augen auf, wenn du es sehen willst.“ Er spürte den Nachdruck ihres Ellenbogens zwischen seinen Rippen, aber er blieb liegen. Wochenende. Ein beliebiges. Er wusste nicht, ob Sonntag oder Samstag war. Er hörte ihr lautes Atmen im Vorzimmer, dann ein Schaben. Sie bindet sich ihre Schnürsandalen, dachte er, dann ging die Tür, und Sekunden später klirrte etwas. Sie hatte, wie er später feststellte, den Wohnungsschlüssel durch den Briefschlitz geworfen, ein starkes Statement, aber so war sie jetzt. Kein Kind mehr.
Er hebt die Tasse an die Lippen, der Kaffee ist kalt und fühlt sich pelzig an auf der Zunge. Er stellt ihn weg, nimmt seine Leica. Da durchfährt ihn ein Schmerz, er geht in Wellen durch seinen Körper. Schweiß bricht ihm aus den Poren. Er steht auf, taumelt, hält sich die Backe. Im linken unteren Kieferquadranten sitzt die Quelle, vermutlich der 36er, vielleicht auch der 37er, jedenfalls ein Mahlzahn, einer von jenen, die zwei Wurzelkanäle haben. Die Chancen – das weiß er vom Vater, der seine Zahnarztpraxis in einem dieser schäbigen Wiener Gemeindebauten auch über das gesetzlich festgeschriebene Pensionsalter hinaus verbissen weiterführt –, die Chancen auf eine schmerzfreie Wurzelbehandlung wie auch auf eine rasche Rekonvaleszenz sind, wie ihm der Vater als Kind erklärt hat, bei den unteren Molaren größer, aber das tröstet ihn jetzt nicht.
Er verzieht das Gesicht, schnappt sich die Packung mit den ganzen Nelken, steckt sich fünf Stück in den Mund und zerkaut sie auf der rechten Seite. Die scharfe, körnige Paste, von der ihm schlecht wird, schiebt er, während er das Würgen unterdrückt, mit der Zunge nach links. Er kleistert sie behutsam und unter vorsichtiger Zuhilfenahme des Zeigefingers um den schmerzenden Zahn. Keine Kur, aber es wird Abhilfe schaffen. Was bleibt, ist sich abzulenken. Die Nachrichten helfen immer. Er taucht ein in das fluoreszierende Blau seines Handys, draußen ist es dunkel, ringsum auch, da ist nur das leuchtende Lichtquadrat, dieses winzige Wunderwerk. Er ruft die Startseite auf.
Ein Jahresrückblick, wie immer.
Und die üblichen Nachrichten: Unglücksfälle, Katastrophen, Anschläge. Einige Menschen sind gestorben, noch mehr sind geboren worden, nur wenige davon mit Zukunft. Die bekannten Abläufe, langweilig bis zum Erbrechen. Aber in diesem Jahr ist etwas anders, ist aus den Fugen geraten, ist irgendwie verschoben, und es ist nicht, weil sich die Briten gegen sich selbst entschieden haben, oder weil die Amerikaner einen Despoten an ihre Spitze gewählt haben, oder gar, weil nicht unweit von hier, fast einen Steinwurf entfernt, jedenfalls in einer bedrohlich nahen Nachbarschaft, ein totalitäres Regime aufkeimt. Natürlich ist da auch der zusätzliche Tag, der aus der Reihe fällt. An der Stelle, wo er steht, zeigt sich der Bruch, zeigt sich die Revolte der Natur gegen den menschlichen Ordnungssinn, der alles in überschaubare Zeiteinheiten pressen will, die jeweils für sich stehen, und so, in ihrer Vereinzelung, Sinn ergeben. Aber wie soll man auch einen Vierteltag leben?
Er saugt an dem beißenden Nelkenbrei und spürt das wohlige Prickeln des natürlichen Anästhetikums. Der Schmerz lässt nach, es folgt die Erschöpfung. Genug der Rückblicke! Er tippt die oszillierende Fläche an, kurz ist der Bildschirm schwarz, dann gelangt er zur Chronik.
Er liest: Eine achtzehnjährige Oberösterreicherin verbrennt hilflos in ihrem Auto, die Einsatzkräfte, die die junge Aignerin gekannt haben, sehen ebenso hilflos zu und müssen, als alles vorbei ist, psychologisch betreut werden; sie wissen, was verständlich ist, mit einem Mal nicht mehr, wie sie am darauffolgenden Tag wieder in ihre Uniformen passen sollen. Dann: Ein oststeirischer Arzt, der seine drei Kinder jahrelang gequält haben soll, steht vor Gericht, die älteste Tochter erzählt unter Eid und somit auch unter dem Zwang, kein Detail auszulassen, wie sie dem Vater den Schraubenzieher auf seine Anordnung hin aus jener Stelle in der Bauchdecke zieht, wo er ihn sich kurz zuvor selbst hineingerammt hat; dabei weiß sie, dass es ein Video davon gibt, aber den Richter interessiert weniger das Bild als die Erfahrung des Mädchens, diese seine Innensicht. Dann auch: Zwei Familien sind auf dem Kreuzjoch in ein Schneetreiben geraten und haben die Nacht in einer unbeheizten Schutzhütte verbracht; die Rettungskräfte, die erst am nächsten Tag zu ihnen durchdringen, finden sie, wenig überraschend, nur noch tot auf, heillos ineinander verkeilt, sodass es länger dauert, bis man die Leichen bergen und die Hütte für die nächsten Schutzsuchenden freiräumen kann. Und schließlich: Eine Frau, Anfang dreißig, stürzt in Wien aus dem Fenster; sie war schon in den frühen Morgenstunden, noch vor Sonnenaufgang und vollkommen unbemerkt, auf dem Asphalt aufgeschlagen, ihren leblosen Körper entdeckte ein Passant mit Hund aber erst viel später; es müssen, so schreibt der anonyme Verfasser des Artikels voller Unglauben, zuvor bereits einige Menschen vorbeigegangen sein, ohne sie bemerkt zu haben; ein Fremdverschulden sei ausgeschlossen, es bliebe also die Frage: Warum stürzt eine Frau aus dem Fenster auf die Straße?
Er klickt sich durch die Bilder, die dem Bericht beigefügt sind. Sie zeigen nicht das Ereignis selbst, sondern seine Spuren: Da sind die Markierungen auf dem Asphalt, wo zuvor ihr Körper gelegen war, dann auch weggeworfene Plastikreste, Zeugen einer Wiederbelebung, Spuren auch von größeren Menschenmengen, von Schaulust, dann ein Polizeiauto, das einsam in der Einfahrt steht, und in einem dunklen Gang die zwei Beamten, sie telefonieren, beide von hinten aufgenommen, sodass der Blitz den Schriftzug auf ihren Schultern ins Unlesbare verzerrt. Schließlich das Haus: Eine kalkweiße Fassade, verziert mit allerlei liebevollen Details, frisch gestrichen und leuchtend, die Einfahrt gepflastert und unter einem Bogen, der so hoch ist, dass selbst ein Lastwagen durchfahren könnte. Und man weiß, ohne darauf hingewiesen zu werden, dass sie aus dem zweiten Fenster von links, in der ersten, etwas höher gelegenen Reihe gesprungen ist, seine Flügel sind aufgebrochen und eröffnen den Blick auf dicke graue Vorhänge.
Er steht auf, holt sich eine zweite Decke, und als er sich eingewickelt hat, pocht es in seinem Kiefer. Er weiß, er wird den Termin nicht mehr lange aufschieben können. Es gibt Menschen, die an so einer Entzündung gestorben sind. Er nimmt das Handy, liest in der Chronik und wundert sich, wie so oft, darüber, dass sich überhaupt jemand die Mühe macht, derartig unsinnige Gegebenheiten zusammenzutragen. Was, zum Beispiel, geht ihn der Fenstersturz einer knapp Dreißigjährigen an?
Er legt das Handy weg, knipst die Stehleuchte an.
Diese Zeit nach ihrem Auszug. Erst allmählich hatte die Wohnung die Zeugen ihrer Anwesenheit freigegeben. Noch Wochen später fand er ihre Haare im Abfluss oder Nagelbruch in den Ritzen des Parketts oder einen Slip hinter der Couch oder ein zerlesenes Buch, eine Ansichtskarte, das Ladekabel fürs Handy, Haarnadeln, Ringe, ihren Kugelschreiber und einen Kaugummi, den sie auf die Unterseite der Küchentheke geklebt hatte, er war überzeugt, es würde nie ein Ende nehmen. Er putzte die Wohnung aufs Gründlichste, und dies mehrfach, und dennoch gelang es nicht, er konnte sie nicht zu seiner machen. Ihr Geruch haftete den Dingen weiter an. Er lüftete, stellte Räucherstäbchen auf, verwendete Raumspray. Alles umsonst. Ende August gab er auf. Hoffte nur noch darauf, dass sich seine Nase, wie gemeinhin angenommen wurde, an die Gerüche gewöhnen werde, und er diese nach einer bestimmten Zeitspanne nicht mehr wahrnehmen würde.
Anfang September verspürte er wieder so etwas wie Freude, ja, fast Vorfreude, jedenfalls eine zaghaft tastende Fröhlichkeit bei dem Gedanken, dass die Ödnis langer, inhaltsleerer Tage nun wieder durch die kleinteilige Logik eines Stundenplans aufgebrochen werden würde. Der Schritt ins Schulgebäude gelang ihm beschwingt, fast wie an seinem ersten Tag, als er noch von einem momentanen Anstieg der Zuversicht erfüllt gewesen war. Und auch der Nachmittag zeigte sich gnädig, ebenso wie die Schüler, die, benommen von den langen Ferien, erst nach und nach begriffen, wo sie sich befanden. Er atmete auf. An diesem Abend versuchte er es wieder, es war keine Entscheidung, vielmehr bahnte sich seine Hand, als er unter der kühlen Bettdecke lag, ihren Weg selbst, die Bewegungen waren ihm noch vertraut, ganz so, als hätte es die monatelange Starre nicht gegeben, er war zunächst zärtlich zu sich, streichelte sich, ließ die Hand wie eine warme Schale auf der empfindsamsten Stelle ruhen und steigerte dann wie gewohnt Druck und Geschwindigkeit. Er begann zu schwitzen, schlug die Decke zurück, arbeitete weiter. Er stöhnte, fluchte, bewegte sich erst langsamer, dann schneller, aber nichts half, auch das Öl nicht, oder der Wechsel von Hand und Körperlage. Er weinte. Rollte sich zusammen und vergrub das nasse Gesicht im Kissen.
Auch die darauffolgenden Versuche scheiterten. Er behalf sich mit Bildern, dann auch mit bewegtem Material, und schließlich versuchte er an das Mädchen aus der 8a zu denken, dessen Rock beim Tanzen hochgerutscht war und eine niedliche, viel zu kindliche Unterhose preisgegeben hatte. Oder an die Schülerin aus der 6b, die immer so streng nach Fisch roch, ja, sogar mit der querschnittsgelähmten Kleinen aus der 7a probierte er es, aber nichts half, nichts führte zum Erfolg. Er schlug so fest mit der Faust gegen die Wand, dass der eierförmige Spiegel herunterkrachte und er die nächsten Wochen, weil er die Scherben bloßhändig aufgesammelt hatte, mit Schnittwunden an den Fingern herumlief. Wie er überhaupt nun wieder mehr schlich als lief, der anfängliche Übermut war von ihm abgefallen, es war Ende September, die Schüler waren allesamt aus ihrer sommerlichen Starre erwacht und anstrengender denn je, und er wusste nicht wohin mit seiner aufgestauten Verzweiflung, er hatte sie im Überfluss. Und an einem jener einsamen Abende in dieser allmählich erkaltenden Wohnung mit den durchlässigen Wänden und dem unausgesetzten Lärm fand er sich, er weiß nicht mehr wie, mit dem Zettel in der Hand wieder. Darauf der Name und die Telefonnummer. Da solle er anrufen, hatte Lena gesagt, während sie ihm den Zettel verächtlich hingeworfen hatte, diese Frau, so Lena, sei die richtige für derlei Unzulänglichkeiten. Er drehte das Stück Papier hin und her, es blieb, was es war. Der Name einer Fremden und ihre Nummer. Er zwirbelte die Ecken, rollte das Papier zu einer Zigarre, entrollte es, betrachtete lange die Abfolge von Ziffern und versuchte sich diese, wie zur Probe, einzuprägen. Dann zuckte er mit den Achseln, als wäre da jemand, dem diese Geste gelten könnte. Was für eine Schnapsidee, dachte er, aber er warf den Zettel nicht weg. Legte ihn auf die Anrichte und prüfte noch, ob er nicht nach hinten, in den Spalt hinein, rutschen würde.
Er sieht, auf der Couch sitzend, die Wanduhr über der Tür. Achtzehn Uhr zwanzig. Die Stehlampe wirft einen trapezförmigen Lichtkegel in den Raum, auch das wärmt ein wenig. Er zieht die beiden Decken enger um seine Schultern, stützt das Kinn auf die angewinkelten Knie und schließt die Augen. Flackern hinter den Lidern, wie das Flügelschlagen von Schmetterlingen, die fortgesetzt aufsteigen, ihrer Auflösung entgegen, er kennt das, er hatte als Kind in die Sonne geschaut, bis es wehgetan hatte, und sich dann an dem pulsierenden Kreisen des Nachdrucks berauscht, einmal hatte er sich übergeben müssen. Jetzt hält er die Augen geschlossen, keine Spur von Übelkeit, nur ein Ziehen im Magen, auch das kennt er, wenn auch in einer weitaus bedrohlicheren Variante. Wie an jenem taufrischen Frühlingstag im Mariazellerland oder viel, viel früher, als er noch eine unfertige, ja, geradezu halbherzige Variante seiner selbst gewesen war.
In den darauffolgenden Tagen schlich er um den Zettel herum, sah ihn, wenn er außer Haus ging oder nach einem Schultag zurückkam, wie ein Ausrufezeichen auf der Anrichte liegen, diese stille Anklage, die den Raum besetzte und ihm, wie auch die Steinfersen der Nachbarn oder der Fluglärm, nach und nach körperlich zusetzte. Aber er widerstand der Versuchung. Er weinte viel in dieser Zeit. Er wühlte in der Trauer wie in einem Zwischenstand, wunderte sich zugleich darüber, dass er rührselig wurde, wenn er an Lena dachte. Keine Nachricht von ihr, nur die, dass sie keine Nachrichten mehr schicken würde, somit bestand kein Zweifel: Er war allein auf dieser Welt. Würde es aller Voraussicht nach bleiben, und mitten in dieser Überzeugung saß das in einer beunruhigenden Konstanz zunehmende Ziehen in seiner Magengrube.
Dann der Tag im Oktober. Er geht über eine Straße, die er kennt, aber er sieht alles zum ersten Mal. Da sind die Läden mit ihren spiegelnden Auslagen, die parallel angeordneten Straßenbahnhaltestellen, die Kreuzungen, die quergelegten Zebrastreifen, und, in einer Verlängerung seiner Trajektorie, direkt vor ihm, das ihm bekannte Gebäude: Ein gründerzeitlicher Bau, kalkweiß, mit hohen Fenstern und Stuck unter dem Dach, die Fassade von Scheinwerfern ausgeleuchtet, und ganz oben, direkt über dem Sims, stehen die drei Laufer aus Stein, Herolde, die, in herrschaftliche Livreen gehüllt, ihre mit Federn geschmückten Häupter zu den Fußgängern hinabneigen und sie, wie sie es wohl zu Lebzeiten auch gemacht hätten, kritisch beäugen, diese Hindernisse, die es für sie von Berufs wegen, während sie vor den Kutschen hergelaufen waren, stets zu verscheuchen galt. Und als setze das Haus diese Tradition fort, ist es so eigensinnig in den Verkehr hineingestellt, dass der Straße nichts übrig bleibt, als auszuweichen und hinten, an der breiten Rückseite des Gebäudes, entweder zum Kalvarienberg zu führen oder linkerhand Richtung Steinhofgründe.
Keine üble Gegend, denkt er und geht direkt auf das Gebäude zu, das ihm seine schmale Stirn bietet, biegt im letzten Moment links ab, kreuzt die Straße und geht von nun an eine enge, dunkle Gasse bergan.
Die Stadt an diesem frühen Oktoberabend ist wie in Cellophan gewickelt. Neben ihm steigt eine Taube auf, er fühlt den Luftzug auf seiner Wange, hört das Gurren und sieht ihre Spiegelung in den Scheiben der Autos, vielfach zurückgeworfen, zersplittert in kleine, klar voneinander abgrenzbare Plättchen, ständig in Bewegung. Ein kristallenes Mosaik. Auch das würde die Leica nicht schaffen, denkt er. Er geht weiter. Er hat den kürzesten Weg von der Schule zu der genannten Adresse genommen, und jetzt ist er zu früh dran, eine knappe Viertelstunde. Er will noch einmal um den Block gehen.
Was er Lena nie gefragt hatte: Wie sie auf diese Frau gekommen war. Er setzt einen Schritt vor den anderen, hält dabei den Kopf gesenkt, ein konzentriertes Kreisen um sich selbst, aber es hilft nur halb, da ist sie wieder, unweigerlich verknüpft mit dem Namen und der Nummer auf dem Zettel. Seine Lena. Vor dem Unfall, nach dem Unfall, gefangen in diesem rätselhaften Zustand der Transition, des Weder-Noch, des Wegelagerers, der geht, um zu gehen, und in diesem Prozess des Gehens in Wahrheit nicht mit einem Ankommen rechnet. Lena, die, obgleich sie aus seinem Leben getreten war, in diesem weiterhin werkte. Es gibt Menschen, denkt er, die schon bei einer flüchtigen Berührung eine unauslöschliche Kerbe in einen hineinschlagen.
Er geht die enge Gasse hinauf, rechts Zinshäuser, links Zinshäuser, dazwischen Platz für eine schmale Fahrbahn und einen noch schmaleren Gehsteig, und er kann nicht ahnen, dass er, indem er diese Gasse hinaufgeht, zugleich auch sein Leben in eine bestimmte Richtung gehen lässt. Sie treffen sich in einem Café, die Frau hatte es so gewollt, und er hatte zugestimmt. Er spürt ein Ziehen in den Sohlen und, wie eine geheimnisvolle Verdoppelung der Welt: dasselbe Ziehen auch im Kiefer. Und eigentlich ist es ein Herbsttag wie jeder andere und er – einer von vielen.
Er hat keine Vorstellung von dieser Frau, auch nach dem kurzen, nichtssagenden Telefonat nicht, dessen nüchterner Zweck die rasch abgewickelte Terminvereinbarung gewesen war. Keine Vorstellung, lediglich die unbestimmte Fantasie, dass sie Lena irgendwie ähnlich sein muss, zumal sie ja von ihr kommt, ihr sozusagen entsprungen ist.
Später – er ist immer noch zu früh dran – sitzt er neben der hohen Scheibe mit dem verkehrten Schriftzug des Cafés, da ist seine Spiegelung, dieses Bild, das er nicht wahrhaben will, er weiß auch so, dass der, den er sieht, furchtbar aussieht; kein Jüngling mehr, ein Mann, müde, abgekämpft, manche würden sagen: eingefallen, selbst die Spiegelung verrät es noch. Er seufzt, schüttelt den Kopf und stützt ihn in die Hände. Diese Bewegung verschiebt den Blick, und er sieht jetzt nicht mehr sich selbst, sondern den Gehsteig, das gegenüberliegende Haus, die Menschen, alle hinter Glas; da ist ein Mann mit Hund, eine Frau und zwei Kinder, und schließlich einer, der Einkäufe schleppt.
Das Café ist voll, und da, wo er sitzt, an der Längsseite des Raumes und zur Straße hin, sind Nischen; quer in den Raum hineingestellte Sitzbänke, Rücken an Rücken, mit roten Samtbezügen und Lehnen, die einem über den Kopf reichen, wenn man sitzt. Eine pedantisch portionierte Zweisamkeit. Es ist heiß, die Luft ist trocken und es riecht nach Rauch, dabei darf man hier, wie in allen Cafés dieser räumlichen Aufteilung und Größe, seit Langem nicht mehr rauchen. Und dann ist da einer, der ihn teilnahmslos grüßt und ihm eine Frage stellt, aber er gibt ihm zu verstehen, dass er mit der Bestellung noch warten will. Er sieht auf die Uhr. Fünf nach sechs.
Dann zehn nach sechs. Die Fensterscheibe hält die Spiegelung des Raumes, man muss sich anstrengen, wenn man durchsehen will. Wieder der Kellner, wieder das Abwinken. Ob er sie wohl erkennen wird?
Viertel nach sechs. Der Kellner kommt nicht mehr, er sitzt allein und ertappt sich dabei, wie er auf das Marmor trommelt, beidhändig. Verlegen klemmt er die Hände zwischen die Schenkel und beißt sich auf die Lippe.
Zwanzig nach sechs. Er gibt ihr noch fünf Minuten.
Halb sieben. Eine Minute, sagt er sich.
Und plötzlich steht sie da.
Im Türstock wie in einem Rahmen.
Eine schmale Gestalt; ein einwandfreies, nahezu perfektes Motiv, denkt er, noch ohne sie als seine Verabredung zu erkennen, vor allem für eine Monochrom-Aufnahme, zumal mit der Leica, obschon diese, wie er weiß, die Aufnahme nicht zuletzt wegen der Lichtverhältnisse versemmeln würde. Da steht sie also, diese Frau, auf flachen Absätzen, und dreht ihren Kopf von einer Seite zur anderen. Lässt den Blick durch den Raum streifen, übersieht ihn, übersieht ihn noch einmal, bevor ihr Blick zurückschnellt und ihn doch fixiert. Sie steht, ohne sich zu rühren, dann nickt sie.
Sie ist älter als erwartet, dabei aber irgendwie ungereimt alt, vielleicht wegen ihrer Bubenfrisur, diesen kurzgeraspelten, frech im Nacken sitzenden Haaren, die einen wunderbaren Kontrast zu der weißen Tönung darstellen, oder auch wegen ihrer jungenhaften Hüfte und dem sportlich federnden Gang. Sie knöpft sich den Mantel im Gehen auf und lässt ihn dabei nicht aus den Augen; ihr Blick ist wach, offen und zugleich auch irgendwie gedankenverloren, ganz so, als würde sie neben den Dingen, die sich ihr präsentieren, ständig auch etwas anderes fassen.
Ihr Händedruck ist fest, entschlossen, vielleicht ein wenig zu nachdrücklich, er zieht seine Hand zurück und setzt sich wieder auf die samtbezogene Bank.
Normalerweise, sagt sie, ihm halb zugewandt und mehr zu sich als zu ihm, treffe sie sich nicht an solchen Orten. Schon gar nicht bei solchen Gelegenheiten. Geschweige denn überhaupt zum Kennenlernen.
Und dann nimmt sie ihren Mantel ab, ohne sich weiter um ihn zu kümmern, da ist ihr scharfkantiges Profil, dann auch, für Momente, ihre Rückseite, und schließlich sitzt sie, ihm direkt gegenüber, eine Armeslänge entfernt, ihr Gesicht unmittelbar auf seines eingestellt. Der Blick geht über den Rand ihrer Gläser. Sie sucht seine Augen, findet sie.
Diesmal wolle sie aber eine Ausnahme machen, sagt sie und lächelt.
Er bemüht sich zurückzulächeln. Er weiß nicht, ob sie ihm gefällt, ja, er weiß nicht einmal, ob er sich für sie interessieren kann, aber da sind sie nun mal, und man muss aufeinander reagieren.
Sie greift nach der Karte, und er sieht, wie zufällig und ausgelöst, den Umriss ihrer Hände, diese glatten, schmalen Finger, dazu auch den weißen Handrücken, durchzogen von einem Netz veilchenfarbener Linien, alles nackt: Sie trägt keinen Nagellack, keine Ringe, und auch die Handgelenke sind frei von Schmuck.
Also, sagt sie und lächelt wieder.
Der nächste Schnappschuss zeigt eine Reihe makelloser Zähne, nur die Eckzähne sind eierschalengelb, mit einem Stich ins Ockerfarbene. Vermutlich eine Raucherin. Oder eine Kaffeetrinkerin. Oder beides.
Seine Freundin habe ihn geschickt? Sie lässt ihn nicht aus den Augen.
Aber der Kellner unterbricht: „Was möchte die Dame?“
Ein Glas Milch, sagt sie, ein kleines, am besten kalt. Und ein Leitungswasser dazu.
„Das müssen wir auch verrechnen“, sagt der Kellner, aber sie winkt ab, bevor er weitersprechen kann.
Dann sitzen sie eine Weile schweigend, und er wundert sich über sie. Seine Irritation ist eine grundsätzliche: Dass eine erwachsene Frau in einem Wiener Café ein Glas kalte Milch trinkt.
Er mustert sie aufmerksamer als zuvor, eine nervöse Neugierde. Nicht nur die Milch fällt auf, auch etwas anderes stimmt nicht mit ihr. Sie sitzt ein wenig tiefer, zumal sie natürlich auch kleiner ist als er, aber zugleich hat er den Eindruck, als würde nicht sie zu ihm, sondern er zu ihr hinaufsehen. Er richtet sich auf, zieht seine Schultern nach hinten und streckt das Kinn vor. Er ist, das weiß er, groß, größer als jeder Mann, den er kennt, einen Zentimeter länger auch als sein Vater, der schon als Riese durchgehen könnte; aber hier, an diesem Tisch, mit ihr, kommt er sich klein vor. Es ist eine neue Erfahrung. Er hustet, versucht sich dabei noch mehr aufzurichten, wird über und über rot und am Ende starrt er ratlos auf den Marmor unter seinen Fingerkuppen.
Also, sagt sie, ohne all das zu beachten. Er sei wegen seiner Freundin hier?
Er schweigt.
Nicht?
Er räuspert sich. Beißt sich auf die Unterlippe.
Weshalb sei er dann hier?
„Das ist es nicht“, sagt er, „das Siezen. Könnten wir nicht – “





























