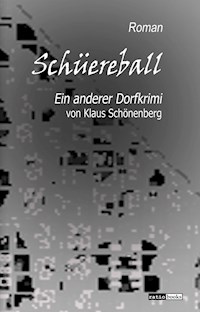
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag ratio-books
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine jüdische Familie im Köln der Nazizeit, ein Privatdetektiv im bergischen Wahlscheid, eine junge Jüdin aus New York, ein eingefleischter Altgeselle in einem Alterswohnheim der besonderen Art, geldgierige Bauhaie, korrupte Verwaltungsbeamte. All' diese mehr oder minder geschmeidigen Charaktere prallen in einer Geschichte aufeinander, die ihren Anfang in einem Schützengraben im Ersten Weltkrieg nimmt. Wie ein lukullisches Mahl setzen sich die Mosaiksteinchen der Erzählung zu einer spannenden Story zusammen. Zwischendurch erfahren wir so manch leckeres Rezept.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Schönenberg
Schüereball
Ein anderer Dorfkrimi
Klaus Schönenberg
Schüereball
Ein anderer Dorfkrimi
Cover: Klaus Schönenberg
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten!
© 2020
Impressum
ratio-books • 53797 Lohmar • Danziger Str. 30
[email protected] (bevorzugt)
Tel.: (0 22 46) 94 92 61
Fax: (0 22 46) 94 92 24
www.ratio-books.de
ISBN E-Book 978-3-96136-080-2
ISBN Print 978-3-96136-079-6
published by
Personen:
Frank Linden, Privatschnüffler in Wahlscheid
Ingrid Grün, seine Freundin
Anat und Rinah Liesenthal – Juden in Köln
Ihre Kinder Michaela und Daniel
Christina, Michaelas Enkelin
Wilhelm und Heidrun Merkelbach, Bauern in Wahlscheid
Werner, ihr Sohn
Joachim Schiermeister, Baulöwe in Wahlscheid
Elisabeth, seine Frau
Richard, Joachims Vater
Karin genannt „Kiki“, Joachims Enkelin
Rolf Pratt, Kommissar in Siegburg
Bettina Engels, Pratts Gehilfin und Nichte
Stammbaum im Anhang
Die Historie:
1918 und 1919 – Beginn einer Freundschaft in der Eifel am
Ende des Ersten Weltkriegs
1935 bis 1945 – Vorkriegs- und Kriegsjahre in Köln und Wahlscheid
1955, 1975, 2003 – Ereignisse in Wahlscheid
All things are connected
Entschuldigung:
Bei allen, die sich auf die Schochen getreten fühlen, möchte ich mich auf´s Herzlichste entschuldigen. Ähnlichkeiten mit lebenden oder dahingeschiedenen Personen sind rein zufällig und ohne böswillige Absicht gewollt. Die halbwahren historischen Bezüge habe ich so hingebogen, dass sie auf die hier erzählte Geschichte passen.
– Der Autor in Wahlscheid im Januar 2020 –
Die Sprache:
Bei einer Mundart handelt es sich nicht um eine Sprache im Sinne einer einem Land, einem Staat oder Nation zuzuordnenden Landes- bzw. Verkehrssprache, sondern um ein Lebensgefühl.
In Wahlscheid wird selbstverständlich „platt“ gesprochen. Irgendwas zwischen „Kölsch“ und Rheinisch-Bergisch. Mindestens, wenn die wesentlichen Dinge des Lebens besprochen werden. Die Dialoge wurden mit wenigen Ausnahmen in so genanntem Hochdeutsch geschrieben. Der geneigte ortsansässige Leser mag sich den Wahlscheider Zungenschlag vorstellen, die Immies werden den eh nie begreifen.
Schüereball / Schüreball
Die Schreibweise
En Schüer ist eine Scheune. Die Schreibweise Schür träfe nicht ganz den Zungenschlag der Gegend. Es mogelt sich ein fast unhörbares „e“ zwischen das diakritische „ü“ und den Konsonanten „r“. Die korrekte Schreibweise ist also „Schüer“ und die damit verbundene Orgie also ein „Schüereball“.
Für
Jean „Schang“ Jülich
Ein Gerechter unter den Völkern
und
Günther Schwarz (16 Jahre alt)
Johann Müller (16)
Bartholomäus „Barthel“ Schink (16)
Gustav Bermel (17)
Franz Rheinberger (17)
Adolf Schütz (18)
Hans Steinbrück (23)
Roland Lorent (24)
Peter Hüppeler (31)
Heinrich Kratina (38)
Josef Moll (41)
Wilhelm Kratz (42)
Johann Krausen (57)
Inhalt
Frank
Eifel, April 1918 Wilhelm
Wahlscheid 2001 Werner
Wahlscheid, Juli 1935 Heidrun
Wahlscheid, August 1938 Joachim
New York, Mai 2003 Christina
Köln, Anfang November 1938 Anat
Wahlscheid, Juni 1955 Joachim
Köln, November 1938 Anat
Wahlscheid, Mai 2003 Christina
Köln, November 1938 Anat
Wahlscheid, Mai 2003 Werner
Wahlscheid, November 1938 Wilhelm
Wahlscheid, Mai 2003 Frank
Wahlscheid, August 1939 Richard
Köln, 1943 Anat
Siegburg, Mai 2003 Frank
Köln, Frühjahr 1943 Michaela
Wahlscheid, Sommer 1975 Richard
Köln, April 1943 Michaela
Wahlscheid, Mai 2003 Frank
Wahlscheid, April 1943 Michaela
Wahlscheid, Mai 2003 Frank
Wahlscheid, Mai 1943 Elisabeth
Wahlscheid, Mai 2003 Kiki
Wahlscheid, September 1955 Elisabeth
Wahlscheid, Mai 1943 Heidrun
Wahlscheid, Mai 2003 Ingrid
Wahlscheid, Mai 1943 Wilhelm
Wahlscheid, Mai 2003 Frank
Wahlscheid, Mai 1943 Heidrun
Wahlscheid, Mai 2003 Joachim
Wahlscheid, Mai 1943 Werner
Wahlscheid, Mai 2003 Joachim
Wahlscheid, Mai 1943 Wilhelm
Wahlscheid, Mai 2003 Christina
Wahlscheid, Mai 2003 Frank
Wahlscheid, Juni 1943 Werner
Wahlscheid, Mai 2003 Frank
Wahlscheid, Mai 2003 Pratt
Wahlscheid, Mai 2003 Kiki
Wahlscheid, Mai 2003 Ingrid
Wahlscheid, Mai 2003 Werner
Wahlscheid, Mai 2003 Bettina
Wahlscheid, Ende Mai 2003 Schüereball
Wahlscheid, Herbst 2003 Epilog
Erläuterungen
Frank
Irgendwie hatte er ja gewusst, dass es eines Tages passieren würde. Nur – dass es hier, quasi in seinen eigenen vier Wänden sein würde – das hat ihn dann doch erstaunt. Als er den plötzlichen Druck auf seiner Brust spürt und ihm bewusst wird, was gleich mit ihm geschehen würde, als sich das dumpfe Klatschen in seine Wahrnehmung drängt und ihm schlagartig klar wird, dass er nur noch Sekunden hat, um seine letzten Gedanken zu sortieren, verlangsamt sich seine Umgebung zu einer zähen Zeitlupenstudie. Das Gefieder des possierlichen Vogels im Gebüsch gegenüber sträubt sich, die winzigen Äugelchen blicken zornig auf die Stelle, wo die Kugel durch den Kirschlorbeer geschossen kam, die Flügel schlagen zwei-dreimal, bevor sich das kleine Federbällchen erschreckt davon macht. Die Katze auf dem Stuhl neben ihm hebt interessiert den Kopf, die Ohrdreiecke wie kleine Lauschsegel auf den Kurs des Vogels gerichtet, der spontan vorbereitete Adrenalinstoß aber vom Rechenzentrum im Hirn zurückgepfiffen, als dem Tier die Fluchtgeschwindigkeit des Vogels klar wird. Wie oft hatte er sich schon vorgenommen, sich mal mit den einheimischen Vogelarten zu beschäftigen. Nun weiß er noch nicht einmal, welchem Federvieh sein letzter Blick gilt. Die Katze dreht ebenso quälend langsam wie gelangweilt den Kopf zu ihm um, reagiert mit einem kurzen Zucken der Ohren, als der Knall der Waffe ins Zentrum ihres Bewusstseins rückt. Er selbst sinniert noch darüber nach, ob eine Gewehrkugel schneller oder langsamer als der Schall ist, als er feststellt, dass sich ein roter Fleck auf seinem Feinripp ausbreitet.
„Was war das? Hast du den Knall gehört?“ Ingrid, seine Mitbewohnerin, bezeichnet ihre Beziehung immer noch als Wohngemeinschaft, obwohl sie seit mehr als fünf Jahren nicht nur Tisch, sondern auch Bett teilen. So etwas passiert eben, wenn zwei verzweifelt an der Jugend und der individuellen Freiheit hängen. Da neben der regelmäßigen chemischen eine dauernde gesetzliche Verbindung keine nennenswerten Vorteile brachte und diverse Scheidungen und Trennungen im Bekanntenkreis nichts als Stress verursacht hatten, hat man es eben dabei belassen. Ihre Stimme klingt wie aus einer tiefen Höhle, wie durch den Wolf gedreht. Er will ihr antworten, aber er muss feststellen, dass sein Sprachzentrum gelähmt ist, sein Hirn offensichtlich schon auf Notbetrieb umgestellt hat und nur noch für die wichtigsten Steuermechanismen da ist.
„Du wolltest den Rasen mähen – hast du versprochen.“ Ja – zum Teufel, wie kommst du bloß drauf, dass mich das jetzt im Moment interessiert. Komm gefälligst her und hilf mir! Sind nie da, wenn man sie wirklich braucht. Vielleicht hätte er doch seine Finger aus der Sache heraushalten sollen. Wie konnte er nur annehmen, dass dieser geldgeile Clan das einfach so auf sich beruhen lassen würde. Zu tief hatte er im Dreck gegraben, aber Ungerechtigkeit konnte er eben nicht so einfach hinnehmen, abgesehen davon, dass er sich davon auch eine recht ordentliche Belohnung versprochen hatte.
Der Rest ist noch ein Flackern der Augen, entsetzte Schreie, Gezerre an seinem Hemd, hektische Betriebsamkeiten und letztlich der Sturz ins Bodenlose, Dunkelheit und Ruhe.
Eifel, April 1918
Wilhelm
Mit Juden hatte er eigentlich noch nie Kontakt gehabt. Und jetzt hatte ihm der Leutnant diesen Kölner Schöngeist an die Seite gestellt und sie zusammen auf diesen vorgeschobenen Posten befohlen. Seit Tagen lagen sie nun schon unter Sperrfeuer aus dem Wäldchen gegenüber und die Lage im Matsch des Schützengrabens wurde allmählich brenzlig. Anat, der junge Mann neben ihm, war kaum ein Jahr älter als er, Wilhelm Merkelbach, Bauernsohn aus einem Nest im Bergischen, das für den Kölner „knapp vor dem Ural“ lag, wie alles, was auf der Schäl Sick, der östlichen Rheinseite, liegt. Aber immerhin hatte Anat Liesenthal Mut bewiesen, als vor ein paar Tagen eine Kontaktaufnahme zu ihrem Befehlsstand in dem kleinen Eifeldörfchen hinter ihnen angesagt schien und irgendwer über die freie Pläne laufen und Meldung machen musste. Seitdem hatte sich doch etwas mehr Respekt vor dem Menschen mit dem verdächtigen Glauben eingestellt. Der schlanke, hochgewachsene Bursche hatte Tabak mitgebracht und dem Küchenbullen ein schönes großes Stück Pökelfleisch geklaut. „Schweinefleisch? Du? – Ich dachte immer .…“ – „Glaubst du, Gott wäre glücklicher, wenn ich hier verhungere?“ Sprach´s, machte sich über den Batzen her und teilte den Kanten in gleiche Stücke auf.
Anat war Spross einer kölnischen Goldschmied-Dynastie, die schon seit vier Generationen in der Domstadt Werkstatt und Geschäft betrieb. Sie war sogar mit der Bankiersfamilie Oppenheim verwandt, die als einer der ersten jüdischen Familien Anfang des 19. Jahrhunderts wieder in Köln siedeln durfte, nachdem die liberalen Einflüsse der Französischen Revolution im Rheinland spürbar wurden. Ständig nervte er Wilhelm mit klugen Sprüchen und Gedichten, die zu lernen sein preußisch korrekter Lehrer in der einzügigen Dorfschule nicht für wichtig gehalten hatte. Was hätte es auch genutzt, wenn er bei der Kartoffelernte im Aggerbusch mit krummem Buckel über Theodor Storms „Schimmelreiter“ philosophieren oder Passagen aus Victor Hugos Spätwerk hätte zitieren können.
Aber er hörte aufmerksam zu und langsam erschlossen sich ihm die Feinheiten seiner eigenen Sprache und er fasste den festen Vorsatz, sich nach dem vermaledeiten Krieg ein oder zwei Bücher zu kaufen und es selbst mal mit Lesen zu versuchen, wenn er des Abends in seiner kleinen Dachkammer im elterlichen Hof mit wehem Kreuz und hungrigem Bauch auf den Strohmatratzen lag. Vielleicht konnte er auch den Pastor um ein Buch angehen – aber er war sich nicht sicher, ob ihn dieser nicht mit spöttischem Gelächter davonjagen würde.
„Der Krieg ist sowieso bald vorbei“, hatte Anat erzählt, als sie kauend im Dreck hockten. „Die Offensive an der Marne ist ins Stocken geraten und unsere Leute kriegen tüchtig Haue. Einer der Melder hat es mir erzählt. Dann macht´s bumm! Und aus ist´s mit Kaiser und Vaterland.“ Wie so oft hatte er dem 19-jährigen Kameraden geglaubt und in dieser Nacht lange über die Konsequenzen nachgedacht. Unvorstellbar, ein Leben ohne die strenge Ordnung und Hierarchie, dem Postmeister, dem Dorfpolizisten – wie sollte das funktionieren? Aber sein Weltbild war eh schon ins Wanken geraten, als er in seiner deutschen Wehrmacht auf Juden traf, die wie selbstverständlich neben ihm Dienst taten und keinen Hehl aus ihrer Treue zu Heimat und Kaiserreich machten. Zuhause im Dorf wurden sie als „Saujüdden“ und „Vaterlandsverräter“ beschimpft, und wie er vom Hörensagen wusste, gab es nur ein paar jüdische Familien an der Sieg und in Siegburg, einer Stadt, die für ihn so unendlich weit weg war, dass er sich kaum erinnern konnte, jemals dort gewesen zu sein. Geschweige denn in Köln, jener Stadt, von der ihm sein weltgewandter Kamerad so viel erzählte. Anat war mit seinen Eltern sogar einmal nach Hamburg gefahren. Sie hatten den Bruder seines Vaters zum Schiff begleitet, das ihn nach New York bringen würde, um dort eine – wie nannte Anat es noch – Dependance ihres Kölner Geschäfts zu eröffnen.
Wenn Anat gewusst hätte, welch ein Segen diese verwandtschaftliche Beziehung einmal für seine Familie sein sollte.
Es lagen noch vier scheußliche Wochen vor ihnen, bis der Krieg für sie endlich vorbei war, sie in Gefangenschaft gerieten und einige Monate später, im Frühjahr 1919 gemeinsam nach Hause zurückkehren konnten und jeder für sich wieder in seine Welt eintauchte, die sich grundlegend geändert hatte. Einen Kaiser gab es nicht mehr, ein Sozialdemokrat hatte die Republik ausgerufen und während sie in französischer Gefangenschaft festsaßen, hatten Wahlen zur Nationalversammlung stattgefunden. So unterschiedlich die beiden waren, ihre Freundschaft sollte über den Tod hinaus Bestand haben.
Erst viele Jahre später sollte Wilhelm bewusst werden, dass viele Männer weniger Glück hatten als die beiden. Sie kamen schwer traumatisiert, verstümmelt oder verwundet nach Hause. Oder überhaupt nicht mehr. Eine arrogante, inzüchtige Monarchie mit einem Kaiser, dessen Dummheit nur noch von seiner Selbstüberschätzung übertroffen wurde, hatte diesen Krieg angezettelt und ein Volk in ein Unglück gestürzt, das noch drei Jahrzehnte andauern sollte, bis ein Selbstreinigungsprozess in Gang kam, der wenigstens für Europa die Chance für eine Befriedung der Nationen bot.
Wahlscheid 2001
Werner
Werner Merkelbach hatte nie geheiratet. Gelegenheiten hatte es genug gegeben, aber eigentlich war er zufrieden mit seiner Rolle als Bauer auf dem Hof, den er gemeinsam mit seinen Eltern bewirtschaftete. Mitte der Sechziger starb sein Vater Wilhelm bei einem Unfall mit dem Traktor, seine Mutter hatte sich von dem Schock nie erholt und starb zwei Jahre später. Werner wurde bewusst, dass auch er nicht ewig als einsamer Bauer würde überleben können. Er verpachtete einige der Äcker und Wiesen, die zum Hof gehörten, und gestaltete einen Teil des am Flüsschen Agger gelegenen Weidelandes in einen Campingplatz um. Das erwies sich als Goldgrube, denn viele kleinere Angestellte und Arbeiter aus dem nahen Köln sehnten sich nach einem ruhigen Wochenende auf dem Land und so waren die 80 Stellplätze bald vermietet. Die winzige Kneipe, die er in einem Teil des Hofs ausbaute, war bald Anlaufpunkt für die „Etagenwanzen“, wie die Camper von den Einheimischen genannt wurden.
Nach und nach baute Werner den alten Stall und die beiden Scheunen in Wohnungen um und so entstand rund um das alte Wohngebäude ein kleiner, heimeliger Wohnpark. Das bescherte ihm keine Reichtümer, aber er konnte gut davon leben, ohne sich sonderlich anstrengen zu müssen.
Es war 1975, sein fünfzigster Geburtstag. Werner hatte ein Menü für das gute Dutzend Freunde zusammengetüftelt, die sich mehr oder minder regelmäßig zum Schwafeln, Kochen, Essen und der Dezimierung des einen oder anderen Weinkellers zusammenfanden. Als Hauptgang sollte es „Penis Aggertalensis” geben, wie er das butterzarte Fleischgericht nannte. Dazu schnitt er ein Rinderfilet der Länge nach auf, sodass ein rechteckiges, einen Zentimeter dickes Stück Fleisch vor ihm auf der Tischplatte lag. Dieses wurde kräftig gepfeffert und gesalzen und mit körnigem Dijonsenf eingeschmiert. Darauf kam eine dünne Lage Sauerkraut und Kirschen, deren Saft zuvor mit Madeira eingedickt wurde. Diese Lage rollte er wie eine dicke Roulade auf, verschnürte das Päckchen mit Küchengarn und briet es in einer großen Pfanne von allen Seiten kräftig an. In Alufolie eingepackt würde es vier bis fünf Stunden bei 80 Grad im Backofen brauchen, bis die Temperatur im Innern des Fleischs exakt 55 Grad betrug.
Dazu gab es kurz angedünsteten Blumenkohl mit Sahne und herzhaftem Bergkäse gratiniert. Für die Soße aus Pfifferlingen wurden Zwiebeln mit den Pilzen angeschwitzt und mit einer Mischung aus schwarzem Pfeffer, etwas Muskatnussblüten, Piment und Curry bestreut und mit Brühe abgelöscht. Mit reichlich Sahne musste das dann gründlich einkochen, bis die Soße kurz vor dem Servieren mit kalter Butter montiert, mit Worcester-Sauce abgeschmeckt und mit frischer Petersilie bestreut wurde. Dazu gab es natürlich reichlich Rotwein und nach der x-ten Flasche 68er Chateau Monbousquet kam das Gespräch mal wieder auf die Rente und auf die Zeit nach den eigenen Zähnen. Ob man dann wohl so gemütlich im Altersheim zusammenhocken und alte Rock&Roll-Nummern in beliebiger Lautstärke würde anhören können? Autark wolle man bleiben, am besten mit eigener Krankenschwester, wohl gefülltem Weinkeller und selbstbestimmten Essensplänen.
Jedenfalls pflanzte sich an jenem denkwürdigen Tag diese Idee in Werners Kopf und im Laufe der Zeit hatten diese Vorstellungen vom Rentnerdasein in seine Umbaupläne Einzug gehalten. Heute, zwei Jahrzehnte später wohnten in den 20 kleinen Wohnungen 15 Ruheständler paarweise oder einzeln mit acht jungen Menschen zusammen. Letztere wohnten umsonst, solange sie in der Ausbildung waren oder studierten. Ihre Miete sollten sie später an die Kasse der Alters-Wohngemeinschaft zahlen, sobald sie eigenes Geld verdienten. In dem langsam aber stetig gewachsenen Gebäudekomplex war ein Gemeinschaftsraum integriert, der sich mit der angeschlossenen Küche zu einem gut besuchten öffentlichen Restaurant entwickelt hatte, das die Bewohner liebevoll „Carpe Diem“ getauft hatten.
Wenn auch manch einer die Vorgänge in Werners Umfeld mit einigem Misstrauen begegnete, so war er doch ein respektables Mitglied der dörflichen Gemeinschaft. Aus der Politik hielt er sich konsequent heraus und außer der Freiwilligen Feuerwehr gehörte er keinem Verein an. Sein Umgang mit den Menschen war von gegenseitigem Respekt geprägt und denen, die er nicht mochte, begegnete er mit gleichgültiger Belustigung, bisweilen auch mit zynischem Humor.
Ständigen Stress hatte er nur mit der Stadtverwaltung. Er wartete Ewigkeiten auf eine Baugenehmigung, Vorschriften wurden akribisch kontrolliert, seine Restaurantküche lag unter ständiger Beobachtung des Ordnungsamtes und verdächtig häufig wurden in der WG wohnende ausländische Studenten von den Behörden auf ihr Bleiberecht kontrolliert. Seit Jahren versuchte man ihm nachzuweisen, dass sein Campingplatz für die in der Agger gefundenen Giftstoffe verantwortlich sei. Ein Gegengutachten, von ihm selbst in Auftrag gegeben, stellte allerdings eindeutig fest, dass die gleichen Werte auch flussaufwärts gemessen werden konnten, sein Campingplatz also kaum die Ursache für die erhöhten Werte sein konnte. Indes wurde sein Gutachten von der Verwaltung bisher ignoriert.
Einen richtigen Hebel, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen, hatte bisher niemand ansetzen können. Werner hatte sich mit Anwälten beraten und achtete sehr genau auf die Einhaltung von Verordnungen und Vorschriften.
Schon in den 60er Jahren waren viele Hektar Wiese und Acker entlang der Agger von den Pächtern und Bauern aufgegeben worden, weil die Erträge deutlich zurückgingen. Sie verkauften das Land nach und nach für kleines Geld an die Clique der örtlichen Baulöwen, allen voran die Schiermeisters, deren Familienoberhaupt sich nach dem Krieg trotz oder vielleicht gerade wegen seiner Nazi-Vergangenheit vom Kleinbauern zum größten und reichsten Gierschlund entwickelt hatte. Zuerst der alte Richard und nach dessen Tod sein anmaßender Sprössling Joachim, mit dem sich Werner, seit sie gemeinsam die harten Bänke der Wahlscheider Volksschule gedrückt hatten, in stetem Zoff befand. Unter dem Deckmantel des wirtschaftlichen Aufschwungs und der Menschenfreundlichkeit versuchte er mit hinterfotziger Lobbyarbeit im Stadtrat Mehrheiten dafür zu finden, das Gelände an der Agger im Nutzungsplan als Bauland auszuweisen. Seit Jahren schon trieb der „Clan der Sizilianer“, wie Werner sie nannte, ein Projekt voran, die gesamten Flächen am Fluss in einen Vergnügungspark mit Hotels und umfangreichen Freizeitanlagen umzubauen. Bisher fehlten dazu die letzten Mehrheiten im Rat und das Filetstück des Areals mit Werners Campingplatz und Wohnanlage.
Nachdem er mit dem Wasserbauingenieur einer Lohmarer Fachfirma das Gegengutachten besprochen hatte, stand für ihn allerdings fest, dass hinter den Vorgängen rund um die Grundstückverkäufe mehr steckte, als ihn zur Aufgabe seines Campingplatzes zu bewegen. Eine Mehrheit für den Bau der geplanten Hotelklötze lag aber mit der derzeitigen Sitzverteilung im Stadtrat in weiter Ferne. So blieb Werner gelassen, aber wachsam.
Dem Erfolg seiner Kneipe, dem „Carpe Diem“ indes tat dies keinen Abbruch. Zuweilen verirrten sich auch Mitglieder des „Clans“ oder Volksvertreter in das Restaurant. Sie gaben sich volksnah und jovial, aber wenn sie zu anmaßend wurden, bekamen Sie den Spott der anderen Gäste und des Personals zu spüren.
Wahlscheid, Juli 1935
Heidrun
„Mach´s gut. Und wenn ihr in Köln keine Bleibe mehr habt, dann kommt ihr zu uns aufs Land.“ Wilhelm und Anat verabschiedeten sich herzlich mit einer Umarmung. Auch die beiden Frauen, Wilhelms Frau Heidrun und Rinah, die Anat vor neun Jahren geheiratet hatte, drückten sich einen Kuss auf die Wange.
Der „Bahnhofs-Gustav“, in Personalunion Bahnhofs-Vorsteher, Schrankenwärter, Kneipenwirt und oberste Informations-Instanz im Dorf, runzelte die Stirn ob solcher Vertraulichkeit, murmelt sich einen Fluch in den grauen Bart und setzte Dienst-Mütze und -Miene auf, als der Zug heranrumpelte und mit Gefauche zum Stehen kam.
Anat, Rinah und ihre beiden Kinder Michaela und der kleine Daniel waren zur Sommerfrische zwei Tage am Wochenende auf dem Hof der Merkelbachs in Wahlscheid gewesen und wollten nun mit dem Zug nach Köln zurückfahren. Sie würden gut zwei Stunden unterwegs und rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit wieder in ihrer Wohnung in der Budengasse sein. So konnten sie einigermaßen sicher sein, nicht von einem Trupp Braunhemden aufgehalten und schikaniert zu werden.
„Die Kölner“, wie Heidrun die Liesenthals nannte, waren gerne hier auf dem Land, denn auf dem kleinen, aber gemütlichen Bauernhof waren sie keinen Angriffen ausgesetzt, die in der Stadt zwar nicht offen zum Ausbruch kamen, aber immer latent vorhanden waren. Trotz des Ansehens, das die Familie Liesenthal in Köln seit Generationen genoss, ließen sie auch die Menschen in ihrer näheren Umgebung spüren, dass sie als Juden nicht erwünscht waren. Da half es wenig, dass Rinah ein Mündel des Kaufhausbarons Leonard Tietz war, der bis zur Arisierung 1933 das größte Kaufhaus in Köln führte. Das war erst zwei Jahre her, aber man hatte den Eindruck, als läge eine Ewigkeit dazwischen.
Die beiden Männer waren ihr in den letzten Tagen merkwürdig bedrückt vorgekommen, hatten lange und mit ernster Miene auf der Bank neben der Scheune gesessen und miteinander geredet und auch jetzt, als sie der Dampflok mit den vier Waggons hinterher winkten, spürte Heidrun, dass ihrem Mann ein dicker Kloß im Hals steckte. Früher hatten die vier immer viel und ausgelassen gelacht, Anat hatte Wilhelm mit seinem überlegenen Wissen über Literatur gehänselt und Willi hatte mit dem Singen von Heimatliedern, die er im Männerchor gelernt hatte, gekontert. Anschließend waren sie dann über die Vorräte des Selbstgebrannten hergefallen und hatten sich köstlich amüsiert. „Man muss in Würde besoffen und alt werden können“, war ihr Leitspruch, den sie dann immer wieder glucksend und wie Kinder kichernd von sich gaben. Die beiden Frauen ließen sie gewähren, erzählten miteinander und nutzten die Zeit, sich näher kennen zu lernen. Heidrun hatte ihrer neuen Freundin ein altes Bergisches Rezept beigebracht: Dielsknall, auch Puttes genannt. Jedes Dorf in der Umgegend hatte einen anderen Namen für das deftige Gericht aus geriebenen Kartoffeln, Mettwurst und gekochtem Schinken. Hinzu kamen noch üppig Pfeffer, Rosinen, Pflaumen und Eier. Das Ganze wurde dann mit reichlich Schmalz zu einem Teig verrührt und in eine runde Backform gegeben, die mit Speckstreifen ausgelegt war. Eigentlich ein Gericht für kalte Winterabende, aber es war Anats Leibgericht und er riss Witze über das Stück Schweinefleisch, das ihnen im Frühjahr 1918 das Leben gerettet hatte. Er konnte geduldig vor dem alten Backes neben der Scheune sitzen und den ca. 2-stündigen Garprozess des Kartoffelkuchens abwarten, der sich dann, auf einen großen Teller gestürzt, als herrlich duftendes, krosses Backwerk präsentierte. Dazu liebte er einen guten Löffel von diesem schwarzen, klebrigen Rübenkraut und er hatte sein Vergnügen daran, wenn die drei Kinder am Tisch bis zu den Ellenbogen eingesaut waren.
Überhaupt hatten auch die drei „Pänz“ eine Menge Spaß miteinander. Die beiden Stadtkinder genossen es, alle paar Monate einige Tage durch die Wälder, Wiesen und Scheunen der Umgebung zu streunen. Heidrun und Wilhelms Sohn Werner wurde 1925, ein Jahr nach ihrer Heirat geboren, Michaela war ein Jahr jünger und der kleine Daniel würde bald sechs werden.
Hoffentlich würden sie sich in Köln durchsetzen können. Gegen diesen Hass und die Gleichgültigkeit konnte auch all das Geld, das ihr Vater verdient hatte, nicht ankommen, ging es Heidrun durch den Kopf. Traurig hatte Anat berichtet, dass die braune Flut nun auch den Kölner Karneval erreicht hatte. Seit die Gestapo ihr Hauptquartier für den Gau Köln-Aachen mitten in der Stadt eingerichtet hatte, war man in der Kölner Innenstadt nicht mehr sicher und im Rosenmontagszug, wichtigste Ikone Kölner Brauchtums, waren Wagen mit antisemitischen und rassistischen Hetzparolen mitgefahren. Die Kölner Karnevalsvereine hatten sich weitgehend mit den neuen Herren arrangiert, denn wer aufmuckte oder der humorlosen Bande den Spiegel vorhielt, wurde drangsaliert und bekam Auftrittsverbot, wie der Büttenredner Karl Küpper, der den dämlichen Nazigruß mit „Eß et am rähne?“ oder „Bei uns im Keller litt der Dreck esu huh!“ veräppelte. Anat hatte sich jahrelang im von Max Salomon gegründeten und allseits respektierten jüdischen Karnevalsverein „Kleiner Kölner Klub 1922“ engagiert, aber mittlerweile war auch der Kölner Fasteleer von den braunen Rotten infiltriert und er wurde kaum noch eingeladen. Ein Vereinsleben war ihm als Jude ohnehin verwehrt, aber seine finanziellen Zuwendungen wurden vom Komitee gerne angenommen, hatte ihr Rinah erzählt.
„Komm, wir fahren heim.“ – Willi riss seine Frau aus ihren Gedanken. „Willst du nicht noch auf ein Bier und einen Schnaps in den Bahnhof?“ Trotz der gedrückten Stimmung gestern Abend hatten die beiden Freunde zwar eine gute Portion Alkohol gehabt, aber sie wollte ihrem Mann nicht seine gewohnte Einkehr nehmen. „Nein – ich will heim, mir ist nicht nach Gustav“, meinte er mit einem Blick auf den Bahnhofsvorsteher, der in seiner Strickjacke jetzt wieder wie ein Wirt aussah und mit seinem alten Kumpel, dem Kürten-Scheng, auf der Bank saß und sich von seiner Schwester den Schnaps bringen ließ. Eine Frau hatte Gustav nicht und außer seiner Schwester Gertrud hätte es auch kaum eine Frau bei diesem ewig greinenden und vor sich hinknurrenden alten Dickschädel ausgehalten.
Der wahre Grund, warum Willi nach Hause wollte, war Heidrun nicht verborgen geblieben. An der Theke in der Gaststätte saß Richard Schiermeister, der „Dorfschulze“, wie er von allen genannt wurde. Bei der Gemeindewahl 1933 war er mit seinen wirren Hetz-Parolen mit Pauken und Trompeten durchgefallen, aber ein Jahr später wurde er nach der neuen Reichs-Gemeindeverfassung vom Landrat in Siegburg als „Gemeindeschulze“ eingesetzt. Willi war schon mehrfach aufs Übelste mit dem grobschlächtigen Schwätzer aneinandergeraten, vor allem Willis Freundschaft zu einem Juden wurde von ihm ständig böse kommentiert.
Sie stiegen in den Wagen, Wilhelms ganzer Stolz: ein Brennabor Typ P von 1919, den ihm sein Onkel, der im Nachbarort die Tochter des Kohlenhändlers geheiratet hatte, vor ein paar Jahren geschenkt hatte. Das Gefährt stammte aus der ersten Serie von Fahrzeugen, die nach dem Krieg wieder in Brandenburg gebaut worden waren und entsprechend anfällig war der 8-Zylinder mit seinen 24 PS auch. Aber Willi war ein geschickter Handwerker und er bekam so allerlei wieder ans Laufen.
Wahlscheid, August 1938
Joachim
Als er des Nachmittags mit seinem Vater durch den Ort fuhr, hatte Joachim die beiden schon gesehen, als sie aus dem Zug stiegen: Das Judenmädchen und ihr kleiner Bruder, die wieder mal im Dorf auftauchten und von den Merkelbachs abgeholt wurden, um bei den Judenfreunden zu schmarotzen, wie sein Vater das nannte. Der musste es wissen, denn er war der Ortsvorsteher.
„Lass bloß die Finger von denen“, hatte ihn sein Vater gewarnt. Dass das keine richtigen Menschen sind, hatte er schon kapiert, aber das schöne, hochgewachsene Mädchen mit den langen schwarzen Haaren interessierte ihn doch, seit er nachts trotz der sommerlichen Hitze das dicke Plumeau bis zum Kinn hochzog, damit nur ja niemand merkte, dass er wieder und wieder Hand an sich legen musste, um den Druck seiner knapp 14 Lenze loszuwerden. Natürlich plagte ihn das schlechte Gewissen, aber es war an der Zeit, das gierige Gerede seiner Schulfreunde zu überprüfen. Sonst war er überall der Wortführer, aber mangels praktischer Erfahrung konnte er in dieser Hinsicht nicht viel zu den Halbwahrheiten und den Phantastereien der Beuede* beitragen. Er hatte keine Schwester oder Cousine, wo er mal am Badetag durchs Schlüsselloch spinksen* konnte, und so beschränkten sich seine optischen Eindrücke auf einige Zeichnungen und zerknitterten Fotos, die seine Kumpels in der Tasche ihrer kurzen Lederhosen mit sich herumtrugen, um damit anzugeben.
Nein – er musste endlich eigene Erfahrungen sammeln und warum nicht mit dieser Judengöre, die ja ohnehin kein richtiges Mädchen ist, aber offensichtlich über die geeigneten Attribute verfügte, um als Anschauungsmaterial zu dienen. Da konnte sein Vater eigentlich nichts dagegen haben. Außerdem wollte er sich ja auch nicht erwischen lassen. Er wusste, dass die Kölner Freunde der Merkelbachs in den beiden Zimmern des Anbaus wohnten, wenn sie auf dem Hof waren. In dem Anbau hatten Willis Eltern gewohnt, bis sie vor einigen Jahren kurz hintereinander starben und ihrem einzigen Sohn den Bauernhof überließen. Und nun nisteten sich die beiden Judenbälger hier ein, um ein paar Tage der Sommerferien auf dem Land zu verbringen. Die Weide reichte fast bis an das Haus heran und lediglich ein Weg aus Steinplatten, in deren Zwischenräumen Gras und Unkraut hervorguckten, trennte den Zaun aus handgedrehtem Stacheldraht von der Hauswand. Der helle Mond stand auf der anderen Seite des Hauses und er konnte unbemerkt und im Schlagschatten bis an das Fenster herantreten in der Hoffnung, durch die kleinen Sprossenfenster einen vorwitzigen Blick nach innen werfen zu können. Gefahr drohte ihm nicht, denn er hatte gesehen, dass Wilhelm Merkelbach mit seinem Sohn Werner und dem kleinen Daniel zu einem Hochsitz gewandert waren, um Wild zu beobachten. Die Bäuerin hielt sich in der Küche auf und putzte Gemüse.
Michaela saß am kleinen Tisch an der Wand rechts von ihm und las in einem Buch. Links standen zwei Betten, die durch zwei schmale, hohe Nachtschränkchen voneinander getrennt waren. Das Mädchen hatte ihr sonst streng nach hinten zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenes Haar offen über den Schultern hängen. Ihr Kleid, die hellrosa Bluse und die Schürze lagen achtlos hingeworfen auf einem kleinen Teppich. Auch ihr war es offensichtlich viel zu warm nach diesem heißen Sommertag und so trug sie nur eine Unterhose und ein dünnes ärmelloses Hemd. Der Raum war durch zwei Kerzen auf dem Tisch und einer Spirituslampe an der Decke beleuchtet. Der Hof verfügte zwar über Strom, aber die Leitungen reichten offensichtlich noch nicht bis in diesen Anbau. Die Tür zum dunklen Flur gegenüber stand offen, um etwas Frischluft in das Zimmer zu lassen. Wahrscheinlich hatte das Mädchen die Fenster geschlossen, um die Mücken fernzuhalten. Sie hatte ihren Kopf in die linke Hand gestützt, ihre rechte lag auf dem nackten Oberschenkel. Das flackernde Licht der Kerze beleuchtete ihr gespannt lesendes Gesicht und er konnte sehen, wie ihre Augen über die Seiten flogen. Ab und zu blätterte sie um. Fasziniert beobachtete Joachim, wie sich ihre Schenkel rhythmisch öffneten und schlossen, offenbar in nervöser Anspannung, die die Geschichte in dem dicken Wälzer hervorrief. Er konnte sich nicht satt sehen. Plötzlich klappte sie das Buch zu, stand auf und räkelte sich, streckte die Arme nach beiden Seiten und hinter den Kopf. Die kleinen Brüste drückten gegen den Stoff, als sich der junge Körper dehnte. So etwas hatte Joachim noch nie gesehen. Gebannt starrte er durch die Scheibe, als Michaela plötzlich mitten im herzhaften Gähnen und Strecken innehielt und ihre Augen weit aufriss.
„Was machst du da, du Schwein?!“ Joachim erstarrte. Sie hatte ihn entdeckt. Jetzt musste er sehen, dass er fortkam und zwar schnell. Noch konnte er hoffen, dass sie ihn zwar gesehen, aber nicht erkannt hatte. Notfalls konnte er alles abstreiten. Sein Vater würde ihn windelweich hauen, wenn er erführe, dass er einem Judenmädchen hinterher stieg. In wilder Panik versuchte er, über den Stacheldrahtzaun zu klettern, um über die Weide zu entkommen. In der Dunkelheit verfehlte er den untersten Draht und riss sich ein gehöriges Loch in sein Hemd, als er abrutschte. Ein heißer Schmerz durchzuckte seinen rechten Oberschenkel und die linke Hand, als die gebogenen Nägel in sein Fleisch schnitten.
Er hörte noch, wie das Fenster aufgestoßen wurde und die Bäuerin irgendwas hinausrief, als er endlich den Zaun überwunden hatte und sich humpelnd davon machte. Das würden sie ihm büßen, die verdammten Juden, diese blöde Kuh – wehe, sie würde ihm mal in die Finger geraten.
New York, Mai 2003
Christina
Die zehn Stunden im Flieger hatten Christina gutgetan. Sie hatte fast vier Stunden fest geschlafen und die restliche Zeit über Notizen und Unterlagen gebrütet. Der Mittelplatz links neben ihr war frei geblieben und der junge Mann am Fenster hatte während des Fluges kaum einen Mucks getan, sich ab und zu kichernd in T.C. Boyles Africa-Epos „Water Music“ vertieft oder vor sich hingeschlummert.
Wieder und wieder musste sie die alten Fotos betrachten und in dem Stapel alter Schulhefte stöbern. Christina hatte sie vor einigen Wochen in einem Karton im Nachlass ihrer Großmutter gefunden. Es waren ihre Tagebücher und sie reichten zurück bis ins Jahr 1936, als sie gerade mal 10 Jahre alt war und endeten Mitte 2002, einige Wochen bevor sie starb. Die Lebenslinie konnte man an der Handschrift über die Jahrzehnte hinweg ablesen, von der schnörkeligen, Stil suchenden Schrift der Kindheit bis zur geübten geradlinigen Hand einer erwachsenen Frau. Erst die Eintragungen der letzten Monate waren von ihrem Krebsleiden gezeichnet, zittrig, zuletzt kaum noch lesbar. Die Kriegsjahre 1940 bis 1945 fehlten zwar, aber die abenteuerlichen Geschichte ihrer Flucht aus Köln waren in einer Kladde des Jahres 1946 nacherzählt. Christina hatte Hinweise gefunden, dass die Oma Ihre Tagebücher aus der Kriegszeit auf ihrer Flucht hatte zurücklassen müssen. Christina war froh, dass sie während ihres Studiums einen Lehrgang in Sütterlin absolviert hatte. Die Einträge der ersten Jahre waren in dieser kompliziert aussehenden deutschen Schrift verfasst, erst später war ihre Großmutter zu der normalen lateinischen Schreibschrift übergegangen.
Christina war in die Fußstapfen ihres Vaters getreten, der sie und ihre Mutter zwar schon vor langer Zeit verlassen und einen Lehrauftrag in Pennsylvania angenommen, aber dennoch einen nicht geringen Einfluss auf die Erziehung und ihre geistige Entwicklung genommen hatte. Sie hatte an der State University Europäische Geschichte und Geographie studiert und nebenbei intensiv Deutsch gelernt.
„Frieden finden .…“ – so lautet der letzte Eintrag in den Tagebüchern; ohne Datum, die Sehnsucht einer Sterbenden. Von ihrer Mutter wusste Christina, dass Oma Michaela Liesenthal im Frühjahr 1943 über Holland nach England gekommen war. Während der Flucht vor dem Nazi-Regime war ihre Tochter Heidemarie, Christinas Mutter, zur Welt gekommen. Die damals 18-jährige Jüdin war auf einem Boot mit anderen Flüchtlingen auf die britische Insel gebracht worden und hatte dort einige Monate bei einer jüdischen Familie gewohnt, bis sie im Mai 1945 endlich eine Schiffspassage nach New York erhalten hatte. Dort angekommen hatte sie einige Tage gebraucht, um in diesem brodelnden Schmelztiegel zurecht zu kommen und die Familie ihres Großonkels Joseph Liesenthal zu finden. Dieser war schon vor dem Ersten Weltkrieg ausgewandert und seine Nachkommen betrieben gemäß der Familientradition Goldschmiedegeschäfte in Manhattan. Es kostete Michaela einige Mühe, mit holprigem Englisch und dem Kleinkind auf dem Arm mit Hilfe der Angestellten bis zu dem großen Anwesen des Clans in Westchester County vorzudringen. Immerhin bot ihr die Familie eine neue Heimat und eine Beschäftigung im Haushalt und später als Verwalterin des familieneigenen Gestüts an. Erst viele Jahre später, 1972, zog sie nach Brockport im Monroe County, als ihre Tochter den Geschichtsprofessor Joseph Hudson heiratete, der an der dortigen State University Geschichte und Politik lehrte. Sie selbst hat nie geheiratet und Christina fand in den Tagebüchern auch keine Hinweise auf Liebschaften mit Männern, wohl aber eine Reihe von Andeutungen, die man mit etwas Phantasie als eine unterdrückte Sehnsucht nach nicht ausgelebten, gleichgeschlechtlichen Beziehungen interpretieren könnte. Nirgends gab es einen Hinweis auf den Vater ihrer Tochter. Wenn später einmal die Rede von Heidemaries Vater war, hieß es immer, er sei Deutscher und im Krieg geblieben.
Ihre Großmutter war eine bildschöne Frau gewesen und Christinas Mutter hatte erzählt, dass es nicht an Gelegenheiten gemangelt hatte, nette und meistens steinreiche junge Männer kennenzulernen, die im Hause der Liesenthals ein- und ausgingen. Mit ihrem freundlichen, aber zurückhaltenden Wesen hielt sie sich indes alle Interessenten auf Distanz und bald wurde aus der „harten Nuss“ in Anspielung auf ihre deutsche Herkunft ein „everlasting Fraulein“. In ihrem Tagebuch hatte sie an einer Stelle dazu geschrieben: „… ewig dumm, ewig langweilig, ewig gleich, was wirklich ewig ist, wissen sie nicht.“ Andeutungen wie diese fanden sich zuhauf in den Heften und sie waren es auch, die Christina neugierig gemacht hatten, mehr über die Vergangenheit ihrer Großmutter zu erfahren.
„Die Eltern, der Bruder sind tot – so viele sind gestorben, das böse Pack überlebt und hat alles genommen.“ Christina hatte diesen Eintrag zuerst auf die Judenpogrome und die Tatsache bezogen, dass in beiden neuen deutschen Staaten viele der Naziverbrecher weiterhin als unbescholtene Bürger leben und sogar hohe und höchste Ämter besetzen konnten. Nach und nach begriff sie aber, dass diese Anmerkungen sehr konkret auf Ereignisse anspielten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit persönlichen Erinnerungen aus der Jugend Michaelas stehen mussten.
Einen deutlichen Beweis dieser These fand sie schließlich zwischen den vielen Papieren und Unterlagen, die Oma Michaela mit nach Brockport gebracht und dort auf dem Dachboden der Hudsons verstaut hatte. Der Brief aus dem Jahr 1959 stammte von einem Anwalt aus Bonn und war mit einer einfachen Schreibmaschine geschrieben und in deutscher Sprache verfasst. Vielfach auseinander- und wieder zusammengefaltet, hatte er arg gelitten. Überdies war das Papier irgendwann einmal feucht geworden und einige Textpassagen waren mit einem Tintenfüller unterstrichen. Nun war der Text nicht mehr vollständig zu entziffern.
„… können wir Ihnen mitteilen, daß die Fa-----------Gemeinde Wahlscheid lebt und mehrere größere Gewerbebetriebe ----------------------handel unterhält. --------------- verheiratet und hat einen dreijährigen Sohn --------- …“
Anbei lag eine Kostennote über 800 Deutsche Mark, darauf der handschriftliche Hinweis, dass die Rechnung bezahlt worden sei. Ihre Großmutter musste gute Gründe gehabt haben, sich mit Hilfe eines deutschen Anwaltes Auskünfte über Menschen in einer kleinen Gemeinde nahe Köln zu beschaffen. Möglicherweise hatte sie versucht nach dem Vater ihres Kindes zu forschen, aber die Suche irgendwann aufgegeben.
Ausgerechnet die Namen waren offenbar unterstrichen worden und dadurch nicht mehr lesbar und Christina hatte vergeblich versucht, die Fragmente durch Informationen aus den Tagebüchern zu ergänzen. Auch ein früherer Studien-Kollege, der sich mit alten Schriften beschäftigt hatte, konnte ihr nicht weiterhelfen.
In den Aufzeichnungen ihrer Großmutter fanden sich viele Hinweise auf Besuche eines Bauernhofs, der einer gewissen Familie Merkelbach gehörte. Offenbar waren Michaelas Eltern mit dieser Bauernfamilie eng befreundet gewesen und sie hatte noch im Jahre 1938 gemeinsam mit ihrem Bruder Daniel einen Teil der Sommerferien in Wahlscheid verbracht.
Im Internet hatte Christina weder Informationen über den Bonner Anwalt gefunden noch Hilfreiches über den Ort Wahlscheid oder deren Einwohner in Erfahrung gebracht. Sie hatte per Email Kontakt zu dem Betreiber einer privaten Homepage der Stadt Lohmar aufgenommen. Wahlscheid war in den 60er Jahren nach Lohmar eingemeindet worden und nurmehr Ortsteil der Stadt. Immerhin konnte ihr der ferne Webmaster mitteilen, dass ein Werner Merkelbach in einem Altenwohnheim lebt und sich offensichtlich guter Gesundheit erfreut. Die Homepage des Wohnheims sagte lediglich, dass ein „Relaunch“, eine Neugestaltung des Internet-Auftritts unmittelbar bevorstünde.
Christinas Mutter war ihr keine große Hilfe bei der Auflösung des Rätsels. Heidemarie lebte seit der Trennung von ihrem Mann vor 10 Jahren in einer Scheinwelt, verließ ihr Zuhause so gut wie überhaupt nicht mehr und saß nur im Wohnzimmer, um dümmliche Soaps im Fernsehen anzuschauen oder in Frauenzeitschriften zu blättern. Auf Fragen reagierte sie kaum und gab nur ausweichende Antworten, wenn die Sprache auf Ereignisse kam, die außerhalb der gemeinsamen Jahre mit ihrem Ehemann lagen.
So hatte Christina beschlossen, nach Deutschland zu reisen. Nach erfolgreichem Abschluss ihres Studiums hatte sie nun die Zeit dazu. Sie hatte etwas Geld von ihrem Vater erhalten und frei von Beziehungen sonstiger Art war sie auch. Was lag also näher, als sich ein wenig das alte Europa anzuschauen und dabei vielleicht etwas über ihre Großmutter und ihre eigene Herkunft herauszufinden. Ihre Mutter in dem Haus in Brockport allein zu lassen, fiel ihr natürlich schwer, aber sie dachte sich, dass sie sich vielleicht ein bisschen neu besinnen würde, wenn sie sich mal eine Weile selbst um die täglichen Belange kümmern müsse.
Christina starrte durch das kleine Fenster auf die Wolkendecke, die sich unter dem Flieger ausbreitete und dachte an die gemeinsamen Jahre mit ihren Eltern in dem kleinen Häuschen in der Nähe des Campus der Universität, an ihre stille, immer etwas bekümmert wirkende Mutter und ihren Vater, der die Attitüden des intellektuellen 68er-Studenten auch als Dozent einer Universität nie abgelegt hatte. Sie musste lächeln, als sie ihren Vater inmitten einer kleinen Schar von Studenten vor sich sah. Mit seinem Strubbelkopf, den fleckigen Jeans und dem alten T-Shirt sah er aus wie einer von ihnen, wenn sie nächtelang über Gott und die Welt diskutierten, Rotwein tranken und große Joints rauchten. Eine Zeitlang hatten sie das vor dem kleinen, rothaarigen Mädchen zu verbergen versucht, aber irgendwann hatte ihr Vater ihr erklärt, was es damit auf sich hatte, und sie hatte den qualmenden Gestank als eine der vielen Merkwürdigkeiten der Erwachsenen akzeptiert. Mutter verbrachte diese Stunden meist in der Küche, kochte Suppe und machte Sandwichs für die Bande.
„Madam – bitte schnallen Sie sich an. Wir landen in wenigen Minuten.“ Die Stewardess holte Christina in die Gegenwart zurück. Sie band ihre roten Locken zusammen, verstaute die Unterlagen wieder in die alte Ledertasche und ihren Laptop in den Rucksack.
Sie hatte in Köln ein Hotel gebucht und wollte sich dort zunächst ein paar Tage orientieren. Es war nicht weit nach Bonn, wo sie den Anwalt aufzutreiben hoffte, und auch das Nest Wahlscheid lag nur eine halbe Autostunde entfernt, wie sie auf ihrer Roadmap im Internet festgestellt hatte. Für die meisten Reisenden aus den USA war Köln eine „One-Stop-City“, eine Stadt, die man nur der einzigen Sehenswürdigkeit, des Doms wegen, besuchte. Sie wusste es besser, ein Kommilitone hatte eine Weile in Köln gelebt und ihr eine Menge mehr Interessantes über die Stadt erzählt.
Köln, Anfang November 1938
Anat
Anat trat aus dem Haus in der Budengasse, wo ihre Wohnung lag, und stand einen Augenblick auf der nassen Straße. Er hatte sich einen Termin beim alten Bankier Weber geben lassen und hoffte, dass er sich damit endlich Klarheit verschaffen konnte, wie sich sein Leben und das seiner Familie zukünftig gestalten sollte.
Die Nazis hatten ihm seine Goldschmiedewerkstatt dicht gemacht. Er musste seine elf Angestellten entlassen und auch sein Schmuckgeschäft hatte er schon vor zwei Jahren geschlossen, als die Angriffe gegen ihn zu massiv wurden. Einer seiner alten Kollegen beschäftigte ihn seitdem bei Bedarf als Uhrmacher. Jetzt kam ihm zugute, dass ihn sein Vater nach dem Krieg in eine Lehre gedrängt hatte. Er konnte von Glück sagen, dass er es mithilfe eines alten Angestellten geschafft hatte, einen Großteil der Goldvorräte und die Schweizer Vreneli-Münzen auf Seite zu schaffen und sie so dem Zugriff der Nazi-Schergen erst einmal zu entziehen. Seit April des Jahres mussten Juden Geldbeträge über 5.000 Reichsmark anmelden und Anat hatte pflichtgemäß sein Bankkonto angegeben, das rund 20.000 RM auswies, den Rest aber verschwiegen. Sie hatten ihn bis zum Gauleiter Grohé zitiert, wo er befragt wurde, aber letztlich ließen sie ihn wieder laufen. Offensichtlich waren die Nazis der Meinung, dass er sich irgendwann verraten würde und das Vermögen der Liesenthals dann ohne öffentlichen Skandal in die Hände des Volkes fiel, wo es ohnehin hingehörte, denn nach Meinung Josef Grohés hatten die Juden alles dem deutschen Volk gestohlen.
Er betrat das Vorzimmer des Bankiers und das grau gekleidete Fräulein gestattete sich einen abschätzenden Blick. Die Kleidung des ehemaligen Goldschmieds war tatsächlich nicht mehr zeitgemäß und an einigen Stellen geflickt, aber er und Rinah hatten beschlossen nicht zu zeigen, dass sie noch über nicht unerhebliche Mittel verfügten, um die Begehrlichkeiten der Nazis in Grenzen zu halten.
„Der Herr Direktor Weber hat gleich Zeit für Sie. Warten Sie einfach einen Moment ab.“ Sie bot ihm keinen Stuhl an. Noch vor vier Jahren hätte sie sich vor Freundlichkeit überschlagen und ihm eine Tasse Kaffee angeboten, aber die Denkmuster dieses einfach gestrickten Geschöpfs waren von den Einflüssen der Zeit nicht verschont geblieben.
Eine Tür in der schweren Eichentäfelung öffnete sich und der alte Bankier betrat humpelnd den Raum. Schwergewichtig mit hochrotem Kopf und Schwabbelkinn entsprach er voll dem Prototypen eines Bankers dieser Zeit. Einzig die listigen Augen unter den dicken Haarbüscheln seiner Augenbrauen zeigten eine gewisse Lebhaftigkeit. „Kumm rinn, Jung – un, Friedche, breng uns ene Kaffee, aber ne juute.“ Wenn Anat ihn so sah, konnte er seine stille Sympathie für den alten Knochen nicht verbergen. Er musste schmunzeln, weil der „Ühm“, wie ihn seine Freunde nannten, den Singsang seiner kölschen Zunge nicht verbergen konnte, auch wenn er versuchte, Hochdeutsch zu sprechen. Anat wusste, dass der schwer herzkranke Ühm neben Englisch und Französisch auch fließend Russisch sprach, sehr gebildet war, und lange Abende bei Schoppen und dicken Zigarren mit Gästen aus allen Schichten im Mohr-Baedorf am Neumarkt verbrachte und über Gott und die Welt philosophierte.
Dennoch: der alte Weber war ein knallharter Geschäftsmann und ein Nationalist wie er im Buche stand und hatte als solcher klar gesagt, was er von der Ehe zwischen seiner Enkelin Rinah und Anat hielt. Aber schon sein Sohn Hubert hatte einen eigenen Kopf gehabt, eine Halbjüdin geheiratet und sich komplett aus der Familie und dem Bankgeschäft seines Vaters zurückgezogen. Geld interessierte ihn nicht und so fristete er sein Leben als ebenso erfolg- wie mittelloser Musiker und Komponist in der Kölner Altstadt. Kurz nach Rinahs Geburt kamen er und seine Frau bei einem Brand ums Leben und Rinah wurde von der Familie Tietz aufgenommen, die als jüdische Kaufmannsfamilie von Posen an den Rhein gekommen war und von hier aus eine Kaufhauskette aufgebaut hatte. Sie waren Juden und als solche sehr um eine soziale Absicherung ihrer Gemeindemitglieder bemüht. Rinah zeigte sich als ruhiges, aber kluges und lernbegieriges Kind, und obzwar der Großvater Ühm Weber offizieller Vormund war, nahm Rinah doch sehr bald die Stelle einer Tochter in der Familie Tietz ein. Als sie dann 1925 den erfolgreichen Goldschmied Anat Liesenthal heiratete, konnte sich der Ühm kaum gegen die inzwischen mächtigen Kaufleute zur Wehr setzen und hatte der Verbindung schließlich seinen Segen gegeben.
„Ich hab immer schon jesagt, datt et besser is, wenn sich die Kulturen und Religionen nitt in et Jeheje kommen. Dä Onkel Max hatte schon recht, wenn er sagt, datt die Juden in der Wüste en eijenen Staat gründen sollten. Ich versteh janich, warum die Nazis denen nit einfach helfen. Dann sinnse die Plach doch los!“ Er meinte Max Bodenheimer, der schon vor dem Krieg einen eigenen Staat auf dem Boden Palästinas eingefordert hatte. Seine National-Jüdische Vereinigung wurde von den Nazis natürlich verboten. Die verfolgten da ganz andere Ziele.
Anat hatte wirklich keine Lust, sich mit seinem Schwieger-Opa in Grundsatz-Diskussionen einzulassen. Der über 70-Jährige hatte seine Meinung über Jahrzehnte geformt und in vielen weinseligen Stunden gefestigt; jeder Widerstand war da zwecklos. Er musste vielmehr versuchen, an die Güte des alten Mannes und an seine Vorstellung von der Trennung der Religionen zu appellieren.
Die Sekretärin betrat das Büro und stellte ein Tablett mit Kaffeetassen und einer Kanne auf den Tisch. Auf einem Teller lagen zwei dunkle Röggelchen, einige dicke Scheiben alter Holländer Käse und ein Stück geräucherter Bauchspeck, daneben ein Topf Senf, Zwiebeln und ein Stück Butter. Während sie sich weiter unterhielten, beschäftigte sich der Ühm abwechselnd mit dem fetten Frühstück und seiner Zigarre, an der er zwischen den Bissen genussvoll paffte. Anat lehnte dankend ab, als ihn der Ühm aufforderte zuzugreifen.
„Siehst du, Ühm“, setzte Anat das Gespräch fort, als die Frau das Zimmer verlassen hatte. „Das ist genau das, was wir wollen. Wir möchten weg aus Köln, aber wir wollen nicht warten, bis sie uns ausweisen. Dann müsste ich alles zurücklassen, was sich die Familie in über hundert Jahren aufgebaut hat. Und ich habe die Verantwortung für meine Familie. Meine Frau ist immerhin deine Enkelin. Und ob du das nun willst oder nicht, aber du bist der Urgroßvater meiner Kinder.“ Anat wusste, dass er den Nerv des Alten getroffen hatte.
„Warum jehst du nit nach New York?“ – „Damit ich als Lakai bei meinem Onkel anschaffen gehe?“ Er hatte noch in guter Erinnerung, wie ihn sein Onkel Joseph behandelt hatte, als er vor rund zehn Jahren bei der Beerdigung seines Bruders in Köln war.
„Wie ich in dingem Alter jewesen bin, wär´ ich froh jewesen, wenn mir einer so´en Anjebot jemacht hätte. Wer weiß, wie lang datt noch juht jeht, wie lang se euch noch in Ruh´ lassen. Un Amerika is jroß. Du muss ja nit bei dingem Onkel arbeiten.“
„Wir würden am liebsten in die Schweiz gehen.“ – „Damit et dir jenauso jeht, wie dem Tietz. Dem habense alles abjenommen. Da kann ich dir nit helfen. Aber ich kann dafür sorjen, datt ihr nach Holland kommt. Da habbich en paar Freunde, die mir noch watt schuldig sind und die euch helfen, auf en anständijes Schiff zu kommen. Drüben wird euch dann erst mal der Hannes helfen.“
Insgeheim musste er dem Ühm recht geben. Die Tietz´ waren vor einigen Jahren in die Schweiz geflüchtet, nachdem der Horten-Konzern ihnen mit Hilfe der Hamburger Commerzbank ihren gesamten Besitz, der immerhin aus dem größten deutschen Kaufhaus-Konzern mit zwei Dutzend Filialen bestand, für einen lächerlichen Betrag abgekauft hatte. Da war er eigentlich besser dran, weil sein Besitz wesentlich kleiner war und nicht aus unbeweglichen Immobilien bestand. Sollte er den Ühm einweihen? Letztlich wird er es müssen, wenn er sein kleines Vermögen mit in die Staaten nehmen wollte. Aber darüber musste er erst mal mit Rinah sprechen.
„Meinst du, dass das klappt?“ „Ihr seid nich die Ersten, die mir rausschaffen. Mir sin doch froh, datt mir die los sind.“
Sein Hausdiener Emil, der dem Ühm treu ergeben war, würde sich um die Einzelheiten kümmern und dafür sorgen, dass sie mit dem Nötigsten versorgt die Ausreise antreten könnten. Der Ühm nannte ihm noch ein paar Fakten und sie kamen überein, dass ihm Anat in der kommenden Woche Bescheid geben wolle. Für das Wochenende hatten sich Willi und Heidrun angemeldet und ohne den Rat seines Freundes wollte Anat keine Entscheidung treffen.





























