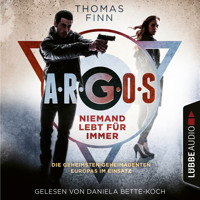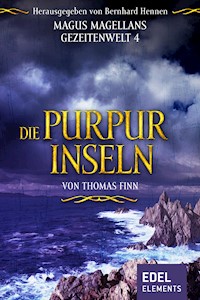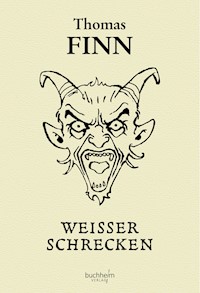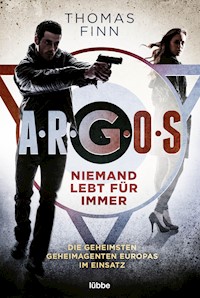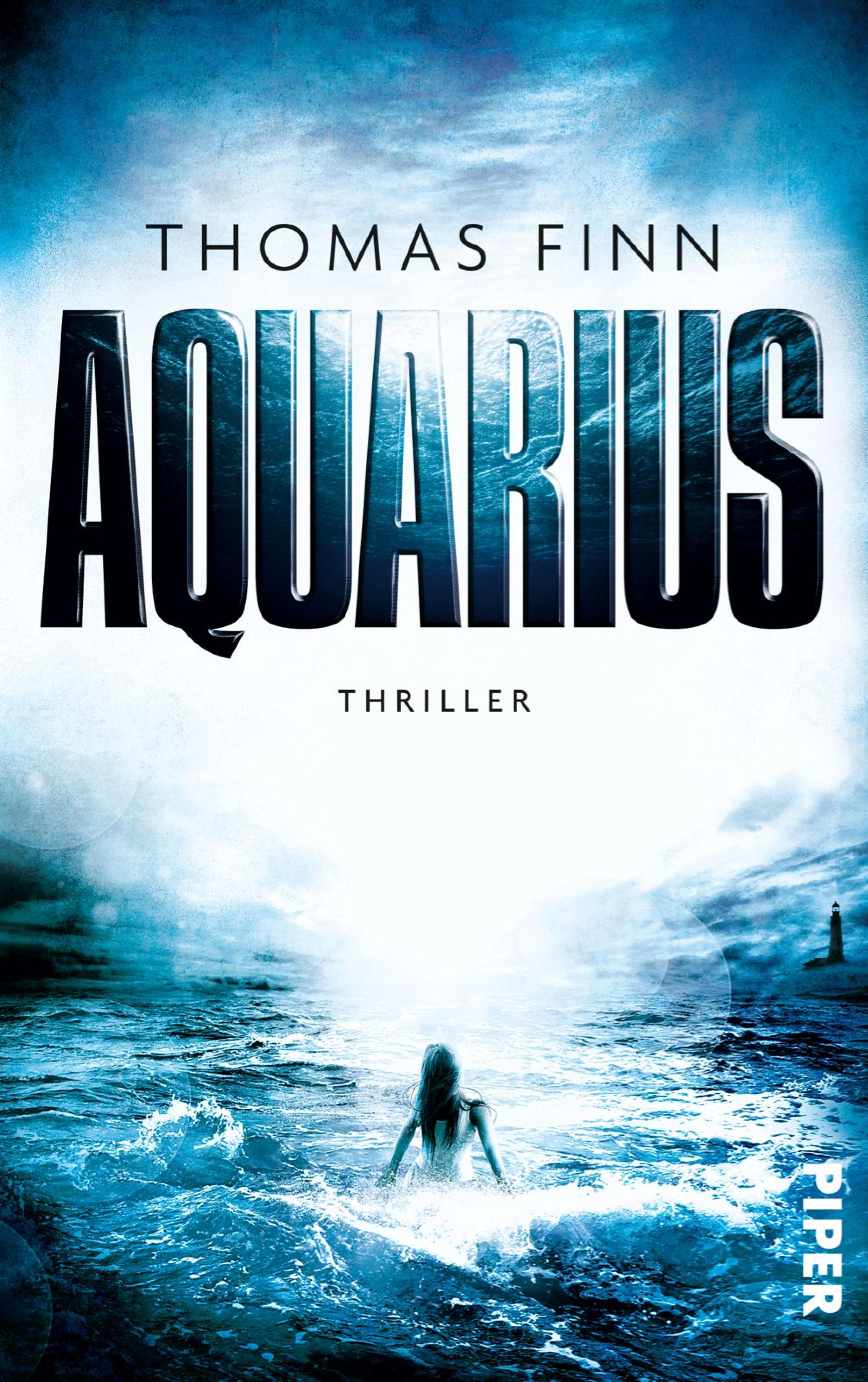6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Lukas Faust erfährt, dass in der Hölle ein Machtkampf tobt, der die Welt in die Apokalypse reißen könnte. Nur wer die mysteriösen schwarzen Tränen besitzt, hat die Macht, das Unheil abzuwenden. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn Lukas und der schwarze Pudel Mephisto müssen die Tränen finden, bevor ihre Verfolger es tun.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 656
Ähnliche
Thomas Finn
Schwarze Tränen
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Der Kampf um die Hölle ist eröffnet
Inhaltsübersicht
Für Tigger, Philipp und Gunter,
ohne die diese Geschichte sicher andere Wege genommen hätte.
»Ich bin der Geist, der stets verneint!
Und das mit Recht; denn alles, was entsteht,
Ist wert, dass es zugrunde geht;
Drum besser wär’s, dass nichts entstünde.
So ist denn alles, was ihr Sünde,
Zerstörung, kurz das Böse nennt,
Mein eigentliches Element.«
Mephistopheles,
Faust; Vers 1338
Prolog
Silber- und Bleibergwerk Teufelsgrund, Schwarzwald 13. September 1431
Wie ein Schleier aus schwarzen Tränen stürzte der Regen auf die Bergwelt hinab. Jacob, der unter einer Tanne Schutz vor den Wassermassen suchte, zuckte zusammen, als ein Blitz die Wolkendecke entflammte. Dem ersten folgte ein zweiter. Dann ein dritter. Ein fahlgelbes Wetterleuchten setzte die Wolkendecke in Brand, und mit ihm rollte ein Grollen von den Passwänden, das der Unterwelt selbst entstiegen zu sein schien. Die Arme eng um den durchfeuchteten Bergmannkittel geschlungen, trat Jacob unter den Zweigen hervor und sah argwöhnisch zum Nachthimmel auf. Irgendetwas stimmte mit den Wolken nicht. Sie erinnerten ihn an Schwaden glühenden Schwefels, und mit jedem Atemzug drängten mehr von ihnen über dem Tal zusammen. Instinktiv fasste er nach dem Griff seiner Bergbarte. Die Axt mit der langen Spitze gehörte zur traditionellen Ausrüstung der Bergleute und diente ihnen als Werkzeug und Waffe gleichermaßen. Allein ihre Nähe vermochte ihn heute nicht zu beruhigen.
Zum Teufel mit der Furcht! Er war doch sonst nicht so zimperlich. Wenn er sich zusammenriss, würde diese Nacht sein Leben von Grund auf verändern. Im Geiste sah er den riesigen Haufen Hacksilber schon vor sich, den ihm der Hutmeister und Oberste Bergwerksaufseher versprochen hatte. Für den Wochenlohn, für den er und die anderen Hauer sonst in der Grube schufteten, konnten sie sich nicht einmal ein Pfund Butter leisten. Er hingegen würde schon bald so reich sein, dass er sich im nahen Staufen jede Hure kaufen konnte, die er haben wollte – falls er nicht gleich in Freiburg sein Glück versuchte. Alles, was er dafür tun musste, war, den Fremden heimlich in den Berg zu führen. Dorthin, wo der seltsame Unfall passiert war – auch wenn er und die anderen Kumpel den Zwischenfall im Stollen für alles andere als natürlichen Ursprungs hielten.
Jacob trat zurück unter die Tanne und überprüfte, ob das Talglicht seiner Laterne noch brannte. Dann wanderte sein Blick zurück zu dem schlammigen Grubenpfad, der hinunter ins Dorf führte. Jenen Weg, den gewöhnlich die Knechte und Knappen nahmen, wenn sie zwischen Bergwerk und Siedlung hin- und herwechselten. Doch der Pfad lag noch immer verwaist und regennass vor ihm. Wo blieb der Kerl? Scheute er das schlechte Wetter?
Ein grelles Licht zuckte am Rande seines Sichtfeldes auf. Dem heftigen Donnerhall folgte ein mächtiger Windstoß, der Jacob von den Beinen fegte. Bäuchlings stützte er auf den Weg und blieb im Matsch liegen. Was, zum Henker …? Im nahen Wald prasselte es. Dort stand jetzt eine ausgewachsene Fichte in Flammen. Allmählich sickerte die Erkenntnis in sein Bewusstsein, dass keine zehn Schritt von ihm entfernt ein Blitz eingeschlagen war. Schwankend rappelte er sich wieder auf – als ihm eine selbstgefällige Stimme entgegenschlug. »Mitternacht! Pünktlich, wie immer.«
Jacob zerrte die Axt aus dem Gürtel und sah sich um. Unweit von ihm trat eine schlanke, hoch aufragende Gestalt aus dem Flackerlicht. Der Fremde trug einen dunklen Übermantel ohne Gürtel, der ihm bis zu den Knöcheln reichte. Sein Gesicht war kaum mehr als ein blasser Schemen unter der breiten Krempe des tief in die Stirn gezogenen Lederhutes. Die Kopfbedeckung erinnerte Jacob an die eines Gelehrten, flößte ihm jedoch kein Vertrauen ein. Irgendetwas stimmte nicht mit diesem Mann. Nur wusste Jacob nicht zu sagen, was. Sein Blick irrlichterte hinüber zu dem ausgetretenen Grubenpfad. Wie war der Fremde hierhergelangt, wenn nicht über diesen Weg? »Seid Ihr der Doktor?«, krächzte er.
»Welch ein bewundernswertes Ausmaß an Scharfsinn.« Die Gestalt trat zwischen den Bäumen hervor und lüpfte die Krempe des Hutes. Im Licht der Flammen enthüllte sich Jacob ein bärtiges, fast asketisches Gesicht mit spitzer Nase und harten Augen, die ihn unnachgiebig musterten. »Gestatten, Magister Johann Georg Faust, Quellbrunn der Nekromanten, Astrologe, Erster der Magier, Chiromant, Aeromant, Pyromant, Zweiter in der Hydromantie. Wenngleich Letzteres auch einer neuerlichen Überprüfung bedürfte, für die mir im Moment aber die Zeit fehlt.« Ein spöttisches Lächeln kräuselte Fausts Lippen. »Du bist dieser Jacob, der mir als Führer versprochen wurde?«
»Äh, ja. Aber wie seid Ihr …?« Jacob stockte, denn schlagartig wurde ihm bewusst, was ihn am Erscheinungsbild des Gelehrten irritierte. Hut und Umhang glänzten nicht vor Nässe. Sie wirkten staubtrocken, als sei der Fremde soeben durch die Tür eines Gasthauses ins Freie getreten. Jacob leckte sich unruhig über die Lippen, als ihm auffiel, dass auch das Rauschen des Regens verstummt war. Um ihn herum tröpfelte es noch von den Bäumen, doch das Unwetter war ebenso plötzlich zum Erliegen gekommen, wie es aufgezogen war. Das Prasseln des Feuers hingegen erschien ihm jetzt lauter als zuvor. Jacob schauderte. War dieser Faust tatsächlich ein Schwarzkünstler? Er packte das Bergeisen fester. »Zuvor will ich wissen, wie es mit meiner Belohnung aussieht«, rief er.
»Immer einen Blick fürs Wesentliche. Das gefällt mir.« Faust stiefelte im Schein der Flammen an ihm vorbei, blieb an der Abbruchkante neben dem Grubenpfad stehen und sah hinab auf das unter ihnen liegende Bergwerksgelände. »Doch mag an dieser Stelle der Hinweis angebracht sein, dass der Lohn für deine Gefälligkeit nicht vom Hutmeister, sondern aus meiner Tasche aufgebracht wird.«
»Ist mir egal, von wem ich das Silber erhalte.«
»Sei versichert, du bekommst, was du verdienst. Allerdings nur, wenn du dich als nützlich erweist.«
Glaubte der Kerl, er habe es mit einem Narren zu tun? Faust wandte ihm noch immer den Rücken zu, und kurz erwog Jacob, dem Kerl die Axt über den Schädel zu ziehen. Es wäre nicht das erste Mal, und vielleicht käme er so noch leichter an die Belohnung heran.
»Du bist doch nützlich, oder?« In der Stimme des Doktors schwang ein lauernder Unterton. Jacob fühlte sich wie ein kleiner Junge, der beim Eierdiebstahl ertappt worden war. »Sicher bin ich das«, antwortete er unbehaglich, ehe er vorsichtig neben den Doktor trat, um selbst einen Blick auf das nächtlich verschattete Tal zu werfen. Die große Senke unter ihnen war auf ganzer Länge abgeholzt und wirkte wie eine klaffende Wunde in der Bergwelt. In der Dunkelheit zeichneten sich die Lagerhäuser sowie die überdachten Arbeitsstätten der Röster und Bergschmiede ab. Die Hütten mit den Treträdern und Tiergöpeln hingegen waren ebenso kaum zu erahnen wie die Grubenbauten und Pochstellen, die Waschwerke sowie die Meilerplätze und Abraumhalden. »Der Eingang zum Hauptstollen ist zu dieser Tageszeit versperrt«, brummte Jacob schließlich. »Aber da existiert ein weiteres Mundloch, gleich da hinten neben der Schmelzhütte. Der Nebenstollen führt ebenfalls zu der Stelle. Doch eines sage ich Euch schon jetzt: In das Bergwerk selbst kriegen mich keine zehn Pferde mehr. Ich führe Euch nur bis zum Eingang.«
»Der Hutmeister berichtete mir, dass du Zeuge der Tragödie warst«, sprach Faust ohne erkennbare Gefühlsregung. »Berichte mir davon.«
Jacob räusperte sich. »Na ja, als die Männer verschüttet wurden, gehörte ich zu jenen, die versucht haben, sie zu bergen.«
»Und?«
»Wir haben drei Tage gebraucht, bis wir uns zu ihnen durchgearbeitet hatten. Und die ersten eineinhalb Tage haben wir sie auch noch gehört.«
»Was hast du gehört?«, wollte Faust wissen.
»Nichts. Also nichts Verständliches. Sie …« Jacob starrte weiter hinunter zum Tal. »Sie haben geweint.«
»Geweint?«
»Ja. Immer, wenn wir innehielten, konnten wir sie schluchzen hören. Den meisten aus der Bergungsmannschaft ging das durch und durch. Die haben die ewige Flennerei nicht mehr ausgehalten und sind nach oben ans Tageslicht geflüchtet.«
»Aber du nicht?«
»Nein, ich nicht. Jedenfalls anfangs.« Jacob warf seinem Begleiter einen verstohlenen Blick zu, doch der Gelehrte ließ sich nicht anmerken, was er von der Geschichte hielt. »Ich bin aus einem anderen Holz geschnitzt.«
»Davon bin ich überzeugt.« Faust grinste wissend, und abermals fühlte Jacob sich ertappt. Aus irgendeinem Grund kam ihm mit einem Mal der Junge in den Sinn, dem er vor etlichen Jahren wegen drei Silberpfennigen den Schädel eingeschlagen hatte. Wusste sein Gegenüber von der Schuld, mit der er seine unsterbliche Seele befleckt hatte? Vielleicht konnten Schwarzkünstler so etwas spüren? Hieß es denn nicht, dass Mörder wie er ihre Seele an den Teufel verkauften? Unsinn, dachte Jacob und schüttelte den Gedanken ab. »Die Verschütteten haben jedenfalls geflennt wie kleine Kinder. Ging irgendwann in ein Wimmern über. Bis sie still wurden. Ganz still.« Faust schwieg, und Jacob zuckte mit den Schultern. »Ich schätze mal, Grubengas oder so.«
»Grubengas?« Faust sah ihn erstmals an. »In einem Silberbergwerk? Bist du närrisch?«
Jacob wusste nicht, was er darauf erwidern sollte. Jetzt erschien ihm die Erklärung ebenfalls unsinnig.
»Und es waren dreizehn Männer, die verschüttet wurden?«
»Dreizehn?« Jacob wurde ob der Zahl unbehaglich zumute. »Na ja. Eigentlich waren es elf.«
»Bemühe deinen Verstand! Das ist wichtig.« Faust fixierte ihn drohend. »Der Hutmeister sprach von exakt dreizehn Männern.«
»Ja, alle zusammen wohl schon. Denn als wir uns zu den Kumpeln durchgearbeitet hatten, zwängte sich einer von uns zu ihnen in die Dunkelheit, um nach ihnen zu sehen. Dann war er plötzlich weg. Also, er hat nicht mehr geantwortet, und gesehen haben wir ihn auch nicht mehr. Aber dann haben wir ihn gehört. Genauso wie bei den anderen. Ich meine … da ging dieses Schluchzen aufs Neue los.« Die Erinnerung an das Geschehene behagte Jacob ganz und gar nicht. »Schließlich ging unser Steiger nachsehen. Als der ebenfalls nicht zurückkam, wurde uns Übrigen angst und bange zumute. Da haben wir die Wand wieder dicht gemacht und sind abgehauen.« Jacob schauderte bei der Erinnerung, versuchte sich aber nichts anmerken zu lassen. Unterdessen flammten tief unter ihnen in der Senke die Lichter von Laternen auf. Wächter schwärmten aus und prüften, ob der Sturm Schäden auf dem Grubengelände angerichtet hatte. Zwei von ihnen hatten offenbar den brennenden Baum hinter ihm und dem Doktor erspäht und marschierten bereits den Grubenpfad empor. Jacob fluchte stumm. Mit etwas Pech würden die beiden sie entdecken und dumme Fragen stellen.
»Und dir ist bei alledem nie der Gedanke gekommen, dass das Bergwerk seinen Namen nicht zu Unrecht trägt? Teufelsgrund?«
Jacob schluckte. »Pah, hier im Schwarzwald wimmelt es von solchen Orten. Kennt Ihr das Höllental? Oder die Teufelstreppe?« Er lachte leise auf und hörte selbst, wie gepresst es klang. »Außerdem gehört das Bergwerk dem Bischof von Basel. Das wird doch wohl mehr Gewicht haben als die alten Märchen, die man sich über das Bergwerk erzählt, oder?«
»Eben, mein Freund. Eben.« Fausts Lippen umspielte ein böses Lächeln. »Welcher erwachsene Mann wird sich schon von ein paar Schauergeschichten bange machen lassen. Darf ich?« Der Doktor nahm ihm die Laterne ab, öffnete die Klappe und griff in die Flamme. Jacob riss ungläubig die Augen auf, als das trübe Flämmchen ansatzlos in Fausts Hand sprang, an Ballen und Gelenken emporwanderte, um schließlich an der Spitze des Zeigefingers zu wabern, als wäre diese der Docht einer Kerze. Ohne Jacob aus den Augen zu lassen, führte Faust die brennende Fingerspitze vor den Mund. »So nah am Ziel meiner Suche sollten wir beide keine weitere Zeit verlieren. Lass mich nur zunächst der Festtagsbeleuchtung ein Ende setzen.« Er blies das Flämmchen aus, und schlagartig sanken im nahen Wald die Flammen der brennenden Fichte in sich zusammen. Nicht einmal Rauch stieg von dem verkohlten Baumgerippe auf.
Jacob keuchte ungläubig und starrte sein Gegenüber entgeistert an. Erst jetzt entdeckte er, dass sich das unheimliche Schauspiel bei den Laternen der Wächter wiederholte. Eine nach der anderen erlosch, und Grubenpfad und Tal versanken in Dunkelheit. Nein, korrigierte Jacob sich, das war keine einfache Dunkelheit. Die Finsternis, die Berg und Tal nun umfangen hielt, war allgegenwärtig. Er fühlte sich, als habe man ihm eine Binde um die Augen gelegt, und seine Nackenhaare stellten sich auf, als ein Luftzug ihm über die Haut fuhr und ein Flattern dicht neben seinem Ohr erklang. Wie der Flügelschlag eines Schwarms von Raben, dachte er. Auch die Luft roch plötzlich anders. Abgestanden und stickig.
Faust drückte ihm im Dunkeln die Laterne wieder in die Hand. Dann schnippte er, und in der Lampe züngelte erneut ein Flämmchen empor. Ihr Schein beleuchtete einen von Schrämspuren überzogenen Felsengang, dessen niedrige Decke von hölzernen Grubenstempeln gestützt wurde.
»Gott im Himmel!« Jacob begriff, dass sie beide von einem Augenblick zum anderen im Berg gelandet waren. Schreiend wich er vor Faust zurück – und krachte gegen die Felswand, wo er zu Boden ging. Panisch tastete er nach seinem Bergeisen, doch die Axt war fort. Faust hielt sie in der Rechten und wies mit ihr auf sein Gesicht.
»Ich hoffe, wir beide verstehen einander jetzt besser?« Der Blick des Zauberers durchbohrte ihn wie kaltes Eisen, und einen Moment lang glaubte Jacob durch diese Augen hindurch wie durch ein Fenster auf die Seele des Mannes blicken zu können. Dort lagen so viel Arroganz und verkommene Bosheit, dass ihm schlecht wurde vor Angst.
»Und jetzt hoch mit dir. Du wirst so lange an meiner Seite bleiben, bis ich deine Dienste nicht mehr benötige.«
Jacob nickte stumm. Hastig rappelte er sich auf, hob die Laterne an und stolperte voran in die Dunkelheit.
Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis Jacob seinen unheimlichen Begleiter an Leitern und Haspelwinden vorbei durch die Tunnel, Kammern und Schächte bis zu jenem Stollen geführt hatte, der hinter den Kumpeln eingestürzt war. Noch immer türmte sich dort das Gestein bis zur Decke. Davor säumte Schutt ihren Weg, und im Gang standen die mit Steinen gefüllten Tragekörbe, die sie bei ihrer überstürzten Flucht zurückgelassen hatten.
»Scheint so, als sei hier seit unserem Abgang niemand mehr gewesen.« Jacob zitterte und wusste selbst nicht zu sagen, ob er sich mehr vor diesem Doktor Faust oder dem lichtlosen Ort fürchtete, an den er sie beide geführt hatte.
Faust bedeutete ihm, still zu sein, und lauschte, dann lächelte er. »Nein, wir sind hier unten alles andere als allein.«
Auch Jacob konnte es jetzt hören. Von irgendwoher drang ein leises Raunen und Flüstern an seine Ohren. »Was ist das?«, keuchte er.
»Verdammte Seelen«, erklärte Faust gelangweilt und kramte ohne Eile unter seinem Gewand.
»Berggeister?!« Jacob blieb der Entsetzensschrei in der Kehle stecken, so sehr fürchtete er sich.
»Nenn sie, wie du willst«, knurrte der Gelehrte und öffnete eine längliche Schachtel, der er zwei langstielige Pflanzen mit ausgefransten grünen Blättern und weißen, in voller Pracht stehenden Blüten entnahm. Waren das Buschwindröschen? »Diese Seelen sind so lästig wie Ungeziefer. Aber damit habe ich gerechnet. Solange wir etwas Hexenblum bei uns haben, belästigen sie uns nicht.« Faust warf ihm das Bergeisen zu. »Also, worauf wartest du? Mach den Weg frei.«
Jacob krümmte sich zusammen. Wie ein geprügelter Hund stolperte er an Faust vorbei und zu dem Schutthügel hinüber. Erst nach ein paar zittrigen Atemzügen fand er den Mut, das Gestein an der Stelle zu bearbeiten, die er und seine Kumpel damals wieder mit Felsen verschlossen hatten. Das pochende Geräusch seines Bergeisens hallte von den Stollenwänden, Gestein rumpelte zu Boden. Schließlich gelang es ihm, den engen Zugang zu dem verschütteten Gangabschnitt erneut freizulegen. Dunkelheit gähnte ihm entgegen. Doch sosehr er auch lauschte, jenseits des Zugangs herrschte Stille.
Faust trat hinter ihn und drückte ihm die Hexenblum in die Hand. »Hübsch festhalten, mein Freund. Solange du dieses Pflänzchen bei dir trägst, können dir die Geister nichts anhaben.«
Jacob wimmerte leise. »Ihr wollt tatsächlich dort hinein?«, stieß er hervor, und seine Stimme klang fremd in seinen Ohren. Kurz erwog er, Faust anzugreifen, ihn fortzustoßen und zu laufen, bis er diesem vermaledeiten Stollen entronnen sein würde. Doch ein Blick in die kalten schwarzen Augen des Doktors belehrte ihn eines Besseren, und so fügte er sich in sein Schicksal.
Faust schob ihn ungeduldig vorwärts. »Nein, nicht ich will da rein, wir wollen da rein. Und jetzt Beeilung.«
Jacob sprach mit bebenden Lippen das Vaterunser, während er sich durch die Öffnung zwängte. Abermals polterte Gestein, und er rutschte auf der anderen Seite eine Schutthalde hinunter. Rasch kam er wieder auf die Beine und hob zitternd die Laterne. Vor ihm im Dunkeln lag der abgeschnittene Streckenabschnitt. Er war leer … oder? Jacob spähte angestrengt in die Dunkelheit und entdeckte weiter hinten, am Rande des Lichtkreises, graue Schemen, die halb sitzend, halb aufgerichtet gegen die Stollenwand lehnten. Schemen mit Gliedmaßen.
Hinter ihm bahnte sich Doktor Faust einen Weg in den Tunnel, nahm ihm die Laterne ab und drehte die Blende auf. »Hervorragend. All die Jahre der Forschungen. Sie waren nicht umsonst.« Er eilte voran, ohne seinen Begleiter weiter zu beachten.
Jacob, den plötzlich Dunkelheit umfing, stolperte bebend hinterher. Als er den Zauberer eingeholt hatte, ächzte er. Dreizehn leblose Körper, deren Haut sich pergamenten über die Knochen spannte, kauerten rechts und links des Tunnels. Ihre staubige Kleidung wirkte viel zu groß, hing schlaff an den ausgemergelten Gliedmaßen herab, und unter den abgemagerten, verschrumpelten Händen zeichneten sich Gelenke und Knochen überdeutlich ab. Endlich wagte er es, einen Blick auf die Gesichter der Toten zu werfen. Das waren Fratzen! Die Münder waren weit aufgerissenen, zwischen den gebleckten Zähnen stachen verdorrte Zungen hervor, und die tiefliegenden Augenhöhlen mit den verschrumpelten Augäpfeln waren an den Rändern gerötet. Es dauerte eine Weile, bis Jacob begriff, dass die Nässe in seinen Beinkleidern nicht allein vom Regen herrührte. »Was zur Hölle ist mit ihnen geschehen?«
Faust lächelte kalt und beleuchtete eine eingetrocknete Pfütze mit weißlichem Salzrand, die die Gangmitte zwischen den mumifizierten Bergleuten ausfüllte. »Es ist so, wie du berichtet hast: Sie haben geweint. Sie haben so lange geweint, bis auch der letzte Tropfen Feuchtigkeit ihre Leiber verlassen hatte.«
Jacob wurde vor Grauen fast ohnmächtig. »Kann uns das ebenfalls passieren?« Panisch schaute er sich um und meinte plötzlich, von irgendwoher ein Raunen zu hören.
»Nein«, murmelte Faust. »Dreizehn Leichen. Dreizehn Opfer. Das sollte reichen, um all das Leid, das sie hier unten freigesetzt hatten, wie ein Tuch aufzusaugen.« Er hob die Laterne und spähte an den Toten vorbei. »Ganz ohne Zweifel haben deine Kumpel hier unten einen überaus bedeutenden Fund gemacht.«
Jacob sah ihn fragend an, doch der Zauberer beachtete ihn nicht. Stattdessen beleuchtete er den Gangabschnitt hinter den Toten, als würde er etwas suchen. »Schon einmal kam es zu einem solchen Ereignis wie hier in Teufelsgrund. Nur ist das bereits einige hundert Jahre her. Es geschah zur Zeit von König Barbarossa. Auch damals waren es dreizehn Opfer.«
Jacob zitterte. »Bitte, lasst uns gehen.«
»Nein, erst wenn ich den Stein in Händen halte.«
»Was für einen Stein?«
»Einen Diamanten.« Faust packte ihn am Arm und zog ihn an den entstellten Leichen vorbei, während er das Licht gezielt auf eine funkelnde Stelle am Stollenende ausrichtete. Dort, unmittelbar neben einem herrenlosen Hammer, lag eine zersprungene Steindruse. Jacob hatte kristallgefüllte Hohlkugeln wie diese schon mehrfach gesehen. Doch das Ding am Ende des Gangs war seltsam. Das umgebende Gestein war tiefschwarz und schien nur einen einzigen Kristall zu umhüllen. Dieser funkelte und blitzte in einem kalten dunklen Licht wie eine übergroße Träne und wirkte, als sei er bereits in Tropfenform geschnitten.
»Bei allen Höllenmächten, da ist er!« Faust lachte triumphierend und streckte die Rechte aus, doch in diesem Moment glitt eine fahle Gestalt aus der Felswand. Und dann noch eine und noch eine. Jacob schrie auf. Berggeister! Die Spukgestalten starrten sie mit leeren, rot leuchtenden Augen an, und es vergingen einige Wimpernschläge, bis Jacob begriff, wer sie waren. »Gott, das sind meine toten Kumpel.«
»Ja, sie halten hier Wache. Also hoch mit dem Zauberkraut!«
Ebenso wie Faust reckte Jacob den Gestalten die Hexenblum entgegen. Die Schemen wehklagten und zerstreuten sich, als triebe sie ein geisterhafter Wind auseinander. Doch weiter hinten glitten bereits weitere Gestalten aus dem Fels, die sie zornig anstarrten. Nach und nach verdorrten die Blütenblätter in Jacobs Händen. »Bitte«, schluchzte er, »so lasst uns doch endlich gehen! Die Blume verdorrt!«
»Sehe ich«, gab Faust unbeeindruckt zurück. »Wir müssen die Geister austricksen. Bleib stehen und halt uns den Spuk vom Leib, damit ich Schutzkreise ziehen kann.« Er zückte ein Stück Kreide und bückte sich.
Jacob beobachtete einer Panik nah, wie der Doktor um ihn einen Kreis zog, den er rasch mit Symbolen versah. Jacob wusste nicht, was er mehr fürchten sollte – den Doktor oder die geisterhaften Gestalten, die immer wieder auf sie zuwogten. Stets wenn sie ihnen zu nahe kamen, wehrte er sie mit der Hexenblum ab, und jedes Mal verwelkte ein weiteres der weißen Blütenblätter. Faust zeichnete derweil einen fünfzackigen Stern auf den Boden und stellte sich selbst hinein. »So, das sollte ausreichen«, brummte er zufrieden.
»Wozu ausreichen?«, wimmerte Jacob, den das eigentümliche Gefühl beschlich, dass sich die Geister nun auf ihn konzentrierten. Inzwischen fiel das vorletzte Blütenblatt zu Boden.
»Der Drudenfuß, in dem ich stehe, sollte ausreichen, um mich vor den Geistern zu schützen, wenn sie über dich herfallen. Und solange sie mit dir beschäftigt sind, wird das hier«, Faust kramte ungerührt eine weitere Hexenblum aus seiner Schachtel, »allemal langen, um den Diamanten zu bergen.«
»Was!?« Jacob fuhr herum, packte das Bergeisen in seinen Händen fester und stürzte sich mit einem wütenden Aufschrei auf seinen Begleiter. Doch er kam nicht weit. Mitten im Sprung prallte er gegen ein unsichtbares Hindernis.
»Oh, ich vergaß zu erwähnen, dass du in einem Zwingkreis stehst.« Faust lächelte zuvorkommend. »Ein solcher verhindert, dass das, was sich in seinem Innern befindet, aus ihm entkommt.«
Das letzte Blütenblatt in Jacobs Händen fiel ab und trudelte zu Boden. Am Stollenende wogte die Heerschar der Geister heran.
»Fahr zur Hölle, elender Zauberer!«, brüllte Jacob und schluchzte, während er mit dem Bergeisen verzweifelt gegen die unsichtbare Wand hämmerte. »Soll dich der Teufel holen!«
»Glaube mir, um genau das zu verhindern, bin ich hier.« Faust deutete eine Verbeugung an, dann wandte sich ab, als sei der wimmernde Haufen Mensch hinter ihm für ihn nicht weiter von Interesse.
Als die kreischende Geisterschar den Zwingkreis überwand, begann Jacob zu schreien.
Faust Des Dramas erster Teil
»Blut ist ein ganz besondrer Saft.«
Mephistopheles,
Faust; Vers 1740
Freitag, der Dreizehnte Heute
Abrakadabra!« Lukas Faust stand umringt von Zuschauern in Staufens malerischer Altstadt und verzichtete darauf, dem wohl ältesten aller bekannter Zaubersprüche auch noch das ebenso bekannte ›Dreimal schwarzer Kater!‹ hinzuzufügen. Seine kleine Aufführung war schon so kaum eines Kindergeburtstages würdig und eher der Not geschuldet. Fehlte nur noch, dass er sich in historische Tracht hüllte und seinen berühmt-berüchtigten Namensvetter imitierte, den Zauberer und Schwarzkünstler Doktor Faust. Der umtriebige Magier, dem Goethe Anfang des neunzehnten Jahrhunderts mit seiner berühmten Tragödie zu Weltruhm verholfen hatte, war untrennbar mit Staufen verbunden. Allerdings war der historische Faust bereits im sechzehnten Jahrhundert gestorben; angeblich in Staufens Hotel zum Löwen. Bei alchimistischen Experimenten, wie die Legende verhieß. Das Gasthaus lag nur knappe fünfzig Meter von seinem jetzigen Standpunkt entfernt und erfreute sich auch heute noch größter Beliebtheit. Dass die lokale Sage davon sprach, sein Namensvetter sei damals vom Teufel geholt worden, schien die vielen Touristen nicht abzuschrecken – im Gegenteil. Und auch Lukas Faust deutete es als gutes Omen, dass Staufen sich aufgrund dieser Legende gern als ›Fauststadt‹ präsentierte. Denn schließlich war auch ihm daran gelegen, eine ganz bestimmte Person zum Teufel zu jagen – und wer wusste schon zu sagen, ob es ihm nicht gelingen würde?
Er hob den Kartenstapel routiniert an jener Stelle ab, an der die Touristin das Messer in das Paket gesteckt hatte. Anschließend drehte er das Päckchen theatralisch auf die Bildseite um. Jeder konnte so das gesuchte Pik-Ass sehen, das er zuvor vermeintlich irgendwo im Kartenset untergemischt hatte. Die Touristin staunte; die Umstehenden applaudierten. Eine Fingerübung, ebenso versiert ausgeführt wie die Münztricks, die er zuvor gezeigt hatte.
Lukas verneigte sich, und obwohl ihm alles andere als zum Lachen zumute war, strahlte er professionell mit der Septembersonne um die Wette. Deren Schein tauchte die pastellfarbenen Bürgerhäuser in malerisches Licht und ließ die künstliche, von klobigen Blumenkübeln überdachte Wasserrinne, die den Stadtkern nach Art der berühmten Freiburger Bächle durchzog, wie ein Band aus Kristall glitzern. Selbst die vielen Risse an den Hauswänden, über denen an manchen Stellen rote Aufkleber mit dem Schriftzug ›Staufen darf nicht zerbrechen‹ prangten, wirkten heute nahezu malerisch. Lukas dachte zurück an die missglückten Erdwärme-Bohrungen nahe des alten Rathauses vor fünf Jahren und an die damit einhergehende besorgniserregende Hebung des Untergrundes unter der denkmalgeschützten Altstadt, die Politik und Bürger bis heute in Atem hielt. Kurz kniff er die Augen zusammen und fixierte die Risse, bis er sie wieder deutlich sah. Mit einem Mal schienen sie ihm wie ein Sinnbild dafür, sich nie wieder vom äußeren Schein blenden zu lassen. Er wusste schließlich aus eigener Erfahrung, dass selbst die hübscheste Fassade Risse bekam, wenn das Fundament nicht hielt, was es versprach. Nur dass sich sein Groll nicht auf Staufen richtete, sondern auf ein verführerisches Miststück namens Sylvia. Denn allein um sie zu finden, war er hier. Sie, die kleine Berlinerin, die ihn nach Strich und Faden ausgenommen hatte. Dabei war sonst er derjenige, dem nachgesagt wurde, er spiele mit den Gefühlen seiner Mitmenschen wie auf der Klaviatur eines Keyboards. Doch das dreiundzwanzigjährige Luder mit den langen schwarzen Haaren und den sinnlichen Lippen hatte den Spieß einfach umgedreht! Rückblickend war es ihm ein Rätsel, dass er nicht schon bei ihrem Kennenlernen vor zwei Wochen erkannt hatte, wie diese Schlange auf zwei Beinen wirklich tickte. Immerhin hatte sie ihm mitten auf dem Alexanderplatz die Brieftasche stehlen wollen. Zugegeben, er hatte sie nur ertappt, weil er die Tricks der Szene kannte und selbst nicht als Musterschüler für moralisch integres Verhalten durchging. Doch von der ersten Sekunde an hatte er gespürt, dass mit Sylvia etwas nicht stimmte. Umso mehr ärgerte er sich, dass er ihr auf den Leim gegangen war. Statt mit dem Hirn hatte er mit anderen Körperteilen gedacht. Bei Licht betrachtet, war das auch kein Wunder, denn Sylvia war die Gestalt gewordene Versuchung. Noch immer wurde sein Mund trocken, wenn er an ihre festen Brüste, den in jeder Hinsicht griffigen Hintern und vor allem an die Nächte dachte, die sie beide wie im Fieber verbracht hatten. Bei alledem war Sylvia so unnahbar geblieben, wie er es bei keiner zweiten Frau erlebt hatte. War das von Anfang an Teil des Spieles gewesen?
Lukas wusste nicht, ob es ihn mehr wurmte, dass sie seine Gefühle so missbraucht hatte oder seine Kunst. Denn sie hatte ihn mit ihren tabulosen Überredungskünsten davon überzeugt, seine Trickfertigkeit auf weitaus gewinnbringendere Weise zu nutzen. Zwei Wochen lang waren sie ein Duo Infernale gewesen. Während Sylvia ihre Opfer gekonnt ablenkte, hatte er sein Talent besudelt und seine Fingerfertigkeit als Taschendieb eingesetzt. Fast achttausend Euro hatten sie ergaunert, und ihr kurzes Zusammenleben kam ihm immer noch vor wie ein Rausch aus Tausendundeiner Nacht. Dabei war die Bühnenzauberei für ihn sein Heiliger Gral. Er hatte schon einiges in seinem Leben verbockt, aber wenn er sich neue Tricks ausdenken und das Publikum damit verblüffen konnte, fühlte er sich für einen winzigen Augenblick als der Mittelpunkt des Universums und Teil der großen Illusion, die die meisten für die Wirklichkeit hielten. Leider war das sein einziges Talent. Denn ihm stets auf den Fersen war diese elende Zerrissenheit, die ihn nichts in seinem Leben zu Ende bringen ließ und dafür sorgte, dass er praktisch jeden in seiner Umgebung enttäuschte, ob er das nun wollte oder nicht. Lukas hatte selbst keine Erklärung dafür, aber manchmal war ihm, als würden im Innersten seines Wesens zwei Seiten seines Ichs um Vorherrschaft ringen. Dass Sylvia es trotz ihrer Skrupellosigkeit irgendwie geschafft hatte, die ewige Unruhe in ihm zu bändigen, offenbarte sie ohne Zweifel als einen dunklen Spiegel seiner selbst. Und das war die bitterste Erkenntnis.
Vielleicht war es am Ende ja ganz gut gewesen, dass sie aufgeflogen waren? Das heißt, dass er aufgeflogen war. Denn zuletzt war er ausgerechnet an einen Zivilbullen geraten, der ihn quer durch Berlin gejagt, aber zum Glück nicht erwischt hatte. Als er es dann spätabends wagte, wieder zu seiner Bude zurückzukehren, war Sylvia fort gewesen. Mitsamt der Kohle und seinen übrigen Wertgegenständen. Nur, dass das Miststück nicht ganz so schlau gewesen war, wie sie vielleicht gedacht hatte. Ein Betätigen der Rückruftaste hatte ihm offenbart, dass sie von seinem Festnetzanschluss mit der Bahnauskunft telefoniert hatte, und das Reiseziel hatte sie sogar auf einem Block notiert. Wie in einem schlechten Krimi hatte er die Zettel mit einem Bleistift schraffiert und so ihren Zielort herausgefunden: Staufen.
Hier war er nun, das Lächeln mittlerweile zur Maske gefroren, und seine Chancen, sie zu finden, standen nicht schlecht. In Kürze begann hier die Staufener Zeitreise. Ein ebenso buntes wie schrilles Spektakel, das in den vergangenen Jahren Tausende Besucher in die Stadt gelockt hatte. Ein Wochenende lang spielten über fünfhundert Statisten Staufens bewegte Stadtgeschichte vom Mittelalter bis hin zum Revolutionsjahr 1848 nach. Dann erfüllte Kanonendonner die kleine Stadt, Umzüge drängten durch die Gassen, und vom Bürger- bis hin zum Malefizturm erstreckte sich ein Mittelaltermarkt, auf dem Weine, Biere und Speisen aller Art angeboten wurden. Wie er Sylvia einschätzte, würde sie die Gelegenheit nutzen, weitere Touristen auszunehmen. Er aber kannte ihre Vorlieben und wusste, welche Plätze sie für ihre Gaunereien bevorzugte. Und er hatte genug Zeit, sich mit Staufens Örtlichkeiten vertraut zu machen. Er würde sie finden und dann … Lukas schüttelte den Gedanken ab. Er wusste nicht, was er dann tun würde.
Der Applaus der Menge war zum Erliegen gekommen, und in der Mütze zu seinen Füßen befanden sich nur dreißig Cent. Lukas seufzte innerlich. Seine überstürzte Abreise hatte seine letzten Ersparnisse aufgebraucht. Er würde sich nicht einmal den Schlafplatz in der Jugendherberge leisten können. Sein Plan, sich mit Kunststücken zu finanzieren, schien auch ins Wasser zu fallen, denn am Himmel, jenseits der hoch über der Stadt thronenden Ruine der Burg Staufen, die eingebettet in die Weinberge des Markgräflerlandes lag, zogen dunkle Regenwolken auf. Lange würde er hier nicht mehr stehen können.
Lukas strich sich das dunkle Haar aus der Stirn, steckte das Kartenspiel weg und zählte insgeheim die Umstehenden durch. Seine kleine Vorführung hatte genügend Zuschauer angelockt. Nach dem Säen wurde es Zeit, die Ernte einzufahren – und das möglichst, bevor ihm die Polizei auf die Schliche kam. Doch konnte er das wagen? Seine Ankunft in Staufen fiel auf einen Freitag, den Dreizehnten. Er war nicht besonders abergläubisch, doch Freitage wie dieser hatten es zeit seines Lebens in sich gehabt. Sein leiblicher Vater war an einem Freitag, dem Dreizehnten, gestorben. An einem Freitag, dem Dreizehnten, war sein Hund von einem Blitz erschlagen worden, seine erste große Liebe hatte an einem solchen Tag mit ihm Schluss gemacht, und sogar sein verhasster Stiefvater war an einem Freitag, dem Dreizehnten, in sein Leben getreten. Und das waren nur die Highlights, die mit diesem Datum verbunden waren. Noch konnte er zu Hause anrufen und um Geld bitten. Es wäre nicht das erste Mal. Nur hatte es seine Mutter selbst schwer genug. Seit Jahren schon rackerte sie sich für ihn ab. Es hatte Zeiten gegeben, da fragte er sich, ob sie eigentlich selbst noch etwas übrig behielt, während sie ihm ständig seine Eskapaden finanzierte. Zum Dank hatte er schon wieder fast acht Monate verstreichen lassen, seit er sie das letzte Mal besucht hatte. Nicht weil er ein schlechter Sohn sein wollte, sondern vielmehr aus Scham. Weil sich in seinem Leben einfach nichts änderte. Und wenn sein verhasster Stiefvater am Apparat wäre, würde der ihn eh nur wieder als Versager beschimpfen. Nein, die Entscheidung war längst gefallen. Er würde sein Glück ein letztes Mal aufs Spiel setzen. Einen anderen Weg gab es nicht.
»Kommen wir zum Höhepunkt der heutigen Darbietung!« Er präsentierte drei schwarze Plastikbecher, kramte eine Erbse aus der Tasche seiner Lederjacke und ging in die Hocke. »Denn ein wahrhafter Zauberer scheut das Duell mit seinem Publikum nicht. Fangen wir mit einem kleinen Warm-up an.« Er legte die Erbse auf den Karton zu seinen Füßen, stülpte eine der Kappen darüber und legte die anderen Becher daneben. Mit fließenden Bewegungen vertauschte er ihre Plätze. »Na, kann mir jemand sagen, unter welchem Becher die Erbse liegt?«
Ein Jugendlicher deutete auf das Hütchen in der Mitte.
»Oh, schade.« Lukas lüpfte es. Es war leer. Dabei hatte er nichts getan. Der Typ war einfach nicht aufmerksam genug gewesen. »Probieren wir es ein weiteres Mal.« Lukas legte die Erbse erneut auf den Karton, stülpte abermals eine der Kappen darüber und vertauschte mehrfach die Plätze der Becher. Ein kleines Mädchen deutete schüchtern auf die Kappe zu seiner Linken. »Nicht schlecht!« Lukas hob den Becher an und präsentierte die Erbse. Das Mädchen freute sich, und er zwinkerte ihr zu. Natürlich plante er nicht, Kinder auszunehmen. Die beiden Typen, die weiter rechts standen und schon eine Weile in breitem sächsischen Dialekt Witze über seine Aufführung rissen, waren ein deutlich besseres Ziel. Dass die beiden den Charme schmieriger Gebrauchtwagenhändler hatten und keinen Hehl daraus machten, dass sie auf jemanden wie ihn herabblickten, forderte Lukas’ Stolz erst recht heraus. Er musste sie nur noch dazu bringen, einzusteigen.
Lukas griff in die Hosentasche, präsentierte eine Euromünze und sah das Mädchen an. Anschließend legte er die Münze gut sichtbar auf den Karton. »Mal sehen, ob du aufmerksam genug bist, wenn ich die Hütchen etwas schneller vertausche. Dann gehört der Euro dir.« Er wiederholte sein Spiel und verschob die Becher diesmal etwas rascher. »Na?« Die Kleine sah kurz zu ihrer Mutter auf und deutete diesmal auf das mittlere Hütchen. Lukas hob die Kappe an, und – welche Überraschung! – abermals lag sie richtig. Er tat etwas verärgert und überreichte dem Mädchen den Euro. »Hier, kauf dir ein Eis. Am besten gleich.«
Freudig nahm das Mädchen das Geldstück entgegen.
Lukas wartete, bis sie und ihre Mutter abgezogen waren. Perfekt. Jetzt wirkte es so, als sei es ›kinderleicht‹, ihm auf die Schliche zu kommen. »Bekanntlich heißt es, dass Kinder die Welt mit anderen Augen sehen«, witzelte er und erweckte bewusst den Eindruck, froh zu sein, dass die Kleine fort war. Abermals präsentierte er Erbse und Hütchen und gab einer Dame mit Kamera die Chance, ihn zu durchschauen. »Ups. Schon wieder ein Treffer.«
Die meisten Umstehenden grinsten mitleidig.
Einer der beiden Sachsen meldete sich zu Wort. »Tja, Junge, da musst du schon ein bisschen gewitzter sein.«
Jetzt hatte er ihn an der Angel. »Ich ergänze«, antwortete Lukas leutselig, »Kinder und Frauen durchschauen die Welt. Wir Männer hingegen haben schon Schwierigkeiten, zwei zueinanderpassende Socken zu finden – ganz so wie der Herr dort.« Der Sachse starrte säuerlich an sich hinunter und bemerkte, dass Lukas recht hatte.
Die Frauen im Publikum lachten.
Lukas beglückwünschte sich zu seiner raschen Beobachtungsgabe. Die kleine Provokation würde ihre Wirkung nicht verfehlen. Er lächelte und schob nach. »Aber bekanntlich schärft sich der Blick des Jägers, wenn sich das Wild blicken lässt.«
Jetzt kam es darauf an. Er zückte seinen letzten Fünfeuroschein, legte ihn auf den Karton und sah wie zufällig zu dem vorwitzigen Sachsen auf. »Findet sich hier jemand, der gewitzt genug ist, die Herausforderung anzunehmen?«
»Hier!« Der Mann drängte sich zu ihm durch, offensichtlich bestrebt, seinen Ruf wiederherzustellen. »Ich werde auf dich anstoßen, wenn ich mir auf deine Kosten einen genehmige.«
Sein beleibter Kumpel lachte, als habe er einen anzüglichen Scherz gemacht.
»Nun, Jägersmann«, spielte Lukas seine Rolle weiter, »das erscheint mir bei näherem Hinsehen ein etwas ungleiches Duell. Mein Einsatz liegt hier, doch wo ist der Eure?«
Sein Gegenüber stutzte, zückte dann aber seine Brieftasche und zog ebenfalls einen Fünfeuroschein. Lukas holte tief Luft, als er sah, wie prall das Portemonnaie gefüllt war.
»Also, die Wette gilt«, grunzte sein Gegenüber.
»Waidmannsheil!« Lukas präsentierte Erbse und Becher, deckte sie theatralisch auf und zu und begann das Hütchenspiel aufs Neue. Gespannt sah er zu dem Sachsen auf. »Und?«
»Ich würde mal sagen, die Erbse liegt da!« Der Mann zeigte auf die Kappe rechts von ihm. Arme Sau. Es war völlig egal, auf welches Hütchen er wies, denn Lukas hatte die Erbse mit Daumen und Ringfinger an sich genommen und verbarg sie geschickt in seiner Handfläche. Eskamotieren, charlieren, palmieren. Er beherrschte die Grundbegriffe der Taschenspielerei aus dem Effeff. »Leider daneben!« Er hob die Kappe an und zuckte entschuldigend mit den Schultern. Stattdessen plazierte er die Erbse geschickt unter dem mittleren Becher, als er die dortige Kappe anhob. Säuerlich sah ihn der Mann an, machte aber gute Miene zum bösen Spiel. »Noch mal.«
»Gern.« Lukas legte beide Scheine auf den Karton.
Der Sachse zückte seinerseits einen Zehner.
Kurz darauf hatte Lukas einen Gewinn von fünfzehn Euro zu verbuchen. Dem Betrogenen war anzusehen, dass er nicht so recht wusste, was er von der Sache halten sollte. Als Spielverderber wollte er aber auch nicht gelten.
In diesem Moment schoben sich die Wolken vor die Sonne, und der Straßenzug verdunkelte sich. Lukas fröstelte, dennoch bemächtigte sich seiner jenes Hochgefühl, das er zuletzt an Sylvias Seite erlebt hatte. Vorsichtig hielt Lukas nach den Hütern des Gesetzes Ausschau. Die standen nicht auf Trickbetrügereien, wie er sie gerade abzog. Doch im Moment ließ sich keiner der Beamten blicken. Es war so leicht! Wider alle Vernunft beschloss Lukas weiterzumachen. Er brachte eine Zuschauerin rechts von ihm dazu zu wetten – und ließ sie fünf Euro gewinnen. Danach war der Damm gebrochen, und weitere Touristen versuchten ihr Glück. Im Hintergrund bimmelten die Glocken der Sankt-Martins-Kirche zur ersten Mittagsstunde, und trotz des sich abzeichnenden Regens blieben weitere Schaulustige stehen. Innerhalb kürzester Zeit schaffte er es, fünfzig Euro einzusacken. Er wollte seine Vorstellung gerade abbrechen, als der Sachse erneut vortrat. »Moment.« Sein dicker Freund wollte ihn davon abhalten, doch der Kerl schüttelte ihn ab und präsentierte verärgert einen Fuffziger. »Hier. Wir wetten um den ganzen Pott. Und diesmal behalte ich dich im Auge.« Er grinste siegessicher.
Lukas atmete tief ein. Der Fuffziger sah einfach zu verlockend aus. »Gut, ein letztes Mal. Aber nicht, dass ich Sie nicht gewarnt hätte. Also, aufpassen!« Abermals täuschte er seine Zuschauer. »Nun, wo ist die Erb…«
Als Lukas aufsah, erstarrte er. Keine drei Meter von ihm entfernt stand Sylvia. Wie immer war ihre rote Jacke leicht aufgeknöpft und ließ den Ansatz ihrer Brüste erkennen – und wie immer schaffte sie es, nicht billig, sondern aufregend zu wirken. Sie schien nicht im mindesten überrascht, ihn zu sehen. Stattdessen lächelte sie spöttisch. Wissend. Fast schadenfroh.
»Da!« Der Sachse griff nach dem linken Becher, bevor ihm Lukas zuvorkommen konnte. Wie erwartet, war es darunter leer. Wütend fegte der Mann die anderen Kappen vom Tisch, unter denen ebenfalls keine Erbse zu finden war, denn die hielt Lukas noch immer in der Hand. »Du verdammter Betrüger!«
Unter den Umstehenden erhob sich empörtes Gemurmel. Lukas unterdrückte einen Fluch und richtete sich auf. Sylvia hatte sich inzwischen zwei Schritte von der Menschenmenge entfernt und warf ihm eine Kusshand zu.
»Ich hab’s die ganze Zeit gewusst!« Der Sachse griff nach den Geldscheinen, trat den Karton zur Seite und packte Lukas am Kragen. »Auf so einen Penner wie dich habe ich gerade gewartet! Mein Freund und ich arbeiten nämlich bei der Security.«
»Niemand nennt mich einen Penner.« Lukas, der seine Überraschung endlich überwand, stieß den Sachsen zurück, was diesen noch mehr verärgerte.
»Ach? Nicht?« Sein Gegenüber langte ihm kurzerhand eine und lachte, als Lukas zu Boden stürzte und sich wütend die Wange rieb. Zwei der Umstehenden zückten nun ihre Handys, um die Polizei zu verständigen. Mist. Dieser Freitag entwickelte sich genau so, wie er befürchtet hatte.
»Und die hier siehst du ebenfalls nicht wieder.« Der verdammte Hilfssheriff beugte sich zu ihm herab und präsentierte Lukas verstohlen die insgesamt einhundert Euro des Wetteinsatzes. »Die Scheinchen werde ich jetzt einstecken«, flüsterte er gehässig. »Und wenn die Polizei fragt, wo der Zaster geblieben ist, werde ich behaupten, dass du sie einem deiner arbeitslosen Pennerfreunde zugesteckt hast.«
Lukas schwollen vor Wut die Adern an den Schläfen an. Wie immer, wenn er sich herausgefordert fühlte, wurde ihm alles andere egal. »Macht nichts«, zischte er ebenso leise zurück. »Ich hab ja die hier!« Ebenso unmerklich präsentierte er dem Sachsen dessen prall gefüllte Geldbörse. Er hatte sie ihm längst aus der Jacke gezogen.
Das Grinsen auf dem Gesicht des Mannes erlosch.
Zornig rammte Lukas seinen Kopf nach vorn und glaubte ein leises Knacken zu hören, als die Nase seines Peinigers brach. Winselnd vor Schmerz kippte der Sachse hintenüber. Lukas war schneller auf den Beinen als je zuvor in seinem Leben. Dann rannte er.
»Horst, schnapp dir das verdammte Arschloch!«, hörte er den am Boden Liegenden brüllen. Doch da hatte Lukas bereits zwei Passanten beiseitegeschubst, stürmte die kopfsteingepflasterte Gasse hinunter und hetzte kurz darauf an der samtroten Fassade des berühmten Gasthauses vorbei, in dem sein Namensvetter sich vor einigen Jahrhunderten in die Luft gesprengt hatte. Einladend stand die Tür offen, doch Lukas rannte, als sei der Teufel hinter ihm her. In seinem Rücken erklangen aufgebrachte Schreie. Als er zurücksah, erkannte er zu seinem Leidwesen, dass der andere Sachse trotz seiner Leibesfülle die Verfolgung aufnahm. Der Kerl war schneller, als er ihm zugetraut hatte. Lukas stürmte auf den Marktplatz mit dem historischen Rathaus, das sich mit seiner bläulich weiß schimmernden Fassade und den bunten Wappen deutlich vor dem nunmehr schwarzen Himmel abzeichnete. Ein kühler Wind kam auf, und aus irgendeinem Grund fiel sein Blick auf die Zeiger der Rathausuhr – kurz nach 13 Uhr. Ein Schwarm Krähen stob krächzend vom Giebel auf. Lukas ignorierte den gespenstischen Anblick, rannte am Marktplatzbrunnen vorbei und warf im Laufen das Fahrrad eines erschrockenen Jugendlichen um, während im Hintergrund die obligatorischen »Haltet-den-Dieb-Rufe« ertönten. Ein weiterer Blick zurück offenbarte, dass auch der Bestohlene mit blutender Nase hinter ihm herstolperte und dessen Freund zügig aufholte. Verdammter Mist!
Lukas schlug einen Haken und sprintete am ehemaligen Kornhaus vorbei in eine wenig bevölkerte Gasse, die von Cafés, Weinstuben und kleinen Geschäften flankiert wurde. Zwei Japaner vor einem Schaufenster machten ihm hastig Platz. Schließlich erreichte er eine Kreuzung, wich einem weinroten Kombi aus, dessen Fahrer wütend hupte, und suchte verzweifelt nach einer Möglichkeit, seine Verfolger abzuschütteln – als er Sylvia ein weiteres Mal entdeckte. Sie trat etwa zwanzig Meter vor ihm auf die Straße und lächelte. Wie hatte sie ihn so schnell überholen können? Vollkommen ruhig stand sie da, und fast schien es ihm, als erwarte sie ihn. Ihr langes schwarzes Haar, das der Wind anhob, wirkte im Zwielicht unwirklich. Wie fließende Schatten, die ihre weiblichen Konturen provozierend umschmeichelten. Über ihm am Himmel grollte es. Gelassen zog sie sich wieder zurück, während hinter Lukas die Stiefelschritte der Sachsen aufhallten. »Gleich haben wir dich, du Wanze!«
Lukas stürmte weiter in die Richtung, in die Sylvia verschwunden war. Er gelangte auf einen gepflasterten, von Bäumen gesäumten Platz, der von zweistöckigen, mittelalterlich anmutenden Wohnhäusern gerahmt wurde. Sylvia sah er nicht unter den herbstlaubfarbenen Dächern der ausladenden Baumkronen, aber in diesem Moment schlug sein Smartphone an. Als Lukas zu den Bäumen hinüberrannte, sich hektisch zu den immer näher kommenden Schritten in seinem Rücken umwandte und das Handy zückte, leuchtete ihm auf dem Display Sylvias Name entgegen.
»Scheiße, hilf mir!«, fauchte er sie an.
»Du klingst ja richtig verzweifelt«, schallte ihm Sylvias spöttische Stimme entgegen.
Lukas fluchte leise. Panisch sah er sich um und entdeckte, dass er in einer Art Sackgasse gelandet war. Von hier aus ging es nicht weiter.
»Aber ich will mal nicht so sein«, erklärte ihm Sylvia derweil in nonchalantem Plauderton. »Sieh dich um. Ich habe etwas für dich zurückgelassen. Wenn du es gefunden hast, warte bis zum Glockenschlag und lauf dann zur nächstbesten Tür. Und Lukas«, ihre Stimme wurde schärfer, »besser, du befolgst meine Anweisungen.«
Es klickte, und er sah sich verwirrt um. Da entdeckte er die Karten. Sie lagen unter einem der Bäume; der auffrischende Wind trieb sie zunehmend auseinander und über das Pflaster. Ein Tarot-Spiel? Ratlos betrachtete er die antiquiert wirkenden Karten und kämpfte den Impuls nieder, zurück auf die Straße zu laufen, um dort sein Glück zu versuchen. Die beiden Sachsen kamen immer näher! Schließlich siegte die Neugier. Rasch hob er eine der Karten auf und sah, dass sie allesamt das gleiche Motiv trugen: eine Frau in schwarzem, sündhaft geschlitztem Gewand, das Haupt von verwelkten Blumen gekrönt. Die Ähnlichkeit mit Sylvia war unverkennbar. Lasziv hielt sie das Maul eines Löwen gepackt, der demütig zu ihr aufblickte. Ohne Zweifel war dies die elfte Karte des Tarots, auch wenn die Abbildung seltsam verfälscht wirkte. Soweit Lukas wusste, stand das Motiv für Kraft. Wollte ihn Sylvia verarschen? Und was sollte das mit den Glocken? Er blickte auf seine Uhr. Kein Kirchturm der Welt läutete um dreizehn Uhr … dreizehn.
In diesem Moment ertönte über den Dächern Staufens der erste Glockenschlag. Der Klang drang verzerrt an seine Ohren, ein weiterer Glockenschlag folgte. Auch dieser war unheimlich. Einige Oktaven zu tief, wie Lukas fand. Und was war das? Die eigentümliche Tarot-Karte in seiner Hand verfärbte sich an den Rändern schwarz. In diesem Moment tauchte der beleibte Sachse hinter der Hausecke auf. Der dritte Glockenschlag ertönte. Dann der vierte. Die Töne folgten im Sekundentakt, jeder von ihnen tiefer als der vorhergehende. Wie ein bedrohlicher Countdown.
Sein Verfolger schien nichts von alledem zu bemerken, hielt triumphierend inne und rannte mit geballten Fäusten auf ihn zu.
Weitere Glockenschläge rollten an Lukas’ Ohren und mischten sich mit dem Grollen am Himmel zu einem unheimlichen Klangbild. Die Karte in seiner Hand wirkte inzwischen wie verkohlt. Lukas warf sich herum, hetzte tiefer in die Schatten der Bäume. Wohin, verdammt? Er wollte soeben in einen der Vorgärten springen, als er Finger an seiner Jacke spürte. Lukas schüttelte die Hand ab, tauchte unter einem Schwinger des Dicken hindurch, rannte an ihm vorbei zurück in Richtung Straße – und direkt in die Arme des anderen Sachsen, der soeben um die Häuserecke gespurtet kam. Noch immer quoll ihm das Blut aus der Nase. Aus seinem Blick sprach blanker Hass.
Das unheimliche Geläut wurde immer tiefer und beängstigender. Ohne mitgezählt zu haben, wusste Lukas, dass sie inzwischen zum zehnten Mal geschlagen hatten. Seine Verfolger brüllten. Abrupt wechselte Lukas die Richtung, und obwohl ihm Sylvias Anweisung vollkommen irrwitzig vorkam, stürmte er auf eine der Wohnungstüren zu. Er erreichte sie mit dem dreizehnten Glockenschlag, riss sie auf – und stolperte kopfüber in die Finsternis.
Höllenzwang
Lukas war so übel wie nach einer durchzechten Nacht. Ein Kribbeln erfüllte seine Gliedmaßen, in seinen Ohren rauschte das Blut, und der schwache Geruch warmen Essens drang ihm in die Nase. Essen? Der Geruch drehte ihm den Magen nur noch mehr um. Schwankend hielt er sich aufrecht und taxierte seine Umgebung: ein großer Raum mit dunkler Wandtäfelung, die sich in Form eines Schachbrettmusters bis über die niedrige Raumdecke spannte. Unmittelbar unter der Decke prangten mittelalterlich anmutende Bemalungen, und überall im Raum verteilt standen gedeckte Tische. Die Flecken auf den Tischtüchern verrieten ihm, dass hier vor kurzem Personen gespeist hatten. Was war das hier? Ein Restaurant?
Konsterniert spähte er hinter sich, hielt nach der aufgerissenen Haustür und den beiden Sachsen Ausschau – und fand nichts von beidem. Lukas klammerte sich an einem Stuhl mit herzförmiger Holzlehne fest. Er war so durcheinander, dass er eine Weile brauchte, bis er sich traute, sich abermals zu regen. Erstmals fiel sein Blick auf die schlanken Saalfenster. Dahinter war es so dunkel, als wäre die Sonne längst untergegangen. Verdammt, wo war er?
Lukas hob die Armbanduhr. Dem Ziffernblatt zufolge war es eine halbe Stunde vor Mitternacht. Hektisch kramte er sein Smartphone hervor und überprüfte die Uhrzeit. Das gleiche Resultat. Die Datumsanzeige zeigte noch immer Freitag an, doch er hatte nicht den blassesten Schimmer, was in den vergangen elf Stunden passiert war. Er ließ sich auf den Stuhl sinken und zwang sich, ruhig zu atmen. Hier stimmte etwas nicht. Und zwar ganz und gar nicht. Seine Gedanken überschlugen sich, kreisten um Fragen, auf die er keine Antwort fand, und die Angst trieb ihm den Schweiß aus den Poren. Er kam erst wieder zur Besinnung, als er Schritte vernahm. Eine junge, adrett gekleidete Frau mit rotem Rock und weißer Bluse betrat den Speisesaal mit einem Stapel frischer Tischdecken unter dem Arm und sah ihn überrascht an. »Es tut mir leid, aber die Küche hat bereits geschlossen. Wenn Sie Hunger haben, schaue ich gern, ob ich Ihnen noch etwas aufs Zimmer bringen kann.«
»Nein, äh, danke.« Lukas erhob sich steif und versuchte sich an einem Lächeln. Es zerfaserte. Also war das hier ein Hotel. Nur welches? Er würde sich zum Narren machen, wenn er die Frau fragte. Vorsichtshalber betastete er seine Jacke und spürte noch immer die Ausbeulung des gestohlenen Portemonnaies. Hastig verließ er den Essraum und überprüfte den Inhalt der Börse. Er fand neben zahlreichen Plastikkarten und zerknüllten Einkaufszetteln fast fünfhundert Euro. Der arrogante Sachse hatte vor ihrem Zusammentreffen offenbar einen Geldautomaten geplündert. Das war gut, beantwortete aber nicht die drängendste Frage: Was sollte er jetzt tun?
Lukas lauschte. Als ihm aus einem der Gänge das Geräusch leiser Stimmen entgegendrang, folgte er diesem einen Gang mit abzweigenden Türen und Treppen entlang und geradewegs zur Hotelrezeption. In dem schmalen Bereich mit rot gestrichenem Tresen und dunkler Wandtäfelung reichte eine schlanke Mittdreißigerin soeben einem Gast seinen Zimmerschlüssel. Der Mann bedankte sich, klappte den Griff eines Rollkoffers aus und nickte grüßend, als er an Lukas vorbeiging. Lukas hingegen beachtete die freundliche Geste kaum. Erstaunt starrte er auf einen Rucksack, der unweit des Tresens auf dem Boden stand. Das war sein eigener, unverkennbar durch die Aufnäher diverser Jonglage- und Zauberer-Festivals, die er eine Zeitlang gesammelt hatte wie Heavy-Metal-Anhänger Festival-Badges. Unmöglich! Den hatte er doch am Bahnhof in ein Schließfach gesperrt.
Die Rezeptionistin sah zu ihm auf, runzelte die Stirn, bemerkte dann aber den Blick, mit dem er den Rucksack ansah. »Ist das Ihrer?«
Lukas nickte bloß.
»Sehr schön. Ihre Freundin sagte mir bereits, dass Sie später kommen würden. Wie Sie sehen, hat der Taxifahrer Ihr Gepäck bereits gebracht.«
Sprach die Frau von Sylvia? Lukas’ Verwirrung wich aufkeimendem Ärger. Aufgewühlt kramte er in den Taschen seiner Jacke nach dem Schließfachschlüssel. Er fand ihn neben Trickwürfeln, einem Kartenspiel und alten Einkaufszetteln. Wenn er ihn noch hatte, wie war dann dieser Taxifahrer an sein Gepäck gelangt? Die Rätsel nahmen kein Ende.
Die Dame an der Rezeption tippte etwas in ihren Computer und lächelte. »Ah, da habe ich Sie ja. Lukas Faust, richtig? Wie witzig. Es kommt nur selten vor, dass ein Faust unser historisches Faustzimmer bucht. Nicht, dass Sie sich da oben vom Teufel holen lassen.« Sie zwinkerte ihm freundlich zu und reichte ihm den Anmeldebogen. »Wenn Sie das bitte noch ausfüllen würden.«
Lukas machte gute Miene zum bösen Spiel. Natürlich könnte er jetzt sein Gepäck nehmen und draußen in der Nacht sein Glück versuchen. Nur befürchtete er, dass er dann keine Antworten auf seine Fragen bekommen würde. Und von denen hatte er inzwischen einige. Rasch erledigte er die Formalitäten und sah so erstmals, wo er gelandet war: im Gasthaus zum Löwen. Zufall?
Lukas runzelte die Stirn, während er sich in das Faustzimmer einschrieb, in dem sein berüchtigter Namensvetter angeblich einst zu Tode gekommen war. Es war separat gelistet, etwas teurer als die anderen, und Lukas fragte sich unwillkürlich, ob die ganze Schauergeschichte rund um diesen Raum mehr war als der Clou einer gewieften Marketing-Abteilung. Er setzte seine Unterschrift unter das Anmeldeformular und sah wieder zu der Rezeptionistin auf. »Und meine, ähm, Freundin ist schon oben?«
Die Dame warf einen Blick aufs Schlüsselbord. »Ja, sie hat den Schlüssel bereits abgeholt. Es ist das Zimmer Nummer fünf. Einfach dort entlang und die Treppe nach oben.« Sie beugte sich über den Tresen und wies ihm den Weg.
Lukas nahm den Rucksack auf und folgte dem Fingerzeig. Zu seinem Erstaunen stieß er auf halbem Weg nach oben auf eine gusseiserne Tür- und Gitterkonstruktion, die ihn vermutlich gedanklich auf das sechzehnte Jahrhundert einstimmen sollte. Hübsch, aber auch gruselig. Abermals versuchte er sich daran zu erinnern, auf welche Weise er in das Hotel gelangt war. Doch die vergangenen Stunden waren wie weggewischt. Was blieb, war eine tiefe Verunsicherung. Und die behagte ihm erst recht nicht.
Die Nummer fünf war leicht zu finden, denn auf der schwarz gestrichenen Zimmertür prangte in gotischer Schrift Dr. Faust. Die Tür war nur angelehnt; aus dem Inneren erklang das Rauschen einer Dusche. Misstrauisch trat er ein und sah sich in dem schummrigen Raum um. Das Faustzimmer war nicht allzu groß, doch die Betreiber des Löwen hatten sich einiges einfallen lassen, um den Gast stimmungsvoll in die Zeit der Renaissance zurückzuversetzen. Das Fenster zum Innenhof war mit bunten Motiven der Faustsaga geschmückt, die Ecke daneben mit ihrem achteckigen Tisch und den blutrot gepolsterten Stühlen wie ein Alkoven gestaltet. Die angrenzende verglaste und stimmungsvoll beleuchtete Wandnische war mit alchimistischen Gerätschaften gefüllt. Den eigentlichen Blickfang bildete jedoch das breite, von einem dunklen, hölzernen Baldachin überdachte Himmelbett. Die Nachttischlampe beleuchtete die zur Zimmertür weisende Holzfläche, auf der reliefartig das Konterfei eines gelockten Mannes mit Bart und Umhang prangte. Der geschnitzte Schriftzug darunter stellte unmissverständlich klar, dass es sich bei der Abbildung um den Zauberer und Alchimisten Doktor Faust handelte. Netter Marketinggag. Lukas zweifelte daran, dass er tatsächlich so ausgesehen hatte. Ebenso wie er daran zweifelte, dass es sich bei dem Interieur im Raum um die echte Möblierung aus der damaligen Zeit handelte. Und doch strahlte das Zimmer etwas aus, das sich schwer in Worte fassen ließ. Nichts Greifbares. Es war eher wie ein Hauch, der seine Sinne streifte. Unwirklich. Unheimlich. Lukas schloss die Tür, deren Schloss gleichfalls in altertümlichem Schmiedestil gehalten war, schüttelte sich und wandte sich verärgert der Badtür zu. »Ich hoffe, du hast mitbekommen, dass ich da bin!«
Die Dusche wurde abgestellt.
Lukas stellte seinen Rucksack neben den offenen Kleiderschrank, der an einen mittelalterlichen Stadtturm gemahnte, und griff gereizt nach einer Karte, die auf dem Nachttisch stand. Sie informierte den Gast über die Geschichte des Hotels. In ihr befand sich auch jene denkwürdige Inschrift, die er bereits am Vormittag auf der Außenfassade des Gebäudes erblickt hatte:
Anno 1539 ist im Leuen zu Staufen Doctor Faustus
so ein wunderbarlicher Nigromanta gewesen,
elendiglich gestorben, und es geht die Sage,
der obersten Teufel einer, der Mephistopheles,
den er in seinen Lebzeiten lang nur seinen Schwager genannt,
habe ihm, nachdem der Pakt von 24 Jahren abgelaufen,
das Genick abgebrochen
und seine arme Seele der ewigen Verdammnis überantwortet.
»Willkommen«, begrüßte ihn eine rauchige Stimme.
Lukas ließ die Karte sinken und blickte zum Bad. Wasserdampf umhüllte Sylvias fraulichen Körper. Das Handtuch, das sie sich um Hüfte und Oberkörper geschlungen hatte, enthüllte mehr, als es verbarg. Lasziv griff sie zu ihrem nassen Haar, um es mit einem zweiten Tuch zu trocknen. Lukas wollte etwas sagen, seinem Ärger Luft machen. Stattdessen starrte er auf ihre Brustwarzen, die sich überdeutlich unter dem Badelaken abzeichneten. Hastig wandte er den Blick ab, doch es war zu spät. Sylvia hatte es gesehen. Sie lächelte spöttisch. Mit wiegendem Hüftschwung trat sie ans Bett. »Na, gefällt dir, was du siehst?« Provozierend langsam knöpfte sie das Badelaken auf und ließ es fallen. Lukas zwang sich dazu, woanders hinzusehen, doch Sylvias perfekt gebräunter Körper, ihre wie modelliert wirkenden Brüste und auch die übrigen Rundungen, an denen jedes Gramm Körpergewicht genau da saß, wo es hingehörte, machten es ihm nicht leicht. Sylvia trocknete ihr Haar weiter und strich sich mit der Zunge leicht über die Lippen. In diesem Augenblick wirkte sie auf Lukas anders als noch in Berlin. Nicht weniger verführerisch, aber eine Spur ordinärer.
»Was tust du hier?«, wollte er wissen. »Und vor allem: Was mache ich hier?«
»Süßer, du bist genau da, wo du sein sollst. Nur musste ich die Sache zum Schluss hin etwas forcieren.« Herablassend sah sie ihn an.
Lukas ärgerte der Blick, dennoch glitt der seine wieder hinab zu ihren Brüsten. Er musste sich regelrecht zwingen, ihr in die Augen zu schauen. »Das ist keine Antwort.«
Sylvia lachte. »Denkst du, ich habe mich deiner in Berlin ohne Grund angenommen?«
»Was soll das heißen? Ich habe dich dabei erwischt, wie du mir mein Geld klauen wolltest.«
»Oha, ich bin ja wirklich ein böses Mädchen.« Sylvia kam langsam auf ihn zu. »Aber wie wir beide wissen, bist du mir ebenfalls an die Wäsche gegangen – und das weitaus öfter.« Sie grinste. »Gib’s zu: du hast viel von mir gelernt. Nicht nur im Bett. Wie viel war denn in der Brieftasche dieses Touristen?«
Lukas wich vor ihr zurück und stieß gegen die Bettkante. »Noch mal, was soll das alles? Und was ist in den letzten Stunden passiert? Ich erinnere mich an nichts mehr. Stand ich unter Drogen?«
Sylvia stieß ihn vor die Brust, er landete rücklings auf dem Bett – und kapitulierte. Was auch immer er ihr noch an den Kopf hatte werfen wollen, im Augenblick sah er sich dazu außerstande. Wie ein Raubtier stieg sie mit ihrem nackten Körper über ihn und rieb ihre Brüste an seinem Oberkörper. Warum musste sie auch so verdammt gut riechen?
»Was«, flüsterte sie, »wenn ich dir sage, dass du in all der Zeit recht hattest?«
»Womit recht hatte?«, keuchte er.
»Dass die Wirklichkeit nur eine Illusion ist. Dass die Welt vollkommen anders ist, als du glaubst.« Lukas liefen wohlige Schauer über den Körper, denn Sylvia knabberte an seinen Ohrläppchen. Ihr heißer Atem erregte ihn. »Es hat seinen Grund, dass ich dich nach Staufen geführt habe. In diesem Monat. Hierher. In dieses Zimmer.«
Lukas stöhnte vor Lust. »Wenn du unbedingt nach Staufen wolltest, hättest du mich verdammt noch mal auch einfach bitten können, mitzukommen.«
»Zur Hölle damit. Wie langweilig.« Sylvia richtete sich auf und lachte vulgär. Dabei achtete sie darauf, dass ihre Brüste keine Handbreit über seinem Gesicht hingen. »Das hätte keinen Spaß gemacht. Außerdem wollte ich wissen, ob du von selbst begreifst, was in dir steckt.« Sie beugte sich über ihn und leckte abermals an seiner Ohrmuschel. »Ich kann dein Blut riechen. Deinen Stolz. Deine Selbstgerechtigkeit. Deinen Egoismus.« Lukas wurde unbehaglich zumute, doch sie sprach weiter. »Alles, was dich daran hindert, der zu werden, der du sein könntest, bist du selbst. Glaube mir, das ist ein Kompliment, das ich nicht jedem mache.«
Unvermittelt spürte Lukas einen stechenden Schmerz am Ohr, denn Sylvia hatte zugebissen. »Hast du sie noch alle?« Wütend stieß er sie von sich und betastete sein schmerzendes Ohr. Es blutete. »Drehst du jetzt völlig durch?«
Mit einem angriffslustigen Fauchen warf sich Sylvia erneut auf ihn, erstickte seine Abwehrversuche mit katzenhafter Gewandtheit, schleuderte ihn auf den Bauch und drehte ihm den Arm schmerzhaft auf den Rücken. »Du glaubst nicht, wie gern ich dich jetzt zureiten würde.« Lukas spürte angewidert, wie sie ihm das Blut vom Ohr leckte. »Nur haben wir dafür keine Zeit.«
»Was zum Teufel ist mir dir los?«, ächzte er. Erfolglos versuchte er weiterhin, sich zu befreien.
»Glaubst du wirklich, dass das, was dir heute widerfahren ist, mit rechten Dingen zuging? Was, wenn ich dir sage, dass du in dreizehnter Generation von ebenjenem Faust abstammst, der einst in diesem Zimmer gestorben ist? Was, wenn ich dir sage, dass er es war, der mich geschickt hat? Dass er will, dass du dein Erbe antrittst?«
»Ein Toter soll dich geschickt haben?« Lukas lachte hilflos. »Ich dachte, die Seele dieses Kerls schmort in der Hölle?«
»Ja, er sitzt in der Hölle – aber nicht mehr lange!« Sylvia verstärkte ihren Griff, und Lukas schrie schmerzerfüllt auf. »Verdammte Scheiße, lass mich los!«
»Armer Lukas. Fühlst du dich benutzt?« Sylvia rieb ihre Brüste auf obszöne Weise an seinem Rücken. Ihre Stimme klang kalt. »Noch drei Minuten bis Mitternacht. Wenn ich es dir befehle, wirst du hier in diesem Zimmer dein Erbe einfordern. Hast du mich verstanden?« Sie packte sein Haar und riss seinen Kopf hoch. »Es muss heute geschehen. Und falls du dich weigerst, werde ich dir jeden Knochen in deinem Leib einzeln brechen.«