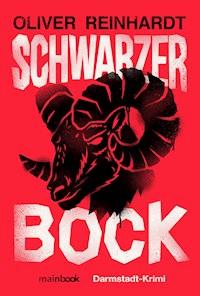
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mainbook Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In Darmstadt hält eine menschenverachtende Mafia die Schwächsten der Schwachen aus Flüchtlingsfamilien in einem finsteren, elenden Loch gefangen und zwingt deren Angehörige, betteln zu gehen, um sie dann abzukassieren. Der Darmstädter Fernsehreporter Tim Groning kommt den Machenschaften auf die Spur. Zusammen mit Kollegen des TV-Senders Tele-Süd versucht er in einer halsbrecherischen Aktion zu retten, was kaum noch zu retten scheint. Dies sind die Zutaten eines fesselnden Krimis, der auch die Rolle der Fernseh-Berichterstattung und ihre Bedeutung in unserer Gesellschaft beleuchtet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oliver Reinhardt
Schwarzer Bock
Kriminalroman
ISBN 978-3-946413-59-2
Copyright © 2017 mainbook VerlagAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Gerd FischerCovergestaltung und Bildrechte: Lukas Hüttner
Auf der Verlagshomepage finden Sie weitere spannende Bücher:www.mainbook.de
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Buch
Als der TV-Reporter Tim Groning mit seinem Kamerateam wegen Hakenkreuzschmierereien an einer Weiterstädter Moschee dreht, entdeckt er in einem Gartenschuppen ein fast nacktes, kleines Mädchen. Am selben Tag wird er von einem Mann, der vorgibt, taubstumm zu sein, um Geld angebettelt. Groning entlarvt die Masche. Der Betrüger springt in ein Auto und flüchtet.
Der Reporter fotografiert das Fahrzeug und beginnt zu recherchieren. Auf den Bildern vom Wagen des Betrügers ist hinter der Heckscheibe ein Logo zu erkennen, das ihn an ein Tier mit Hörnern erinnert, eine Art schwarzer Bock. Es ist das Logo von ›Hessen hat Herz‹, einem Darmstädter Sozialhilfeverein. Bald stellt sich heraus, dass es zwischen diesem Mann und dem Verein eine Verbindung gibt. Groning folgt dieser Spur, die ihn bis zu einer Wohnung in einem heruntergekommenen Hochhaus in einem ghettoähnlichen Stadtteil Darmstadts führt.
Der eigentliche Albtraum jedoch wartet an einem anderen Ort – doch auch diese Fährte nimmt Groning bald auf und blickt in einen Abgrund, der tiefer ist, als er sich vorzustellen vermochte …
Autor
Oliver Reinhardt wurde 1969 in Hamburg geboren und verbrachte seine Kindheit in der Hansestadt. 1984 übersiedelte er mit seiner Familie nach Darmstadt und lebt heute in Pfungstadt.
Nach Studium und Volontariat arbeitete er jahrelang im Rhein-Main-Gebiet als freier Fernsehjournalist. „Schwarzer Bock“ ist der Start einer Krimi-Reihe um den Darmstädter TV-Reporter Tim Groning.
Für Dirk
1
In dem großen, dunklen Raum gab es keine Fenster. Es roch nach Schimmel. Urin. Kot. Angst. Manchmal hörte man ein leises Wimmern. Hier gab es keine Zeit. Seelenschmerz und Trauer hingen wie Spinnweben an den kalten Wänden. Wo noch Hoffnung war, kämpfte sie gegen die Verzweiflung der Menschen, die hier zu überleben versuchten.
Der kleine Junge hatte Angst vor dieser Dunkelheit. Er ekelte sich vor dem modrigen Geruch in diesem Loch. Aber mehr noch als Furcht und Ekel hatte er Hunger. Vorsichtig lugte er unter der klammen, kratzigen Wolldecke hervor, die ihm als einziger Schutz vor der Kälte diente. Im dem Kellergewölbe standen Holzpritschen, etwa zwanzig wackelige Gestelle, die das Wort Bett nicht verdienten. Auf jedem dieser Gestelle lag ein Mensch. Von der Pritsche neben sich hörte der Junge ein leises Geräusch. Dort lag Ava. Sie war sechs Jahre alt und hatte lange, blonde Haare und blaue Augen. Er mochte Ava. Mit ihren langen vorderen Zähnen sah sie ein wenig aus wie ein Kaninchen. Er mochte Kaninchen. Zu Hause hatte er zwei Widder, mit langen Schlappohren und zotteligem Fell. Der Junge hatte sich immer gut um die beiden gekümmert. Bis zu diesem Tag, dessen Bilder sich wie ein finsteres Karussell unaufhörlich in seinem Kopf drehten.
Es war an einem sonnigen, warmen Nachmittag passiert. Die Tür seines Kinderzimmers flog mit einem lauten Knall auf. Seine Mutter wurde hineingedrängt von zwei großen, kräftigen Männern, die er noch nie zuvor gesehen hatte. »Bitte, nicht, lassen Sie mir meinen Jungen, ich tue alles, aber der Junge kann nichts dafür, bitte!« Ihre Stimme überschlug sich, die Augen waren weit aufgerissen. So hatte er seine Mutter noch nie gesehen. Er begriff nicht, was geschah.
»Halts Maul!«, schrie einer der beiden Fremden und hielt die Frau an den Armen fest. Der zweite Mann trat gegen den Kaninchenkäfig, den der Junge gerade reinigen wollte. Die Plastikschale zerbrach, das Metallgitter flog an die Wand und Sägemehl verteilte sich auf dem Teppichboden. Die zwei Widderkaninchen flohen in Panik unter das Bett des Jungen. Er spürte, dass sich in diesem Moment etwas in seinem Leben veränderte. Und dass es nicht gut war. Angst überflutete ihn. »Wir machen das, was Sie verlangen«, hörte der Junge seinen Vater aus dem Flur vor dem Kinderzimmer flehen, »den Jungen brauchen Sie nicht, wir tun das, ich verspreche es!«
Der Junge sah ihn. Er war kreidebleich, seine Augen traten aus den Höhlen hervor und er hatte beide Hände flach an die Schläfen gelegt. Einer der Unbekannten griff nach dem Jungen, verfehlte jedoch seinen Arm. Wütend spie er einen Fluch aus, den der Junge nicht verstand. Beim zweiten Versuch packte er das Kind im Genick. Die Mutter heulte laut auf. Eine riesige Hand presste ein übelriechendes Tuch auf sein Gesicht. Die Sinne des Jungen schwanden. Er konnte kaum noch atmen. Die Schreie seiner Mutter wurden immer leiser. Zuletzt spürte er noch, wie er sich in die Hosen machte. Dann verlor er das Bewusstsein.
Als er wieder aufwachte, tupfte ihm ein alter, hagerer Mann mit einem nassen Taschentuch die Stirn ab. Er hatte einen stoppeligen Bart, fettige Haare und roch nach Urin. Doch seine Augen waren freundlich und der Junge spürte, dass dieser Fremde nicht böse war.
»Was ist passiert?«, fragte das Kind.
»Du bist vor ein paar Stunden gebracht worden. Keine Sorge, wir kümmern uns um dich«, sagte der Mann mit leiser Stimme. Nun sah der Junge, dass im Halbdunkel des kalten Raumes weitere Erwachsene und ein paar Kinder standen, die ihn neugierig musterten. Sein Blick richtete sich auf eine Frau mittleren Alters, die ein wenig aussah wie seine Mutter.
»Wo bin ich?«, fragte er.
»Wir wissen es nicht«, antwortete die Frau. »Wir sind hergekommen wie du, wir waren alle weggetreten.«
Der Junge setzte sich auf. »Warum bin ich hier?« Wieder stieg die Angst in ihm auf. Die Umstehenden blickten sich an. Schweigend. Unheilvoll. »Warum ist es so dunkel?«
»Wir haben nur eine Taschenlampe«, erklärte der alte, hagere Mann. »Sie haben sie nicht gefunden. Aber die Batterien sind schon schwach.«
»Du musst durstig sein. Hier!« Ein blondes Mädchen, etwa in seinem Alter, reichte ihm eine Wasserflasche. Er nahm die Flasche, trank aber nicht.
»Was ist hier los? Wo sind meine Eltern?« Seine Stimme bebte.
Niemand antwortete. Einige der Erwachsenen drehten sich mit gesenktem Blick um und verließen den Kreis, der sich um den Jungen gebildet hatte. Ein anderer Mann, der ihm weitaus weniger freundlich erschien, nahm ihm die Wasserflasche wieder ab. »Bevor sie umkippt, halte ich sie. Wir müssen sparsam sein mit dem Wasser«, sagte er. Der kleine Junge war völlig durcheinander. Konnte es sein, dass er träumte? Ein zweites Gefühl kam zu der Angst hinzu, die seinen Brustkorb zusammendrückte. Es war eine überwältigende Einsamkeit. Tränen schossen ihm in die Augen und liefen seine Wangen herunter. Als er dachte, er müsse sich vor innerem Schmerz zusammenkrampfen, fühlte er, wie sich eine Hand auf seine legte. Er sah auf. Es war das blonde Mädchen. »Ich weiß«, sagte sie. »Es ist schlimm. Ich bin Ava.« Seine Stimme versagte fast, als er antwortete. »Ich bin Navid.«
Er konnte nicht sagen, wie lange diese erste Begegnung mit Ava her war, es kam ihm aber wie eine Ewigkeit vor. Die beiden hatten sich schnell angefreundet. Sie gaben sich gegenseitig Halt und Wärme. Es entstand eine besondere Verbindung, die ein erwachsener Beobachter Seelenverwandtschaft hätte nennen können. Der Junge nannte es ›Schön-Gefühl‹. Manchmal ging es ihm so schlecht, dass er sich wünschte, er wäre nicht mehr da. Ava schien das zu spüren. Sie setzte sich ganz dicht neben ihn und sah in seine Augen. Dann begann in dem dunklen Schlimmen, das in den Tagen der Gefangenschaft in seinen Brustkorb gekrochen war, etwas zu leuchten. Etwas Schönes.
Nun lag Navid auf seiner Holzpritsche und hätte gerne mit Ava geredet. Er dachte an seine Eltern. Was war nur passiert? Wurde er bestraft? Aber wofür? Es waren immer dieselben Fragen, die ihn quälten.
Sein Mund war trocken. Er tastete auf dem Boden nach einer Wasserflasche. Dieses Zeug schmeckte wirklich widerlich, dachte er und nahm nur einen kleinen Schluck. Wenige Minuten später war er eingeschlafen.
2
»Verdammtes Blut!«, sagte Grau.
»Zieh dir doch Handschuhe an, du Anfänger!«, erwiderte Grün höhnisch.
»Nein, danke! Ich hasse diese Plastikdinger, da schwitzt man drin«, gab Grau zurück und riss ein paar Blätter Küchenpapier von einer Rolle ab. Angestrengt versuchte er, seine Hände zu reinigen.
»So wird das nie was. Du brauchst kaltes Wasser«, warf Gelb ein.
»Das weiß ich auch, du Dummschwätzer! Wer hat uns denn diese Scheiß-Hütte ohne fließendes Wasser besorgt, hä?«, bellte Grau in Gelbs Richtung.
»Reg dich ab, es läuft doch alles blendend. Bis auf dein kleines Hygieneproblem«, sagte Gelb und kicherte.
»Halt bloß die Schnauze, du Penner!«, schrie Grau. »Nichts läuft hier blendend. Wir haben Zehntausend die Woche gesagt. Und was ist? Nicht mal Sechstausend kommen rum, nicht mal armselige Sechstausend! Und ich darf hier die Drecksarbeit machen.«
»Entspann dich, Grau!« Rots tiefe Stimme erfüllte die schmierige Küche des abbruchreifen Fachwerkhauses. »Bald haben wir mehr als Zehn in der Woche. Verlass dich auf mich!«
»Ja, genau«, bellte Grau. »Wo habe ich das schon mal gehört? ›Verlass dich auf mich, Grau.‹ ›Ich weiß, was ich tue, Grau.‹ Dämliche Kacke. Wie willst du das anstellen, Rot? Erzähl doch mal? Noch mehr Familien? Die Bude hier platzt jetzt schon aus allen Nähten, und umziehen können wir sowieso nicht, oder?« Graus Stimme bekam einen sarkastischen Unterton.
Gerade als Rot dazu ansetzen wollte, Grau zu maßregeln, meldete sich Blau zu Wort. »Bevor wir uns noch die Köpfe einschlagen: Wir brauchen neues Valium. Und eine Flasche Sterillium.«
»Schon wieder neues Valium? Weißt du, wie schwer das zu bekommen ist?«, rief Grün verärgert.
»Mag sein«, antwortete Blau. »Aber willst du hier Tag und Nacht das Geschrei in der Bude haben? Ich nicht!«
»Ja, schon gut. Ich besorge alles heute Abend. Noch irgendwas?« Grün nahm einen kleinen Schreibblock und machte sich Notizen.
»Konserven und Wasser für mindestens zehn Tage«, sagte Gelb.
»Macht also hundert Dosen plus hundert Flaschen Wasser«, rechnete Grün. »Super. Das fällt ja gar nicht auf beim Aldi.«
»Dann geh eben zu drei verschiedenen, verdammt!«, sagte Rot und rang um Fassung.
»Es ist gleich Mittag. Hilft mir jemand bei der Fütterung?«, fragte Blau in die Runde.
Im Rahmen der Vorbereitungen waren auch die Aufgaben der Gruppenmitglieder genau festgelegt worden. Grau war für die Durchsetzung ihrer Interessen bei den ›Vertragspartnern‹ eingeteilt. Grün kümmerte sich um die Versorgung mit Lebensmitteln und Gebrauchsgütern. Gelb trug die Verantwortung für die Absicherung des ganzen Vorhabens eingeschlossen der Funktionsfähigkeit der Fahrzeuge und der Kommunikationstechnik. Blau war der ›Ameisenpfleger‹. Die Gruppe hatte sich zu Beginn der Planung auf Ameisen als Codewort für die Geiseln geeinigt. Rot koordinierte die Handlungen der Teamkollegen. Und er saß auf dem Koffer mit dem Geld, das die Gruppe zum Arbeiten brauchte.
»Ich sag es dir jetzt nochmal: Niemand außer dir hat Kontakt mit den Ameisen!«, schnauzte Rot. »Es geht hier um Risikominimierung. Wen die Ameisen nicht gesehen haben, den können sie nicht beschreiben. Du hast diese Aufgabe übernommen, halte dich an die Vorgaben!«
Blau seufzte und stand auf. »War ja nur ne Frage«, sagte er leise.
»Beantwortet!«, feixte Grün und steckte sich das Notizbuch in die Tasche seiner schwarzen Winterjacke.
Der ›Ameisenpfleger‹ begann sich umzuziehen. Zuerst zog er einen alten, stinkenden Parka an, der ihm drei Nummern zu groß war. Dann stopfte er sich kleine Stoffkissen in die Jacke. Besonders die Region um den Bauch unterfütterte er hingebungsvoll. Er legte eine schwarze Sturmhaube an und wickelte sich Paketklebeband um ihr unteres Ende, das eng an seinem Hals anlag. In seine Augen setzte er sich neongrüne Kontaktlinsen ein. Anschließend zog er sich grobe, dunkelblaue Strickhandschuhe über. Eine dreckige, blaue Jeans, ebenfalls viel zu groß für den eher schmächtigen Mann, vollendete die Tarnung. Die anderen Männer sahen ihm gelangweilt zu.
»Die Schuhe«, bemerkte Rot.
Blau nickte. Über seine nagelneuen Turnschuhe der Marke ›Nike‹ stülpte er zwei schwarze Plastiktüten und klebte sie an den Fußgelenken fest. Dann stand er vom Küchentisch auf und sah die anderen an. »Und?« So wollte er sicherstellen, dass er bei seiner Tarnung nichts vergessen hatte. Er war sich aber auch darüber im Klaren, dass diese Frage eine Steilvorlage für sarkastische Bemerkungen war.
»Wie eine Mischung aus Heino ohne Sonnenbrille und einem geplatzten Frosch«, überlegte Gelb.
Grün kicherte.
»Nee …«, bereitete Rot seinen Beitrag vor. »Wie ein Kassenpatient nach einem Facharzttermin.«
»Quatsch. Er sieht einfach aus wie ein Mensch, der in Deutschland arm ist«, stellte Grün fest.
»Und schon wissen wir wieder, warum wir das hier machen!«, sagte Grau und schlug mit der flachen Hand auf den Küchentisch.
»War ja klar, dass mir keiner hilft«, murmelte Blau und nahm zwei große, blaue Mülltüten mit schwerem Inhalt in die Hände.
»Grüß schön!«, rief ihm Rot hinterher, als Blau die Kellertür öffnete und die prall gefüllten Säcke hindurch wuchtete. »Du mich auch!«, bellte Blau zurück. »Wenn ich wieder da bin, steht hier was zu essen auf dem Tisch, dass das klar ist!«
»Ich habe zwei Wochen altes Schweinemett für dich mitgebracht, Zombie«, grinste Grün.
Nachdem sich die Tür hinter Blau wieder geschlossen hatte, blickten sich die restlichen vier Männer an. Es schien, als würden sie alle das gleiche denken. Sie sprachen nicht darüber. Doch es war, als ob dieser von einer düsteren Vorahnung genährte Gedanke in der Küche wie ein Nebel schwebte.
Kurz, bevor alles begann, hatten sich die Männer in einem China-Imbiss in Pfungstadt getroffen. Nach dem Essen erhielt jeder zu seiner Rechnung einen Glückskeks. Grün las seine chinesische MaschinenWeisheit vor: ›Das Wasser haftet nicht an den Bergen, die Rache nicht an einem großen Herzen‹. Niemand lachte.
3
9.30 Uhr. Tim Groning sah aus dem Panoramafenster des Konferenzraums im vierten Stock des TeleSüd-Gebäudes. So konnte er einen großen Teil der verschneiten Stadt überblicken, in der er viel Zeit verbracht hatte. Er mochte Darmstadt. Als er vor über zwanzig Jahren herkam, um für den kleinen Regionalsender als Fernsehreporter zu arbeiten, fand er den Namen der Stadt abstoßend. Die Stadt der Gedärme. Wer gab einer Stadt freiwillig einen solch unsympathischen Namen? Mittlerweile hatte er sich daran gewöhnt. Er kannte die Menschen, er kannte die Straßen. Die Eingeweide. Darmstadt war keine Großstadt. Darmstadt war ein Dorf, das groß sein wollte. Bodenständig und weltoffen, gemütlich und pulsierend, urhessisch und doch entwurzelt. Groning empfand oft Mitleid für diese Stadt, die einfach nicht zu sich selbst finden konnte.
An der Stelle begann sein Gehirn üblicherweise mit der Einspielung einschlägiger Bildsequenzen aus seiner Darmstädter Vergangenheit, unterlegt mit leiser melancholischer Musik und einer Sprecherstimme, die lustige, hessische Zoten in entsprechender Mundart vortrug. Doch diesmal wurde der Beginn der Darbietung von einer schnarrenden Männerstimme unterbrochen, die aus der mit wehmütiger Erinnerung gefüllten Seelenbadewanne einfach den Stöpsel zog.
»Guten Morgen, alle zusammen, und wieder einmal darf ich euch zur Morgenkonferenz begrüßen. Schön, dass die Meisten es geschafft haben, zumindest physisch anwesend zu sein.« Die Stimme gehörte Rudolf Schaik, dem Redaktionsleiter von TeleSüd. Groning musste bei dessen Anblick manchmal an Heinz Schenk denken. Er war ein Fan des großen Komödianten, der die Befindlichkeiten der Hessen auf einmalig augenzwinkernde Weise zu transportieren wusste. ›Willst du die Hessen verstehen, sieh dir Heinz Schenk an!‹ Diesen Satz hörte er oft von seiner alten Vermieterin in der Heinrichstraße. Im Gegensatz zu Schenk war Schaik jedoch nicht angetreten, um gute Laune zu verbreiten.
»Bevor ich gleich um eure Themenvorschläge bitte, möchte ich nochmal auf die Panne in den Abendnachrichten eingehen.« Zwanzig Menschen an dem großen, ovalen Konferenztisch des Fernsehsenders verdrehten die Augen und stöhnten leise. In der gestrigen 18-Uhr-Sendung war zum Thema ›Marode Bahnhöfe in Südhessen‹ ein falscher Hintersetzer aufgetaucht. Das waren Bilder, die hinter dem Nachrichtensprecher eingeblendet wurden und das Thema optisch unterstreichen sollten. Anstelle des vorgesehenen Fotos des Frankfurter Hauptbahnhofes sah man eine Luftaufnahme des Frankfurter Flughafens. Das war peinlich, kam aber manchmal vor. Für einen Schlussredakteur, einen erfahrenen Kollegen, der vor der Sendung nochmals alle Inhalte auf ihre Richtigkeit überprüfte, hatte der kleine Regionalsender kein Geld. So waren Beitragsautoren und Moderatoren selbst verantwortlich für das, was über den Sender ging. Einen Bahnhof mit einem Flughafen zu verwechseln, dachte Groning, war allerdings ausgesprochen dämlich.
»Einen Bahnhof mit einem Flughafen zu verwechseln, ist ausgesprochen dämlich, Gerd«, stellte Rudolf Schaik fest und blickte zu Gerd Bentes, dem Sprecher der Nachrichten.
Bentes wurde rot und senkte seinen Blick. »Ich habe ja schon gesagt, dass es mir leidtut«, sagte er leise. »Ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist.«
Karl Behm, ein Kameramann, der regelmäßig mit Tim Groning zusammenarbeitete, beugte sich seitlich zu ihm. »Gleich sagt er wieder Computerfehler, wetten?«
Gerd Bentes drehte seine Kaffeetasse nervös im Kreis. »Ich glaube, das war ein Computerfehler, das wäre nicht das erste Mal; neulich …«
»… Neulich hast du ebenfalls deinen Kopf in deinem Hintern gehabt, als du gesagt hast, auch die nächste Woche gibt es in Südhessen wieder Wetter!«, rief Miriam Popovic, Redakteurin des Senders, sichtlich aufgebracht.
»Herbstliches Wetter habe ich in den Prompter getippt, herbstliches, doch das war einfach weg, ich konnte wirklich nichts dafür!« Bentes´ Tasse kreiste immer schneller. Er sah sich selbst gern als die graue Eminenz des Senders, ›Best Ager FünfzigPlus‹, erfahren, eloquent und weise.
Hinzu kam, dass er verdammt gut aussah, fand er. Eine Mischung aus Robert Redford und Lino Ventura. Eigentlich sah er sich bei der Tagesschau der ARD, hin und wieder einen Gastauftritt in einer GalaSendung absolvierend oder eingeladen zu gesellschaftlich bedeutenden Anlässen. Eigentlich. Momentan war er Angriffsfläche für eine Meute wütender Nattern, die er einmal an der eigenen Brust genährt hatte mit dem Nektar seiner unschätzbar wertvollen Berufserfahrung. So sah er das. Die wütenden Nattern sahen das anders.
Ole Andersen, angestellter Reporter, schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Gerd versaut unser redaktionelles Niveau, wir geben uns hier Mühe, recherchieren sorgfältig und er verhunzt die Anmoderation für den Beitrag, oder er liest Müll in den Nachrichten, das darf doch nicht wahr sein!« Andersen hatte einen leichten dänischen Spracheinschlag, der sich verstärkte, wenn er sich aufregte.
Rudolf Schaik klopfte mit einem Bleistift gegen sein Wasserglas. »So kommen wir nicht weiter«, sagte er. Das allgemeine Gemurmel im Raum ebbte ein wenig ab. »Gerd, wir reden anschließend in meinem Büro. Ich bin sicher, wir finden einen Weg.«
Erneut beugte sich Karl Behm zu Tim Groning. »Auf jeden Fall finden die beiden den Weg zu der Flasche Whiskey in Rudolfs Schreibtisch.«
Groning musste lächeln. Bei TeleSüd verwandelten sich des Öfteren problematische Situationen in hochprozentige Lösungen. Die Altglasentsorgung übernahm die Putzkolonne. Nur wenige im Betrieb lehnten Alkohol völlig ab, dazu gehörte die außergewöhnliche Rothaarige, der Groning am Konferenztisch gegenübersaß. Christine Adamsky war Chefin vom Dienst, kurz CvD, also seine direkte Vorgesetzte. Sie war wohl zehn Jahre jünger als er, Anfang dreißig schätzte er. Das Verhältnis der beiden war professionell freundlich. Mehr nicht. Und doch ertappte er sich häufig dabei, wie er sie heimlich beobachtete. Schwärmte er für sie? Blödsinn. ›Du bist doch kein Schuljunge mehr!‹, rief er sich dann im Geiste zur Ordnung.
Kowalek, der Hausmeister des TeleSüd-Gebäudes, hatte ihn einmal beim ›Nicht-Schwärmen‹ für Christine Adamsky erwischt. Der Reporter hatte durch eine angelehnte Bürotür beobachtet, wie sie ihre Nylonstrümpfe wechselte. Wie ein Geist war Kowalek hinter ihm aufgetaucht.
»Na, Groning, is natürlich reiner Zufall, oder?«, hustete der westfälische Kettenraucher, dessen Vornamen niemand zu kennen schien, »was macht denn der Zollstock in deiner Hose? Ach, nee, is ja gar keiner. Eher ´ne Luftpumpe, was?«
In solchen Situationen fiel Groning nie eine schlagfertige Antwort ein. In ein paar Wochen würde er vierundvierzig werden. Er war durchaus redegewandt, denn das war ein wichtiger Bestandteil seines Jobs als Reporter. Servierte man ihm jedoch eine solche Steilvorlage, fehlten ihm die Worte. Das ärgerte ihn. Sehr.
Er zwang seine Aufmerksamkeit zurück in den Konferenzraum, richtete den Blick auf den Notizblock vor sich und begann, kleine Vierecke zu kritzeln. Seine Gedanken kreisten um Christine Adamsky und er überlegte, wie sie wohl nackt aussehen würde. Kurz bevor Groning in einen wunderbaren erotischen Tagtraum abgleiten konnte, ergriff die Chefin vom Dienst das Wort. Ihr Tonfall war auffallend dominant.
»Kommen wir zu den Themen des Tages, im Abendmagazin haben wir dreiundvierzig Minuten netto, ich bitte um Vorschläge.«
Frank Meerheide, Cutter bei TeleSüd, murmelte einen gewaltigen Fluch. Dreiundvierzig Minuten redaktionelle Sendezeit für die verschiedenen Beiträge des einstündigen Magazins, das war eine Menge.
»In Weiterstadt sind an die Moschee Hakenkreuze geschmiert worden«, sagte Tim Groning. »Ich könnte drei Minuten daraus machen.« Christine Adamsky sah ihn dankbar an.
Aus dem Hintergrund dröhnte Ole Andersens Stimme. »Im Frankfurter Zoo hat ein Elefant einem Pfleger ins Gesicht gefurzt, der braucht jetzt neue Schneidezähne. Mach ich fünf Minuten draus.« Müdes Lächeln in der Runde.
»Danke, Ole, konstruktiver geht es kaum«, sagte Christine Adamsky und holte tief Luft. »Tim, du fährst zur Moschee, drei Minuten. Ole, am Frankfurter Flughafen wird der Weihnachtsmarkt eröffnet, das sind zwei Minuten, anschließend fahrt ihr ins Städtische Klinikum Darmstadt, da wird der neue Bettenturm eingeweiht, mit Bürgermeister, gibt nochmal zwei Minuten.«
»Was? Das sind doch Kack-Themen, das können die Praktikanten machen!«, beschwerte sich Ole Andersen enttäuscht.
»Die Praktikanten setze ich anderweitig ein, Ole«, sagte Christine Adamsky und wandte sich an Nina Abdimi, eine dreiundzwanzigjährige Studentin des Masterstudiengangs Journalistik aus Mainz, die nun vor Aufregung leuchtend rote Wangen bekam.
»Nina, die ›Neue Bühne‹ in Arheilgen hat heute Generalprobe mit einer Komödie, schau es dir an, rede mit den Schauspielern, bring mir ein paar nette O-Töne, das schneidest du zusammen mit Fanni auf drei Minuten. Alles klar, Fanni?« Frank Meerheide betrachtete die junge Frau. Das konnte interessant werden. »Wir machen ganz großes Kino, Christine«, sagte er und versuchte, dabei ernst auszusehen.
»Avanti, Praktikanti!«, bemerkte Groning sarkastisch und bedauerte gleichzeitig den Kollegen, der mit diesem Greenhorn raus musste, um den Beitrag zu drehen. Das Arbeiten mit Redaktions-Praktikanten war für jeden Kameramann eine Strafe. Gleiches galt für Kamerafrauen.
»Nina, du drehst mit Frieda Becker, die weiß, worauf es ankommt«, sagte Christine Adamsky. Nina Abdimi nickte.
»Arme Frieda«, flüsterte Behm Frieda Becker zu. »Du musst nicht nur gute Bilder abliefern, du darfst auch noch den Babysitter geben.«
Sie lächelte ihn an. »Ach, Karl, du hast doch auch mal angefangen, oder?«
Der Kameramann schüttelte ernst den Kopf. »Nein. Habe ich nicht.«
Rudolf Schaik, der Redaktionsleiter, beobachtete aufmerksam das Mienenspiel des alten, erfahrenen Kameramannes. Er wusste, dass sich die jungen Hüpfer im Sender an den alten Hasen orientierten, wenn es darum ging, betriebliche Stimmungen einzuschätzen. Mitarbeiter wie Behm waren Meinungsmacher, das durfte ein Redaktionsleiter niemals unterschätzen. »Kannst du dich noch an deine ersten Einsätze erinnern, Karl?«, sagte Schaik nachdenklich. »Ich denke da an mehrere vergessene Objektivdeckel und leere Kameraakkus …«
»Das war mein anderes Ich, Rudolf. Mein Unter-Ich«, erwiderte Behm und sah Schaik dabei in die Augen. Beide Männer waren etwa gleich alt, die Sechzig lag hinter ihnen.
Schaik lächelte, klickte entschlossen mit seinem Kugelschreiber und richtete sich in seinem Stuhl auf. »Doch jetzt, Damen und Herren, geht es weiter. Uns fehlen noch dreiunddreißig Minuten Programm. Christine, bitte!« Die Chefin vom Dienst führte die Themensuche fort.
Gronings Notizblock hatte sich inzwischen mit unzähligen Vierecken gefüllt. Der Reporter, der seinen Beruf mochte, ihn aber hier und jetzt verfluchte, war der Meinung, dass die redaktionelle Richtlinie von TeleSüd in die falsche Richtung lief. Regionale und lokale Berichterstattung waren sicherlich wichtig für das Programm, entstand so doch eine starke Zuschauerbindung. Jeder Geflügelzuchtverein, jede Freiwillige Feuerwehr und jede Schultheater-Gruppe kam mit ihren Neuigkeiten ins Programm. Hier ging es nicht um große Politik oder bedeutende wirtschaftliche Zusammenhänge. TeleSüd war die elektronische Wandzeitung der Südhessen-Region.
›Oma Schulz aus Dieburg wird neunzig? Wir drehen das.‹
›Der Kindergarten in Groß-Bieberau wird renoviert? Wir senden das.‹
Für Groning war das in Ordnung. Es ging um die Menschen dieser Gegend, um ereignislose Leben und deren Würdigung. Durch diese Ausschließlichkeit jedoch befand sich der Sender in einer journalistischen Sackgasse. Groning fand, die Redaktionsleitung müsse einen geeigneten Reporter von der tagesaktuellen Berichterstattung über ›Hupsi und Pupsi aus Blödburg und Dödeldorf‹ abziehen. Dieser Reporter könnte dann investigativ arbeiten. Im Dreck wühlen. Sich eingraben in skandalöse Themen. Sich einsickern lassen in schmierige, stinkende Sachverhalte. Er könnte dunkle Geheimnisse in den modrigen Kammern der südhessischen Seele erschnüffeln und sie als Top-Story über den Sender schicken. Das würde dem Renommee von TeleSüd guttun. Mehr Zuschauer würden einschalten. Das bedeutete höhere Einschaltquoten. Dadurch konnte der Sender höhere Werbeminutenpreise verlangen. Mehr Geld käme in die Kasse und könnte in journalistische Qualität investiert werden. Dieses investigative Trüffelschwein könnte Tim Groning sein. Er war bereit für die großen Nummern. Doch die großen Nummern waren anscheinend nicht bereit für ihn.
»Tim? Hallo, Tim!« Er sah auf. Christine Adamsky blickte ihn ungeduldig an. Er spürte, dass auch alle anderen ihn ansahen. »Sorry, ich bin schon in Weiterstadt«, sagte er und lächelte.
»Bring doch bitte auf dem Rückweg vom Dreh ein paar Kästen Wasser mit, der Lieferant kommt erst morgen«, ordnete die Chefin vom Dienst an.
»Geht klar, Christine.« Groning hätte schreien können. Der potenzielle Investigativ-Reporter, möglicher Grimme-Preis-Träger, Retter der Sender-Finanzen, durfte Mineralwasser-Kästen schleppen.
»Wir sind dann schon mal weg«, sagte er müde und klopfte Karl Behm auf die Schulter. Der erhob sich ächzend von seinem Stuhl.
Groning und Behm schlurften durch die Tür des Konferenzraums. Draußen auf dem Flur hielten beide inne und sahen sich an.
»Helga?«, fragte Behm.
»Helga!«, nickte Groning. Sie fuhren mit dem Aufzug ins Erdgeschoß. Die alte, analoge Uhr in der Lobby zeigte 10.15 Uhr an. Groning und Behm traten hinaus auf die Straße. Die übliche vormittägliche Geräuschkulisse umfing sie.
Der Sender hatte im Herzen Darmstadts Quartier bezogen, Rheinstraße Ecke Neckarstraße. Die zentrale Lage hatte jedoch einen schwerwiegenden Nachteil. Parkplätze waren Mangelware. Das Parkhaus unter dem Bürogebäude war eher klein und meistens belegt. TeleSüd hatte Dauerplätze angemietet, die reichten jedoch nur für die vier Kamerateam-Fahrzeuge und die Wagen der beiden Geschäftsführer. Die anderen angestellten und freien Mitarbeiter hatten das Nachsehen.
»Erst Auto holen?«, fragte Behm.
»Nee, erst Seele trösten«, antwortete Groning.
Die Männer gingen um die Ecke des Gebäudes ein Stück die Neckarstraße entlang. Direkt an einer der drei Straßenbahnhaltestellen der Kreuzung stand ein kleiner Kiosk. ›Wasserhaus‹ stand auf einem Schild auf dem Dach des Holzhäuschens, das einer umgebauten Gartenlaube glich. Zwischen den üblichen Zeitungsständern befand sich ein gläsernes Schiebefenster. Dahinter konnte man das Gesicht einer alten Frau erkennen. Es war faltig, wettergegerbt und voll feiner Bartstoppeln. Die langen, grauen Haare waren unordentlich zu einem Dutt hochgesteckt. Sie glänzten fettig. Klare, stahlblaue Augen blickten Behm und Groning durch das geschlossene Schiebefenster prüfend an. Es war jedes Mal das Gleiche. Die alte Frau sah die Kundschaft vor dem Fenster warten. Doch man musste erst an die Scheibe klopfen, damit sie öffnete.
»Morgen, Helga«, sagte Karl Behm.
»Sieh an, der Seelendieb und der Schreiberling«, grinste sie schelmisch.
»Hallo, Helga«, antwortete Tim Groning. Er hatte sich an die Schrullen der alten Kioskbesitzerin gewöhnt.
»Wie schlimm ist es denn?«, fragte sie und zog zwei Kaffeebecher unter dem Tresen hervor.
»Doppelt schlimm«, sagte der Kameramann und dachte über die Seelen nach, die er den Menschen schon geklaut haben musste, folgte man dem alten Indianerglaube aus Amerika, der besagte, dass durch das Filmen und Fotografieren von Menschen deren Seelen den Körper verließen, also von der Kamera gefangen genommen wurde.
»Verstehe. Fernsehland ist abgebrannt.« Helga Krenzer füllte die Becher mit dampfendem Kaffee. Dann griff sie in ein Regal, nahm eine Flasche Weinbrand heraus und gab in beide Tassen einen Schuss hinein. Die Männer bedankten sich und schlürften schweigend das Gebräu.
»Ei, ei, ei«, feixte die alte Frau, »der Herr Reporter hat ja Flecken auf seiner weißen Weste, schau mal einer an!«
Groning sah an sich herunter. Auf seiner alten, roten Winterjacke und der abgewetzten Jeans waren ein paar kleine, dunkle Tupfen. Die hellbraunen Winterstiefel hatten rote Sprenkel, die an Ketchup erinnerten. Er war peinlich berührt. In der letzten Zeit hatte er sich ein wenig gehen lassen. Das musste jetzt aufhören. »Also, gestern wollte ich waschen, aber – ich bin nicht dazu gekommen.«
»Macht doch nix«, grinste sie schelmisch. »Du musst halt nur aufpassen, dass dir keiner ´nen Euro zusteckt.«
Die Kioskbesitzerin kannte die meisten Mitarbeiter von TeleSüd gut. Sie waren im Laufe der Jahre zu Stammkunden geworden. Lust auf was Süßes? Geh zu Helga. Abends keine Lust mehr zum Supermarkt zu fahren? Helga hat das Nötigste. Kleiner Seelentröster gefällig? Helga hilft.
Ihr breiter südhessischer Dialekt wirkte auf Groning wie ein Psychopharmakon. Man entspannte sich und erzählte. Manchmal mehr als gut war. Die zwei Geschäftsführer des Senders, Nicole Schwarz und Holger Graumann, mieden das Wasserhaus. Doch Helga wusste: Irgendwann kommen sie alle. Sie musste nur warten. Und sie konnte warten. Nicht, dass sie die Menschen aushorchte. Keineswegs. Sie hörte einfach zu.
Helga Krenzer kannte Darmstadt. Sie redete mit vielen Menschen. Wen sie mochte, dem gab sie manchmal einen Rat. Solch ein Rat war Gold wert. Wer diesen Rat jedoch ignorierte, dem riet sie nie wieder etwas. Das war Helga. »Wohin gehts denn heute, die Herren Berichterstatter?«
»Nach Weiterstadt, zur Moschee. Jemand hat wohl Hakenkreuze an die Minarette gekritzelt«, antwortete Groning, leerte den Rest seines Kaffees und reichte Helga den Becher. »Bitte, nochmal vollmachen«, sagte er.
»Nach Weiterstadt? Dann reicht doch der eine Kaffee.« Sie blickte Groning ernst in die Augen. Der Reporter wusste nicht genau, was die alte Frau meinte. Aber er verstand instinktiv, dass sie ihn warnte.
»Komm, Karl, wir müssen los«, sagte er zu seinem Kollegen, der gerade seinen Becher austrank. »Aber ich will noch so einen Turbo!«, protestierte Behm.
»Nein, willst du nicht.« Groning legte einen Zehn-Euro-Schein auf den Tresen. »Danke Helga. Bis später.«
»Ja, bis später. Und was die Hakenkreuze angeht: Schön politisch korrekt bleiben, gell!«
»Ja, genau«, sagte Karl Behm. »So ein Nazi ist auch nur ein Mensch.«
»Komm jetzt!« Groning zog seinen Kollegen am Ärmel in Richtung des Eingangs zur Tiefgarage, der hinter dem Kiosk lag.
»Wer ist unser dritter Mann?«, fragte der Reporter.
»Farid«, antwortete der Kameramann. »Na, das passt ja. Ist er nicht Moslem?«
»Keine Ahnung«, erwiderte Behm.
Farid Abu Salama saß im Teamfahrzeug, einem Renault Trafic älteren Baujahres, und kontrollierte die Kameraausrüstung. Der Iraker tat dies sehr gewissenhaft, denn er wollte sich in diesem Sender durch überdurchschnittliche Leistungen zum Kameramann hocharbeiten. Mit seinen einundzwanzig Jahren hatte er bereits zwei Ausbildungen abgebrochen, vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Drogenbesitzes kassiert und war zweimal wegen Ladendiebstahls zu Geldstrafen verurteilt worden. Damals spürte er, dass er einen neuen Anfang machen musste. Dieser Anfang hatte mit einem seltsamen Zufall begonnen.
Als er an jenem glühend heißen Sommertag vor dem Kioskfenster Helga Krenzers erschien und um ein Glas Leitungswasser bat, geschah etwas Außergewöhnliches. Die Kioskbesitzerin lehnte seine Bitte ab.
Im gleichen Atemzug jedoch bot sie ihm einen Aushilfsjob an. »Ich brauche jemand, der hier drin übernachtet, der aufpasst und schreit, wenn jemand einbrechen will.« Ihre stechenden, blauen Augen schienen ihn wie Röntgenstrahlen zu durchdringen. Farid versuchte, wegzusehen, doch er konnte es nicht.
»Kannst du das? Kannst du schreien, wenn du Angst hast?« Ihre Stimme wurde seltsam eindringlich. »Kannst du Diebe verjagen? Na?«
Sein Herz schlug heftig in seiner Brust, war er doch selbst mal ein Dieb gewesen. Er musste nicht nachdenken. Er fühlte, dass er das konnte.
»Ja«, hauchte er. Zu mehr reichte seine Spucke nicht.
Helga Krenzer nickte. Sie gab dem jungen Mann eine Dose Limonade. »Willkommen im Wasserhaus, mein Herr!«
Von diesem Tag an übernachtete Farid Abu Salama jede Nacht im Kiosk.
Tagsüber kümmerte er sich um seine psychisch kranke Mutter, half ihr bei der Hausarbeit und erledigte die Einkäufe für sie. Gegen 22 Uhr kam er zum Kiosk und Helga Krenzer ging nach Hause. Farid verriegelte das Holzhäuschen und legte sich auf ein aufklappbares Feldbett. Ein paar Mal kratzte nach Mitternacht etwas an der Tür des Kiosks. »Wer ist da?«, rief er laut. Das Kratzen hörte auf. Die Kioskbesitzerin entlohnte ihn mit reichlich Essen und freien Getränken, hin und wieder steckte sie ihm einen Fünfzig-Euro-Schein zu. Eines Morgens bat sie Farid, schon mittags zum Wasserhaus zu kommen. Ein mulmiges Gefühl kroch in seine Magengegend. Was wollte sie ihm sagen? War es vorbei? Aber warum? Wovon sollte er dann leben? Er würde niemals zum Sozialamt gehen! Doch was war die Alternative? Wieder mit Stehlen anfangen? Ihm wurde elend. Kurz vor 12 Uhr stand er vor dem geschlossenen Glasfenster des Wasserhauses. Doch Helga Krenzer war nirgends zu sehen. Das war ungewöhnlich. Ein Finger tippte auf seinen Rücken. Erschrocken fuhr er herum. Da stand die alte Kioskbesitzerin, an ihrer Seite ein älterer Mann. Beide lächelten.
»Farid, das ist Karl Behm. Kameramann bei TeleSüd. Er sucht einen Assistenten. Ich habe ihm gesagt, ich kenne jemand, der zuverlässig ist.«
Farid Abu Salama konnte nicht sprechen, so aufgeregt war er.
»Komm doch mal mit«, sagte der Kameramann, drehte sich um und entfernte sich langsam vom Wasserhäuschen. Bevor Farid folgen konnte, klopfte ihm Helga auf die Schulter. »Bau keinen Mist, Junge!«
In den folgenden Monaten entwickelte sich Farid Abu Salama unter Anleitung von Karl Behm zu einem brauchbaren Kameraassistenten. Er lernte, wie er einen sendefähigen Ton aufzunehmen hatte, kümmerte sich um Vollständigkeit und Funktionalität der Kameraausrüstung und bewährte sich als helfende Hand des Kameramannes während eines Drehtages. Behms altgediente Arbeitskollegen sahen eher ungläubig, mit wie viel Ruhe und Gelassenheit er sein Wissen an diesen nervösen Jungspund weitergab, der gleichsam aus dem Nichts im Sender aufgetaucht war.
Karl Behm hatte die Geschichte seiner eigenen Lehrzeit bei einer großen Fernsehproduktionsfirma in Köln nie jemandem erzählt. Er hielt die Demütigungen, Versagensängste und das schwer verwundete Selbstwertgefühl, das ihm sein Lehrmeister damals in die Seele gebrannt hatte, tief in sich verschlossen. Deshalb wahrte er zu Neulingen deutlichen Abstand. Eines aber hatte er sich vorgenommen. Ein einziges Mal wollte er einem Anfänger, der sich wie Behm damals auf einem steinigen Stück Weg seines Lebens befand, eine Chance geben. Ihm zeigen, dass Lernen nicht bedeuten musste, Schmerzen zu ertragen. Und so gab er diese Chance Farid. Der junge Mann nahm seine neue Aufgabe sehr ernst. Manchmal erhielt er ein Lob von seinen Vorgesetzten und das machte ihn stolz. Doch er kämpfte dieses Gefühl schnell nieder und mahnte sich selbst zur Demut. Farid Abu Salama wollte niemals vergessen, woher er kam und was früher geschehen war.
So versuchte er, auch Demut zu empfinden, während er daran arbeitete, Hundekotze von der Ladefläche des Renault Trafic abzukratzen. Doch dieses Gefühl wollte sich einfach nicht einstellen. Viel eher war er wütend auf dieses dämliche Tier, das eine erstaunliche Menge übelriechender Bröckchen, überzogen mit gelblichem Schleim, auf den Boden des Teamfahrzeugs erbrochen hatte. Der Brei war bereits eingetrocknet. Es gehörte auch zu den Aufgaben eines Kameraassistenten, sich um die Pflege des Wagens zu kümmern. Farid Abu Salama schwitzte bei dem Versuch, die ekelhaften Placken mit einem Schraubenzieher aus dem Bordwerkzeugkasten abzulösen.
In diesem Moment öffnete sich die Schiebetür des Renaults und Karl Behm sah ins Wageninnere. »Morgen, Farid, wie siehts aus? Oh, Gott, was stinkt denn hier so? Hast du gefurzt?«
Farid guckte ihn entnervt an. »Nein, der Pudel von Kollegin Balioglu hat sich übergeben.«
Gronings Gesicht erschien neben dem Behms. »Hallo, Farid, können wir? Mann, hier riechts ja übel!« Der Kameraassistent wollte etwas erwidern, doch der Kameramann war schneller. »Pudel. Erklär ich dir später.«
»Wie, Pudel?« Der Reporter verstand nicht. Doch die Zeit drängte, sie mussten zum Drehort.
Behm fuhr. Groning saß auf dem Beifahrersitz und telefonierte mit dem Verantwortlichen der Weiterstädter Moschee. Er avisierte das Kamerateam und bat um eine Drehgenehmigung auf dem Gelände. Inzwischen bereitete Farid Abu Salama im hinteren Teil des Teamfahrzeugs das Kameraequipment vor.
Sie befanden sich auf der Pallaswiesenstraße stadtauswärts. Der Reporter notierte sich gerade die Namen möglicher Interviewpartner von Polizei, Moschee und anderen Beteiligten in Sachen Hakenkreuzschmierereien, als ihn ein saftiger Fluch Karl Behms aufblicken ließ.
»Verfluchte, beschissene Mützenträger, immer da, wo sie nicht sein sollen, bloß nie da, wo sie gebraucht werden!«, knurrte Behm.
In etwa zweihundert Metern Entfernung konnte man eine Polizeikontrolle sehen. Einsatzfahrzeuge, Beamte mit gelben Warnwesten, davor eine Schlange von etwa zehn Autos.
»Das kann dauern«, rief Farid von hinten.
»Das ist nicht das Problem«, sagte Groning.
Farid sah ihn fragend an. »Was denn dann?«
»Helgas Kaffee«, antwortete Behm. Farid wollte nachfragen, doch Groning hob die Hand. Der Kameraassistent hielt den Mund.
Langsam rollte der Renault auf den Anfang der Kontrollstation zu. Der Reporter tastete in der Jackentasche nach seinem Presseausweis. Als er ihn in der Hand hielt, blickte er auf das Foto. So hatte er vor zehn Jahren ausgesehen. Wehmut tropfte in seine Erinnerungen. Die Zeit hatte an seinem Körper viele Wunden geschlagen. Vieles hatte sich verändert. Alt zu werden, dachte der Reporter, war schon übel. Alt auszusehen, war beschissen. Er nahm sich zusammen und sah wieder nach vorne.
Der Polizist, der mit der Kelle in der Hand vorne an der Kontrollstation stand, musterte misstrauisch ihren roten Transporter. Fast schien es so, als wolle er das Kamerateam durchwinken.
»Na, also«, sagte Behm erleichtert.
Doch dann hob sich die Kelle. »Fuck!«, murmelte Farid von hinten.
Sie fuhren auf den zugewiesenen Halteplatz und Behm kurbelte die Seitenscheibe herunter.
»Schön höflich!«, zischte Groning dem Kameramann leise zu.
»Ja, ja …«, knurrte Behm.
»Guten Tag, allgemeine Verkehrskontrolle, bitte Ihren Führerschein, den Fahrzeugschein und die Personalausweise von allen Insassen«, sagte der Polizist emotionslos.
»Was ist denn passiert, Herr Wachtmeister?«, fragte Karl Behm in honigsüßem Ton.
Groning fluchte in sich hinein. Dies war bereits die Kampfansage des Kameramannes an die Staatsmacht. Es war jetzt 11 Uhr und sie hatten noch nicht einmal den Drehort erreicht.
Eine abgestandene Erinnerung platzte in das Bewusstsein des Reporters. Vor fast zwei Jahrzehnten, Behm und er arbeiteten erst kurz zusammen, war es während eines Drehs zu einem Zwischenfall gekommen. Groning streifte auf dem Frankfurter Messegelände mit dem Team-Kombi ein parkendes Auto. Nach diversen Gläsern Prosecco an den Ständen der Buchmesse waren sowohl der Reporter als auch der Kameramann nicht mehr fahrtüchtig. Sie stiegen aus dem Kombi und sahen sich den Schaden an. Der herbeigeeilte Wachdienst rief die Polizei. Groning wusste, dass er seinen Führerschein verlieren würde. Als die Streife eintraf, zog Karl Behm seinen Kollegen nah an sich heran. »Egal, was jetzt passiert«, flüsterte Behm verschwörerisch, »du hältst die Schnauze, klar?«
Der Reporter verstand kein Wort. »Was? Wieso soll ich …«
»Halt einfach die Schnauze!« Groning nickte.
Der Kameramann ging den beiden Polizisten breitbeinig entgegen. »Officers, yo, Officers, es tut mir leid, ich habe das Auto angebumst, aber besser die Karre als die Fahrerin, oder?« Sein Lachen war aus Plastik. Die Beamten musterten ihn. Der folgende Alkoholtest machte den Kameramann für fast ein Jahr zum Fußgänger.
Auf der Fahrt von der Polizeiwache zurück zum Sender fragte Groning seinen Kollegen nach dem Warum. »Weil wir zum selben Stamm gehören«, antwortete er leise. Der Reporter wollte nachhaken. Es verstehen. Doch er schwieg. Die beiden sprachen nie wieder über diese Sache.
»Das ist eine allgemeine Verkehrskontrolle«, erwiderte der Beamte ruhig. Er trat zwei Schritte zurück und sah in den Laderaum des Renaults. Dort saß der Kameraassistent auf einer Materialkiste und grinste den Polizisten verunsichert an.
»Das geht nicht, dass der da hinten unangeschnallt sitzt, während der Fahrt«, mahnte er.
»Außerdem ist er Araber, das geht dann ja auch nicht, nehme ich an, Herr Wachtmeister.« Behms Lächeln war extrabreit.
»Wie bitte?«, fragte der Beamte bedrohlich leise. Er trat ganz nah an das Fahrerfenster heran. Zeit für den Reporter zu handeln. Er sah die zwei silbernen Sterne auf den Schulterklappen des Polizisten.
»Entschuldigung, Herr Oberkommissar, wir sind von TeleSüd und auf dem Weg zum Dreh an einem Tatort. Es gab einen Vorfall an der Moschee in Weiterstadt, könnten Sie uns bitte durchlassen?«, sagte Groning betont sachlich. Er hielt seinen Presseausweis in Richtung des Beamten.
»Ich weiß, was da los ist«, sagte der Polizist und blickte auf den Ausweis. »Also gut. Aber Ihr Kollege da hinten muss nach vorne kommen und sich anschnallen!« Seine Stimme bekam etwas Oberlehrerhaftes. Karl Behm schnaubte verächtlich durch die Nase. Der Polizeikommissar blickte ihn an. Lange. Finster. Seine Nasenflügel begannen zu beben. Er schob sein Gesicht näher an das des Kameramannes heran. Sein Kopf neigte sich fast unmerklich ein wenig zur Seite. »Haben Sie Alkohol getrunken?«, fragte er Behm mit einem sadistischen Funkeln im Blick.
Groning schloss die Augen.
4
Der rote Renault Trafic von TeleSüd rumpelte über eine Schotterstraße und hielt vor einem stählernen Schiebetor. Im Hintergrund sah man ein großes, weißes Gebäude mit zwei Minaretten, die sich überdimensional in den Himmel zu bohren schienen. Auf dem Gelände der Moschee war niemand zu sehen.
Farid, der nach der Polizeikontrolle das Steuer übernommen hatte, machte den Motor aus. »Ich guck mal nach einer Klingel«, sagte er und stieg aus dem Wagen.
»Es kotzt mich an, Karl, dass du jedes Mal abdrehst, wenn du einen Polizisten siehst«, rief Tim Groning, als er mit Karl Behm endlich allein war. »Es kotzt mich wirklich an!«
»Mich kotzt auch vieles an!«, nölte Karl Behm.
Groning unterdrückte den Impuls, dem Kameramann mit der Hand ins Gesicht zu schlagen. »Was?«, schrie er, »was kotzt dich an? Dass du bei jeder Kleinigkeit einen Dreh gefährdest? Dass dein beschissenes Gehirn abschaltet, wenn dir einer eine Anweisung gibt? Dass ich die Scheiße, die du mutwillig verursachst, wieder in Ordnung bringen darf, du kranker Spinner? Arbeiten mit dir ist wie Jonglieren mit Handgranaten, bei denen jemand die Sicherungsstifte gezogen hat!« Groning haute mit der Faust auf das Armaturenbrett des Renaults. Das Radio schaltete sich ein und spielte leise ›Strangers in the night‹.
»Mach deinen Dreck doch alleine«, sagte Karl Behm mit leiser, drohender Stimme.
Nachdem Behms alkoholgeschwängerter Atem bemerkt worden war, hatte der Polizist den Kameramann gefragt, ob er mit einem Alkoholtest einverstanden sei.
Behm sagte nein. Er habe jetzt leider keine Zeit, er müsse die Flugblätter und den Sprengstoff zu seinen Kumpels bringen, die warteten vor der Moschee auf ihn. Es folgte erwartungsgemäß eine größere Polizeiaktion, in deren Mittelpunkt das Teamfahrzeug und seine drei Insassen standen.
Tim Groning konnte es nicht aufhalten. Er bemühte sich zwar zu unterstreichen, das sei alles ein derber Scherz des überarbeiteten Kollegen, doch keiner lachte. Nach etwa dreißig Minuten war der Renault Trafic komplett ausgeweidet. Im Umkreis von zehn Metern lagen geöffnete Koffer und Taschen, deren auseinandergenommener Inhalt sowie die gesamte Innenverkleidung des Transporters, eingeschlossen das CD-Radio, das Handschuhfach und die beiden Sonnenblenden. Der Alkoholtest von Behm ergab eine Blutalkoholkonzentration von 4,6 Promille. Behm wurde blass. Er bat die mit dem Test befasste Beamtin um eine Wiederholung der Messung. Nun wurden 0,21 Promille vom Gerät angezeigt. Karl Behm wurde mündlich verwarnt und ermahnt, das Fahrzeug nicht weiter zu führen. Während Farid Abu Salama das Teamfahrzeug-Puzzle wieder zusammensetzte, rief Groning in der Redaktion an und schilderte die Lage. Er kündigte an, es würde ziemlich knapp werden und es solle auf jeden Fall ab 15 Uhr ein Schnittplatz freigehalten werden, einen fähigen Cutter eingeschlossen. Dann half er dem Kameraassistenten, den Renault wieder einzuräumen. Der Kameramann stand schweigend neben der Beifahrertür und rauchte einen Zigarillo. Als Groning das bemerkte, zog sich sein gesamter Zorn, der sich in der letzten halben Stunde aufgebaut hatte, zu einem kleinen, schwarzen Klumpen in seinen Eingeweiden zusammen. Er sah Behm an. Als spürte er diesen Blick, drehte sich Behm um und schaute Groning in die Augen. Dann ließ er den Zigarillo fallen, trat ihn mit der Schuhspitze aus und ging zum Heck des Wagens. Langsam nahm er einen herumstehenden Lichtkoffer und verstaute ihn widerwillig auf der Ladefläche. Groning schüttelte den Kopf. Farid klopfte dem Reporter mitfühlend auf die Schulter. »Aber er ist ein guter Kameramann, Tim«, sagte er leise.
»Das reicht nicht«, erwiderte Groning. »Nicht mehr!«
Nach diesem Vorfall setzte sich der Kameraassistent hinter das Steuer. Die weitere Fahrt zur Moschee in Weiterstadt verlief schweigend.
Nun stand Farid vor dem Tor und drückte auf einen Klingelknopf, über dem ein kleines Messingschild angebracht war. Darauf stand in Deutsch, Arabisch und Türkisch ›Herzlich willkommen!‹ Während er wartete, hörte er aus dem Teamfahrzeug laute Stimmen. Er fragte sich, wann es zwischen dem Reporter und dem Kameramann endlich so sehr krachen würde, dass beide nicht mehr zusammen eingesetzt wurden. Privat seien die Zwei wohl eng befreundet, das hatte er von Fanni Meerheide, dem Cutter, gehört. Umso mehr wunderte er sich, dass es während der Arbeit ständig diesen Zoff gab.
Farid saß zwischen den Stühlen. Er mochte beide. Von Tim Groning lernte er einiges über Journalismus und Recherche. Doch nur durch Karl Behm hatte er den Job überhaupt bekommen. Aber er sah auch, dass Behm eine andere, eine dunkle Seite hatte, die Farid unheimlich war. Aufbrausend und jähzornig war er dann, wie ein ungezogenes Kind. Als wirkte in ihm manchmal eine selbstzerstörerische Kraft, die sein Handeln übernahm. Bevor er sich weitere Gedanken machen konnte, ob und wie er in dieser Situation Stellung beziehen konnte, zuckte er erschrocken zusammen. Neben ihm war unbemerkt ein großer Schatten aufgetaucht.
»Wer sind Sie?«, fragte ein Riese von einem Mann; er war bestimmt zwei Meter groß und überragte den Kameraassistenten ein gutes Stück.
»Ich?«, fragte Farid und ärgerte sich im selben Moment, stand er doch alleine vor dem Tor. Der Riese sah ihn schweigend an. »Ach so, ja, wir sind das Kamerateam von TeleSüd, wir kommen wegen der Hakenkreuze.«
»Alle aus. Es gibt nur noch Halbmonde«, sagte der Riese ernst.
»Was?«, fragte Farid verwirrt. »Ach so!« Er verstand. Ein Witz. Ein witziger Muslim. Der Kameraassistent grinste verlegen.
Der Torwächter lachte laut. »Nur Spaß! Ich weiß, wer ihr seid. Steht ja auf dem Auto«, sagte er und deutete auf den roten Transporter mit dem gelben TeleSüd-Schriftzug an den Seiten.
In diesem Moment stieg Karl Behm aus der Beifahrertür und knallte sie heftig hinter sich zu.
»Also, dürfen wir reinkommen? Wir haben uns leider etwas verspätet«, sagte Farid und sah auf seine Armbanduhr.
Der Riese entriegelte das Stahltor. Es schwang zurück und er machte eine einladende Handbewegung. »Bitte. Schön, dass Sie kommen konnten. Ich bin Omar El-Thani, der Verwalter. As-salamu alaikum!«
»Wa alaikum as-salam«, erwiderte der Kameraassistent, »ich hole die anderen, einen Moment bitte.«
Während er zum Transporter zurücklief, hoffte er inständig, dass seine beiden Kollegen für die Dauer der Dreharbeiten ihren Streit beilegen konnten.
»Wir können rein, Karl!«, rief er dem Kameramann entgegen. Beide stiegen wieder in den Renault.
»Wie siehts aus, Farid?«, fragte Tim Groning.
»Gut«, antwortete er. »Das ist der Hausverwalter, Omar El-Thani. Er zeigt uns alles.« Der Reporter notierte sich den Namen und die Funktion des Mannes. Das Teamfahrzeug rollte langsam durch die Einfahrt der Moschee. Es war 11.40 Uhr.
5
In dem feuchten Keller, der für zwanzig Menschen zum Gefängnis geworden war, lagen Navid und Ava nebeneinander auf einer Holzpritsche. Es war still. Die abgestandene, modrige Luft war fast zum Greifen.
»Wann gibt‘s endlich was zum Essen?«, fragte der Junge leise.
»Bestimmt bald. Er kommt immer um diese Zeit«, antwortete das Mädchen und sah auf den Kunststoffring an ihrem rechten kleinen Finger, in den eine winzige Uhr eingearbeitet war.
»Wer ist er?«
»Niemand kennt ihn. Er ist verkleidet. Da sind noch andere Männer«, sagte Ava.
»Wie viele sind es?«, fragte Navid ängstlich.
»Drei oder vier, glaube ich. Aber wir wissen es nicht genau.«
Der Junge schauderte. »Warum kommt denn niemand und hilft uns?«
»Keine Ahnung. Die Erwachsenen haben viel darüber geredet. Sie glauben, es kommt niemand, weil keiner weiß, wo wir sind. Sie sagen auch, dass wir alle Geiseln sind. Sie denken, wir sind ein Pfand für etwas, das getan werden soll. Ich weiß nicht, was das bedeutet.«
»Was sind Geiseln?«, überlegte Navid.
»Geiseln sind Leute, die eingesperrt werden, obwohl sie nichts gemacht haben.«
»Aha.« Navid dachte nach. Welchen Sinn hatte es, jemanden einzusperren, der nichts getan hatte? Seine Eltern bestraften ihn manchmal. Aber dann hatte er immer etwas angestellt. Wenn man etwas Schlimmes machte, musste man dafür die Verantwortung tragen. Das hatten sie ihm gesagt, bevor sie ihn in seinem Kinderzimmer für ein paar Stunden einschlossen. Aber das hier war nicht sein Kinderzimmer. Und diesmal hatte er wirklich nichts getan.
»Woher kommst du?«, fragte Ava.
»Aus Darmstadt.«
Sie verdrehte die Augen. »Nein, woher kommst du wirklich?«
»Ach so. Aus Syrien. Und du?«
»Aus dem Irak.«
Navid nickte. »Meine Eltern werden bald kommen und dann holen sie uns alle hier raus, du musst keine Angst haben, Ava«, sagte Navid und griff nach Avas Hand.
Das Mädchen lächelte. »Willst du mich beschützen?«, fragte sie und drückte seine Hand.
Der Junge war plötzlich froh, dass es in dem Raum so dunkel war. Er fühlte, wie seine Wangen zu glühen begannen. In seiner Brust breitete sich eine angenehme Wärme aus. So etwas hatte er noch nie zuvor gefühlt.
»Ja, ich beschütze dich. Du musst keine Angst haben«, sagte er und kam sich auf einmal sehr erwachsen vor.
»Das ist schön«, erwiderte Ava und kuschelte sich an ihn.
Navid wollte etwas antworten, doch er hatte einen dicken Kloß im Hals. Er musste an die Worte seines Vaters denken, die er ihm an seinem Geburtstag im letzten Sommer gesagt hatte: ›Du bist dann ein Mann, wenn du handelst wie ein Mann‹. Navid hatte das nie richtig verstanden. Doch jetzt war etwas anders. Ein wenig glaubte Navid, dass ein Mann sich so fühlen musste, wie er es gerade tat. Das alles fand er sehr verwirrend.
Ava riss ihn aus seinen Gedanken, indem sie sich mit einem Ruck aufsetzte. Angestrengt horchte sie in die Dunkelheit.
»Was ist?«, fragte Navid.
»Ich glaube, er kommt.« Avas Stimme klang aufgeregt.
»Der verkleidete Mann?«
Gerade als das Mädchen antworten wollte, drangen laute Geräusche in den Raum. Die anderen Geiseln bewegten sich auf ihren Holzgestellen. Doch niemand stand auf.
Eine Männerstimme rief durch die geschlossene Tür. »Ihr kennt die Nummer, jeder bleibt auf seinem Bett sitzen, dann passiert keinem was. Wenn einer von euch Ärger macht, werden alle bestraft. Also, schön cool bleiben! Ich komme jetzt rein.«
6
Tim Groning stieg aus dem Renault aus. Er sah sich um. Das Gelände der Moschee machte einen sehr gepflegten Eindruck. Es war menschenleer. Mittlerweile hatte leichtes Schneetreiben eingesetzt. Er zog den Reißverschluss seiner Winterjacke bis ganz oben und wickelte sich seinen Schal fester um den Hals. Das Gebäude war komplett weiß getüncht, die goldenen Dächer der beiden Minarette wurden langsam von Schneeflocken bedeckt. Die große, hölzerne Eingangstür war geschlossen. Rechts neben ihr war auf der Fläche von etwa zwei Quadratmetern eine Art Graffito zu sehen. Der Reporter blickte sich um. Sein Kamerateam und der Verwalter standen zusammen und unterhielten sich. Groning ging zu ihnen.
»Guten Tag, Herr El-Thani. Mein Name ist Tim Groning, ich bin der Reporter. Darf ich mir die Sache genauer anschauen?«
Der Verwalter nahm die ausgestreckte Hand des fröstelnden Reporters und schüttelte sie. »Selbstverständlich, Herr Groning, dazu sind Sie ja hier.«
In dem Augenblick, in dem sich beide Hände berührten, durchzuckte Groning ein seltsames Gefühl. Irgendetwas stimmte nicht. Es war nicht der Verwalter. Es war diese Umgebung. Er kannte dieses Gefühl. Und er mochte es nicht. Das ›Alarmgefühl‹. Noch nie hatte er jemandem davon erzählt. Es war für ihn vergleichbar mit dem leisen Rauschen von Blattwerk in einem Wald. In seinem Inneren erwachte eine diffuse Unruhe. Schon oft hatte sie ihm bei seiner Arbeit geholfen und dennoch mochte er diesen Helfer nicht.
Farid und Karl sahen sich an. »Was brauchst du?«, fragte der Kameraassistent.
»Das Übliche«, erwiderte der Kameramann. »Und du musst Licht machen, bei dem Sauwetter wird das sonst ein Negerkampf im Tunnel.«
Farid grinste. Er mochte Behm nicht zuletzt wegen seiner deftigen Sprache. Ihm war klar, dass der Kollege deswegen oft aneckte. Aber gerade diese Kantigkeit verlieh dem Kameramann eine gewisse Aura. Farid begann, das Stativ und die Kamera aus dem Renault Trafic auszuladen.
Groning war nahe an das Graffito herangetreten. »Schwarzer Spraylack«, murmelte er leise.
»Wir kennen das schon«, sagte der Verwalter der Moschee. Unbemerkt war er neben den Reporter getreten.
»Wie oft kommt sowas vor?«, fragte Groning.
Omar El-Thani überlegte und kratzte seinen Bart. »Etwa einmal im Monat.«
»Sie haben uns noch nie angerufen«, bemerkte Tim Groning und sah ihm in die Augen.
»Das stimmt. Aber diesmal ist etwas anders«, sagte der Hausverwalter.
Groning blickte auf die Schmiererei. Es waren sechs unterschiedlich große Hakenkreuze. Sie waren nicht besonders sorgfältig gesprüht worden. Alles deutete auf große Eile hin. »Was ist diesmal anders?«, fragte er.
Omar El-Thani deutete auf die hölzerne Eingangstür. »Sie haben versucht, die Moschee anzuzünden«, sagte er und fuhr sich mit einer Hand langsam über sein Gesicht. Der Reporter ging zu der Holztür und betrachtete sie.
In der rechten unteren Ecke sah er einen bräunlich-schwarzen Brandfleck von etwa zehn Zentimetern Durchmesser. An dieser Stelle hatte das Furnier Blasen geworfen. Groning kniete sich vor die Tür und roch an dem Brandfleck. »Ich denke, es ist Benzin«, sagte er. Aus dem plumpen Nazigeschmiere war soeben ein fremdenfeindlicher Brandanschlag geworden.
Neben dem Reporter hatte Karl Behm die Kamera auf dem Stativkopf einrasten lassen. Er drehte verschiedene Einstellungen der Hakenkreuze. Hin und wieder gab er seinem Kameraassistenten eine kurze Anweisung und Farid veränderte die Position der Akkuleuchte, die mit ihrem klaren, kalten Licht der Szene eine klinische Anmutung verlieh.
»Noch mal Tuch und Puste, bitte!«, sagte Behm. Der Kameraassistent griff in seine Bauchtasche und holte eine Packung mit speziellen Reinigungstüchern und eine Dose Pressluft heraus.
Karl Behm nahm beides und begann, die Linse der Kameraoptik von Schneeflocken zu befreien. Das Wetter machte die Dreharbeiten nicht gerade leichter. Die Kamera, die er mitgenommen hatte, eine Sony DVW-970, war zwar mit einer Schutzhülle wetterfest eingepackt, doch die Linse lag frei und musste in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Das ärgerte ihn.
Karl Behm ärgerte vieles.
Besonders aber ärgerte ihn, dass es in der Gesellschaft, in der er lebte, unplattbare Fahrradreifen und Hirnschrittmacher gab, Satellitennavigation und computergesteuerte Melkmaschinen, Teilchenbeschleuniger und elektronische Beichtstühle. Doch noch niemand hatte eine Kameraoptik erfunden, die sich nicht zusaute. »Wissenschaft kotzt mich an«, nuschelte der Kameramann.
Farid sah ihn verwundert an. »Was kotzt dich an?«, fragte er.
»Alles«, erwiderte Behm.
Farid nickte. »Ich weiß.«
Die Dreharbeiten gingen zügig voran. Um 13.10 Uhr hatte das Kamerateam alle nötigen Bilder eingefangen. Die Totalen der Moschee und ihrer Umgebung, die Aufnahmen der Hakenkreuze an der Wand und die Eindrücke der Stelle, an der das Gotteshaus angezündet werden sollte, waren im Kasten.
Im Kasten. Tim Groning konnte sich für solche Branchentermini begeistern. Der Begriff ›Im Kasten‹ entstammte noch der Zeit, in der man Bilder mittels einer per Hand gedrehten Filmspule auf das Zelluloid in einem abgedunkelten Holzkasten bannte. Seither hatte die Aufnahmetechnik einen Quantensprung gemacht. Musste man früher nach drei Minuten die Filmrolle wechseln, so passten heute alle jemals in Deutschland gedrehten Spielfilme auf die Speicherkarte einer modernen Fernsehkamera. Zumindest war das gefühlt so, dachte Groning. Eigentlich hatte er keine große Ahnung von Kameratechnik. Umso aufmerksamer hörte er zu, wenn sich Kameraleute über die neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet unterhielten. Infolgedessen entwickelte er im Laufe der Zeit ein erstaunliches Halbwissen in diesem Bereich. Dass dieses Wissen nicht fundiert war, war ihm gleich. Hauptsache, er konnte bei einschlägigen Fachgesprächen mitreden. Und er wollte mitreden.
Alles, was dem Reporter für den Bericht noch fehlte, war ein Interview mit dem Hausverwalter Omar El-Thani. Doch dieser lehnte ab.
»Warum möchten Sie das nicht?«, fragte Groning El-Thani.
Der sah ihm erst in die Augen, dann blickte er zu Boden. »Ich möchte keinen Ärger, Herr Groning.«
»Wer sollte Ihnen deswegen Ärger machen, Herr El-Thani?«
Omar El-Thani schien verlegen. Mit einer geistesabwesenden Geste strich er sich über sein Haar. »Dieselben Leute, die das da gemacht haben.« Er deutete auf die schwarzen Hass-Parolen an der Wand der Moschee.
»Ich verstehe«, sagte Groning und lächelte. Er verstand wirklich. Sie lebten nicht in einer Zeit, in der es ratsam war, wegen ein paar Kritzeleien an Häuserwänden leichtfertig sein Leben zu riskieren.
»Ich könnte Ihr Gesicht technisch verfremden und Ihre Stimme verzerren, Herr El-Thani. Wäre das in Ordnung für Sie?«
Omar El-Thani sah Groning an. »Würden Sie das an meiner Stelle tun, Herr Groning?«
Er erwiderte seinen Blick. »Nein. Ich glaube nicht.«
Der Hausverwalter schien erleichtert. »Sie sind ein ehrlicher Mann, Herr Groning.«
Der Reporter schüttelte unmerklich den Kopf. »Nein, Herr El-Thani. Ich bin nur realistisch.«
Ein seltsames Gefühl flutete im Inneren des Reporters an. Es schien auf das andere Gefühl in seinen Eingeweiden zu treffen, jene beunruhigende Emotion von vorhin, sein ›Alarmgefühl‹. Beide schienen sich zu vereinen. Gemeinsam suchten sie den Weg über die Nervenbahnen seines Rückgrats direkt in sein Stammhirn. Von dort ausgehend bewegte sich ein Kribbeln über seinen Hinterkopf bis in seine Schläfen. Die Speicheldrüsen in seinem Mund begannen hektisch zu arbeiten.
›Verflucht!‹, dachte er, ›nicht jetzt. Nein, nicht jetzt!‹ Er kannte diesen plötzlich auftretenden Frontalangriff auf die Reste seiner körperlichen und geistigen Unversehrtheit. Groning hatte nie begriffen, warum er so etwas empfinden konnte. Doch im Laufe der Jahre hatte er gelernt, auf dieses besondere Kribbeln zu hören.
»Darf ich Sie um etwas bitten?«, fragte er den Hausverwalter.
»Natürlich«, erwiderte El-Thani freundlich.
»Ich würde gerne einmal rund um das Gebäude gehen. Und zwar alleine. Wäre das für Sie in Ordnung?«
»Alleine?«, fragte Omar El-Thani überrascht.
Der Reporter nickte.
»Natürlich. Wenn es Ihnen hilft. Ich warte hier auf Sie.«





























