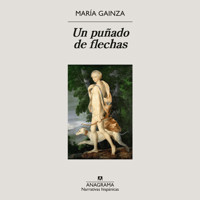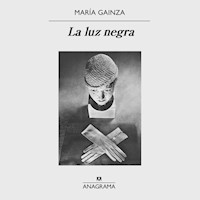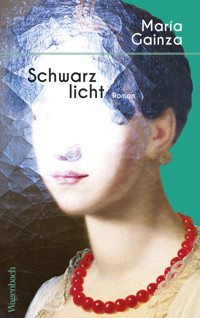
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nehmen wir einmal an, es war so: María beginnt als junge Frau für die beste Kunstgutachterin des Landes zu arbeiten. Enriqueta Macedo, die ausschließlich in druckreifen Sentenzen spricht, lehrt María, wie sich Kunstfälschungen durch genaues Sehen enttarnen lassen. Und sie weiht ihren Schützling in ein wohlgehütetes Geheimnis ein: Als Teil einer Bande erklärt Enriqueta seit Jahren Fakes zu Originalen. Die exzentrischen Betrüger, die im Bohème-Treff Hotel Meláncolico verkehren, kreisen um eine mysteriöse, nicht zu fassende Meisterfälscherin. Deren Spezialität: Werke »im Stil« einer einst berühmten, ebenso schillernden Porträtmalerin. María, mittlerweile illusionslose Kunstkritikerin, folgt den Spuren der verschwundenen Fälscherin. Mit sprühendem Witz entführt die Argentinierin María Gainza in ein Spiegelkabinett voller spleenig-nebulöser Figuren, authentischer Fakes und unwahrscheinlich schöner Geschichten: Denn was ist origineller als eine echt gute Fälschung?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Origineller als das Original? Eine schillernde Hochstaplergeschichte aus Buenos Aires – in den Hauptrollen: eine rätselhafte geniale Künstlerin ohne Werk, eine Bande melancholischer Fälscher und eine Erzählerin auf der Suche nach der Wahrheit.
»Wer María Gainza liest, wird mit Gedanken beschenkt.« Süddeutsche Zeitung
María Gainza
Schwarzlicht
Roman
Aus dem argentinischen Spanisch von Peter Kultzen
Verlag Klaus Wagenbach Berlin
Für Azucena
Die Nummer eins
Endlich stand ich vor dem Hotel Étoile. Ein Schild am Eingang verkündete, dass nichts frei sei, ich ging aber trotzdem hinein und bat an der Rezeption um ein Zimmer. Man gab mir eins im zehnten Stock, mit Blick auf den Friedhof, Badewanne aus italienischem Marmor, Louis-Seize-Schreibtisch, einem floßbreiten Bett und in Goldpapier eingewickelten Bonbons, die aus den Kissen hervorlugten wie falsche Diamanten im Schnee. Dem Concièrge erklärte ich, mein Mann komme später mit den Koffern nach, aber mein Mann wird niemals kommen. Normalerweise lüge ich den Leuten nicht ins Gesicht, aber das hier ist ein Fall von höherer Gewalt.
Ich habe mich unter dem Fantasienamen María Lydis angemeldet. Meinen Ausweis sehen wollte niemand; andernfalls hätten sie vielleicht die Kunstkritikerin erkannt, die ich einmal war. Aber wer wäre angesichts meines verlausten schwarzen Pelzmantels auf die Idee gekommen, dass ich eine Zeitlang in der Welt der Kunst ganz gut im Geschäft war und – ja, doch – sogar ein gewisses Prestige erlangt hatte, das sich der Illusion verdankte, eine empfindsame Prosa sei Ausdruck einer ehrbaren Gesinnung, am Stil erkenne man den Charakter?
Ich werde mich in meiner »Chambre Impériale« – so jedenfalls steht es auf dem Bronzeschildchen an der Tür aus Walnussholz – einschließen und die Sonntagsschriftstellerin hervorkehren, die wir alle in uns tragen. Erst wenn ich alles, was ich weiß, herausgelassen habe, werde ich imstande sein, ein neues Kapitel aufzuschlagen und noch einmal ganz von vorn anzufangen. Inspiriert hat mich dabei ein Brauch aus dem siebzehnten Jahrhundert, über den Defoe in Moll Flanders berichtet: Wer damals in England zum Tod durch Erhängen verurteilt wurde, erhielt die Möglichkeit, vor der Vollstreckung von seinem Verbrechen zu erzählen.
Erwarten Sie keine Namen, Zahlen, Daten. Alles Solide entzieht sich mir, was bleibt, ist nichts als eine vage Atmosphäre, technisch gesehen bin ich eine Impressionistin alter Schule. Davon abgesehen haben mich all die Jahre in der Welt der Kunst misstrauisch gemacht. Besonders verdächtig erscheinen mir die Historiker, die mit ihren exakten Angaben und frostigen Fußnoten einen unheilvollen Zwang auf ihre Leser ausüben. »So ist es gewesen«, sagen sie einem. In meinem Alter schätzt man sanftere Umgangsformen, mir ist es lieber, wenn es heißt: »Nehmen wir einmal an, es war so.«
Ich kam mit einem schiefen Lächeln zur Welt – aufgrund einer Muskelschwäche hebt mein rechter Mundwinkel sich höher als der linke. Manche Leute sagen, daran zeige sich mein verschlagener Charakter. Wie bei jenem Mann, der eigentlich herzensgut war, aber dann zum Gauner wurde, weil seine Schultern beim Gehen mit katzenhafter Langsamkeit kreisten. Was andere einem sagen, einem immer und immer wieder sagen, glaubt man am Ende selbst. Wenn aber heute tatsächlich etwas auf mich zutreffen sollte, dann das Gefühl, vollkommen gescheitert zu sein. Schon früh habe ich aus Gründen, die hier keine Rolle spielen, aufgehört, mir irgendwelche Hoffnungen in Bezug auf meine männlichen und weiblichen Mitmenschen zu machen. Letztere haben mir ohnehin nie etwas anderes als Argwohn entgegengebracht. Nur eine hat mir etwas zugetraut, mir das Gefühl gegeben, wichtig zu sein, und wer uns ein solches Geschenk macht, dem verdanken wir unser Leben.
Wir lernten uns in der Taxierungsabteilung des Banco Ciudad kennen. Enriqueta hatte in den sechziger Jahren dort zu arbeiten begonnen, nachdem sie als eine der Jahrgangsbesten ihr Studium an der Escuela Nacional de Bellas Artes abgeschlossen hatte. Ich fing dort an, weil ich Beziehungen hatte, so wie es zu meiner Zeit üblich war.
Etwa zwei Jahre vorher hatte Onkel Richard, schon reichlich angetrunken, beim Weihnachtsessen lautstark und etwas lallend verkündet, dass es nichts Besseres als Arbeit gebe, um das schwarze Schaf der Familie auf den rechten Weg zu bringen – eine der Plattitüden, wie sie zur Intelligenz meines Onkels passten. Ehrlich gesagt, war ich gar nicht darauf aus, mich irgendwie zu etablieren, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich mich lieber einfach treiben lassen, mich an nichts und niemanden gebunden. Meine Verwandtschaft hingegen betrachtete mich als hoffnungslosen Fall, als jemanden, der sich in seinem Leben, wenn überhaupt, als Schmetterlingsjäger hervortun würde. Ich weiß nicht recht, warum, aber ich nahm die Herausforderung trotzdem an. Wahrscheinlich wollte ich damit vor allem erreichen, dass Onkel Richard endlich die Klappe hielt. So kam es jedenfalls, dass mir – eigentlich nur wegen des Gequatsches unter Suffköpfen – das Glück zuteilwurde, als Sklavin in den Dienst Enriqueta Macedos gestellt zu werden.
Am ersten Montag im Januar trat ich um neun Uhr morgens durch die Glastür der Taxierungsabteilung des Banco Ciudad und steuerte die Rezeptionistin an, die hinter einem gläsernen Tresen saß. Sie trug keinen BH – dieser Kampf war damals schon seit Längerem gewonnen. Als ich ihr sagte, dass Señorita Macedo mich erwarte, warf sie mir einen Blick zu, den ich als so etwas wie »Na dann, viel Glück« deutete. Ich passierte noch eine Glastür. Ich fand es auffällig, wie viel Verwendung dieses Material hier fand, womöglich, sagte ich mir, sollte das auf die Transparenz bei den Transaktionen verweisen.
Ich brauchte gar nicht erst zu fragen, um zu wissen, dass ich sie vor mir hatte. Enriqueta Macedo war damals eine der angesehensten Sachverständigen auf ihrem Gebiet, eine altgediente und vielgerühmte Heldin des Kunstbetriebs. Als ich ins Zimmer trat, kauerte sie vor einem an der Wand lehnenden Gemälde und war offenbar kurz davor, sich auf dieses oder mitten in dieses hineinzustürzen. Richtigerweise müsste man sagen, dass sie das Bild nicht so sehr in Augenschein nahm, als es vielmehr beschnupperte. Ich räusperte mich schüchtern, ganz wie im Kinofilm. Für ihr Alter auffällig flink, sprang sie auf und gab mir mit in die Höhe gerecktem Kinn zu verstehen, dass es an mir sei, näherzukommen. (Später sollte ich begreifen, dass sie diese hochmütige Haltung einnahm, um von ihrem Doppelkinn abzulenken.) Sie trug eine zitronengelbe Bluse und ein zerknittertes stahlgraues Kostüm. Sie machte einen gewöhnlichen, ja geradezu etwas lächerlichen Eindruck, doch ihr Äußeres war, wie ich nach einiger Zeit feststellen sollte, ihrer Geisteshaltung genau entgegengesetzt.
Eilig ging ich quer durch den Raum auf sie zu. Dabei unterzogen ihre Augen mich einer unerbittlichen Prüfung. Da ich unfähig war, ihrem Blick standzuhalten, richtete ich meinen auf ihre Schuhe, die nichts weiter als ein schwarzes Etwas auf dem Fußboden waren.
Bevor ich etwas sagen konnte, schmetterte sie mir entgegen:
»Ich hoffe, du hast deine Hausaufgaben gemacht.«
Zitternd bot ich ihr mein schiefes Lächeln dar. Offensichtlich rief die Asymmetrie Vergnügen oder Mitleid, vielleicht auch Erleichterung bei ihr hervor. Sie schnalzte teilnahmsvoll mit der Zunge und führte mich zu einem Tisch.
»Lass dich von meinen komischen Schikanen nicht einschüchtern. Ich hab nun mal die schlechte Angewohnheit, streitsüchtig zu sein, tut mir leid. Aber jetzt darfst du dich erst mal ein bisschen in die Familiengeheimnisse einlesen.«
Damit waren zwanzig schwarze Ordner gemeint, die – wie ein Gehrock, der einen überdimensionierten Bauch verbergen soll – die Quittungen sämtlicher in den letzten Monaten bei der Bank deponierten Gemälde enthielten. Ich blätterte eine Zeitlang darin – ein schier unerschöpflicher Papierwust –, und als ich lange genug so getan hatte, als würde ich mich für ihren Inhalt interessieren, ergab ich mich in mein Schicksal. Ich werde mich schon dran gewöhnen, sagte ich mir. Und es ist in der Tat bemerkenswert, wie schnell man sich an alles Mögliche gewöhnt.
Mit fünfundzwanzig saß ich in der bedeutendsten Taxierungsstelle des Landes, an dem Ort, wo despotisch über den Preis und die Echtheit der Gemälde verfügt wurde, die auf dem Markt zirkulierten, wo man Bilder als Pfand oder auch in Verwahrung nahm, wenn ein Rechtsstreit um sie entbrannt war. Was von außen attraktiv schien, erwies sich im Inneren als düster-bedrückende behördengraue Institution.
Regelmäßig überkam mich ein unbestimmtes Gefühl der Enge und Beklemmung in dieser Höhle, in der die Angestellten ausschließlich über Gewinnerwartungen redeten und sich dabei einer Fremdsprache bedienten, die ich zwar verstand, der ich aber dennoch nicht folgen konnte, so als ob ich zwar die einzelnen Wörter begriffe, sich mir der Sinn des ganzen Satzes jedoch entzog. Um meine Position innerhalb dieser Familie von Geldanbetern zu festigen, legte ich mir schon bald eine zweifelhafte Tugend zu – ich fing an, das Geld zu verachten.
Nur Enriqueta schien meine moralische Atemnot zu verstehen. All das ist inzwischen schon so viele Jahre her, dass es schwerfällt, dieser Frau wirklich gerecht zu werden, aber vielleicht kann man sagen, dass ich in ihr eine Anmut entdeckte, die sich in meiner Umgebung ansonsten nahezu vollständig verflüchtigt zu haben schien.
Sie gehörte zu den Frauen, denen das Älterwerden gut steht. Als es so weit war, muss sie sich gesagt haben: Puh, endlich, das mit der Jugend hätten wir geschafft! Im Winter trug sie einen schwarzen Mantel, der aussah, als hätte man dafür einem räudigen Hund das Fell abgezogen. Aber das schäbige Stück hielt warm, und darauf kam es seiner Besitzerin an. Wenn sie zur Bürotür hereinkam, verbreitete sie eine Aura göttlicher Strenge, was sich wahrscheinlich ihrem langjährigen Umgang mit Kunstwerken verdankte. »Diese Gemälde werden uns alle überleben – wie die Gebirge«, pflegte sie zu sagen und ließ dabei den Blick umherschweifen.
Irgendwelche romantischen Vorstellungen, was ihre Mitmenschen anging, hatte sie sich nicht erhalten, dafür besaß ihr Glaube an die Kunst beinahe esoterische Züge. Auch wenn sie selten davon sprach, schien sie einer älteren Zivilisation zu entstammen, die es nicht nötig hatte, alles in Worte zu fassen. Die Einrichtung ihres Arbeitszimmers war schlicht, die Sessel mit echtem Leder bezogen; an den Wänden hingen Reproduktionen von Werken William Blakes. »Meine einzige Religion«, sagte Enriqueta, als ich bei meinem ersten Besuch aus der Ferne den Blick darauf richtete. »Geh ruhig näher ran, sie beißen nicht, auch wenn sie’s könnten.« Es handelte sich um die Illustrationen zu Miltons Paradise Lost. Die Darstellungen der Hölle schienen mir um ein Vielfaches besser als die des Himmels, was ich jedoch für mich behielt. Damals wusste ich noch nicht, dass allein die Tatsache, eine eigene Meinung zu haben, einen Wert an sich besaß. Es sollte sogar der Tag kommen, an dem man mich dafür bezahlen würde, meine Meinung zu äußern.
Enriquetas Arbeitszimmer hatte etwas Mysteriöses an sich, es hätte ohne Weiteres sein können, dass eins der Bücherregale nur die Tarnung einer Geheimtür war. Am Schreibtisch sitzend, schaute ihr Kopf zwischen Stapeln von Kunstkatalogen hervor, die sie vor der Welt schützten wie eine Wagenburg vor einem Indianerüberfall. Woher sie kam, war nicht ganz klar. Von ihrer Familie sprach sie nie, es sei denn, um daran zu erinnern, dass einer ihrer Urgroßväter von den Schiffbrüchigen auf dem Floß der Medusa verspeist worden war. Von diesem ehrenvollen genealogischen Detail abgesehen, bewegte sie sich durchs Leben, als wäre sie völlig auf sich allein gestellt.
Sie war kalt und streng. Ihre Kollegen, gewöhnliche, um nicht zu sagen: ziemlich mittelmäßige Zeitgenossen, hielten sie für eingebildet. Ich dagegen mochte sie sofort. Nicht nur, weil sich durch die Zusammenarbeit mit ihr mein Verstand schärfte, ihr haftete auch etwas an, das es einem unmöglich machte, sie einfach nur als ein Ungeheuer höherer Art zu betrachten. Sie war merkwürdig, aber ich meine das nicht im schlechten Sinne. Sie war eine Eingeweihte – das unterschied sie von den Normalsterblichen. Sie besaß ein Adlerauge, ein Talent, das in der Welt der Kunst, so wie der »klinische Blick« in der Welt der Medizin, vom Aussterben bedroht ist. Sie war imstande, durch ein Bild hindurchzusehen, seine Matrix zu erfassen. Und sie verfügte über die angeborene Gabe, ein Bild im Kopf in seine Einzelteile zu zerlegen und anschließend wieder zusammenzusetzen wie ein Schweizer Uhrmacher einen mechanischen Zeitmesser. Wobei sie – als gute Maschinenstürmerin, die sie gleichzeitig war – jede Art neumodischer technischer Hilfsmittel zur Bestimmung der Echtheit eines Kunstwerks rundheraus ablehnte. Alles, was sie sich in dieser Hinsicht zugestand, war eine Taschenlampe, die ein schwaches bläuliches Licht ausstrahlte und mühelos in ihre geschlossene Hand passte. Ein »Schwarzlicht«, wie die Forensiker sagen. Kriminaltechniker verwenden es, um Blut, Samen, Speichel oder Schweiß von Opfern oder Tätern aufzuspüren, Kunstsachverständige dagegen machen sich mit diesem Licht auf die Suche nach Elementen, die einem Gemälde nachträglich hinzugefügt wurden. Glaubte man Enriqueta, so war nichts weiter als dieses Gerät nötig, um ein gemaltes Kunstwerk in all seiner Tiefe zu erkunden. Alles Übrige hatte man selbst beizusteuern.
Wie lange würde jemand wie Enriqueta brauchen, um mich zu entlarven? Einen Monat? Eine Woche? Vielleicht nur wenige Minuten. Wider Erwarten war sie offensichtlich jedoch zu einem positiven Urteil über mich gelangt, denn sie nahm mich unverzüglich unter ihre Fittiche und hatte mich, ehe ich mich’s versah, zu ihrer Erbin bestimmt.
»Lass dir hier drinnen bloß nicht anmerken, wenn du von etwas begeistert bist, unter keinen Umständen!«, belehrte sie mich wenige Tage nachdem wir uns kennengelernt hatten. »Halte unbedingt das Metall deiner Stimme geheim, dann kannst du sicher sein, dass diese Leute dich in Ruhe lassen.«
Um mir den hierfür nötigen unerschütterlichen Gleichmut einzuimpfen, erzählte sie mir die Geschichte des Anaxagoras, der auf die Nachricht vom Tod seines Sohnes hin ausgerufen haben soll: »Sciebam me genuisse mortalem« (»Ich wusste, dass ich einen Sterblichen gezeugt habe«). Ich bin mir aber sicher, dass ihre Neigung zur Ataraxie, deren Fahne sie hochhielt, keine angeborene war. Ich glaube vielmehr, dass sie sich damit gegen die Zumutungen des Lebens zu wehren versuchte.
In den ersten Monaten erteilte sie mir einen Begutachtungsschnellkurs. Ich war jung, wusste wenig, und was ich wusste, verstand ich kaum, dafür jedoch weckte nahezu alles rasendes Interesse bei mir. Ich wich ihr nicht mehr von der Seite und notierte mir, was sie sagte, in verschiedene Kladden mit festem Einband. Auf den Einbänden lese ich: »Die Kunst der Zuschreibung«, »Provenienz«, »Falsches Antik-Papier – Der Teebeutel-Trick«, »Auf die Details wie Ohrmuscheln und Fingernägel kommt es an (Die Morellische Methode)«. Enriqueta sprach stets in knappen, lebendigen Sätzen, rund und stachelig wie ein Igel. Oft waren es Aphorismen, wobei sie zwischen zitierten und erfundenen keinerlei Unterschied machte: »Sprich über Malerei, das ist der einfachste Weg, um Leute kennenzulernen.« »Wenn man ein Bild betrachtet, sollte man aufs Klo müssen – nichts hält den Geist so wach wie ein angespannter Schließmuskel.« »Nichts ist geeigneter als Kunst, um jemanden zu entlarven. Einen billigeren Lügendetektor kenne ich nicht.« Immer wieder ließ sie völlig unvermittelt derartige Weisheiten vom Stapel.
Freitags, wenn für gewöhnlich nur wenig Arbeit anfiel, ließ sie mich alte Auktionskataloge aus der Bibliothek holen, die ich anschließend stundenlang durchsehen sollte. »Das ist ein Muskel, den musst du trainieren«, sagte sie dazu. Ich sah hin, ohne zu wissen, was genau ich ansehen sollte. Als ich ihr das schließlich verzweifelt gestand, erklärte sie: »Irgendwann wirst du so weit sein, dass du spürst, wahrnimmst, weißt, wie man die Dinge ansehen muss.« Obwohl es vordergründig immer um Malerei ging, schienen ihre Ratschläge sich in Wirklichkeit auf die Kunst des Lebens zu beziehen.
Ich werde noch etwas über Enriqueta sagen: Sie war sehr munter und lebhaft, und egal, ob ich ihr beim Lösen eines Kreuzworträtsels helfen, ihren Fisch entgräten oder ihre Schuhe zubinden sollte, wenn ihr wieder einmal die rheumakranken Finger wehtaten – für mich war das alles reine Poesie.
Um sechs Uhr abends verschwanden die übrigen Bankangestellten in den Fluren wie die Ratten in der Kanalisation. Dann gingen wir beide hoch auf die Dachterrasse des Gebäudes, um unsere Unterhaltung dort fortzusetzen. Während wir von der Ehrentribüne aus den Sonnenuntergang verfolgten, konnte sich Enriqueta in endlosen Ausführungen über Vasari, Karel van Mander oder Pico della Mirandola ergehen, aber nicht im bleischweren, feierlichen Jargon der Akademiker, vielmehr sprach sie mit einer Vertrautheit über die erwähnten Personen, als handelte es sich um alte Freunde. Sie schloss die Augen und belegte sie mit zärtlichen Spitznamen, schalt sie manchmal auch, weil sie ihre Körperpflege vernachlässigten. Ich glaube, zeitweilig vergaß sie, wo und neben wem sie sich befand. An wolkenlosen Tagen sorgte eine seltsame Kombination aus Sonnenstrahlung, Luftverschmutzung und Neonreklamen manchmal dafür, dass um uns herum alles wie in ein bratapfelfarbenes Licht getaucht war, wie auf den Gemälden des Präraffaeliten Burne-Jones. Ein optischer Effekt, der nie länger als fünf Minuten anhielt, doch sobald es so weit war, sprang Enriqueta aus ihrem Liegestuhl wie ein Toast aus dem Toaster, wandte das Gesicht dem Himmel zu und murmelte mit zusammengepressten Lippen: »Flammantia moenia mundi.« Im selben Augenblick zerschellte das kupferfarbene Licht an ihrer Brust, um gleich darauf an ihren Schulterblättern wieder auszutreten, woraufhin mich ein langer und durchdringender Schauder überlief. Auf einmal sah ich, wer oder was sie eigentlich war – eine Künstlerin ohne Werk, ein Kunstwerk für sich.
Nicht lange, und ich hatte ihr klar zu verstehen gegeben, dass ich ihr in jeder Hinsicht zur Verfügung stand, ob es darum ging, ihr einen Kaffee zu bringen, oder in ihrem Auftrag einen Mord zu begehen. Enriqueta las in mir wie in einem offenen Buch.
Ein Jahr später hinterließ sie mir an einem Sonntagmorgen eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, in der sie mir mitteilte, dass sie mich um fünf Uhr nachmittags an der Ecke Calle Suipacha, Avenida Sarmiento erwarte. Ich solle meine Badesachen mitnehmen. Als die brave Soldatin, die ich war, packte ich sofort meine Tasche. Und während ich mich der verabredeten Stelle näherte, rief ich mir eine Maxime in Erinnerung: Charakterbildung findet an Sonntagnachmittagen statt.
Als ich ankam, stand sie bereits vor der Tür und rauchte ihre übliche Gauloise. Wie immer zog sie daran bis zum letzten Millimeter, um den Stummel anschließend auf den Boden zu werfen und mit ihrem Stilettoabsatz auszutreten. Mit einer Handbewegung, in der eine große Vertrautheit lag, forderte sie mich auf, ihr zu folgen. »Du brauchst bloß ein Verbrechen zu begehen, und die Welt vor deinen Augen wird durchsichtig wie Glas«, murmelte sie und sah nach rechts und links, während wir das Badehaus Colmegna betraten, dessen in weiße Uniformen gekleidete Angestellte mit ihren rosigen und gleichzeitig strengen Gesichtern sie wie eine alte Bekannte begrüßten.
In einem feuchten Umkleideraum zog ich meinen Badeanzug mit dem ausgeleierten Gummi an und machte mich auf den Weg zum Schwimmbecken, in dem sich zu früheren Zeiten die strammen Körper von Nixen und Neptunen getummelt haben mussten, jetzt aber lag es halb verlassen und mit teilweise losen Fliesen da. Über den Beckenrand verstreut saß, auf der Flucht vor Einsamkeit und Angst, eine Handvoll Greise mit schlaffer Haut und ließ die Beine ins Wasser baumeln.
Wenige Minuten später erschien auch Enriqueta. Erstaunlich schlank in ihrem schwarzen Badeanzug, kletterte sie wie eine schwungvoll ausgeführte Signatur die Aluminiumleiter hinunter und glitt ins lauwarme Wasser. Eine Zeitlang ließen wir uns schweigend nebeneinander dahintreiben. Es stimmt schon: Ein starker Wind trennt dich vom Rest deiner Spezies, das Wasser hingegen vereint.
Nach dem Baden hüllten wir uns in raue weiße Handtücher und wanderten wie Kartäusermönche einen Gang entlang, an dessen schmierigem Gummibelag die Fußsohlen haften blieben. Schließlich erreichten wir einen kleinen Raum mit Holzlatten an den Wänden. Darin mehrere breite Sitzreihen, wiederum aus Holz, und ein sehr feiner, lauwarmer, leicht nach Rosmarin duftender Dunst. Wir setzten uns einander gegenüber, legten uns dann jedoch, als wir feststellten, dass niemand sonst hereinkam, auf den Rücken und starrten an die Decke. Es war ein guter Ort, um nichts zu sagen. Die Greise hatten draußen unterdessen begonnen, das Schwimmbecken zu umkreisen. Man hörte das Quietschen der Rollatoren, ein seltsames Geräusch, das klang, als bestünden sie aus Eis. Allmählich hatte ich den Eindruck, mein Kopf sei von einer Wolldecke umhüllt, und schließlich fiel ich in einen leichten Halbschlaf.
»Wenn du erlaubst«, riss Enriqueta mich unversehens aus meinem Dämmer, »erzähl ich dir jetzt ein paar Dinge, die du wissen solltest.«
Vor meinem inneren Auge tauchte das Bild Garibaldis auf, wie er seinen Soldaten beim Aufbruch in Rom erklärte, was er ihnen anzubieten habe: Hitze und Durst während des Tages, Kälte und Hunger während der Nacht und Gefahr rund um die Uhr. Enriquetas Stimme war nicht rau und bestimmt wie sonst. Diesmal hörte sie sich seltsam entfernt an, als spräche sie von einem Pferd oder einem Berg aus, und ihre Sprache hätte ich unter anderen Umständen als biblisch bezeichnet. Dass das, was ich hier erzähle, das damalige Geschehen exakt wiedergibt, kann ich nicht behaupten, denn meine schlaffen Muskeln hatten sich gegen meine Konzentrationsfähigkeit verschworen. Dennoch bin ich sehr wohl imstande, zum Kern der Angelegenheit vorzudringen.
Vierzig Jahre lang hatte die aufrechte und unnahbare Enriqueta Macedo gefälschte Kunstwerke für echt erklärt. Für jedes falsche von ihr als Original ausgewiesene Gemälde erhielt sie eine Provision. Das machte sie aber nicht des Geldes wegen, sie wurde vielmehr im Namen der Kunst »zum Straftäter«, wie sie selbst es bezeichnete: Falsch waren ihrer Ansicht nach bloß Werke von zweifelhafter Qualität.
»Kann eine gute Fälschung etwa nicht ebenso viel Vergnügen bereiten wie ein Original? Ist das Falsche in einem gewissen Punkt nicht wahrhaftiger als das Authentische? Und besteht der eigentliche Skandal im Grunde genommen nicht darin, dass mit Kunst gehandelt wird?«, schleuderte sie mir entgegen, ohne meine Antwort abzuwarten. Sie war schließlich »die Nummer eins«, die graue Eminenz der Taxierungsabteilung – wie hätte ich ihr widersprechen sollen?
Diese erste Unterhaltung dauerte gerade einmal zwanzig Minuten, länger lässt es sich in einer Sauna nicht gut aushalten. Wir sollten aber noch mehrmals hierher zurückkehren. Schon bald war mir klar, warum Mafiabosse und andere Gauner ihre Privatangelegenheiten an solchen Orten regeln – selbst der widerlichste Spitzel kann sich nicht verkabeln, wenn er keine Kleider am Leib hat. Ach! Die egalitäre Gerechtigkeit der Sauna! Mit nacktem Bauch lässt sich der Millionär vom Armen nicht unterscheiden, der Verbrecher nicht vom Anständigen.
Von da an sprachen wir über die wirklich wichtigen Dinge nur noch in jenem kleinen Raum. An manchen Tagen war der Dampf so dicht, dass Enriquetas Gestalt sich darin aufzulösen schien, und mich beschlich das Gefühl, ich sei in Wirklichkeit ganz allein hier und lauschte einer Stimme, die aus meinem eigenen Inneren zu mir drang.
Ich will bei meiner Erzählung aber zurückhaltend bleiben. Jedenfalls wurde ich so in die Welt des Verbrechens eingeführt. Endlich hatte ich das Gefühl, irgendwo dazuzugehören, und meine beiden Hälften – die, die nach Schutz suchte, und die, die auf Abenteuer aus war – waren zufrieden. Natürlich bekam ich auch immer wieder einmal Angst, und noch hatte ich keinen Philosophen bei der Hand, der mir erklärt hätte, dass kein starkes Gefühl ohne ein Quantum Schrecken auskommt.
Bald war offensichtlich, dass wir, sie und ich, identische Seelen besaßen, die sich nur hinter unterschiedlichen Masken verbargen. Unsereiner, wie Enriqueta, den großen Bernard Berenson zitierend, sich ausdrückte. Im Grunde waren wir zwei Romantikerinnen, die glaubten, mit ihren Streichen etwas gegen die herrschenden bürgerlichen Vorstellungen zu tun, gegen die Art, wie diese Leute die Welt betrachten – die Leute, die Kunst kaufen.