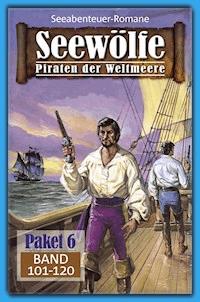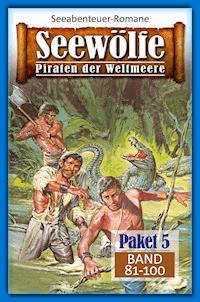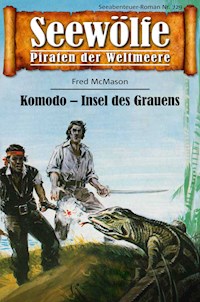2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Der gefesselte Carberry sah mit Entsetzen, wie der verrückte Gordon Brown die andere Laterne holte und das Öl entzündete, nachdem er den Inhalt der ersten Lampe bereits auf die rauhen Dielen gekippt hatte. Seine Hände zitterten, und fast wäre ihm die Lampe aus den Fingern gerutscht. Dazu kicherte er wie ein Irrer. Eine kleine Flamme zuckte auf. Sie wurde rasch größer und lief in einer Schlangenlinie über die Dielen. Das Holz war knochentrocken, und das anfangs kleine Feuer griff in rasender Eile um sich. Es begann bereits, sehr heiß zu werden. Gordon Brown näherte sich der halboffenen Tür. Der leichte Luftzug fachte die Flammen noch schneller an. Ein wildes Fauchen raste durch die Windmühle. Carberry wand sich in seinen Fesseln und wußte doch, daß er keine Chance hatte...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 125
Ähnliche
Impressum© 1976/2020 Pabel-Moewig Verlag KG,Pabel ebook, Rastatt.eISBN: 978-3-96688-006-0Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Fred McMason
Auch ein Bastardwird begraben
Sein Haß ist grenzenlos – er will den Profos töten
„Profos“, sagte Francis Drake knapp und hart. „Walten Sie ihres Amtes. Als oberster Gerichtsherr an Bord der ‚Marygold‘ erkläre ich Gordon Brown der ihm zur Last gelegten Verbrechen für schuldig und befehle, ihn zu Tode zu bringen. Er soll an der Rah hängen.“
„Nein!“ schrie Gordon Brown. „Nein! Gnade! Ich bin unschuldig! Der verdammte Spanier hat mich verführt – ah …“
„Du Stinktier!“ fuhr ihn der Profos an. „Du hundsgemeines, dreckiges Stinktier! Jetzt stirb wenigstens wie ein Mann!“
Er band den brüllenden Gordon Brown los und stieß ihn zum Mitteldeck hinunter.
Kräftige Fäuste packten zu. Sie fierten die Großrah weg, legten dem tobenden Mann eine Schlinge um den Hals, befestigten sie an der Rahnock und hievten die Rah hoch.
Das Brüllen brach abrupt ab. Gordon Brown hatte seine Schulden bezahlt. Eine halbe Stunde später wurde er der See übergeben.
So geschehen im Oktober 1576 an Bord der „Marygold“ unter dem Kommando von Francis Drake.
Aber Gordon Brown schien zweiundzwanzig Jahre später von den Toten auferstanden zu sein, um seine Rache zu nehmen …
Die Hauptpersonen des Romans:
Gordon Brown – ein Kerl, an dem alles schmierig ist, außen und innen, außerdem wird er von Haß zerfressen.
Nathaniel Plymson – der Kneipenwirt der „Bloody Mary“ bricht eine Lanze für die Arwenacks, obwohl sie mal wieder alles kurz und klein geschlagen haben.
Edwin Carberry – der Profos guckt einer Sängerin tief in die Augen und wird zu einem Stelldichein eingeladen, das sich als die reine Hölle entpuppt.
Mac Pellew – Der Zweitkoch entdeckt eine neue Nahkampfwaffe, die er mit Erfolg einsetzt.
Philip Hasard Killigrew – ist fast geneigt, an „Geisterschiffe“ zu glauben, findet dann aber des Rätsels Lösung.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
1.
März 1598.
Die spanische Silbergaleone „Fidelidad“ gab zwar ihr Bestes und wurde auch von hervorragenden Seeleuten gesegelt, aber das änderte nichts an der Tatsache, daß sie trotz allem eine „lahme Ente“ blieb.
Mit ihrer schweren Last – Gold, Silber, Perlen und Kleinodien – rollte sie behäbig durch die aufgetürmte See und legte sich schwerfällig von einer Seite auf die andere.
Die Prise, die die Arwenacks den Spaniern abgenommen hatten, war für London bestimmt, sozusagen als Gastgeschenk für Ihre Majestät, die Königin von England. Schließlich wollte man nicht mit leeren Händen erscheinen.
Die „Fidelidad“, jetzt besetzt mit zwölf Arwenacks, segelte etwa drei Kabellängen voraus. Auf der Galeone war jeder Fetzen Tuch gesetzt worden.
Die Schebecke segelte, seitlich versetzt im Kielwasser, hinterher. Sie hatte nur wenig Tuch gesetzt, nur ein paar Lappen, damit sie nicht ständig an der Galeone vorbeisegelte.
„Heilige Bramstenge“, sagte der Profos Edwin Carberry und rang die Hände. Gleichzeitig schickte er einen gottergebenen Blick zum wolkenverhangenen Himmel. „Kann dieser Zossen denn nicht etwas schneller durch die See törnen! Das ist ja nicht zum Aushalten, ist das. Jeder Pißrinnenkapitän segelt hundertmal schneller.“
„Na, na“, ließ sich Philip Hasard Killigrew vernehmen. „Das wird Juan aber gar nicht gern hören. Er segelt die Galeone hervorragend, oder willst du das etwa bestreiten, Ed?“
„Es liegt nicht an ihm, ich weiß, es liegt an dem lausigen Schiff.“
„Eben! Weil es voll abgeladen ist, und daher kannst du es nicht mit der leeren Schebecke vergleichen. Die da vorn geben sich wirklich alle Mühe, doch mehr ist nicht herauszuholen. Aber wie ich dich kenne, verfolgst du einen ganz anderen Gedanken, nicht wahr?“
„Iiich?“ fragte der Profos langgezogen. „Ich doch nicht, Sir.“
Er setzte ein Gesicht wie ein Heiliger auf, der beschuldigt wurde, gerade eine Kirche geplündert zu haben.
„Du kannst es kaum erwarten“, sagte Hasard lächelnd, „endlich in Plymouth einzulaufen. Du siehst in Gedanken nur noch Plymmies Kneipe vor dir und überlegst wahrscheinlich, wie du es am besten anstellen kannst, sie in Trümmer zu legen.“
„Plymmies Kneipe in Trümmer?“ sagte der Profos fassungslos, als sei das der größte Frevel auf Erden. „Aber Sir, wir wollen doch nur Erinnerungen austauschen, bei einem kleinen Plausch, versteht sich. Niemals hätte ich den Gedanken erwogen, die gute alte ‚Bloody Mary‘ in Trümmer zu legen. Ich bin doch kein Kneipenzerklopper, da sei Gott vor, Sir.“
„Wenn ich mich recht entsinne, war die Kneipe jedes Mal nach eurem Besuch so gut wie abgewrackt. Das ist doch heilige Tradition.“
„Ja, ja, die Tradition!“ Carberry seufzte. „Das ist so ein Ding mit Haken und Ösen. Da sitzt man in anheimelnder Atmosphäre beschaulich und völlig friedfertig beim alten Plymson, und schon taucht so ein schlitzohriger Bastard auf, der Streit anfängt. Was tut man als friedfertiger und frommer Pilger? Man läßt sich eins auf die Glocke hauen und wehrt sich erst dann, wenn hundert Kerle auf einen einstürmen. Das bezeichne ich als reine Notwehr zur Erhaltung des eigenen Lebens, Sir, denn man will ja noch was leisten auf dieser schönen Welt.“
„Fehlt nur noch, daß jetzt Englein um dich herumtanzen, um dir einen Heiligenschein aufzusetzen“, murmelte Hasard. „Du spielst also nicht mit dem Hintergedanken, bei Plymmie wieder mal Stunk anzufangen?“
„Bewahre, Sir. Ich bin mitunter regelrecht entsetzt, daß man so von mir denkt.“
„Wir sollten ihn ein bißchen beweihräuchern“, schlug Ben Brighton vor. „Oder ihn zumindest heilig sprechen lassen. Aber leider kann ihn nur der Papst kanonisieren.“
„Lieber lasse ich mich dreimal kielholen!“ rief der Profos. „Kanonisieren ist eine hundsgemeine Sache. Das haben die Türken in Istanbul auch getan – einfach einen Kerl vor eine Kanone gebunden und sie dann abgefeuert. Wenn ich euch nicht mehr wert bin …“
Edwin Carberry sah in grinsende Gesichter. Ganz besonders der Kutscher grinste wieder einmal sehr infam.
„Ist was?“ fragte Carberry verwirrt.
„Du hast wieder mal was in den falschen Hals gekriegt“, erklärte der Kutscher. „Kanonisieren hat absolut nichts damit zu tun, vor eine Kanone gebunden zu werden. Kanonisation ist eine Heiligsprechung.“
„Hört sich trotzdem gemein an“, beharrte Carberry. „Zu was benutzt man unverständliche Fremdwörter, wenn man das auch einfacher ausdrücken kann?“
„Das tut man sehr oft.“
„Und warum?“ fragte der Profos angriffslustig.
Es sah ganz danach aus, als würden sich die beiden wieder mal in die Haare geraten, aber dann winkte der Kutscher fast entsagungsvoll ab, als die Haarspaltereien begannen.
„Der Klügere gibt nach“, sagte er lässig.
„Wenn der Klügere immer nachgibt“, sagte der Profos mit einem hinterhältigen Grinsen, „dann würden nur noch die Dummen die Welt regieren, oder sehe ich das falsch?“
Der Kutscher wollte gerade zu einer Erwiderung ansetzen, aber dann schluckte er sie doch hinunter.
„Damit hast du gar nicht mal so unrecht“, gab er zu.
„Das solltest du allmählich anerkennen.“
„Und ihr hört jetzt mit eurem Streit auf“, sagte der Seewolf. „Sonst lassen wir Plymouth an Backbord und segeln gleich durch nach London.“
Dem Profos hätte er damit wirklich nichts Schlimmeres antun können, denn der war schon ganz wild darauf, endlich wieder mal das alte Schlitzohr Nathaniel Plymson zu sehen. Und nicht nur das, denn schließlich war in der alten Spelunke an der Ecke Millbay Road und St. Mary Street immer etwas los. Ein bißchen Heimweh war natürlich auch dabei.
„Aber nicht doch, Sir“, sagte der Profos bescheiden. „Der Kutscher und ich streiten doch nicht. Wir tauschen nur gegenseitige, Erfahrungen aus, oder stimmt das nicht, mein liebes Kutscherlein?“
Das „liebe Kutscherlein“ nickte augenzwinkernd.
„Natürlich“, versicherte er. „Ein reiner Erfahrungsaustausch, mehr steckt nicht dahinter.“
Die beiden waren wieder ein Herz und eine Seele, wie Hasard lächelnd feststellte. Wenn es bei Carberry um Plymouth ging, dann war er recht schnell zu besänftigen, besonders dann, wenn ihm angedroht wurde, an dem Städtchen vorbeizusegeln.
„Nun gut“, meinte der Seewolf. „Dann bleiben wir also auf dem Kurs. Zwei oder drei Tage können wir in Plymouth verbringen, wenn ihr alle einverstanden seid.“
Sie waren alle einverstanden, ganz besonders der Profos, der sich grinsend die Hände rieb und schon riesig auf das alte und ausgekochte Schlitzohr Plymmie freute.
Aber dann kam doch noch etwas dazwischen.
Die Bewegungen der voraussegelnden Galeone wurden träger. Sie wälzte sich jetzt buchstäblich durch das Meer. Auch die Schaumkronen der hochgehenden Dünung verschwanden nach und nach. Leichter Dunst lag in der Luft, ein Dunst, der scheinbar aus dem Nichts entstand.
„Wir kriegen Nebel“, erklärte Smoky. „Ich rieche das ganz deutlich.“
„Seit wann kann man Nebel riechen?“ fragte Luke Morgan. „Das ist doch nichts weiter als Stuß.“
„Ich kann, das aber“, behauptete der Decksälteste. „Die Luft hat dann einen ganz besonderen Geruch, aber dafür muß man eine feine Nase haben. Wollen wir wetten, daß es bald Nebel gibt?“
„Nein“, sagte Luke, „lieber nicht. Im Wetten hast du immer die Nase vorn, da bleibe ich draußen.“
Schon nach einer knappen Stunde stellte sich heraus, daß Smoky recht hatte. Die Luft war noch dunstiger geworden, und der Wind stellte langsam sein Fauchen ein.
Nach einer weiteren halben Stunde bewegten sich Schebecke und Galeone mit der gleichen Geschwindigkeit, obwohl Hasard etwas mehr Tuch setzen ließ.
„Nebel“, sagte auch Hasard. „Nicht mehr lange, und wir geraten in eine ganz besonders dicke Suppe. Wir werden versuchen, zur Galeone hin aufzuschließen.“
„Noch besser wäre, wir blieben zusammen“, schlug Dan O’Flynn vor. „Sollten wir die Galeone aus den Augen verlieren, kann es vielleicht Schwierigkeiten geben. Allein ist das schwerbeladene Schiff ziemlich hilflos.“
„Das stimmt allerdings“, gab Hasard zu. „Auch hier treiben sich ein paar Schnapphähne herum. Wir werden also aufschließen und bei der ‚Fidelidad‘ längsseits gehen.“
Der Dunst schien jetzt direkt aus dem Wasser zu wachsen. Leichter Wind verwirbelte ihn zu abstrakten Gebilden, die sich an manchen Stellen wie Kreisel drehten.
Old O’Flynn starrte wie gebannt auf diese Nebelfetzen und dachte dabei wieder an Wassergeister, die ruhelos aus der Tiefe nach oben strebten. Er sagte jedoch nichts, denn er sah den grinsenden Blick Edwin Carberrys, der nur auf ein Wort von ihm zu lauern schien.
Ganz unmerklich begann der Wind einzuschlafen. An der Dünung änderte sich jedoch nichts. Sie blieb weiterhin langgezogen und träge.
Die Schebecke segelte der Galeone von achtern auf, schob sich immer näher heran und ging schließlich längsseits. Leinen flogen hinüber und wurden an den Holzpollern belegt.
„Es ist besser, wenn wir zusammenbleiben“, rief Hasard zu Don Juan hinüber. Der hochgewachsene Spanier mit dem kühn geschnittenen Gesicht hatte das Kommando über die Silbergaleone. „In spätestens einer Stunde ist der Nebel so dicht, daß wir die Hand nicht mehr vor den Augen erkennen.“
„Und der Wind läßt uns ebenfalls im Stich!“ rief Don Juan zurück. „Es sieht nach einem längeren Aufenthalt aus.“
„Das befürchte ich auch.“
Hasard blickte zu den Segeln hinauf. Sie wurden zusehends schlaffer, nur ein kleiner Windstoß beulte sie noch aus. Mit den Flögeln war es nicht anders. Die Windbüdel fielen in sich zusammen.
Die ersten Nebelbänke begannen über dem Wasser zu schweben. Sehr schnell wurden sie dichter und kompakter. Manche sahen wie unheimliche schwimmende Inseln aus.
Es dauerte nur noch eine halbe Stunde, dann hingen die Segel wie Leichentücher von den Rahen. Auf der Schebecke trat derselbe Zustand ein. Auch hier war kein Leben mehr in den Segeln.
Auf dem Meer breitete sich eine unnatürliche Stille aus. Kein Wind sang mehr im laufenden oder stehenden Gut, kein Plätschern von Wasser war mehr zu hören. Beide Schiffe liefen keine Fahrt. Die einzigen Geräusche waren das Knarren und Ächzen von Blöcken und Taljen und das leise Aneinanderreihen der Bordwände.
Immer dichter wurde der Nebel, der jetzt in langen dicken Schwaden über das Wasser trieb und es einhüllte, bis die Wasseroberfläche unter einem dunklen Grauschleier verborgen war.
„Dann können wir ja gemeinsam kochen“, schlug der Kutscher vor. „Zeit genug haben wir.“
Der Vorschlag wurde mit Begeisterung aufgenommen, und so gingen die Männer bald darauf ans Werk.
Trotz der Kühle aßen sie an Deck. Inzwischen war der Nebel so dicht geworden, daß man vom Vorschiff aus das Achterdeck nicht mehr erkennen konnte. Die Arwenacks waren zu Scheinen geworden, die in den Konturen immer wieder zerflossen oder sich aufzulösen schienen.
Immer noch ging die Dünung langgezogen, und hin und wieder klatschte es zwischen den Bordwänden, wenn Wasser emporstieg.
Das Essen verlief recht schweigsam. Die meisten hingen ihren Gedanken nach und dachten an England, wo sie lange nicht mehr gewesen waren.
Eine kompakte Nebelwand schob sich heran. Sie sah wie ein riesiger Berg aus Watte aus, der jede Gestalt in sich aufzusaugen schien. Bald waren auch die Umrisse der Männer nicht mehr zu erkennen.
„Verdammte Nebelsuppe“, brummte Al Conroy mißmutig. „Hoffentlich hält sie nicht zu lange an.“
Seine kraftvolle Stimme klang ganz weit entfernt, als spräche er aus einer anderen Welt. Es ließ sich auch nicht feststellen, aus welcher Richtung seine Stimme ertönte.
„Scheint aber doch noch eine ganze Weile zu dauern“, erwiderte der Decksälteste Smoky. „Man kennt das ja in dieser Ecke. Wenn der Nebel sich erst einmal festgesetzt hat, dann verschwindet er auch nicht mehr so schnell.“
Smoky war für sein Gegenüber nur noch ein heller dunstiger Fleck, gesichtslos, zerfließend wie ein Geist, der sich unruhig bewegte, obwohl er ganz still saß. Seine Stimme schien aus einer tiefen Gruft an die Ohren der anderen zu dringen.
Old O’Flynn schüttelte sich unbehaglich und sah sich in dieser „Geisterrunde“ immer wieder nach allen Seiten um. Ein bißchen fröstelnd zog er die Schultern hoch. Er gewahrte, daß etwas auf ihn zukroch und ihn mit kalten feuchten Fingern anzufassen schien. Nebelgeister, tanzende Kobolde und Gnome aus einer schattenreichen Welt, die ein normaler Mensch nicht begriff.
Nach dem Essen standen sie auf und wanderten auf dem Schiff umher. Ein paar Arwenacks standen am Schanzkleid und starrten in die fast greifbare Suppe, die sie wie ein eisiger Hauch von allen Seiten berührte.
Klamm und feucht war es. Selbst das Wasser war nicht zu sehen. Die Umgebung erweckte den Eindruck, als schwebten beide Schiffe irgendwo zwischen Himmel und Erde. Es gab kein Oben und Unten mehr, keine Richtung ließ sich bestimmen. Sie waren in einer Materie gefangen, die sie nie mehr freizugeben schien.
Ein paar Stunden lang ging das so. Sie verharrten offenbar immer auf demselben Fleck, wurden von der Dünung nur leicht angehoben und dann wieder abgesetzt.
Viel später war ein weit entferntes leises Winseln zu hören, das ebenfalls aus dem Nichts ertönte. Ein kaum spürbarer Hauch fuhr über sie hinweg, der das Frösteln noch verstärkte.
„Wind“, sagte Don Juan leise. „Es kommt Wind auf, aber er scheint uns noch nicht zu erreichen.“
„Jetzt wird es nicht mehr lange dauern“, erwiderte Hasard. „Wir sind nur noch nicht richtig in der Windzone drin.“
Sie lauschten angestrengt in den Nebel. Das leise Winseln wiederholte sich. Dann glaubten sie, einen langgezogenen Seufzer zu hören, der klagend über der See verhallte.
„Unheimlich ist das“, murmelte Old O’Flynn beklommen. „Als sei hier jemand ganz in der Nähe. Wenn mich nicht alles täuscht, dann habe ich eben sogar Stimmen gehört.“
„Dich täuscht vermutlich alles“, meinte der Seewolf. „Oder hat noch jemand Stimmen gehört?“
„Donegal hört immer Stimmen im Nebel“, versicherte der Profos mit einem schiefen Grinsen. „Wahrscheinlich haben sich ein paar Wassermänner unterhalten oder gefragt, ob sie an Bord aufentern dürfen.“