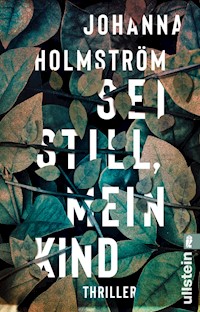
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Hinter der Idylle wartet das Grauen Kinderpsychologin Robin Löf kehrt nach zwölf Jahren zurück an den Ort, an dem sie aufgewachsen ist: Vråkören, eine abgelegene Villenkolonie vor den Toren Helsinkis. Seit Robins Bruder Lukas unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen ist, hat sie ihre Mutter hier nicht mehr besucht. Robin bemerkt rasch, dass die Anwohner ihrer Mutter feindselig gegenüberstehen. Auch im Wald, der die Siedlung umgibt, scheint es nicht mit rechten Dingen zuzugehen: Robin fühlt sich verfolgt. Als ein Unbekannter versucht, sie zu ermorden, überschreitet sie alle Grenzen, um die Wahrheit herauszufinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Sei still, mein Kind
Die Autorin
JOHANNA HOLMSTRÖM wurde 1981 in Sibbo geboren. Sie gehört der schwedischsprachigen Minderheit in Finnland an. Seit einigen Jahren lebt sie mit ihren zwei Töchtern in Helsinki. Sie ist Journalistin und studiert arabische Literaturwissenschaft. Für ihre Erzählungen erhielt sie unter anderem den Literaturpreis des Svenska Dagbladet. Asphaltengel wurde von der Presse hymnisch besprochen.Von Johanna Holmström sind in unserem Hause bereits erschienen:Die Frauen von SjälöAsphaltengel
Das Buch
Kinderpsychologin Robin Löf kehrt nach zwölf Jahren zurück an den Ort, an dem sie aufgewachsen ist: Vråkören, eine abgelegene Villenkolonie vor den Toren Helsinkis. Seit Robins Bruder Lukas unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen ist, hat sie ihre Mutter hier nicht mehr besucht. Robin bemerkt rasch, dass die Anwohner ihrer Mutter feindselig gegenüberstehen. Auch im Wald, der die Siedlung umgibt, scheint es nicht mit rechten Dingen zuzugehen: Robin fühlt sich verfolgt. Als ein Unbekannter versucht, sie zu ermorden, überschreitet sie alle Grenzen, um die Wahrheit herauszufinden.
Johanna Holmström
Sei still, mein Kind
Thriller
Aus dem Schwedischen von Wibke Kuhn
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage August 2021© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH,Berlin 2021© Johanna Holmström 2015Die schwedische Originalausgabe erschien 2015 unter dem TitelHush Baby bei Schildts & Söderströms, Helsingfors.Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, MünchenAutorenfoto: © Riika HurriE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.com Alle Rechte vorbehalten. ISBN 978-3-8437-2415-9
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
PROLOG
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
PROLOG
Widmung
Summertime …and the livin’ is easy …fish are jumpin’ and the cotton is high …well, your daddy’s richand your ma is good lookin’ …so hush little baby …don’t you cry …
PROLOG
Der erste Schuss, der mit einem trockenen Knall direkt neben seinem Ohr in den Baum einschlägt, lässt ihn erstarren. Beim zweiten fängt er an zu rennen. Er drückt das Gewehr beim Laufen an die Brust, wie sie es in der Armee gelernt haben, aber seine Arme ermüden so rasch, dass er es dann doch lieber in die Hände nimmt.
Der Boden ist nass, mit den Stiefeln bleibt er im Blaubeergestrüpp hängen. Er stolpert, und während er sich ungeschickt vorwärtsbewegt, fängt er an zu schluchzen. Der Wald rundum ist nicht sehr dicht, die Kiefernstämme sind kerzengerade und schmal. Verstecken kann man sich hier nirgends.
Das leicht hügelige Gelände zehrt an seinen Kräften, und bald nimmt sein Tempo deutlich ab. Er bleibt kurz stehen, um zu lauschen, und späht zitternd und weinend zwischen den Bäumen hindurch.
Er hört entfernte Rufe von rechts und ändert die Richtung, und dann rennt er auch schon in wilder Panik weiter, bis der Boden auf einmal unter ihm nachgibt und er nach vorne fällt.
Das Gewehr fliegt ihm aus der Hand, und er landet mit einem lauten Platschen im Sumpf. Schlammiges Wasser spritzt ihm ins Gesicht, und er versucht fieberhaft, sich wieder hochzurappeln. Doch es ist zwecklos. Je mehr er strampelt, umso tiefer saugen ihn Schlamm und Moor herab. Rundherum breiten sich Moltebeerengestrüpp und Wollgras aus. Der Sumpfporst verströmt seinen starken Duft.
Als kleiner Junge, wenn er mit seinen Schwestern Linnea und Emilia unterwegs war, zog er sich den Sumpfporst immer durch die Faust, dann hielt sich der Geruch noch eine ganze Weile auf der Haut.
Beim Gedanken an seine Schwestern muss er laut aufschluchzen, und er dreht sich mühsam um, als die patschenden Schritte hinter ihm näher kommen.
»Nein …«, greint er, und die grün gekleidete Gestalt bleibt stehen.
»Ja, da flennst du jetzt, du Schwein …«, sagt die grün gekleidete Gestalt, und dem Mann, der im Moor liegt, gelingt es, eine Hand herauszuziehen.
»Bitte, zieh mich hier raus!«
Die grün gekleidete Person hebt das Gewehr. Es ist Elchsaison, und der Lärm der Jagdgesellschaften, die sich mit ihren Ratschen durch den Wald bewegen, lässt die beiden aufhorchen und in den Wald spähen. Sie waren auch bei einer solchen Jagdgesellschaft dabei, bis dem Mann im Sumpf klar wurde, dass ein Rollentausch stattgefunden hatte und er nun Gejagter statt Jäger war.
Nach dem dritten Schuss, der durch den Wald hallt, findet sich die ganze Jagdgesellschaft am Ort des Geschehens zusammen. Dann stehen sie beieinander und schauen zu, wie das Blut das wassergetränkte Moos langsam rot färbt.
1. Kapitel
»Hast du schon mal einen Menschen sterben sehen?«
Das Mädchen hat den Blick die ganze Zeit nicht von ihren Händen genommen, aber als sie ihre Frage stellt, schaut sie Robin an. Die dunkelblonde Ponylocke, die ihr fast ganz über die Augen fällt, ist strähnig wie bei einem kleinen Mädchen, und sie hat ein Pflaster am Zeigefinger. Ihr kleiner Bruder hat sie gebissen. Das hat sie sofort erzählt, als sie den Raum betrat. Sie hielt Robin den Finger entgegen, fast triumphierend, und dann fügte sie hinzu, dass sie überhaupt nicht geweint hatte, obwohl es wehgetan hatte.
Das Mädchen heißt Laura. Sie ist acht Jahre alt. Vor etwas über einem Jahr wurde bei ihrer Mutter Knochenmarkkrebs diagnostiziert. Als sie vor ungefähr vier Monaten zu Robin geschickt wurde, hatte das Mädchen schon eine ganze Weile zusehen müssen, wie ihre Mutter Päivi mager und ausgemergelt in einem Krankenhausbett lag, jenseits jeglicher Hoffnung auf Genesung.
Die Behandlung war viel zu spät begonnen worden. Päivi war in einem sehr frühen Stadium schwanger gewesen, als die Krankheit entdeckt wurde, aber sie entschied sich dafür, die Schwangerschaft auszutragen. Sie entschied sich fürs Leben, wie sie sagte. Das Leben des Kindes. Ihr eigenes Schicksal war so oder so ein sehr ungewisses. Die Ärzte konnten ihr nichts versprechen. Die Behandlung konnte auch erfolglos bleiben, wenn sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschied.
»Aber ich müsste es eigentlich noch schaffen, das Kind auf die Welt zu bringen, haben sie gemeint«, erzählte Päivi, als Robin sie im Krankenhaus besuchte.
Als der kleine Junge zur Welt kam, so hatte Laura zugegeben, phantasierte sie davon, ihn mit einem Kissen zu ersticken. Wenn jemand sterben musste, damit ein anderer leben durfte, dann würde sie sich für Mama entscheiden, das war ihre Überlegung.
Jetzt war Lauras kleiner Bruder schon sieben Monate alt und hatte gerade seine ersten Schneidezähne bekommen. Vier kleine scharfe Reiskörner, die er dann offenbar bei der ersten Gelegenheit an seiner großen Schwester ausprobieren musste.
Hast du schon mal einen Menschen sterben sehen?
Auf Lauras Frage gibt es keine eindeutige Antwort, also beschließt Robin, mit einer Gegenfrage zu antworten.
»Warum fragst du?«
Das Mädchen lässt den Blick aus dem Fenster schweifen. Der Spätherbst bläst das Laub in kleinen Wirbeln über den grauen Parkplatz, auf dem Autos in tristen Farben in langen, anonymen Reihen stehen. Es ist ein beklemmender Anblick, aber Robin hat sich das Arbeitszimmer ja auch nicht wegen der Aussicht ausgesucht. Sie arbeitet im Stadtzentrum in der Klinik, die die beste kinderpsychiatrische Abteilung des ganzen Bezirks beherbergt. Eine Privatklinik, die aber auch mit der gesetzlichen Krankenkasse zusammenarbeitet. Mehr Nachfrage als Angebot. Topbezahlung. Da ist die Aussicht eine Bagatelle, die sie achselzuckend wegstecken kann.
»Na ja …«, meint Laura. »Ich frage mich, wie man es weiß, wenn jemand ganz kurz davorsteht.«
Ihre Stimme löst sich in ein Flüstern auf, und Robin betrachtet das glänzende Haar des Mädchens. Sie würde gern die Hand ausstrecken und darüberstreichen, doch sie unterlässt es. Zwischen ihnen steht der Schreibtisch, der ganz deutlich die Distanz zwischen medizinischem Personal und Patient markiert, so klein der Patient auch sein mag.
In dem Jahr, das Lauras Mutter jetzt schon im Krankenhausbett vor sich hinstirbt, hat sich die Art, wie das Mädchen mit der Situation umgeht, drastisch geändert. Als Robin sie zum ersten Mal traf, war sie völlig verschlossen. Die Familie machte sich Sorgen, als das Mädchen aufhörte zu sprechen. Allmählich hörte sie dann auch noch auf zu essen. Ihr Krankheitsverlauf schien den der Mutter abzubilden, und als Lauras Mutter, frisch nach der Entbindung und in schlechtem Allgemeinzustand, durch die physische Anstrengung einen Großteil ihrer Haare verlor, fand Lauras Vater dunkelblonde Haarbüschel im Bett seiner Tochter. Sie riss sich im Schlaf das eigene Haar aus, das sie sich als Einschlafhilfe immer um den Finger wickelte.
In der schlimmsten Phase musste man Laura in die Kinderklinik einliefern und an den Tropf hängen. Ihr schmächtiger Körper war einem Kollaps gefährlich nahe gekommen. Doch dann begann sie sich langsam wieder zu erholen. Sie hörte auf, sich die Haare auszureißen, sie machte nicht mehr ins Bett, und die unkalkulierbaren Wutanfälle, die ihre Lehrer ebenso erschreckten wie ihre Klassenkameraden, waren bald nur noch eine Erinnerung, die zusammen mit ihrem Wunsch begraben wurde, dass ihr kleiner Bruder sterben solle.
»Hast du deine Mutter besucht?«, fragt Robin sanft, und Lauras Blick taucht wieder ab in ihren Schoß.
Sie zupft an ihrem Pflaster und nickt. »Papa und ich.«
Robin schaut aus dem Fenster. Der Himmel ist dunkelgrau, zugezogen mit dicken Regenwolken. Früher oder später wird der erste Schnee fallen, aber es war ein langer, nasser Herbst. Überhaupt nicht wie der Herbst, in dem sie auch jemand hatte sterben sehen. Dieser Herbst war kalt gewesen. Der Winter kam schon im Oktober und lockerte seinen eisigen Griff nicht vor dem Frühjahr, einem Frühjahr, das erst gegen Ende April begann. Robin blinzelt, um die Erinnerung zu verscheuchen, und lässt den Blick wieder zum gesenkten Kopf des Mädchens zurückwandern.
»Wie ging es ihr heute?«, fragt Robin.
»Sie hat bloß geschlafen. Sie ist gar nicht aufgewacht. Nicht mal, als ich ihre Hand gehalten habe. Papa hat gesagt, sie muss sich ausruhen. Damit sie wieder gesund werden kann.«
Robin presst die Lippen zusammen, um einen Seufzer zu unterdrücken. Sie hat Lauras Vater Miro mehrmals gesagt, dass es sich nicht lohnt, Laura falsche Hoffnungen zu machen. Sie weiß, dass ihre Mutter nicht wieder gesund wird. Deswegen geht sie ja auch in die Therapie. Aber jedes Mal, wenn ihr Vater ihr erzählt, dass ihre Mutter wieder gesund wird, hat Laura richtig schlechte Tage, die einen Rückschlag im therapeutischen Prozess bedeuten. Robin nimmt sich vor, Miro später anzurufen, um ein ernstes Wort mit ihm zu reden.
»Aber sie wird nicht wieder gesund«, fährt Laura fort, und Robin lässt den Stift sinken.
Laura schaut sie an. Ihre großen grauen Augen sind voller Tränen, die gleich überlaufen werden. Sie schnieft und trocknet sich die Augen mit dem Handrücken ab. Robin schüttelt den Kopf.
»Nein, sie wird nicht wieder gesund.«
»Aber warum sagt Papa dann, dass sie sich ausruhen muss? Dass sie wieder gesund wird?«
Robin schweigt einen Moment. Dann beugt sie sich zu Laura vor und stützt die Ellbogen auf den Tisch.
»Dein Vater macht das nur, weil er meint, dass es dir dann besser geht. Erwachsene machen so was manchmal. Aber du weißt, dass deine Mutter sehr, sehr krank ist. Und dass sie nicht wieder gesund wird.«
Robin macht eine Pause und schaut Laura fest in die Augen.
»Deine Mutter schläft jetzt viel, weil sie nicht mehr viel Zeit hat. Ihr Körper schafft es nicht mehr, die ganze Zeit wach zu bleiben. Und so weiß man, dass er sich aufs Sterben vorbereitet. Verstehst du, was ich sage, Laura?«
Robin schluckt schwer. Es widerstrebt ihr, Laura die Wahrheit zu sagen, aber sie weiß, dass das Mädchen jetzt genau das braucht. Sie muss die Chance bekommen, sich zu verabschieden. Päivis Zeit läuft langsam ab. Sie hat nur noch ein paar Wochen, vielleicht sogar weniger. Das Letzte, was Laura jetzt gebrauchen kann, sind Erwachsene, die sie anlügen, weil sie glauben, sie auf diese Art beschützen zu können. Trotzdem kommt Robin sich grausam vor, am liebsten würde sie selbst lügen. Auch sie würde den Schmerz gern lindern, indem sie ihn aufschiebt.
»Wie bei Bruno«, sagt Laura, und Robin runzelt die Stirn.
»Wer ist denn Bruno?«
»Minnas Hund«, antwortet Laura. »Der war krank und hat immer nur noch geschlafen und geschlafen, und eines Tages ist er nicht mehr aufgewacht. Minnas Mutter meinte, das war besser so, weil er so schlimme Schmerzen hatte.«
Robin nickt. »Ja. Genauso ist das. Genauso wie bei Bruno.«
Es regnet wieder, und es ist schon dunkel, als Robin die Wohnungsschlüssel auf die Küchenarbeitsplatte legt und sich ein großes Glas Wasser einschenkt. Sie trinkt das Wasser im Stehen an der Spüle, ohne das Licht einzuschalten, gefangen in einer geistesabwesenden Stimmung, die sie nicht recht abschütteln kann.
Das seltsame Gefühl befiel ihren Körper noch in der Praxis, bevor sie die Tür aufmachte und Laura hinausließ. Im Wartezimmer saß Lauras Tante Emmi, und nachdem die beiden Hand in Hand durch die Tür verschwunden waren, ging Robin zurück an ihren Tisch, um ihre Autoschlüssel zu holen.
Auf der Heimfahrt über die herbstnassen Straßen war sie beim rhythmischen Geräusch der Scheibenwischer völlig in Gedanken versunken. Sie rieselten auf sie herab, auf dieselbe unerbittliche Art wie der Nieselregen auf die Windschutzscheibe, erst sanft, dann immer heftiger, sie klopften leicht, aber fordernd an und weigerten sich, sie wieder in Ruhe zu lassen.
»Mach auf, Robin! Lass mich rein!«
Sie sieht Lukas’ Gesicht vor ihrem inneren Auge. Sein nasses langes blondes Haar. Die Kleider, die ihm am schlanken Körper klebten. Er klapperte vor Kälte mit den Zähnen, als er sich an ihr vorbei durch die Tür drückte. Seine blassen Arme waren nackt.
Damals hatte sie ihn ins Haus im Vråkören hineingelassen. Zum letzten Mal. Er ging durch die Zimmer und sammelte alles zusammen, was er tragen konnte. Zu Anfang hatte sie noch versucht zu protestieren, unbeholfen und matt, aber sie gab es bald auf. Sie wusste, dass es nichts helfen würde, dass sie nichts sagen konnte, was zu ihm durchgedrungen wäre. Er folgte einer anderen Stimme, einer Stimme, die nicht mal seine eigene war, aber trotzdem all seine Handlungen steuerte. Da verstummte sie. Stand nur schweigend an der Tür und lauschte den Geräuschen seiner Plünderung. Irgendetwas fiel zu Boden und zerbrach mit lautem Splittern. Sie wusste, dass er es kaum bemerkte. Er riss einfach weiter alles um, immer verzweifelter, sich immer weniger bewusst, was er hier eigentlich tat. Da wurde sie auf einmal wütend. Sie ging ins Schlafzimmer und fand ihn am Bücherregal. Eine Weile blieb sie dort stehen und betrachtete ihn, wie seine Hände einzelne Bände herauszogen und auf den Boden fallen ließen. Sie hob ein Buch hoch und betastete es eine Weile. Obwohl sie vor Wut zitterte, zwang sie ihre Stimme zur Ruhe.
»Sie haben es versteckt«, sagte sie schließlich, und er warf ihr einen raschen Blick zu.
Seine glasigen Augen wirkten geistesabwesend.
»Hm«, machte er.
»Sie haben das Schmuckkästchen versteckt nach dem letzten Mal. Für wie blöd hältst du sie eigentlich?«
Doch er hörte nicht auf zu suchen. Die Bücher plumpsten eins nach dem anderen auf den weichen hellgelben Teppich. Sie hätte am liebsten geweint. Da legte sie die Hände in den Nacken. Sie zitterten so stark, dass Robin den Verschluss kaum aufbekam, aber dann lag die Kette auf ihrer Handfläche, und sie schloss die Finger darum, bevor sie ihm die Hand hinstreckte.
»Hier! Nimm die! Wenn es denn wirklich so scheißwichtig ist. Vielleicht kriegst du ja was dafür.«
In dem Augenblick schien es fast, als wäre er kurz aufgewacht. Seine Hände hielten einen Moment inne. Er sah sie mit offenem Mund an, und sein schmales bleiches Gesicht glänzte feucht. Sie sahen sich schweigend an. Bruder und Schwester. Dann drängte er sich an ihr vorbei, blieb nur kurz stehen, um ihr die Kette aus der Hand zu reißen, und verschwand mit den Sachen, die er hatte mitnehmen können. Sie folgte ihm auf die Treppe und beobachtete, wie er mit langen Schritten die Auffahrt hinunterlief und in ein Auto sprang, das dort auf ihn wartete. Als der Wagen davongefahren war, wurde ihr bewusst, dass es gar nicht regnete. Dass es den ganzen Tag über nicht geregnet hatte. Dass seine Kleider schweißdurchtränkt gewesen sein mussten.
Robin reibt ihr Glas mit Spülmittel ein, spült es ab und stellt es ins Trockengestell, bevor sie das Licht im Wohnzimmer einschaltet, das sauber aufgeräumt, unberührt und einsam auf sie wartet. Sie weiß, dass es Lauras Frage war, die ihre Gedanken wieder zu Lukas gelenkt hat.
»Hast du schon mal einen Menschen sterben sehen?«
Ja, denkt sie. Ja, Laura, ich glaube, das habe ich. Es ist sogar möglich, dass ich einen Menschen getötet habe.
2. Kapitel
Zwei Tage nach der Sitzung mit Laura geht Robin auf den alten Müllberg neben dem neuen Hafen. Der Regen hat sich einen Tag freigenommen, und der Himmel ist hellblau. Die Sonne hat es bis jetzt kaum geschafft, sich über die Baumwipfel zu erheben, obwohl es schon auf acht Uhr zugeht.
Robin hat sich die langen, dunklen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und ihre Joggingsachen angezogen, wie immer, aber das Gefühl von Erwartung, das sich stechend und prickelnd in ihrem ganzen Körper ausbreitet, macht ihre Schritte leichter und ihre Atemzüge tiefer.
Mit dem Joggen hatte sie als Siebzehnjährige begonnen, atemlos dahinstolpernd, und mit weit aufgerissenen Augen in der Dunkelheit, vor der sie sonst eigentlich keine Angst hatte. Sie weiß noch, wie sie nach Schritten hinter sich lauschte, wie sie bei jedem Hundegebell zusammenzuckte und wie sie bei vorbeifahrenden Autos gleich in den Straßengraben auswich. Damals war sie wie ein gejagtes Tier, ein Hase, der mitten auf der Straße im Scheinwerferlicht stehen blieb und dann blind und verzweifelt weiter in den Lichtkegel hineinhoppelte, der ihm gleichzeitig den Weg wies und ihn blendete.
Jetzt, mit vierunddreißig Jahren, sind ihre Schritte zielstrebig und sicher, ihr Körper ist schlank, geschmeidig und stark, und ihre Ausdauer ist so groß, dass sie jederzeit an dem Halbmarathon teilnehmen könnte, den ein paar von ihren Kollegen aus der Klinik zum Vergnügen mitlaufen. Mittlerweile läuft ja jeder. Die Leute trainieren wie verrückt, verlegen sich auf die extremsten Spezialgebiete: Marathon, Eisklettern, Triathlon … doch Robin behält ihr Hobby für sich selbst. Sie nutzt ihre Sohlen auf den Waldwegen ab, weil es für sie der einzige Weg ist, sich ihre Konzentration und Ausgeglichenheit zu wahren in einem Job, der weniger stabilen Personen innerhalb eines Jahres einen Nervenzusammenbruch bescheren würde.
Von ihrer Wohnung in einem der am wenigsten exklusiven Stadtteile gehen die Joggingpfade tief in den nahe gelegenen Wald, ins Naturschutzgebiet, und führen bis zur Gemeindegrenze und ans Meer.
Sie atmet helle Wölkchen in den kühlen Herbstmorgen. Der Wald rundherum hat bereits seine Farben verloren. Der Sand knirscht unter ihren Füßen, während sie zwischen den grauen Baumstämmen dahinläuft. Die Espen mit ihren dünnen, entlaubten Ästen zeichnen ihr verflochtenes Netz aus Zweigen in den hellblauen Himmel.
Zwei Jogger, rot und grün gekleidet, ein großer, blonder Mann und eine kleinere, dunkelhaarige Frau, keuchen vorbei und nicken ihr zu, doch sie erwidert den Gruß nicht. Sie ballt vielmehr die Fäuste noch fester und beschleunigt ihre Schritte. Das kleine Fernglas in ihrer Jackentasche schlägt ihr gegen die Hüfte, und sie beißt die Zähne zusammen, als das Gelände steil ansteigt. Ihre pfeifenden Atemzüge füllen ihren Kopf, während sie sich nach oben auf die Kuppe kämpft. Dann entspannt sie sich und lässt ihre Schritte auf dem s-förmig geschwungenen Abhang hart auf den Boden trommeln. Sie läuft bergab, vorbei an dem schwarzen Teich, der von senkrechten Klippen umgeben ist, wahrscheinlich ein mit Wasser vollgelaufener Bombenkrater aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Wasser, das man zwischen den kerzengeraden Baumstämmen erkennen kann, ist so schwarz, dass es aussieht wie Tinte. Die spiegelglatte Oberfläche ist übersät mit gelbem Espenlaub. Es ist schön, aber sie wirft nur einen flüchtigen Seitenblick darauf. Sie läuft weiter, nimmt die letzte Kurve mit einem Sprint, bevor sie die Zielgerade erreicht, die direkt bis zum alten Müllberg führt.
Noch vor zwanzig Jahren war dieser grasbewachsene Hügel, den sie heute mit Milchsäure in den Oberschenkeln hinaufrennt, der größte Schuttabladeplatz der Stadt. Ende der Achtzigerjahre wurde die Deponie geschlossen, und der Abfall und der andere Schrott wurden mit einer Erdschicht bedeckt. An derselben Stelle erhebt sich heute eine mit Gras überwachsene Hügelkette mit mehr als vierhundert verschiedenen Pflanzenarten, fünfundsechzig Meter über dem Meeresspiegel. Sie kann sich noch an die Diskussionen in der Tagespresse vor zehn Jahren erinnern, inwiefern diese massive Umgestaltung und Sanierung wirklich nach allen Regeln der Kunst und des Umweltschutzes abgelaufen war, aber langfristig war es egal. Wenn man genug Geld hinlegt, kann man jede Mülldeponie der Welt zuschütten, und die Stadtbewohner konnten sich freuen über ein Erholungsgebiet mit richtigem grünem Flair, inspiriert von der alten, finnischen Kulturlandschaft. Ein paar Jahrzehnte später denkt keiner mehr daran, dass es jemals eine Mülldeponie gegeben hat. Sie war mit Gras und schönen Blumen bewachsen, und niemand redet groß von der stinkenden, dickflüssigen roten Brühe, die immer noch heraussickert und die Gräben neben den Joggingpfaden füllt.
Robin erreicht den Gipfel und bleibt stehen. Stützt sich auf ihre Oberschenkel und lässt den Kopf nach unten hängen. Ihre Lungen arbeiten wie verrückt, und es dauert eine gute Minute, bis ihr Puls so weit gesunken ist, dass sie sich aufrichten und den Blick über die Aussicht schweifen lassen kann.
Vom höchsten Punkt der Hügelkette kann sie bis zum Stadtkern sehen. Man hat ungefähr zehn große, runde Findlinge hier hingelegt, auf denen die kleinen Kinder herumklettern und -springen. Schmutziggrauer Nebel hängt über dem Flugplatz, in weiter Ferne am Horizont, wo die Flugzeuge mit regelmäßiger Präzision abheben und landen.
Ein Stückchen weiter links blinkt der Fernsehturm in Böle, von dem die öffentlich-rechtlichen Sender in Stadt und Land senden. Der Dom markiert das Stadtzentrum, aber das liegt ziemlich weit entfernt. Robin wohnt in Nordsjö, am Rande der Stadt, wo früher eine Halbinsel war, isoliert und abgelegen, bevor man irgendwann Ende der Sechzigerjahre eine Brücke baute, die Nordsjö mit dem Rest der Stadt verband. Dann zog der Hafen von Sumparn, knappe fünf Kilometer vom Zentrum entfernt, in diesen abgelegenen Stadtteil, wo es nur eine Mülldeponie und einen Golfplatz gab. Und auf einmal war der Stadtteil trotz seines dubiosen Rufs ein wichtiger Ort geworden.
Sie betrachtet eine Weile die Aussicht. Im Sommer kann man kaum glauben, dass sich dort unten eine Stadt ausbreitet. So grün. So zugewuchert von Bäumen und Natur ist sie dann, und danach kommt das Meer, das das Grün unterbricht, der Hafen mit seinen farbenfrohen Containern, blauen, roten, gelben, grünen, die wie Legosteine auf dem rostroten und dunkelgrauen Asphalt verteilt stehen. Die blauen und weißen Frachtkähne warten darauf, dass sie ihre heutige Ladung von den Fernlastern geliefert bekommen – die aus dieser Höhe eher an Spielzeugautos erinnern –, um anschließend zwischen den Inseln hinauszufahren, diesem ganzen unübersichtlichen Wirrwarr aus Klippen mit Krüppelkiefern auf dem rauen Felsrücken, Inseln, so weit das Auge reicht, und dazwischen der ungebrochene Horizont, das wogende Meer, das die Schiffe zwischen Finnland, Estland und Deutschland hin und her trägt … das alles kann sie von ihrem Aussichtspunkt sehen, an dem sie in Gesellschaft von ein paar frühmorgendlichen Spaziergängern steht, die atemlos die Aussicht kommentieren, aber das ist für sie nicht interessant. Was sie interessiert, liegt hinter ihrem Rücken, und sie dreht sich um, ostwärts, Richtung Sibbo, wo sie nicht mehr sehen kann als ein beinahe ununterbrochenes Band aus Wäldern.
Dort liegt die alte Gemeindegrenze, die erst vor ein paar Jahren verlegt wurde und einen beträchtlichen Teil der ländlichen Nachbargemeinde schluckte. Sie ist verblüfft, dass es so unberührt aussieht. So unschuldig. Als würde sich dort unten überhaupt nichts verbergen, unter diesen schützenden Baumkronen. Sie atmet aus. Holt das Fernglas aus der Tasche. Sucht eine Weile, bevor sie die Ziegeldächer findet, die durch die Kiefernzweige schimmern. Sie schaut genauer hin, und plötzlich rückt alles so nah, es kommt ihr vor, als würde sie durch Zeit und Raum in einen Garten versetzt werden, an den sie sich noch so gut erinnern kann, ein weißes Haus mit einem roten Dach, ein Mädchen und ein Junge, die um die Garage rennen, immer auf den Beinen, immer auf der Flucht, und dann lässt sie das Fernglas sinken. Die roten Dächer verschwinden. Werden wieder vom Wald verschlungen. Sie schluckt, hebt den Feldstecher erneut an die Augen und betrachtet sie weiter.
Später ruft sie Henrika an. Während das Freizeichen ertönt, überlegt sie es sich anders und will schon wieder auflegen, doch dann überlegt sie es sich noch einmal anders, und so geht es ein paar Mal hin und her, aber sie unterdrückt letztlich den Impuls, den Anruf wirklich abzubrechen. Die Stimme, die sich schließlich meldet, klingt spröde und heiser, als wäre ihre Mutter gerade erst aufgewacht, obwohl es sechs Uhr abends ist.
»Hallo?«
Robin macht den Mund auf. Einen Augenblick glaubt sie, dass ihre Stimme überhaupt nicht funktionieren wird, und sie muss unvermittelt an Lauras Stummheit denken, wie die Sprache das Mädchen unfreiwillig verlassen hatte und wie schwer es gewesen war, sie wieder zurückzulocken.
»Hallo? Wer ist da?«, fragt Henrika, und Robin befeuchtet sich die Lippen mit der Zunge.
»Hallo, Mama. Ich bin’s. Stör ich grade?«
Schweigen. Atemzüge in der Leitung. Ein Rascheln, als würde Henrika sich den Hörer fester ans Ohr drücken.
»Robin, bist du das?«
Robin stößt mit einem lang gezogenen Seufzer die Luft aus den Lungen. Wer sollte es denn sonst sein? Von den zwei Kindern, die Henrika gehabt hat, ruft heute nur noch Robin an.
»Ja, Mama. Ich bin’s. Wie geht’s dir?«
Nach dem Telefonat sitzt Robin eine Weile mit dem Telefon in der Hand auf dem Sofa. Ihr Blick ruht auf dem Glastisch vor dem schwarzen Fernseher, während sie das Telefonat mit ihrer Mutter noch einmal Revue passieren lässt. Sie hatte so alt geklungen. Als wäre sie in den vergangenen zwölf Monaten um mindestens zehn Lebensjahre gealtert. Sie sprechen ein paar Mal pro Jahr, aber an diesem Tag ruft Robin grundsätzlich an. Immer am gleichen Datum. An dem Tag, an dem Lukas starb, siebzehn Jahre ist das mittlerweile her. Diesmal kam es ihr so vor, als hätte Henrika es vergessen. Sie wirkte verwirrt, vielleicht sogar betrunken, aber da war noch etwas anderes, worauf Robin nicht recht den Finger legen konnte. Sie beißt sich auf die Lippen, während sie überlegt. Dann wird es ihr plötzlich klar, und ihre Hand, die am Telefon herumgespielt hat, erstarrt. Ihre Mutter hatte sich verängstigt angehört. Sie hatte versucht, es zu verbergen. Die Stimme neutral zu halten. Doch Robin kannte diese Tonlage. Die Lügen, die sich darunter versteckten. Glaubte Henrika wirklich, dass Robin es vergessen hatte? Meinte sie, Robin so leicht hinters Licht führen zu können?
Robin sieht das weiße Haus vor ihrem inneren Auge. Auf einmal ist sie in den Flur mit dem dicken Teppich versetzt. Sahnefarben und weich schluckte er jedes Geräusch schleichender Schritte, und Robin war gut im Anschleichen. Stimmen, die sich Mühe gaben, leise zu bleiben, hatten sie vom Wohnzimmer zum Schlafzimmer gelockt. Sie hatte Heimlichkeiten gewittert, und sie konnte die beiden sehen, ihn und sie.
Er saß mit gesenktem Kopf auf dem Bett. Sein langes, blondgelocktes Haar verbarg sein Gesicht. Henrika saß vor ihm auf dem Boden und hielt seine Hände fest umklammert. Lukas trug ein weißes T-Shirt, seine schmalen Schultern zuckten. Robin hielt den Atem an. Sie wollte zu ihm gehen und musste die Lippen zusammenpressen, um sich nicht von seinem Weinen anstecken zu lassen. Während er heiser schluchzte, drückte sie sich an die Wand, um nicht entdeckt zu werden. Sie hatte das Gefühl, dass sie da etwas Verbotenes beobachtete und dass sie die Sache noch schlimmer machen würde, wenn sie sich zu erkennen gab. Das Zimmer war kaum beleuchtet. Kleine Wandlampen aus Glas mit Blumenmuster. Helle, lachsrosa Tapeten, perfekt abgestimmt auf den seidenen Bettüberwurf und die Teppiche. Henrika strich Lukas über Haar und Wangen. Hob sein Gesicht mit der Hand an.
»Ich will nicht, Mama«, sagte er. Seine Stimme war brüchig und klang verschleimt.
Sie beruhigte ihn, als wäre er ein kleines Kind, obwohl er bereits sechzehn war.
»Pscht, mein Liebling, pscht, pscht.«
Er verbarg die Augen mit einer Hand, und sie nahm seinen Kopf in den Arm. Wiegte ihn vor und zurück.
Robin wusste nicht, was sie denken sollte. Sie konnte sich nicht erinnern, wann sie ihren Bruder zum letzten Mal hatte weinen sehen. Jedenfalls nicht, seitdem sie sich als Kinder geprügelt hatten oder auf dem kiesbestreuten Hof irgendwelche wilden Spiele mit dem Fahrrad aufgeführt hatten. Henrika tat nichts, um ihn zum Schweigen zu bringen. Sie wiegte ihn nur weiter in den Armen, und das Letzte, was Robin hörte, bevor sie wieder davonschlich, war Henrikas wiederholtes »Pscht, mein Liebling, pscht, pscht.«
Zwei Tage später war Lukas fort. Er war in die USA geflogen, um eine Weile bei ihrem Vater Antero zu wohnen.
Antero war nach der Scheidung nach Kalifornien gezogen, damals war Robin drei. Lukas war fünf. Zwei Jahre später hatte Henrika wieder geheiratet, Olof Löfvenbergh, und Antero, der sich niemals sonderlich für Robin oder Lukas interessiert hatte, war in den hintersten Winkeln ihrer Erinnerung verschwunden. Ein paar Jahre machte er noch durch eine Geburtstagskarte, ein bisschen Geld zu Weihnachten auf sich aufmerksam, dann hörte auch das auf.
Kurz nachdem Henrika Olof kennengelernt hatte, zogen sie zusammen in seine Villa im Wald, in die neue Siedlung, die zu dieser Zeit noch nicht mehr war als eine Handvoll Einfamilienhäuser und aufgebuddelte Sandhaufen, die später verkauft werden sollten. Die Fichten, die ihre dichten Zweige zwischen den Häusern schwanken ließen, trennten die Häusern voneinander und verhinderten jegliche Einblicke. Die Gegend war wie geschaffen für Abenteuer und Geheimnisse, und als Robin und Lukas zum ersten Mal auf der Ausfahrt aus dem Auto stiegen, waren sie ganz stumm und brachten den Mund nicht mehr zu, während sie die Baumwipfel bestaunten, die hoch über ihren Köpfen aufragten.
Olof war ein Gründertyp. Er hatte sein erstes Geld als Immobilienmakler für die Firma seines Vaters verdient. Wie sich herausstellte, war er der geborene Verkäufer. Die Provisionen stiegen, und nachdem er ausreichend Startkapital zusammengekratzt hatte, nahm er einen kleinen Kredit auf und kaufte ein paar halbfertige Häuser auf, die von ihren bis über beide Ohren verschuldeten Eigentümern aufgegeben werden mussten. Mithilfe seines Kapitals stellte er die Häuser fertig, und es gelang ihm, sie zu einem so guten Preis zu verkaufen, dass er sich mit mehreren zigtausend Gewinn an sein nächstes Projekt machen konnte. Danach war er schuldenfrei und damit auch bereit, größere Risiken einzugehen. Er erarbeitete sich rasch ein Vermögen, das ihn innerhalb von sieben Jahren auf die Liste der hundert bestverdienenden Privatpersonen Finnlands brachte. Doch Olof Löfvenbergh war kein gewöhnlicher Unternehmer. Er war ein Visionär. Nach und nach begann er, unerschlossenes Land in Hauptstadtnähe zu kaufen und die Häuser selbst bauen zu lassen. Das stellte sich langfristig als viel gewinnbringender heraus, weil er selbst über die Materialkosten bestimmte, und zu diesem Zeitpunkt wusste er, wie man gewisse Bestimmungen unterlaufen und von wo man die billigsten Arbeitskräfte importieren konnte. Neun Jahre nachdem er als privater Unternehmer begonnen hatte, hatte er ein zehn Hektar großes Gebiet in der Gemeinde gekauft, die an Helsingfors angrenzte. Man schrieb in den Zeitungen darüber, weil er bereit gewesen war, einen ungewöhnlich hohen Preis dafür zu zahlen – gerade wenn man sich vor Augen hielt, dass das eigentlich alles nur wertlose Waldgrundstücke waren. Und dieser Wald warf im Grunde nicht mal richtiges Nutzholz ab, so zugewuchert und verwachsen und steinig war er. Man hatte ihn ausgelacht. Er bezahle dafür, dass die Krähen den Blick aufs Meer genießen konnten, sagte man.
Ein paar Jahre später lachte keiner mehr über Olof Löfvenbergh. Die Stadt hatte sich in Richtung Osten ausgedehnt, und schon bald war Olofs wertloses Waldgrundstück mit Meerblick eine der begehrtesten Wohngegenden, in die die neureichen Familien mit kleinen Kindern zogen, wenn sie dem Lärm und den Abgasen der Großstadt entfliehen wollten, um stattdessen in luxuriösen Landhäusern zu wohnen, keine halbe Stunde Autofahrt vom Stadtzentrum entfernt. Olof parzellierte und verkaufte, und als er damit fertig war, lag er auf Platz 25 in der Rangliste der reichsten Finnen. Doch schon bald sollte sich herausstellen, dass Olof unersättlich war. Soviel er auch hatte, er wollte immer noch mehr, und Olof brachte seine Henrika mit den zwei Bonuskindern in die Gegend an der Gemeindegrenze, und dort rannten die beiden vergnügt quietschend zum Strand hinunter, um aufs Meer zu schauen, während hinter ihnen die Autotüren zuschlugen, mit einem dumpfen Laut, der vom Wind fortgetragen wurde und den Kiefernwald seufzen ließ.
3. Kapitel
Der Vråkören liegt auf einer Landzunge, die früher einmal eine Insel gewesen ist. Im Laufe der Jahre hat die Landhebung sie ans Festland angeschlossen, aber der Boden zu beiden Seiten der Straße, die in die Gegend führt, ist immer noch sumpfig und feucht.
In den letzten zehn Jahren ist der zugewucherte Wald, der die Gegend früher beherrschte, größtenteils verschwunden und die Fläche bebaut worden. Die Häuser stehen auf Grundstücken, die durch niedrige Holzzäune voneinander getrennt sind, welche wiederum farblich auf das abgestimmt sind, was sie einzäunen. Die Abstände zwischen den Häusern sind zwar groß genug, um einem das Gefühl von Ellbogenfreiheit zu geben, aber trotzdem noch nah genug, um sich nicht einsam fühlen zu müssen. Das Gelände ist immer noch leicht hügelig, und die unterschiedliche Höhe der Hügel ermöglicht den meisten einen Blick aufs Meer. Die Straßen sind beleuchtet und haben Namen mit maritimem Charakter: Schotgasse, Kapitänsbogen, Relingsweg, Steuermannsstieg, Stromlinie, Matrosenstieg …
Robin fährt langsam über die gewundenen Straßen. Nicht mal wenn sie wollte, könnte sie schnell fahren. Die Fahrbahnhindernisse zwingen sie in regelmäßigen Abständen zum Bremsen, für den Fall, dass die scharfen Kurven ihre Geschwindigkeit noch nicht genug gesenkt haben. Die massiven Steinschlösser türmen sich auf der linken Seite über ihr auf. Sie starren mit ihren großen dunklen Panoramafenstern übers Meer, das rechts von der Straße liegt. Die Rasenflächen sind penibel gepflegt. Die ganz Kreativen haben die Natur des Schärengartens zu einem Teil ihrer künstlichen Gartenlandschaft gemacht. Die Klippen, die zwischen den Grünflächen hervorleuchten, sind blitzblank geputzt und von allem gereinigt worden außer Moos – als hätte man den Fels gescheuert, gewaschen und sterilisiert. Alles, was das Auge stören könnte, ist entfernt worden. Das wilde Wacholdergestrüpp, das in den Felsspalten wächst, ist zurückgestutzt und zu perfekten Speerspitzen getrimmt worden.
Die Architektur variiert. Eingeklemmt zwischen den Klippen stehen minimalistisch anmutende, weiße, würfelförmige Häuser, die aussehen wie Pappkartons mit runden Bullaugen. Die Strandgrundstücke werden von pompösen herrschaftlichen Villen dominiert, die ein eher traditionelles Oberschichtengepräge tragen. An der schönsten Wegbiegung, die direkt am Strand vorbeiführt, hat sich der Eigentümer offenbar gedacht, wenn er für die Aussicht schon bezahlen muss, dann sollte er auch als Einziger ein Recht darauf haben, sie zu genießen. An der Straßenseite wurde ein hoher Zaun errichtet, der fast jeden Einblick unmöglich macht, aber stellenweise wurden Lücken gelassen, sodass jeder, der hier vorbeikommt, irgendwie doch noch mitbekommt, wie herrlich es die Leute auf der anderen Seite des Zaunes haben. Robin muss grinsen, als sie an dem Zaun mit den Gucklöchern vorbeifährt. Sie bemerkt einen kleinen Pfad, der nach unten führt, fast bis zum Schilfgürtel am Ufer, und an einer Art Aussichtsplatz endet, der groß genug ist, um sich mit dem Auto dort hinzustellen. Dann beschreibt die Straße eine Kurve, und Robin muss das Bremspedal durchtreten, um nicht das ältere Paar niederzumähen, das dort seine zwei kleinen weißen Terrier Gassi führt. Sie werfen ihr giftige Blicke zu, und Robins Puls rast, als sie weiterfährt.
Auf dem letzten Straßenstück werden die weißen Häuser von hellrosafarbenen, blauen und gelben abgelöst. Im Vorgarten hat man hier römische Götterskulpturen stehen, Freiheitsstatuen, Springbrunnen, Whirlpools, Teiche mit Seerosen, kleine Tennisplätze und große Trampoline für die Kinder. Manche von den Häusern haben Erker und Zinnen, nach dem Vorbild der windgepeitschten, halb verfallenen Herrenhäuser auf den Schäreninseln. Bei fast allen parken mindestens zwei Autos auf dem kleinen Vorhof, der meistens mit irgendeiner ausgeklügelten Außenbeleuchtung ausgestattet ist, um die winterliche Dunkelheit und das damit verbundene Sternenlicht auf sichere Distanz zu halten. Zwischen den Siedlungen hat man Abstand gelassen, dort breitet sich das Sumpfland aus und atmet Nebelschwaden.
Robin kann sich noch an die Herbstabende ihrer Kindheit erinnern. Der Nebel schwebte zwischen den Hügeln wie Milch, wie das Meer, das dort früher einmal wogte. An ihrem Strand lagen zwei Bootswracke, die Überreste alter Segelboote, die man versenkt und zum Verwittern hatte liegen lassen, keine dreißig Meter vom Strand entfernt. Als sie damals versenkt wurden, mussten sie ein ganzes Stück weiter vom Ufer entfernt gewesen sein. Aber als sich das Meer langsam zurückzog, stiegen die Wracks allmählich aus ihrem wassergefüllten Grab hoch, wie ein Memorandum, dass die Zeit manchmal auch enthüllen kann, was man schon für begraben hielt. Robin fürchtete sich damals vor den Wracks, wenn sie sich in der Dämmerung vor der hellblauen Wasseroberfläche abzeichneten. Sie sahen aus wie die Skelette von gestrandeten Walen. Sie sind immer noch da, eine Kuriosität, die der Aussicht aus den Wohnzimmern eine etwas bizarre Note verleiht. Etwas, worüber man reden kann, um das Eis zu brechen, wenn die Gäste auf den italienischen Ledersofas Platz genommen haben.
Wo keine Bebauung und kein Sumpfland ist, ist Wald. Es ist kein schöner Wald, und auch kein besonders praktischer. Er ist fast genauso zugewuchert und verwachsen wie damals, als Olof Löfvenbergh beschloss, ihn aufzukaufen. In diesem Wald gibt es nichts anderes als bloßes Gelände. Man kann keine Beeren pflücken. Keine Pilze sammeln. Er steht da nur, weil man irgendwann entschieden hat, dass er da stehen bleiben darf. Im Übrigen schützt er sogar ein wenig vor dem Lärm der Landstraße. Er schirmt ab, signalisiert, dass die Welt auf Abstand gehalten werden soll, und schafft so die perfekte Illusion. Niemand würde glauben, dass man sich hier in der Landeshauptstadt befindet. Wenn man mitten in diesem Wald steht und sich umschaut, kann einem sogar ein bisschen mulmig werden. Er mag ja nutzlos sein, aber dicht ist er auf jeden Fall. Und dunkel. Manchmal wirkt er geradezu undurchdringlich. Es geschieht nicht selten, dass man seine Schritte beschleunigt, um schneller wieder herauszukommen, wenn man an einem eiskalten, rauen Abend allein den Hund ausführt, kurz bevor der Schnee kommt, der alles ein bisschen heller macht.
Als Robin das Wohngebiet verlässt, fährt sie die Hauptstraße weiter entlang und erreicht den Strand. Dort befindet sich der Kaufladen der Siedlung. Er gehört der alten Großhändlerdynastie Vinqvist und lag früher auf einer der nahe gelegenen Inseln, Tallmaran. Doch als der Schärengarten immer leerer wurde und die einst so lebendige Inselgemeinde auf ein paar Sommerhäuser zusammenschmolz, die langsam vor sich hin verwitterten, verlegten die Vinqvists den Laden kurzerhand aufs Festland. Als die Wohnsiedlung sich zu einem Tummelplatz der Reichen entwickelte, gab es keinen mehr, der das Wort »Wucherpreise« in den Mund genommen hätte, wenn er durch die Regalreihen ging und das einfallslose Angebot musterte. Robin stellt ihr Auto ab und geht hinunter zur Anlegestelle mit der Tanksäule, an der die hartnäckigsten Motorbootenthusiasten der Gegend noch so spät im Herbst den Tank füllen können, ohne ihn vom Boot loszumachen.
Es ist ein stiller, klarer Abend. Das Wasser liegt glatt und blank zwischen den Schären, und die untergehende Sonne gibt einen warmen Schein ab, der die Farbe der Klippen ins Rote spielen lässt. Die Zweige der Birken am Strand leuchten orangebraun vor grauem Granit, und Robin betritt vorsichtig den Steg, der vom Raureif ein wenig glatt ist. Ihre Schuhsohlen greifen auf dem Eis, das das Holz bedeckt, und sie geht bis zum vordersten Punkt und bleibt stehen.
Sie hätte gedacht, dass es schwer sein würde, hierher zurückzukommen. Sie hat diesen Ort zwölf Jahre lang gemieden, war fest entschlossen, ihn nie wieder aufzusuchen, auch wenn sie manchmal eine gewisse Sehnsucht gespürt hatte. Doch den Ort, den sie aus ihrer Kindheit in Erinnerung hat, gibt es so nicht mehr. Er hat sich derart verändert, ist so gezähmt und herausgeputzt, dass sie ihn kaum wiedererkennt. Sie hatte immer befürchtet, von einem erstickenden Panikgefühl befallen zu werden, sobald sie die kleine Brücke über den Kanal überquerte, aber es war ausgeblieben. Stattdessen kam es ihr eher vor, als würde sie einem unangenehmen alten Bekannten wiederbegegnen und feststellen, dass man durch die Jahre, die seit der letzten Begegnung vergangen sind, genug Abstand gewonnen hat, um ihn mit einem neutralen Nicken grüßen zu können. Es gab einfach nichts Altes, zu dem sie hätte zurückkehren können, weil alles Alte durch Neues ersetzt worden war.
Ohne ihren Platz zu verlassen, dreht sie sich um hundertachtzig Grad und ist wider Willen beeindruckt von dem, was sie sieht. Als sie klein war, gab es in der Gegend drei Anlegestege und eine Handvoll Häuser. Jetzt ist die ganze Bucht in einen Freizeithafen verwandelt worden, der Hunderten von Booten Platz bietet. Die Hälfte von ihnen liegt noch im Wasser und wartet darauf, an Land geholt zu werden, bevor sich das Eis übers Meer legt. Ein nicht unbeträchtlicher Teil von ihnen sind kleine schwimmende Häuser. Luxusjachten, auf denen genug Platz ist, dass eine ganze Familie darauf wohnen kann, ohne sich während der Ferienreise nach Monaco auf die Nerven zu gehen.
Hinter den Bootsstegen sieht Robin die neuesten Neubauten, in denen man sich die teuersten Quadratmeter der Gegend kaufen kann, in Form kleiner Wohnungen mit Meeresblick in drei Richtungen. Bevor diese rot-weißen Nistkästen mit dem steilen schwarzen Dach gebaut wurden, hatte an dieser Stelle ein beliebtes Restaurant gestanden. Die besten Burger der Stadt. Bier, Kaffee und Pizza. Die Jugendlichen aus der Umgebung kamen genauso hierher wie die Autofahrer von weit weg, die aus den Städten kamen, die schon näher an der russischen Grenze lagen. Als die Gegend durch gezielte Baumaßnahmen aufgewertet werden sollte, stellte das Restaurant seine Tätigkeit ein. Es wurde durch eine moderne kleine Bar ersetzt, die lockend mit ihren Neonlichtern blinkt. Meistens ist sie leer.
Robin kann sich noch an die fettigen Pommes erinnern, die Lukas und sie sich im Winter immer dort kauften, nachdem sie einen langen Spaziergang auf dem zugefrorenen Meer gemacht hatten. Wie sie zwischen den anderen Wintersportlern gesessen und sich lachend die Münder vollgestopft hatten. Jetzt ist es ungastlich geworden, die einheimischen Bewohner haben die Flucht ergriffen. Überall hängen Schilder, die verkünden, dass man sich auf Privatgrund bewegt, der mit Kameras überwacht wird.
Während Robin in Gedanken versunken dasteht und in der kühlen Luft zittert, zerreißt ein Motorengeräusch die Stille. Ein kleines graues Aluminiumboot taucht im Sund auf. Der Mann am Steuer trägt einen grünen Regenmantel mit hochgeklappter Kapuze, die er sich so tief ins Gesicht gezogen hat, dass man es kaum erkennen kann. Er ist ungefähr in ihrem Alter, und sie weicht seinem Blick aus, als er näher kommt. Am Steg hält er an und füllt einen Benzintank, dann verschwindet er in den Laden. Auf der Terrasse davor sitzen ein paar fettleibige Männer mittleren Alters und trinken Kaffee. Rauchgeruch hängt in der Luft und setzt sich in Robins Kleidung fest, sodass sie ihn immer noch wahrnimmt, als sie sich wieder ins Auto setzt, um zum Haus ihrer Mutter zu fahren.
Der Rauchgeruch wird stärker, als sie die Tür aufmacht und in der Auffahrt aussteigt. Sie schaut sich um. Bläulicher Dunst füllt die Luft, und sie atmet den Geruch durch die Nase ein. Laub, vielleicht auch Zweige, alter Müll, den jemand mit Spiritus angezündet hat. Nichts Außergewöhnliches um diese Jahreszeit.
Das Haus, das mit seinen zweihundert Quadratmetern einmal das größte in der Gegend war, sieht genauso aus, wie sie es in Erinnerung hat. Es steht ganz oben auf einem Hügel, der im Winter fast unzugänglich wird, wenn er mit einer Eisschicht bedeckt ist. Robin und Lukas rodelten immer mit ihren roten Schlitten hinunter, obwohl das streng verboten und lebensgefährlich war, wegen des Straßenverkehrs. Aber was für ein Straßenverkehr? Robin und Lukas konnten näher kommende Autos schon aus weiter Ferne sehen, und außerdem war nur äußerst selten jemand anders als Hans Laitinen da, der hin und wieder auf Überraschungsbesuch vorbeikam. Wenn sein silberfarbener BMW auf den Hof fuhr, erstarrte Lukas immer. Er versetzte Robin einen Schlag mit der behandschuhten Faust und zischte ihr zu: »Komm!« Und dann liefen sie zusammen hinters Haus und duckten sich hinter den Felsen, die das Grundstück vom Wald trennten. In diesen Momenten hatte Lukas immer einen angespannten Gesichtsausdruck, und sie saßen hinter dem Felsen, bis der Schnee unter ihnen schmolz und sie am ganzen Körper froren. Doch Robin wagte nicht, etwas zu ihrem Bruder zu sagen. Einmal blieben sie so lange dort sitzen, bis Lukas sich in die Hose pinkelte. Er begann zu weinen, als sich die gelbe Pfütze unter ihm ausbreitete, während der Himmel langsam dunkler wurde. Sie hatten nicht gehört, wie Hans Laitinen sein Auto anließ, und bevor sie das nicht hörten, konnten sie nicht zurück.
Robin geht zur Tür und drückt auf die Klinke. Zu ihrer Überraschung ist abgesperrt, und sie runzelt die Stirn. Soweit sie sich erinnern kann, gab es in ihrer Kindheit kaum jemand, der seine Tür absperrte. Das war einfach unnötig. Fremde verirrten sich nur selten in diese Gegend.
Sie klingelt an der Tür und hört die Big-Ben-Glockentöne durch den Flur hallen. Im Haus ist es dunkel, aber das Auto ihrer Mutter steht schief geparkt in der Garage, deren Tor weit offen steht.
Robin wartet eine Weile, dann geht sie in den Garten hinter dem Haus. Der Rauchgeruch wird stärker, und jetzt kann sie auch die dunkelgrauen Rauchschwaden sehen, die um die Hausecke geweht werden. Sie beschleunigt ihre Schritte, dann bleibt sie wie angewurzelt stehen. Im Garten steht ihre Mutter, Henrika, vor einem heftig lodernden Holzstoß, der einen roten Schein über ihr Gesicht tanzen lässt. Sie steht gefährlich nahe an den wild flackernden Flammen. Robin eilt zu ihr und fasst sie am Arm, um sie zurückzuziehen, und im nächsten Augenblick krachen tatsächlich die Reste des Stoßes zusammen und schleudern Funken in den immer dunkler werdenden Himmel.
Henrika schreit auf und stößt Robin von sich, doch die hält ihre Mutter fest an den Armen. Schließlich hört Henrika auf, gegen sie anzukämpfen, und starrt Robin an. Erst sind ihre Augen noch in wilder Panik aufgerissen, aber dann sieht man ihrem Gesicht an, wie das Wiedererkennen einsetzt, und sie drückt Robin mit einem lauten Seufzer an sich und schließt sie fest in die Arme.
»Was hast du denn da draußen gemacht?«, fragt Robin ihre Mutter bestürzt, als sie etwas später in der dunkel gebeizten Küche zusammen auf den hohen Barhockern am Marmortresen sitzen.
Im Großen und Ganzen sieht alles so aus, wie Robin es in Erinnerung hat, aber es wirkt jetzt kleiner. Gedrängter. Heutzutage wollen die Leute luftige Räume mit hoher Decke, doch das Haus ihrer Mutter wurde nach den Grundsätzen einer anderen, eher auf Gemütlichkeit abzielenden Ästhetik erbaut, und seitdem ist es nicht mehr verändert worden.
»Ach … ich hab bloß ein bisschen Abfall verbrannt … genau wie alle anderen im Herbst. Jetzt, wo es nass ist.«
»Du hattest Glück, dass ich gerade gekommen bin! Du hättest das ganze Haus abbrennen können, auf jeden Fall hättest du dich selbst verletzen können«, sagt Robin.
Sie hatte ihre Mutter mehr oder weniger aus dem Garten von ihrer Feuerstelle wegziehen müssen, sie durch den Flur in die Küche führen und auf einen Stuhl drücken. Henrika wollte das Feuer nicht unbewacht lassen, sagte sie, doch Robin blieb hart.
Henrika schaut sich um und schnaubt.
»Das Haus? Seit wann scherst du dich denn um dieses Haus?«
Sie rutscht von ihrem Hocker herunter und holt eine Flasche Wodka aus dem Schrank unter der Spüle. Aus der Geschirrspülmaschine nimmt sie zwei Schnapsgläser, die sie bis obenhin vollgießt. Das eine schiebt sie Robin über den schwarzen Tresen zu, das andere leert sie in einem Zug, um sich gleich darauf nachzuschenken. Robin ahnt, dass das heute nicht Henrikas erster Schnaps ist.
Sie nippt am Wodka. Er sticht auf der Zunge und zieht ihr alles im Mund zusammen. Nach ein paar vorsichtigen Schlucken breitet sich behagliche Wärme im Körper aus.
Henrika setzt sich gegenüber von Robin hin und stützt die Ellbogen auf den Tisch. Sie lässt den Kopf hängen und schaut in ihr Glas.
»Du scherst dich um dieses Haus ungefähr genauso viel, wie du dich um mich scherst«, murmelt sie, und dann sieht sie Robin wieder an.
Die weicht ihrem Blick aus und schaut stattdessen ins Wohnzimmer, wo die dunkle Ledersitzgruppe sich vor dem Panoramafenster mit Meerblick abzeichnet. Sie muss einen Seufzer unterdrücken. Immer dieser ewige Meerblick. Was kauft man sich eigentlich davon? Es ist doch bloß Wasser. Und zugig ist es obendrein. Der Wind kommt oft vom Meer, und dann heult er und schlägt gegen die großen Fensterscheiben. Wenn man nicht gut genug isoliert, ist es schweinekalt im Wohnzimmer. Das Feuer im offenen Kamin knackt und knistert. Sie wirft einen raschen Blick auf Henrika.
»Wenn ich mich nicht um dich scheren würde, wäre ich wohl nicht hier«, sagt Robin, aber sie hört selbst, wie falsch diese Worte klingen.
In den letzten fünf Jahren ist der Kontakt zwischen Mutter und Tochter alles andere als eng und warm. Robin hat pflichtschuldigst angerufen, dabei aber durchaus gemerkt, dass die Abstände zwischen den Gesprächen immer länger ausfielen. Die sporadischen Treffen in der Hauptstadt ein paar Mal pro Jahr fanden im Café oder bei einem schnellen Abendessen im Restaurant statt. Als Robin mit achtundzwanzig nach Rovaniemi zog, um dort ein Praktikum in der psychiatrischen Klinik zu absolvieren, hatte Henrika ihr vom Bahnsteig aus hinterhergewinkt, und näher war Henrika der einsamen Stadt im Norden nicht mehr gekommen. Dort, im entlegensten aller Käffer, geriet Robin in eine schlechte Beziehung, die ihr jede Lebenslust und Energie aussaugte. Sie hatte sich geschämt. Und nicht gewollt, dass ihre Mutter sah, wie sie sich zu leben zwang. Als sie sich ein paar Jahre später endlich freigemacht hatte und vor vier Monaten in die Hauptstadt zurückgezogen war, angelockt von einem Jobangebot, das sie nicht hatte ablehnen können, fand sie es aus irgendeinem Grund schwierig, den Kontakt zu Henrika wieder aufzunehmen. Sie hatte angerufen, das schon, doch Henrika wiederum rief von sich aus nie an. Die Kommunikation ging von Tochter zu Mutter, nie umgekehrt. Tatsache war, dass Henrika sie diesmal auch nicht gebeten hatte, zu ihr zu kommen. Im Gegenteil, sie hatte versichert, dass Robin nicht zu kommen brauchte. Doch Robin wusste aus Erfahrung, je mehr ihre Mutter versuchte, sie fernzuhalten, umso schlechter ging es ihr. Sie war ja genauso. Sie hatte alles getan, um zu verheimlichen, dass Kalevi sie in Rovaniemi in ihrer Wohnung herumschubste, wenn er gerade Lust dazu hatte, und hatte immer wieder behauptet, es gebe keinen Grund, warum Henrika sie besuchen solle.
Henrika sitzt ganz still da. Die Dunkelheit zieht immer schneller herauf. Dann schnieft sie einmal, und Robin schaut sie an.
»Was war das denn für Abfall, den du da verbrannt hast?«, fragt Robin, und Henrika schaut weg.
Sie schüttelt den Kopf und zuckt mit den Schultern.
»Bloß Abfall. Laub, das ich zusammengerecht habe, Zweige, ein paar Sachen, die schon viel zu lange hier rumgelegen haben. Abfall eben!«
Ihr schriller, ausweichender Ton kann Robin nicht überzeugen, im Gegenteil. Sie betrachtet das eingefallene Gesicht ihrer Mutter eine Weile und versucht, ihren unsteten Blick festzuhalten, denn sie weiß, dass Henrika sie anlügt. Das macht sie gereizt. Als ob ihre Mutter nicht wüsste, dass Robin es im Job Tag für Tag mit Lügen zu tun hat. Lügende Eltern, Kinder, die mit Ausflüchten kommen und sich Märchen ausdenken … Auf einmal schaut Henrika ihr geradewegs in die Augen.
»Warum bist du eigentlich hier, Robin?«
Robin runzelt die Stirn und schüttelt verständnislos den Kopf.
»Wie meinst du das? Ich hab doch gesagt, dass ich kommen würde. Weißt du das nicht mehr?«
Henrika wendet den Blick ab und befeuchtet die Lippen mit der Zungenspitze.
»Ja … natürlich weiß ich das noch, aber … du hast schon so oft gesagt, dass du kommst, und du bist nie gekommen. Also … warum jetzt?«
»Du klangst so seltsam am Telefon. So … geistesabwesend. Ich hab mir Sorgen gemacht. Und offenbar ja mit Grund. Es geht dir ja sichtlich nicht gut!«, erwidert Robin.
Henrika schnaubt und schüttelt den Kopf. Das rotblonde lange Haar, das ihr Gesicht einrahmt, schwingt von einer Seite zur andern.
»Das hat dich früher ja auch nicht davon abgehalten, hier wegzubleiben, würd ich mal sagen«, sagt Henrika und wirft Robin einen schnellen freudlosen Blick zu.
Sie bleiben eine Weile stumm sitzen. Henrika wiegt sich vor und zurück. Ihr Mund zittert. Wieder befeuchtet die Zunge ihre Lippen. Dann macht sie den Mund auf und holt lang und geräuschvoll Luft, bevor sie überraschend anfängt zu reden, fast wie mit sich selbst.
»Ich hatte an dem Abend was getrunken. Ich hab mich einsam gefühlt. Paranoid. Und dann war es auf einmal da, überall in den Zeitungen. Dass er rausgekommen ist«, sagt Henrika.
Robin erstarrt. Sie starrt ihre Mutter an. Er? Rausgekommen? Was meint sie damit? Doch bevor sie weitere Fragen stellen kann, schaut Henrika sie an und senkt die Stimme.
»Beziehungsweise – eben nicht rausgekommen. Ausgebrochen ist er! Und jetzt ist er auf freiem Fuß!«, sagt sie fast im Flüsterton.
Robin atmet aus. Schüttelt den Kopf. »Wovon redest du? Wer?«
Ihre Mutter wirkt ungeduldig. »Mein Gott, lebst du eigentlich hinterm Mond?« Sie beugt sich vor. »Der Armbrustmann!«, zischt sie, und sie starren sich in die Augen, während nur das Knacken des Kaminfeuers die Stille durchbricht.
Der Armbrustmann. Der Schreck ihrer Kindheitslandschaft. Einen Augenblick meint Robin den trockenen Duft des Kiefernwaldes in der Luft wahrzunehmen. Die Augen ihrer Mutter werden zu Lukas’ Augen, verschworenes Schweigen, Blicke, die den des anderen festhalten, ein geteiltes Geheimnis. Robin schaudert.
Auf einmal klingelt es an der Tür. Sie zuckt zusammen, als die Töne des Big-Ben-Glockenspiels durch den Flur dröhnen, und wirft ihr Glas um. Sie legt eine Hand auf die Brust und atmet heftig aus, doch ihre Mutter schießt vom Stuhl hoch und macht ein paar rasche Schritte rückwärts. Dabei stößt sie gegen das Küchenregal, dass Glas und Porzellan nur so scheppern. Dann wird es wieder still. Robin mustert ihre Mutter. Sie hätte gute Lust, über die komische Situation zu lachen, doch Henrika drückt sich ganz erstarrt ans Regal und schaut sie ängstlich an.
»Was ist denn los?«, fragt Robin. »Willst du nicht aufmachen?«
Doch ihre Mutter antwortet nicht, sie schüttelt nur stumm den Kopf, also steht Robin widerwillig selbst auf. Sie hat sich von der Angst ihrer Mutter anstecken lassen und geht jetzt mit zögerlichen Schritten durch den Flur, um die Tür zu öffnen.
Auf der Treppe steht ein blondes, langhaariges Mädchen. Robin schluckt und zwingt sich zu einem Lächeln. Sie dreht sich um und knipst das Licht im Eingangsbereich an, woraufhin auch die Außenbeleuchtung an der Treppe mit angeht. Robin bemerkt eine Bewegung ein Stück entfernt in der Auffahrt. Eine blonde Frau mit kurzen Haaren in beiger Daunenjacke steht dort mit den Händen in den Taschen und wartet. Robin nickt ihr zu und wendet dann ihren Blick wieder dem Mädchen zu. Es ist acht, vielleicht neun Jahre alt. Genau wie Laura. Es schenkt Robin ein Lächeln, das seine Zahnlücken entblößt, und hält ihr eine rote Metalldose entgegen.
»Hallo! Ich heiße Miranda und wohne in der Kapitänsstraße vierzehn. Ich verkaufe Kekse für die Grundschule Norrsund. Möchtest du auch eine Dose kaufen?«, leiert das Mädchen seinen Spruch herunter, der wie auswendig gelernt klingt, und dann schlägt es die Hand vor den Mund und wird rot, weil es merkt, dass es etwas Wichtiges vergessen hat. Es lässt den Kopf hängen und murmelt seinen Zehenspitzen zu: »Also, ich gehe in die Vierte. Wir sammeln Geld für unsere Klassenreise.«
Beschämt dreht es sich um und schaut zu seiner Mutter, die herbeigeeilt kommt, um die Situation zu retten.
Robin schaut die blonde Frau an, die ihr die Hand hinstreckt.
»Hallo, ich bin Matilda Strömberg, Mirandas Mutter.«
Robin ergreift die Hand und schüttelt sie. »Freut mich«, sagt sie abwartend.
Matilda Strömberg wartet darauf, dass Robin sich ebenfalls vorstellt, doch als nichts kommt, fährt sie fort: »Wo ich schon gerade hier bin, möchte ich daran erinnern, dass es verboten ist, Abfall im Garten zu verbrennen, wenn der Wind nicht Richtung Meer weht. Der Rauch zieht genau über unsere Grundstücke auf der anderen Seite des Berges. Wir wollen ja auch nicht unbedingt wie die Räucherheringe riechen!«, sagt sie und schließt mit einem kleinen nervösen Lachen.
»Papa hat gesagt, er hofft, dass der Wind sich dreht und direkt zu eurem Haus weht, sodass es abbrennt«, fügt Miranda hinzu und blickt zu Robin auf.
Matilda lacht noch einmal, diesmal lauter, und legt dem Mädchen die Hand auf die Schulter.
»Nein, das hat er nicht gesagt«, behauptet Matilda, und Miranda schaut sie an.
»Hat er wohl!«
»Pscht!«, macht Matilda brüsk und drückt Mirandas Schulter so fest, dass das Mädchen sich windet.
Es schaut Robin an, die ihr mit einem Auge zuzwinkert.
»Ich werde Henrika die Grüße ausrichten«, sagt Robin, und Matilda versucht, über ihre Schulter einen Blick in den Flur zu werfen.
»Ist sie denn nicht zu Hause? Ich hab ihr Auto in der Garage gesehen.«
Robin zieht diskret die Tür hinter sich zu und stellt sich, nur mit Strümpfen an den Füßen, auf die Vortreppe. Matilda zieht sich zurück und wirft Robin einen verärgerten Blick zu.
»Richte ihr aus, dass das nicht noch mal vorkommen darf! Wenn sie was verbrennen will, kann sie bis nächsten Samstag warten, wenn alle anderen auch ihren Müll verbrennen«, sagt Matilda.
Robin schlingt die Arme um den Körper, weil sie in der kühlen Luft zu zittern beginnt.
»Ich werde es ihr ausrichten.«
Dann bleiben sie eine Weile schweigend so stehen und schauen sich an. Matilda lächelt Robin an. Robin wartet. Schließlich lacht Matilda auf.
»Und die Kekse?«, fragt sie.
Robin schüttelt verständnislos den Kopf, und Matilda versetzt Miranda einen Stoß.
»Na ja, also … wo wir schon mal hier sind, kannst du uns doch wohl auch eine Dose abkaufen«, meint Matilda.
Verblüfft starrt Robin sie einen Moment an, denn Matildas Dreistigkeit imponiert ihr fast schon wieder. Doch dann tut ihr das Mädchen doch leid, und sie beugt sich zu ihr herunter.
»Komm doch morgen wieder und bring drei Dosen mit, dann kauf ich sie dir alle ab«, sagt Robin, und diesmal ist das Lächeln, das sich über Mirandas Gesicht ausbreitet, ein echtes.
Robin macht die Tür zu und geht zurück in die Küche, wo ihre Mutter sich wieder an den Tresen gesetzt hat. Sie hat den verschütteten Wodka aufgewischt und Robins Glas wieder aufgefüllt. Sie lümmelt am Tisch, stützt sich mit den Ellenbogen auf, und ihr Gesicht ist schlaff und ausdruckslos.
»Was wollte sie denn, die feine Frau Strömberg?«, fragt Henrika, und Robin setzt sich.
Sie zuckt mit den Schultern und zieht die Augenbrauen hoch.
»Dass du deinen Abfall am Samstag verbrennst«, antwortet sie.
»Diese dumme Nuss!«, schnaubt Henrika. »Die mit ihren Regeln, wie und wo und wann man irgendwelche Dinge auf seinem eigenen Grund und Boden machen darf. Irgendwann stell ich mich nackt da raus, damit ich ihr den Arsch zeigen kann.«
Robin sieht ihre Mutter an, die bereits ziemlich betrunken ist.
»Die haben vergessen, wem sie das hier alles zu verdanken haben. Wer ihnen diesen Traum hier hingebaut hat! Olof! Bevor er hierherkam, war hier nämlich überhaupt nichts! Nichts als Krähen und Gestrüpp. Olof hat diese Gegend überhaupt erst zu dem gemacht, was sie ist. Sie verdanken ihm ihre Häuser, und dann haben sie den Nerv, sich über den Rauchgeruch zu beschweren? Den Rauchgeruch! Der ist ja gar nichts im Vergleich zum Gestank ihres ganzen Schickeria-Gehabes. Damit muss ich jeden Tag klarkommen, aber beklag ich mich etwa? Oh nein!« Sie leert ihr Glas. »Ich bin nicht der Typ, der sich beklagt.«





























