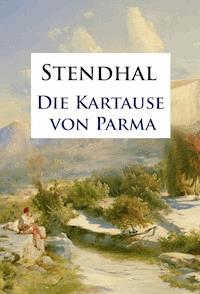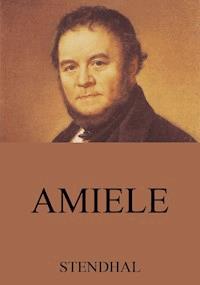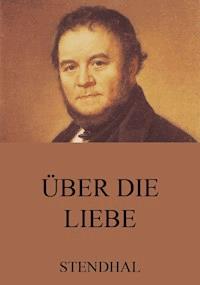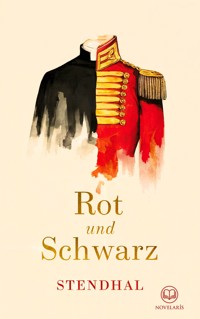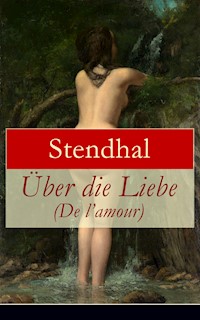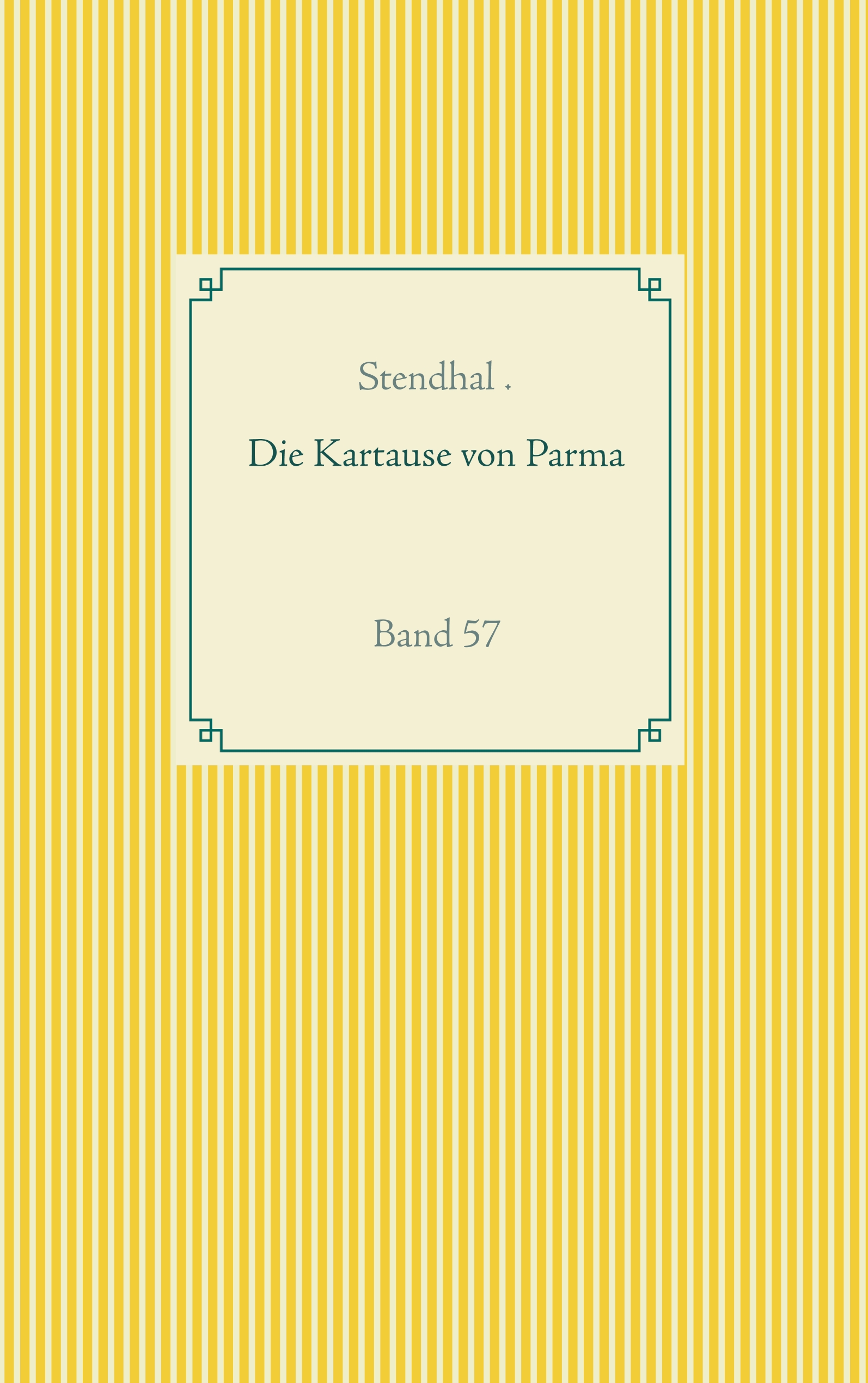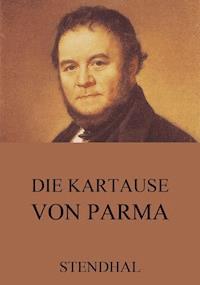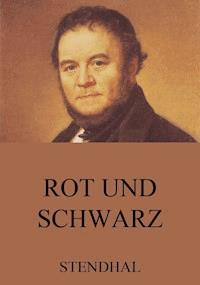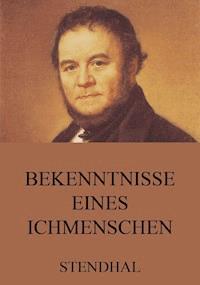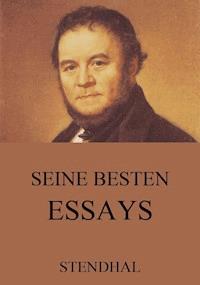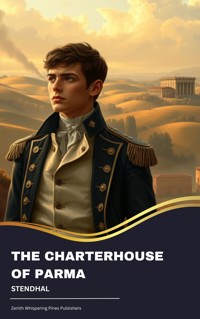Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stendhal war einer der bedeutendsten französischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Diese Edition umfasst die Werke: Die Fürstin von Campobasso Die Truhe Schwester Scolastica Vanina Vanini Die Äbtissin von Castro Die Cenci Zu viel Gunst schadet Die Herzogin von Palliano Vittoria Accoramboni Der Liebestrank Philibert Lescale Ernestine, oder die Entstehung der Liebe Der Jude Eine Geldheirat Mina von Wangel Erinnerungen eines römischen Edelmannes Die Truhe und das Gespenst Der Ruhm und der Buckel oder der Weg ist glitschig Eine Unterhaltung zwischen elf und Mitternacht
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 927
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Seine schönsten Erzählungen
Stendhal
Inhalt:
Stendhal – Biografie und Bibliografie
Die Fürstin von Campobasso
Die Truhe
Schwester Scolastica
Vorwort
Schwester Scolastica
Vanina Vanini
Die Äbtissin von Castro
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Die Cenci
Zu viel Gunst schadet
Die Herzogin von Palliano
Vittoria Accoramboni
Der Liebestrank
Philibert Lescale
Ernestine, oder die Entstehung der Liebe
Der Jude
Eine Geldheirat
Mina von Wangel
Erinnerungen eines römischen Edelmannes
Die Truhe und das Gespenst
Der Ruhm und der Buckel oder der Weg ist glitschig
Eine Unterhaltung zwischen elf und Mitternacht
Seine schönsten Erzählungen, Stendhal
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849636722
www.jazzybee-verlag.de
Stendhal – Biografie und Bibliografie
Eigentlich Marie-Henri Beyle, franz. Schriftsteller, meist unter dem Pseudonym Stendhal (spr. stangdall, von Stendal, der Heimat des von ihm verehrten Winckelmann) auftretend, geb. 23. Jan. 1783 in Grenoble, gest. 23. März 1842 in Paris, wurde nach einem an Abenteuern reichen Jugendleben kaiserlicher Beamter. machte die Feldzüge in Deutschland mit, ward 1812 Auditeur im Staatsrat und ging nach der zweiten Restauration nach Italien, das jetzt sein Lieblingsaufenthalt wurde. Nach der Julirevolution von 1830 wurde er Generalkonsul in Civitavecchia. Seine hauptsächlichsten Schriften sind die Romane: »Armance« (1827, 3 Bde.), »Le Rouge et le Noir« (1831, 2 Bde.) und besonders »La Chartreuse de Parme« (1839, 2 Bde.; oft aufgelegt), in denen sich Vorzüge, wie scharfe Charakteristik, pikanter Stil und glänzender Witz, aber auch Fehler finden, wie krankhaftes Jagen nach Originalität und Mangel an sittlicher Idee. Unter seinen übrigen Schriften sind die bedeutendsten: »Lettres écrites de Vienne sur Haydn, etc.«(1814, unter dem Namen A. C. Bombet); »Histoire de la peintureen Italie« (1817, 2 Bde.); »De l'amour« (1822, 2 Bde.); »Racine et Shakespeare« (1823).Nach seinem Tod erschienen: »Nouvelles inédites« (1853); »Romans et nouvelles« (1854); »Correspondance inédite« (1855); »Vie de Henri Brulard«, eine leichtverkleidete Selbstbiographie (1890), von der weiteres in seinem »Journal« (1888) und in den »Souvenirs d'égotisme« (1892) enthalten ist, ferner: »ll:uvres posthumes. Napoléon etc.« (1881, 3. Aufl. 1897) und »Lettres intimes« (1892). Sein bedeutendster Schüler, Mérimée, übertrifft ihn an Eleganz des Stiles. Ihren größten Erfolg haben Beyles Romane erst in unsrer Zeit errungen. Unter den neuern Schriftstellern wollen sowohl die Naturalisten (Zola) als die Psychologen (Bourget) in ihm einen Vorgänger erblicken. Vgl. Paton, Henry B., a critical and biographical study (Lond. 1874); Cordier, Stendhal et ses amis (Evreux 1890); Rod, Stendhal (Par. 1892); Farges, Stendhal diplomate. Rome et l'Italie de 1829 à 1842 (das. 1892); P. Brun, Henri B. (Grenoble 1900); Stryienski, Comment a vécu Stendhal (Par. 1900; mit zwölf Porträten des Dichters); A. Chuquet, Stendhal-B. (2. Aufl., das. 1902); Rüttenauer, Aphorismen aus Stendhal (Straßb. 1901).
Die Fürstin von Campobasso
Es war im Jahre 1726, also zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts, in Rom. Der Nepotismus trieb seine übelsten Blüten. Aber zu keiner Zeit war der römische Hof glänzender gewesen. Benedikt XIII. aus dem Hause Orsini regierte, oder vielmehr sein Neffe, der Fürst von Campobasso, der im Namen des Papstes alle Geschäfte führte, die großen wie die kleinen. Von überall her strömten die Fremden in die Ewige Stadt. Italienische Nobili und spanische Granden, damals noch im Überflusse des Goldes der Neuen Welt, kamen in Scharen. Jeder Reiche und jeder Machthaber stand über den Gesetzen. Galanterie und Prunk waren offenkundig die einzigen Betätigungen im Gewimmel der Fremden und der Einheimischen.
Die beiden Nichten des Papstes, die Gräfin Orsini und die Fürstin von Campobasso, teilten sich in die Macht ihres Onkels und in die Huldigungen des Hofes. Die Schönheit beider Frauen wäre aufgefallen, selbst wenn sie der Hefe des Volkes angehört hätten. Die Orsini, wie man in Rom familiär zu sagen pflegte, war heiter und lebenslustig, die Campobasso verträumt und fromm. Aber gerade diese zarte Seele war der wildesten Leidenschaft fähig. Ohne erklärte Feindinnen zu sein, wiewohl sie sich tagtäglich beim Papste trafen und sich oft besuchten, waren die beiden Damen Nebenbuhlerinnen in allem, in ihrer Schönheit, ihrem Ansehen, ihrem Reichtum. Die Gräfin Orsini war weniger schön, aber sie war verführerisch, leichtlebig, tatenlustig, intrigant. Sie hatte Liebhaber, aber ihr Herz blieb ewig frei. Keiner herrschte länger denn einen Tag. Ihr Glück bestand darin, zweihundert Menschen in ihren Sälen zu empfangen und unter ihnen als Königin zu erscheinen. Arg spottete sie ihrer Kusine, der Campobasso. Diese hatte die Ausdauer gehabt, sich drei Jahre lang allerorts mit einem spanischen Granden zu zeigen, bis sie ihm zu guter Letzt sagen ließ, er möge Rom binnen vierundzwanzig Stunden verlassen, wenn ihm sein Leben lieb sei. »Seit dieser Großtat«, scherzte die Orsini, »hat meine erhabene Kusine das Lachen ganz verlernt. Das ist nun schon etliche Monate her. Zweifellos geht die Ärmste an Mißmut oder Liebessehnsucht langsam zugrunde. Und ihr Gatte, dieser Schlaukopf, verfehlt nicht, Seiner Heiligkeit, unserm Onkel, diese Gemütsöde als das Ideal frommen Insichgehens zu preisen. Ich denke, eines schönen Tages unternimmt die fromme Büßerin eine Wallfahrt nach Hispania.«
Die Campobasso war jedoch himmelweit davon entfernt, sich nach ihrem spanischen Herzog zu sehnen. Sie hatte sich während seiner Regierungszeit zu Tode gelangweilt. Hätte sie Verlangen nach ihm gefühlt, so hätte sie ihn einfach wieder holen lassen. Sie gehörte zu den in Rom nicht raren Menschenkindern, die in der Alltäglichkeit wie in der Leidenschaft immerdar natürlich und naiv sind. Obgleich kaum dreiundzwanzig Jahre alt und in der vollen Blüte ihrer Schönheit, war sie in der Tat fanatisch fromm. Es geschah, daß sie vor ihrem Onkel auf die Kniee sank und seinen päpstlichen Segen erflehte. Man weiß sattsam genug, daß der gute Benedikt XIII. von jedweder Gewissenslast, mit Ausnahme von zwei oder drei Todsünden, auch ohne Beichte absolvierte. Er weinte vor Rührung. »Steh auf, liebe Nichte!« sprach er. »Du bedarfst meines Segens nicht. In den Augen des Herrn stehst du höher als ich.« Hierin täuschte sich Seine Heiligkeit trotz aller Unfehlbarkeit. Und mit ihm ganz Rom. Die Campobasso war toll verliebt. Ihr neuer Liebhaber liebte sie ebenso leidenschaftlich wie sie ihn. Aber trotzdem war sie tief unglücklich.
Seit mehreren Monaten sah sie bei sich fast täglich den Attache Chevalier von Senecé, einen Neffen des Herzogs von Saint-Aignan, des damaligen Gesandten Ludwigs XV. in Rom.
Der junge Senecé war als Sohn einer Favoritin des Regenten Philipp von Orleans der Empfänger ausgesuchter Ehren. Er war kaum zweiundzwanzig Jahre alt und schon längst Oberst. In seinem Wesen hatte er allerlei dandyhafte Angewohnheiten, aber er war nicht anmaßend. Heiterkeit, nimmermüde Vergnügungssucht, Unbesonnenheit, Schneid und Gutmütigkeit waren die Haupteigenschaften seines eigenartigen Charakters, und man konnte zum Lobe seiner Nation sagen, daß er ein vollauf mustergültiger Vertreter von ihr war. Gerade das typisch Gallische hatte die Fürstin vom ersten Augenblick an bestochen. »Ich traue dir nicht über den Weg«, sagte sie einmal zu ihm, »Du bist Franzose. Und eines erkläre ich dir im voraus: An dem Tage, wo Rom erfährt, daß ich dich manchmal heimlich bei mir habe, weiß ich, daß du mich verraten hast. Dann ist meine Liebe aus«
Sie hatte mit der Liebe gespielt und war dabei der wildesten Leidenschaft verfallen. Auch Senecé hatte sie geliebt, wie bereits gesagt, aber das Einvernehmen beider währte bereits acht Monate, und in der Zeit, da sich die Liebe einer Italienerin verdoppelt, stirbt die eines Franzosen. Die Eitelkeit tröstete den Chevalier ein wenig in seiner Langenweile. Bereits hatte er zwei oder drei Porträts der Fürstin nach Paris gesandt. Übrigens war er von Jugend auf in jeder Hinsicht ein begnadetes Glückskind, so daß er seine sorglose Natur selbst in Dingen der Eitelkeit nicht verleugnete, die doch sonst die Herzen seiner Landsleute nicht in Ruhe läßt.
Senecé hatte für den Charakter seiner Geliebten nicht das geringste Verständnis. Infolgedessen kam ihm ihre Bizarrerie bisweilen spaßig vor. Sehr oft, ganz besonders am Festtage der Heiligen Balbina, deren Namen sie trug, hatte er die Herzenskämpfe und Gewissensbisse dieser aufrichtig frommen Schwärmerin zu beschwichtigen. Bei aller Liebe und Leidenschaft hatte sie, gerade wie eine Frau aus dem Volke, ihren Glauben nicht vergessen. Der Chevalier hatte diese Regung nur mit Gewalt besiegt und mußte sie so immer von neuem besiegen.
Dies Hindernis war das erste, das dem mit allen Gaben des Zufalls überschütteten jungen Mann in seinem Leben begegnete. Es war der Anlaß, daß er der Fürstin gegen über zärtlich und aufmerksam blieb. Von Zeit zu Zeit hielt er es für seine Pflicht, sie zu lieben. Er hatte in Rom nur einen Vertrauten. Das war sein Gesandter, der Herzog von Saint-Aignan, dem er durch die Campobasso, der er alles erzählte, ein paarmal Dienste leistete. Nicht zu vergessen: die Wichtigkeit, die er dadurch in den Augen des Gesandten gewann, schmeichelte ihm ungemein.
Die Campobasso war auch hierin so ganz anders als Senecé. Die gesellschaftlichen Vorzüge des Geliebten machten gar keinen Eindruck auf sie. Geliebt oder nicht geliebt werden war ihr ein und alles. ›Ich opfre ihm auf ewig mein Seelenheil‹, dachte sie oft bei sich. ›Er ist ein Ausländer, ein Ketzer. Er kann mir derlei Opfer gar nicht entgelten.‹ Aber wenn dann der Chevalier erschien, in feinem Frohsinn, der so entzückend und so ungezwungen war, dann staunte sie wie vor einem Wunder und ließ sich so gern bezaubern. Bei seinem Anblicke vergaß sie alles, was sie sich vorgenommen hatte ihm zu sagen, und alle ihre düsteren Gedanken waren verflogen. Das war für sie ein Zustand, den ihre erdenferne Seele noch nie erlebt hatte. Er dauerte weiter, wenn Senecé längst von ihr wieder fort war. Schließlich ward sie sich klar, daß sie ohne den Geliebten nicht denken, nicht leben konnte.
Die Mode, die in Rom zwei Jahrhunderte hindurch die Spanier bevorzugt hatte, begann sich schon damals den Franzosen zuzuwenden. Man fing an, ihren Charakter zu verstehen, der Freude und Glück überall hinträgt, wo er sich zeigt. Diesen Charakter gab es einstmals nur in Frankreich. Seit der großen Revolution von 1789 ist er nirgends mehr zu finden. Denn ein so beständiger Frohsinn gedeiht nur bei Sorglosigkeit. Heutzutage gibt es in Frankreich für niemanden mehr eine sichere Laufbahn und ruhige Lebensentwicklung, nicht einmal mehr für das Genie, das so seltene. Zwischen den Angehörigen der Kaste Senecés und dem Reste der Nation herrscht Kriegszustand. Auch in Rom war es damals bei weitem anders als in unsern Tagen. Im Jahre 1726 ahnte man nichts von alledem, was sich daselbst zwei Menschenalter später zutragen sollte, als das Volk, von etlichen Pfaffen bestochen, den Jakobiner Basseville umbrachte, der die Hauptstadt der Christenheit angeblich zivilisieren wollte. Dem Chevalier gegenüber hatte die Campobasso, was ihr noch nie widerfahren, die Vernunft verloren. Dinge, die der gesunde Menschenverstand nicht billigt, hatten sie himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt gemacht. Nachdem Senecé einmal die Religiosität ihres strengen, ehrlichen Herzens besiegt hatte, also etwas, was ihr hehrer und höher gewesen als die irdische Vernunft – seitdem war ihre Liebe lodernde Leidenschaft geworden.
Die Fürstin hatte einem Monsignore Ferraterra ihr Wohlwollen geschenkt und sich vorgenommen, ihn emporzubringen. Ihr ward ganz seltsam zumute, als Ferraterra ihr eines Tages berichtete, Senecé ginge nicht nur auffällig viel zur Orsini, sondern er wäre auch daran schuld, daß die Gräfin ihrem offiziellen Liebhaber, einem berühmten Sänger, den Laufpaß gegeben hatte.
Es war an dem Abend, da die Campobasso diese schicksalsschwere Nachricht erhalten hatte.
Regungslos saß sie im Erdgeschoß ihres Palastes in einem riesigen Lehnstuhl von vergoldetem Leder. Neben ihr, auf einem Tischchen mit schwarzer Marmorplatte, stand ein mächtiger zweiarmiger Leuchter auf hohem Fuß, ein Meisterwerk von Benvenuto Cellini. Das Licht der dicken Kerzen durchhellte das weite Gemach und ließ Einzelheiten aus der Finsternis hervortreten. An den Wänden hingen Gemälde, vom Alter gedunkelt; denn die Zeit der großen Meister war längst vorüber.
Der Fürstin gegenüber, fast zu ihren Füßen, auf einem niedrigen Ebenholzschemel, der mit massivem Goldzierat geschmückt war, hockte die rassige Gestalt des jungen Franzosen. Die Römerin schaute ihn an. Ununterbrochen. Seit er den Saal betreten, hatte sie noch kein Wort an ihn gerichtet. Sonst war sie ihm immer entgegengeeilt und ihm in die Arme geflogen.
Im Jahre 1726 war Paris bereits die Königin der Eleganz und des Schicks. Der Chevalier ließ sich von dort durch die Post regelmäßig allerlei kommen, was das schmucke Aussehen auch des feschesten Franzosen noch erhöht. Senecé hatte seine weltmännische Schulung durch die großen Mondänen am Hofe des Regenten und unter der Anleitung des berüchtigten Canillac, eines Roués am Hofe Philipps, empfangen. Aber trotz seiner bei einem Manne seines Ranges so natürlichen Sicherheit war er einigermaßen verlegen. Seine Miene verriet es deutlich. Er sah ihr ins Gesicht. Ihr schönes blondes Haar war nicht ganz in Ordnung. Ihre großen schwarz-blauen Augen starrten ihn an. Aber er verstand nicht, was ihr düsterer Ausdruck besagte. Sann sie auf tödliche Rache? Oder war es nur der tiefe Ernst leidenschaftlicher Liebe?
»Also du liebst mich nicht mehr?« stieß sie endlich hervor. Dieser Kriegserklärung folgte neues langes Schweigen.
Es fiel der Fürstin schwer, auf diesen verführerischen entzückenden Mann verzichten zu sollen. Wenn sie ihm keine Szene machte, war er stets bereit, ihr tausend Torheiten zu sagen. Davon war sie überzeugt. Aber sie war viel zu stolz, als daß sie die Aussprache hinausgeschoben hätte. Eine gefallsüchtige Frau ist eifersüchtig aus Eigenliebe; eine leichtlebige, weil sie das so gewohnt ist; eine Frau jedoch, die wahrhaftig und leidenschaftlich liebt, hegt das Bewußtsein ihrer Rechte.
Die sonderbare Art ihres Blickes, die der römischen Leidenschaft eigentümlich ist, belustigte Senecé. Er sah in eine Tiefe voller Geheimnisse und Rätsel. Das war Seelennacktheit. Die Orsini besaß diesen Reiz nicht. Trotz dieser Entdeckung dauerte dem jungen Franzosen das Stillschweigen über die Maßen an. Da er in der Kunst, die geheime Innenwelt eines italienischen Herzens zu ergründen, so gar kein Meister war, fand er seine ruhige vernünftige Miene wieder und geriet in sein gewohntes Wohlbehagen. Das heißt: einen Kummer hatte er in diesem Augenblick doch. Beim Durchschreiten des Kellerganges, der aus einem Nachbarhause in den tiefgelegenen Saal führte, in dem die Fürstin ihn empfing, war an der blitzsauberen Stickerei seines wunderfeinen, erst gestern aus Paris angekommenen Rockes eine Spinnwebe hängen geblieben. Das verdroß ihn. Vor Spinnen hatte er Abscheu.
Senecé bildete sich ein, in den Augen der Geliebten die Stille vor dem Sturm zu erkennen. ›Um einen Auftritt zu vermeiden,‹ dachte er, ›gehe ich ihren Vorwürfen aus dem Wege. Dann brauche ich nicht Rede und Antwort zu stehen.‹ Dann aber, in einem Stimmungsgemisch von Ärgerlichkeit und Ernst, sagte er sich folgendes:
›Wäre hier nicht eine günstige Gelegenheit, ihr die Wahrheit leise anzudeuten? Sie wirft die Frage aus freien Stücken auf.‹ Damit ist schon der halbe Verdruß überstanden. Ganz bestimmt: ich bin wirklich nicht für die Liebe geschaffen. Aber nie habe ich etwas Schöneres gesehen als diese Frau mit ihren Sphinxaugen. Sie hat schlechte Manieren. Sie läßt mich durch abscheuliche Keller schleichen. Andrerseits ist sie die Nichte des Souveräns, an dessen Hof mich mein König und Herr gesandt hat. Mehr noch: sie ist blond in einem Lande, wo alle Frauen brünett sind. Das ist ein ganz besonderer Vorzug. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht hörte, daß sie himmlisch schön sei, und das sagen Leute, deren Zeugnis unparteiisch ist, Leute, die nicht im entferntesten ahnen, daß sie mit dem glücklichen Besitzer so vieler Reize sprechen. Was die Macht anbelangt, die ein Mann über seine Geliebte haben soll, so brauche ich mir in dieser Hinsicht keine Sorgen zu machen. Wenn ich es darauf ankommen lassen wollte, so genügt ein einziges Wort und ich entführe sie aus diesem Palaste mit seinen Goldmöbeln, weg von ihrem Onkel und all dem Glanz seines Hofes, nach Frankreich, nach einem meiner Güter, in einen Winkel der Provinz, in ein obskures Dasein... Hol mich der Teufel: die Aussicht auf diese selbstlose Treue veranlaßt mich zu dem festen Entschluß, sie lieber nicht zu fordern. Die Orsini ist lange nicht so hübsch. Wenn sie mich liebt, liebt sie mich eben. Vielleicht ein bißchen mehr als den Kastraten Butafoco, den sie gestern in Gnaden entlassen hat, mir zu Ehren. Aber sie ist ein Weltkind. Sie hat Lebensart. Man kann bei ihr im Wagen vorfahren. Und eins weiß ich ganz bestimmt: eine Szene wird sie mir niemals machen. Dazu liebt sie mich viel zu wenig.‹
Während des langen Schweigens hatte die Fürstin ihren starren Blick nicht abgewandt von der sonnigen Stirn des jungen Franzosen.
›Ich sehe ihn zum letzten Male‹, klagte sie bei sich. Und urplötzlich warf sie sich in seine Arme und drückte heiße Küsse auf seine Stirn und auf seine Augen, die längst nicht mehr leuchteten, wenn er sich bei ihr einstellte.
Der Chevalier hätte sich selber verachtet, hätte er nicht augenblicklich all seine Pläne, mit ihr zu brechen, vergessen. Sie freilich, sie war zu erregt und empört, um von ihrer Eifersucht zu lassen. Im nächsten Augenblick sah Senecé zu seiner Verwunderung, daß Tränen der Wut über ihre Wangen jagten. Halblaut redete sie mit sich selbst:»Wie, ich erniedrige mich so sehr, daß ich ihm seinen Wankelmut vorwerfe? Ich, die ich mir geschworen habe, mir nie etwas davon anmerken zu lassen? Ach, meine Niedrigkeit ist noch viel schlimmer. Ich muß der Leidenschaft nachgeben, mit der mich dieser Verführer vergiftet hat! Ach, ich verworfene, verworfene, verworfene Fürstin! ch muß ein Ende machen.«
Sie trocknete ihre Tränen und gab sich den Anschein, als beruhige sie sich.
»Chevalier,« sagte sie fast friedsam, »wir müssen ein Ende machen! Sie gehen oft zur Gräfin ...«
Hier ward sie totenbleich.
»Wenn du sie liebst, so geh alle Tage hin! Meinetwegen.
Aber komme nie wieder hierher ...«
Sie hielt inne, als ob es ihr schwer fiele, weiter zu reden.
Sie wartete aus ein Wort des Chevaliers. Aber dieses Wort ward nicht gesprochen. Sie mußte einen leichten Krampf in sich überwinden, und aus aufeinandergebissenen Zähnen drangen ihre weiteren Worte hervor:
»Das ist mein Todesurteil und das Ihre!«
Diese Drohung machte die schwankende Seele des Chevaliers wieder fest. Zunächst war er über den unvermittelten Wandel von zärtlicher Liebkosung zu Zorn erstaunt gewesen. Jetzt begann er zu lachen.
Rasche Rote überflutete die Wangen der Fürstin, bis sie scharlachrot wurden. ›Jetzt erstickt sie vor Wut‹ dachte Senecé, ›sie kriegt einen Schlaganfall.‹
Er eilte auf sie zu, um ihr das Kleid am Halse zu öffnen. Sie stieß ihn zurück, mit einer Entschlossenheit und einer Kraft, die er nicht gewohnt war. Später erinnerte er sich, daß sie mit sich selber gesprochen hatte, als er den Versuch gemacht, sie in seine Arme zu nehmen. Im Moment trat er ein wenig zurück, ohne recht zu wissen, warum. Seine halb unbewußte Diskretion war unnötig. Offenbar sah sie ihn gar nicht mehr. Er war ihr tausend Meilen fern. Halblaut, aus zusammengepreßter Kehle, stammelte sie: »Er beschimpft mich. Er höhnt mich. Ich weiß, jung wie er ist, und bei der Plauderhaftigkeit, die hierzulande herrscht, wird er der Orsini meine ganze Würdelosigkeit erzählen, meine Selbsterniedrigung ... Ich bin meiner nicht mehr sicher. Ich habe nicht einmal mehr die Macht über mich, vor seinen hübschen Augen kalt zu bleiben...«
Wiederum ward sie schweigsam. Der Chevalier langweilte sich gräßlich. Endlich erhob sich die Fürstin und sagte abermals in noch unheilvollerem Tone: »Wir müssen ein Ende machen!« Senecé, der unter ihren Küssen auf den Gedanken einer ernsten Erklärung verzichtet hatte, sagte ein paar Scherzworte, die ein Ereignis betrafen, über das man in Rom zur Zeit gerade viel redete. »Lassen Sie mich, Chevalier!« unterbrach sie ihn unwillig, »Ich fühle mich nicht wohl«
›Diese Frau ist misslaunig‹, dachte Senecé bei sich und beeilte sich zu gehorchen. ›Nichts ist so ansteckend wie schlechte Laune.‹
Die Fürstin folgte ihm mit den Augen, bis er aus dem Saale verschwunden war. Mit bitterem Lächeln sagte sie sich:
›Und ich wollte blindlings über mein Lebensgeschick entscheiden! Es war ein Glück, daß mich seine unangebrachten Scherze aufgerüttelt haben. Wie beschränkt ist dieser Mann! Wie kann ich ein Wesen lieben, das mich so wenig versteht! Er will mich durch einen Scherz erheitern, zu einer Stunde, da mein und sein Leben auf dem Spiele steht! Ach, wie klar wird mir hierbei das unheimliche dunkle Element in meiner Natur, das mein Unglück ist!‹
Sie fuhr wild aus ihrem Lehnstuhl auf.
›Wie herrlich waren seine Augen, als er mir jene heiteren Worte sagte! Ja, ich kann es nicht leugnen: die Absicht des armen Jungen war liebenswert. Er kennt den Unglückszug meines Charakters. Er wollte .mich über das schwarze Herzeleid hinwegtrösten, das mich quält. Andre hätten mich nach dem Grund gefragt. Liebenswürdiger Franzose! Mein Gott, was wußte ich vom Glück, eh ich ihn liebte!‹
Der Gedanke an die guten Seiten ihres Geliebten verführte sie zu köstlicher Träumerei. Dann aber fielen ihr die Vorzuge der Gräfin Orsini ein. Wiederum ward ihr die Seele finster. Die Qualen der schrecklichsten Eifersucht peinigten ihr das Herz. In Wahrheit stand sie seit zwei Monaten im Banne düsterer Vorahnung. Erträgliche Augenblicke hatte sie nur in der Gegenwart des Chevaliers gehabt, und doch hatte sie ihm beinahe immer, wenn sie in seinen Armen gelegen, bittere Worte gesagt.
Der Abend war furchtbar für sie. Erschöpft und durch den Schmerz gewissermaßen sanfter gestimmt, erwog sie den Gedanken, noch einmal mit dem Chevalier zu reden. ›Er hat wohl gesehen, daß ich empört bin, aber er kennt den Grund meiner Klage nicht. Vielleicht liebt er die Gräfin gar nicht. Vielleicht geht er nur zu ihr, weil er als Fremder die geselligen Zustände des Landes kennen lernen, insonderheit in der Familie des Herrschers verkehren muß. Wenn ich Senecé offiziell in mein Haus einführen lasse, wenn er vor aller Augen hierher kommen kann, dann bleibt er vielleicht ebenso stundenlang bei mir wie bei der Orsini.‹
»Nein!« rief sie in Raserei. »Ich erniedrige mich, wenn ich spreche. Er würde mich verachten. Weiter käme nichts dabei heraus. Der Flattersinn der Orsini, den ich in meiner Tollheit oft verachtet habe, ist wahrlich angenehmer als mein Charakter, zumal in den Augen eines Franzosen. Ich bin dazu geschaffen, mürrisch mit einem Spanier dahinzuleben. Was ist verrückter, als immer ernst zu sein, als ob die Tatsachen des Daseins nicht schon an und für sich ernst genug wären! Was soll aus mir werden, wenn ich meinen Chevalier nicht mehr habe, der frohes Leben in mich bringt, der die warme Sonne in mein Herz trägt, die sonst nicht drinnen scheint?«
Sie hatte befohlen, niemanden vorzulassen außer Monsignore Ferraterra. Er kam, um ihr Bericht zu erstatten, was sich im Hause der Gräfin Orsini bis ein Uhr nachts zugetragen hatte. Der Prälat hatte der Fürstin in ihrer Liebesgeschichte ehrlich gedient. Er zweifelte seit gestern nicht mehr, daß Senecé sehr bald mit der Orsini die allerintimsten Beziehungen haben würde, ja vielleicht bereits hätte. Sein Gedankengang war nun folgender: ›Die Fürstin wird mir mehr nützen, wenn sie sich von ihrer Sünde kehrt, denn als Dame der großen Welt. Dort wird sie immer einen haben, der ihr lieber ist als ich, einen Liebhaber. Eines Tages kann diese Rolle ein Römer spielen. Er kann einen nahen Verwandten haben, der Kardinal werden will. Bekehre ich sie aber zu einem frommen Wandel, so wird sie immer zuerst an ihren Gewissensrat denken, und bei ihrem leidenschaftlichen Sinn... was kann ich da nicht alles von ihrem Onkel erhoffen!‹
So wiegte sich der ehrgeizige Prälat in den verlockendsten Zukunftsträumen. Im Geiste sah er, wie sich die Fürstin dem Papste zu Füßen warf und den Kardinalshut für ihn erbat. Seine Heiligkeit würde ihr dies allergnädigst gewähren, schon aus Erkenntlichkeit gegen ihn. Er hatte nämlich die Absicht, sobald die Fürstin bekehrt wäre, Benedikt XIII. unwiderlegliche Beweise ihres Verhältnisses mit dem jungen Ausländer vorzulegen. Der Papst, fromm, sittenstreng und voller Abscheu vor den Franzosen, würde demjenigen ewige Dankbarkeit bewahren, der eine Seiner Heiligkeit so mißfällige Sache aus der Welt geschafft hätte.
Ferraterra gehörte dem Hochadel von Ferrara an. Er war reich und schon über fünfzig Jahre alt. Durch die nahe Aussicht auf den Kardinalshut vollbrachte er Wunder. Alsbald änderte er seine Rolle bei der Campobasso. Der Prälat, der sich in Senecés Charakter schlecht zurechtfand, hielt ihn für ehrgeizig. Es war zwei Monate her, daß der Chevalier die Fürstin vernachlässigte. Ihm zu nahe zu treten, dünkte ihn gefährlich. Der Prälat hatte eine sehr lange Zwiesprache mit der vor Liebe und Eifersucht tollen Fürstin. Sie begann mit einem ausführlichen Geständnis der traurigen Wahrheit. Nach dieser wuchtigen Einleitung war es nicht schwierig, die religiösen und moralischen Gefühle, die im Herzensgrund der Römerin schlummerten, in Bewegung zu bringen. Es war echte Frömmigkeit in ihr. »Jedwede gottlose Leidenschaft muß mit Unglück und Schande enden!« sagte Ferraterra salbungsvoll.
Als er den Palazzo Campobasso verließ, war es hellichter Tag. Er hatte der Bußfertigen das Gelübde abgenommen, Senecé an diesem Tage nicht einzulassen. Dies zu versprechen, war der Fürstin nicht schwer gefallen. Sie wollte fromm sein. Außerdem fürchtete sie, sich in den Augen des Geliebten verächtlich zu machen, wenn sie sich schwach zeigte. Ihr Entschluß hielt bis vier Uhr nachmittags an. Das war die Stunde, da der Chevalier sie zu besuchen pflegte. In der Tat erschien er auf dem Wege, der an der Rückfront des Palazzo Campobasso vorbeiführte. Als er das Zeichen bemerkte, das ihm kundtat, sein Eintritt sei unmöglich, ging er höchst zufrieden von dannen, zur Orsini.
Die Einsame fühlte, wie der Wahnsinn sie langsam überkam. In ihrem Hirn jagten sich die seltsamsten Pläne und Entschlüsse. Plötzlich lief sie wie eine Rasende die große Treppe ihres Hauses hinunter, befahl ihren Wagen und rief dem Kutscher zu:
»Palazzo Orsini!«
Das Übermaß ihres Leids zwang sie, ohne rechten Willen, ihre Kusine aufzusuchen. Sie traf sie in einer Gesellschaft von fünfzig Personen. Alles, was in Rom Witz und Ehrgeiz hatte, ging im Palazzo Orsini ein und aus. Im Palazzo Campobasso fand man nicht so leicht Eingang.
Das plötzliche Erscheinen der Fürstin erregte großes Aufsehen. Ehrerbietig machte ihr alle Welt Platz. Sie bemerkte das gar nicht. Sie sah nichts als ihre Rivalin und staunte sie an. Zu ihrer Qual und Pein fand sie eine Menge reizender Dinge an ihr. Stumm und versonnen saß sie da.
Nach ein paar Höflichkeitsphrasen begann die Orsini wie zuvor in ihrer witzigen, munteren losen Art zu plaudern. Die Campobasso dachte bei sich: ›Dieser Frohsinn paßt tausendmal besser zum Chevalier als meine tolle, grüblerische Liebe.‹ In einer ihr selber unerklärlichen Aufwallung von Bewunderung und Haß fiel sie der Gräfin um den Hals. Sie hatte für nichts Augen als für den Charme ihrer Kusine. Aus der Nähe wie von ferne schien sie ihr in gleichem Maße anbetungswürdig. Sie verglich ihr Haar, ihren Teint, ihre Augen mit den eigenen. Das Ergebnis dieser wunderlichen Prüfung war, daß die Fürstin an sich selbst alles häßlich und abscheulich fand. An ihrer Rivalin hingegen dünkte sie alles unvergleichlich und köstlich.
Starr und finster saß die Campobasso inmitten der schwatzenden und gestikulierenden Menschenmenge wie eine Basaltstatue. Man kam und ging, laut und lärmend. Alles das verursachte ihr Unbehagen, geradezu Pein. Da hörte sie, daß man den Chevalier von Senecé meldete. Es wurde ihr ganz seltsam zumute.
Zu Beginn ihrer heimlichen Beziehungen war sie mit ihm übereingekommen, daß er in Gesellschaft wenig mit ihr reden und sich so benehmen solle, wie sich das für einen ausländischen Diplomaten geziemt, der einer Nichte des Souveräns, bei dem er beglaubigt ist, just zwei oder dreimal im Monat begegnet.
Senecé begrüßte die Fürstin mit dem gewohnten Respekt und Ernst. Sodann gesellte er sich wieder zur Gräfin Orsini, bei der er den heiteren, fast vertraulichen Ton anschlug, dessen man sich vor einer lebhaften Frau bedient, die einen gern und täglich sieht. Die Campobasso war zu Tode verwundet.
›Die Gräfin zeigt mir, wie ich hätte sein sollen‹, sagte sie sich und ging hinweg. Sie hatte die letzte Leidensstation erreicht. Unglücklicher konnte kein menschliches Wesen werden. Sie war entschlossen, Gift zu nehmen. Alle Wonnen, die ihr der Geliebte je geschenkt, vermochten die Waagschale mit den grenzenlosen Herzensqualen nicht zu halten, die sie in der Nacht heimsuchten. Römerinnen haben tausendmal mehr Leidenschaft als andere Frauen.
Am nächsten Tage kam Senecé wiederum am Palast vorüber. Wiederum grüßte ihn das Zeichen der Ablehnung. Wiederum ging er fröhlich von dannen. Trotzdem war er gekränkt.
›Also war das neulich doch der Laufpaß!‹ meinte er, und seine Eitelkeit flüsterte ihm zu: ›Du mußt sie in Tränen sehen!‹
Bei dem Gedanken, ein so schönes Weib, die Nichte Seiner Heiligkeit, auf immerdar verloren zu haben, empfand er eine verliebte Regung. Er kroch in den wenig sauberen Kellergang, der ihm jedesmal gräßlich unangenehm war, und trat die Tür ein, die zu dem Saale des Erdgeschosses führte, in dem ihn die Fürstin zu empfangen pflegte.
»Unerhört!« rief die Fürstin, die in diesem Raume ihrem Leid nachhing. »Sie wagen es, hier zu erscheinen?« ›Ihre Entrüstung ist Heuchelei!‹ dachte der junge Franzose bei sich. ›Diesen Saal betritt sie nur, wenn sie meiner harrt.‹
Der Chevalier ergriff ihre Hand. Sie zitterte. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Er sah sie an. Nie war sie ihm schöner erschienen. Im Augenblick liebte er sie. Sie aber vergaß alle die frommen Gelübde der letzten zwei Tage und warf sich in seine Arme.»Und dieses Glück soll fortan die Orsini haben!« rief sie. Senecé, der wie immer die römische Seele mißverstand, wähnte, sie wolle sich von ihm in guter Freundschaft trennen, wolle einen Bruch unter Wahrung des äußeren Scheins. Dies wäre so recht nach seinem Sinn gewesen. ›Als Attache der königlichen Gesandtschaft ‹, sagte er sich, ›wäre es inkorrekt von mir, wenn ich mir die Nichte des Souveräns, bei dem ich beglaubigt bin, zur Todfeindin machte. Viel fehlte dazu nicht. ‹ Im voraus stolz auf den glücklichen Ausgang, zu dem er es höchstwahrscheinlich, wie er meinte, bringen würde, begann er der Fürstin Vernunft zu predigen. Sie würden im angenehmsten Verein leben. Warum sollten sie nicht sehr glücklich sein? Was hätte sie ihm eigentlich vorzuwerfen? Die Liebe mache einer guten traulichen Freundschaft Platz. Er bäte inständig um das Vorrecht, von Zeit zu Zeit an diesen lieben, alten Ort zurückkehren zu dürfen. Ihre Beziehungen würden immer zärtlich sein...
Zuerst verstand ihn die Fürstin nicht. Als sie endlich zu ihrem Entsetzen begriff, erstarrte sie. Unbeweglich, stieren Blicks stand sie da. Schließlich, bei seiner letzten Torheit, den ›immer zärtlichen Beziehungen ‹, unterbrach sie ihn mit dumpfer, wie aus der untersten Tiefe ihres Herzens dringender Stimme, wobei sie langsam Wort für Wort betonte:
»Sie wollen wohl sagen, Sie finden mich immer noch hübsch genug, um mich als Dirne zu gebrauchen!« »Aber beste, teuerste Freundin,« erwiderte ihr Senecé in ungeheuchelter Verwunderung, »habe ich denn Ihre Eigenliebe verletzt? Wie kann es Ihnen nur in den Sinn kommen, Worte des Vorwurfs zu äußern? Glücklicherweise ahnt ja kein Mensch etwas von unserm Einverständnis. Ich bin ein Edelmann. Ich gebe Ihnen von neuem mein Ehrenwort: niemals soll ein lebendes Wesen von dem Glück erfahren, das Sie mir geschenkt haben!«
»Auch die Orsini nicht?« fragte sie in so kühlem Tone, daß des Chevaliers Verblendung weiterwährte. Naiv gab er die Antwort:
»Habe ich Ihnen je die Namen derer genannt, die ich vielleicht geliebt habe, ehe ich Ihr Sklave ward?«
»Bei aller meiner Hochachtung vor Ihrem Ehrenworte stehe ich hier doch vor einer Gefahr, die ich vermeiden möchte.«
Das klang so fest und feierlich, daß der junge Franzose endlich stutzte.
»Leben Sie wohl, Chevalier!«
Ihre Stimme zitterte mit einem Male. Aber schon wiederholte sie klar und bestimmt:
»Leben Sie wohl, Chevalier!«
Er ging.
Die Fürstin ließ Ferraterra holen.
»Es gilt, mich zu rächen!« erklärte sie ihm.
Der Prälat war hocherfreut.
›Jetzt gibt sie sich in meine Hände!‹ frohlockte er. ›Nun ist sie mein für ewig! ‹
Zwei Tage später, nach einem erdrückend heißen Tage, ging Senecé um Mitternacht auf dem Korso spazieren, um frische Luft zu schöpfen. Ganz Rom war auf den Beinen. Als er wieder in seinen Wagen steigen wollte, vermochte ihm sein Diener kaum zu antworten. Er war betrunken. Der Kutscher war verschwunden. Der Diener meldete ihm lallend, der Kutscher hätte einen Streit mit einem ›Feinde‹ gehabt.
»Großartig! Mein Kutscher hat Feinde!« lachte der Chevalier und schickte sich an, zu Fuß nach Haus zu gehen.
Unterwegs, kaum zwei oder drei Straßen vom Korso weg, nahm er wahr, daß er verfolgt wurde. Drei, vier oder fünf Männer blieben jedesmal stehen, sobald er Halt machte. Wenn er weiterging, setzten auch sie ihren Weg fort.
›Ich konnte einen Bogen machen und auf einer andern Straße nach dem Korso zurückkehren‹, überlegte sich Senecé. ›Unsinn!‹ meinte er dann wieder. ›Was stören mich diese Kerle? Ich bin ja bewaffnet.‹
Er nahm den blanken Dolch in die Hand.
Mit diesen Gedanken schritt Senecé weiter, durch mehrere abgelegene Straßen, von denen eine immer einsamer war als die andere. Er hörte, daß die Männer hinter ihm schneller gingen. Er spähte nach vorn. Da bemerkte er gerade vor sich eine kleine Kirche, die den Franziskanermönchen gehörte. Seltsamer Schimmer leuchtete hinter den hohen Fenstern.
Senecé stürzte auf das Portal zu und pochte mit dem Holzknauf stark an die Tür. Die Männer, die ihm nachgegangen, waren fünfzig Schritt von ihm entfernt. Jetzt begannen sie auf ihn zuzulaufen. In diesem Augenblick öffnete ein Mönch die Tür. Senecé trat eilends in die Kirche. Der Mönch schlug die Tür rasch zu. Gleich darauf donnerten die Banditen mit den Füßen gegen die Tür.
»Gottlose Buben!« murmelte der Mönch.
Senecé gab ihm eine Zechine.
»Offenbar wollten sie mir ans Leben«, sagte er.
Die Kirche strahlte im Glanze von mindestens tausend Kerzen.
»Seltsam! Messe zu dieser Stunde?« fragte der Chevalier den Mönch.
»Zu Befehlen, Eccellenza! Mit besonderer Erlaubnis Seiner Eminenz des Herrn Kardinal-Vikars.«
Das Chor der kleinen Kirche, genannt San Francesco a Ripa, war auf das prächtigste zu einer Trauerfeier hergerichtet. Man sang die Totenmesse.
»Wer ist der Verstorbene?« erkundigte sich Senecé. »Ein Fürst?«
»Ich glaube«, antwortete der Priester. »Denn man hat nichts gespart. Wahrlich, das ist Geld- und Lichtverschwendung! Der Herr Pfarrer hat uns übrigens erzählt, der Entschlafene sei ohne das Sakrament gestorben.«
Senecé ging näher heran und erblickte ein Wappenschild von französischer Form. Seine Neugier steigerte sich. Er trat dicht an den aufgebahrten Sarg und erkannte sein eigenes Wappen und las die lateinische Inschrift:
NOBILIS HOMO IOANNES NORBERTVS SENECE EQVES DECESSIT ROMAE A.D.MDCCXXVI
Zu deutsch: Der edle Herr Johann Norbert Chevalier von Senecé, gestorben zu Rom im Jahre des Herrn 1726.
»So habe ich also den Vorzug, meiner eigenen Leichenfeier beizuwohnen«, sagte sich Senecé halblaut. »Bisher hat sich meines Wissens nur Kaiser Karl V. dieses Vergnügen geleistet. Mir scheint, hier weiter zu verweilen ist vom Übel.«
Er gab dem Mesner ein zweites Goldstück.
»Pater, laßt mich durch das Hinterpförtchen Eures Klosters hinaus!«
»Sehr gern, Eccellenza!« erwiderte der Mönch.
Kaum war der Chevalier auf der Straße, da begann er, in der Linken den Dolch, in der Rechten sein Pistol, zu laufen, was er nur konnte. Bald hörte er wiederum hinter sich Verfolger. Als er vor seinem Haus anlangte, schien ihm die Tür verschlossen zu sein. Ein Mann stand davor.
›Jetzt gibts einen Kampf!‹ dachte der junge Franzose.
Eben wollte er den Dastehenden niederknallen, da gewahrte er, daß es sein Kammerdiener war.
»Schließ auf!« rief er ihm zu.
Die Tür war offen. Beide huschten hinein und verriegelten die Tür.
»Gnädiger Herr,« meldete der Diener, »ich habe Euer Gnaden überall gesucht. Ich habe Trauriges zu berichten. Der arme Johann, der Kutscher, ist erdolcht worden. Die Mörder stießen Flüche auf Euer Gnaden aus. Der Dolchstoß hat dem gnädigen Herrn gegolten...«
Der Diener wollte noch mehr sagen. Da schlugen ein halbes Dutzend Flintenschüsse gleichzeitig durch eins der offenen Fenster, die von der Halle des Hauses nach dem Garten hinaus gingen.
Senecé und sein Kammerdiener stürzten tot nieder. Beide von mehreren Kugeln durchbohrt.
Zwei Jahre später stand die Fürstin von Campobasso im Gerücht, die frömmste Frau Roms zu sein. Monsignore Ferraterra war längst Kardinal.
Die Truhe
Eines schönen Maienmorgens im Jahre 1827 ritt Don Blas Bustos y Mosquera, der Polizeimeister von Granada, mit einem Gefolge von dreizehn Reitern ins Dorf Alcolote. Es liegt eine Wegstunde von der Stadt. Bei seinem Anblick rannten die Bauern in ihre Häuser und verriegelten die Türen. Voll Schaudern lugten die Weiber aus den Fensterecken nach dem schrecklichen Manne. Die Vorsehung hatte seine Grausamkeit gestraft und seiner Gestalt den Ausdruck seiner Seele aufgedrückt. Er war sechs Fuß lang, schwarz und gräßlich mager, vom Scheitel bis zur Sohle Polizeimeister; der Bischof und der Gouverneur zitterten vor ihm.
Während des Volkskrieges gegen Napoleon, in jenen Guerillakämpfen, die den Spanier des neunzehnten Jahrhunderts vor der Nachwelt dem Franzosen gleichwertig machen, war Don Blas ein berühmter Bandenführer. An Tagen, da seine Schar nicht wenigstens einen Franzosen zur Strecke brachte, schlief er in keinem Bett; das hatte er geschworen.
Nach Ferdinands Rückkehr (1814) kam er auf die Galeeren von Ceuta. Acht Jahre ertrug er entsetzliches Elend. Man hatte ihn beschuldigt, er wäre in seiner Jugend Kapuziner gewesen und dem Kloster entsprungen. Schließlich ward er begnadigt; niemand erfuhr, warum. Nie spricht er ein Wort. Seine Schweigsamkeit ist allbekannt. Ehedem rühmte man seinen scharfen Witz. Keinen Gefangenen ließ er henken, ehe er ihm ein drastisches Wort zugerufen hatte. Seine gräßlichen Scherze erzählten sich beide Heere.
Don Blas ritt im Schritt durch die Dorfstraße, mit seinen Luchsaugen links und rechts die Häuser musternd. Als er vor die Kirche kam, läutete es zur Messe. Er flog aus dem Sattel; absitzen konnte man das nicht nennen. Vor dem Altar sank er in die Knie. Vier seiner Gendarmen taten dasselbe; dann blickten sie ihm in die Augen. Von Andacht sahen sie nichts darin. Sein finsterer Blick starrte auf einen jungen Herrn von fast vornehmem Aussehen, der unweit von ihm im Gebet versunken war.
›Ein Mann der Gesellschaft – und ich kenne ihn nicht?‹ dachte Don Blas. ›Den habe ich in Granada niemals gesehen. Also verbirgt er sich.‹
Er wandte sich einem seiner Leute zu und gab den Befehl, den jungen Menschen beim Austritt aus der Kirche zu verhaften.
Nach dem Ite, missa verließ er selber rasch das Gotteshaus und begab sich in den Saal des Wirtshauses von Alcolote.
Alsbald brachte man den jungen Mann, der offenbar nicht wußte, was ihm geschah.
»Euer Name?«
»Don Fernando della Cueva.«
Des Polizeimeisters üble Laune nahm zu, als er, jetzt aus der Nähe, sah, daß Don Fernando ein hübsches Gesicht hatte. Er war blond, und trotz der schlimmen Lage wahrte er seine sanfte Miene.
Nachdenklich betrachtete Don Blas den jungen Mann.
»Was habt Ihr unter den Cortes getrieben?« fragte er nach einer Weile.
»Im Jahre achtzehnhundertdreiundzwanzig war ich auf der Schule zu Sevilla. Damals war ich fünfzehn, heute bin ich neunzehn Jahre alt.«
»Wovon lebt Ihr?«
»Mein Vater, Brigadekommandeur im Heere des Don Carlos Cuarto – Gott segne das Andenken des guten Königs! – hat mir ein kleines Gut hier in der Nähe hinterlassen. Es bringt mir tausend Taler im Jahre. Ich bewirtschafte es eigenhändig mit drei Knechten ...«
»Die Euch zweifellos sehr treu sind!« unterbrach ihn Don Blas, bitter lächelnd. »Ein guter Fang!«
»Ins Gefängnis!« befahl er. »Doch ohne Aufsehen!«
Den Verhafteten seinen Leuten überlassend, ging er und setzte sich an den Frühstückstisch.
›Ein halbes Jahr Gefängnis‹, dachte er bei sich, ›das ist die richtige Quittung auf so gesunde Farbe, so frisches Wesen, so unverschämte Zufriedenheit!‹ Im Augenblick, wo der Küchenjunge das Mahl brachte, hob der Reiter, der an der Tür des Gastzimmers Wache stand, seinen Karabiner, einen alten Mann zu bedrohen, der mit herein wollte.
Der Polizeimeister sprang auf. Hinter dem Greise sah er ein junges Mädchen, bei deren Anblick Don Fernando vergessen war.
»Nicht gerade nett, mich beim Essen zu stören«, sagte er zu dem Alten. »Doch tretet ein; sagt, was Ihr wollt!« Während er dies sagte, starrte er die Begleiterin an. Es dünkte ihn, auf ihrer Stirn und aus ihren Augen leuchte die himmlische Unschuld der Madonna auf den Bildern der alten Italiener.
Was der Alte vortrug, hörte er nicht. Daß er essen wollte, hatte er vergessen. Immerfort schaute er auf das Mädchen.
Endlich erwachte er aus seinem Traumzustande. Zum dritten oder vierten Male wiederholte der Alte, warum Don Fernando della Cueva, seit langem der Bräutigam seiner Tochter, freigelassen werden müsse.
Bei dem Worte Bräutigam schoß ein derart grimmiger Blitz aus dem Auge des Schreckensmannes, daß das Mädchen und sogar der Vater zusammenfuhren.
»Wir haben immer in der Furcht Gottes gelebt«, begann der Alte von neuem. »Wir sind gute Christen. Meine Familie ist alt, aber ich bin arm, und Don Fernando ist eine gute Partie für meine Tochter. Ines heißt sie. Ich habe nie ein Amt gehabt, weder zur Franzosenzeit noch vorher oder nachher.«
Don Blas verharrte in düsterem Schweigen.
Der alte Mann fuhr fort: »Ich gehöre zum Uradel des Königreichs Granada – und vor der Revolution hätte ich einem unverschämten Mönche, der mir nicht Rede und Antwort zollt, die Ohren abgehauen.«
Dem Greise standen Tränen in den Augen. Vor Furcht zog Ines einen Rosenkranz aus ihrem Busen, der am Gewand der Madonna del Pilar geweiht war, und ihre niedlichen Hände umkrampften das Kreuz. Auf diese Hände starrte Don Blas; und dann umschlangen seine Augen die ganze Gestalt der schönen, schon etwas üppigen Jungfrau.
›Ihr Gesicht könnte regelmäßiger sein‹, dachte er; ›aber ihre Anmut ist überirdisch.‹
»Ihr seid Don Jaimo Arregui?« fragte er endlich.
»So heiße ich.«
»Siebzig alt?«
»Neunundsechzig.«
»Ich bin also beim Richtigen«, sagte Don Blas, und sein faltenreiches Gesicht hellte sich sichtlich auf. »Euch suchte ich schon lange. Unser Herr und König hat allergnädigst geruht, Euch ein Jahresgeld von dreihundert Talern auszusetzen. Zwei Jahresraten dieses Ehrensolds sind fällig. Ich habe sie in meinem Hause zu Granada. Morgen mittag werde ich sie Euch bei mir einhändigen. Zugleich werde ich Euch die Beweise zeigen, daß ich Altkastilianer und reicher Grundbesitzer bin, guter Christ wie Ihr, und daß ich niemals die Kutte getragen habe. Damitist Eure Beleidigung von vorhin hinfällig.«
Der alte Edelmann getraute sich nicht, der Zusammenkunft auszuweichen. Er war Witwer und Ines sein einziges Kind. Ehe er nach Granada aufbrach, vertraute er seine Tochter dem Pfarrer an, und er traf Anordnungen, als ob er nimmer wiederkehre.
Der Polizeimeister empfing ihn in Gala, ein Großordensband unter dem Rock. Er benahm sich wie ein urbaner alter Offizier, der Gutes stiften will. Er lächelte, bei jedem Anlaß und auch ohne Anlaß.
Wenn er es hätte wagen können, so hätte Don Jaimo die sechshundert Taler, die ihm Don Blas zahlte, ausgeschlagen. Er mußte mit ihm essen; auch das war nicht auszuschlagen. Und nach dem Mahle gab ihm der furchtbare Mann alle seine Papiere zu lesen, vom Taufzeugnis an bis zu einer Urkunde, die seine Freilassung von der Galeere erklärte und es bestätigte, daß Don Blas niemals Mönch gewesen war.
Don Jaimo war nach wie vor auf irgendwelchen schlimmen Scherz gefaßt.
Da hob Don Blas an:
»Ihr seht, ich bin zweiundvierzig Jahre alt, habe eine ehrenhafte Stelle mit einem Gehalt von dreitausend Talern. Auf der Bank von Neapel habe ich eine Rente von tausend Dukaten ... Ich bitte um die Hand Eurer Tochter.« Don jaimo ward leichenblaß. Eine Weile herrschte Stille.
Don Blas begann zuerst wieder zu sprechen: »Eines darf ich Euch nicht verhehlen. Don Fernando della Cueva ist in eine schlimme Sache verwickelt. Er steht längst auf der Fahndungsliste. Es droht ihm die Garrötte, mindestens die Galeere. Ich war acht Jahre auf den Galeeren. Ihr könnt mir glauben: ein übler Aufenthalt!« Er rückte dem Alten näher und flüsterte ihm ins Ohr: »In spätestens drei Wochen bekomme ich vom Justizministerium den Befehl, Don Fernando aus dem Gefängnis von Alcolote nach dem hiesigen zu bringen. Ich werde dafür sorgen, daß der Befehl am Spätabend dort eintrifft. Will Don Fernando die Nacht benutzen, zu entkommen, so will ich in Rücksicht auf Eure echte Freundschaft zu ihm ein Auge zudrücken. Er kann auf ein, zwei Jahre verschwinden; sagen wir, nach Majorca in Australien. Inzwischen wird man ihn vergessen.« Der greise Edelmann gab keine Antwort. Er war zusammengebrochen; mit Mühe und Not kam er in sein Dorf zurück.
»Das ist also das Blutgeld für Don Fernando, meinen Freund, den Bräutigam meiner Ines!«
Im Hause des Pfarrers nahm er sein Kind in die Arme. »Der Mönch begehrt dich zum Weibe!«
Ines trocknete sehr bald ihre Tränen und bat, den Rat des Pfarrers, der in der Kirche war, im Beichtstuhle einholen zu dürfen.
Bei aller Gefühllosigkeit seines Alters und seines Standes weinte der Priester. Sie müsse sich entschließen, riet er, entweder zur sofortigen Flucht oder zur Heirat mit Don Blas. Im ersten Falle solle der Vater versuchen, Gibraltar zu erreichen, und von da England.
»Und wovon leben wir dort?« fragte Ines.
»Ihr müßtet Haus und Hof verkaufen.«
»Wer sollte das kaufen?«
»Ich habe mir dreihundert Taler gespart«, sagte der Pfarrer; »die gebe ich Euch gern, wenn Ihr nicht glaubt, Euer Glück zu machen, indem Ihr Don Blas heiratet.«
Vierzehn Tage später stand die Polizei von Granada in Parade um die Kirche San Dominico. Es ist so dunkel darin, daß man am hellen Mittag nicht sieht, wohin man den Fuß setzt. Kein Mensch außer den Geladenen wagte sich an diesem Tage hinein.
In einer Seitenkapelle brannten Hunderte von Kerzen. Der Lichterschein brach eine Feuerbahn durch das Kirchendunkel, und schon am Portal sah man auf den Altarstufen einen Mann knien, der alle andern um Kopflänge überragte. Sein Haupt war fromm geneigt, seine schlanken Arme kreuzten sich über der Brust. Er erhob sich; man sah die Orden unter dem Rocke. Er reichte einem jungen Weibe die Hand. Behend und jugendlich, in seltsamem Gegensatz zu des Mannes steifer Würde, schritt sie ihm zur Seite. Tränen schimmerten in den Augen der jungen Gattin, aber in ihrem Antlitz überwog engelhafte Sanftmut allen Kummer, und das Volk staunte, als sie vor der Kirche in die Hochzeitskutsche stieg.
Unstreitig war Don Blas fortan milder als zuvor. Die Hinrichtungen verminderten sich. Statt die Verurteilten von hinten zu erschießen, ließ er sie bloß henken. Manchmal erlaubte er ihnen sogar, vor dem letzten Gange ihre Angehörigen zu umarmen.
Eines Tages sprach er zu seiner Frau, die er unsinnig liebte: »Ich bin eifersüchtig auf die Sancha.«
Sancha war die Milchschwester und Freundin von Ines. Sie hatte als Zofe seiner Tochter bei Don Jaimo gewohnt und war in gleicher Eigenschaft in den Palazzo des Don Blas gekommen.
»Wenn ich nicht bei dir bin«, sagte er, »so bist du allein mit Sancha und redest immer mit ihr. Sie ist fröhlich und macht dich guter Dinge. Ich bin ein alter Soldat und habe einen ernsten Beruf. Ich weiß, ich bin kein heiterer Mensch. Deine Sancha mit ihrem ewigen Lachen macht mich in deinen Augen zum alten Griesgram. Hier hast du den Schlüssel zum Geldschrank! Gib ihr so viel Geld, wie du willst! Meinetwegen alles, was drin ist. Sie soll fort. Sie muß fort. Ich will sie nicht mehr sehen.«
Als Don Blas abends aus dem Dienst heimkam, war das erste Wesen, dem er begegnete, Sancha; sie tat wie sonst ihre Arbeit. Er trat an sie heran. Sie schaute auf und sah ihn mit jenem spanischen Blick an, in dem sich so seltsam Furcht, Mut und Haß mischen. Don Blas lachte auf.
»Liebe Sancha«, sagte er, »hat Frau Ines dir gesagt, daß ich dir sechshundert Taler Rente aussetzen will?«
»Ich nehme nur von meiner Herrin Geschenke«, erwiderte sie, ihn noch immer fest anschauend. Don Blas trat in das Zimmer seiner Frau.
»Wieviel Gefangene hast du zur Zeit im Gefängnisse zur Torre Vieja?« fragte sie.
»In den Kellern zweiunddreißig, und zweihundertundsechzig, glaube ich,in den oberen Stockwerken. Warum?«
»Gib ihnen die Freiheit!« sagte Ines. »Und ich trenne mich von der einzigen Freundin, die ich auf Gottes Erde habe.«
»Das geht über meine Macht!«
Den ganzen Abend sprach er kein Wort mehr. Ines arbeitete bei ihrer Lampe; sie sah, wie er im Wechsel rot und blaß wurde. Sie legte ihre Stickerei hin und begann ihren Rosenkranz zu beten.
Am nächsten Tage das nämliche Schweigen.
In der Nacht darauf brach in der Torre Vieja Feuer aus. Zwei Gefangene kamen um; alle übrigen entkamen trotz der Wachsamkeit des Kerkermeisters und seiner Gesellen.
Zwischen Ines und ihrem Manne fiel kein Wort darüber; aber als er andern Tags nach Hause kam, war Sancha fort. Er warf sich Ines in die Arme.
Anderthalb Jahre war es her, daß es in der Torre Vieja gebrannt hatte, als vor der elendesten Herberge des Dorfes La Zuia ein staubbedeckter Reiter absaß. Der Ort liegt eine Wegstunde südlich von Granada, während Alcolote nördlich liegt. Granada ist sozusagen eine zauberische Oase inmitten der ausgedörrten andalusischen Hochebene. Seiner Tracht nach mußte man den Fremden für einen Katalonier halten, und sein in Majorca ausgestellter Paß war auch visiert in Barcelona, wo er gelandet war. Der Herbergswirt war arm. Als er dem Reisenden den Paß zurückgab, der auf den Namen Don Pablo Rodil lautete, sagte er mit einem scharfen Blick auf den Katalonier:
»Gnädiger Herr, ich werde Eure Exzellenz aufmerksam machen im Falle, daß die Polizei von Granada sich nach Eurer Exzellenz erkundigt.«
Der Fremde sagte, er wolle die schöne Gegend ansehen; er ging eine Stunde vor Sonnenaufgang fort und kam erst um Mittag zurück, während der ärgsten Hitze, wo jedermann bei Tisch sitzt oder Siesta hält.
Don Fernando war in Granada gewesen. Mehrere Stunden hatte er auf einem Hügel, wo junge Korkeichen standen, gesessen und nach dem Inquisitionspalast geschaut, in dem Don Blas und Ines ihre Wohnung hatten. Er vermochte den Blick nicht wegzuwenden von den alten schwarzen Mauern, die das Häusergewirr der Stadt riesenhaft überragten.
Als er Majorca verließ, hatte Fernando sich geschworen, nie Granada zu betreten. Aber eines Tages packte ihn die Sehnsucht allzu stark. Er begab sich in das Gäßchen am Inquisitionspalast und ging unter einem Vorwand, der ihm zu reden und zu verweilen gestattete, in den Laden eines Handwerkers. »Jawohl, dort oben«, sagte der Meister, »sind die Fenster vom Schlafzimmer der Donna Ines.« Er wies nach dem sehr hohen zweiten Stock.
Um die Siesta machte sich Don Fernando auf den Rückweg nach La Zuia. Die Furien der Eifersucht peitschten ihn. Am liebsten hätte er Ines erdolcht und dann sich selber umgebracht.
›Ich bin ein Feigling‹, warf er sich vor, ›ein Schwächling, während sie die Kraft hat, ihn zu lieben, weil sie wähnt, es wäre ihre Pflicht!‹
An einer Straßenecke begegnete er Sancha.
»Freundin!« rief er sie an, tat aber so, als spräche er nicht mit ihr. »Ich heiße Don Pablo Rodil. Ich wohne in La Zuia, im ›Engel‹ Kannst du morgen beim Abendläuten an der Großen Kirche sein?«
»Ich werde dasein«, entgegnete Sancha, ohne ihn anzublicken.
Am folgenden Abend sah Don Fernando Sancha kommen. Ohne ein Wort zu sagen, ging er nach seiner Herberge, und ohne daß es jemand sah, trat auch sie dort ein.
Fernando schloß seine Tür.
»Nun?« fragte er, Tränen im Auge.
»Ich bin nicht mehr bei ihr im Dienst«, antwortete Sancha. »Vor anderthalb Jahren hat sie mich weggeschickt, ohne Anlaß, ohne Erklärung. Ich bin überzeugt: Sie liebt Don Blas.«
»Sie liebt Don Blas?« schrie Don Fernando, sich die Tränen abwischend. »Auch das noch!«
»Ich habe mich ihr zu Füßen geworfen und sie bei allen Heiligen gebeten, mir den Grund ihrer Ungnade zu sagen. Kalt hat sie mir zur Antwort gegeben: ›Mein Mann will es!‹ Kein Wort mehr. Ihr wißt, sie war schon immer sehr fromm. Jetzt ist ihr Leben ein endloses Gebet.«
Um der herrschenden Partei zu gefallen, hatte Don Blas es zuwege gebracht, daß ein Teil des Inquisitionspalastes, in dem er seine Wohnung hatte, den Klarissinnen eingeräumt worden war. Die Nonnen hatten sich darinnen breitgemacht und sich auch eine Kirche eingerichtet. Donna Ines war fast immer bei ihnen. Sowie Don Blas aus dem Hause war, fand man sie nur kniend am Altar der ewigen Anbetung. »Sie liebt ihn?« wiederholte Don Fernando. »Dieses Scheusal?«
»Am Tage, bevor ich entlassen ward, sagte Donna Ines zu mir...«
»Ist sie froher Laune?« unterbrach er sie.
»Das nicht. Aber sie lebt in gleichmäßiger sanfter Stimmung, ganz anders als damals, als Ihr sie kanntet. Von ihrem früheren Frohsinn, ihrer Tollheit, wie der Pfarrer es nannte, hat sie nichts mehr.«
»Die Treulose, Ehrlose, Schamlose!« Fernando raste durch die Stube. »So hält sie ihren Schwur! Das ist ihre Liebe! Nicht einmal traurig ist sie, während ich...«
»Wie ich Eurer Gnaden bereits gesagt habe«, begann Sancha abermals, »am Tage, bevor ich entlassen ward, sprach Donna Ines mit mir in Güte und Freundschaft, wie einst in Alcolote. Und andern Tags sagte sie bloß: ›Mein Mann will es!‹ Weiter nichts. Dabei gab sie mir eine Urkunde, die mir die schöne Rente von hundert Talern sichert.«
»Zeig mir das Schriftstück!«
Er küßte den Namenszug der Geliebten.
»Hat sie je von mir gesprochen?«
»Niemals. Sogar der alte Don Jaimo hat ihr in meiner Gegenwart einmal vorgeworfen, daß sie einen so lieben Nachbar ganz und gar vergessen könne. Sie ward bleich, entgegnete aber nichts. Sie geleitete ihren Vater zur Tür und eilte dann in die Kapelle, wo sie sich einschloß.«
»Ich bin der größte Narr!« rief Don Fernando. »Hassen werde ich sie immerdar. Sprechen wir nicht mehr von ihr. Ein Glück, daß ich wieder nach Granada gekommen bin, und vor allem, daß ich dich getroffen habe. Und du, Sancha, was treibst du?«
»Ich habe in Albaracen, eine halbe Stunde vor Granada, einen Kramladen...« Und im Flüstertone setzte sie hinzu: »Ich handle da mit schönen englischen Waren, die mir die Schmuggler aus den Alpujarras bringen. Mein Lager ist mehr als dreitausend Taler wert. Ich bin zufrieden.« »Du hast also einen Banditen der Alpujarras zum Liebsten ... Wir werden uns kaum wiedersehen. Hier nimm meine Uhr zum Andenken an mich!«
Als Sancha gehen wollte, hielt er sie zurück.
»Was meinst du?« fragte er. »Soll ich sie aufsuchen?«
»Sie würde vor Euch fliehen«, erwiderte Sancha, »und wenn sie sich aus dem Fenster stürzen müßte. Seid auf der Hut! Allezeit streifen Aufpasser um ihr Haus. Wie Ihr Euch auch verkleidet, man wird Euch erwischen.«
Fernando schämte sich seiner Schwäche und sagte nichts mehr, entschlossen, sich am kommenden Tage wieder nach Australien einzuschiffen.
Acht Tage darauf fügte es der Zufall, daß Don Fernando durch Albaracen kam. Briganten hatten den Generalkapitän O'Donnell gefangen und ihn eine Stunde lang bäuchlings in den Sumpf gehalten. Don Fernando erblickte Sancha, die voll Geschäftseifer durchs Dorf lief.
»Hier habe ich keine Zeit, mit Euch zu reden!« rief sie ihm zu. »Kommt zu mir!«
Ihr Laden war geschlossen. Sie selber war dabei, englische Waren in eine Truhe aus schwarzem Eichenholz zu stopfen.
»Wahrscheinlich werden wir heute nacht angegriffen«, sagte sie zu Don Fernando. »Meinem Laden droht Beschlagnahme. Ich komme eben aus Granada. Donna Ines, die immer gütige, hat mir erlaubt, meine kostbarsten Waren in ihrem Schlafzimmer unterzubringen. Sollte Don Blas die Truhe bemerken, so wird Donna Ines eine Ausrede finden.«
Sie fuhr fort, ihre Schale und Schleier eiligst einzupacken. Don Fernando sah zu. Plötzlich stürzte er sich auf die Truhe, warf heraus, was drinnen war, und legte sich dafür hinein.
»Bist du verrückt geworden?« fragte Sancha.
»Hier sind fünfzig Dukaten! Der Teufel soll mich holen, wenn ich diese Truhe verlasse, ehe sie im Inquisitionspalast zu Granada steht! Ich muß Ines sehen.«
Was die erschrockene Sancha auch einwenden mochte, Don Fernando blieb taub dagegen.
Sie sprach noch, als Zanga, ein Lastträger, Sanchas Vetter, ins Haus trat. Er sollte die Truhe auf seinem Maultiere nach Granada schaffen. Als Don Fernando seine Schritte hörte, machte er den Deckel zu, und Sancha schloß mit einem Seufzer die Truhe ab. Sie offenzulassen wäre unklug gewesen.
Also zog Don Fernando an einem Sommertage um elf Uhr in seiner Truhe in Granada ein. Er war dem Ersticken nahe. Im Inquisitionspalast angekommen, trug Zanga seine Last Treppen hinauf. Es kam Don Fernando vor, als sei es im zweiten Stock, wo die Truhe hingestellt ward. Er hörte, wie sich der Träger entfernte und die Tür ins Schloß fiel. Dann war kein Laut mehr zu hören.
Er versuchte mit seinem Dolche den Riegel des Truheschlosses zurückzuschieben. Es gelang ihm. Zu seiner grenzenlosen Freude sah er sich im Schlafgemach der Geliebten. Er bemerkte Frauenkleider und neben dem Bett das Kruzifix, das Ines schon in ihrer Kammer zu Alcolote gehabt hatte. Einmal, nach einem Zwist, hatte sie ihn in ihr Gemach geführt und ihn auf dieses Kruzifix ewige Liebe schwören lassen.
Der Raum war sehr dunkel und die Hitze darin gewaltig. Die Läden waren geschlossen, und die türkischen Musselinvorhänge zugezogen. Die tiefe Stille ward nur unterbrochen durch das leise Plätschern eines kleinen Springbrunnens in der Ecke. Ein dünner Wasserstrahl fiel aus ein paar Fuß Höhe in eine Muschel aus schwarzem Marmor zurück. Vor diesem schwachen Geräusch erbebte Don Fernando, er, der in seinem Leben hundert Proben tollkühner Tapferkeit abgelegt hatte. Von dem vollkommenen Glück, das er sich in Majorca immer von neuem erträumt hatte, nachgrübelnd, wie er je einmal in das Schlafgemach der Ersehnten gelangen könne, davon empfand er nicht das geringste. Seine Verbannung, die Trennung von den Seinen, sein ganzes Unglück, seine leidenschaftliche Liebe, alles das, was ihn halb wahnsinnig gemacht, überwältigte ihn in diesem Augenblicke, und ein einziger Gedanke entwuchs diesem Wirrwarr seiner Gefühle: die Furcht, Ines zu mißfallen, die scheu und keusch in seiner Erinnerung lebte.
Er war einer Ohnmacht nahe, als die Klosteruhr zwei schlug und er leichte Tritte die steinerne Treppe heraufkommen hörte. Sie kamen an die Tür. Don Fernando kannte den Schritt. Es war Ines. Rasch verbarg er sich in der Truhe; er hatte nicht den Mut, dem ersten Ausbruche der Entrüstung eines pflichtgetreuen Weibes standzuhalten.
Ines legte sich auf ihr Bett, und bald merkte Don Fernando an ihren gleichmäßigen Atemzügen, daß sie eingeschlafen war. Erst jetzt wagte er sich an das Bett und erblickte sie, der seit Jahr und Tag alle seine Gedanken galten.
Er erschrak vor der Schläferin, die ahnungslos in seiner Gewalt war, und seine sonderbare Furcht verstärkte sich, als er wahrnahm, daß ihre Gesichtszüge in den zwei Jahren der Trennung einen ihm fremden Ausdruck kalter Würde angenommen hatten. Ein reizvoller Gegensatz zu dieser Strenge lag in der leichten Unordnung ihres Sommerkleides. Und allmählich füllte sich sein Herz mit dem Glücke des Wiedersehens.
Wenn Ines ihn erblickt, so ist ihr erster Gedanke die Flucht. Das wußte er. Deshalb schloß er die Tür ab und steckte den Schlüssel ein.
Endlich kam der Augenblick, der seine Zukunft entscheiden sollte. Ines regte sich. Offenbar erwachte sie. Einer plötzlichen Eingebung zufolge kniete Don Fernando vor dem Kruzifix nieder. Ines schlug ihre schlaftrunkenen Augen auf, und es war ihr: der Geliebte wäre hunderttausend Meilen fern gestorben und seine Gestalt da am Kruzifix sei eine Vision. Sie richtete sich auf und faltete die Hände, erstarrt auf dem Bettrande sitzend. »Lieber, armer Fernando!« flüsterte sie in tiefster Erregung.
Ebenso erregt machte Don Fernando, der noch immer vor dem Kruzifix kniete, eine Bewegung, um Ines besser zu sehen. Jetzt erwachte sie völlig, begriff die Wahrheit und sprang auf.
»Welche Verwegenheit!« rief sie. »Verlaßt mich, Don Fernando!«
Sie flüchtete in die entfernteste Ecke des Gemaches, wo der Springbrunnen plätscherte.
»Kommt mir nicht zu nahe! Kommt mir nicht zu nahe! Entfernt Euch unverzüglich!«
In ihren Augen leuchtete die reinste Tugend.
»Ines, ich gehe nicht eher«, erwiderte Don Fernando, »als bis du mich angehört hast. Ich habe dich in den zwei Jahren nicht vergessen können. Tag und Nacht hatte ich dein Bild vor Augen. Vor diesem Kruzifix hast du mir geschworen, ewig die Meine zu sein.«
Voll Zorn rief sie: »Geht oder ich rufe die Leute – und wir sind beide des Todes.«