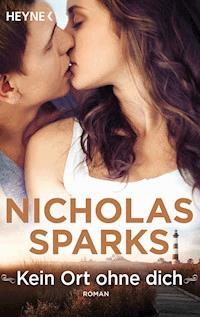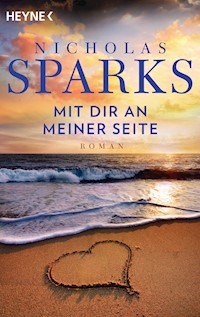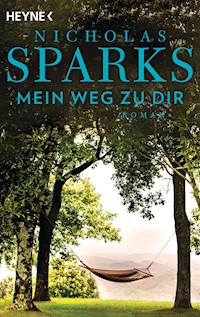9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Mit 34 glaubt Russell auf der absoluten Glücksseite des Lebens zu stehen: Er hat eine umwerfende Frau und eine süße kleine Tochter, ein wunderschönes Haus und beruflichen Erfolg. Aber dann zerbricht sein Traum binnen kürzester Zeit: Er verliert seinen Job, und in seiner Ehe zeigen sich gefährliche Risse. Plötzlich steht er als beinahe alleinerziehender Vater da und fühlt sich vollkommen überfordert. Doch noch größere Herausforderungen warten auf ihn – und mit ihnen die Chance auf ein neues Glück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 734
Ähnliche
ZUM BUCH
Eigentlich läuft alles nach Plan für Russell: Er hat eine fantastische Ehefrau, Vivian, eine süße kleine Tochter und ein wunderschönes großes Haus in North Carolina. Beruflich hat er endlich den Sprung gewagt und sich mit einer kleinen Werbeagentur selbstständig gemacht. Leider hat er noch keinen einzigen Auftrag, doch er ist voller Vertrauen auf die Zukunft. Aber dann bewegt sich sein Leben plötzlich in atemberaubender Geschwindigkeit in eine ganz andere Richtung als geplant: Mit einem Mal muss er um seinen Beruf und seine Ehe kämpfen, und dann findet er sich auch noch in der Rolle des alleinerziehenden Vaters wieder. Die fünfjährige London ist ein wunderbares Kind, dennoch fühlt sich Russell zunächst völlig überfordert von seinem neuen Leben und seiner neuen Verantwortung. Und gerade als er glaubt, alles langsam wieder in den Griff zu bekommen, warten weitere ungeahnte emotionale Herausforderungen auf ihn …
ZUM AUTOR
Nicholas Sparks, 1965 in Nebraska geboren, lebt in North Carolina. Mit seinen Romanen, die ausnahmslos die Bestsellerlisten eroberten und weltweit in über 50 Sprachen erscheinen, gilt Sparks als einer der meistgelesenen Autoren der Welt. Mehrere seiner Bestseller wurden erfolgreich verfilmt. Alle seine Bücher sind bei Heyne erschienen, zuletzt Wenn du zurückkehrst.
www.nicholas-sparks.de
NICHOLAS
SPARKS
Seitdu
beimirbist
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Astrid Finke
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel TWO BY TWO bei Grand Central Publishing/Hachette Book Group USA, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2016 by Willow Holdings, Inc.
Copyright © 2017 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Lüra – Klemt & Mues GbR
Umschlaggestaltung: t.mutzenbach design, München
Umschlagkonzept: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Umschlagfoto: Johner Royalty-Free/gettyimages und Africa Studio, BrAt82, marina shinkarchuk/shutterstock.com
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-10246-3V008
www.heyne.de
www.nicholas-sparks.de
Für euch, meine treuen Leserinnen und Leser:
Danke für die letzten zwanzig Jahre
Kapitel 1
Vater, Mutter, Kind
»Wow!«, erinnere ich mich gesagt zu haben, als Vivian mit dem positiven Schwangerschaftstest aus dem Bad kam. »Das ist ja super!«
In Wahrheit gingen meine Gefühle eher in Richtung: Ehrlich? Jetzt schon?
Es war mehr ein Schock als alles andere, gewürzt mit einer Prise Panik. Wir waren erst seit gut einem Jahr verheiratet, und sie hatte bereits gesagt, dass sie vorhabe, die ersten Jahre zu Hause zu bleiben, wenn wir irgendwann ein Kind bekämen. Ich hatte ihr immer beigepflichtet, doch in jenem Moment begriff ich, dass unser Leben als Doppelverdiener bald vorbei sein würde. Darüber hinaus war ich mir nicht sicher, ob ich schon bereit war, Vater zu werden, aber was sollte ich tun? Sie hatte mich ja nicht hereingelegt oder mir verheimlicht, dass sie sich ein Baby wünschte, und sie hatte mir Bescheid gesagt, als sie die Pille absetzte. Natürlich wollte ich auch Kinder, aber wir verhüteten erst seit wenigen Wochen nicht mehr. Ich weiß noch, dass ich dachte, es würde wahrscheinlich ein paar Monate dauern, bis ihr Körper sich wieder umgestellt hatte.
Aber nicht bei meiner Vivian. Ihr Körper hatte sich sofort wieder umgestellt. Meine Vivian war fruchtbar.
Ich schlang die Arme um sie und musterte sie. Strahlte sie schon? Doch dafür war es noch zu früh, oder? Was genau bedeutete dieses Strahlen überhaupt? War das einfach eine andere Formulierung für verschwitzt sein? Inwiefern würde sich unser Leben verändern? Und wie stark?
Fragen kreisten und kreisten, und als ich damals meine Frau im Arm hielt, wusste ich, Russell Green, auf keine davon eine Antwort.
Monate später war es so weit, wobei ich zugeben muss, dass ein Großteil jenes Tages in meiner Erinnerung verschwimmt.
Heute denke ich, ich hätte wahrscheinlich besser alles aufgeschrieben, als es noch frisch war. Einen Tag wie diesen sollte man in allen Einzelheiten erinnern, nicht nur in den unscharfen Bildern, die ich im Gedächtnis habe. Dass ich überhaupt noch so viel davon weiß, liegt an Vivian. Ihr scheint sich jedes Detail tief eingeprägt zu haben. Andererseits war sie ja auch diejenige, die die Wehen ertragen musste, und Schmerz kann das Bewusstsein schärfen. Heißt es zumindest.
Eines weiß ich allerdings: Manche unserer Erinnerungen an die Ereignisse an jenem Tag weichen leicht voneinander ab. Zum Beispiel fand ich mein Verhalten unter den gegebenen Umständen völlig nachvollziehbar, während Vivian mich mal egoistisch, mal schlichtweg einen Idioten nannte. Wenn sie ihren Freundinnen die Geschichte erzählte – und das hat sie oft getan –, brachen sie in Gelächter aus oder schüttelten den Kopf und sahen sie mitleidig an.
In meinen Augen allerdings war ich weder egoistisch noch ein Idiot; immerhin war es unser erstes Kind, und keiner von uns beiden wusste genau, was zu erwarten war, als die Wehen einsetzten. Ist man je bereit dafür? Eine Entbindung, war mir erklärt worden, konnte ganz unterschiedlich verlaufen – mehr als ein Mal erinnerte Vivian mich während der Schwangerschaft daran, dass es von den ersten Wehen bis zur tatsächlichen Geburt länger als einen Tag dauern könne, besonders beim ersten Kind, zwölf Stunden seien keine Seltenheit. Wie die meisten werdenden Väter betrachtete ich meine Frau als Expertin, immerhin war sie diejenige, die viele Bücher darüber gelesen hatte.
Es sollte auch festgehalten werden, dass ich am fraglichen Morgen beileibe nicht komplett versagte. Ich hatte meine Verantwortung ernst genommen. Sowohl Vivians Tasche als auch die für das Baby waren gepackt, beide waren mehrfach auf Vollständigkeit überprüft worden. Fotoapparat und Videokamera warteten geladen und einsatzbereit, und das Kinderzimmer war mit allem bestückt, was unser Baby für mindestens einen Monat brauchte. Ich kannte den schnellsten Weg zum Krankenhaus und hatte Ausweichrouten für den Fall eines Staus ausgetüftelt. Dass das Baby bald kommen würde, wusste ich ebenfalls, denn in den Tagen vor der Geburt hatte es schon mehrmals falschen Alarm gegeben. Selbst mir war also klar, dass der Countdown offiziell begonnen hatte.
Mit anderen Worten: Ich war nicht gänzlich überrascht, als meine Frau mich am 16. Oktober 2009 um halb fünf weckte und verkündete, der Abstand zwischen den Wehen betrage circa fünf Minuten und es sei Zeit, in die Klinik zu fahren. Ich zweifelte das nicht an; Vivian kannte den Unterschied zwischen Senkwehen und den richtigen Geburtswehen. Doch obwohl ich mich auf diesen Moment vorbereitet hatte, drehten sich meine ersten Gedanken nicht darum, dass ich mich hastig anziehen und das Auto beladen sollte. Und nein, sie galten auch nicht meiner Frau und dem Kind. Sondern sie waren in etwa so: Heute ist der große Tag, und es wird viel fotografiert werden. Andere Menschen werden sich diese Bilder noch jahrelang ansehen, deshalb sollte ich besser kurz unter die Dusche springen, bevor wir fahren, weil meine Haare aussehen, als hätte ich die Nacht in einem Windkanal zugebracht.
Nicht, dass ich eitel bin, ich glaubte nur, ich hätte noch reichlich Zeit, also sagte ich Vivian, ich sei in ein paar Minuten abfahrbereit. Ich brauche nie lange im Bad, an normalen Tagen nicht mehr als zehn Minuten, einschließlich Rasur, aber kaum hatte ich mir die Wangen eingeschäumt, glaubte ich, aus dem Wohnzimmer einen Schrei zu vernehmen. Ich lauschte angestrengt, und obwohl es danach still blieb, beeilte ich mich. Als ich mir das Gesicht abwusch, hörte ich Vivian abermals schreien, wobei es seltsamerweise klang, als schrie sie mich nicht an, sondern als schimpfe sie über mich. Mit einem Handtuch um die Taille trat ich noch tropfend in den Flur. Gott ist mein Zeuge, ich war nicht länger als sechs Minuten im Bad.
Wieder rief Vivian laut etwas, und ich brauchte eine Sekunde, um zu begreifen, dass sie auf allen vieren in ihr Handy brüllte, ich sei UNTER DER BLÖDEN DUSCHE!, UND WAS ZUM HENKER DENKT SICH DIESER IDIOT DABEI? Idiot war übrigens noch der netteste Ausdruck, mit dem sie mich bedachte. Was ich nicht wusste, war, dass der Abstand zwischen den Wehen mittlerweile nur noch zwei Minuten betrug und sie außerdem Rückenwehen hatte. Die sind entsetzlich schmerzhaft, und plötzlich stieß Vivian einen so kraftvollen Schrei aus, dass er durch unser gesamtes Wohnviertel in Charlotte, North Carolina, hallte, ein ansonsten friedliches Fleckchen.
Keine Sorge, daraufhin schaltete ich noch einen Gang höher und sprang ohne mich abzutrocknen in meine Kleider. Auf dem Weg zum Auto stützte ich Vivian, ohne zu kommentieren, dass sie ihre Fingernägel in meinen Arm grub. Wie der Blitz saß ich am Steuer und fuhr los.
Die Wehen hatten immer noch denselben Abstand, als wir in der Klinik ankamen, wegen ihrer starken Schmerzen wurde Vivian dennoch direkt in den Entbindungssaal gebracht. Ich hielt ihre Hand und versuchte, sie beim Atmen zu unterstützen – allerdings begleitet von einigen deftigen Äußerungen ihrerseits über mich und wohin ich mir das verdammte Atmen stecken könne, bis der Anästhesist eintraf. Zu Beginn der Schwangerschaft hatte Vivian hin und her überlegt, ob sie eine PDA wollte, und sich schließlich zögerlich dafür entschieden, was jetzt ein Segen war. Sobald die Wirkung des Medikaments einsetzte, waren die Schmerzen erträglicher, und Vivian lächelte zum ersten Mal, seit sie mich geweckt hatte.
Dann war es so weit. Schwestern wurden gerufen, die mit ruhiger Professionalität alles vorbereiteten. Dann forderte der Arzt meine Frau unvermittelt auf zu pressen.
Bei der dritten Kontraktion drehte er plötzlich seine Handgelenke wie ein Zauberer, der einen Hasen aus dem Hut zieht, und schon war ich Vater.
Einfach so.
Unsere Tochter wurde untersucht, und obwohl sie leicht anämisch war, hatte sie zehn Finger, zehn Zehen, ein gesundes Herz und offensichtlich eine funktionierende Lunge. Ich erkundigte mich nach der Anämie, aber der Arzt sagte, das sei kein Grund zur Sorge, und dann wurde unser Baby gewaschen und gewickelt und meiner Frau in die Arme gelegt.
Genau wie vorhergesehen, wurden den ganzen Tag lang Fotos geknipst, nur schien sich seltsamerweise hinterher niemand für mein Aussehen darauf zu interessieren.
*
Man hört ja manchmal, Babys sähen bei ihrer Geburt entweder aus wie Winston Churchill oder wie Mahatma Gandhi. Da die Haut meiner Tochter infolge der Anämie einen grauen Farbton hatte, war mein erster Gedanke allerdings, dass sie Yoda ähnelte, ohne die Ohren natürlich. Ein wunderschöner Yoda, wohlgemerkt, ein atemberaubender Yoda, ein so liebenswerter Yoda, dass mein Herz beinahe zerbarst, als sie meinen Finger umklammerte. Ein paar Minuten später kamen meine Eltern, und in meiner Nervosität und Aufregung ging ich ihnen entgegen und sagte das Erste, was mir in den Sinn kam.
»Wir haben ein graues Baby!«
Meine Mutter sah mich an, als hätte ich den Verstand verloren, während mein Vater sich in den Ohren bohrte, als wären sie möglicherweise verstopft und beeinträchtigten sein Gehör. Ohne meinen Kommentar weiter zu beachten, betraten sie das Zimmer, in dem Vivian mit seligem Gesichtsausdruck unsere Tochter im Arm hielt. Bei ihrem Anblick fand ich, dass dies das zauberhafteste kleine Mädchen der Weltgeschichte sein musste. Natürlich glauben das alle frischgebackenen Väter von ihren Kindern, aber Tatsache ist, es kann nur ein Kind geben, das wirklich das zauberhafteste der Weltgeschichte ist, und ich wunderte mich insgeheim, dass nicht jeder im Krankenhaus hereinkam und meine Tochter bestaunte.
Meine Mutter trat ans Bett und beugte sich weit vor, um sie besser sehen zu können.
»Habt ihr euch schon für einen Namen entschieden?«, fragte sie.
»London«, antwortete meine Frau, ohne die Augen von unserem Kind abzuwenden. »Wir nennen sie London.«
*
Irgendwann gingen meine Eltern, aber sie kehrten am Nachmittag noch einmal zurück. Dazwischen waren auch Vivians Eltern zu Besuch gekommen. Sie waren per Flugzeug aus Alexandria, Virginia, angereist, wo Vivian aufgewachsen war, und obwohl Vivian sich sehr darüber freute, spürte ich sofort, wie die Anspannung im Raum stieg. Von Anfang an hatten meine Schwiegereltern mir zu verstehen gegeben, dass ihre Tochter sich ihrer Ansicht nach unter Wert verkauft hatte, als sie mich heiratete, und wer weiß? Außerdem mochten sie offenbar meine Eltern nicht, was allerdings auf Gegenseitigkeit beruhte. Die vier behandelten einander zwar immer freundlich, man merkte aber deutlich, dass sie sich in Wahrheit lieber aus dem Weg gingen.
Auch meine ältere Schwester Marge und Liz kamen vorbei und brachten Geschenke. Marge und Liz waren schon länger zusammen als Vivian und ich – damals über fünf Jahre –, und ich hielt die beiden nicht nur für ein großartiges Paar, sondern wusste auch, dass Marge die tollste ältere Schwester war, die man sich wünschen konnte. Da meine Eltern früher beide arbeiteten, Dad als Klempner und Mom als Sprechstundenhilfe bei einem Zahnarzt, hatte Marge nicht nur gelegentlich als Elternersatz fungiert, sondern auch als Vertraute, die mich verständnisvoll durch die Nöte der Pubertät begleitete. Übrigens mochten weder Marge noch Liz Vivians Eltern, besonders, seit diese sich bei unserer Hochzeit geweigert hatten, Marge und Liz gemeinsam am Familientisch sitzen zu lassen. Gut, Liz gehörte im engeren Sinne nicht zur Verwandtschaft, und Marge trug einen Smoking statt eines Kleids, aber es war ein Affront, den keine der beiden je verzeihen konnte, zumal die heterosexuellen unverheirateten Paare durchaus mit bei uns saßen.
Während die Besucher im Krankenhaus kamen und gingen, blieb ich den gesamten Tag bei meiner Frau und saß abwechselnd im Schaukelstuhl am Fenster und auf der Bettkante. Immer wieder flüsterten wir einander verwundert zu, dass wir eine Tochter hatten! Wenn ich die beiden betrachtete, spürte ich, dass ich zu ihnen gehörte und wir drei für immer verbunden wären. Das Gefühl war überwältigend, wie alles andere an diesem Tag, und unwillkürlich überlegte ich, wie London wohl als Teenager aussehen oder wovon sie träumen oder was sie mit ihrem Leben anfangen würde. Sobald London weinte, legte Vivian sie automatisch an die Brust, und ich erlebte gleich das nächste Wunder.
Woher weiß London, wie das geht?, fragte ich mich im Stillen. Woher um alles in der Welt weiß sie das?
*
Es gibt noch eine Erinnerung an diesen Tag, die allerdings nur mir gehört.
Es geschah in jener ersten Nacht im Krankenhaus, lange nachdem die letzten Besucher gegangen waren. Vivian schlief, und ich döste im Schaukelstuhl, als ich meine Tochter unruhig werden hörte. Vor ihrer Geburt hatte ich noch nie ein Neugeborenes gehalten, und jetzt hob ich sie hoch und schmiegte sie dicht an mich. Ich dachte, ich müsste Vivian wecken, doch zu meiner Überraschung entspannte sich London. Vorsichtig setzte ich mich wieder in den Schaukelstuhl, und während der nächsten zwanzig Minuten konnte ich nur über die Gefühle staunen, die die Kleine in mir auslöste. Dass ich sie vergötterte, wusste ich bereits, jetzt schon kam mir ein Leben ohne sie unvorstellbar vor. Ich erinnere mich, ihr zugeflüstert zu haben, dass ihr Vater immer für sie da sein würde, und als wüsste sie genau, was ich sagte, pupste sie und krümmte sich und begann zu weinen. Vivian wachte davon auf, und ich reichte ihr das Baby.
Kapitel 2
Am Anfang
»Ich hab es ihm heute gesagt«, verkündete Vivian.
Wir waren im Schlafzimmer, Vivian trug ihren Pyjama und kroch zu mir unter die Decke, endlich waren wir beide allein. Es war Mitte Dezember, und London lag seit weniger als einer Stunde in ihrem Bettchen. Sie war inzwischen acht Wochen alt, doch sie schlief nicht länger als drei bis vier Stunden am Stück. Vivian beklagte sich nicht, aber sie war immer müde.
»Wem was gesagt?«, fragte ich.
»Rob.« Damit war ihr Chef gemeint. »Ich habe ihn offiziell informiert, dass ich nach dem Mutterschaftsurlaub nicht zurückkomme.«
»Aha.« Ich spürte die gleiche Panik in mir aufsteigen wie nach dem positiven Schwangerschaftstest. Vivian verdiente fast so viel wie ich, und ich glaubte nicht, dass wir uns unseren Lebensstil ohne ihr Einkommen weiter leisten konnten.
»Er meinte, die Tür steht immer offen, falls ich es mir anders überlege«, ergänzte sie. »Aber ich habe ihm erklärt, dass London nicht von Fremden aufgezogen wird. Warum sollte man sonst überhaupt ein Kind bekommen?«
»Mich musst du nicht überzeugen.« Ich gab mir alle Mühe, meine Gefühle zu verbergen. »Ich stehe auf deiner Seite.« Na ja, überwiegend. »Du weißt aber, dass wir dann nicht mehr so oft essen gehen und uns nicht mehr so viele Dinge leisten können, oder?«
»Ja, das weiß ich.«
»Und es ist kein Problem für dich, seltener zu shoppen?«
»Das hört sich ja geradezu an, als würde ich Geld verschwenden! Das tue ich nie.«
Die Kreditkartenabrechnungen ließen manchmal anderes vermuten, genau wie ihr Schrank, der vor Kleidern und Schuhen und Taschen überquoll. Aber ich hörte die Verärgerung in ihrer Stimme, und das Letzte, was ich wollte, war mit ihr streiten. Also drehte ich mich zu ihr um und zog sie an mich, hatte längst etwas anderes im Sinn. Ich küsste sie auf den Hals.
»Jetzt?«, fragte sie.
»Es ist lange her.«
»Und mein armer Schatz hat das Gefühl, gleich zu platzen, stimmt’s?«
»Offen gestanden möchte ich das Risiko nicht eingehen.«
Sie lachte, aber als ich ihr Pyjamaoberteil aufknöpfte, ertönte ein Geräusch aus dem Babyfon. Sofort erstarrten wir.
Nichts.
Immer noch nichts.
Und gerade als ich dachte, die Luft sei rein, und den Atem ausstieß, den ich unwissentlich angehalten hatte, setzte das Weinen in voller Laustärke ein. Seufzend drehte ich mich auf den Rücken, und Vivian stand auf. Als London sich schließlich eine gute halbe Stunde später wieder beruhigt hatte, war Vivian nicht mehr in Stimmung für einen zweiten Versuch.
Am nächsten Morgen hatten Vivian und ich mehr Glück. So viel Glück sogar, dass ich mich fröhlich erbot, mich um London zu kümmern, wenn sie aufwachte, damit Vivian noch ein wenig schlafen konnte. London allerdings schien genauso müde zu sein wie ihre Mutter, denn erst nach meiner zweiten Tasse Kaffee hörte ich Geräusche durch das Babyfon, allerdings war es kein Weinen.
In Londons Zimmer drehte sich das Mobile über der Wiege, und die Kleine strampelte putzmunter mit den Beinchen. Ich musste lächeln, und plötzlich lächelte sie ebenfalls.
Es war kein Reflex. Das kannte ich schon, und beinahe hätte ich meinen Augen nicht getraut. Denn dies hier war ein echtes Lächeln, unbestreitbar, und als sie zusätzlich noch gluckste, wurde mein Tag, der schon großartig begonnen hatte, noch tausendmal besser.
*
Ich bin kein weiser Mensch.
Das soll nicht heißen, dass ich nicht intelligent bin. Aber Weisheit bedeutet mehr als das, denn sie umfasst Verständnis, Empathie, Erfahrung, inneren Frieden und Intuition, und rückblickend mangelt es mir an einigen dieser Eigenschaften.
Was ich außerdem inzwischen gelernt habe: Alter ist genauso wenig ein Garant für Weisheit wie für Intelligenz. Ich weiß, dass das häufig anders gesehen wird. Halten wir ältere Menschen nicht auch deshalb per se für weise, weil sie graue Haare und faltige Haut haben? In letzter Zeit bin ich jedoch zu dem Schluss gekommen, dass manche Menschen mit der Neigung, Weisheit zu erlangen, auf die Welt kommen und andere nicht. Und bei manchen zeigt sie sich schon in jungen Jahren.
Bei meiner Schwester Marge zum Beispiel. Sie ist weise, obwohl sie nur fünf Jahre älter als ich ist. So ist sie schon, seit ich sie kenne. Liz ebenfalls. Sie ist jünger als Marge, und doch ist das, was sie sagt, sowohl überlegt als auch einfühlsam. Nach einem Gespräch mit ihr denke ich oft noch lange darüber nach. Auch meine Eltern sind weise, was mir in letzter Zeit häufig durch den Kopf geht, weil mir klar geworden ist, dass Weisheit zwar bei uns in der Familie liegt, mich allerdings leider übergangen hat.
Denn wäre ich weise, hätte ich damals im Sommer 2007 auf Marge gehört, als sie mich auf der Fahrt zu dem Friedhof, auf dem meine Großeltern begraben lagen, fragte, ob ich mir absolut sicher sei, dass ich Vivian heiraten wolle.
Wäre ich weise, hätte ich auf meinen Vater gehört, der mich fragte, ob ich sicher sei, mich mit fünfunddreißig mit einer eigenen Werbeagentur selbstständig machen zu wollen.
Wäre ich weise, hätte ich auf meine Mutter gehört, als sie mir riet, so viel Zeit wie möglich mit London zu verbringen, da Kinder schnell groß werden und man diese Jahre nie zurückholen könne.
Aber wie gesagt, ich bin kein weiser Mensch, und deshalb geriet mein Leben ins Trudeln. Selbst jetzt noch frage ich mich, ob ich mich jemals davon erholen werde.
*
Wo soll man beginnen, wenn man eine Geschichte begreifen will, die nur schwer zu begreifen ist?
Nun, beginnen wir damit: Als Kind glaubte ich, dass ich mich im Alter von achtzehn wie ein Erwachsener fühlen würde, und ich hatte recht. Mit achtzehn schmiedete ich bereits Pläne fürs Leben. Meine Eltern waren finanziell immer gerade so über die Runden gekommen, und ich hatte nicht die Absicht, auch so zu leben. Ich träumte davon, eine eigene Firma zu gründen, mein eigener Chef zu sein, bevor ich überhaupt wusste, was ich tun wollte. Da ich davon ausging, auf dem College in die richtige Richtung gelenkt zu werden, ging ich auf die North Carolina State, aber je länger ich dort war, desto jünger und unerfahrener kam ich mir vor. Als ich schließlich meinen Abschluss in Händen hielt, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, noch mehr oder weniger der Gleiche zu sein wie damals in der Schule.
Zudem wusste ich immer noch nicht, in welcher Branche ich tätig werden wollte. Ich besaß wenig Erfahrung in der wirklichen Welt und noch weniger Kapital, daher verschob ich meinen Traum vorerst und nahm in der Werbebranche eine Stelle bei einem Mann namens Jesse Peters an. Ich trug im Büro Anzüge und arbeitete unendlich viel, und doch fühlte ich mich weiterhin meistens jünger, als ich eigentlich war. An den Wochenenden besuchte ich dieselben Kneipen wie zu Studentenzeiten, und oft malte ich mir aus, noch mal von vorn anfangen zu können. Im Laufe der nächsten acht Jahre sollte es Veränderungen geben: Ich heiratete und erwarb ein Haus und kaufte mir einen Hybridwagen, aber selbst dadurch empfand ich mich nicht als erwachsen. Letzten Endes hatte Peters die Stelle meiner Eltern eingenommen, wie sie durfte er mir sagen, was ich zu tun hatte, sonst …
Die Erkenntnis, doch erwachsen zu sein, kam natürlich, nachdem London geboren war und Vivian ihren Job gekündigt hatte. Zu dem Zeitpunkt war ich noch keine dreißig, und der Druck, den ich in den nächsten Jahren als Ernährer meiner Familie verspürte, erforderte Opfer, die nicht einmal ich erwartet hatte. Nach der Arbeit – zumindest an den Tagen, an denen ich zu einer vernünftigen Uhrzeit nach Hause kam – trat ich durch die Tür und hörte London »Daddy!« rufen. Wenn sie dann auf mich zurannte und mir die Ärmchen um den Hals schlang, sagte ich mir, dass es sämtliche Opfer wert war, und wenn nur wegen unseres wundervollen kleinen Mädchens.
In der Hektik des Alltags fiel es leicht, mir einzubilden, dass mit den wichtigen Dingen – mit meiner Frau, meiner Tochter, meinem Job, meiner Familie – alles in Ordnung war, selbst wenn ich nicht mein eigener Chef sein durfte. In den seltenen Momenten, in denen ich überhaupt zum Nachdenken kam, stellte ich mir ein zukünftiges Leben vor, das sich von meinem derzeitigen gar nicht so stark unterschied, und auch das war in Ordnung.
Oberflächlich betrachtet lief also alles recht glatt, aber das hätte ich als Warnzeichen nehmen müssen. Ganz ehrlich, ich hatte nicht die geringste Ahnung, dass ich nur wenige Jahre später morgens aufwachen und mich wie einer der frühen Immigranten auf Ellis Island fühlen würde, die mit nichts als den Kleidern am Leib in Amerika angekommen waren, die Sprache nicht beherrschten und sich fragten: Was mache ich denn jetzt?
Wann genau war es gekippt? Wenn man Marge fragt, ist die Antwort eindeutig: »Es ging bergab, als du Vivian kennengelernt hast.« Das hat sie mehr als ein Mal gesagt. Natürlich korrigierte sie sich immer sofort, typisch Marge. »Nein, ich nehme das zurück. Es fing schon vorher an, als du noch auf dem College warst und dieses Poster an der Wand hängen hattest, das von der Frau mit dem superknappen Bikini und den dicken Dingern. Mir hat es übrigens immer gut gefallen, aber es hat dein Denken verzerrt.« Nach weiterer Überlegung schüttelte sie den Kopf. »Aber eigentlich warst du schon immer ein bisschen verkorkst, und wenn das diejenige sagt, die als die Verkorksteste in der Familie gilt, heißt das einiges. Vielleicht ist das wahre Problem, dass du immer zu nett warst.«
Wenn man anfängt zu grübeln, was falsch gelaufen ist, beziehungsweise was man falsch gemacht hat, ist das wie eine Zwiebel zu schälen. Es gibt immer noch eine weitere Haut, noch einen Fehler oder eine schmerzhafte Erinnerung, die dann noch weiter und weiter in die Vergangenheit zurückführt, auf der Suche nach der ultimativen Wahrheit. Ich habe den Punkt erreicht, an dem ich zu suchen aufgehört habe: Das Einzige, was jetzt zählt, ist, daraus zu lernen und künftig nicht mehr die gleichen Fehler zu begehen.
*
Um zu verstehen, warum, muss man mich verstehen. Was übrigens nicht einfach ist. Ich kenne mich schon seit einem Dritteljahrhundert, und die Hälfte der Zeit verstehe ich mich selbst nicht. Also fange ich vielleicht damit an: Meiner Beobachtung nach gibt es zwei Männertypen auf der Welt. Den Heiratstyp und den Junggesellentyp. Der Heiratstyp ist einer, der mehr oder weniger jede Frau daraufhin abklopft, ob sie die Eine sein könnte. Deshalb sagen Frauen um die dreißig und vierzig so oft Sätze wie Alle guten Männer sind vergeben. Damit meinen sie Männer, die bereit, willens und in der Lage sind, sich auf eine feste Beziehung einzulassen.
Ich war immer der Heiratstyp. Für mich fühlt es sich richtig an, in einer Beziehung zu leben. Aus unerfindlichen Gründen habe ich mich in Gesellschaft von Frauen schon immer wohler gefühlt als in der von Männern, selbst bei Freundschaften, und meine Zeit mit einer Frau zu verbringen, die rein zufällig auch noch wahnsinnig in mich verliebt war, schien mir das Größte überhaupt.
Aber genau da wird es ein bisschen knifflig, denn nicht alle Heiratstypen sind gleich. Es gibt Untergruppen, Männer, die sich zum Beispiel für romantisch halten. Klingt nett, oder? Die Art Mann, die sich die meisten Frauen angeblich wünschen? Stimmt wahrscheinlich, und ich muss zugeben, dass auch ich Mitglied in diesem Klub bin. In seltenen Fällen ist dieser spezielle Subtyp allerdings zusätzlich so gestrickt, dass er es anderen gern recht macht, und die Kombination aus alldem, so glaubte ich lange, würde mir dazu verhelfen, dass meine Frau mich immer genauso lieben würde wie ich sie.
Nur, warum war ich so? War es einfach mein Naturell? War ich von meiner eigenen Familie beeinflusst? Oder hatte ich nur im prägenden Alter zu viele romantische Filme gesehen? Oder alles zusammen?
Ich weiß es nicht, aber ich erkläre ohne Zögern, dass die vielen romantischen Filme ganz und gar Marges Schuld waren. Sie liebte Klassiker wie Die große Liebe meines Lebens und Casablanca, aber Ghost – Nachricht von Sam und Dirty Dancing waren auch ganz oben dabei, und Pretty Woman haben wir mindestens zwanzigmal gesehen. Das war Marges absoluter Lieblingsfilm. Damals wusste ich natürlich nicht, dass nicht nur ich, sondern auch Marge irrsinnig in Julia Roberts verknallt war, aber darum geht es nicht. Der Film ist vermutlich unsterblich, und zwar, weil er funktioniert. Zwischen den von Richard Gere und Julia Roberts gespielten Figuren war … eine Art chemische Verbindung. Sie unterhielten sich. Sie lernten, einander zu vertrauen. Sie verliebten sich. Und wie kann man je die Szene vergessen, als Richard Gere vor dem Opernbesuch auf Julia wartet und sie in einem Kleid auftaucht, das sie vollkommen verwandelt? Die Zuschauer sehen Richards ehrfürchtig erstarrte Miene, und schließlich öffnet er eine Samtschachtel mit der Diamantkette, die Julia an dem Abend tragen soll. Als sie danach greift, klappt Richard den Deckel zu, und Julia lacht überrascht auf …
Es war eigentlich alles da, in diesen wenigen Sekunden. Die Romantik, meine ich – Vertrauen, Erwartung und Freude gepaart mit Oper, schöner Kleidung und Schmuck führten zusammen zu Liebe. In meinem vorpubertären Gehirn machte es klick: eine Art Handbuch, wie man Mädchen beeindruckte. Ich hatte mir nur zu merken, dass Mädchen den Jungen erst mögen mussten und dass romantische Gesten letztendlich zu Liebe führten. So wurde ein weiterer Romantiker in der echten Welt geschaffen.
Als ich in der sechsten Klasse war, kam ein neues Mädchen zu uns. Melissa Anderson war aus Minnesota, und mit ihren blonden Haaren und blauen Augen erinnerte sie an ihre schwedischen Vorfahren. Als ich sie das erste Mal sah, muss mir die Kinnlade heruntergefallen sein, und damit war ich nicht allein. Jeder Junge tuschelte über sie, und ich fand, dass sie das mit Abstand hübscheste Mädchen war, das jemals seinen Fuß in Mrs. Hartmans Klasse in der Arthur E. Edmonds School gesetzt hatte.
Doch der Unterschied zwischen mir und den anderen Jungen war, dass ich genau wusste, was zu tun war. Ich wollte sie umwerben, und wenn ich auch nicht Richard Gere mit Privatjet und Diamantketten war, besaß ich doch immerhin ein Fahrrad und konnte Armbänder knüpfen, komplett mit Holzperlen. Die allerdings würden später kommen. Erst einmal mussten wir einander mögen, wie Richard und Julia. Ich sorgte dafür, dass ich beim Mittagessen an ihrem Tisch saß. Wenn sie redete, hörte ich zu und stellte Fragen, und Wochen später, als sie mir endlich sagte, dass sie mich nett fand, wusste ich, dass es Zeit für den nächsten Schritt war. Ich schrieb ihr ein Gedicht und steckte es ihr eines Nachmittags im Schulbus zu, mit einer Blume. Ich glaubte zu wissen, was passieren würde: Sie würde verstehen, dass ich anders war, und damit einher ginge eine noch größere Erkenntnis, woraufhin sie meine Hand nähme und sich von mir nach Hause begleiten ließe.
Leider lief es nicht so. Statt das Gedicht zu lesen, quatschte sie den gesamten Heimweg mit ihrer Freundin April, und am nächsten Tag setzte sie sich mittags zu Tommy Harmon und sprach kein Wort mit mir. Auch nicht am folgenden Tag oder dem darauf. Als Marge mich später schmollend in meinem Zimmer fand, erklärte sie mir, dass ich zu bemüht sei und einfach ich selbst sein solle.
»Das bin ich doch.«
»Dann solltest du dich vielleicht ändern«, gab Marge zurück. »Weil du nämlich verzweifelt rüberkommst.«
Mein Problem war, dass ich nicht weiter nachgedacht hatte. Dachte Richard Gere nach? Er wusste eindeutig mehr als meine Schwester, und wieder einmal steuerten die Weisheit und ich in entgegengesetzte Richtungen. Denn Pretty Woman war ein Film, und ich lebte in der echten Welt, aber das Muster, das ich bei Melissa Anderson eingeführt hatte, setzte sich, mit Variationen, fort, bis es letzten Endes zu einer Gewohnheit wurde. Ich wurde der König der romantischen Geste – Blumen, Briefe, Karten und dergleichen –, und im College war ich der »geheime Bewunderer« eines Mädchens, das ich anhimmelte. Ich hielt Türen auf und lud zum Essen ein, und ich hörte zu, wann immer eine Frau reden wollte, selbst wenn es darum ging, wie sehr sie noch an ihrem Exfreund hing. Die meisten mochten mich wirklich. Für sie war ich ein Kumpel, die Art Mann, der mit einer Gruppe Freundinnen ausgehen durfte. Selten jedoch bekam ich die Frau, die ich mir ausgesucht hatte. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich gehört habe: »Du bist der netteste Typ, den ich kenne, und du findest bestimmt eines Tages jemand ganz Besonderes. Ich habe zwei oder drei Freundinnen, mit denen ich dich bekannt machen könnte …«
Es war nicht leicht, der Mann zu sein, der perfekt für jemand anderen war. Oft brach es mir das Herz, und ich begriff nicht, warum Frauen mir erzählten, sie wünschten sich bestimmte Eigenschaften wie Romantik und Rücksichtnahme, Interesse und die Begabung, gut zuhören zu können – und die dies alles dann aber nicht zu schätzen wussten.
Natürlich hatte ich nicht nur Pech in der Liebe. In der zehnten Klasse hatte ich eine Freundin namens Angela, auf dem College waren Victoria und ich fast ein Jahr lang zusammen. Und im Sommer nach meinem Abschluss, mit zweiundzwanzig, lernte ich eine Frau namens Emily kennen.
Emily wohnt immer noch hier in der Gegend, und im Laufe der Jahre bin ich ihr hin und wieder begegnet. Sie war die erste Frau, die ich geliebt habe, und da Romantik und Nostalgie oft miteinander verknüpft sind, denke ich heute noch an sie. Emily hatte etwas Unkonventionelles. Sie bevorzugte lange, mit Blumenmuster bedruckte Röcke und Sandalen, schminkte sich nur wenig und hatte im Hauptfach Bildende Kunst mit Schwerpunkt Malerei studiert. Sie war schön, mit kastanienbraunen Haaren und leuchtenden, grünbraunen Augen, aber es war nicht nur ihr Aussehen. Sie lachte gern, war freundlich zu jedem, intelligent, eine Frau, die nach Meinung der meisten Menschen perfekt für mich war. Meine Eltern vergötterten sie, Marge liebte sie, und Emily und ich konnten sogar wunderbar zusammen schweigen. Unsere Beziehung war leicht und entspannt, wir waren nicht nur Geliebte, sondern auch Freunde. Abgesehen davon, dass wir uns über alles unterhalten konnten, freute sie sich über die Briefchen, die ich ihr unters Kissen legte, oder die Blumen, die ich ihr ohne besonderen Anlass zur Arbeit schicken ließ. Emily liebte mich so sehr, wie sie romantische Gesten liebte, und nach zwei Jahren Beziehung plante ich, ihr einen Antrag zu machen, zahlte sogar schon einen Verlobungsring an.
Und dann baute ich Mist. Warum, kann ich selbst nicht erklären. Ich könnte dem Alkohol die Schuld geben, denn an dem Abend hatte ich mit Freunden in einer Kneipe getrunken, aber was auch immer der Grund war, ich kam mit einer Frau namens Carly ins Gespräch. Sie war hübsch, und sie flirtete gut, und sie hatte sich erst kürzlich von ihrem langjährigen Freund getrennt. Ein Bier führte zum anderen, was wiederum zu mehr Flirten führte, und letzten Endes landeten wir zusammen im Bett. Am nächsten Morgen machte Carly deutlich, dass sie kein Interesse an einer irgendwie gearteten Beziehung hatte, und obwohl sie mich zum Abschied küsste, gab sie mir nicht einmal ihre Telefonnummer.
In solch einer Situation gibt es ein paar sehr einfache Männerregeln, und Regel Nummer eins lautet: Behalt es für dich. Falls die Freundin einen Verdacht hegt und direkt fragt, tritt sofort Regel Nummer zwei in Kraft: leugnen, leugnen, leugnen.
Jeder Mann kennt diese Regeln, das Problem war nur, dass ich auch ein schlechtes Gewissen hatte. Ein schrecklich schlechtes. Selbst einen Monat später noch konnte ich die Erfahrung nicht abschütteln. Es geheim zu halten schien mir unvorstellbar, ich konnte mir keine Zukunft mit Emily aufbauen, wenn ich wusste, dass sie zumindest zum Teil auf einer Lüge basierte. Ich sprach mit Marge darüber, und wie üblich half sie mir auf ihre schwesterliche Art weiter.
»Halt gefälligst den Mund, du Trottel. Das war bescheuert von dir, und das schlechte Gewissen solltest du auch haben. Aber wenn du es nie wieder tun willst, dann verletz jetzt nicht auch noch Emilys Gefühle. So etwas wird sie nicht verkraften.«
Natürlich hatte Marge recht, das wusste ich, und doch …
Ich wollte, dass Emily mir verzieh, weil ich nicht sicher war, ob ich mir sonst selbst jemals verzeihen konnte, und daher ging ich schließlich zu Emily und redete mir alles von der Seele – bis heute wünschte ich, meine Worte zurücknehmen zu können.
Wenn Vergebung das Ziel gewesen war, wurde es nicht erreicht. Wenn ein weiteres Ziel gewesen war, eine langfristige Beziehung auf ein Fundament der Wahrheit zu stellen, wurde auch das verfehlt. Mit Tränen der Wut und Enttäuschung verkündete Emily, sie brauche Zeit zum Nachdenken.
Ich ließ sie eine Woche lang in Ruhe und wartete geknickt auf einen Anruf, doch das Telefon klingelte nicht. In der folgenden Woche hinterließ ich ihr zwei Nachrichten, beide Male mit einer Entschuldigung, aber immer noch meldete sie sich nicht. Erst in der Woche darauf trafen wir uns zum Mittagessen, aber das verlief verkrampft, und hinterher durfte ich sie nicht zu ihrem Wagen begleiten. Eine Woche später hinterließ sie mir eine Nachricht, dass es aus sei. Ich war wochenlang am Boden zerstört.
Die Zeit linderte mein schlechtes Gewissen, wie das eben so ist, und ich versuchte mich mit dem Gedanken zu trösten, dass sich für Emily mein Fehltritt zumindest im Nachhinein als gut erwies. Vom Freund eines Freundes erfuhr ich, dass sie ein paar Jahre nach unserer Trennung einen Australier geheiratet hatte, und wenn ich sie ab und zu sah, machte es immer den Eindruck, als sei das Leben gut zu ihr. Ich redete mir ein, dass ich mich für sie freute. Mehr als jeder andere Mensch verdiente Emily ein wundervolles Leben, und Marge empfand es genauso. Noch nach meiner Hochzeit mit Vivian sagte meine Schwester gelegentlich zu mir: »Diese Emily war eine tolle Frau … Das hast du echt vergeigt.«
*
Ich bin in Charlotte, North Carolina, geboren, und abgesehen von einem einzigen Jahr in einer anderen Stadt habe ich immer dort gewohnt. Selbst jetzt noch kann ich kaum fassen, wo Vivian und ich uns kennengelernt haben oder auch nur, dass wir uns überhaupt kennengelernt haben. Immerhin stammte sie wie ich aus dem Süden, und wie ich hatte sie neben ihrem Job sehr wenig Freizeit und ging selten aus. Wie hoch standen die Chancen, dass wir uns auf einer Cocktailparty in Manhattan begegnen würden?
Damals arbeitete ich in der Zweigstelle der Agentur in Midtown, was toller klingt, als es war. Jesse Peters war der Meinung, dass so ungefähr jeder, der im Büro in Charlotte Anlass zu Hoffnungen gab, sich mindestens eine Zeit lang im Norden bewähren musste, und wenn nur, weil viele unserer Kunden Banken waren und jede große Bank eine wichtige Niederlassung in New York City hatte.
Im Mai 2006 veranstaltete der Vorstandschef einer dieser Banken, der laut eigener Aussage meine Vision liebte, eine Spendengala für das MoMA. Der Mann war, ganz im Gegensatz zu mir, ein Kunstkenner, und obwohl es eine sehr exklusive Veranstaltung war, wollte ich eigentlich nicht hingehen. Doch seine Bank war unser Kunde, und Peters verlangte Gehorsam, also was sollte ich tun?
Von der ersten halben Stunde weiß ich praktisch nichts mehr, nur, dass ich mich fehl am Platze fühlte. Weit über die Hälfte der Gäste waren alt genug, um meine Großeltern zu sein, und fast jeder tummelte sich in finanzieller Hinsicht in einer anderen Stratosphäre. Irgendwann lauschte ich zwei grauhaarigen Herren, die über die Vorteile eines G IV im Gegensatz zur Falcon 2000 diskutierten. Es dauerte ein Weilchen, bis ich begriff, dass sie ihre Privatjets verglichen.
Als ich mich von diesem Gespräch abwandte, entdeckte ich Vivians Chef am anderen Ende des Raums. Ich erkannte ihn aus dem Fernsehen, und Vivian erzählte mir später, dass er sich für einen Kunstsammler hielt. Dabei runzelte sie die Stirn, um durchblicken zu lassen, dass er Geld, aber keinen Geschmack besaß, was mich nicht überraschte. Trotz berühmter Gäste konnte man den Humor der von ihm moderierten Late-Night-Show am besten als niveaulos beschreiben.
Zunächst stand sie hinter ihm. Erst als sie vortrat, um jemanden zu begrüßen, sah ich sie. Mit ihren dunklen Haaren, der makellosen Haut und Wangenknochen, von denen Supermodels träumen, war sie die schönste Frau, die ich je gesehen hatte.
Anfangs dachte ich, sie sei die Freundin des Moderators, doch je länger ich sie beobachtete, desto sicherer war ich mir, dass sie kein Paar waren, sondern dass sie für ihn arbeitete. Außerdem trug sie keinen Ring, noch ein gutes Zeichen. Aber mal ehrlich, welche Chance hatte ich?
Davon ließ sich der Romantiker in mir allerdings nicht abschrecken, und als sie sich an der Bar einen Cocktail bestellte, trat ich neben sie. Von Nahem sah sie sogar noch umwerfender aus.
»Sie sind es«, sagte ich.
»Wie bitte?«
»Die Frau, die Disney-Grafiker vor sich sehen, wenn sie die Augen ihrer Prinzessinnen zeichnen.«
Nicht gerade überwältigend, ich gebe es zu. Etwas plump und vielleicht sogar kitschig, und in der unbehaglichen Pause danach rechnete ich fest damit, es vermasselt zu haben. Aber nein: Sie lachte.
»Also, den Spruch habe ich wirklich noch nie gehört.«
»Er würde auch nicht bei jeder funktionieren«, sagte ich. »Ich bin Russell Green.«
Sie wirkte erheitert. »Vivian Hamilton«, erwiderte sie, und ich schnappte fast nach Luft.
Sie hieß Vivian.
Wie Julia Roberts’ Figur in Pretty Woman.
*
Woher weiß man, ob jemand der oder die Richtige für einen ist? Welche Signale müssen vorhanden sein, dass man denkt: Das ist die Frau, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte? Wie konnten, zum Beispiel, sowohl Emily als auch Vivian mir richtig erscheinen, wo sie doch so unterschiedlich wie Tag und Nacht waren?
Ich weiß es nicht, aber wenn ich an Vivian denke, fällt es mir immer noch leicht, mich an die berauschende Aufregung unserer ersten gemeinsamen Abende zu erinnern. Während zwischen Emily und mir ein warmes Wohlgefühl herrschte, brannten Vivian und ich füreinander, fast von Anfang an, als sei unsere gegenseitige Anziehung vom Schicksal bestimmt. Jedes Treffen, jedes Gespräch verstärkte meine Überzeugung, dass wir genau das waren, was der andere suchte.
Als Heiratstyp malte ich mir bald unseren gemeinsamen Lebensweg aus, in dem Glauben, dass unsere leidenschaftliche Verbindung ewig lodern würde. Innerhalb weniger Monate war ich sicher, Vivian heiraten zu wollen, auch wenn ich es nicht sagte. Vivian brauchte länger, um so für mich zu empfinden, doch nach sechs Monaten waren wir ein festes Paar und tasteten bereits die Ansichten des anderen über Gott, Geld, Politik, Familie, Kinder und Grundwerte ab. Häufig waren wir einer Meinung, und in Anlehnung an einen weiteren romantischen Film machte ich ihr am Valentinstag auf der Aussichtsplattform des Empire State Buildings einen Antrag, eine Woche, bevor ich wieder nach Charlotte ziehen musste.
Ich glaubte nur zu wissen, worauf ich mich einließ, als ich mich vor Vivian kniete. Sie allerdings, das ist mir heute klar, hatte keinen Zweifel. Dass nämlich ich der Mann war, den sie nicht nur wollte, sondern brauchte, und am 17. November 2007 gaben wir uns vor Freunden und Verwandten das Jawort.
*
Wie bei jedem Paar gab es auch bei uns Höhen und Tiefen, Probleme und Chancen, Erfolge und Fehlschläge. Alles in allem hatte ich den Eindruck, dass unsere Ehe wunderbar funktionierte, zumindest in der Theorie.
In der Praxis allerdings wäre das Wort kompliziert passender.
Einerseits hatte ich mir das Ganze wie einen nie endenden romantischen Werbespot gedacht, mit Rosen und Kerzen, mit Weichzeichner gefilmt, eine Parallelwelt, in der Liebe und Vertrauen jede Schwierigkeit überwinden konnten. Gleichzeitig wusste ich natürlich, dass sich für eine Beziehung langfristig beide Seiten anstrengen mussten. Kompromisse, Kommunikation und Kooperation sind erforderlich, zumal das Leben einem gern Knüppel zwischen die Beine wirft, wenn man am wenigsten damit rechnet. Idealerweise richtet der Knüppel keinen großen Schaden an; manchmal schweißt das gemeinsame Bewältigen von Problemen ein Paar sogar noch stärker zusammen.
Doch hin und wieder bringt einen solch ein Knüppel auch böse zu Fall und hinterlässt Narben, die nie zu heilen scheinen.
Kapitel 3
Und was dann?
Der alleinige Ernährer der Familie zu sein, war nicht leicht. Am Ende der Woche war ich häufig erschöpft, aber ein Freitag hat sich mir besonders eingeprägt. London wurde am nächsten Tag ein Jahr alt, und ich hatte den ganzen Tag an mehreren Verkaufsvideos für Spannerman Properties gearbeitet, einem der größten Bauträger im Südosten der USA. Die Agentur verdiente an dieser Kampagne ein kleines Vermögen, und die Verantwortlichen bei Spannerman waren ganz besonders anspruchsvoll. Für jede Projektphase gab es eigene Deadlines. Deadlines, die von Spannerman selbst, einem Mann mit einem Vermögen von zwei Milliarden Dollar, noch erschwert wurden. Er musste jede Entscheidung absegnen, und ich hatte das Gefühl, dass er mir das Leben so unangenehm wie möglich machen wollte. Daran, dass er mich nicht mochte, hegte ich keinen Zweifel. Er war ein Mann, der sich gern mit schönen Frauen umgab – die meisten seiner leitenden Angestellten waren weiblich und attraktiv –, und selbstverständlich verstanden Spannerman und Peters sich ganz hervorragend. Ich hingegen verachtete sowohl den Mann als auch seine Firma. Er stand in dem Ruf, auf seinen Baustellen zu pfuschen und Politiker zu bestechen, besonders im Hinblick auf Umweltschutzbestimmungen, und es hatte bereits zahlreiche negative Zeitungsberichte sowohl über ihn als auch seine Firma gegeben. Was mit ein Grund gewesen war, unsere Agentur zu engagieren, denn sein Image musste dringend aufpoliert werden.
Im Laufe des Jahres hatte ich unendlich viele Stunden in den Spannerman-Auftrag gesteckt, und es war das mit Abstand schlimmste Jahr meines Lebens gewesen. Mir graute jeden Morgen davor, ins Büro zu gehen. Da aber Peters und Spannerman befreundet waren, behielt ich meine Gefühle für mich.
Jesse Peters hielt viel davon, seine Mitarbeiter durch Bonuszahlungen zu motivieren, und trotz Spannerman konnte ich jeden Bonus maximieren. Das musste ich auch. Erstens fühlte ich mich wohler, wenn ich etwas Geld beiseitelegen konnte, und zweitens halfen die Boni, unseren Kontostand auszugleichen. Denn statt zu sinken, waren unsere Ausgaben im vergangenen Jahr sogar gestiegen, obwohl Vivian versprochen hatte, ihre »Besorgungen«, wie sie das Shoppen mittlerweile nannte, zurückzuschrauben. Offenbar war es ihr unmöglich, ein Kaufhaus oder einen anderen Laden zu betreten, ohne mehrere Hundert Dollar auszugeben, selbst wenn sie eigentlich nur Waschmittel brauchte. Mir fehlte dafür das Verständnis, und auch wenn ich mich fragte, ob sie damit vielleicht eine innere Leere füllte, war ich manchmal verärgert und fühlte mich ausgenutzt. Doch wenn ich das Thema ansprach, entstand daraus oft ein Streit. Und selbst wenn die Debatte nicht hitzig wurde, veränderte sich danach nur wenig. Vivian versicherte mir immer, sie kaufe nur, was wir brauchten, oder es sei ein günstiges Angebot gewesen.
An jenem Freitagabend waren mir solche Gedanken allerdings fern, und als ich ins Wohnzimmer trat, schenkte London mir ihr unwiderstehliches, hinreißendes Lächeln. Vivian, schön wie eh und je, blätterte auf der Couch in einer Haus-und-Garten-Zeitschrift. Ich küsste zuerst London und dann Vivian und genoss den Duft von Babypuder und Parfüm.
Wir setzten uns zum Essen, erzählten uns gegenseitig von unserem Tag, und dann wurde London ins Bett gebracht. Vivian badete die Kleine und zog ihr den Schlafanzug an, danach deckte ich sie zu und las ihr vor.
Anschließend goss ich mir unten ein Glas Wein ein und stellte fest, dass die Flasche fast leer war, was bedeutete, dass Vivian wahrscheinlich gerade ihr zweites Glas trank. Das erste erhöhte die Chance auf Zärtlichkeiten, das zweite machte sie wahrscheinlich, und so müde ich auch war, meine Stimmung hob sich.
Als ich mich neben sie setzte, blätterte Vivian wieder in der Zeitschrift. Nach einer Weile hielt sie mir eine aufgeschlagene Seite hin.
»Wie findest du diese Küche?«
Die Schränke waren cremefarben, die Arbeitsflächen aus braunem Granit, inmitten glänzender topmoderner Geräte stand eine Kücheninsel. Ein Traum von einer Küche.
»Die ist toll.«
»Ja, oder? Alles an dieser Küche hat Klasse. Und erst die Beleuchtung … Der Kronleuchter ist atemberaubend.«
Den hatte ich noch gar nicht bemerkt. Ich beugte mich vor. »Wow. Der ist wirklich schick.«
»In dem Artikel steht, dass eine Küchenrenovierung fast immer den Wert eines Hauses steigert. Falls wir mal verkaufen wollen.«
»Warum sollten wir? Ich wohne sehr gern hier.«
»Ich spreche ja nicht von jetzt gleich. Aber ewig bleiben wir doch wohl nicht hier.«
Seltsamerweise war mir noch nie in den Sinn gekommen, dass wir hier nicht ewig bleiben wollten. Immerhin wohnten meine Eltern auch noch in dem Haus, in dem ich aufgewachsen war. Aber darüber wollte Vivian eigentlich gar nicht sprechen.
»Wahrscheinlich hast du recht mit der Wertsteigerung«, sagte ich. »Aber momentan können wir uns eine neue Küche eigentlich nicht leisten.«
»Wir haben doch etwas gespart, oder?«
»Ja, aber das sind unsere Rücklagen. Für Notfälle.«
»Okay.« Die Enttäuschung war ihr anzuhören. »Ich dachte ja nur.«
Sorgsam knickte sie die Ecke der Seite ein, um das Foto später leicht wiederfinden zu können, und ich kam mir vor wie ein Versager. Ich hasste es, sie zu enttäuschen.
*
Das Leben als Hausfrau und Mutter war schön für Vivian.
Obwohl sie ein Kind hatte, sah sie mindestens zehn Jahre jünger aus, als sie war, und manchmal wurde sie sogar nach ihrem Ausweis gefragt, wenn sie sich einen Cocktail bestellte. Doch das Aussehen trog in Bezug auf ihre anderen Eigenschaften. Vivian hatte auf mich schon immer einen reifen und selbstbewussten Eindruck gemacht, und im Gegensatz zu mir traute sie sich, ihre Meinung zu sagen. Wenn sie etwas wollte, teilte sie es mir mit, wenn etwas sie störte, hielt sie damit nicht hinter dem Berg, gleichgültig, ob es mich möglicherweise verletzte. Die Kraft, man selbst zu sein, ohne Angst vor Ablehnung, war etwas, vor dem ich große Achtung hatte, und wenn nur, weil ich selbst danach strebte.
Stark war sie ebenfalls. Vivian jammerte oder beklagte sich nicht, wenn sie mit Widrigkeiten konfrontiert wurde, eher wurde sie geradezu stoisch. In all den Jahren, die ich sie kenne, habe ich sie nur ein Mal weinen sehen, und zwar, als ihre Katze Harvey starb.
Dass sie nicht schnell weinte, kann man interpretieren, wie man will, aber Tatsache war, dass Vivian auch nicht viel Grund dazu hatte. Uns waren bis dahin größere Tragödien erspart geblieben, der einzige mögliche Anlass zu Enttäuschung war, dass Vivian kein zweites Mal schwanger wurde. Als London achtzehn Monate alt war, probierten wir es wieder, aber Monat für Monat verstrich ergebnislos. Zwar wäre ich bereit gewesen, zu einem Spezialisten zu gehen, doch Vivian schien zufrieden damit, der Natur ihren Lauf zu lassen.
Auch ohne ein zweites Kind empfand ich es normalerweise als Glück, mit Vivian verheiratet zu sein, zum Teil wegen unserer Tochter. Manche Frauen sind besser zur Mutterschaft geeignet als andere, und Vivian war ein Naturtalent. Sie war gewissenhaft und liebevoll, eine geborene Krankenschwester, die sich von nichts erschüttern ließ, und ein Muster an Geduld. Vivian las London Hunderte von Büchern vor und konnte stundenlang mit ihr auf dem Fußboden spielen. Die beiden gingen in den Park und die Bücherei. Dazu hatten sie Verabredungen mit Kindern aus der Nachbarschaft, Vorschulkurse und die üblichen Arzttermine, sodass die beiden ständig unterwegs waren. Wenn ich an jene ersten Jahre in Londons Leben zurückdenke, sehe ich Vivian immer mit einem Ausdruck tiefer Freude auf dem Gesicht vor mir, ob sie unsere Tochter nun auf dem Arm hielt oder ihr dabei zusah, wie sie Schritt für Schritt die Welt entdeckte.
Vivians Vorstellung von einer perfekten Mutterschaft gestattete mir nicht nur, mich auf meine Karriere zu konzentrieren, sondern hatte auch zur Folge, dass ich mich selten allein um London kümmerte und dementsprechend nie wirklich merkte, wie anstrengend das sein konnte. Da es bei Vivian so leicht aussah, dachte ich, das wäre es auch, aber im Laufe der Zeit wurde Vivian launischer und gereizter. Sie kümmerte sich weniger um den Haushalt, sodass abends noch lauter Spielzeug im Wohnzimmer auf dem Boden lag und sich in der Küche das schmutzige Geschirr stapelte. Die Wäsche blieb liegen, Teppiche wurden nicht gesaugt, und da ich Unordnung noch nie mochte, beschloss ich irgendwann, zweimal pro Woche eine Putzhilfe kommen zu lassen. Später engagierte ich auch für drei Nachmittage in der Woche einen Babysitter und übernahm selbst den Samstagvormittag mit London, damit Vivian etwas Zeit für sich hatte. Meine Hoffnung war, dass sie dadurch wieder mehr Energie für uns als Paar hätte. Meinem Empfinden nach definierte meine Frau sich mittlerweile als Vivian und als Mutter und uns drei zusammen als Familie. Ehefrau und Teil eines Paares zu sein war ihr hingegen nach und nach lästig geworden.
Dennoch machte ich mir keine allzu großen Gedanken über unsere Beziehung. Wir waren wie die meisten Ehepaare mit kleinen Kindern, dachte ich. Abends unterhielten wir uns über das Übliche: über London, die Arbeit, die Familie oder was wir essen oder am Wochenende unternehmen wollten oder wann das Auto zur Inspektion musste. Ich fühlte mich gar nicht grundsätzlich an den Rand gedrängt, denn der Freitagabend wurde zum Beispiel zu Vivians und meinem romantischen Abend erklärt. Selbst meine Kollegen wussten davon, und außer in einem echten Notfall verließ ich das Büro zu einer vernünftigen Uhrzeit, hörte im Auto Musik und trat dann lächelnd durch die Tür. Ich beschäftigte mich mit London, während Vivian sich schick machte, und wenn die Kleine schlief, kam es mir fast vor wie bei unseren Dates früher, vor der Hochzeit.
Ich liebte Vivian und schwankte nie in meiner Überzeugung, mein Leben mit ihr verbringen zu wollen. In meinem Wunsch, das auch zu zeigen, grübelte ich lange über Geschenke zu Weihnachten, zu Hochzeits-, Geburts- und Valentinstagen nach, legte ihr Briefchen unter das Kissen, bevor ich zur Arbeit ging, und überraschte sie manchmal mit einem Frühstück im Bett. Anfangs freute sie sich über solche Gesten, nach und nach allerdings wurden sie ihr gleichgültig. Also zermarterte ich mir das Gehirn, was ihr gefallen, wodurch ich ihr vermitteln könnte, wie viel sie mir immer noch bedeutete.
Und am Ende bekam Vivian die Küche, die sie sich gewünscht hatte, genau wie in der Zeitschrift.
*
Vivian hatte immer vorgehabt, wieder zu arbeiten, wenn London in die Schule kam, in Teilzeit, um weiterhin am Nachmittag und Abend zu Hause sein zu können. Auf keinen Fall wollte sie eine dieser Mütter sein, die sich ständig ehrenamtlich engagierten und zu Weihnachten die Schulcafeteria dekorierten. Und sie wollte auch nicht den ganzen Tag in einem leeren Haus sitzen. Schließlich hatte sie ihr Studium an der Georgetown University summa cum laude abgeschlossen und vor Londons Geburt erfolgreich als Pressereferentin in mehreren Positionen gearbeitet.
Auch ich hatte bei meiner Agentur nicht nur gute Boni verdient, sondern war mehrmals befördert worden, und 2014 war ich zuständig für einige der wichtigsten Kunden. Vivian und ich waren mittlerweile sieben Jahre verheiratet, London gerade fünf geworden und ich vierunddreißig. Wir hatten unsere Küche renoviert, planten aber auch eine Modernisierung des Badezimmers. Unsere Anlagen an der Börse entwickelten sich gut, und abgesehen vom Hauskredit hatten wir keine Schulden. Ich war vernarrt in meine Frau und mein Kind, meine Eltern wohnten in der Nähe, und meine Schwester und Liz waren meine allerbesten Freunde. Von außen betrachtet war mein Leben wunderbar, und das antwortete ich auch jedem, der fragte.
Und doch wusste ich tief drinnen irgendwie, dass das gelogen war.
So gut es in meinem Job laufen mochte – niemand, der für Jesse Peters arbeitete, fühlte sich je wohl oder sicher in seiner Position. Peters hatte die Firma zwanzig Jahre vorher gegründet, und mit Büros in Charlotte, Atlanta, Tampa, Nashville und New York war sie die mit Abstand bekannteste Agentur im Südosten des Landes. Peters war berühmt für seine Cleverness und Skrupellosigkeit. Seine Methode war, anderen Agenturen entweder die Kunden abzuwerben oder ihre Preise zu unterbieten, und wenn das nicht funktionierte, kaufte er seine Wettbewerber einfach auf. Die Erfolge blähten sein ohnehin riesiges Ego zu irren Ausmaßen auf, und sein Führungsstil spiegelte seine Persönlichkeit voll und ganz wider. Er war davon überzeugt, immer recht zu haben, hatte Lieblinge unter seinen Angestellten und spielte die Abteilungsleiter gegeneinander aus, sodass alle immer mit einer gewissen Anspannung lebten. Er förderte ein Klima, in dem die meisten mehr Lorbeeren für sich zu beanspruchen versuchten, als ihnen zustanden, während sie gleichzeitig Fehler auf die Kollegen schoben. Es war eine brutale Form des Sozialdarwinismus, in dem nur wenige Aussichten auf langfristiges Überleben hatten.
Glücklicherweise waren mir über zehn Jahre lang die wüsten Büroscharmützel weitgehend erspart geblieben, die mehr als einen Nervenzusammenbruch ausgelöst hatten. Anfangs, weil ich zu unterwürfig war, um beachtet zu werden, und später, weil ich Kunden akquirierte, die meine Arbeit schätzten und die Agentur dementsprechend bezahlten. Im Laufe der Zeit redete ich mir ein, dass Peters mich wegen meiner guten Umsätze als zu wertvoll betrachtete, um mich zu quälen. Immerhin behandelte er mich nicht annähernd so schlecht wie manche Kollegen. Während er mit mir hin und wieder freundlich im Flur plauderte, verließen andere, zum Teil erfahrenere Angestellte Peters’ Büro oft völlig unter Schock. Wenn ich sie dann sah, konnte ich mir ein erleichtertes Aufseufzen (und vielleicht sogar einen Hauch Selbstzufriedenheit) nicht verkneifen.
Wie man sich doch täuschen kann … Meine erste größere Beförderung erlebte ich ungefähr zeitgleich mit meiner Hochzeit, die zweite folgte dann zwei Wochen, nachdem Vivian mir einmal das Auto von der Werkstatt ins Büro gebracht hatte. An dem Tag hatte mein Chef uns spontan zum Mittagessen eingeladen. Die dritte Beförderung wurde eine knappe Woche, nachdem Peters und Vivian sich drei Stunden lang bei einem Geschäftsessen unterhalten hatten, ausgesprochen. Erst im Rückblick wurde mir klar, dass Peters weniger an meiner Arbeitsleistung als an Vivian interessiert war, und nur das hatte ihn davon abgehalten, mich ins Visier zu nehmen. Vivian, sollte ich erwähnen, hatte verblüffende Ähnlichkeit mit beiden Exfrauen von Peters, und vermutlich wollte er sie einfach bei Laune halten … oder wenn möglich als Ehefrau Nummer drei heiraten.
Das ist kein Scherz. Und auch keine Übertreibung. Im Gespräch mit mir versäumte Peters nie, sich nach Vivian zu erkundigen, zu erwähnen, wie attraktiv sie sei, oder zu fragen, wie es uns gehe. Bei Geschäftsessen schaffte Peters es immer, neben meiner Frau zu sitzen, und bei jeder Weihnachtsfeier steckten sie in einer Ecke die Köpfe zusammen. Wahrscheinlich hätte ich das alles ignorieren können, wäre da nicht Vivians Reaktion auf seine Avancen gewesen. Zwar ermutigte sie Peters nicht, aber sie wies ihn auch nicht zurück. So schrecklich er als Chef war, zu Frauen konnte er ziemlich charmant sein, besonders zu schönen wie Vivian. Er hörte zu und lachte und machte im richtigen Moment das richtige Kompliment, und weil er außerdem so reich wie Krösus war, hielt ich es für möglich oder sogar wahrscheinlich, dass Vivian sich von seinem Interesse geschmeichelt fühlte. Für sie war es nichts Ungewöhnliches, dass er sich von ihr angezogen fühlte. Seit der Grundschule buhlten Jungen um ihre Aufmerksamkeit, und sie erwartete es nicht anders. Was ihr allerdings nicht gefiel, war, dass es mich manchmal eifersüchtig machte.
Im Dezember 2014, dem Monat vor dem schicksalhaftesten Jahr meines Lebens, zogen wir uns gerade für die Weihnachtsfeier der Agentur um. Als ich meine Bedenken hinsichtlich Jesse Peters äußerte, seufzte sie entnervt.
»Stell dich nicht so an«, sagte sie, und ich wandte mich ab, ratlos, warum meine Frau meine Gefühle derart abtat.
*
Um einmal ein bisschen zurückzuspulen, was Vivian und mich betrifft:
So bereichernd die Mutterschaft für Vivian auch gewesen war, die Ehe mit mir schien für sie an Reiz verloren zu haben. Mir war länger schon aufgefallen, dass Vivian sich in den vergangenen Jahren verändert hatte, doch in letzter Zeit bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass Vivian sich weniger veränderte als vielmehr entwickelte, mehr und mehr zu dem Menschen wurde, dem sie eigentlich entsprach – einem Menschen, der mir wiederum zunehmend fremd wurde.
Die Verschiebung fand kaum merklich statt. In Londons erstem Lebensjahr akzeptierte ich Vivians gelegentliche Launenhaftigkeit und Gereiztheit als normal und verständlich, als vorübergehende Phase, und ich gewöhnte mich daran. Leider schien die Phase jedoch kein Ende zu nehmen. Vivian wurde immer frustrierter und abweisender. Häufig ärgerte sie sich schon über Kleinigkeiten, warf mir Beleidigungen an den Kopf, die ich nicht einmal geflüstert hätte. Ihre Aggression zielte in der Regel darauf ab, mich zu einer Entschuldigung zu veranlassen. Als jemand, der Konflikte scheute, war ich schließlich so weit, dass ich schon den Rückzug antrat, wenn sie nur die Stimme erhob, gleichgültig, wie gekränkt ich gewesen sein mochte.
Die Nachwirkungen ihres Zorns waren häufig schlimmer als die Attacke selbst. Eine Versöhnung schien unerreichbar, und statt etwas auszudiskutieren oder einfach abzuhaken, zog Vivian sich zurück. Manchmal sprach sie tagelang kaum mit mir, beantwortete Fragen nur mit ein oder zwei Worten. Stattdessen konzentrierte sie ihre Aufmerksamkeit auf London und begab sich ins Schlafzimmer, sobald unsere Tochter im Bett lag, sodass ich allein im Wohnzimmer zurückblieb. An solchen Tagen strahlte sie eine regelrechte Verachtung mir gegenüber aus, und ich fragte mich, ob meine Frau mich überhaupt noch liebte.