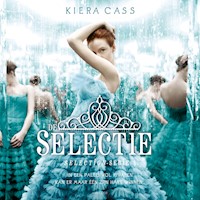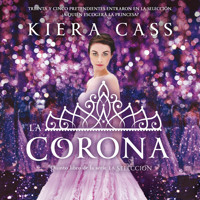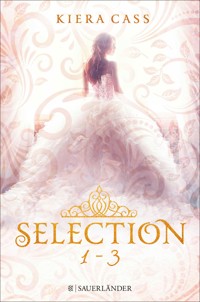
Die SELECTION-Reihe Band 1-3: Selection / Die Elite / Der Erwählte (3in1-Bundle) E-Book
Kiera Cass
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Endlich: alle drei Bände des Weltbestsellers von Kiera Cass in einem! Das Bundle beinhaltet die gesamte Liebesgeschichte von America, Maxon und Aspen – von Americas Ankunft im Palast bis zum großen Finale. Beim Casting erhält America die Chance ihres Lebens. Mit 34 anderen Kandidatinnen kämpft sie um das Herz von Prinz Maxon – und kann ihre große Liebe Aspen trotzdem nicht vergessen. Starke Gefühle, wunderschön erzählt. Diese Ausgabe umfasst die drei Einzelbände Selection; Selection – Die Elite sowie Selection – Der Erwählte – mehr als 1000 Seiten Romantik pur!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1179
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Kiera Cass
Selection – Band 1 bis 3
Selection / Selection. Die Elite / Selection. Der Erwählte
Über dieses Buch
Die Chance ihres Lebens?
35 perfekte Mädchen – und eine von ihnen wird erwählt. Sie wird Prinz Maxon, den Thronfolger des Staates Illeá, heiraten. Für die hübsche America Singer ist das die Chance, aus einer niedrigen Kaste in die oberste Schicht der Gesellschaft aufzusteigen und damit ihre Familie aus der Armut zu befreien. Doch zu welchem Preis? Will sie vor den Augen des ganzen Landes mit den anderen Mädchen um die Gunst eines Prinzen konkurrieren, den sie gar nicht begehrt? Und will sie auf Aspen verzichten, ihre heimliche große Liebe?
Die gesamte Liebesgeschichte von America, Maxon und Aspen umfasst die drei Einzelbände ›Selection‹; ›Selection – Die Elite‹ sowie ›Selection – Der Erwählte‹
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Kiera Cass wurde in South Carolina, USA, geboren und lebt heute mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Virginia. Die Idee zu den ›Selection‹-Romanen kam ihr, als sie darüber nachdachte, ob Aschenputtel den Prinzen wirklich heiraten wollte – oder ob ein freier Abend und ein wunderschönes Kleid nicht auch gereicht hätten ...
Mit ihren ›Selection‹-Romanen hat sie es weltweit auf die Bestseller-Listen geschafft.
Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S.Fischer Verlage finden sich auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Garbsen
›Selection‹:
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel ›The Selection‹ bei HarperTeen, New York, USA
© by Kiera Cass
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2013 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
›Selection - Die Elite‹
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel ›The Elite‹ bei HarperTeen, New York, USA
© by Kiera Cass
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2014 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
›Selection - Der Erwählte‹
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel ›The One‹ bei HarperTeen, New York, USA
© by Kiera Cass
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2015 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Zero Werbeagentur, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-5031-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Band 1]
[Selection]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
[Band 2]
[Selection – Die Elite]
[Widmung]
[Motto]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Danksagung
[Band 3]
[Selection – Der Erwählte]
[Widmung]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
Epilog
Danksagung
[Band 1]
1
Meine Mutter war völlig ekstatisch, als wir den Brief bekamen. Für sie hatten sich damit all unsere Probleme auf einen Schlag gelöst. Es gab nur einen Haken an ihrem tollen Plan: mich. Ich halte mich nicht für eine besonders bockige Tochter, aber hier war für mich Schluss.
Ich wollte nicht zur Königsfamilie gehören. Und ich wollte keine Eins werden. Ich wollte es nicht mal versuchen.
Ich verkroch mich in meinem Zimmer, dem einzigen stillen Ort in unserem überfüllten Haus, und überlegte, wie ich Mom umstimmen konnte. Bislang hatte ich nur meine aufrichtigen Ansichten anzubieten … und die würde sie sich vermutlich nicht mal anhören.
Aber jetzt konnte ich Mom nicht länger aus dem Weg gehen. Es war bald Zeit zum Abendessen, und als ältestes Kind im Haus hatte ich das Kochen zu übernehmen. Ich zwang mich zum Aufstehen und begab mich in die Schlangengrube.
Mom warf mir einen erbosten Blick zu, blieb aber stumm.
Schweigend hantierten wir in Küche und Esszimmer herum, bereiteten Hühnchen, Pasta und Apfelschnitze zu und deckten den Tisch für fünf. Wenn ich mal aufblickte, schaute Mom mich so durchdringend an, als wolle sie mir auf diese Art ihren Willen aufzwingen. Das versuchte sie ständig. Wenn ich nicht auftreten wollte, weil die Auftraggeber grob und herablassend waren. Oder wenn ich den Hausputz übernehmen sollte, weil wir uns nicht mal mehr eine Sechs als Hilfe leisten konnten.
Manchmal bekam sie ihren Willen. Manchmal auch nicht. Aber in dieser Sache wollte ich mich nicht umstimmen lassen.
Mom kann es nicht ausstehen, wenn ich widerspenstig bin. Dabei sollte sie das eigentlich nicht wundern, denn das habe ich von ihr. Und hier ging es auch nicht um mich. Mom war schon seit einiger Zeit sehr angespannt. Der Sommer neigte sich dem Ende entgegen, und die Kälteperiode nahte. Und damit waren auch die Sorgen nicht fern.
Mom knallte den Krug mit Tee auf den Tisch. Beim Gedanken an Tee mit Zitrone lief mir das Wasser im Mund zusammen. Aber ich musste warten; es wäre Verschwendung gewesen, mein Glas Tee jetzt schon zu trinken und dann zum Essen nur Wasser zu haben.
»Glaubst du, es würde dich umbringen, das Formular auszufüllen?«, fragte sie schließlich. »Das Casting wäre so eine tolle Chance, für uns alle.«
Ich seufzte laut. Das Formular auszufüllen kam in meiner Vorstellung wirklich fast dem Tod gleich.
Es war kein Geheimnis, dass die Rebellen – jene Untergrundkolonien, die Illeá, unser großes und vergleichsweise junges Land, hassten – häufig brutale Angriffe auf den Palast starteten. Wir hatten gesehen, was sie in Carolina angerichtet hatten. Das Haus eines Stadtrats war in Brand gesteckt worden, und man hatte die Autos einiger Zweier zerstört. Einmal hatten die Rebellen sogar Häftlinge aus dem Gefängnis befreit – allerdings nur ein junges schwangeres Mädchen und eine Sieben, einen Vater von neun Kindern. Ehrlich gesagt, fand ich das eigentlich sogar richtig.
Doch von der Bedrohung abgesehen, schmerzte mir auch das Herz bei der Vorstellung, an dem Casting teilzunehmen. Und ich musste unwillkürlich lächeln beim Gedanken daran, wie viele gute Gründe es für mein Hierbleiben gab.
»Die letzten Jahre waren schlimm für deinen Vater«, sagte Mom aufgebracht. »Wenn du nur einen Funken Mitgefühl hast, tust du es für ihn.«
Dad. Ja. Dad würde ich wirklich helfen wollen. Und May und Gerad. Und vermutlich sogar meiner Mutter. Wenn sie das Ganze so darstellte, gab es auch keinen Anlass mehr zum Lächeln. Wir hatten es schon so lange schwer. Ich fragte mich, ob Dad das Casting auch als Chance betrachtete.
Unsere Lage war nicht so schlimm, dass wir ums nackte Überleben kämpfen mussten. Wir waren nicht bettelarm. Aber so weit entfernt davon wohl auch nicht.
Als Künstler waren wir nur drei Kasten höher als die Allerniedrigsten und galten wenig mehr als Dreck. Geld war knapp und unser Einkommen saisonabhängig.
In einem alten Geschichtsbuch hatte ich mal gelesen, dass die großen Feste früher alle im Winter stattfanden. Auf etwas namens Halloween folgte Thanksgiving, dann kamen Weihnachten und Silvester in kurzer Folge.
Weihnachten gab es noch. Die Geburt einer Gottheit ließ man unangetastet. Aber nachdem Illeá den großen Friedensvertrag mit China geschlossen hatte, begann das neue Jahr entweder im Januar oder im Februar, je nach Mondphase. Und alle anderen Dank- oder Unabhängigkeitsfeiern aus unserem Teil der Welt wurden dem Dankbarkeitsfest untergeordnet. Das fand im Sommer statt, und man feierte damit die Entstehung von Illeá, die Tatsache, dass es uns noch gab. Was Halloween war, wusste ich nicht. Es tauchte auch nie wieder auf.
Mindestens dreimal im Jahr hatte also die ganze Familie Arbeit. Dad und May malten Bilder, und Mäzene kauften ihre Werke als Geschenke. Mom und ich traten bei Festen auf – ich sang, sie spielte Klavier – und versuchten alle Engagements anzunehmen, die uns angeboten wurden. Als ich noch jünger war, fürchtete ich die Auftritte. Inzwischen finde ich mich damit ab, dass wir nur Hintergrundmusik zu liefern haben. Das wird von uns erwartet: dass man uns nicht sieht, sondern nur hört.
Gerad hatte seine Gabe noch nicht entdeckt. Aber er war ja auch erst sieben. Das hatte noch Zeit.
Mit der Laubfärbung würde unsere kleine Welt wieder ins Wanken geraten. Fünf Münder, aber nur vier Leute, die Geld verdienen konnten. Und keine Garantie für Aufträge bis Weihnachten.
Aus diesem Blickwinkel betrachtet, erschien mir das Casting wie eine Rettungsleine. Dieser blöde Brief konnte mich aus dem dunklen Loch herausziehen, mich und meine Familie.
Ich warf einen Blick auf meine Mutter. Für eine Fünf war sie recht mopplig. Sie aß gar nicht viel, und wir hatten ja ohnehin nie genug. Vielleicht sieht man einfach so aus, wenn man fünf Kinder geboren hat. Wie ich hatte sie rote Haare, durchzogen von weißen Strähnen. Die waren vor zwei Jahren plötzlich aufgetaucht. Mom war noch ziemlich jung, aber sie hatte Fältchen um die Augen, und während sie in der Küche arbeitete, ging sie so gebeugt, als habe sie eine schwere Last zu schleppen.
Ich wusste, dass sie viel Verantwortung trug. Und ich wusste auch, dass sie deshalb Druck auf mich ausübte. Schon unter normalen Umständen stritten wir uns häufig, aber wenn der bedrohliche Herbst nahte, wurde sie immer gereizter. Mir war auch klar, dass sie mich jetzt unmöglich fand, weil ich mich weigerte, dieses Stück Papier auszufüllen.
Aber es gab Dinge auf dieser Welt – wichtige Dinge –, die ich liebte. Und dieses Blatt Papier kam mir vor wie eine Mauer, die mich von allem trennen sollte, was ich mir wünschte. Vielleicht war das, was ich wollte, ganz unsinnig. Vielleicht würde ich es auch nie bekommen. Aber dennoch gehörte dieser Wunsch zu mir. Ich fühlte mich außerstande, meine Träume zu opfern, sosehr meine Familie mir auch am Herzen lag. Und die Familie bekam ohnehin schon so viel von mir.
Seit Kenna geheiratet hatte und Kota ausgezogen war, war ich das älteste Kind im Haus, und ich hatte mich bemüht, meine neue Rolle so schnell wie möglich auszufüllen. Ich tat, was in meinen Kräften stand. Schulunterricht bekam ich zu Hause, und meine Proben nahmen den größten Teil des Tages ein, da ich nicht nur sang, sondern auch mehrere Instrumente lernte.
Doch dieser Brief stellte all das in Frage. In Moms Vorstellung war ich schon Königin.
Es wäre schlau gewesen, diesen blöden Wisch verschwinden zu lassen, bevor Dad, May und Gerad nach Hause kamen. Aber Mom hatte ihn in der Tasche, und beim Essen brachte sie ihn zum Vorschein.
»An die Familie Singer«, flötete sie.
Ich versuchte ihr den Brief wegzureißen, aber sie war schneller. Früher oder später würden es ohnehin alle erfahren, aber so konnte sie die anderen leicht auf ihre Seite ziehen.
»Mom, bitte!«, sagte ich flehentlich.
»Ich will es aber hören!«, bettelte May. Das wunderte mich nicht. Meine kleine Schwester sah zwar wie eine drei Jahre jüngere Version von mir aus – aber unsere Persönlichkeiten waren grundverschieden: Im Gegensatz zu mir war May lebhaft und fröhlich. Und derzeit völlig verrückt nach Jungs. Sie würde diese Sache auf jeden Fall furchtbar romantisch finden.
Ich lief schamrot an. Dad hörte aufmerksam zu, und May strahlte. Gerad, der süße Kleine, aß ungerührt weiter. Mom räusperte sich und fuhr fort.
»Die jüngste Volkszählung hat ergeben, dass in Ihrem Haushalt eine unverheiratete weibliche Person zwischen sechzehn und zwanzig Jahren lebt. Wir möchten bekannt geben, dass in Kürze die Möglichkeit besteht, dem großartigen Staate Illeá Ehre zu erweisen.«
»Das bist du!«, kreischte May und packte mich an der Hand.
»Ich weiß, du Quietschmaus. Lass mich los, du brichst mir noch den Arm.« Aber May hielt meine Hand weiter umklammert und zappelte aufgeregt herum.
»Unser hochverehrter Prinz Maxon Schreave«, las Mom weiter, »wird in diesem Monat volljährig. Er möchte diese neue Lebensphase mit einer Partnerin an seiner Seite gestalten und eine Tochter von Illeá zur Frau nehmen. Wenn Ihre ledige Tochter oder Schwester Interesse daran hat, Prinz Maxons Gemahlin und die verehrte Prinzessin von Illeá zu werden, füllen Sie bitte das beigelegte Formular aus und senden es an Ihre zuständige Provinzverwaltung. Aus jeder Provinz wird eine junge Frau ausgelost und dem Prinzen vorgestellt werden.
Für die Dauer ihres Aufenthalts werden die Teilnehmerinnen im wunderbaren Palast Illeá in Angeles untergebracht sein. Die Familien der Teilnehmerinnen werden für ihre Dienste an der Königsfamilie eine großzügige Entschädigung erhalten.« Diese Worte betonte Mom besonders.
Ich verdrehte die Augen, während sie weiterlas. So verfuhren sie im Herrscherhaus mit den Söhnen. Prinzessinnen der Königsfamilie dagegen sollten in arrangierten Ehen mit anderen Königshäusern untergebracht werden, um die politischen Beziehungen mit diesen Ländern zu festigen. Ich verstand den Grund: Wir brauchten Verbündete. Aber ich fand das scheußlich und hoffte, so etwas nicht miterleben zu müssen. Tatsächlich war in der Königsfamilie seit drei Generationen keine Tochter geboren worden.
Prinzen dagegen verheiratete man mit Frauen aus dem Volk, um die Moral unserer bisweilen instabilen Nation aufrechtzuerhalten. Dieses Vorgehen sollte uns als Volk wohl immer daran erinnern, dass Illeá quasi aus dem Nichts entstanden war.
Beide Varianten der Verheiratungspraxis gefielen mir gar nicht. Und bei der Vorstellung, vor den Augen des gesamten Volkes an einem Castingwettbewerb teilzunehmen, bei dem dieser aufgeblasene Angeber sich das attraktivste und oberflächlichste Mädchen aussuchen durfte, das dann später im Fernsehen das hübsche Lärvchen an seiner Seite sein sollte, hätte ich schreien können. Etwas Demütigenderes gab es wohl kaum.
Außerdem hatte ich mich oft genug bei Zweiern und Dreiern zu Hause aufgehalten, um zu wissen, dass ich zu denen nicht gehören wollte – geschweige denn zu den Einsern. Abgesehen von den Zeiten, in denen es bei uns nicht genug zu essen gab, war ich mit meinem Dasein als Fünf vollauf zufrieden. Mom wollte innerhalb des Kastensystems aufsteigen, nicht ich.
»Und er würde sich ganz bestimmt für America entscheiden! Sie ist doch wunderschön«, schwärmte meine Mutter.
»Bitte, Mom. Ich bin nichts Besonderes.«
»Das stimmt nicht!«, warf May ein. »Weil ich nämlich so aussehe wie du, und ich bin sehr hübsch!« Sie grinste so breit, dass ich mir das Lachen nicht verkneifen konnte. Außerdem hatte sie recht. May war wirklich ein wunderhübsches Mädchen.
Aber das lag nicht nur an ihrem Gesicht, sondern an ihrem gewinnenden Lächeln und ihren leuchtenden Augen. May strahlte eine Energie und Begeisterung aus, die jeden in Bann zog. Sie hatte einen ganz besonderen Zauber, der mir nicht gegeben war.
»Was meinst du, Gerad? Findest du mich hübsch?«, fragte ich meinen kleinen Bruder.
Alle blickten auf das jüngste Familienmitglied.
»Nein! Mädchen sind blöd!«
»Gerad, bitte.« Mom stieß einen geplagten Seufzer aus, aber er war nicht ernst gemeint. Man konnte Gerad schwer böse sein. »America, du musst doch wissen, wie bezaubernd du bist.«
»Und wieso taucht dann hier keiner auf, der mit mir ausgehen will, wenn ich angeblich so bezaubernd bin?«
»Ach, da tauchen schon welche auf, aber die schicke ich immer weg. Meine Töchter sind zu hübsch, um einen Fünfer zu heiraten. Kenna hat einen Vierer geheiratet, und ich bin mir ganz sicher, dass du eine bessere Partie machen kannst.« Mom trank einen Schluck Tee.
»Er heißt James. Hör auf, ihn nur als Nummer zu bezeichnen. Und seit wann tauchen hier Jungs auf?« Meine Stimme klang immer schriller. Ich hatte noch nie einen Jungen vor unserer Tür gesichtet.
»Schon eine ganze Weile«, sagte Dad, der sich damit heute zum ersten Mal zu Wort meldete. Er klang bedrückt und starrte auf seine Teetasse. Ich fragte mich, was ihn so beunruhigte. Die Jungen? Dass Mom und ich wieder zankten? Dass ich nicht am Wettbewerb teilnehmen wollte? Dass ich weit weg sein würde, wenn ich doch teilnahm?
Dad und ich waren uns sehr nah. Nach meiner Geburt war Mom wohl ziemlich erschöpft, weshalb hauptsächlich er sich um mich gekümmert hatte. Mein Temperament hatte ich von meiner Mutter geerbt, aber die Feinfühligkeit hatte ich von meinem Vater.
Er warf mir einen kurzen Blick zu, und da wusste ich die Antwort: Dad wollte mir das nicht abverlangen. Er wollte nicht, dass ich an dem Casting teilnahm. Aber er wusste sehr genau um die Vorteile, selbst wenn ich nur einen einzigen Tag im Palast sein würde.
»Bitte nimm Vernunft an, America«, sagte Mom. »Wir sind wahrscheinlich die einzigen Eltern des Landes, die ihre Tochter dazu überreden müssen. Denk doch an diese großartige Chance! Du könntest eines Tages Königin sein!«
»Mom. Selbst wenn ich Königin sein wollte – was ich absolut nicht will –, gibt es Tausende von Mädchen aus der Provinz, die daran teilnehmen wollen. Tausende. Und selbst wenn man mich auswählt, sind da immer noch vierunddreißig andere, die sich garantiert viel besser auf Verführung verstehen als ich.«
Gerad horchte auf. »Was ist Verführung?«
»Nichts«, antworteten wir alle wie aus einem Munde.
»Es ist völlig albern zu glauben, dass ich Siegerin werden könnte«, endete ich.
Meine Mutter schob ihren Stuhl zurück, stand auf und beugte sich über den Tisch. »Aber irgendeine wird die Siegerin, America. Und deine Chancen stehen so gut wie die der anderen.« Sie warf ihre Serviette auf den Tisch und ging hinaus mit den Worten: »Wenn du aufgegessen hast, musst du dein Bad nehmen, Gerad.«
Mein Bruder stöhnte.
May aß schweigend weiter. Gerad wollte noch einen Nachschlag, aber es gab nichts mehr. Als die beiden aufstanden, fing ich an, den Tisch abzuräumen. Dad blieb sitzen und trank seinen Tee. Er hatte wieder Farbe in den Haaren, einen gelben Klecks, der mich zum Lächeln brachte. Dann stand er auf und wischte sich Krümel vom Hemd.
»Tut mir leid, Dad«, murmelte ich, als ich die Teller zusammenstellte.
»Sei nicht albern, mein Kätzchen. Ich bin dir nicht böse.« Er lächelte leichthin und legte mir den Arm um die Schultern.
»Ich will nur?…«
»Du musst mir nichts erklären, Schätzchen. Ich weiß Bescheid.« Er küsste mich auf die Stirn. »Ich geh wieder an die Arbeit.«
Ich bereitete in der Küche den Abwasch vor. Mein Essen hatte ich kaum angerührt. Ich bedeckte es mit einer Serviette und stellte den Teller in den Kühlschrank. Die anderen hatten höchstens ein, zwei Krumen übrig gelassen.
Ich seufzte und ging in mein Zimmer. Die ganze Sache war zum Verrücktwerden.
Wieso setzte Mom mich so unter Druck? War sie nicht zufrieden mit ihrem Leben? Liebte sie Dad nicht? Warum reichte ihr das nicht aus, was wir hatten? Warum musste sie immer so einen Stress machen?
Ich legte mich auf mein Bett mit der klumpigen Matratze und versuchte die Sache mit dem Casting zu durchdenken. Sie hatte gewiss auch ihre Vorteile. Es wäre auf jeden Fall schön, eine Weile genug zu essen zu haben. Aber es war ohnehin überflüssig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich würde mich nicht in Prinz Maxon verlieben. Ich hatte ihn einmal in dem wöchentlichen Bericht aus dem Capitol gesehen und fand ihn nicht mal besonders sympathisch.
Es schien eine halbe Ewigkeit zu dauern, bis endlich Mitternacht war. Neben meiner Tür hing ein Spiegel. Ich überprüfte, ob meine Haare noch so gut aussahen wie morgens, und legte eine Spur Lippenstift auf, damit ich ein bisschen Farbe im Gesicht hatte. Mom hatte angeordnet, dass Schminksachen aufgespart werden sollten für Auftritte, aber in Nächten wie dieser genehmigte ich mir ein bisschen Make-up.
Möglichst lautlos schlich ich in die Küche und packte die Reste meines Essens, etwas altbackenes Brot und einen Apfel zusammen. Dann ging ich in mein Zimmer zurück, machte das Fenster auf und schaute hinaus in unseren kleinen Garten hinter dem Haus. Es gab kaum Mondlicht, und ich musste warten, bis meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Hinter dem Rasen konnte ich die Umrisse unseres Baumhauses erkennen. Als wir noch Kinder waren, hatte Kota immer Bettlaken an die Äste gebunden, damit es wie ein Schiff aussah. Er war Kapitän und ich erster Offizier. Meine Pflichten damals bestanden hauptsächlich darin, aufzukehren und Essen zu machen, das aus Erde und Zweigen in Moms Bratpfannen bestand. Kota nahm dann einen Löffel voll von dem Zeug und »aß« es, indem er es über die Schulter warf. Dann musste ich natürlich schon wieder auskehren, aber das machte nichts. Ich war froh, überhaupt mit Kota auf dem Schiff sein zu dürfen.
Ich schaute mich um. In den Häusern nebenan war alles dunkel; niemand sah mich. Vorsichtig kletterte ich aus dem Fenster. Zu Anfang hatte ich mir dabei blaue Flecke zugezogen, aber inzwischen fiel es mir leicht. Ich hatte die Technik über die Jahre verbessert. Und ich wollte auf das Essen achtgeben.
Ich huschte über den Rasen. An sich hätte ich meine Tageskleidung anlassen können, aber ich trug meinen niedlichsten Schlafanzug, der aus einem braunen Höschen und einem engen weißen T-Shirt bestand und in dem ich mich sehr hübsch fühlte.
Obwohl ich nur eine Hand frei hatte, war es nicht schwer für mich, die an den Baum genagelten Bretterstufen hinaufzuklettern. Auch das hatte ich lange geübt. Mit jeder Stufe fühlte ich mich befreiter. Ich war nicht weit weg vom Haus, aber der ganze Trubel schien jetzt meilenweit entfernt zu sein. Hier musste ich nicht Prinzessin werden.
Als ich in den kleinen Raum kroch, der mein Zufluchtsort war, wusste ich, dass ich dort nicht alleine war. In der Ecke versteckte sich jemand im Dunkeln. Mein Herz schlug unwillkürlich höher. Ich stellte das Essen ab und blinzelte. Die Person bewegte sich und entzündete einen Kerzenstummel. Nur ein kleines Licht, das man vom Haus nicht sehen konnte, aber es reichte aus. Schließlich sprach der Eindringling, und ein freudiges Lächeln trat auf sein Gesicht.
»Hallo, schönes Mädchen.«
2
Ich kroch weiter nach hinten. Das Baumhaus war kaum vier Quadratmeter groß, und nicht mal Gerad konnte darin aufrecht stehen, aber ich liebte es. Es gab nur die Öffnung, durch die man hineinkam, und ein winziges Fenster an der Hinterwand. Ich hatte einen alten Tritthocker in die Ecke gestellt, der als Tisch für die Kerze diente, und einen kleinen Läufer auf den Boden gelegt, der schon so abgetreten war, dass man fast auf den bloßen Brettern hockte. Alles war sehr karg, aber es war mein Zufluchtsort. Unser Zufluchtsort.
»Bitte nenn mich nicht so. Erst meine Mutter, dann May und jetzt auch noch du. Das nervt.« Aspens Blick nach zu schließen, nützte mein Einwand rein gar nichts. Er lächelte.
»Geht nicht anders. Du bist das schönste Wesen, das ich jemals gesehen habe. Du kannst mir nicht vorwerfen, dass ich das auch sage, wenn ich schon einmal Gelegenheit dazu habe.« Er nahm mein Gesicht in beide Hände, und ich schaute tief in seine Augen.
Das reichte aus. Seine Lippen berührten meine, und ich konnte an nichts anderes mehr denken. Es gab kein Casting mehr, keine mittellose Familie, nicht einmal Illeá selbst. Nur noch Aspens Hände auf meinem Rücken, sein Atem auf meinen Wangen. Meine Hände strichen über seine schwarzen Haare, die noch feucht waren vom Duschen – er duschte immer nachts – und sich von selbst zu einem perfekten kleinen Knoten zusammengedreht hatten. Aspen roch nach der selbst gemachten Seife seiner Mutter. Ich träumte oft von diesem Duft. Als wir uns voneinander lösten, lag ein Lächeln auf meinem Gesicht.
Er saß breitbeinig da, und ich setzte mich auf ein Bein, wie ein Kind, das gewiegt werden will. »Tut mir leid, dass ich nicht besser gelaunt bin. Es ist wegen … wir haben heute diese blöde Mitteilung bekommen.«
»Ah ja, der Brief.« Aspen seufzte. »Wir haben zwei gekriegt.«
Natürlich. Die Zwillinge waren gerade sechzehn geworden.
Aspen betrachtete mich eingehend. Das tat er immer, wenn wir zusammen waren, als müsse er sich mein Gesicht neu einprägen. Wir hatten uns über eine Woche nicht gesehen und wurden immer unruhig, wenn mehr als ein paar Tage zwischen unseren Treffen lagen.
Und auch ich schaute ihn an. Aspen war – von allen Kasten – bei Weitem der am tollsten aussehende Typ der Stadt mit seinen schwarzen Haaren, den grünen Augen und dem geheimnisvollen Lächeln. Er war groß, aber nicht zu groß, und dünn, aber nicht zu dünn. In dem schummrigen Licht sah ich, dass er dunkle Schatten unter den Augen hatte; vermutlich hatte er die ganze Woche bis in die Nacht hinein gearbeitet. Sein schwarzes T-Shirt war an mehreren Stellen ebenso fadenscheinig wie die alte Jeans, die er fast jeden Tag trug.
Wenn ich sie nur für ihn flicken könnte. Das war mein größter Wunsch. Nicht Prinzessin von Illeá zu sein, sondern Aspens Prinzessin.
Es war schmerzhaft, nicht immer bei ihm sein zu können. An manchen Tagen wurde ich fast verrückt, weil ich so oft an ihn dachte. Wenn ich es nicht mehr aushalten konnte, machte ich Musik. Ich musste Aspen im Grunde dankbar sein, weil ich seinetwegen zu einer besseren Musikerin wurde.
Wir verstießen gegen das Gesetz. Aspen war eine Sechs. Sechser waren Bedienstete und nur deshalb eine Kaste höher als die Siebener, weil sie besser ausgebildet und auf Hausarbeit spezialisiert waren. Aspen sah umwerfend gut aus und war klüger, als alle ahnten, aber es gehörte sich nicht für eine Frau, jemanden aus einer niedrigeren Kaste zu heiraten. Der Mann konnte zwar um ihre Hand anhalten, erhielt aber nur selten eine Zusage. Und jeder, der in eine andere Kaste einheiratete, musste Formulare ausfüllen und an die neunzig Tage warten, bevor die anderen rechtlichen Schritte erfolgen konnten. Angeblich war das so, damit man Zeit hatte, sich noch alles anders zu überlegen. Wie auch immer – wenn man uns beide so spät nach der Sperrstunde und in dieser Lage entdecken würde, bekämen wir ernsthafte Probleme. Ganz zu schweigen von dem Donnerwetter, das ich von meiner Mutter zu hören bekommen würde.
Aber ich liebte Aspen nun mal. Seit fast zwei Jahren. Und er liebte mich. Wie wir da saßen und er mir übers Haar strich, konnte ich mir nicht vorstellen, an dem Casting teilzunehmen. Ich war doch schon verliebt.
»Wie denkst du darüber? Über das Casting, meine ich?«, fragte ich ihn.
»Das geht schon klar, denke ich. Er muss ja irgendwie ein Mädchen finden, der arme Bursche.« Der Sarkasmus in Aspens Stimme war unüberhörbar. Aber ich wollte seine wirkliche Meinung hören.
»Aspen.«
»Schon gut. Na ja, einerseits finde ich es irgendwie kläglich. Kann sich der Prinz mit niemandem verabreden? Ich meine, kriegt er allen Ernstes kein Mädchen ab? Wenn sie die Prinzessinnen mit Prinzen aus anderen Familien verheiraten, warum machen sie das mit ihm nicht genauso? Es muss doch irgendwo ein Mädchen aus einer königlichen Familie geben, das zu ihm passt. Ich kapier das nicht. So weit dazu.
Aber andererseits?…« Er seufzte. »Irgendwie finde ich die Idee auch gut. Aufregend. Er wird sich verlieben und dabei vom ganzen Volk beobachtet werden. Und ich finde die Vorstellung schön, dass die beiden dann zusammen glücklich sind bis an ihr Lebensende und so. Dass jedes Mädchen aus Illeá Königin werden könnte. Das macht Hoffnung. Dann könnte ich vielleicht auch so glücklich werden.«
Er strich über meine Lippen. Seine grünen Augen blickten in mein Innerstes, und ich spürte diese tiefe Verbindung, die ich bislang nur mit ihm empfunden hatte. Ich wollte auch, dass wir zusammen glücklich sein konnten bis an unser Lebensende.
»Dann bestärkst du die Zwillinge darin, dass sie teilnehmen sollen?«, fragte ich.
»Ja. Ich meine, wir haben den Prinzen ab und an gesehen; er scheint ganz in Ordnung zu sein. Bestimmt ziemlich eingebildet, aber freundlich. Und die Mädchen sind so verrückt auf das Casting – das ist echt witzig. Sie sind durchs Haus getanzt, als ich heute heimkam. Und für unsere Familie wäre es gut. Meine Mutter macht sich Hoffnungen, weil wir gleich zwei Bewerbungen abschicken können.«
Das war der erste erfreuliche Gedanke zu diesem schrecklichen Wettbewerb. Ich schämte mich, weil ich nur an mich und nicht an Aspens Schwestern gedacht hatte. Wenn eine von ihnen in die engere Auswahl käme und Siegerin würde?…
»Aspen, ist dir bewusst, was das bedeuten würde? Wenn Kamber oder Celia gewinnen würden?«
Er zog mich dichter an sich, küsste mich zart auf die Stirn und streichelte mir den Rücken.
»Daran hab ich den ganzen Tag gedacht«, antwortete er. Der kehlige Klang seiner Stimme vertrieb jeden anderen Gedanken aus meinem Kopf. Ich konnte nur noch an Aspens Berührungen und seine Küsse denken. Aber dann hörte ich, wie sein Magen laut knurrte.
»Ich hab uns übrigens was zu essen mitgebracht«, sagte ich beiläufig.
»Ach ja?« Ich merkte, dass er nicht begierig klingen wollte, aber es gelang ihm nicht ganz.
»Hühnchen. Wird dir schmecken, ich hab es selbst gekocht.«
Ich reichte ihm meine Mitbringsel, und er gab sich sichtlich Mühe, betont langsam zu essen. Ich biss einmal in den Apfel, um ihm Gesellschaft zu leisten bei seinem Mahl, aber den Rest ließ ich für ihn übrig.
Bei mir zu Hause musste man sich auch Sorgen um die Mahlzeiten machen, aber bei Aspen war es noch viel schlimmer. Er hatte zwar regelmäßig Arbeit, wurde aber viel schlechter bezahlt, und so gab es nie genug zu essen für seine Familie. Aspen war das älteste von sieben Kindern, und so wie ich ihn zu unterstützen versuchte, unterstützte er seine Familie. Seine Portionen überließ er häufig den jüngeren Geschwistern und der Mutter, die immer erschöpft war von der Arbeit. Sein Vater war vor drei Jahren gestorben, und seitdem musste Aspen die Familie alleine ernähren.
Ich sah zufrieden zu, wie Aspen sich die Soße von den Fingern leckte und das Brot einverleibte. Vermutlich hatte er eine halbe Ewigkeit nichts mehr gegessen.
»Du kannst toll kochen«, sagte er und biss in den Apfel. »Eines Tages wirst du jemanden fett und glücklich machen.«
»Dich werde ich fett und glücklich machen, das weißt du doch.«
»Ah, fett sein!«
Wir lachten, und dann berichtete er, wie es ihm seit unserem letzten Treffen ergangen war. Er hatte Büroarbeit für die Fabriken gemacht; ein Job, der ihn auch noch durch die nächste Woche bringen würde. Seine Mutter hatte endlich mehrere sichere Putzjobs bei Zweiern in unserer Wohngegend gefunden. Die Zwillinge allerdings waren traurig, weil sie ihre Theatergruppe nach der Schule aufgeben mussten, um Geld zu verdienen.
»Ich werd mal schauen, ob ich sonntags noch zusätzlich arbeiten kann. Ich finde es schrecklich, wenn die beiden etwas aufgeben müssen, das sie so sehr lieben.« Er hörte sich an, als sei es ihm absolut ernst mit diesem Plan.
»Aspen Leger, das lässt du schön bleiben! Du arbeitest doch ohnehin schon zu viel.«
»Ah, Mer«, raunte er mir ins Ohr, und sofort bekam ich Gänsehaut. »Du kennst doch Kamber und Celia. Die müssen unter Menschen sein. Man kann sie nicht einsperren und die ganze Zeit putzen oder Schreibarbeiten machen lassen. Das tut ihnen nicht gut.«
»Aber die anderen können auch nicht erwarten, dass du alles im Alleingang schaffst, Aspen. Ich weiß, was du für deine Schwestern empfindest, aber du musst auch auf dich aufpassen. Wenn du sie wirklich liebst, solltest du besser für ihren Ernährer sorgen.«
»Mach dir keine Gedanken, Mer. Ich glaube, es ist allerhand Gutes in Aussicht. Irgendwas wird sich bestimmt bald ändern.«
Nur dass seine Familie immer Geld brauchen würde. »Ich weiß, was du schaffen kannst, Aspen. Aber du bist kein Superheld. Du kannst den Menschen, die du liebst, nicht alles bieten, was sie sich wünschen. Deine Kräfte … sind auch nicht unerschöpflich.«
Wir blieben eine Weile stumm. Ich hoffte, dass Aspen sich meine Worte zu Herzen nehmen und sich nicht komplett verausgaben würde. Es kam immer wieder vor, dass Sechser, Siebener oder Achter vor Erschöpfung starben. Diese Vorstellung war mir unerträglich. Ich umschlang ihn fester, um das schlimme Bild aus meinem Kopf zu vertreiben.
»America?«
»Ja?«, flüsterte ich.
»Wirst du an dem Casting teilnehmen?«
»Nein! Natürlich nicht! Es soll sich bloß niemand einbilden, dass ich irgendeinen Fremden heiraten würde. Ich liebe dich«, sagte ich ernsthaft.
»Willst du eine Sechs werden? Immer Hunger und Sorgen haben?«, fragte er. Ich hörte den Schmerz in seiner Stimme, aber er wollte es wirklich wissen: Wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Palast mit Dienern oder der Dreizimmerwohnung mit Aspens Familie – wofür würde ich mich entscheiden?
»Wir werden es schaffen, Aspen. Wir sind findig und werden schon zurechtkommen.« Das versuchte ich mir auch selbst einzureden.
»Du weißt, dass es so nicht laufen wird, Mer. Ich werde weiterhin meine Familie ernähren müssen. Ich lasse niemanden im Stich. Und falls wir Kinder hätten?…«
»Wir werden auf jeden Fall Kinder haben«, sagte ich. »Aber wir passen auf, ja? Wer sagt denn, dass wir mehr als zwei kriegen müssen?«
»Du weißt, dass wir darüber nicht bestimmen können!« Ich hörte die unterdrückte Wut in seiner Stimme.
Und ich konnte sie ihm nicht verdenken. Wenn man reich war, konnte man seine Familie planen. Gehörte man aber zu den Vierern oder einer noch niedrigeren Kaste, blieb man sich selbst überlassen. Aspen und ich hatten in den letzten Monaten immer wieder Streit bekommen, sobald wir versuchten, uns ein gemeinsames Leben vorzustellen. Kinder waren das große Wagnis. Je mehr man hatte, desto mehr konnten auch arbeiten. Aber es gab eben auch viele hungrige Münder zu stopfen?…
Wir verfielen wieder in Schweigen. Aspen war temperamentvoll und neigte bei Diskussionen zum Jähzorn. Er hatte aber gelernt, sich zu beherrschen, und ich wusste, dass er sich jetzt genau darum bemühte.
Ich wollte nicht, dass er beunruhigt war oder sich Sorgen machte; ich glaubte tatsächlich, dass wir zurechtkommen würden. Wenn wir unsere Stärken nutzen würden, könnten wir alles Mögliche ausgleichen. Vielleicht war ich zu optimistisch oder zu verliebt; aber ich war fest davon überzeugt, dass Aspen und ich alles erreichen konnten, was wir wollten, wenn wir nur fest genug daran glaubten.
»Ich denke, du solltest es machen«, sagte er unvermittelt.
»Was?«
»Dich für das Casting bewerben.«
Ich starrte ihn aufgebracht an. »Bist du verrückt?«
»Hör mir zu, Mer«, raunte er mir ins Ohr. Das war nicht fair von ihm, weil er genau wusste, dass mich das ganz durcheinanderbrachte. Seine Stimme klang so kehlig und zärtlich, als wolle er mir etwas Romantisches sagen, doch das Gegenteil war der Fall. »Wenn du es besser haben könntest im Leben und du würdest diese Chance nicht nutzen – das könnte ich mir niemals verzeihen. Das könnte ich einfach nicht ertragen.«
Ich atmete heftig aus. »Es ist doch sowieso Blödsinn. Da werden sich Tausende bewerben. Ich würde es nicht mal in die Endrunde schaffen.«
»Dann kannst du dich ja genauso gut auch anmelden.« Er streichelte meine Arme. Wenn er das tat, war ich außerstande, ihm zu widersprechen. »Ich will doch nur, dass du es versuchst. Wenn du in die Endrunde kommst, nimmst du daran teil. Und wenn nicht, muss ich mir jedenfalls nicht vorwerfen, dass ich dir im Weg gestanden habe.«
»Aber ich liebe den Prinzen nicht, Aspen. Ich mag ihn nicht mal. Ich kenne ihn nicht mal persönlich.«
»Niemand kennt ihn persönlich. Und das kommt noch hinzu: Vielleicht würdest du ihn dann ja doch mögen.«
»Hör auf, Aspen. Ich liebe dich.«
»Ich liebe dich auch.« Er küsste mich zärtlich. »Und wenn du mich liebst, ziehst du das durch, damit ich mir keine Vorwürfe machen muss.«
Immer, wenn er sich selbst ins Spiel brachte, war ich wehrlos. Weil ich ihn nicht kränken konnte und alles tun wollte, um ihm das Leben zu erleichtern. Und letztendlich würde ich recht behalten: Es war ausgeschlossen, dass ich das Casting gewinnen würde. Ich konnte das Ganze also ruhig mitmachen, damit alle zufrieden waren, und falls ich nicht Siegerin wurde, würden alle das Thema schnell vergessen. Wenn meine Mutter merkte, dass ich willig war, würde sie vielleicht sogar ein Auge zudrücken, sobald Aspen genug Geld gespart hatte und um meine Hand anhalten würde.
»Bitte?«, raunte er mir ins Ohr, und mein Körper schien zu schmelzen.
»Also gut«, flüsterte ich. »Ich mach es. Aber du musst wissen, dass ich nicht irgendeine Prinzessin sein möchte. Sondern nur deine Frau.«
Er streichelte mein Haar.
»So wird es sein.«
Vielleicht bildete ich es mir ein, aber ich hätte schwören können, dass ihm Tränen in die Augen traten. Aspen hatte viel durchgemacht, aber ich hatte ihn nur einmal weinen sehen: als sein Bruder auf dem Marktplatz ausgepeitscht wurde. Der kleine Jemmy hatte auf dem Markt Obst gestohlen. Mit einem Erwachsenen hätte man kurzen Prozess gemacht und ihn, je nach Schwere des Diebstahls, ins Gefängnis geworfen oder zum Tode verurteilt. Weil Jemmy aber erst neun war, wurde er nur ausgepeitscht. Aspens Mutter hatte damals nicht genug Geld gehabt, um ihn zum Arzt zu bringen, weshalb Jemmys Rücken nun völlig vernarbt war.
An jenem Abend hatte ich aus dem Fenster geschaut, um zu sehen, ob Aspen ins Baumhaus kommen würde. Als ich ihn erspähte, ging ich sofort rüber. Er weinte eine Stunde lang in meinen Armen und sagte, wenn er nur mehr gearbeitet und mehr verdient hätte, dann hätte Jemmy nicht stehlen müssen. Es sei so ungerecht, dass Jemmy leiden musste, nur weil er versagt hätte.
Es war qualvoll, sich das anzuhören, denn natürlich war es nicht wahr. Aber es hatte keinen Sinn, ihm das zu sagen; er wollte es nicht hören. Aspen trug immer die Bürde aller Wünsche seiner geliebten Menschen mit sich herum. Da ich wunderbarerweise einer von ihnen war, versuchte ich meine Last möglichst klein zu halten.
»Singst du mir ein Schlummerlied?«, fragte er jetzt.
Ich lächelte. Es machte mir immer Freude, ihm vorzusingen, und ich sang leise ein Schlaflied für ihn.
Nach ein paar Minuten begann er gedankenverloren meine Schläfe zu streicheln. Dann küsste er meinen Hals und meine Ohren. Schob meinen Ärmel hoch und ließ seine Lippen über meinen Arm wandern. Mein Atem ging schneller. Das machte Aspen immer, wenn ich für ihn sang. Vielleicht genoss er mein heftiges Atmen sogar noch mehr als meine Lieder.
Kurz darauf lagen wir zusammen auf dem schäbigen Läufer. Aspen zog mich auf sich, und meine Hände strichen durch seine festen Haare, was sich wunderbar anfühlte. Er küsste mich hart und verlangend, und seine Finger gruben sich in meine Taille, meinen Rücken, meine Hüften, meine Schenkel.
Wir waren aber immer vorsichtig und erlaubten uns nie, was wir wirklich wollten – immerhin hatten wir schon gegen genügend Gesetze verstoßen. Doch ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendwer in Illeá leidenschaftlicher war als wir.
»Ich liebe dich, America Singer. Ich werde dich lieben, solange ich lebe.« Seine Stimme klang ergriffen und berührte etwas tief in meinem Inneren.
»Ich liebe dich auch, Aspen. Du wirst immer mein Prinz sein.«
Und er küsste mich, bis die Kerze niedergebrannt war.
Es mussten mehrere Stunden vergangen sein, seitdem ich zu ihm ins Baumhaus gekommen war, und meine Lider wurden schwer. Aspen war es einerlei, wie viel er selbst schlief, aber er achtete immer darauf, dass ich genug Schlaf bekam. Und so stieg ich schließlich müde die Stufen hinunter, mit meinem Teller und meinem Penny in der Hand.
Aspen war ganz verrückt nach meinen Liedern, und wenn er gerade mal ein bisschen Geld hatte, bezahlte er meinen Gesang mit einem Penny. Ich wollte eigentlich, dass er alles Geld an seine Familie weiterreichte, aber diese Pennys – die ich aufbewahrte, weil ich es nicht übers Herz brachte, sie auszugeben – waren wie ein Souvenir; sie erinnerten mich an alles, was Aspen für mich tun würde und was ich ihm bedeutete.
Auf meinem Zimmer holte ich das kleine Glas aus seinem Versteck und horchte auf den beglückenden Klang, als der Penny sich seinen Artgenossen zugesellte. Dann schaute ich aus dem Fenster. Zehn Minuten später sah ich Aspen die Stufen hinunterklettern und die Straße entlang huschen.
Ich blieb noch ein Weilchen wach, dachte an Aspen, meine Liebe zu ihm und das Gefühl, von ihm geliebt zu werden. Ich fühlte mich wie etwas ganz Besonderes, Kostbares, Einzigartiges. Keine Königin konnte sich großartiger fühlen als ich.
Und mit diesem Gefühl, sicher verwahrt in meinem Herzen, schlief ich ein.
3
Aspen war ganz in Weiß gekleidet und sah aus wie ein Engel. Wir waren noch in Carolina, aber weit und breit die einzigen Menschen. Das Alleinsein störte uns nicht. Aspen flocht eine Krone aus Zweigen für mich, und wir waren ein Paar. Ganz offiziell.
»America«, krähte meine Mutter und riss mich damit aus meinen Träumen.
Sie schaltete das Licht an, und ich rieb mir die brennenden Augen.
»Wach auf, America, ich möchte dir einen Vorschlag machen.« Ich schaute auf den Wecker. Erst kurz nach sieben. Ich hatte etwa fünf Stunden geschlafen.
»Mehr Schlaf?«, murmelte ich.
»Nein, Schatz, setz dich auf. Ich muss was Wichtiges mit dir besprechen.«
Ich rappelte mich mühsam hoch. Meine Kleider waren zerknittert, und meine Haare standen in alle Richtungen ab. Mom klatschte immer wieder ungeduldig in die Hände, als würde ich dadurch schneller wach.
»Na los doch, America. Komm zu dir.«
Ich gähnte. Zweimal.
»Was ist los?«, fragte ich.
»Ich will, dass du dich für das Casting anmeldest. Du würdest eine hervorragende Prinzessin abgeben.«
Es war definitiv zu früh für solche Gespräche.
»Also ehrlich, Mom, ich bin grade erst?…« Ich seufzte, als mir wieder einfiel, was ich Aspen letzte Nacht versprochen hatte: dass ich mich zumindest anmelden würde. Aber jetzt, bei Tageslicht, war ich nicht mehr sicher, ob ich mich wirklich dazu zwingen konnte.
»Ich weiß, dass du nicht willst«, sagte meine Mutter, »aber ich wollte dir etwas anbieten, um dich vielleicht doch umzustimmen.«
Ich horchte auf. Was mochte das sein?
»Ich habe gestern Abend mit deinem Vater gesprochen, und wir haben beschlossen, dass du alt genug bist, um alleine aufzutreten. Am Klavier bist du so gut wie ich, und wenn du weiter fleißig übst, wirst du bald fast perfekt Geige spielen. Und deine Stimme ist ohnehin die beste in der ganzen Provinz, wenn du mich fragst.«
Ich lächelte schläfrig. »Danke, Mom. Nett von dir.« Aber eigentlich arbeitete ich nicht gern alleine. Ich hatte keine Ahnung, wie sie mich damit umstimmen wollte.
»Das ist noch nicht alles. Du kannst deine Aufträge selbstständig annehmen und alleine auftreten und … und du kannst die Hälfte deiner Einnahmen behalten.« Sie verzog das Gesicht.
Ich riss die Augen auf.
»Aber nur, wenn du dich für das Casting anmeldest.« Ein Lächeln trat auf ihr Gesicht. Sie wusste, dass sie mich damit überzeugen konnte, obwohl sie offenbar mit mehr Widerstand gerechnet hatte. Aber ich war nicht dumm. Ich hätte mich ohnehin angemeldet, und nun würde ich obendrein noch Geld dafür bekommen! Geld, das ich Aspen geben konnte. Wenn wir gemeinsam sparten, konnten wir vielleicht auch schneller unsere Verbindung bekannt geben.
»Du weißt aber, dass ich mich nur anmelden kann, ja?«, sagte ich. »Ich kann niemanden dazu zwingen, mich auch auszuwählen.«
»Natürlich, das weiß ich. Aber es ist trotzdem den Versuch wert.«
»Wow, Mom.« Ich schüttelte verwundert den Kopf. »Na schön, dann fülle ich heute das Formular aus. Und du meinst das wirklich ernst mit dem Geld?«
»Sicher. Früher oder später würdest du ja sowieso alleine losziehen. Und es wird dir guttun, Verantwortung für dich selbst zu übernehmen. Aber vergiss bitte deine Familie nicht. Wir brauchen dich.«
»Wie könnte ich dich vergessen, Mom? Wer soll denn sonst an mir herumnörgeln?« Ich zwinkerte ihr zu, sie lachte, und damit war ihr Angebot beschlossene Sache.
Während ich duschte, ließ ich mir noch einmal durch den Kopf gehen, was sich in weniger als einem Tag ereignet hatte. Indem ich ein Blatt Papier ausfüllte, machte ich meiner Familie und Aspen eine Freude und verdiente vielleicht genug Geld, damit Aspen und ich heiraten konnten!
Ich selbst dachte nicht so viel an Geld, aber Aspen bestand darauf, Rücklagen zu haben. Die rechtlichen Schritte für unsere Eheschließung würden etwas kosten, und nach der Trauung wollten wir mit unseren Familien ein bisschen feiern. Diese Summe anzusparen, würde wohl nicht allzu lang dauern, aber Aspen wollte noch mehr Sicherheit. Vielleicht würde er sich irgendwann entspannen und darauf vertrauen, dass ich uns mit meinen Auftritten schon durchbringen würde.
Nach dem Duschen frisierte ich mich und legte zur Feier des Tages eine Spur Make-up auf. Dann ging ich zu meinem Kleiderschrank. Viel Auswahl hatte ich nicht. Die meisten Sachen, die ich besaß, waren beige, braun oder grün. Es gab ein paar Kleider für meine Arbeit, die allerdings hoffnungslos unmodisch waren. Aber so war es nun mal. Sechser und Siebener trugen fast immer Jeans oder andere robuste Stoffe. Fünfer waren meist schlicht gekleidet, da die Maler bei der Arbeit Kittel trugen und Sänger und Tänzer nur zu ihren Auftritten ein besonderes Outfit benötigten. Die höheren Kasten bekam man von Zeit zu Zeit in Khakis und Jeans zu sehen, dann aber modisch kombiniert. Als wäre es nicht schon übel genug, dass sie sich alles leisten konnten, fanden sie es auch noch schick, sich in der Nutzkleidung der unteren Kasten zu zeigen.
Ich entschied mich für meine Khakishorts und das grüne Hängertop – die spannendsten Sachen für tagsüber, die mein Kleiderschrank hergab – und prüfte mein Outfit dann noch mal im Spiegel. Ich fand mich ziemlich hübsch heute. Das lag wahrscheinlich an der Aufregung.
Mom saß mit Dad am Küchentisch und summte vor sich hin. Beide schauten mich ein paarmal an, aber ich ließ mich nicht beirren.
Als ich den Brief öffnete, staunte ich über das edle Papier, das sich schwer und weich zugleich anfühlte. So etwas Kostbares hatte ich noch nie in Händen gehalten. Als ich es berührte, wurde mir erst richtig bewusst, was ich mir vorgenommen hatte. Und mir kamen drei Wörter in den Sinn: Was wäre, wenn?
Ich schob den Gedanken beiseite und griff zum Stift.
Als Erstes musste ich Namen, Alter, Kaste und Adresse angeben, dann Größe, Gewicht, Haar-, Augen- und Hautfarbe. Mit einem gewissen Stolz konnte ich vermerken, dass ich drei Sprachen beherrschte. Die meisten Leute sprachen zwei, aber meine Mutter hatte darauf bestanden, dass wir Englisch und Französisch lernten, da beide Sprachen noch in einigen Landesteilen benutzt wurden. Außerdem war es hilfreich für die Auftritte – es gab so viele schöne Lieder auf Französisch. Auf dem Formular musste man auch die besten Schulnoten angeben, was sicher für krasse Unterschiede zwischen den einzelnen Bewerberinnen sorgte, denn nur Sechser und Siebener dürfen öffentliche Schulen besuchen und bekommen Noten. Ich stand kurz vor meinem Abschluss. Bei »Besondere Fähigkeiten« vermerkte ich meinen Gesang und alle Instrumente, die ich beherrschte.
»Meinst du, ich sollte auch hinschreiben, dass ich schlafen kann wie ein Murmeltier?«, fragte ich Dad und schaute ihn an, als denke ich ernsthaft darüber nach.
»Ja, unbedingt. Und du solltest auch angeben, dass du riesige Essensportionen in weniger als fünf Minuten verschlingen kannst«, antwortete er.
Ich lachte. Er hatte recht: Ich neigte dazu, mein Essen quasi zu inhalieren.
»Ach, ihr zwei wieder! Dann schreib doch gleich auch noch hin, dass du ein absoluter Starrkopf bist!«, schnaubte meine Mutter und stürmte hinaus. Ich konnte nicht fassen, dass sie sich so aufregte – sie bekam doch jetzt ihren Willen.
Ich schaute Dad fragend an.
Er machte gerade eine kleine Pause, bevor er an dem Gemälde weiterarbeitete, das bis Ende des Monats fertig sein sollte. »Sie will nur dein Bestes, das ist alles«, sagte er und lehnte sich entspannt zurück.
»Du doch auch, aber du rastest nie so aus«, erwiderte ich.
»Stimmt. Aber deine Mutter und ich haben eben unterschiedliche Vorstellungen davon, was gut für dich ist.« Er lächelte mich an. Den Mund hatte ich von ihm geerbt – mitsamt der Fähigkeit, arglos Dinge zu äußern, die dann Probleme verursachten. Mom neigte zum Aufbrausen, konnte aber in entscheidenden Situationen den Mund halten. Ich nicht. Und jetzt schon gar nicht?…
»Dad, wenn ich einen Sechser oder sogar Siebener heiraten wollte, würdest du es mir erlauben?«
Mein Vater stellte seinen Becher ab und sah mich an. Ich bemühte mich um eine ausdruckslose Miene. Dann seufzte er schwer.
»America, ich würde dich auch einen Achter heiraten lassen, wenn du ihn liebst. Aber du musst wissen, dass Liebe in einer Ehe manchmal schwindet, wenn man zu sehr unter Druck steht. Wenn ein Mann nicht für dich sorgen kann, fängst du vielleicht an, ihn zu hassen. Und wenn es deinen Kindern schlecht geht, kann es ganz schlimm werden. Unter solchen Umständen hat Liebe manchmal keine Chance zu überleben.«
Er legte seine Hand auf meine, damit ich ihn anschaute. Ich versuchte nicht betroffen zu wirken.
»Aber ich will vor allem, dass du geliebt wirst«, fuhr Dad fort. »Du verdienst es, geliebt zu werden. Und ich hoffe sehr, dass du aus Liebe heiratest und nicht wegen einer Zahl.«
Er konnte mir nicht sagen, was ich hören wollte – dass es tatsächlich so sein würde –, aber vorerst musste ich mich damit zufriedengeben.
»Danke, Dad.«
»Und sei nicht so streng mit deiner Mutter. Sie versucht nur, alles richtig zu machen.« Er küsste mich auf den Kopf und machte sich wieder an die Arbeit.
Ich seufzte und beschäftigte mich weiter mit dem Formular. Es kam mir vor, als sei meine Familie der Ansicht, dass ich kein Recht auf eigene Wünsche hätte. Das ärgerte mich, aber ich wusste, dass ich nichts dagegen tun konnte. Bei unserem Status konnten wir uns den Luxus des Wünschens nicht erlauben. Wir standen zu sehr unter Druck.
Als ich fertig war, ging ich mit dem Formular in den Garten. Mom nähte einen Rocksaum, während May im Schatten des Baumhauses ihre Schulaufgaben machte.
»Hast du’s echt ausgefüllt?«, fragte May und begann sofort wieder, aufgeregt herumzuzappeln.
»Hab ich.«
»Und warum hast du’s dir anders überlegt?«
»Mom kann sehr überzeugend sein«, sagte ich etwas spitz, aber meine Mutter schien sich ihrer Bestechungsaktion nicht zu schämen. »Sobald du Zeit hast, können wir zum Bürgeramt gehen, Mom.«
Sie lächelte. »Braves Mädchen. Mach dich startklar, dann gehen wir los. Ich will das so schnell wie möglich erledigen.«
Ich holte meine Schuhe und meine Tasche und blieb vor Gerads Zimmer stehen. Mein kleiner Bruder starrte auf eine leere Leinwand. Wir probierten alles Mögliche mit ihm aus, aber nichts schlug wirklich an. Man brauchte sich nur den ramponierten Fußball in der Ecke oder das gebrauchte Mikroskop anzuschauen, das wir einmal vor Weihnachten anstelle unserer Gage bekommen hatten, und es gab keinen Zweifel daran, dass Gerad nicht für die Künste geschaffen war.
»Fällt dir nichts ein?«, fragte ich und trat in sein Zimmer.
Er schaute auf und schüttelte den Kopf.
»Vielleicht könntest du es mit Bildhauerei probieren, wie Kota. Du hast tolle Hände. Du würdest das sicher gut können.«
»Ich will kein Bildhauer werden. Und ich will auch nicht malen oder singen oder Klavier spielen. Ich will Ball spielen.« Er stampfte mit dem Fuß auf.
»Ich weiß. Aber das kannst du doch auch in deiner Freizeit machen. Du musst etwas lernen, womit du Geld verdienen kannst. Ich bin mir sicher, du schaffst das.«
»Aber warum?«, sagte er kläglich.
»Das weißt du doch. Das schreiben die Gesetze vor.«
»Aber das ist ungerecht!« Gerad stieß die Leinwand von der Staffelei. Stäubchen wirbelten durch die Luft. »Wir können schließlich nichts dazu, dass unser Urgroßvater oder sonst wer arm war.«
»Ich weiß.« Es war wirklich schwer hinzunehmen, dass man Beschränkungen erdulden musste, weil die Vorfahren die Regierung nicht unterstützen konnten, aber so lief es nun mal. Und wir konnten überhaupt von Glück sagen, dass wir in Sicherheit waren. »Es war wohl damals nicht anders möglich.«
Er blieb stumm. Ich seufzte, hob die Leinwand auf und stellte sie wieder auf die Staffelei. Auch Gerad konnte Hindernisse nicht einfach aus seinem Leben verschwinden lassen.
»Du musst deine Hobbys nicht aufgeben, Brüderchen. Aber du willst doch Mom und Dad helfen und erwachsen werden und irgendwann einmal heiraten, oder?« Ich pikte ihn in die Seite.
Er streckte mir im Spaß die Zunge heraus, und wir kicherten beide.
»America!«, hörte ich meine Mutter rufen. »Wo steckst du denn?«
»Ich komme!«, schrie ich und wandte mich wieder Gerad zu. »Ich weiß, es ist nicht leicht, aber so ist es nun mal. Okay?«
Doch insgeheim wusste ich, dass an dieser Situation nichts okay war. Gar nichts.
Mom und ich gingen zu Fuß zum Bürgeramt. Wir fuhren nur vor einem Auftritt mit dem Bus oder wenn die Strecke zu weit war. Es machte keinen guten Eindruck, wenn man verschwitzt im Haus von Zweiern eintraf. Die blickten ohnehin schon auf uns herab. Aber heute war gutes Wetter, und wir hatten es nicht weit.
Offenbar waren wir nicht die Einzigen, die ihre Unterlagen auf direktem Weg einreichen wollten. Vor dem Bürgeramt der Provinz Carolina standen lange Viererschlangen bis fast um das gesamte Gebäude herum. Es sah aus, als wollten sich alle Mädchen aus der gesamten Provinz bewerben. Sogar einige Mädchen aus meiner Nachbarschaft. Ich wusste nicht, ob ich das erschreckend oder erfreulich finden sollte.
»Magda!«, rief jemand. Wir drehten uns beide um, als wir den Namen meiner Mutter hörten.
Celia und Kamber liefen auf uns zu, mit Aspens Mutter. Sie hatte sich offenbar freigenommen, um ihre Töchter zu begleiten. Die beiden trugen ihre besten Sachen und sahen sehr adrett aus. Die Kleider waren schlicht, aber wie ihr Bruder wirkten auch Celia und Kamber immer umwerfend. Auch sie hatten schwarze Haare und ein hinreißendes Lächeln.
Aspens Mutter lächelte mich an, und ich erwiderte das Lächeln. Ich fand sie wunderbar. Wir sahen uns nicht oft, aber sie war immer nett zu mir. Und ich wusste, dass es nichts mit meiner höheren Kaste zu tun hatte; sie gab auch Kleider, die ihren Kindern nicht mehr passten, an bettelarme Familien weiter. Sie war einfach eine gütige Frau.
»Hallo, Lena. Kamber, Celia, wie geht’s euch?«, begrüßte meine Mutter die drei.
»Gut!«, antworteten die beiden Mädchen wie aus einem Mund.
»Ihr seht toll aus«, sagte ich und strich Celia eine Locke über die Schulter.
»Wir haben uns für das Foto hübsch gemacht«, erklärte Kamber.
»Foto?«, fragte ich.
»Ja«, antwortete Aspens Mutter leise. »Ich habe gestern bei einem der Stadträte geputzt. Und da habe ich erfahren, dass in der Vorrunde gar nicht wirklich ausgelost wird. Die machen vielmehr Fotos und versuchen so viele Informationen wie möglich zu kriegen. Weshalb sollte es denn wichtig sein, wie viele Sprachen man spricht, wenn am Ende das Los entscheidet?«
Das hatte mich auch gewundert, aber ich hatte angenommen, man bräuchte diese Informationen nach der Auslosung.
»Es scheint sich teilweise rumgesprochen zu haben«, sagte Aspens Mutter. »Schaut euch nur mal um, viele hier sind wirklich ganz schön aufgetakelt.«
Ich betrachtete die anderen Bewerberinnen. Lena hatte recht – man konnte deutlich erkennen, wer Bescheid wusste und wer nicht. Hinter uns stand ein Mädchen, offenbar eine Sieben, das noch seine Arbeitskleidung trug. Die schmutzigen Stiefel kamen vielleicht nicht aufs Bild, aber ihr staubiger Overall wahrscheinlich schon. Eine andere Sieben etwas weiter hinten trug einen Werkzeuggürtel. Ihr einziger Vorzug bestand darin, dass ihr Gesicht sauber war.
Ein Mädchen vor mir dagegen hatte die Haare hochgesteckt, und zarte Löckchen umrahmten ihr Gesicht. Die Bewerberin daneben, den Kleidern nach zu schließen eine Zwei, schien die gesamte Welt in ihrem Dekolleté versenken zu wollen. Einige waren so stark geschminkt, dass sie in meinen Augen fast wie Clowns aussahen. Wie auch immer – sie hatten sich jedenfalls angestrengt.
Ich sah ansehnlich aus, hatte mir aber nicht solche Mühe gegeben. Wie die beiden Siebener hatte ich nichts von dem wirklichen Verfahren bei der Vorrunde geahnt, und nun machte ich mir plötzlich Sorgen.
Wieso überhaupt? Ich zwang mich zum Nachdenken.
Ich wollte das alles doch gar nicht. Wenn man mich nicht hübsch genug fand, war das nur in meinem Sinne. Aspens Schwestern würden auf jeden Fall die Nase vorn haben. Sie waren Naturschönheiten und sahen bezaubernd aus mit ihrem dezenten Make-up. Gingen Kamber oder Celia als Siegerin aus dem Wettbewerb hervor, würde Aspens Familie im Kastensystem aufsteigen. Und meine Mutter würde ja wohl kaum etwas dagegen einwenden können, dass ich einen Einser heiratete, nur weil er nicht der Prinz selbst war. Zum Glück war ich nicht besser informiert gewesen!
»Wahrscheinlich hast du recht«, sagte Mom. »Dieses Mädchen da drüben sieht aus wie ein Christbaum.« Sie lachte, aber ich merkte, dass sie erschüttert war über meinen Startnachteil.
»Keine Ahnung, weshalb manche Mädchen so übertreiben«, sagte Mrs Leger. »Schau doch nur America an. Sie sieht so hübsch aus. Ich bin froh, dass du nicht so zurechtgemacht bist.«
»Ach, ich bin doch nichts Besonderes. Wer würde schon mich auswählen, wenn er Kamber oder Celia haben könnte?« Ich zwinkerte den beiden zu, und sie lächelten. Auch Mom lächelte, aber es sah gezwungen aus. Sie fragte sich wohl, ob sie nicht lieber nach Hause laufen und sich umziehen sollte.
»Ach Unsinn!«, erwiderte Mrs Leger. »Jedes Mal, wenn Aspen deinem Bruder geholfen hat, schwärmt er davon, wie schön und talentiert die Singer-Kinder sind.«
»Wirklich? Was für ein netter Junge!«, säuselte Mom.
»Ja, man könnte sich keinen besseren Sohn wünschen. Er ist mir eine große Hilfe und arbeitet so hart.«
»Und eines Tages wird er bestimmt ein Mädchen glücklich machen«, sagte meine Mutter, die nur mit halbem Ohr zuhörte, weil sie die anderen Teilnehmerinnen musterte.
Mrs Leger sah sich rasch um. »Ganz unter uns: Ich glaube, er hat schon jemanden im Sinn.«
Ich erstarrte. Und überlegte, ob ich etwas sagen sollte oder ob jede Äußerung mich verraten würde.
»Und, wie ist sie?«, fragte Mom. Für Klatsch war immer Zeit, auch wenn sie mich gerade im Geiste mit einem Wildfremden verheiratete.
»Ich weiß es nicht. Ich habe sie noch nicht kennengelernt. Ist auch nur eine Vermutung, aber er wirkt so viel fröhlicher in letzter Zeit«, antwortete Mrs Leger strahlend.
In letzter Zeit? Wir trafen uns schon seit zwei Jahren. Wieso erst in letzter Zeit?
»Er summt vor sich hin«, warf Celia ein.
»Ja, er singt auch«, ergänzte Kamber.
»Er singt?«, rief ich aus.
»Oh ja«, antworteten die beiden wie aus einem Mund.
»Dann hat er bestimmt ein Mädchen«, sagte meine Mutter. »Ich frage mich, wer sie wohl ist.«
»Ich würde es auch allzu gern wissen«, sagte Mrs Leger. »Sie muss jedenfalls ein tolles Mädchen sein. In den letzten Monaten schuftet Aspen noch viel mehr als sonst. Und er spart Geld. Wahrscheinlich will er heiraten.«
Ich gab unwillkürlich einen kleinen Laut von mir, hatte aber Glück, denn die anderen schienen anzunehmen, ich fände die Nachricht als solche aufregend, und schöpften keinen Verdacht.
»Und ich freue mich so sehr für ihn«, fuhr Mrs Leger fort, »auch wenn er uns noch nicht verrät, wer sie ist. Aber er lächelt viel mehr und wirkt so zufrieden. Wir hatten eine schlimme Zeit, seit wir Herrick verloren haben, und Aspen trägt seitdem eine schwere Last. Ein Mädchen, das ihn glücklich macht, ist jetzt schon wie eine Tochter für mich.«
»Sie kann sich jedenfalls beglückwünschen! Dein Aspen ist ein großartiger Junge«, sagte Mom.
Ich konnte es nicht fassen. Seine Familie rackerte sich ab, um über die Runden zu kommen, und er legte Geld beiseite für mich! Ich wusste nicht, ob ich ihn schelten oder küssen sollte. Ich war überwältigt.
Er wollte also wirklich um meine Hand anhalten!
Ich konnte an nichts anderes mehr denken. Aspen, Aspen, Aspen.




![Selection Storys. Herz oder Krone [Band 1] - Kiera Cass - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/09a2067bd4cef710590deb122408622d/w200_u90.jpg)
![Selection Storys. Liebe oder Pflicht [Band 2] - Kiera Cass - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/158fb1392ee6a14e19034afb01d2e59d/w200_u90.jpg)