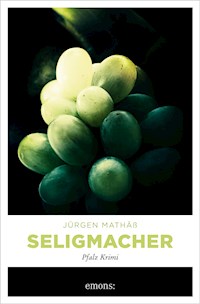
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Badenhop
- Sprache: Deutsch
Ein Krimi zum Genießen. Ein Mord in der Villa Ludwigshöhe und ein gestohlenes Gemälde des Impressionisten Max Slevogt geben Kommissar Jan Badenhop Rätsel auf. Als ein weiterer Toter in einem Weinberg gefunden wird, scheint es zunächst keinen Zusammenhang zu geben. Doch Badenhop hat so seine Zweifel. Seine Ermittlungen führen ihn von der Weinstraße bis in das multikulturelle Umfeld des Ludwigshafener Hemshofs – und zu einem alten Widersacher.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Jürgen Mathäß, 1951 in Landau geborener freier Weinjournalist, Unternehmensberater und Buchautor, studierte VWL und Jura in Frankfurt/Main. Er war Chefredakteur des Businessmagazins »Weinwirtschaft« und machte sich 1993 als Journalist und Unternehmensberater selbstständig. Er lebt seit zwanzig Jahren wieder in Landau, ist verheiratet und hat drei Kinder.
www.juergen-mathaess.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Roberto Pastrovicchio/Arcangel.com
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-798-9
Pfalz Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Der Horizont vieler Menschen istwie ein Kreis mit Radius null.Das nennen sie dann ihren Standpunkt.
Albert Einstein (angeblich)
Prolog
Verdammte Schraube. Irgendeiner seiner Vorgänger hatte den Verschluss der Ölwanne so zugeknallt, dass Egid sich jetzt überlegte, ob er sie aufbohren müsste. Eine Drecksarbeit. So hatte er sich das nicht vorgestellt, als er den fast fünfzig Jahre alten DKW Junior irgendwo in der Nähe von Bamberg gekauft und abgeholt hatte. Natürlich wusste er, dass da noch viel Arbeit zu investieren war. Aber mussten es unbedingt unbewegliche Schrauben sein?
Billig war der knallgelbe Dreizylinder sowieso nicht gewesen. Aber Egid hatte sich wie ein kleines Kind darauf gefreut. Den perfekt hergerichteten Oldtimer an schönen Tagen aus der Garage holen und übers Land fahren. Da wäre seine Familie in Feierstimmung. Sogar seine Frau, die sich sonst nur ins Auto setzte, um irgendwo hinzukommen, und seine Begeisterung für die »Blechkisten« überhaupt nicht verstand.
Stolz konnte man sein. Fahrer wie Zuschauer erlebten regelmäßig, wie sehr Fahrgäste in Oldtimern von den Passanten beneidet wurden. Da war man etwas Besonderes. Etwas Besseres. Für kurdische Flüchtlinge alles andere als üblich. Eine bewegende Vorstellung auch für ihn, obwohl er die alte Kutsche natürlich nicht deshalb herrichten wollte. Ihm ging es um das Auto, nicht um die Zuschauer. Trotzdem: Freudige Erwartung mischte sich in den Ärger wegen der blöden Schraube. Wer hätte gedacht, dass er es in diesem Land einmal so weit bringen würde?
Schon als Junge hatte sich Egid für Autos interessiert. Kein Wunder: Sein Vater arbeitete in einer Autowerkstatt in Wan, das die Türken Van nannten. Er hatte ihn ein paarmal zur Arbeit mitgenommen. Das waren einige seiner schönsten Kindheitserinnerungen. Bereits beim ersten Mal hatten ihn die Männer dort freundlich begrüßt und gefragt: »Na, Egid, willst du deinem Vater helfen?« Der Vater hatte sich viel Zeit für seine Fragen genommen. »Wie funktioniert das?« »Was macht man damit?« »Wie schnell fährt das Auto?« Da gab es so viele Werkzeuge, unzählige Einzelteile und immer wieder tolle Schlitten. Alles war interessant, eine Männerwelt eben.
Später, als er etwas älter war, wurden seine Fragen spezifischer. Und einmal, mit dreizehn, kurz bevor die Familie die Türkei verließ, hatte der Vater ihn sogar für ein paar Tage als Arbeiter in die Werkstatt gebracht. Da durfte er helfen, Autos abzukleben, die neu lackiert werden sollten. Seite an Seite arbeitete er mit den Älteren. Ein richtiger Mann. Natürlich wollte er auch Automechaniker werden. Ein anderer Beruf wäre ihm nie in den Sinn gekommen.
Ganz überraschend kam es nicht für die Familie, als der Vater eines Tages sagte: »Wir müssen weg.« Es hatte wieder Razzien gegeben. Einige ihrer Freunde waren verschwunden. Sie konnten nicht viel mitnehmen, jeder einen Koffer. Die Großeltern blieben in Wan. Egid hatte sie sehr vermisst.
Nach der Ankunft im fremden Deutschland hatte er lange warten müssen, bis er sein Berufsziel hatte weiterverfolgen können. Immerhin wurde die Familie wegen ihrer PKK-Sympathie nicht mehr verfolgt und bedroht, obwohl die Organisation schon zwei Jahre nach ihrer Ankunft auch in Deutschland verboten wurde. Der Vater hatte das nicht verstanden, jedoch darauf geachtet, dass er sich an die Vorschriften hielt. »Wir sind hier Gäste in einem fremden Land. Die Deutschen haben uns aufgenommen. Dass sie der türkischen Regierung einen Gefallen tun, damit sie mit ihr Geschäfte machen können, gefällt mir nicht. Aber wir müssen es akzeptieren.«
Nur wenige Freunde und nicht alle Verwandten hatten diese Haltung geteilt, ebenso wenig wie seine sprachlichen Anweisungen. Der Vater drängte von vornherein darauf, dass die ganze Familie, vor allem die vier Kinder, umgehend Deutsch lernten und sich in der Schule und im Beruf den Anforderungen der neuen Heimat stellten. Das war im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof, wo die Familie bis heute wohnte, nicht ganz einfach und schon gar nicht selbstverständlich. Sogar in der Schulklasse gab es mehr Zuwandererkinder als Deutsche. Viele befreundete Kurden versuchten, ihr gewohntes Leben so gut es ging weiterzuleben, blieben unter sich, brachten der deutschen Gesellschaft und ihren Gesetzen nur so weit Sympathie entgegen, als es ihren Vorstellungen vom Leben und den Gesetzen ihrer Religion nicht widersprach.
Jedenfalls, so ging es Egid durch den Kopf, hatte der Vater mit seiner Einstellung dazu beigetragen, dass die Kinder sich nicht mit Hilfsarbeiten durchs Leben schlagen mussten. Sie hatten einen Beruf gelernt und hatten Deutsche in ihrem Freundeskreis – ihre hier geborenen Kinder sowieso. Dass Egid eine eigene Autowerkstatt hatte, war indirekt auch das Verdienst seines Vaters. Die Mutter allerdings hatte es nicht geschafft. Sie war nur bei ihren Putzjobs unter Deutsche gekommen und konnte bis heute kein richtiges Gespräch in einer anderen Sprache als Türkisch und Kurdisch führen.
Egid wollte es für diesen Arbeitstag gut sein lassen und aus der Grube herausklettern. Gerade drehte er sich zur Treppe um, als er sah, wie sich ein Schatten am Fußboden neben dem Wagen bewegte. Egid verhielt sich ruhig. Er fragte sich, ob er noch Geräusche gemacht hatte, als der Fremde in die Halle gekommen war. Hatte der bemerkt, dass er sich in der Grube aufhielt?
Kurz darauf sah er ein paar sonderbare Cowboystiefel und ein Stück von zwei Jeansbeinen. Der Mann schien still stehen zu bleiben.
Cowboystiefel? Etwas regte sich in seinem Kopf, kroch ihm über den Rücken und ließ ihn den Schraubenschlüssel fester in die Hand nehmen. Eine dumpfe, böse Erinnerung hatte sich in seinem Gehirn Bahn verschafft. Als ob ein böser Geist seine Werkstatt erfasst hätte, schien die Freude über den gelben DKW von einem Augenblick auf den anderen etwas Verbotenes geworden zu sein, etwas, das gar nicht sein durfte. Nicht nach dem, was passiert war.
Egid musste sich überwinden, die Angst, die Trauer und die Wut wieder dorthin zu verbannen, wo sie keinen Schaden anrichten konnten. Erinnerung ja, doch das Leben ging weiter, auch wenn dieser Satz manchmal unerträglich banal war.
Nein, dachte er, was soll das? Es gibt keinen einzigen Grund, sich wegen dieser Kleinigkeit aufzuregen. Was geschehen war, lag lange zurück. Der Kunde hier konnte nichts dafür. Leute, denen solche Stiefel gefielen, gab es mehr als genug.
Stumm schüttelte er den Kopf, wie um die Gedanken abzuschütteln, die ihn einen Moment gepackt hatten. Dennoch verharrte er still und wartete, als ob er sich auf eine unbekannte Gefahr einstellen müsste.
Dann bewegten sich die Füße wieder. »Hallo, ist da jemand?«, hörte Egid den Mann rufen.
»Augenblick, ich komme raus«, antwortete er, legte den Schraubenschlüssel an die Seite der Grube, wischte sich die ölverschmierten Hände am Overall ab, ging die Treppe hoch und sah zu dem Mann, der sich in diesem Moment umdrehte. Dann erstarrte er.
EINS
»Herr Grindelsbacher, Sie sollten weniger Hausmacher essen«, hatte der Arzt mit ernstem Blick gesagt. »Oder allgemein: Der Verzehr tierischer Fette sollte auf jeden Fall reduziert werden. Gemüse und frisches Obst sind dagegen sehr zu empfehlen. Fisch ginge auch, aber möglichst keine Meeresfrüchte.« Krabben und Ähnliches enthielten besonders viel Cholesterin. Und das müsse runter. »Man kann fast sagen, LDL unter siebzig ist Ihre Lebensversicherung«, hatte er ihm noch mit auf den Weg gegeben, als er das Rezept für achtziger Atorvastatin unterschrieb. »Jeden Abend. Nicht vergessen!« Obwohl er ja noch recht jung sei, lebe er jetzt mit einem kardiovaskulären Risiko. Damit sei nicht zu spaßen. Mit einem Blick auf die Speckrollen am Bauch seines Patienten hatte er hinzugefügt: »Bewegung und frische Luft sind noch wichtiger. Körperliche Fitness senkt das Infarktrisiko nämlich erheblich stärker als niedrige Cholesterinwerte.« Um mit schiefem Grinsen zu ergänzen: »Bewegung, das heißt Sport, Laufen, Abnehmen. Nicht mit dem Traktor durch die Weinberge fahren.«
Karl Grindelsbacher wusste das alles, auch wenn er es gern verdrängte. Er hatte seine Morgentoilette beendet, das weiße Hemd, das Erika ihm herausgehängt hatte, und den Anzug angezogen. Ohne Eile schlurfte er in die Küche.
Obwohl der fast glatzköpfige Mittvierziger zuletzt einige Kilos abgenommen hatte, war seine rundliche Körperform weitgehend unverändert geblieben. Er sehe aus wie Gernot Hassknecht von der »heute-show«, hatte einmal ein Kollege gespottet. Grindelsbacher hatte sich daraufhin an einem Freitagabend die Politsatire angesehen, für die er sich noch nie interessiert hatte. Aber dieser Hassknecht trat gar nicht auf. Danach vergaß er die Sache wieder. Politik war nicht sein Ding. Diese Comedy-Sendungen auch nicht, die immer häufiger im Fernsehen kamen. Wenn überhaupt, dann setzte er sich dazu, wenn Erika Volksmusiksendungen verfolgte. Und Fußball natürlich.
In seiner Jugend hatte er selbst gekickt. Bis er seine spätere Frau kennenlernte. Da hatten sie an den Wochenenden lieber zusammen etwas unternommen, zumindest anfangs, als sie noch frisch verliebt gewesen waren. Danach war er nicht mehr so richtig reingekommen, obwohl er noch ein paarmal ins Training gegangen war. Zeit hätte er gehabt. Die Arbeit als Angestellter bei der städtischen Verwaltung forderte ihn nicht besonders. Ausgleich hätte ihm nicht geschadet. Stattdessen hielt er sich an nahrhafte Pfälzer Kost und trank mit seinen Kumpels lieber einen Schoppen Schorle, als auf dem Platz herumzurennen. Und schließlich waren da noch die paar Weinberge, die er von den Eltern geerbt hatte und nebenbei versorgen musste.
Kinder hatten sie keine bekommen, was seine Frau eher enttäuscht, er dagegen zufrieden in Kauf genommen hatte. Letztlich war es vielleicht gut gewesen, denn seine Ehepartnerin war schon jung einem Krebsleiden erlegen. Er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, wie er allein mit Kindern den Alltag hätte bewältigen sollen.
Zwei Jahre später war er Erika bei der Geburtstagsfeier eines Freundes begegnet. Sie hatten sich auf Anhieb verstanden und waren nach einem Jahr in Rhodt zusammengezogen. Es hatte ihm gar nichts ausgemacht, dass sie Kevin mit in die Beziehung gebracht hatte, der damals erst zehn Jahre alt gewesen war. Nun lebten sie schon ein Jahrzehnt zusammen. Von Heirat war nie die Rede gewesen. Warum auch? Sie fühlten sich als Familie. Kevin und er waren wie Vater und Sohn.
Doch, es ging ihnen ganz gut, bis dieser Herzanfall angedeutet hatte, dass zumindest bei ihm nicht alles einfach so weitergehen konnte. Immerhin hatte er gleich zweimal Glück gehabt, einmal, weil Erika dabei und der Notarzt schnell zur Stelle gewesen war. Zweitens, weil er nach der Genesung diese ruhige Stelle im Schloss angeboten bekommen hatte.
Dass dieser Job gut für ihn wäre, hatte er zumindest gedacht. Aber bald hatte er festgestellt, wie langweilig das Herumstehen war und dass der Arbeitstag ihm viel länger vorkam als früher. Kunst war auch nicht gerade das, wofür er sich noch begeistern konnte. Merkwürdig, denn vor Jahren hatte er eine Zeit lang recht regelmäßig Ausstellungen besucht, sogar ein paar Künstler gekannt. Wenn er heute darüber nachdachte, hatte das mehr mit seinen damaligen Kumpels zu tun gehabt als mit echtem Interesse. Eine wilde Zeit. Er mochte lieber gar nicht darüber nachdenken.
Spätestens als er Erika kennengelernt hatte, war es vorbei gewesen. Die Einladungen zu den Ausstellungen schickten die Galerien und Kunstmuseen zwar immer noch. Er warf sie jedoch sofort weg. Max Slevogt, na ja. Er konnte die eine oder andere Frage von Besuchern beantworten. Richtig interessiert gezeigt hatte er sich nur beim Einstellungsgespräch.
Jetzt stocherte Grindelsbacher unwillig in seinem Müsli herum. Lebenspartnerin Erika, die nach seiner Herzoperation die Rolle einer Ernährungs-Gouvernante übernommen hatte, lehnte daneben an der Küchenzeile und würde mit rigidem »Du willst doch nicht ernsthaft …« reagieren, wenn er Anstalten machte, im Kühlschrank nach seinem geliebten Schwartenmagen zu kramen. Fleisch, vor allem Schwein und Rind, hatte sie ihm strikt rationiert. Nur mit äußerster Anstrengung hatte er geschafft, dass immerhin noch etwas davon im Haushalt bleiben durfte und nicht alles weggeworfen werden musste. Es war ja eigentlich auch in Ordnung. Er sollte unbedingt gesünder leben. Seit er wieder zur Arbeit ging, war außerdem entschieden worden, dass er den knappen Kilometer zu Fuß lief. Da wagte er Erika nicht zu widersprechen. Anfangs hatte er hügelaufwärts ganz schön gekeucht. Nach vier Wochen fiel es ihm schon erheblich leichter. An manchen Tagen lief er geradezu beschwingt an den Weinbergen vorbei nach oben.
Am liebsten hätte er den Job ja ganz aufgegeben. Das könnte sogar seiner Gesundheit nützen. Statt die meiste Zeit herumzusitzen oder herumzustehen, könnte er mehr im Weinberg und im Keller arbeiten. Kevin, Erikas Sohn, wurde in Kürze mit seiner Winzerausbildung fertig und träumte davon, eigene Weine abzufüllen, statt wie bisher die Trauben ihrer anderthalb Hektar Weinberge bei der Genossenschaft abzuliefern. Zukunftsmusik. Von den paar Zeilen Dornfelder, Müller-Thurgau und Riesling konnte man nicht leben. Aber wenn noch einiges dazukäme, könnte man in diese Richtung planen.
Ohne es zu merken, nickte er mehrfach wie zur Bestätigung seiner Überlegungen.
»Hat’s geschmeckt?«, fragte Erika, die das Nicken wohl falsch verstanden hatte.
Aufgeschreckt aus seinen Gedanken sah er sie an, murmelte: »Geht so«, und schob die leere Schüssel von sich weg. Etwas Handfestes wäre ihm erheblich lieber gewesen.
»Ich hab dir einen Tomatensalat eingepackt und etwas von dem Siebenkornbrot, das du ja ganz gern magst«, sagte die fürsorgliche Diktatorin an seiner Seite und hielt ihm die Aktentasche hin. »Heute Abend kommt Kevin nach Hause. Er will mit dir über den Anbau reden.«
Vor Wochen hatte Kevin einen Anbau erwähnt. Grindelsbacher hatte das nicht als aktuelle Sache verstanden, die man schon detailliert besprechen musste. Das ging ihm zu schnell. Wenn Kevin mit kleinen Mengen eigener Abfüllung anfangen wollte, musste man nicht gleich mehrere zigtausend Euro in einen Anbau stecken, zu dem ja dann wohl auch Traubenannahme, Pumpen, Stahltanks, Barriquefässer und andere stinkteure Geräte gehören würden. Ein Rattenschwanz von Kosten, bevor man nennenswert Kunden für die Weine hätte. Nein, dazu hatte er keine Lust.
»Hm, darüber können wir reden. Aber man muss zusehen, dass man nicht die Katze vom Schwanz her aufzäumt. Erst soll er mal klein anfangen. Wenn es läuft, kann man immer noch investieren.«
Erika grinste. »Katze aufzäumen wäre mal was Neues. Lass uns doch mal sehen, was Kevin für Pläne hat, und hör ihn an, ohne gleich zu explodieren, okay?« Sie strich ihm sanft über die Wange und gab ihm einen Abschiedskuss.
Wenig später verließ Grindelsbacher das Haus. Ein herrlicher Tag. Die Morgensonne ließ die letzten Mandelblüten in weißlichem Rosa leuchten. Die ersten Triebe waren in den Weinbergen zu sehen. In den Gärten blühten Tulpen. Trotz des schönen Frühlingswetters war er irgendwie schlecht gelaunt. Etwas rumorte in ihm. Das Ernährungsdiktat? Kevins Pläne? Die Arbeit, die ihm noch nie Spaß gemacht hatte?
Er dachte nicht weiter darüber nach und schlug mit mürrischem Gesicht den Weg in Richtung Schloss ein. Dabei machte ihm das Laufen gar nicht mehr so viel Mühe wie noch vor wenigen Wochen.
Als er die letzten Häuser des Dorfes hinter sich gelassen hatte, die zarten Triebe der Reben rechts und links des Weges, blühende Büsche und den blauen Himmel sah und diesen unwiderstehlichen Duft des Frühlings einatmete, da war ihm auf einmal leichter ums Herz. Je näher er der Villa und dem Wald kam, umso besser schien die Luft zu schmecken, die in seine Lungen strömte.
Ein paar Meter noch, dann hatte er das große Eingangstor erreicht und dachte gar nicht mehr darüber nach, wie häufig ihm heute wohl Besucher komische Fragen stellen würden, wie oft er allzu Neugierige zurechtweisen müsste, weil sie die Gemälde berühren wollten oder gar mit Butterbroten vor den Bildern herumfuchtelten. Ach, er freute sich sogar auf den Blick aus dem oberen Stockwerk, wo sich die Ausstellung befand. Heute, bei diesem klaren Frühlingswetter, konnte er bestimmt die ganze Rheinebene bis nach Heidelberg überblicken.
ZWEI
Drei gut gelaunte Rentnerpaare verließen am Morgen nach einem üppigen Frühstück das »Gästehaus Pabst« in Rhodt. Sie sahen nicht aus wie die typischen Pfälzerwald-Wanderer, die sonntags mit Knickerbockern, Hosenträgern und kariertem Hemd in den Wanderhütten saßen. Zwar trugen sie Wanderschuhe, und einige von ihnen hatten sich einen kleinen Rucksack aufgeschnallt. Aber die pensionierten Lehrer und Kleingewerbetreibenden aus Dortmund unter Führung eines Weinhändlers, der sie in die Pfalz gelockt hatte, waren dezent gekleidet, sodass sie auch in einer Kunstausstellung nicht fehl am Platz wirken mussten.
Das abwechslungsreiche Tagesprogramm war schon am Abend ausgemacht worden. Kunst, Geschichte, zünftige Einkehr, Wanderung, schließlich Besuch eines Weinguts, eines Lieferanten des Händlers. Dieser weinselige Tagesabschluss sollte glücklicherweise wieder in Rhodt stattfinden. Kein langer Heimweg. Kein Auto. Gut so.
Man sah nach oben und nach Westen und schien allgemein zufrieden mit dem leicht bewölkten, angenehm warmen Frühlingstag.
»Na, dann wollen wir mal«, meinte einer der sechs nicht sonderlich einfallsreich und wandte sich in Richtung Wald. Die erste Etappe würde kurz ausfallen – entlang der Weinberge und ein kurzes Waldstück hoch zur Villa Ludwigshöhe. Rasch fand jeder seinen Trott. Man plauderte ein wenig über den gestrigen Abend mit Leberknödeln und Bratwurst und lachte über »vielleicht einen Schoppen zu viel«. Die Stimmung konnte kaum besser sein.
Nicht nur an schönen Frühlingstagen war »die Villa«, wie die Pfälzer sagten, ein beliebtes Ausflugsziel. Der ehemalige Sommersitz des Bayernkönigs Ludwig I. war aus Edenkoben mit dem Auto und aus Rhodt zu Fuß leicht zu erreichen. Der phantastische Blick über die Rheinebene rief immer wieder Ahs und Ohs hervor.
Der Weinhändler fand wohl, er sollte seine Gäste etwas auf den Besuch einstimmen, und hielt, als man sich dem imposanten Bau näherte, einen kleinen Vortrag.
»Der Grundstein für die ›Villa italienischer Art‹ – so lautete der Bauauftrag – wurde 1846 gelegt. Erstmals sind Ludwig und Gemahlin Therese zu sechs Wochen Sommerfrische im Juli 1852 aus München angereist. Doch da war er schon kein König mehr: 1848 hatte er abdanken müssen, vor allem wegen des deutlich geäußerten Unverständnisses der bayerischen Untertanen für die erotisch-politische Affäre seiner Majestät mit der Tänzerin Lola Montez. Das Schloss ist bestens gepflegt, und wir können heute beide Stockwerke besichtigen. Im unteren Stockwerk habe ich schon erlebt, dass sogar Kinder Spaß haben, vielleicht weil noch ein Badezimmer und die technisch damals hochmoderne Schlossküche zu bewundern sind. Vor allem aber dürfen sie – die Erwachsenen müssen – große Filzschuhe über ihre Schuhe ziehen und damit auf dem wertvollen Parkett herumrutschen. Allerdings hat es, als ich dort gewesen bin, ein wenig Ärger gegeben, weil die Kinder bei ihren Rutschpartien den Vortrag der Führerin gestört haben.«
»Oben gibt es eine Ausstellung, oder?« Einer der Wanderer hatte sich schon ein wenig vorinformiert.
»Ja, genau. Das obere Stockwerk kann getrennt besichtigt werden. Es beherbergt seit 1980 eine Dauerausstellung mit jeweils etwa hundertdreißig wechselnden Gemälden des wohl bekanntesten Pfälzer Künstlers, des Impressionisten Max Slevogt.«
Einer aus der Gruppe wollte wissen, wie lange die Besichtigung dauern sollte und ob noch genug Zeit für die Wanderung bliebe.
»Das können wir uns einrichten, je nachdem, wie lange wir uns mit der Ausstellung Zeit nehmen. Man kann im Schloss und drum herum den ganzen Tag verbringen, wenn man will. Es gibt draußen, wenige Schritte bergan, die einzige Sesselbahn der Pfalz hinauf zur Rietburg. Von der ursprünglichen Burg sind nur noch wenige Mauern erhalten. Ich habe geplant, dass wir hochfahren und dann eine längere Wanderung machen.«
Das Weindorf Rhodt mit allerlei touristischen Attraktionen von der malerischen Theresienstraße bis hin zu Weingütern und Weinstuben nutzten viele Pfalzbesucher als Ausgangspunkt oder Abschluss ihres Kurzurlaubs. Einer abwechslungsreichen Landpartie stand wenig mehr entgegen als sonntägliche Scharen von Menschen, die das gleiche Vergnügen suchten und die Weinstuben ebenso überfüllten wie die beiden Cafés am unteren Ende und in der Mitte der Theresienstraße. Die »Villa«, die an Wochentagen eher spärlich besucht wurde, war bei vielen ein Teil des sonntäglichen Programms. Keine Frage, dass die wandernden Pfalzbesucher sich diesen kulturellen Leckerbissen nicht entgehen lassen wollten.
Dieser Dienstag jedoch war nicht wie jeder andere. Die Vorfreude der an Werktagen nicht allzu zahlreichen Touristen wurde arg enttäuscht, weil unangekündigt das Schloss und die Ausstellungen für Besucher nicht geöffnet waren. »Wegen Zwischenfall geschlossen« stand auf einem handgeschriebenen und eilig an das Eingangstor geklebten Zettel. Davor stand jetzt die kleine Rentnergruppe.
Einer las vor, schüttelte den Kopf und sagte missgelaunt: »Zwischenfall? Was soll das denn heißen? Da kommt man extra hierher …«
Dann begann das Rätseln, um welches unerwartete Ereignis es sich handeln könnte, vor allem, weil man ein Auto mit aufgesetztem Blaulicht damit in Verbindung brachte, das etwas abseits geparkt war. Einigung war nicht zu erzielen. Ein Unfall? Ein Diebstahl? Ein randalierender Besucher? Gut, dann würde man eben die Wanderung etwas ausdehnen und sich gegen Abend im Dorf erkundigen, ob morgen wieder geöffnet wäre. Dem freundlichen und sehr gesprächigen Vermieter käme wohl im Laufe des Tages zu Ohren, was es mit dem »Zwischenfall« in der Villa auf sich hatte.
Wer sich noch im Inneren des monumentalen Gebäudes aufhielt, wusste bereits: Es war Schreckliches passiert. Michael Rüb, Angestellter der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz und verantwortlich für die Besucherorganisation der Slevogt-Ausstellung, konnte es kaum fassen. Mit zitternden Fingern hatte er die Edenkobener Polizei angerufen. Es hatte nicht lange gedauert, bis der grüne Passat mit dem aufgesetzten Blaulicht vor der Tür gehalten hatte.
Jetzt stand Rüb mit den Polizisten in einem der hinteren Ausstellungsräume und starrte auf die Szenerie, die ihm immer noch unfassbar schien. Die kleine Gruppe bildete einen Halbkreis um den Platz des berühmten »Selbstbildnis mit Strohhut«. Das kleinformatige Werk des Pfälzer Impressionisten hatte Dr. Sigrun Paas für die Max-Slevogt-Galerie der Villa einmal so beschrieben:
Das Porträt nimmt von Anfang an eine herausragende Stelle im Schaffen Slevogts ein. Unter den gegen Ende der achtziger Jahre entstandenen, in dunklen Farben gehaltenen Bildnissen gibt es nicht wenige Selbstporträts. Auf dem »Selbstbildnis mit Strohhut« dominieren lichte Farben. Vor allem der gelb glänzende Hut und das helle Hemd vermitteln eine sommerliche Atmosphäre. Gegenüber den früheren Selbstporträts unverändert sind die Nachdenklichkeit im Blick des Malers und der prüfende, Distanz schaffende Blick, der kritisch auf dem Betrachter liegt. Dem ruhigen, vertieften Beobachten entspricht die Struktur der Malerei, die in ihrer Dynamik große gestische Schwünge vermeidet zugunsten einer genaueren Modellierung.
Wo vorher das »Selbstbildnis mit Strohhut« gehangen hatte, sah Rüb jetzt nur noch ein weißes Rechteck. Das Gemälde war verschwunden. Ein Diebstahl in der Villa Ludwigshöhe, während der Öffnungszeiten! Das hatte es noch nie gegeben. Wie es gelungen war, das Werk abzunehmen und sich unbemerkt zu entfernen, war Rüb völlig unklar.
Dennoch konnte er die Umstände des Diebstahls oder den Verlust eines der bekanntesten Werke der Ausstellung im Augenblick noch gar nicht gedanklich verarbeiten. Ihn beschäftigte eine ganz andere, ihm immer noch unwirklich scheinende Tatsache: Vor der leeren Stelle an der Wand lag nämlich der für zwei Räume der Ausstellung zuständige Aufseher Karl Grindelsbacher in seinem Blut, das sich bereits einen Weg in die Ritzen und Poren des Parketts gesucht hatte.
»Halten Sie Abstand und berühren Sie auf keinen Fall etwas.« Der diensthabende Polizist war nur wenige Minuten nachdem sie Grindelsbacher entdeckt hatten hereingestürmt. »Das hier ist nichts für uns, Gerd«, sagte er in dienstlich-strengem Ton zu seinem Kollegen. »Ruf sofort das Kommissariat für Schwerverbrechen in Neustadt an und dann sorge dafür, dass niemand das Haus verlässt, auch keiner der Ausstellungsbesucher. Und frag unten am Eingang, wie viele Leute heute schon wieder rausgegangen sind und ob sich die Person an der Kasse an alle erinnert. Viele waren es bestimmt nicht. Es ist ja noch früh am Tag.« An die Umstehenden gewandt fragte er, wer den Toten entdeckt habe.
Michael Rüb deutete auf eine ältere Dame, die auf dem einzigen vorhandenen Stuhl saß. »Das ist eine Besucherin. Sie kam in den Raum und fand Karl hier auf dem Boden. Wie lange er schon da lag, weiß man nicht. Am frühen Morgen sind kaum Besucher hier, und heute kamen zufällig auch keine Schulklassen. Aber sehr lange kann er nicht unentdeckt gelegen haben, da ständig Leute in allen Ausstellungsräumen herumlaufen.«
Der Polizist nickte. »Zeigen Sie mir bitte, welchen Ausgang der Täter genommen haben könnte. Er wird ja vermutlich nicht durch den Haupteingang hinausspaziert sein, oder?«
Rüb dachte einen Moment nach. »Viele andere Möglichkeiten als den Haupteingang gibt es nicht, es sei denn, der Mann hat sich sehr gut ausgekannt und war in der Lage, die Türsperren zu überwinden. Und die Türen sind normalerweise nur mit registrierten Fingerabdrücken zu öffnen, abgesehen von zwei existierenden Hauptschlüsseln, die einbruchsicher verwahrt werden.«
Sehr wahrscheinlich schien es nicht, dass der Täter das Schloss durch den Haupteingang verlassen hatte, fand wohl auch der Polizist und meinte: »Dann muss der Kerl Ortskenntnis und sogar einen Helfer für den nötigen Fingerabdruck gehabt haben. Es wäre ja sehr sonderbar, wenn ein Mörder mit blutigem Messer und gestohlenem Gemälde hinausspazieren könnte, ohne dass es bemerkt wird. Auch wenn das Gemälde, wie man am Abdruck an der Wand sieht, nicht sehr groß sein kann. Hm, na ja, etwa dreißig mal fünfundzwanzig. Das müsste doch aufgefallen sein. Warten wir mal, was die Kollegen vom Kommissariat sagen.«
DREI
Bernd Hochdörffer lehnte lässig am Türpfosten im Büro seines Kollegen Jan Badenhop. »Hätte ich mir nie träumen lassen, dass du Nordlicht mich mal fragst, ob ich zu einer Weinprobe mitkomme. Aber doch, warum nicht? Man kann ja immer was dazulernen. Und wenn Schwörer das macht … Der ist ja nicht nur Super-Experte, sondern auch superwitzig. Ich mache mir übrigens immer noch gern einen Spaß daraus, ihn aufzuziehen, weil er damals diesen durchtriebenen Kellereibesitzer Dorschd in Ranschbach nicht drangekriegt hat, obwohl jeder wusste, dass dort gepanscht wurde.«
Der Weinkontrolleur Stefan Schwörer war im Neustadter Kommissariat erstmals im Zusammenhang mit einem Mord im nahe gelegenen Weinort Forst aufgetaucht. Unvergesslich war er bei diesem Fall nicht nur durch seine sympathische Art geworden, sondern weil es ihm gelungen war, durch Verkostung von Weinen der Lage Pechstein den entscheidenden Hinweis auf den Mörder zu liefern. Seitdem hatte Jan Badenhop, der zuständige Kommissar im Neustadter Kommissariat für Schwerverbrechen, ihn immer mal wieder in Zusammenhang mit Wein um Rat gefragt. Seine wortreichen und detailgenauen Erklärungen, seine pfälzische Frohnatur und sein unermüdliches Bemühen, bei Badenhop Weininteresse zu wecken, hatten zu einer Art Freundschaft der beiden Männer geführt. Seit Kurzem waren sie sogar per Du. Schwörer hatte Badenhop erstmals zu sich nach Hause zum Essen eingeladen. Gleich bei der Begrüßung an der Tür hatte er erklärt, er weigere sich, seine privaten Gäste zu siezen. Er lade nur Freunde zu sich nach Hause ein. Damit war die Freundschaft besiegelt. Dass sie auch begossen wurde, darüber konnte im Hause Schwörer kein Zweifel bestehen.
Badenhop, der vor einigen Jahren ohne jeden Zugang zum Thema Wein aus Hamburg in die Pfalz gekommen war, hatte sich, ob er wollte oder nicht, schon allein deshalb immer wieder mit Wein beschäftigen müssen, weil einige seiner Fälle mit Wein und Winzern zu tun gehabt hatten. Schwörer war es allerdings nicht allzu schwergefallen, die Neugierde des Hamburgers zu wecken.
Nach und nach hatte Badenhop eine ganz neue Seite seines Wesens entdeckt: die Affinität zu gutem Essen und Trinken. Er wunderte sich angesichts des hervorragenden Angebots an Restaurants in Hamburg, wieso er den Reiz dort weniger empfunden hatte. War er mit seiner Frau Ingrid, die das großstädtische Leben liebte, hin und wieder »schön essen« gegangen, hatte er es vor allem als gesellschaftliches oder privates Ereignis wahrgenommen. Inzwischen freute er sich auf gute Hausmannskost in den besseren Weinstuben und auf die Weine, die dazu passten. Selbst die Unterschiede von Rebsorten wie Riesling, Sauvignon Blanc oder Weißburgunder waren ihm mittlerweile bekannt, freilich ohne dass er sich zugetraut hätte, in jedem Fall eine sichere Einschätzung abgeben zu können.
Einen kleinen Vorrat an Flaschen, darunter das eine oder andere Große Gewächs, hatte er sich ebenfalls in den Keller gelegt. Einige gute Namen Pfälzer Winzer waren ihm schon deshalb geläufig, weil Schwörer ihn immer wieder mit der Nase darauf stieß.
»Das Wichtigste auf der Flasche ist der Name des Winzers«, pflegte der zu dozieren. »Alle anderen Angaben können bei zwei Weinen identisch sein – und doch ist der eine wunderbar, und der andere kann froh sein, wenn er beim Kochen in die Soße darf und nicht direkt in den Abfluss muss.« Beim letzten Halbsatz hatte Schwörer den Zeigefinger gehoben und nach jedem Wort eine kleine Pause gemacht.
Badenhop hatte eine Erklärung für das Interesse, das die Pfalz und nicht zuletzt Schwörer in ihm geweckt hatten. Essen und Trinken waren zweifellos körperliche, Gefühle und Wohlbefinden ansprechende Tätigkeiten. Dennoch konnte man den Genuss steigern, wenn man mehr darüber erfuhr. Ein Glas Wein zu trinken war eine Sache. Die Rebsorte, die Stilistik, vielleicht sogar den Boden zu ergründen und mit dem Genuss in Verbindung zu bringen – das war viel mehr als ein Schluck Wein. Seine emotionale Seite, die der Hamburger, seit er in der Pfalz war und ihren so ganz anderen Menschenschlag kennengelernt hatte, als etwas unterentwickelt empfand, konnte er beim Essen und Trinken ausbauen und gleichzeitig Wissen auf diesem Gebiet ansammeln. Das gefiel ihm. Dass er seine Emotionalität auch auf anderem Gebiet weiterentwickelte, hatte er letztlich ebenfalls als sehr angenehm empfunden, auch wenn erhebliche familiäre Konflikte dabei überwunden werden mussten.
Versonnen lächelte er beim Gedanken an seine Partnerin Katrin vor sich hin.
Hochdörffer, selbst Pfälzer durch und durch, nahm die »Verpfälzerung« seines Kollegen mit Befriedigung zur Kenntnis und musste zugeben, dass Badenhop sich etwas Fachwissen angeeignet hatte, über das er selbst nicht verfügte, da er zwar regelmäßig mit großem Vergnügen Wein trank, aber nicht sehr viel darüber redete. Er wusste, was ein Pfälzer Weintrinker eben so wusste – zehn Namen, fünf Lagen und ein paar Rebsorten.
Aber Badenhop hatte irgendwann begonnen, sich wirklich zu interessieren. Er ließ sich von Schwörer zu Weinproben mitschleppen und hatte sich sogar ein kleines Quartheft gekauft. Dort trug er jeden Wein ein, den er probierte oder trank – ganz wie es ihm Schwörer empfohlen hatte.
So weit wäre Hochdörffer nie gegangen.
»Und überhaupt«, hatte er kürzlich gestichelt, »versuch dich nicht einzuschleimen. Pfälzer wird man erst in der dritten oder vierten Generation. Vorher ist man immer noch ein Zuwanderer.«
Badenhop hatte nur müde gelächelt. »Übertreib es lieber nicht. Besonders weit darf man nicht zurückgehen, sonst findet man heraus, dass es die Pfälzer gar nicht gibt – zumindest nicht als altes, einheitliches Völkchen. In dieser Gegend haben sich ja Menschen aus allen möglichen Ecken Europas nicht nur die Hand gegeben. Ihr Pfälzer seid richtige Promenadenmischungen.«
»Genau«, hatte Hochdörffer gekontert. »Das erklärt den besonderen Wert des pfälzischen Erbguts. Eine vernünftige Vermischung von Genmaterial führt bekanntlich zu besonders hoch entwickelten Exemplaren einer Spezies.«
Mit dieser pfälzischen Interpretation darwinistischer Evolutionstheorie hatte die kollegiale Kabbelei geendet.
Dass Hochdörffer schließlich doch zu einer Weinprobe mitkommen wollte, freute Badenhop. Er fand, er habe in letzter Zeit die Freundschaft mit seinem Kollegen ein wenig schleifen lassen. Und Schwörer, dem das regelmäßige Weintrinken Hochdörffers bei gleichzeitigem Desinteresse an Weinwissen schon lange ein Dorn im Auge war – »eines Pfälzers unwürdig«, hatte er es einmal genannt –, hatte ausdrücklich gebeten, Hochdörffer solle ausnahmsweise mitgeschleppt werden, »damit er etwas lernt«.
Der Abend würde sicher interessant werden. »Pfalz und Burgund – Pinot Noir vom Feinsten«, hieß das Thema. Das habe er, Schwörer, als besonderer Liebhaber der Bourgogne schon immer mal machen wollen. »Spätburgunder gibt es hier ja seit Ewigkeiten«, pflegte er zu dozieren. »Aber kaum einer hat vor dreißig Jahren auch nur die Qualität eines mittelmäßigen Bourgogne erreicht. Seitdem hat sich viel getan. Die besten Pfälzer kommen den Grands Crus aus dem Burgund mittlerweile ziemlich nahe.«
Vor allem natürlich sein eigener, hatte er vermutlich gedacht. Schwörer hatte begonnen, die Weine eines kleinen eigenen Weinbergs selbst auszubauen. Alle gängigen Weinführer hatten seinen »Pinot Noir« zuletzt über den grünen Klee gelobt.
Noch bevor Badenhop und Hochdörffer Details über den geplanten Abend austauschen konnten, hörten sie Sabine Vogel schnellen Schrittes den Flur entlanghasten.
»Herr Badenhop«, rief sie aufgeregt, »Sie müssen sofort nach Edenkoben!«
***
Bei Kilometer 8,743 klingelte die Apple Watch. Ohne sein Lauftempo zu reduzieren, warf Kriminalassistent Kevin Groß einen Blick auf das Display. Sabine Vogel. Was wollte die Abteilungssekretärin jetzt von ihm? Er hatte frei, nicht nur das: Er absolvierte gerade seine vor einiger Zeit auf zehn Kilometer verlängerte Tagesstrecke. Sabine wusste das. Es musste also wichtig sein.
Mürrisch nahm er das Gespräch an. »Was gibt’s? Bin grad am Laufen«, keuchte er in Richtung Uhr.
»Mord in der Villa Ludwigshöhe. Wo bist du? Badenhop greift dich irgendwo auf und nimmt dich mit.«
»Er soll an meine Haustür kommen. In sieben Minuten bin ich dort.«
Der junge Polizist, ebenso wie Kommissar Hochdörffer Pfälzer durch und durch, hatte wesentlich dazu beigetragen, dass sein Chef mittlerweile in der Lage war, auch den unverfälschten Dialekt älterer Dorfbewohner zu verstehen, die das Hochdeutsche kaum beherrschten. Er machte sich inzwischen gar nicht mehr die Mühe, Hochdeutsch mit Badenhop zu sprechen.
Anfängliche Versuche hatten ihm mehr Spott als Dankbarkeit eingebracht. Dennoch war Badenhop zeitweise darauf angewiesen gewesen, dass Groß Gespräche mit hartgesottenen Pfälzern führte. Einmal hatte er kommentiert: »Ich bin ja froh, dass ich nicht nur einen Assistenten, sondern auch einen Dolmetscher in der Abteilung habe.« Immerhin war das Übersetzen vom Pfälzischen ins Hochdeutsche nicht mehr nötig. Was nicht bedeutete, dass Badenhop alle schwierigen Details verstand. Bei »dreigedrehder Hoppschloodel« schwante ihm höchstens eine diffuse Beleidigung.
Gleich ging es also mit seinem Chef zur Villa. Da war er schon lange nicht mehr gewesen.
Als Groß in die Straße einbog, in der er wohnte, sah er Badenhops Wagen um die Ecke kommen. Badenhop winkte ihn sofort ins Auto, beäugte ihn kritisch und konnte einen Kommentar nicht lassen.
»Na ja«, witzelte er, als Groß sich in den Wagen setzte, »falls der Täter zu Fuß abgehauen ist, sind Sie ja schon mal für die Verfolgung angezogen.«
»Lieber hätte ich mich noch geduscht«, antwortete Groß trocken. »Aber was tut man nicht alles an seinem freien Tag für die nächste gute Beurteilung.« Es hörte sich freilich eher so an: »Liewer heddich noch geduschd. Was machd mer nit alles an seim freie Daach fer die neggschd guud Beurdälung.«
Badenhop ließ die Anspielung unkommentiert und gab Gas. Groß, der grundsätzlich mit Anzug und Krawatte ins Büro kam, auch wenn er immer ein wenig wie frisch hineingesteckt aussah, würde sich allerlei spitze Bemerkungen anhören müssen, wenn sie zurück ins Kommissariat kamen. Badenhop musste grinsen, als er daran dachte.
»Da hat einer aber richtig Interesse an Kunst, wenn er einen Wärter umbringt, um ein Gemälde klauen zu können«, murmelte Groß, als Badenhop ihm die wenigen Informationen weitergegeben hatte, die ihm bekannt waren. »Dass ein Slevogt so begehrt ist, hätte man ja auch als Pfälzer nicht gedacht. Und der Kerl muss das Messer oder eine andere Stichwaffe mitgebracht haben. Er hat also damit gerechnet, dass er beim Klauen gestört wird. Sehr komisch.«
Dieser für einen Kunstraub recht ungewöhnliche Aspekt war Badenhop gleich aufgefallen. Wer dachte sich so etwas aus? Er hatte das Gefühl, es könnte mehr dahinterstecken.
Als sie den Tatort betraten, war die Spurensicherung bereits angekommen. Die Ausstellung zog sich, wie Badenhop bemerkte, über mehrere Räume. Der Mord war in einem kleineren Raum geschehen, der recht weit vom Ausgang entfernt lag.
Badenhop ließ sich von den anwesenden Polizisten berichten, was sie schon erfahren hatten, und fragte dann, den Blick auf Michael Rüb gerichtet: »Wie viele Personen waren heute Morgen hier, und wie viele sind jetzt noch da?«
Rüb hatte das bereits geklärt. »Im Schloss haben heute insgesamt sieben Angestellte Dienst. Besucher waren es nach Kartenverkauf einundzwanzig, verteilt auf die Ausstellung und die Räume im Erdgeschoss. Davon haben wir dreizehn noch gefunden. Sie befinden sich alle im größeren Raum vorn, zusammen mit dem heute anwesenden Personal.«
»Alle Ausgänge werden bewacht. Nach unserem Eintreffen konnte niemand mehr die Villa verlassen«, ergänzte der Polizist. »Die Schließung erfolgte allerdings erst eine gewisse Zeit nach Entdeckung der Tat.«
Das war eine Schwachstelle, fand Badenhop. »Wie viel Zeit könnte vergangen sein zwischen der Tat und dem Abschließen der Türen?«
Rüb schien zu spüren, dass hier womöglich ein Versäumnis seinerseits vorlag, machte jedoch auf Badenhop nicht den Eindruck, die Situation beschönigen zu wollen. »Es gab natürlich unmittelbar nachdem der Tote gefunden wurde, eine gewisse Zeit der Unruhe. Wir haben zuerst nachgesehen, ob ihm noch zu helfen ist, und mussten auch die Besucher fernhalten, die aufmerksam geworden waren. Es könnten vielleicht drei oder vier Minuten gewesen sein, bis ein Mitarbeiter an der Kasse Bescheid gegeben hat, dass niemand mehr rein- oder rauskann.«
»Ist es möglich, dass sich jemand Zutritt zum Schloss verschafft oder es verlässt, ohne den Besuchereingang zu nutzen?«
Rüb schüttelte den Kopf. »Das ist eigentlich unmöglich. Schon wegen der Kunstwerke ist das Schloss sowohl beim Zutritt wie beim Verlassen sehr gut gesichert. Da müsste jemand einen Schlüssel haben. Davon gibt es nur zwei. Die Angestellten können die Türen nur mit ihren Fingerabdrücken öffnen.«
Badenhop trat zu der leeren Stelle an der Wand und stellte überrascht fest, dass das gestohlene Kunstwerk nicht alarmgesichert gewesen war. »Welche Art von Videoüberwachung gibt es? Da müssten wir ja spätestens erkennen können, wer alles hier war, und möglicherweise sogar sehen, was passiert ist.«
»Ja«, bestätigte Rüb, »die Videos können Sie einsehen.«
»Na prima. Dann machen wir uns mal an die Arbeit. Groß«, bemerkte Badenhop, »Sie befragen die Besucher, ich die Angestellten. Die Spurensicherung soll das ganze Schloss durchsuchen. Schwer vorstellbar, dass die Tatwaffe und das Bild hinausgeschafft werden, wenn alle Angestellten noch hier sind und die Besucher durch den Haupteingang müssen. Aber die Videos sehen wir uns zuerst an.« An die beiden Edenkobener Polizisten gewandt ergänzte er: »Sie können ruhig mit auf die Videos schauen, vielleicht fällt Ihnen etwas auf.«
Die Übertragung aus dem Raum, in dem der Mord geschehen war, zeigte in der fraglichen Zeit zwei Besucher, die die ausgestellten Werke betrachteten und den gelangweilt herumstehenden Karl Grindelsbacher nicht beachteten. Als die beiden gegangen waren, sah man etwa eine Minute lang nur den Museumswärter. Der starrte jedoch plötzlich überrascht in eine Richtung, hob die Hand und riss den Mund auf, als ob er eine laute Anweisung geben wollte.
In diesem Moment wurde das Bild dunkel, allerdings nur für wenige Sekunden. Als die Kamera wieder den Raum zeigte, sah man Grindelsbacher blutend am Boden liegen. Das Gemälde war von der Wand verschwunden.
»Da hat jemand sehr geschickt die Kamera zugehängt, ohne dass er selbst aufgenommen werden konnte. Und alles genau in einem Moment, in dem niemand zugesehen hat. Sehr merkwürdig, sehr überlegte Handlung oder viel Glück. Der muss vorher ausbaldowert haben, wie er das hinbekommen kann«, sinnierte Groß.
Die nächste gelinde Überraschung gab es beim Durchsehen der übrigen Videos. Keiner der Besucher verhielt sich auffällig. Allerdings befand sich unter ihnen eine muslimische Frau mit Niqab, die ebenso interessiert wie die anderen die ausgestellten Werke betrachtete.
»So eine, ich glaub’s nicht«, entfuhr es einem der Streifenpolizisten.
Groß sah ihn überrascht an und schien den Ausruf für unangebracht zu halten. »Also, ähhh … Wir sollten ja keine Vorurteile haben oder eine muslimische Frau gleich für verdächtiger halten als alle anderen«, sagte er leicht belehrend.
Schon diese kleine Bemerkung brachte bei dem Polizisten das Fass zum Überlaufen. Der Anblick der Niqab-Frau und Groß’ Hinweis reichten, um eine Hemmschwelle zu überschreiten. »Ich sage Ihnen mal was, junger Mann. Wenn Sie sich jahrelang an der Front den Arsch aufreißen mit diesen Gaunern und sehen, aus welchen Ländern immer wieder bestimmte Tätergruppen stammen, die uns auslachen, weil ihnen anders als in ihren Heimatländern nichts passiert bei unserer laschen Justiz, und offiziell wird heile Welt und Willkommenskultur gepredigt, dann schwillt Ihnen vielleicht auch der Kamm.«
Badenhop war entsetzt und atmete, wie um sich zu beruhigen, tief ein und wieder aus. »Machen Sie mal halblang. Im Moment haben wir eine Person im Niqab, sonst nichts. Das ist kein Grund, uns Ihre Vorurteile und Ihre Verallgemeinerungen zu präsentieren. Halten Sie sich also bitte zurück.« Dann sah er Groß an. »Sie, Herr Groß, sollten mich andererseits gut genug kennen und wissen, dass ich für Rassismus und Ungleichbehandlung nicht besonders anfällig bin. Aber wir sind Ermittler und dürfen als solche wichtige Beobachtungen nicht unter den Tisch fallen lassen.«
»Was ist an einer muslimischen Frau heutzutage noch eine wichtige Beobachtung?«, fragte Groß in leicht moserndem Ton.
»Als Erstes fällt mir ein, dass es vielleicht ungewöhnlich ist, wenn eine strenggläubige muslimische Frau – und darum handelt es sich wohl bei einer Niqab-Trägerin – allein, also ohne Begleitung eines Mannes oder anderer Frauen, ein Museum aufsucht. Zweitens ist diese Person von allen, die wir auf den Videos gesehen haben, die einzige, die einen größeren Gegenstand, zum Beispiel ein Messer oder ein kleineres Bild, unter ihrer Kleidung verstecken könnte. Drittens ist keine Niqab-Trägerin unter den Wartenden drüben im großen Raum. Sie hält sich also an anderer Stelle des Hauses auf oder hat das Haus verlassen. Viertens muss es sich bei diesem Niqab nicht unbedingt um die Kleidung einer Muslimin handeln.«
Groß schien immer noch ein wenig im Zwiespalt. Er spürte anscheinend das starke Bedürfnis, auf keinen Fall Vorurteilen folgen zu wollen. Andererseits aber hatte Badenhop die unter kriminalistischen Gesichtspunkten eindeutige Unterschiedlichkeit dieser Person ja schlüssig begründet. Groß war vermutlich ebenso klar wie Badenhop, dass die Außenwirkung dieses Falles sie auf eine harte Probe stellen könnte. »Keine muslimische Kleidung, sondern …?«, fragte er dennoch.
»Es kann eine Verkleidung sein. Ich erinnere mich an mindestens zwei Überfälle auf Juwelierläden, die mit Burkas erfolgten, einen in London und einen in Ratingen bei Düsseldorf. In beiden Fällen hat sich herausgestellt, dass die Burka nur den traditionellen Strumpf über dem Kopf ersetzt hat. Sie hat gegenüber dem Strumpf noch den Vorteil, dass man problemlos schon auf der Straße damit herumlaufen kann und beim Betreten des Tatorts nicht sofort als bedrohliche Person auffällt. Natürlich dürfen wir jetzt nicht voreingenommen Einschränkungen machen. Diese Niqab-Person muss noch lange nicht der Täter sein. Aber es ist eine Möglichkeit. Ich bin gespannt, was die Spurensicherung dazu zu sagen hat.«
Nach dieser ungewöhnlich langen Rede seines Chefs schien Groß leicht verärgert, einmal wegen der Äußerungen des Polizisten, aber auch, weil Badenhop ihm mal wieder unter die Nase gerieben hatte, dass es sich lohnte, über naheliegende Schlussfolgerungen hinauszudenken.
Anschließend bedankte sich Badenhop für den raschen Einsatz der örtlichen Polizisten und schickte sie nach Hause. Er wolle bei der Aufnahme von Zeugenaussagen der Angestellten und der Museumsbesucher »weitere emotionale Eruptionen vermeiden«, sagte er Groß gegenüber.
Zunächst ging er an den Eingang, wo ihm noch eine unangenehme Situation bevorstand. Das Gespräch mit der Kassiererin, die er nach den Ereignissen der vergangenen eineinhalb Stunden befragte, verlief unter merkwürdiger Anspannung. Die unscheinbare, rundliche Frau mit kurzen dunkelblonden Haaren und herabhängenden Mundwinkeln war Badenhop vom ersten Moment an nicht sehr sympathisch. Sie wirkte unfreundlich und belästigt und schien sich bei jeder Frage angegriffen zu fühlen, als ob Badenhop ihr ein Fehlverhalten vorwerfen wolle. Er fragte zunächst, ob ihr vor oder nach der Tat Besucher besonders aufgefallen seien.
»Was hätte ich denn sehen sollen? Dass einer mit einem blutigen Messer in der Hand hier durchrennt? Das wäre mir wahrscheinlich aufgefallen. Ansonsten habe ich ja anderes zu tun.« Es sei ja so, dass »alle möglichen Leute hier ein und aus gehen, junge, alte, Leute von hier, Fremde. Was geht es mich an?« Sie achte nicht mehr darauf.
»Es war also niemand Ungewöhnliches dabei?«
»Nein, wieso? Soll ich mir die einzelnen Leute alle merken?«
Badenhop musste konkret werden: »Wir haben auf den Überwachungsvideos eine Person mit Niqab gesehen. Ist sie nicht hier durchgekommen?«
»Doch. Und? Ich habe mir darüber keine Gedanken zu machen. Wir haben Anweisungen, niemanden wegen seines Aussehens, seiner Kleidung, seiner Religion oder seiner Hautfarbe anders zu behandeln, solange er sich an die Besucherregeln hält. Muslime, Schwule, Schwarze oder Sinti, das sind offiziell alles Besucher, nichts weiter. Daran halte ich mich. Was ich selbst darüber denke, tut nichts zur Sache.«
Badenhop war von dieser Frau genervt, aber sie war eine wichtige Zeugin. »Sie haben erst von einem Kollegen, der zu Ihnen gerannt ist, erfahren, was in der Ausstellung passiert ist. Aber hier unten sehen Sie die Aufnahmen der Videokameras auf den Bildschirmen. Warum ist Ihnen nicht aufgefallen, dass eine der Kameras für einige Sekunden ausgefallen war und anschließend Ihr Kollege auf dem Boden lag?«
Schon wieder ging die Frau in Verteidigungshaltung. »Was kann ich denn dafür? Wie kann einer hier Karten verkaufen, Fragen beantworten und außerdem die Kameras beobachten? Wollen Sie behaupten, ich hätte absichtlich weggesehen? Oder ich hätte die ganze Zeit auf die Videos starren müssen? Das ginge vielleicht am Wochenende, wenn wir zu zweit sind, aber nicht, wenn ich allein hier sitze.«
Sie habe, so erfuhr Badenhop auf Nachfrage, gerade einen Blick auf die Bildschirme geworfen und gesehen, dass Grindelsbacher auf dem Boden lag. Aber bevor sie noch zum Telefon greifen und einen Kollegen hinschicken konnte, sei jemand heruntergerannt, habe ihr berichtet, was passiert war, und ihr gesagt, es dürfe niemand mehr das Haus verlassen.





























