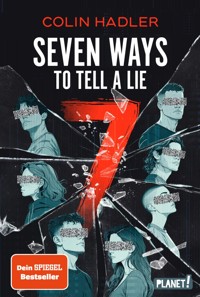
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Sieben Freunde, sieben Lügen und eine Wahrheit, die sie das Leben kosten könnte
In der idyllischen Kleinstadt Wane erschüttert ein Video die Highschool: Ein Schulbus stürzt in eine Schlucht und geht in Flammen auf. Niemand überlebt. Jonah traut seinen Augen nicht – denn er selbst kommt in dem Video vor, zusammen mit seinen ehemals besten Freunden. Doch der Unfall ist nie passiert!
Schnell begreift Jonah, dass es sich um ein Deepfake handelt. Aber nicht nur das: Irgendjemand hat es auf ihre dunkelsten Geheimnisse abgesehen. Um das Schlimmste zu verhindern, muss die zerbrochene Clique wieder zusammenfinden und sich ihrer Vergangenheit stellen. Doch da taucht schon das nächste Video auf ...
Der neue All-Age-Thriller von Colin Hadler!
"Ein absoluter Pageturner, keinesfalls verpassen!"
Ursula Poznanski
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Sieben Freunde, sieben Lügen und eine Wahrheit, die sie das Leben kosten könnte
Im idyllischen Wane erschüttert ein Video die Highschool: Ein Schulbus stürzt in eine Schlucht und geht in Flammen auf. Niemand überlebt. Jonah traut seinen Augen nicht – denn er selbst kommt in dem Video vor, zusammen mit seinen ehemals besten Freunden. Doch der Unfall ist nie passiert!
Schnell begreift Jonah, dass es sich um ein Deepfake handelt. Aber nicht nur das: Irgendjemand hat es auf ihre dunkelsten Geheimnisse abgesehen. Um das Schlimmste zu verhindern, muss die zerbrochene Clique wieder zusammenfinden und sich ihrer Vergangenheit stellen. Doch da taucht schon das nächste Video auf ...
„Ein absoluter Pageturner, keinesfalls verpassen!“
Ursula Poznanski
Der Autor
© Julian Schmelzinger
Colin Hadler wurde 2001 in Graz geboren. Schon ab dem Alter von zwölf Jahren spielte er in Schauspielhäusern Theater. Hadler schreibt Drehbücher, Gedichte und Romane. Bereits während seiner Schulzeit tourte er durch andere Gemeinden und Bundesländer, um Jugendliche wieder zum Lesen zu bringen. Momentan lebt Colin Hadler in Wien und studiert Publizistik- und Kommunikationswissenschaft..
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Planet! auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor:innen und Übersetzer:innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator:innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher und Autor:innen auf:www.thienemann.de
Planet! auf Instagram:https://www.instagram.com/thienemann_booklove
Planet! auf TikTok:https://www.tiktok.com/@thienemannverlage
Viel Spaß beim Lesen!
Colin Hadler
Seven Ways to Tell a Lie
Planet!
Für Jonathan & Anne
One way to say thank you
Der Bus
Die Kamera fängt alles ein, selbst den Tod.
Jonah sitzt auf einem der hinteren Fensterplätze des Shuttlebusses und hält sich so verkrampft an der Vorderlehne fest, dass die Adern seines rechten Arms hervortreten. Mit der linken Hand versucht er das Blut zu stoppen, das aus seiner Nase quillt – die rote Flüssigkeit sprenkelt über den abgewetzten Sitz.
»Tut mir leid«, stammelt er, wobei man ihm die Reue auch einfach hätte ansehen können. Im Hintergrund das Dröhnen des Motors, Reifenquietschen und gelegentliches Wimmern. »Mom, Dad, es tut mir leid! Ich … ich hätte auf euch hören sollen.« Kaum ausgesprochen, füllen sich seine hellblauen Augen mit Tränen. Jonah hebt den Kopf und blickt einen direkt an.
Die Kamera zoomt raus, gleitet von Jonah weg und schwenkt auf eine andere Sitzreihe.
Da ist Samuel, der sich mit dem Rücken ans Fenster presst. Hinter ihm zieht die Landschaft rasend schnell vorbei. Jeder Baum, jeder Felsen, jede bemooste Lichtung nur einen Sekundenbruchteil zu sehen. Samuels Kiefermuskeln sind angespannt, aber seine Augenlider geschlossen. Sein trainierter Körper ist fest im Fahrzeug verankert. Er murmelt etwas, das man nicht versteht. Und auch wenn das Chaos förmlich durch die Kameralinse dringt, wirkt es, als wäre es für Samuel nur ein weiterer, gewöhnlicher Morgen – und nicht die letzte Busfahrt seines Lebens.
Die Kamera gleitet auf den Gang.
Victor, der Sunnyboy von Wane, steht breitbeinig da und krallt sich rechts und links in die Sitze, um nicht durch den Bus geschleudert zu werden. Sein sonst so charmantes Lächeln ist einer unnatürlichen Blässe gewichen.
»Haltet euch gut fest!«, brüllt er, obwohl ihn niemand zu beachten scheint. »Scharfe Kurve! Gleich da vorn!«
Als der Bus tatsächlich beinahe ins Schleudern gerät, wispert Jonah eine weitere Entschuldigung. Samuels Murmeln wird noch konfuser – und das gelegentliche Wimmern lauter, panischer.
Die Kamera schlängelt sich an Victor vorbei, ganz nach hinten, zur Sitzbank.
Laurin und Jessica haben ihre Hände ineinander verschlungen. Ob aus Liebe oder aus Angst, ist schwer zu sagen.
»Glaubst du, wir haben es verdient?«, japst Jessica und wirft Laurin einen unschlüssigen Blick zu. »Das alles?«
»Ich weiß es nicht.« Laurins Brust bebt. Es grenzt an ein Wunder, dass er auch nur ein Wort, einen weiteren Atemzug hervorbringt, ohne zu kollabieren.
»Wane ist ein Drecksloch! Die würden sich doch alle daran aufgeilen, uns so zu sehen, was?«
»Jessica, ich weiß es nicht.« Und weil Laurin gerne noch etwas Beruhigendes hinzugefügt hätte, dazu aber sichtlich nicht mehr in der Lage ist, festigt er bloß seinen Griff um ihre Hand.
Die Kamera gleitet wieder rückwärts, an Victor vorbei, der sich noch immer wacker auf den Beinen hält – bis zu der Stelle, an der das Wimmern seinen Ursprung hat.
Die kläglichen Laute kommen von Ruby, die mit angewinkelten Beinen auf einem der Sitze hockt. Mit den Fingern umschließt sie die Kreuzkette um ihren Hals. Sie sieht nach draußen – zum Himmel –, wie sie es von ihren Eltern gelernt hat, die jeden Abend vor dem Einschlafen beten.
Ihr Wimmern formt sich zu vollständigen Sätzen: »Ich vermisse dich.« Das zierliche Mädchen schluckt, kauert sich noch enger in den Sitz, während sie heftig durchgerüttelt wird. »Und ich glaube fest daran, dass du noch lebst. Ja, ja, das tue ich!« Sie atmet scharf ein. »Irgendwo da draußen bist du!«
Als sich die Kamera schlussendlich auch von Ruby löst, geht das Bild in eine Totale über. Man sieht jede einzelne Sitzreihe, die Fenster, die Jugendlichen. Jonah, Samuel, Victor, Laurin, Jessica und Ruby. Viele Namen, viele Persönlichkeiten, die nun alle, außerhalb dieses Busses, keine Bedeutung mehr haben.
Und dann, als hätte ihnen jemand etwas ins Ohr geflüstert, kommt Bewegung in die Gruppe. Jonah steht auf, um besser über seinen Sitz spähen zu können. Auch Laurin und Jessica erheben sich von ihrer Bank, lösen sich voneinander. Samuel öffnet unerwartet die Augen, Ruby hört auf zu beten – und Victors Mund klappt nach unten, verzieht sich zu einem langen, tonlosen Schrei. Sie alle schauen in dieselbe Richtung. Nach vorne.
Die Kamera dreht sich mit ihren Blicken mit und hält erst, als sie die Windschutzscheibe erfasst.
Eine Schlucht tut sich auf. Ein Abgrund, der unaufhaltsam näher kommt, Meter für Meter. Die Erkenntnis durchfährt sie alle viel zu plötzlich. Es bleibt keine Zeit für letzte Worte, keine Zeit, den angefangenen Gedanken zu Ende zu führen. Mit Höchstgeschwindigkeit rast das Fahrzeug über die unebene Fläche – es schlittert über die Klippe, überschlägt sich. Körper und Gegenstände werden durch die Luft geschleudert, prallen aneinander. Und als der Aufschlag und die darauffolgende Explosion einfach alles in Stücke reißt, hat der Bus seine Endstation erreicht.
1
Der Sommer rund um Wane erblüht in seinen schönsten Farben. Dichte Wälder ziehen sich über die Bergketten und Gipfel, ein saftiges Grün, das sich im leichten Luftzug bewegt. Am Boden sprießen die Wildblumen – Sonnenhüte, Feuerkraut und Lupinen –, die sich besonders nahe den Bergbächen und Flüssen ausbreiten, in denen schon unsere Ahnen gebadet haben. Und sollte ich meine Atmung nicht zügig wieder unter Kontrolle bekommen, wird man zwischen seltenen Pilzen und herumkrabbelnden Käfern auch mein Erbrochenes finden.
Ich bin völlig außer Puste, meine Kehle schreit nach Wasser und meine Waden brennen. Es geht bergauf. Der schmale Waldweg ist mit Steinen, herausstehenden Wurzeln und tiefen Löchern versehen, die vermutlich von einem Tier stammen. Der Zickzack-Lauf verlangt mir einiges ab. Ausgelaugt umklammere ich den Staffelstab, den ich an den nächsten Läufer aus meinem Team weiterreichen muss.
Mittlerweile habe ich gar keine Bedenken mehr, während des Marathons einem Bären oder einem Wolf zu begegnen – ehrlich, ich würde freiwillig in das große Maul klettern und mich verdauen lassen, um diesem Wettbewerb ein schnelles Ende zu setzen. Dabei sind es für jeden Läufer nur sechs Kilometer. Marathon wird es bloß deshalb genannt, damit es sportlicher und aufgeblasener klingt.
Als ich die Spitze des Hügels erreiche, halte ich inne und stütze mich auf meinen Knien ab, um mich zu sammeln. Mein Kopf pocht. Ich sollte an etwas anderes denken, versuchen, die Anspannung zu lockern, die mich zu lähmen droht. Keuchend blicke ich auf.
Vor mir hat sich die Mauer aus Baumstämmen geöffnet und die Sicht auf Wane freigegeben. Mein Zuhause. Unweigerlich kommt mir der Imagefilm in den Sinn, der erst vor Kurzem auf unserer Schulwebsite gepostet wurde, und ich muss schmunzeln. Es ist, als hätte ich die tiefe, männliche Off-Stimme noch im Ohr.
Wane. Eine malerische Kleinstadt in Washington, ein paar Kilometer vom Colville National Forest entfernt. Ein märchenhafter Fluss schlängelt sich durch das weite Tal und teilt die Stadt in zwei Hälften. Bestaunen Sie dieses Paradies für Flora und Fauna von der gewölbten, denkmalgeschützten Brücke aus, eine Erfahrung, die Sie bestimmt niemals wieder vergessen werden.
Hätten sie mich die Werbung machen lassen, hätte das ganze etwas anders geklungen: Wane. Ein idyllischer Rattenkäfig. Ein Paradies für Snobs und Hochstapler.
Das, was in Wane wirklich eine Rolle spielt, sind die beiden Highschools: Sundown auf der rechten Seite des Flusses – die Privatschule direkt neben der Kirche. Und Greenwood auf der linken, die öffentliche Schule. Jedes Jahr, wenn die Sommerferien in greifbare Nähe rücken, veranstaltet die Stadt die Victory Games. Ein Sportwettbewerb zwischen den rivalisierenden Highschools. Es ist das Event schlechthin, was auch an dem Rahmenprogramm selbst liegt. Überall gibt es Schießbuden, Zuckerwattestände, Foodtrucks und Livemusik. Und am Ende steht das große Abschlussfest an, die Siegerehrung, die im alten Wane abgehalten wird – eine verlassene Stadt, etwa zwanzig Minuten mit dem Bus entfernt. Die Victory Games sind auch dieses Jahr wieder in vollem Gange, aber das Abschlussfest wurde gestrichen. Wegen des schrecklichen Vorfalls bei den letzten Spielen. Kein Wunder, dass sie darüber im Imagefilm kein Sterbenswörtchen verlieren.
»Da sieh mal einer an«, ruft mir ein Typ von der Seite zu und überholt mich mit einem Grinsen. »Von einem Schüler aus Sundown hätte ich mehr erwartet.« Am Oberarm trägt er eine dunkelgrüne Binde. Greenwood. Ich selbst trage eine gelbe.
Zugegeben, an einen Werbespot zu denken ist wahrscheinlich keine sportliche Höchstleistung. Ich atme ein letztes Mal tief durch – und renne weiter. Zu meiner Erleichterung ist das Pochen durch die Verschnaufpause etwas schwächer geworden. Ich bündle meine Kräfte, werde noch schneller, hole beinahe auf. Als der Typ aus Greenwood allerdings bemerkt, dass ich ihm auf den Fersen bin, legt auch er einen Zahn zu.
Der verwachsene Trampelpfad geht in einen größeren Forstweg über. Wir sind nun beide am Sprinten. Ich schwitze, beiße die Zähne zusammen und ignoriere den leichten Säuregeschmack, der sich in meinem Mund ausbreitet. Nur noch ein paar Hundert Meter, nur noch … Ich stocke. An der Weggabelung, auf der wir unsere Stäbe weiterreichen sollen, wartet nur eine einzige Person. Ein groß gewachsener Schüler aus einem anderen Team, ebenfalls mit grüner Binde. Von Ruby keine Spur.
Als wir die Kreuzung erreichen, übergibt mein Konkurrent seinen Staffelstab. Und während sein Mitschüler schon weiterrennt – geradewegs Richtung Ziel –, wendet er sich mir zu. »Dein Team hat dich wohl im Stich gelassen«, sagt er, und sein Grinsen kehrt wieder in voller Breite zurück. »Ihr seid echt eine Gruppe von Versagern.« Danach stapft er einfach davon, würdigt mich keines Blickes mehr und verschwindet in der Ferne.
Es vergehen einige Momente, bis ich mich selbst Rubys Namen rufen höre: »Ruby? Ruby, hey! Verarsch mich nicht, ja?«
Meine Finger, die beim Laufen so vernarrt an dem Stab festgehalten haben, werden immer schlaffer – und ich sehne mich nach dem Gefühl der Wut. Ich wünschte, ich könnte mich über die Sticheleien des Typen ärgern oder darüber, dass mich Ruby in diese Situation gebracht hat. Aber da ist nur diese tiefe, einnehmende Sorge.
Ein Luftzug rauscht durch die Blätter, lässt die Äste knacken, trocknet meinen Schweiß. Und als ich in den Wald sehe, kann ich nichts Menschliches darin erkennen.
Die Bilder vom Abschlussfest flackern vor meinem inneren Auge auf, die Schüsse, die Schreie. »Ruby! Ruby, hörst du mich?« Ich rufe immer lauter, immer eindringlicher. Auch wenn der Name ein anderer war, ist es genau wie damals.
Als ich gerade befürchte, die Vergangenheit könnte vollends über mich hereinbrechen, bekomme ich eine leise, gereizte Antwort. »Ich bin hier, Jonah.«
Ich blicke zum Forstweg rechts von mir – und tatsächlich: zwischen zwei bemoosten Stämmen entdecke ich die gelbe Armbinde. Rasch gehe ich los und werde erst langsamer, als ich Ruby im Ganzen vor mir sehe. Sichtlich abwesend sitzt sie auf einer Bank und ritzt mit einem spitzen Stein etwas ins Holz. Es ist ungewohnt, sie in dem engen Sportoutfit zu sehen, wo sie doch sonst immer diese grauen Pullover trägt, die ihr viel zu groß sind. Die Kreuzkette um ihren Hals hat sie nicht abgelegt, obwohl Schmuck beim Sport verboten ist. Ich weiß bis heute nicht, ob sie den Anhänger freiwillig trägt oder ob sie von ihren Eltern dazu gezwungen wird.
Dass sich Ruby für den Staffellauf eingeschrieben hat, hat mich jedenfalls gewundert. Andererseits muss man sich bei den Victory Games für mindestens drei Disziplinen anmelden. Sie hatte also keine große Wahl.
»Du hast mich fast zu Tode erschreckt«, sprudelt es prompt aus mir heraus. Das ungute Gefühl von vorhin wirkt noch in mir nach. »Warum warst du nicht auf der Kreuzung? Du hättest es ja zumindest versuchen können!« Ich lasse den Stab vor ihr auf den Boden fallen. »Ruby. Schau mich wenigstens an. Bitte.«
Als sie es tut – als Ruby wirklich zu mir hochsieht –, fallen mir sofort ihre geröteten Wangen auf. Sie muss geweint haben.
»Gerade du solltest wissen, warum ich nicht da war«, sagt sie.
Und darauf habe ich keine Antwort. Sie hat recht. Tief in mir weiß ich, dass Ruby recht hat. Ich wusste es ab der Sekunde, in der ich sie nicht bei der Weggabelung habe stehen sehen, wollte es aber nicht wahrhaben. Deswegen schweige ich. Und Ruby sieht wieder weg.
Als ich mich still neben sie setze, hebt sie einen Fuß auf die Bank, um ihre Zeichnung zu verdecken. Ich stütze mich gegen die Lehne und mustere sie, mustere ihre kurz geschorenen Haare und ihre zusammengekauerte Haltung. Es ist schon lange her, dass ich das letzte Mal mit ihr geredet habe.
»Ich hab es versucht«, murmelt sie irgendwann kleinlaut, wobei ihre Unterlippe bei jedem ihrer Worte zittert. »Ehrlich, Jonah. Ich hab mich auf die Kreuzung gestellt und hab versucht, es zu verdrängen. Aber ich …« Ruby atmet tief aus, konzentriert darauf, nicht wieder in Tränen auszubrechen. »Ich kann einfach nicht weitermachen, als wäre nichts passiert. Enya war so wichtig für mich. Ich kann doch nicht … Warum sollten wir …« Sie kämpft spürbar mit ihren Gefühlen. Und auch wenn mir ein schmerzvoller Stich durchs Herz gefahren ist, als sie Enyas Namen erwähnt hat – obwohl ich wusste, sie würde es irgendwann tun –, versuche ich sie mit meinem Blick aufzufangen.
»Schon gut«, flüstere ich.
Es ist lediglich ein Hauch Trost, ein simpler Satz, der sich in Ruby jedoch zu etwas Größerem zu entfalten scheint. Sie schnieft und schafft es irgendwie, mir wieder ins Gesicht zu sehen. »Ist es nicht krank, dass sie den Wettbewerb trotzdem durchziehen? Enya ist seit einem Jahr verschwunden und sie tun alle so, als wäre nichts gewesen.«
»Was hast du erwartet?«
»Keine … keine Ahnung.« Sie zuckt mit den Schultern. »Auf jeden Fall nicht das.«
Ich seufze. Nur zu gut weiß ich, was Ruby mit das meint. Ich war an dem Punkt, an dem sie jetzt ist. Das ganze verdammte Jahr über. Und vielleicht bin ich es immer noch.
»Diese Clique war alles für mich«, wispert sie. »Ich weiß, wir haben nicht immer harmoniert, ganz im Gegenteil.« Ruby schüttelt halb fassungslos, halb amüsiert den Kopf. »Kannst du dich daran erinnern, dass wir einmal so heftig gestritten haben, dass Enya das Licht ausgeknipst hat und wir alle kreuz und quer durch das Ferienhaus gestolpert sind?«
Ich schmunzle und antworte: »Enya hat so zu lachen begonnen, dass wir alle mit eingestiegen sind.«
»Ja. Aber ohne sie ist da gar nichts mehr, nicht einmal Streit.«
Ich nicke leicht. Enya war nicht nur Teil unserer Gruppe, sie war das Herzstück. Nach ihrem Verschwinden haben wir restlichen sechs uns aufgelöst, ganz still und plötzlich, als hätte schon immer diese ungeschriebene Regel existiert, dass wir uns voneinander abstoßen, sobald Enya uns nicht mehr zusammenhält. Und da ich nichts sagen kann, was irgendetwas davon ungeschehen machen würde, murmle ich einfach: »Verfluchtes Wane.«
»Verfluchtes Wane«, wiederholt Ruby und steckt sich in einer beiläufigen Bewegung das Ende ihres Kreuzes in den Mund. Als sie darauf herumkaut, wird mein Schmunzeln stärker. Das hat sie früher andauernd gemacht, wenn sie über etwas nachgedacht hat. Warum auch immer. Bei Ruby ist es besser, nicht alles zu hinterfragen. Eines steht jedenfalls fest: Wenn Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre, dann spätestens zwischen ihren Schneidezähnen.
»Komm her«, sage ich und breite die Arme aus. Ohne zu zögern erwidert Ruby meine Umarmung; eine freundschaftliche, warme Berührung.
»Danke, Jonah«, flüstert sie in meine Schulter. »Und tut mir leid, dass ich dich beim Staffellauf habe hängen lassen.«
»Halb so wild.« Als ich mich von ihr löse, nimmt Ruby den Fuß von der Bank und ich schiele verstohlen auf die eingeritzte Zeichnung. Unwillkürlich lache ich los.
»Was?«, fragt sie grinsend.
»Während ich beim Laufen fast gestorben bin, hast du Brüste ins Holz geritzt?«
»Ich wollte mich ablenken.«
»Und hat’s funktioniert?«
Resigniert schüttelt sie den Kopf.
»Na gut«, sage ich, stehe auf und schnappe mir den Staffelstab. »Ich lauf den Marathon für uns beide zu Ende, aber nur unter einer Bedingung.« Ich zeige auf das Holzbrett. »Du ritzt auch einen Penis in die Bank. Wenn du schon Vandale betreibst, dann setz dich wenigstens für Gleichberechtigung ein.« Ohne auf ihre Reaktion zu warten, drehe ich mich um und laufe los.
»Du und deine Sprüche!«, ruft mir Ruby noch hinterher. »Du bist immer noch der Alte, Jonah!«
Ich lächle. Lächle gegen den Schmerz an, der während des Gesprächs in mir hochgekommen ist. Ich lächle darüber, dass auch Enya immer die Augen verdreht hat, wenn ich einen dummen Spruch gerissen habe. Ich lächle, aber es fühlt sich gar nicht an, als würde ich es tun.
Mein Lächeln fühlt sich an wie Weinen.
Als ich mich dem Ziel nähere, komme ich an einigen überambitionierten Eltern und Schülern vorbei, die sich an den Rand des Forstweges gestellt haben, um die Sieger – oder in diesem Fall: mich –, auf den letzten Metern anzufeuern. Der Jubel fällt bei mir aber eher verhalten aus, als wären sich alle nicht recht sicher, ob ich nicht doch jeden Moment zusammenbrechen könnte.
Mit letzter Kraft jogge ich durch den festlich bemalten Torbogen. Auf dem Veranstaltungsplatz dahinter wurden einige Stände errichtet und es riecht so intensiv nach frischem Kaffee und Donuts, dass sich mir der Magen zuschnürt. Überall haben sich kleinere Grüppchen von Schülern, Lehrern und Einwohnern gebildet. Erschöpft lege ich den Staffelstab zur Sammelstelle und will mich gerade nach meiner besten Freundin umsehen, als mich jemand ganz anderes entdeckt. Mr Hendriks. Mit einem Klemmbrett in der Hand schneidet er mir den Weg ab.
Der hat mir gerade noch gefehlt.
Der Schulleiter von Sundown trägt wie immer seine runde Brille und seinen kotzbraunen Anzug – seine Haare hat er sich nach hinten gegelt, zumindest die paar wenigen Strähnen, die ihm trotz seiner Eitelkeit geblieben sind.
»Mr Griffin«, zischt er und blickt zwischen mir und seinen Notizen hin und her. »Wo ist Ms Wallace? Laut Protokoll hätte sie den letzten Abschnitt laufen sollen.« Vorwurfsvoll schiebt er seine Brille nach vorne, bis ganz an die Nasenspitze. Er ist die einzige Person in der Highschool, die uns mit unserem Nachnamen anspricht. »Hat Sie sich etwa geweigert? Schon wieder?«
»Sie wollte ja, Mr Hendriks«, sage ich und versuche dabei halbwegs glaubwürdig zu klingen. »Ich habe sie bloß nicht gelassen.«
»Nicht gelassen?«
»Ja, Sir. Ich wollte allen beweisen, dass ich es auch allein schaffe.«
»Verstehe. Was man eben so macht bei einem Teamsport.« Aufgebracht kritzelt er etwas auf sein Klemmbrett. »Wenn Sie so gerne alles allein durchziehen, will ich Ihnen ausnahmsweise mal behilflich sein. Nachsitzen! Und zwar morgen nach dem Unterricht. Und wehe, dort kommen Sie auch so spät wie zur Ziellinie!«
Da ich keine Kraft mehr habe zu widersprechen, nicke ich einfach nur. »Sonst noch was?«
»Ja, laut Protokoll muss ich Sie über Ihre Platzierung informieren.«
Verdutzt horche ich auf.
»Disqualifiziert. Sie alle drei.«
Na, schönen Dank auch!
Zähneknirschend wende ich mich von ihm ab und hoffe, dass mir der Junge eine Klasse unter mir, der in unserem Dreierteam als Erster dran war, nicht allzu böse sein wird.
Gerade als ich mich wieder gefasst habe, legt mir jemand eine Hand auf die Schulter. »Da bist du ja endlich«, murmle ich, weil ich genau weiß, wer hinter mir steht – und diesmal fühlt sich mein Lächeln echt an.
2
Thea johlt und kreischt vor Freude, als wir einen steilen Abhang hinunterrasen. Nach meinem Gespräch mit Mr Hendriks haben wir uns gleich unsere Fahrräder geschnappt und uns auf den Weg in die Stadt gemacht. Ich bin so verschwitzt, dass ich gar nicht weiß, ob ich unter die Dusche oder direkt in die Waschstraße soll.
Als Thea zu mir zurücksieht, schimmert ihr Nasenpiercing in der Nachmittagssonne. Ihre Augen funkeln, und ihr dunkelblondes, gewelltes Haar weht ihr unbändig ins Gesicht. »Du bist immer wieder für eine Überraschung gut«, jauchzt sie und genießt sichtlich den Adrenalinkick. »Ich dachte ja, du würdest auf dem letzten Platz landen, aber eine Disqualifikation … so schlecht hätte ich nicht einmal dich eingeschätzt.«
»Ich auch nicht«, grummle ich und höre mich dabei ein wenig verbittert an.
Mitten in der Kurve steigt Thea auf die Bremse und fährt neben mir her, damit sie ihre Antwort nicht schreien muss. »Trau dich ja nicht, dich wegen der Disqualifikation fertigzumachen!« Für einen Moment bin ich mir nicht sicher, ob ich das jetzt als eine Drohung oder eine Ermutigung auffassen soll, aber da redet sie schon weiter: »Du bist nicht nur deine Strecke gelaufen, sondern auch die von Ruby. Das soll dir erst mal jemand nachmachen.«
Skeptisch kneife ich die Augenbrauen zusammen. »Aufmunterungen stehen Ihnen nicht, Ms Florence«, sage ich und werde etwas schneller.
Thea lacht. »Mein Fehler.« Und als sie mich mühelos überholt, wirft sie mir einen herausfordernden Seitenblick zu. »Ist das alles, was du draufhast?«
»Meine Beine sind weich wie Butter«, protestiere ich grinsend, doch sie ist bereits außer Hörweite und schon wieder am Jauchzen.
Früher habe ich in Freundschaften stets das Tiefgründige gesucht. Zwar haben mich auch die wilden Eskapaden beflügelt, aber vor allem war es die Schwere, das Ungreifbare, das mich fasziniert hat. Nach Enyas Verschwinden war es ebenjene Schwere, aus deren Tiefe ich kaum mehr emporsteigen konnte. Jetzt bedeutet Freundschaft für mich Erleben. Rauskommen, Unsinn treiben, nicht nachdenken, einfach die Zunge aus dem Mund strecken und schreien. Thea ist all das, und noch viel mehr. Es sind kostbare Momente, in denen ich dem Sog meiner Gedanken entfliehen kann. In denen ich nicht dauernd gefragt werde, wie es mir geht – denn oft will ich darauf keine ehrliche Antwort geben.
Mit Thea geht das deswegen so leicht, weil sie kein Teil unserer Clique war. Weil sie mich nicht an die damalige Zeit erinnert. Sie ist ein Neuanfang.
Nachdem ich zu Hause duschen war, machen wir uns auf den Weg Richtung Stadtzentrum. Da wir es nicht eilig haben, gehen wir zu Fuß, schieben unsere Fahrräder aber aus Gewohnheit neben uns her. Theas Schicht im alten Kino beginnt erst in zwei Stunden. Sie hat die Aushilfsstelle vor ein paar Wochen angenommen, um ihrer Mutter finanziell unter die Arme zu greifen, die in Sundown als Putzfrau angestellt ist. Seitdem riecht sie immer ein wenig nach Popcorn, aber ich mag den Geruch.
Als die untergehende Sonne die Stadt in eine orangegelbe Suppe taucht, schleicht sich wieder die Off-Stimme aus dem Imagefilm in meinen Kopf.
Entlang der gepflasterten Einkaufsstraßen finden Sie charmante Fachwerkhäuser und Boutiquen, deren Schaufenster zum Verweilen einladen. Und an jeder Ecke ist ein gemütliches Café mit nostalgischem Flair. Genießen Sie es!
Im Film hat es wie ein Befehl geklungen. Genießen Sie es, sonst überfährt Sie der Millionär von nebenan mit seinem nigelnagelneuen Ferrari. Genießen Sie es, bevor die Familie, die in der Villa am Ende der Straße wohnt, ihre Pitbulls auf Sie hetzt. Und, ganz wichtig, genießen Sie es, bevor ans Licht kommt, dass alle viel verlogener und machtbesessener sind, als es den Eindruck macht.
In Wane zwängt sich jeder in ein makelloses Image, auch wenn das fast nie der Wahrheit entspricht. Sonst wird man ganz schnell aus der Stadt geekelt. Bis auf Dirty Joe, bei dem haben sie es noch nicht geschafft. Ja, Dirty Joe. So wird er von den Jugendlichen und heimlich auch von den Erwachsenen genannt – er ist der einzige Bettler hier und lungert meist vor dem Supermarkt herum. Angeblich soll ihm früher einmal eine Firma gehört haben, die aber schon vor über zwei Jahrzehnten pleitegegangen ist.
Auf Theas Bitte halten wir einen Moment an. Sie öffnet ihre Tasche, die sie auf den Gepäckträger geschnallt hat, und holt ein paar Donuts heraus. Thea überreicht sie Dirty Joe und er bedankt sich bei ihr; erinnert sich sogar an ihren Vornamen.
Ich grinse in mich hinein. Typisch Thea.
Als sie zurückkommt und meinen vielsagenden Blick bemerkt, schnauft sie und schiebt ihr Rad zügig weiter. »Jetzt schau mich nicht an, als wäre ich Jesus. Es waren nur ein paar Donuts.«
»Heute sind es Donuts, aber in ein paar Monaten gibst du jemandem sein Augenlicht zurück. Du wirst schon sehen.«
»Ja, ja, schon klar. Ich hab bloß mitbekommen, dass sie eine Petition gegen Dirty Joe starten wollen. Und ich mag ihn. Er hat so etwas Abgebrühtes.« Thea zuckt gleichgültig mit den Achseln. »Und wenn er die Donuts nicht essen will, kann er zumindest alle, die da unterzeichnen, mit Gebäck bewerfen.«
Wenn ich ehrlich bin, habe ich schon oft versucht, meine beste und einzige Freundin in meinem Kopf zu beschreiben – sie in eine Schublade zu stecken, wie es einem in dieser Stadt von klein auf beigebracht wird –, aber Thea würde diese Schublade mit einem Baseballschläger in tausend Stücke zerschlagen. Vielleicht ist sie ja das: tausend Stücke aus tausend verschiedenen Schubladen, willkürlich zusammengesetzt und nur mit einem Klebeband befestigt, sodass immer mal wieder etwas herausbricht und ausgetauscht werden muss. Manche dieser Stücke sind geformter als andere, manche farbenfroher und manche so scharf, dass man sich daran blutig schneidet. Aber viele davon sind zuvorkommend, charmant, liebevoll und …
»Wenn du mich weiter so angaffst, stelle ich dir das in Rechnung.«
Okay, vielleicht doch nicht so viele.
»Das hättest du wohl gern«, kontere ich. »Nur leider muss ich …« Ich bleibe abrupt stehen, als ich vor uns das neue Wahlplakat des Bürgermeisters erblicke. James Miller. Er ist nur eine Armlänge von mir entfernt, schön säuberlich an die Wand geklebt. »… dich enttäuschen«, vollende ich meinen Satz leise. James Miller hat seine Mundwinkel zu einer Grimasse verzogen und seine weißen Haare sind auf die Seite geschleckt. Direkt daneben, auf einem anderen Plakat, ist sein einziges Kind zu sehen. Enya Miller. Die Vermisstenanzeige von ihr ist halb eingerissen und verschmutzt. Vater und Tochter. Wenn Enya wüsste, wie nah sie ihrem Vater sein muss, obwohl sie gar nicht mehr hier ist …
Ich trete an das Backsteingebäude, reiße den Bürgermeister von der Wand und zerknülle ihn. Danach starre ich auf das halbe Gesicht von Enya.
Thea stellt sich zu mir, berührt mich sachte am Arm. Auch sie hat Enya vage gekannt.
Ich schlucke schwer. »Lass uns weitergehen«, wispere ich und meine beste Freundin nickt stumm. Und ich bin mir sicher – ich habe es schließlich ein ganzes Jahr lang trainiert –, ich hätte die Situation rasch wieder verdrängen können, wäre da nicht das fremde Mädchen, das uns entgegenkommt. Es ist ungefähr in unserem Alter, schaut erst aufs Handy, dann auf die Vermisstenanzeige, dann auf mich – besonders auf mich.
Liegt da Abscheu in ihrem Blick? Mitleid? Erstaunen? Ich kann es nicht richtig deuten.
Thea scheinen ihre Blicke ebenfalls aufzufallen, denn als das Mädchen an uns vorbeigegangen ist, fragt sie: »Was hat sie denn?«
»Wahrscheinlich weil wir beide befreundet sind«, versuche ich es mir zu erklären. Einigen Menschen passt es nicht, wenn jemand aus Greenwood mit jemandem aus Sundown abhängt – auch wenn ich in meinem Innersten schon ahne, dass es nichts damit zu tun hat.
Ich drehe mich noch einmal um, aber das Mädchen ist schon verschwunden.
Wenig später sitzen wir in unserem Stammlokal, dem Riverside; ein simples Diner mit Fensterblick auf den Fluss, das mit Abstand die besten Milchshakes und Waffeln zubereitet. Diesmal ist meine Freude über unseren Besuch allerdings gedämpft.
Der verstörte Ausdruck des Mädchens geht mir nicht mehr aus dem Kopf, aber auch hier im Diner sitzen zwei Typen aus Sundown, die uns regelrecht fixieren. Ich kenne sie von den Pausen, in denen sie gefühlt nie eine Möglichkeit auslassen, irgendwen dumm anzupöbeln.
Sie befinden sich ein paar Tische weiter und tragen immer noch die verpflichtende Schuluniform, obwohl es draußen schon dunkel geworden ist: ein dunkelgelber Blazer mit dem eingestickten Schullogo, darunter ein weißes Hemd und je nach Geschlecht eine schwarze Hose oder ein Rock. Ich persönlich habe nie verstanden, wie man sich mit einem Stofffetzen so rühmen kann. Thea hat es da besser. In Greenwood darf man sich anziehen, wie man möchte.
Ich versuche in Ruhe meinen doppelten Cheeseburger und meinen Vanille-Milchshake zu genießen, da wirft einer der Typen ein paar Pommes in unsere Richtung. Sie lachen spöttisch.
»Okay«, sagt Thea und wischt sich wie in Zeitlupe den Mund ab. »Ich geh jetzt da rüber und verprügle sie.«
»Die hören sicher gleich wieder auf«, entgegne ich beschwichtigend. »Ignorier sie einfach.«
»Ich hoffe, du hast recht.« Sie schlürft genervt an ihrem Shake.
Beiläufig hole ich mein Handy hervor und schalte es auf stumm, weil es schon die ganze Zeit vibriert. Vermutlich irgendeine unnötige Diskussion in einem Gruppenchat.
Als sich Thea ihren letzten Chicken Nugget in den Mund gestopft hat, öffnet sie ihre Tasche. »Ich hab übrigens was für dich«, sagt sie und lässt ihre Worte dabei möglichst unbedeutend klingen, aber das kaufe ich ihr nicht ab.
»Echt?«
»Laut Protokoll«, fährt sie fort und äfft damit ganz offensichtlich Mr Hendriks nach, »feiern wir nämlich in einem Monat unsere einjährige Freundschaft.«
Amüsiert lege ich meinen Kopf schief. »Und dann gibst du es mir heute? Ist doch noch ein Monat hin?«
»Jonah.« Sie seufzt, als müsste sie einem Kleinkind die Welt erklären. »Ich wollte dir einfach etwas schenken und damit es nicht komisch rüberkommt, habe ich mir gedacht, unsere einjähr… unsere elfmonatige Freundschaft wäre ein guter Anlass dafür.«
Ich lehne mich auf der Bank zurück und ein aufregendes Kribbeln durchfährt mich. »Seit wann interessierst du dich dafür, dass etwas komisch rüberkommt?«
»Willst du es jetzt oder nicht?!«
»Ja! Ja, natürlich.«
Thea beginnt in ihrer Tasche zu kramen. Ich rechne es ihr hoch an, dass sie mich auf diese Weise von den finsteren Gedanken an Enyas einjähriges Verschwinden ablenken will. Sie hat mich schon damals aus einem Loch geholt, als meine ehemalige Freundesgruppe zerbrochen ist. Etwa einen Monat danach. Ich vermute ja immer noch, dass sie mich aus Mitleid angesprochen hat – vielleicht um sicherzugehen, dass ich nicht gefährdet bin, mich irgendwo hinunterzustürzen –, und sie dann erst gemerkt hat, wie gut wir uns eigentlich ergänzen. Von Tag zu Tag ein klein wenig mehr.
Manche andere aus der Clique haben sich auch wieder auf Freundschaften einlassen können, manche noch nicht. Ich zu meinem Teil versuche es jedenfalls.
»Tada! Keine Donuts!« Thea hält eine kleine Stoffeule in die Höhe, der ein Auge fehlt. »Ist sie nicht süß und hässlich zugleich?« Meine beste Freundin schaut sie ganz verliebt an. »Ich hab sie in einem Antiquariat gefunden und musste sofort an dich denken. Du hast mir doch erzählt, dass du so eine mal als Kind hattest, sie aber nicht mehr findest. Und …«, sie streckt sie mir stolz entgegen, »… der Verkäufer hätte sie sonst entsorgt. Also … hey! Jetzt hast du sie an der Backe.«
Ich strahle von einem Ohr zum anderen, so fühle ich mich zumindest. »Sie ist perfekt, Thea«, murmle ich und nehme sie an mich, fühle ihren weichen Stoff und fahre vorsichtig über das Loch an ihrem fehlenden Auge.
»Was für ein Müll«, spottet plötzlich eine Stimme von rechts. Thea und ich reißen zeitgleich unsere Köpfe hoch. Es sind die beiden älteren Sundown-Schüler. Die zwei Typen sind aufgestanden und haben sich vor unserem Tisch aufgebaut – der vordere mit einem arroganten, abwertenden Grinsen. Cody, glaube ich. Den Namen des hinteren kenne ich nicht. Er hat eine ausdruckslose Miene und vor der Brust verschränkte Arme.
»Na, Chief?«, giftet mir Cody zu und spuckt auf mein Tablett. »Du verkriechst dich also im Riverside.« Selbstsicher stützt er seine Hände am Tisch ab.
Mit einem flüchtigen Blick scanne ich die Umgebung, doch sonst ist niemand mehr im Diner. Nur die junge Kellnerin, die verschreckt hinter der Theke steht und sich nicht rührt.
»Und ich dachte«, grunzt er weiter, »solche wie du sind zu stolz, um nach Mommy und Daddy zu flennen. Aber so wie du in dem Video geheult hast, habe ich mich wohl geirrt.«
Meine Brust zieht sich augenblicklich zusammen. Auf die indigene Abstammung meines Vaters reduziert zu werden, ist so alltäglich geworden und tut doch immer noch so weh wie beim ersten Mal.
»Und ich dachte«, keift Thea und springt von ihrer Bank auf, »deine Mutter hätte dich bei der Geburt nicht fallen gelassen, Arschloch!«
»Lass sie reden«, erwidere ich ruhig, weil ich nicht will, dass sie meinetwegen Probleme bekommt. »Die beiden sind es nicht wert.«
Cody sieht belustigt zu seinem Kumpel und wendet sich dann Thea zu. »Na schau an, das Mädchen aus Greenwood hat etwas zu melden.«
»Das Mädchen aus Greenwood«, sagt sie mit gefährlich gedehnter Stimme, »stopft dir gleich dieses Stofftier so tief in deine Fresse, dass du daran erstickst.« Sie zeigt drohend mit dem Zeigefinger auf ihn. »Außerdem kenne ich dich. Jaaa, so jemanden wie dich merke ich mir! Ich hab dich auf Jessicas Homeparty in der Abstellkammer gesehen. Na, erinnert sich dein Erbsenhirn noch daran, was du in dem Zimmer getrieben hast? Oder warst du zu betrunken?«
Man merkt, wie sich seine Gesichtszüge schlagartig verändern.
»Ich hab’s auf Video, Penner. Und wenn du nicht willst, dass du bald das Gespött der gesamten Schule bist, würde ich mich mal ganz schnell verpissen.« Sie beugt sich so weit nach vorne, dass kaum ein Blatt Papier mehr zwischen die beiden passt. »Du hast dreißig Sekunden.«
»Greenwood-Schlampe!«, zischt er, stürmt jedoch kurz darauf erbost aus dem Diner, seinen Kumpel im Schlepptau.
Thea atmet tief durch. »Oh Mann«, antwortet sie aufgewühlt, aber auch irgendwie zufrieden. »Ich hab von der Sache mit der Abstellkammer nur Gerüchte gehört. Wusste gar nicht, dass das stimmt.« Besorgt blickt sie zu mir. »Jonah, alles okay?« Doch ich antworte nicht.
Der Blick des fremden Mädchens. Die vielen Nachrichten. Diese Typen.
»Weißt du, von welchem Video er gesprochen hat?«, hakt Thea nach.
Ich stehe auf und mache ein paar Schritte vom Tisch weg, sehe aber noch einmal zu ihr. »Ich gehe kurz aufs Klo«, sage ich ausweichend. »Du hast was gut bei mir, Thea. Danke.« Ich merke, wie mir langsam schummrig wird.
In der Toilette angekommen, schließe ich mich in einer der Kabinen ein und hole mein Handy heraus. Zehn ungelesene Nachrichten von Ruby. Ich öffne unseren Chat und klicke auf das Video, das sie mir geschickt hat.
Als ich mich selbst darin sehe, bekomme ich weiche Knie. Im Video entschuldige ich mich bei meinen Eltern, fange an zu weinen. Alles Sätze, die ich nie gesagt habe. Dinge, die ich in diesem Bus nie getan habe.
Ich sinke an der Kabinenwand mit dem Rücken zu Boden.
Es ist der Shuttlebus, der immer ins alte Wane fährt, dorthin, wo der schreckliche Vorfall passiert ist.
Ich bekomme schweißnasse Hände.
Und dann tauchen die anderen aus der Clique auf, einer nach dem anderen. Samuel. Victor. Laurin und Jessica. Ruby.
Alle … bis auf Enya.
Meine Atmung wird schneller, unregelmäßiger, als ich uns dort vereint sehe. In diesem Bus. In Todesangst.
Aber das ist nie passiert.
Das. Ist. Nie. Passiert.
Genau wie beim Laufen spüre ich den säuerlichen Geschmack im Mund, das Pochen in meinem Kopf.
Als der Bus schließlich explodiert und wir alle sterben, schaffe ich es gerade noch, mich über die Kloschüssel zu beugen, ehe ein Schwall Erbrochenes meinen Körper verlässt.
3
Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich schon reglos in dieser Toilettenkabine sitze. Wie lange ich schon auf die Türklinke starre und sich die einzelnen Videoschnipsel in meinen Gedanken drehen, hin und her, als wäre mein Kopf ein Karussell ohne Ausgang. Meine Augen sind glasig und wenn ich schlucke, ist da noch ein leichtes Brennen in meiner Kehle.
Das ist der Tiefpunkt. Oder was auch immer es sein soll, dieses konfuse, bedrückende, seltsame Etwas, das durch mein Handydisplay in meinen Körper gefahren ist. Und doch schaffe ich es allmählich, mich aus meiner Schockstarre zu befreien. Mein logisches Denken wagt sich vor, ganz langsam, als hätte es Angst, dass ich es wieder samt Mageninhalt nach draußen befördere, wenn es zu abrupt zu mir zurückkehrt.
Deepfake ist der erste Begriff, der zu mir durchsickert. Das Video muss ein Deepfake sein!
Ich habe von dem Phänomen schon oft gehört. Deepfakes sind bearbeitete Fotos und Videos, die täuschend echt aussehen, es aber im Kern nicht sind. Als Grundlage dient dabei reales Material – und dann wird der Kopf ausgetauscht. Wenn man nur genug Aufnahmen von jemandem besitzt, kann man das Gesicht so nachstellen, dass es sich bewegt und verhält wie die Person selbst. Genauso die Stimme. Oder aber sie sind komplett KI-generiert.
Doch auch wenn das Video ein Fake ist – auch wenn der Busunfall nie passiert ist –, sieht man dennoch unsere ehemalige Clique auf dem Weg in das alte Wane. Unsere Gruppe war in den beiden Schulen nicht unbekannt und wir haben nie ein Geheimnis aus unserer Freundschaft gemacht, aber wieso sollte jemand so etwas tun? Wieso sollte sich jemand die Mühe machen, eine Freundesgruppe zu schikanieren, die schon vor einem Jahr auseinandergebrochen ist?
In der nächsten Sekunde schwingt die Tür der Männertoilette auf und Schritte sind zu hören. Vor meiner Kabine kommen sie zum Stillstand.
»Ich erkenne dich sogar an deinem Gang«, meine ich und lehne meinen rauchenden Kopf an die Wand hinter mir.
»Ich bin der einzige andere Gast im Diner, das zählt nicht«, sagt Thea leise. Dann höre ich ein schleifendes Geräusch an der Tür. Thea muss sich wie ich auf den Boden gesetzt haben. »Ein Freund hat mir das Video gerade geschickt. Ich habe es mir angesehen.« Sie schnaubt, als könnte sie das alles gar nicht fassen. »Was für eine Scheiße! Als wären diese Typen nicht schon schlimm genug gewesen.«
Längeres Schweigen.
Ich weiß nicht, ob Thea auf eine Antwort von mir wartet – auf irgendeine Erklärung –, aber ich habe keine.
Unerwartet sehe ich einen Schatten. Theas Hand schiebt sich unter der Tür durch, in den Fingern die entstellte Eule. Unwillkürlich muss ich grinsen und nehme sie an mich. Dann strecke ich mich und greife nach der Klinke, drücke die Tür ein Stück weit nach innen, sodass wir uns durch einen Spalt sehen können.
»Du hast gesagt, dass du sie früher aus dem Regal geholt hast, wenn du nicht schlafen konntest«, murmelt Thea. »Du bist nie zur Ruhe gekommen, weil du so viel nachgedacht hast – während die anderen kleinen Hosenscheißer in deinem Alter schon tief und fest gepennt haben.«
Ich mustere das Stofftier, schwelge in meiner Erinnerung und sage: »Ich hatte auch einen Adler. Aber ich war der festen Überzeugung, dass er mich im Schlaf nicht beschützen würde, weil er nicht nachtaktiv ist. Eine Eule schon.«
»Ziemlich schlau für ein Kind.«
Damals war ich fünf. Jetzt bin ich siebzehn. Im Moment fühle ich mich aber, als wäre ich in all den Jahren kein bisschen schlauer geworden. Egal wie heftig ich mir den Kopf über das Video zerbreche, ich habe keinen blassen Schimmer, was es bedeuten soll.
Ich gebe mir einen Ruck und stehe auf. »Hoffen wir mal, dass sie den Boden regelmäßig wischen«, sage ich.
»Wohl kaum«, erwidert Thea und stemmt sich ebenfalls hoch.
Ich trete an das Waschbecken, spüle meinen Mund aus und spritze mir kaltes Wasser ins Gesicht. Danach blicke ich auf mein Spiegelbild. Meine wuscheligen, schwarzen Haare sind ganz zerzaust und meine hellblauen Augen wirken etwas dunkler als sonst. Nachdem ich mich selbst in diesem Video gesehen habe, komme ich mir fast ein wenig fremd vor. Jeder Wimpernschlag, jedes Kiefermahlen, jedes Wangenzucken ist irgendwie sonderbar.
Thea stellt sich dicht neben mich und wir schauen uns durch den Spiegel an. »Hast du eine Ahnung, wer so etwas Krankes gemacht haben könnte? Hattet ihr mit irgendwem Stress?«
»Ich meine … ja, wir hatten unsere Auseinandersetzungen. Aber nichts Großes. Und außerdem ist das alles mehr als ein Jahr her.«
Thea dreht sich zu mir und inspiziert mich mütterlich, als wäre ich zu einem zweiten Obdachlosen mutiert, für den sie keine Donuts mehr übrig hat. »Du warst ganz schön lange in der Toilette.«
»Hab mich übergeben«, gestehe ich.
»Das hättest du vor einer halben Stunde tun sollen«, antwortet sie mit einem vorsichtigen Schmunzeln. »Dann hättest du wenigstens auf die Typen zielen können.«
Ich steige in ihr Schmunzeln mit ein, auch wenn es bei uns beiden nur schwach ist, mehr Fassade als Realität.
So wie das Video.
Als ich flüchtig auf die Uhr schaue, kommt Bewegung in mich. »Oh Gott!«, stoße ich aus. »Deine Schicht im Kino hat schon vor ein paar Minuten begonnen.«
»Ja, aber –«
»Nichts aber! Wegen mir riskierst du keine Kündigung.« Ich halte ihr die Toilettentür auf. »Los, komm!«
Als wir uns aufs Rad schwingen und durch die nächtlichen Straßen preschen, ist mir immer noch etwas schummrig, aber ich reiße mich zusammen. Draußen ist es stockfinster, nur die Anzeigetafeln des Kinos strahlen majestätisch.
An einem normalen Abend wäre ich jetzt mit Thea mitgekommen und sie hätte mich gratis in eine Vorführung geschleust – und danach, wenn alle Besucher weg gewesen wären, hätten wir uns unerlaubt in einen Saal geschlichen und einen Film angesehen, der noch gar nicht erschienen ist. Bis tief in die Nacht. Wie zwei Eulen.
Aber heute ist kein normaler Abend.
»Irgendein Volltrottel hat sich da einen Scherz erlaubt«, redet Thea wirr vor sich hin, als sie vom Rad steigt. »Der war einfach zu lange im Internet. Das wird sich bestimmt bald aufklären und –«
»Thea, es ist okay«, beruhige ich sie. »Ich komm klar. Mach dir keine Sorgen.«
Sie nickt und lächelt mir verstohlen zu. »Mal sehen.« Dann dreht sie sich kurzerhand um. Thea verschwindet ins Kino – und ich nach Hause.
Als ich in meinem Zimmer ankomme, bemerke ich sofort, dass meine Mutter wieder fein säuberlich das Bett gemacht hat. Sie kann es einfach nicht lassen.
Ich schlüpfe in frische Boxershorts, stelle die Eule auf meinen Nachttisch und …
Und denke über meine Worte in dem Video nach. Ich denke an Ruby, wie sie sich gefühlt haben muss, als sie es sich angeschaut hat. Und ich denke an Enya. So wie ich es immer tue.
Ich sollte auf meinen eigenen Rat hören und mir keine Sorgen machen. Vermutlich verläuft das alles ohnehin bald im Sand und die meisten aus Sundown interessiert es gar nicht.
Und außerdem … es werden schon nicht allzu viele gesehen haben, oder?
Es haben alle gesehen.
Einfach alle.
Das Video muss sich wie ein Lauffeuer verbreitet haben, denn als ich am nächsten Morgen durch den lauten, vollen Flur der Highschool gehe, spüre ich Dutzende Blicke an mir haften. Abwertende, belustigte und vereinzelt auch betroffene Blicke. Und auf einigen Handys sehe ich das Deepfake-Video laufen.
Im Gang riecht es penetrant nach Schweiß, Schulsachen werden durch die Luft geworfen und an der Ecke präsentiert ein Erstklässler stolz seine neue Rolex. Es ist ein Meer aus Eindrücken, ein Meer aus Schuluniformen, das sich allerdings spaltet, als ich es durchquere. Ich komme mir vor, als wäre ich ansteckend. Als wäre das Video eine Zukunftsvision – ein Blick durch die Kristallkugel –, und man wäre todgeweiht, sobald man mich auch nur berührt.
Sollen sie ruhig schauen! Vier Worte, die ich in meinen Kopf zu pressen versuche. Denn im Prinzip schauen sie doch immer. Wenn es kein Skandal ist, ist es wegen einem vermeintlichen Schönheitsmakel, und wenn es das nicht ist, dann wegen meiner Hautfarbe. Und selbst wenn nichts davon da wäre, würden sie es doch trotzdem tun, weil sie das Schauen lieben und gleichzeitig erleichtert sind, nicht selbst ins Visier zu geraten.
Ich trete an meinen Spind und lasse mir alle Zeit der Welt, einfach nur ich und meine Bücher. Den Lärm im Hintergrund blende ich zunehmend aus. Inmitten des Tumults finde ich ein paar Sekunden Frieden – bis ich jäh zusammenfahre. Ein Schatten taucht neben mir auf, ganz plötzlich. Es ist Ruby.
»Du hast gehört, was ich in dem Video gesagt habe!« Sie lehnt sich gegen einen der Spinde, ihren Anhänger hat sie unter die Uniform gesteckt und mit den Händen umklammert sie ein Notizbuch. »Ich habe gesagt: Ich glaube fest daran, dass du noch lebst. Damit muss ich Enya gemeint haben!«
»Ruby«, antworte ich etwas perplex. »Du hast nichts davon gesagt oder gemeint. Das Video ist Fake.« Zu meiner Verwunderung kann ich in ihrer Miene keine Anzeichen von Angst oder Schock ablesen. Es ist, als wären ihr die Blicke der anderen egal. Als würde sie verdrängen, dass wir in dem Video alle gestorben sind. Sie wirkt vielmehr aufgeregt und – auch wenn es mir schwerfällt, das wahrzuhaben – ein wenig hoffnungsvoll. Ganz anders als gestern im Wald.
»Ja, das Video ist Fake«, stimmt mir Ruby zu. »Aber die Details sind es nicht. Den Bus gibt es. Unsere Freundesgruppe gibt … gab es! Und wir sind auf dem Video alle drauf. Bis auf Enya! Das muss dir doch aufgefallen sein …« Sie tritt näher an mich heran, ihre Augen werden größer und fixieren mich mit einer solch emotionalen Versessenheit, dass ich nicht weiß, wohin mit meinen Gedanken. »Jonah!« Man merkt, wie viel Bedeutung sie in ihre Worte legt. »Was … wenn sie lebt?«
Ich erstarre. Es fühlt sich an, als hätte man mich durchbohrt. Als hätte man einen Speer genommen und ihn mir in die Brust gestoßen, einfach so. Was Ruby da sagt, ist unmöglich. Daran will ich nicht denken. Daran kann ich gar nicht denken, wenn mir meine psychische Gesundheit wichtig ist. Seit einem Jahr gibt es kein Lebenszeichen von Enya. Keines. Und ich versuche händeringend, damit abzuschließen, mich von der Hoffnung nicht zerfressen zu lassen. Ein bescheuertes Video wird das nicht ändern.
»Vielleicht ist das ein Hilferuf«, fährt Ruby fort und ignoriert meine Fassungslosigkeit. »Eine Nachricht von ihr.«
»Eine Nachricht, in der sie uns alle umbringt?!« Ich merke, wie Wut in mir hochsteigt. Bei den Idioten, die mich grundlos dumm angemacht haben, konnte ich sie unterdrücken – aber nicht bei Ruby. Dafür haben wir zu viel gemeinsam durchgemacht. »Steiger dich da gar nicht erst rein«, setze ich nach.
»Warum sollte jemand sonst so etwas machen? Enya hat uns alle gekannt.«
»Hör auf, ihren Namen zu sagen«, zische ich gereizt und versuche mich auf das Innere meines Spinds zu konzentrieren. Heft für Heft für Heft …
»Wenn man genau darauf achtet, erkennt man unsere Charakterzüge in dem Video, unsere Eigenheiten. Das kann kein Zufall sein!«
»Ruby, lass es.«
»Aber hör mir doch zu! Enya hätte –«
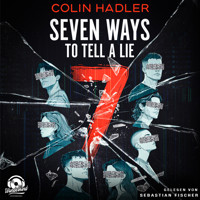
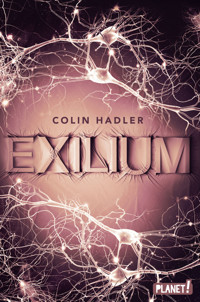

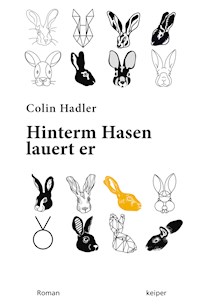















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









